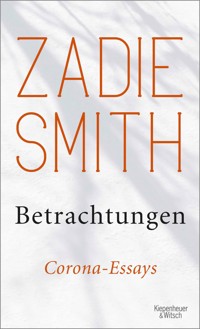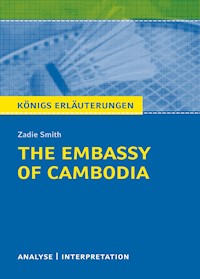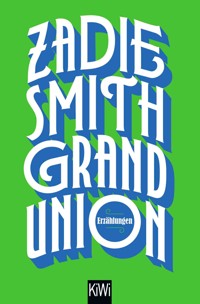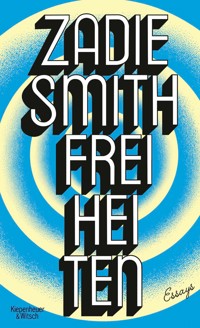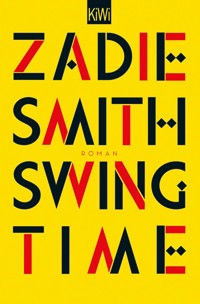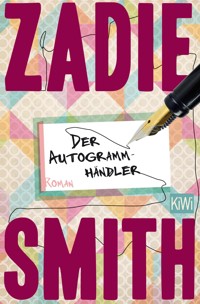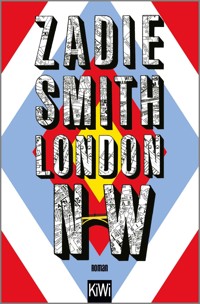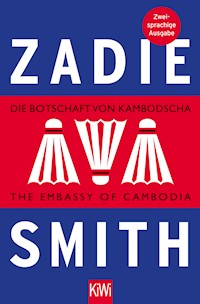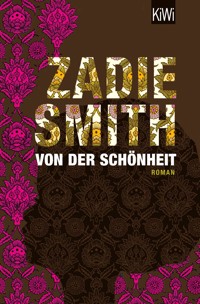
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Familien, zwei Weltanschauungen, eine verbotene Liebe. Howard Belsey, Universitätsprofessor und erklärter Liberaler, findet in seinem Erzfeind Monty Kipps, ebenfalls Professor und Rembrandt-Experte, die Verkörperung all dessen, was er verabscheut. Als sich Howards Sohn Jerome ausgerechnet in Montys attraktive Tochter verliebt, sieht sich Howard zum Einschreiten gezwungen. Doch erotische, intellektuelle und familiäre Verwicklungen und Katastrophen lassen nicht lange auf sich warten. In ihrem drittenRoman »Von der Schönheit« erzählt Zadie Smith auf komische und rasante Weise von zwei mehr als turbulenten Familien zwischen England und Amerika, schwarz und weiß, Hässlichkeit und Schönheit, Liberalismus und Konservativismus. Ein fesselndes Porträt unvergesslicher Charaktere, die sich in den Wirren des Lebens und der Liebe zu verlieren drohen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 757
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Zadie Smith
Von der Schönheit
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Zadie Smith
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Zadie Smith
Zadie Smith, geboren 1975 im Norden Londons, lebt heute in New York. Ihr erster Roman »Zähne zeigen«, 2001 erschienen, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, von der Kritik gelobt und ein internationaler Bestseller. Der Roman »Von der Schönheit«, 2006 erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, war auf der Shortlist des Man Booker Prize 2005 und gewann 2006 den Orange Prize.
Der Übersetzer
Marcus Ingendaay studierte nach dem Abitur Anglistik, Germanistik und Theaterwissenschaft an den Universitäten in Köln und Cambridge. Anschließend arbeitete er als Werbetexter und Reporter. Heute lebt er als freier Schriftsteller und Übersetzer in München. Er erhielt 1997 den Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis sowie 2000 den Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wenn Howard Belsey etwas hasst, dann sind es neokonservative Menschen. Ein Paradebeispiel ist für ihn sein Erzfeind Monty Kipps, wie er Universitätsprofessor und Rembrandt-Experte. Als sich Howards Sohn Jerome in Montys attraktive Tochter verliebt, fühlt sich Howard genötigt einzuschreiten. Erotische, intellektuelle und familiäre Verwicklungen und Katastrophen nehmen ihren Lauf.
Komisch, rasant, mit liebenswerten und unvergesslichen Charakteren erzählt Zadie Smiths dritter Roman von zwei mehr als turbulenten Familien zwischen England und Amerika, schwarz und weiß, Hässlichkeit und Schönheit, Liberalismus und Konservativismus.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Dank
I Kipps und Belsey
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
II Die Anatomiestunde
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
III Von Schönheit und Irrtum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Anmerkung der Autorin
Für Laird
Dank an meine ersten Leser Nick Laird, Jessica Frazier, Tamara Barnett-Herrin, Michael Shavit, David O’Rourke, Yvonne Bailey-Smith und Lee Klein. Sie haben mir – mit Rat und Kritik – Mut gemacht, dieses Buch überhaupt zu beginnen. Dank auch an Harvey und Yvonne für ihre Unterstützung und an meine jüngeren Brüder Doc Brown und Luc Skyz, die mich in all jenen Dingen beraten haben, die ich aufgrund meines fortgeschrittenen Alters nicht mehr weiß. Dank an meinen ehemaligen Studenten Jacob Kramer für seine Hintergrundinformation über das Collegeleben und die Ostküstenmentalität. Dank an India Knight und Elisabeth Merriman für die Hilfe bei den französischen Passagen. Dank an Cassandra King und Alex Adamson, die sich um alle außerliterarischen Belange gekümmert haben.
Ich danke Beatrice Monti für einen weiteren Aufenthalt in Santa Maddalena, der mir tatsächlich sehr geholfen hat. Dank an meine englischen und amerikanischen Lektoren Simon Prosser und Anne Godoff, ohne die dieses Buch länger und schlechter geworden wäre. Dank auch an Donna Poppy, die gescheiteste Redakteurin, die man sich wünschen kann. Dank an Juliette Mitchell von Penguin für den Einsatz in meiner Sache. Und ohne meine Agentin Georgia Garrett könnte ich diesen Job ohnehin an den Nagel hängen. Und danke, George, du bist ein echter Bobby Dazzler.
Dank an Simon Schama für sein monumentales Werk Rembrandts Augen, das mir zumindest die Augen für Malerei geöffnet hat. Dank an Elaine Scarry für ihren wundervollen Essay »On Beauty and Being Just«, der mir nicht nur eine Kapitelüberschrift geschenkt hat, sondern auch den Titel für das ganze Buch und überhaupt jede Menge Inspiration. Es versteht sich von selbst, dass mein ganzes Werk auf die eine oder andere Weise dem großen E.M. Forster verpflichtet ist, und diesmal wollte ich es ihm mit einer ausdrücklichen Hommage entgelten.
Am meisten aber danke ich meinem Mann, dem ich immer mal wieder einen Vers klaue, damit meine Prosa hübscher aussieht. Denn Nick weiß, was Zeit ist: »Zeit ist … wie du deine Liebe verbringst.« Deshalb ist ihm auch dieses Buch gewidmet – wie mein ganzes Leben.
IKipps und Belsey
Wir weigern uns beide gleichermaßen, der andere zu sein.
H.J. Blackham
1
Ebenso gut könnte man mit Jeromes E-Mails an seinen Vater beginnen:
Von: [email protected]
Datum: 5. November
Betreff:
Hallo Dad, ich mache einfach so weiter mit meinen E-Mails und erwarte nicht mehr, dass du darauf antwortest, obwohl ich natürlich hoffe, dass du es tust – falls das einen Sinn ergibt.
Erst einmal: Es gefällt mir hier. Ich arbeite in Monty Kipps’ Büro (wusstest du eigentlich, dass er Sir Monty ist?), ganz in der Nähe von Green Park. Zusammen mit einem Mädchen aus Cornwall, sie heißt Emily und ist cool. Im Untergeschoss arbeiten drei weitere Yankee-Praktikanten (einer sogar aus Boston!), weswegen ich mich hier wie zu Hause fühle. Auch ich bin eine Art Praktikant, Aufgabengebiet Öffentlichkeitsarbeit. Ich organisiere seine Lunchtermine, bin für die gesamte Presse zuständig und rede mit Leuten am Telefon usw. Monty selbst ist viel mehr als bloß Professor, er sitzt in der Race Commission und kümmert sich um kirchliche Wohlfahrtseinrichtungen auf Barbados, Jamaika, Haiti usw. – was bedeutet, dass mir die Arbeit nicht so leicht ausgeht. Und weil der Laden insgesamt recht überschaubar ist, habe ich viel mit ihm persönlich zu tun. Ganz abgesehen davon, dass ich jetzt in seiner Familie lebe – ein Familienanschluss der anderen und wirklich völlig neuen Art. Jaja, die Familie … Da du nicht geantwortet hast, kann ich mir deine Reaktion vorstellen (nicht schwer, oder?). Aber es war zu der Zeit eben die einfachste Lösung. Als ich aus dem Einzimmer-Apartment in Marylebone rausgeflogen bin, haben mir die Kipps’ ganz von sich aus angeboten, bei ihnen zu wohnen. Dazu bestand von ihrer Seite aus nicht die geringste Veranlassung, aber sie haben gefragt, und ich habe – dankbar – angenommen. Jetzt wohne ich schon eine Woche bei ihnen, und immer noch kein Wort von Miete o.Ä., was dir einiges über sie verrät. Ich weiß, du hättest es am liebsten, wenn ich sagen würde, es wäre der reine Albtraum, aber das ist es nicht. Im Gegenteil, ich finde es fantastisch hier, es ist geradezu ein neues Universum. Und das Haus ist – wow! Ein viktorianisches Reihenhaus in einer sogenannten »Terrace«, unscheinbar von außen, aber innen sehr weiträumig und total das edle Ambiente. Trotzdem kein bisschen großkotzig. Mir gefällt diese Bescheidenheit. Alles ganz in Weiß mit lauter antiken Sachen und handgearbeiteten Decken und Regalen aus dunklem Holz und Stuck und einer Treppe, die bis in den vierten Stock hochgeht. Und im ganzen Haus gibt es nur einen einzigen Fernseher, nämlich im Keller. Und selbst der ist nur für die Nachrichten und die Sachen, die Monty selber im Fernsehen macht, aber damit hat es sich dann. Manchmal denke ich, dieses Haus ist das genaue Gegenteil von unserem … Es liegt im Norden von London, in »Kilburn«, was erst einmal ziemlich idyllisch klingt. Aber, Mannomann, es ist alles andere als idyllisch, außer hier in unserer kleinen Seitenstraße, hier kriegt man von dem Krach rein gar nichts mehr mit, und man könnte sich in den Garten setzen, unter diesen riesigen, fast dreißig Meter hohen Baum, dessen Stamm über und über mit Efeu bewachsen ist … und man könnte lesen und sich gleichzeitig vorkommen wie in einem Roman … Der Herbst ist übrigens anders hier, nicht so ausgeprägt, obwohl die Bäume ihre Blätter früher verlieren, und alles ist irgendwie melancholischer.
Die Familie hier ist ein eigenes Thema und hat mehr Raum und Zeit verdient, als ich im Augenblick habe (gerade mal die Mittagspause). Deshalb in aller Kürze: Monty hat einen Sohn, Michael. Ein netter Typ, durchtrainiert, aber vermutlich etwas dröge. Dir zumindest wäre er bestimmt zu langweilig. Er ist Geschäftsmann, aber was er genau macht, habe ich noch nicht herausgefunden. Und groß ist er, sicher noch fünf Zentimeter größer als du. Alle in dieser Familie haben diesen karibisch-athletischen Körperbau, und Michael ist dazu deutlich über zwei Meter groß. Es gibt daneben noch eine Tochter, auch sie sehr groß und sehr schön, den Fotos nach zu urteilen. (Sie ist gerade unterwegs mit Interrail durch Europa, soll aber am Freitag zurückkommen.) Und Montys Frau Carlene – was soll ich sagen, sie ist perfekt. Sie stammt nicht aus Trinidad, sondern von einer kleinen Insel, Saint Soundso – ich habe das beim ersten Mal nicht richtig verstanden, und jetzt ist es zu spät. Sie meint, ich müsse mehr essen, und versucht dauernd, mich mit Essen vollzustopfen. Hier in der Familie redet man über Sport und Gott und Politik, und Carlene schwebt über allem wie ein Engel. Außerdem unterstützt sie mich bei meinen Gebeten. Sie versteht wirklich zu beten, und es ist zur Abwechslung mal sehr schön, wenn man beten kann, ohne dass jemand ins Zimmer platzt und (a) einen fahren lässt, (b) herumbrüllt, (c) mit einem die »verlogene Metaphysik« von Gebeten diskutiert, (d) laut singt oder (e) lacht.
So viel zu Carlene Kipps. Sag Mum, dass sie backt. Nur dass sie backt, mehr nicht. Und dann lass sie in ihrem eigenen Saft schmoren und mach dir einen schönen Tag.
Aber auch für dich habe ich eine wichtige Botschaft. In dieser Familie wird morgens GEMEINSAM gefrühstückt, und man unterhält sich MITEINANDER, und dann fährt man ZUSAMMEN in die Stadt. (Na, alles mitbekommen? Oder willst du dir das notieren?) Ich weiß, ich weiß, das ist jetzt sehr schwer, und du müsstest etwas dazulernen. Aber ich bin eben noch nie einer Familie begegnet, in der man so sehr zusammenhält wie in dieser.
Ich hoffe, du ziehst aus alledem den richtigen Schluss: dass nämlich deine Dauerfehde mit diesem Mann letztlich Zeitverschwendung ist. Der Einzige, der Krieg führt, bist du. Monty steigt auf so etwas grundsätzlich nicht ein. Außerdem kennst du ihn nicht einmal, nur aus der Zeitung und bescheuerten Briefen. Ehrlich, so kann man auch seine Energie vergeuden. Wie ja überhaupt die meiste Gemeinheit in der Welt nur fehlgeleitete Energie ist. Aber egal, ich muss jetzt Schluss machen, die Arbeit ruft.
Liebe Grüße an Mom und Levi – und mit Einschränkung auch an Zora.
Und nicht vergessen: Ich mag dich eigentlich (und bete auch für dich).
Puh, noch nie so eine lange Mail geschrieben.
Jerome xxoxxxx
Von: [email protected]
Datum: 14. November
Betreff: Noch einmal hallo
Dad,
danke, dass du die Einzelheiten betr. Dissertation an mich weitergeleitet hast. Aber könntest du in der John Brown anrufen und mir eine Verlängerung der Abgabefrist besorgen? Langsam verstehe ich, warum sich Zora in Wellington eingeschrieben hat. Wenn Daddy selber Professor ist, kannst du ruhig mal etwas später abgeben . Ich habe deine Mail-Anfrage gelesen und dann wie ein Blöder nach einem Anhang gesucht (z.B. einem Brief???), aber ich nehme an, du bist immer noch zu beschäftigt/sauer/etc. für eine Antwort. Wie auch immer, ich bin es jedenfalls nicht. Wie geht es mit deinem Buch voran? Mom sagte, du kämst nicht richtig in die Gänge. Ist dir endlich der Nachweis gelungen, dass Rembrandt im Grunde gar nicht malen konnte?
Mit den Kipps’ verstehe ich mich immer besser. Am Dienstag waren wir alle im Theater (mittlerweile ist der ganze Clan beisammen) und haben uns eine Tanztruppe aus Südafrika angesehen, und auf der Rückfahrt in der »Tube« fingen wir an, eine Melodie aus der Show zu summen. Und nach und nach – Carlene hat vorgesungen (sie hat eine tolle Stimme) – wurde daraus ein richtiges Lied, an dem sich sogar Monty beteiligte, denn er ist ganz und gar nicht der »autoaggressive Psychopath«, für den du ihn hältst. Es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis, wir in dieser U-Bahn, die irgendwann überirdisch weiterfährt, und das letzte Stück, das wir dann durch den leichten Nieselregen zu diesem schönen Haus zurückgingen, wo es selbstgemachtes Hühnchen-Curry gab. Aber ich ahne, was du jetzt für ein Gesicht ziehst, und höre lieber auf.
Was noch passiert ist: Monty versucht, in mir die große Schwäche aller Belseys auszugleichen: logisches Denken, indem er mir Schach beibringt. Und heute war ich zum ersten Mal nicht schon nach sechs Zügen schachmatt, obwohl ich am Ende natürlich verloren habe. Überhaupt hält man mich bei Kipps’ für einen Träumer, der nichts richtig auf die Reihe kriegt. Keine Ahnung, was sie sagen würden, wenn sie erführen, dass ich bei den Belseys noch geradezu als Wittgenstein gelte. Ich glaube, sie finden mich irgendwie amüsant, und Carlene unterhält sich gern in der Küche mit mir, wo mein Ordnungssinn aber als etwas Positives gesehen wird und nicht als Ausdruck eines analretentiven Syndroms … Ich muss allerdings zugeben, es ist schon etwas seltsam, wenn man morgens aufwacht, und alles ist still (und im Flur wird nur GEFLÜSTERT, um die anderen nicht aufzuwecken), oder wenn man mal nicht Levis zusammengerolltes, nasses Handtuch ins Kreuz kriegt und keine Zora da ist, die das ganze Haus zusammenbrüllt. Mom schrieb, Levi hätte die Zahl seiner Kopfbedeckungen nun auf VIER erhöht (Scullcap, Basecap, Kapuzenshirt plus Kapuze vom Dufflecoat), das Ganze noch mit Kopfhörer, sodass man von seinem Gesicht gerade noch die Augen sieht. Bitte gib ihm einen Kuss von mir. Und küss auch Mom von mir und denk daran, morgen in einer Woche ist ihr Geburtstag. Ein Kuss auch für Zora, die bitte Matthäus 24 lesen möge. Ich weiß, dass sie ohne tägliche Bibellektüre nicht leben kann.
Euch allen Liebe und Frieden in Fülle
Jerome xxxxx
PS: Um deine »höfliche Anfrage« zu beantworten: Nein, ich habe immer noch niemanden … aber das stört mich trotz deines verächtlichen Untertons überhaupt nicht … mit zwanzig hat man selbst heute noch genügend Zeit, vor allem, wenn man beschlossen hat, Jesus Christus nachzufolgen. Ich fand die Frage an sich schon krass, und erst gestern im Hyde-Park musste ich über dein erstes Mal nachdenken – mit jemandem, dem du vorher noch nie begegnet bist und den du auch nachher nie wieder gesehen hast. Ehrlich gesagt, das klang für mich nicht so verlockend, dass ich so eine Erfahrung wiederholen müsste …
Von: [email protected]
Datum: 19. November
Betreff:
Lieber Dr. Belsey!
Ich weiß nicht, wie du diese Nachricht aufnimmst! Aber wir lieben uns! Das Kipps-Mädchen und ich! Ich will ihr einen Heiratsantrag machen, Dad! Und ich glaube, dass sie ja sagt!!! Klar, was so viele Ausrufezeichen bedeuten!!!! Sie heißt Victoria, aber alle nennen sie nur Vee. Sie ist wunderbar, atemberaubend und einfach fantastisch. Heute Abend will ich sie »offiziell« fragen, aber ich wollte es dir eben zuerst sagen. Es ist über uns gekommen wie das Hohe Lied Salomos, und man kann das gar nicht anders erklären, als dass es für uns beide eine echte Offenbarung war. Dabei ist sie erst vergangene Woche hier eingetroffen – klingt verrückt, aber so ist es!!!! Nein, im Ernst: Ich bin überglücklich. Bitte nimm zwei Valium und sag Mom, sie soll mir baldmöglichst schreiben. Mein Prepaid-Handy ist leer, und das Telefon hier will ich nicht benutzen.
Jxx
2
»Was soll ich damit?«
Howard Belsey lenkte den Blick seiner amerikanischen Frau Kiki Simmonds auf die entscheidende Passage der E-Mail, die er für sie ausgedruckt hatte. Sie stützte sich beidseits des Ausdrucks auf die Ellbogen und senkte den Kopf, wie immer, wenn sie sich auf eine winzige Schrift konzentrieren musste. Howard ging auf die andere Seite der Küchentheke, um sich um den singenden Wasserkessel zu kümmern. Der Kessel gab nur einen kurzen Pfiff von sich, der Rest war Schweigen. Ihre einzige Tochter Zora saß abgewandt auf einem Barhocker, sie hatte ihre Kopfhörer auf und verfolgte andächtig, was im Fernsehen lief. Levi, der Jüngste, stand neben seinem Vater an der Küchenzeile. Beide begannen nun ihr wortloses Frühstücks-Ritual: reichten sich gegenseitig Müslipackung und Löffel, füllten ihre Schalen und bedienten sich einträchtig aus dem rosa Milchkrug mit dem sonnengelben Rand. Das Haus ging nach Süden hinaus. Licht traf auf die gläserne Flügeltür zum Garten, unterlief den Rundbogen, der die Küche teilte, und verweilte auf dem Stillleben mit der reglos lesenden Kiki am Frühstückstisch. Vor ihr stand eine dunkelrote portugiesische Obstschale mit einem Berg von Äpfeln. So früh am Morgen gelangte das Licht sogar bis in den Flur und das sogenannte kleine Wohnzimmer. Dort war der Platz für das Bücherregal mit ihren ältesten Taschenbüchern, flankiert von einem Wildleder-Sitzsack und einer Ottomane, auf der Murdoch, ihr Dackel, in einem Sonnenstrahl lag.
»Soll das ein Witz sein?«, fragte Kiki, erhielt aber keine Antwort.
Levi schnitt das Grüne von den Erdbeeren, wusch sie unter dem Wasserhahn und ließ sie in die beiden Müslischalen fallen. Howard kam es zu, die blättrigen Teile aufzufangen und im Mülleimer zu entsorgen. Kaum waren sie damit fertig, legte Kiki die ausgedruckten Seiten mit dem Gesicht nach unten auf den Tisch, nahm die Hände von den Schläfen und lachte leise vor sich hin.
»Was ist so komisch daran?«, fragte Howard, trat an die Küchentheke und stützte dort seine Ellbogen auf. Als Reaktion darauf erstarrte Kikis Miene zu einer gleichgültigen schwarzen Maske. Dieser sphinxhafte Ausdruck veranlasste ihre amerikanischen Freunde des Öfteren dazu, Kikis Herkunft in einem fernen exotischen Land zu suchen statt in einer Kleinstadt in Florida, woher sie in Wirklichkeit kam.
»Liebling, das ist überhaupt nicht komisch«, sagte sie. Sie griff nach einem Apfel und schnitt ihn mit einem der kleinen Messer mit durchsichtigem Griff in ungleiche Stücke. Diese aß sie langsam nacheinander weg.
Howard strich sich mit beiden Händen die Haare aus der Stirn.
»Entschuldige, ich dachte nur … weil du gelacht hast.«
»Wie soll ich denn deiner Meinung nach darauf reagieren?«, fragte Kiki seufzend. Sie legte ihr Messer weg und schnappte sich Levi, der gerade mit seiner Müslischale an ihr vorbeikam. Sie hielt ihren kräftigen, fünfzehn Jahre alten Sohn am Bund seiner Jeans fest und zog ihn umstandslos zu sich herunter, um das Schildchen seines Baseball-Hemds wieder unter den Kragen zu schlagen. Doch als sie ihm auch noch seitlich mit den Daumen unter das Gummiband seiner Boxershorts griff, um diese hochzuziehen, riss er sich los.
»Mom … Mann …«
»Levi, Schatz, bitte zieh dir die Hose richtig an … die hängt ja so tief, dass man deinen Arsch sehen kann …«
»Also nicht komisch«, resümierte Howard, ohne dass er sich von einer solchen Rückfrage irgendetwas versprach. Andererseits wollte er Kiki nicht so leicht aus seinem Verhör entlassen. Doch schon dieser erste Schritt war grundverkehrt und würde zu nichts führen.
»Gott, Howard«, sagte sie und drehte sich zu ihm. »Können wir damit nicht einmal ein Viertelstündchen warten? Wenigstens bis die Kinder aus dem Haus …« Sie hob den Kopf, denn sie hatte einen Schlüssel gehört, der fruchtlos im Schloss der Haustür stocherte. »Zora, Schatz, mach du bitte auf, ich kann das heute nicht, nicht mit meinem Knie, und sie kommt nicht rein, also hilf ihr …«
Zora, die eine Art getoastete Käsetasche aß, zeigte wortlos auf den Fernseher.
»Zora, bitte: Mach ihr die Tür auf, es ist die neue Putzfrau, Monique. Irgendwie passt ihr Schlüssel nicht, und habe ich dich nicht gebeten, ihr einen neuen machen zu lassen? Ich kann nicht immer hier sein, nur um sie ins Haus zu lassen. Zora, ich rede mit dir: Setz endlich deinen Arsch in Bewegung!«
»Arsch Nummer zwei an diesem Morgen«, bemerkte Howard. »Nett. Und so zivilisiert.«
Zora rutschte von ihrem Barhocker und ging durch den Flur zur Haustür. Einmal mehr sah Kiki ihren Howard fragend an, was dieser mit seiner unschuldigsten Miene parierte. Sie nahm die E-Mail ihres weit entfernten Sohnes, dann auch die Brille, die an einem Kettchen auf ihrer eindrucksvollen Brust lag, und setzte sie wieder auf die Nasenspitze.
»Eines muss man Jerome lassen«, murmelte sie beim Lesen. »Dumm ist er nicht … Er weiß, wie man sich die Aufmerksamkeit seines Vaters verschafft.« Dann, unvermittelt, blickte sie hoch und blätterte ihm – wie ein Bankkassierer – jede Silbe einzeln hin. »Monty Kipps’ Tochter. Zack, bumm, und schon bist du ganz Ohr.«
Howard verzog die Brauen. »Ist das dein ganzer Beitrag zu diesem Thema?«
»Howard, da kocht noch ein Ei auf dem Herd. Ich weiß nicht, wer es da hingetan hat, aber das ganze Wasser ist schon verdunstet, und es stinkt. Hol’s runter, mach den Herd aus, bitte.«
»Ist das dein ganzer Beitrag?«
Howard sah zu, wie sie sich erst in aller Ruhe ein weiteres Glas Clamato-Saft eingoss. Dann ergriff sie das Glas mit dieser Tomaten-Muschel-Pampe, führte es an die Lippen, hielt jedoch inne, um noch etwas hinterherzuschicken.
»Tja, Howie, er ist zwanzig. Er will, dass Daddy mal zuhört, und ich finde, er macht das gar nicht so schlecht. Allein dass er dieses Praktikum bei Kipps’ machen wollte, ich meine, Praktikantenstellen gibt es wie Sand am Meer. Und jetzt will er gar die kleine Kipps heiraten? Man braucht kein Sigmund Freud zu sein, um zu kapieren, was das bedeutet. Trotzdem, das Dümmste, was wir jetzt tun können, wäre, diesen Quatsch ernst zu nehmen.«
»Die Kippsens?«, fragte Zora laut, als sie aus dem Flur zurückkam. »Was ist da eigentlich los? Ist Jerome bei denen eingezogen? So was Dämliches. Bald nennt er sich noch Jerome … Monty Kipps«, sagte Zora, knetete zwei imaginäre Männchen ineinander und sagte noch einmal: »Jerome und … Monty Kipps … wohnen unter einem Dach?« Zora markierte ein Schaudern.
Kiki kippte ihren Saft hinunter und knallte das Glas auf den Tisch. »Jetzt ist es aber genug mit Monty Kipps. Gott ist mein Zeuge, ich will diesen Namen heute nicht mehr hören, ist das klar?« Sie schaute auf ihre Uhr. »Wann ist deine erste Stunde? Warum bist du überhaupt noch hier? Oh, guten Morgen, Monique«, sagte Kiki mit plötzlicher Förmlichkeit und ganz ohne ihren Florida-Singsang. Monique schloss die Tür hinter sich und trat näher.
Kiki schenkte Monique ein zerfranstes Lächeln. »Hier geht heute alles drunter und drüber, und keiner kommt pünktlich. Und Sie, Monique, alles okay?«
Monique, die neue Putzfrau, war eine gedrungene Haitianerin. Sie war etwa in Kikis Alter, aber noch dunkler als Kiki. Sie war zuvor erst einmal da gewesen. Sie trug eine Bomberjacke der US Navy mit hochgeklapptem Kunstpelzkragen und sah aus, als wolle sie sich jetzt schon für alles entschuldigen, was im Rahmen ihrer Tätigkeit später schiefgehen würde. Verschlimmert wurde das Ganze noch durch ihr eingewebtes Haarteil, ein billiges synthetisches Ding, das, längst überfällig, nur noch an wenigen eigenen Haaren hing und heute noch weiter hinten saß als sonst.
»Soll ich hier anfangen?«, fragte sie furchtsam, wobei ihre Hand vor dem Reißverschluss ihrer Jacke schwebte, ohne daran zu ziehen.
»Nein, Monique, mir wäre es lieber, wenn Sie im Arbeitszimmer anfangen würden, meinem Arbeitszimmer«, sagte Kiki schnell und kam damit Howard zuvor. »Ist das okay so? Und, bitte, lassen Sie alles Papier da, wo es ist. Oder legen Sie es aufeinander, wenn das geht.«
Monique aber rührte sich nicht, sondern stand einfach nur da und hielt sich an ihrem Reißverschluss fest. Auch Kiki hing gewissermaßen im Undefinierten fest, da sie schlichtweg keine Vorstellung davon hatte, was eine schwarze Frau von einer schwarzen Frau hielt, die eine schwarze Frau zum Putzen angeheuert hatte.
»Zora zeigt Ihnen alles. Zora, bitte zeig Monique die Zimmer.«
Zora sprang in großen Sätzen die Treppe hoch, und Monique schlurfte hinterher. Howard trat aus der Kulisse und direkt in seine Ehe.
»Sollte das je passieren«, sagte er betont sachlich zwischen zwei Schlucken Kaffee, »dann ist Monty Kipps mit uns verwandt. Mit uns. Nicht mit irgendjemandem, mit uns.«
»Howard«, sagte Kiki nicht weniger beherrscht, »bitte, nicht jetzt wieder die alte Arie. Du stehst nicht auf der Bühne. Wie ich schon sagte, ich will diese Geschichte jetzt überhaupt nicht diskutieren, ich habe mich doch klar genug ausgedrückt.«
Howard verbeugte sich leicht.
»Levi braucht noch Taxigeld. Wenn du dir unbedingt um etwas Gedanken machen willst, dann mach dir Gedanken darum. Aber nicht um die Kippsens.«
»Kippsens?«, rief Levi von irgendwoher, wo man ihn nicht sehen konnte. »Wassen für Kippsens?«
Der falsche Brooklyn-Akzent stammte weder von Howard noch von Kiki, sondern hatte sich ungefähr drei Jahre zuvor, an seinem zwölften Geburtstag, in ihm festgesetzt. Jerome und Zora waren in England geboren, Levi in Amerika. Allerdings kamen Howard ihre verschiedenen amerikanischen Dialekte allesamt künstlich vor und nicht wie echte Heimatgewächse, in denen sein Erbgut oder das seiner Frau weiterlebte. Levis Brooklyn-Akzent aber übertraf alles. Die Belseys lebten zweihundert Kilometer nördlich von Brooklyn, woher also kam diese Sprache? Er wollte an diesem Morgen schon etwas dazu sagen (gegen den Rat seiner Frau), aber jetzt erschien Levi in der Tür und entwaffnete ihn mit zahnlückigem Lächeln, bevor er sich im nächsten Moment über einen Muffin hermachte.
»Levi«, sagte Kiki, »Schatz, das interessiert mich jetzt sehr: Weißt du, wer ich bin? Und hast du in irgendeiner Weise mitgekriegt, worüber hier seit Wochen geredet wird? Weißt du, es geht um Jerome. Jerome, den kennst du doch, das ist dein Bruder. Jerome nicht hier. Jerome über große Teich gefahren in Land namens England, erinnerst du dich?«
Levi hatte jetzt ein Paar Turnschuhe in der Hand. Diese schüttelte er in Richtung des mütterlichen Sarkasmus, verzog das Gesicht und setzte sich, um sie anzuziehen.
»Na und? Was heißt das? Kenn ich deshalb die Kippsens? Nein, ich weiß gar nichts über die.«
»Jerome … los, ab in die Schule.«
»Und jetzt bin ich auch noch Jerome.«
»Levi, ab in die Schule, aber ein bisschen dalli.«
»Mann, warum bist du eigentlich so … Ich hab doch nur gefragt, das war alles, aber du bist gleich ange…«, und machte eine Geste, die aber keinerlei Aufschluss über das fehlende Wort gab.
»Es geht um Monty Kipps. Das ist der Mann, für den dein Bruder in England arbeitet«, lenkte Kiki erschöpft ein. Howard fand es interessant zu beobachten, wie Levi hier seinen Willen durchsetzte, indem er Kikis ätzender Ironie einfach seine eigene entgegensetzte.
»Siehst du, es geht doch«, sagte Levi, als seien Vernunft und guter Umgangston allein seinem Wirken geschuldet. »War das so schwer?«
»Sag mal, ist das ein Brief von Kipps?«, fragte Zora, die in diesem Moment die Treppe herunterkam und hinter ihrer Mutter Aufstellung nahm. So wie die Tochter sich über ihre Mutter beugte, erinnerten ihn die Frauen an die zwei dicklichen Wasserträgerinnen bei Picasso. »Dad, bitte, diesmal will ich an der Antwort mitarbeiten. Wir werden ihn vernichten. Für wen ist es denn? Die Republic?«
»Nein, gar nicht. Es hat mit alledem überhaupt nichts zu tun. Die Mail ist von Jerome. Er will heiraten«, sagte Howard, dem der Bademantel aufgegangen war, und wandte sich ab. Er ging hinüber zur Flügeltür, die in den Garten führte. »Und zwar die Tochter von Kipps. Offenbar halten das alle für komisch. Deine Mutter zum Beispiel, sie hält es für ausgesprochen erheiternd.«
»Nein, Liebling«, sagte Kiki. »Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass ich es nicht komisch finde. Aber letztlich wissen wir ja nicht einmal, was genau passiert ist. Was haben wir denn? Eine E-Mail von sieben Zeilen, von der wir nicht einmal wissen, was sie genau bedeutet. Und allein deswegen rege ich mich noch nicht auf.«
»Meint er das ernst?«, unterbrach Zora. Sie riss ihrer Mutter das Blatt aus der Hand und hielt es dicht vor ihre kurzsichtigen Augen. »Das ist wohl eher ein verdammter, verfickter Witz!«
Howard drückte die Stirn an die dicke Glasscheibe und spürte, wie das Kondenswasser seine Brauen benetzte. Draußen fiel weiterhin der demokratische Ostküsten-Schnee und machte alles gleich: Gartenstühle, Gartentisch, Pflanzen, Briefkästen und Zaunpfähle. Er hauchte einen Atompilz an die Scheibe und wischte ihn mit dem Ärmel weg.
»Zora, du musst zur Schule, okay? Und ich wünsche in meinem Haus keine solchen Ausdrücke – nein. Schluss. Aus. Papperlapapp!«, sagte Kiki und kam damit jedes Mal einem Widerwort von Zora zuvor. »Okay? Und bring Levi zum Taxistand. Ich kann ihn heute nicht fahren, meinetwegen frag Howard, ob er ihn fährt, aber es sieht nicht so aus. Ich rufe dann Jerome an.«
»Mich braucht keiner zu fahren«, sagte Levi, und erst jetzt nahm Howard das neue Ding auf seinem Kopf wahr: ein schwarzer Damenstrumpf, den er am Hinterkopf zu einem Knoten zusammengebunden hatte, der – unbeabsichtigt – aussah wie ein Nippel.
»Du kannst ihn nicht anrufen«, sagte Howard ruhig. Er zog sich taktisch auf die linke Seite des imposanten Kühl- und Gefrierschranks zurück, wo man ihn nicht sehen konnte. »Sein Prepaid-Handy ist leer.«
»Was hast du gesagt?«, fragte Kiki. »Was sagst du? Ich kann dich nicht hören.«
Plötzlich stand sie hinter ihm. »Wo hast du die Nummer von den Kippsens?«, fragte sie, obwohl sie beide die Antwort kannten.
»Jaja, ich weiß«, sagte Kiki. »Sie ist in dem Kalender, dem Kalender, den du bei dieser berühmten Konferenz in Michigan verloren hast, weil du wieder mal Wichtigeres zu tun hattest, als dich um deine Frau und deine Kinder zu kümmern.«
»Können wir das bitte später besprechen?«, fragte Howard. Denn wer schuldig ist, kann höchstens um eine Vertagung der Urteilsverkündung bitten.
»Wie du willst, Howard, wie du willst. Es bleibt ja doch an mir hängen. Permanent muss ich mich um die Folgen deines Handelns kümmern …«
Howard schlug mit der Faust gegen das Gefrierfach.
»Howard, bitte lass das. Siehst du, jetzt ist die Tür auf … da taut doch alles, bitte mach sie wieder zu, aber bitte richtig. Richtig zu ist, wenn die Tür … Okay, es ist auf jeden Fall nicht gut. Das heißt, wenn es wirklich so ist, wie er schreibt, was wir aber noch nicht wissen. Wir sollten hier schrittweise vorgehen, bis wir wirklich wissen, was los ist. Also lassen wir es erst mal dabei, auch wenn … ach, ich weiß auch nicht, wir können das alles noch später besprechen, wenn Jerome wieder da ist und … und wenn es überhaupt noch etwas zu besprechen gibt. Abgemacht?«
»Hört doch auf zu streiten …«, sagte Levi auf der anderen Seite der Küche und wiederholte es sogar laut.
»Aber wir streiten doch gar nicht, mein Schatz«, sagte Kiki und beugte erst ihren Oberkörper, dann ihren Kopf nach vorn und entließ ihr Haar aus dem flammroten Kopftuch. Sie trug es in zwei dicken Zöpfen, die entrollten Widderhörnern glichen und ihr bis an den Hintern reichten. Ohne aufzusehen, strich sie von beiden Seiten das Tuch glatt und wickelte es sich erneut und auf genau dieselbe Weise um den Kopf, nur fester. Ihre Gestalt gewann dadurch um zwei bis drei Zentimeter, und mit dieser neuen Autorität im Gesicht beugte sie sich über den Tisch und sah abermals ihre Kinder an.
»Okay, die Show ist zu Ende, Zora. Hinten im Blumentopf neben dem Kaktus liegen noch ein paar Dollar. Die gibst du Levi. Wenn nichts mehr da ist, leih ihm was, du kriegst es später von mir wieder, ich bin in diesem Monat etwas knapp. Okay, und jetzt geht hin und lernt. Oder macht, was ihr wollt. Nur tut etwas. Damit wir hier weiterkommen.«
Einige Minuten später, als sich die Tür hinter ihren Kindern geschlossen hatte, wandte sie sich ihrem Mann zu, mit einem Gesicht wie eine ausgearbeitete Dissertation, die nur Howard bis in die letzte Fußnote hinein bekannt war. Und weil eh alles egal war, lächelte Howard, erhielt dafür aber nichts zurück. Howard hörte auf zu lächeln. Sollte es jetzt ernsthaft zum Kampf kommen, würde nicht einmal ein Volltrottel auf ihn wetten. Denn Kiki, die er vor achtundzwanzig Jahren noch wie einen leichten Teppich auf der Schulter hatte tragen können, um sie – wie beim ersten Mal in ihrem ersten Haus – erst hinzulegen und dann sich auf sie drauf, Kiki wog inzwischen gut einhundertzehn Kilo und wirkte darüber hinaus auch noch zwanzig Jahre jünger als er. Nicht nur verfügte ihre Haut über den berühmten ethnischen Knitterschutz, durch ihre gewaltige Gewichtszunahme spannte sie sich sogar noch straffer als früher. Selbst mit zweiundfünfzig hatte sie noch das Gesicht eines Mädchens, eines schönen, wilden Mädchens.
Jetzt durchquerte sie den Raum und rempelte ihn dabei mit solcher Kraft an, dass er in den dort stehenden Schaukelstuhl plumpste. Zurück am Küchentisch, packte sie alles, was sie auf der Arbeit garantiert nicht brauchte, in einen kleinen Rucksack. Dann sagte sie, ohne ihn anzusehen: »Weißt du, was ich nicht begreife? Ich begreife nicht, wie man als Professor, der auf seinem Gebiet alles weiß, auf allen anderen Gebieten so unerhört dämlich sein kann. Ich meine, schlag ruhig in deinem Elternratgeber nach, Howie. Da wirst du feststellen, dass du mit deiner Methode exakt, aber exakt das Gegenteil von dem erreichst, was du willst. Das genaue Gegenteil.«
»Aber das genaue Gegenteil geschieht ja sowieso«, sagte Howard, in seinem Stuhl schaukelnd. »Immer das Scheißgegenteil von dem, was ich verdammt noch mal will.«
Kiki hielt inne. »Richtig. Weil du nie kriegst, was du willst. Dein ganzes Leben ist eine Orgie der Entrechtung und der unerfüllten Ansprüche.«
Die Bemerkung verwies auf den jüngsten Ärger. Und war ein Angebot, im Hause ihrer Ehe eine Tür einzutreten, die direkt ins Vorzimmer des Elends führte. Das Angebot wurde abgelehnt. Stattdessen begann Kiki mit dem bekannten Kunststück, den kleinen Rucksack exakt in der Mitte ihres gewaltigen Rückens auszurichten.
Howard stand auf und rückte seinen Bademantel zurecht. »Haben wir wenigstens ihre Anschrift?«, fragte er. »Ihre Privatanschrift?«
Kiki drückte die Fingerspitzen an ihre Schläfen wie ein Hellseher auf dem Rummel. Sie sprach langsam, und trotz der sarkastischen Pose waren ihre Augen feucht.
»Mich würde nur interessieren, was wir dir deiner Meinung nach angetan haben. Wir, deine eigene Familie. Was haben wir dir angetan? Haben wir dich deiner berechtigten Ansprüche beraubt?«
Howard seufzte und sah weg. »Ich halte am Dienstag einen Vortrag in Cambridge, ich könnte einen Tag früher nach London fliegen, und wenn nur, um …«
Kiki schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Herrgott, wir leben nicht mehr im Jahr 1910, Jerome kann heiraten, wen er verdammt noch mal will. Oder sollen wir ihm etwa Visitenkarten drucken lassen und ihn dazu verdonnern, nur noch die Töchter solcher Kollegen kennenzulernen, die dir zufällig …«
»Oder könnte die Adresse nicht in dem grünen Moleskin sein?«
Sie klimperte entschlossen mit den Augen, um Tränen kategorisch auszuschließen. »Keine Ahnung, ob die Adresse da sein könnte«, sagte sie, indem sie seinen Akzent nachmachte. »Such doch selber danach. Vielleicht liegt sie unter dem ganzen Müll in deiner verdammten Höhle.«
»Vielen Dank«, sagte Howard und erklomm die Treppe zu seinem Arbeitszimmer.
3
Das Haus der Belseys, ein großes granatrotes Gebäude im Neuengland-Stil, erstreckt sich über vier knarzende Etagen. Ein Keramik-Mosaik über der Eingangstür weist auf das Jahr der Errichtung hin (1856), und bis heute sind die grünen Bleiglasscheiben erhalten, die bei starkem Lichteinfall ein verträumtes Grün auf die Dielen malen. Allerdings sind es nicht mehr die ursprünglichen Fenster, sondern Nachbildungen, die Originale wären für den Alltagsgebrauch zu wertvoll. Hoch versichert lagern sie in einem großen Safe im Keller. Ein nicht unerheblicher Teil des gesamten Gebäudewerts liegt in diesen Fenstern, durch die niemand hindurchschauen und die niemand öffnen kann. Das einzige Originalfenster ist ein rautenförmiges Oberlicht dicht unter dem First, das einen mehrfarbigen Lichtkreis auf verschiedene Punkte des oberen Treppenabsatzes wirft, je nachdem, wie weit sich die Sonne über Amerika fortbewegt hat. Kommt man an diesem Fenster vorbei, färbt sich ein weißes Hemd auch mal rosa und eine gelbe Krawatte blau. Trifft das Licht am späten Vormittag hingegen genau auf den Boden, dann, so der Aberglaube in der Familie, darf man auf keinen Fall drauftreten. Zehn Jahre zuvor hätte man hier Kinder erlebt, die sich gegenseitig in den Lichtkreis schubsen, und noch heute, als junge Erwachsene, machen sie auf dem Weg nach unten einen Bogen darum.
Die Treppe ist eine steile Wendeltreppe. Um den Auf- oder Abstieg kurzweiliger zu gestalten, begleiten einen die Familienfotos der Belseys an der Wand. Erst die Kinder in Schwarz-Weiß: mit Bäuchlein und Grübchen und mit einem Strahlenkranz aus Locken. Und immer scheinen sie auf den Betrachter zuzulaufen, übereinander zu stolpern oder auf ihren kleinen Wurstbeinchen einzuknicken. Da ist Jerome, der ganz böse guckt, weil er Zora halten muss, und sich vermutlich fragt, wer das schon wieder ist. Und Zora, die einen winzigen verknautschten Levi im Arm hält, aber mit diesem wahnwitzigen Besitzerstolz einer Frau, die Kinder aus der Neugeborenenabteilung stiehlt. Es folgen Schulporträts, Abschlussfeiern, Swimmingpools, Restaurants, Urlaubs- und Gartenbilder, an denen sich ihre körperliche Entwicklung ebenso ablesen lässt wie ihr sich festigender Charakter. Nach den Kindern kommen vier Generationen der – mütterlichen – Simmonds-Linie. Die strenge Abfolge markiert zugleich ihren triumphalen Aufstieg. Kikis Ururgroßmutter war noch Haussklavin; die Urgroßmutter bereits ein Zimmermädchen; ihre Großmutter schließlich eine Krankenschwester. Und diese Schwester Lily erbte eines Tages das ganze Haus von einem gutherzigen weißen Arzt, für den sie, damals in Florida, zwanzig Jahre lang tätig gewesen war. Eine Erbschaft dieser Größenordnung ändert alles für eine arme Familie in Amerika, man gehört mit einem Schlag zur Mittelschicht. Und 83 Langham Drive ist wirklich ein schönes Mittelschicht-Haus und viel größer, als es von außen aussieht. Hinten im Garten befindet sich sogar ein ungeheizter Pool, der allerdings wegen der vielen abgeplatzten Kacheln sehr einem englischen Lächeln ähnelt. Tatsächlich sieht das ganze Haus mittlerweile etwas schäbig aus, doch das gehört wohl zu seiner inneren Größe und wirkt jedem neureichen Eindruck entgegen. Ein Haus, geadelt durch die Dienste, die es der Familie geleistet hat. Seine Vermietung finanzierte einst nicht nur die Ausbildung von Kikis Mutter (einer Rechtsanwaltsgehilfin, sie starb erst im vergangenen Frühjahr), sondern auch die von Kiki selbst. Über viele Jahre hinweg diente es auch als Feriendomizil für die Simmonds’, die jeden September aus Florida anreisten, um den Herbst in Neuengland zu verleben. Nach dem Tod ihres Mannes, eines Pfarrers, die Kinder waren alle aus dem Haus, zog Howards Schwiegermutter, Claudia Simmonds, dauerhaft ein und lebte glücklich und zufrieden als Zimmerwirtin, die die vielen leer stehenden Räume an Studenten vermietete. Schon damals hatte Howard ein Auge auf dieses Haus geworfen, doch da war Claudia vor. Sie wusste natürlich, dass es für Howard geradezu ideal war, nur einen Steinwurf entfernt von jener ganz anständigen Uni, die vielleicht erwog, ihn einzustellen. Aber es machte ihr Spaß, ihn zappeln zu lassen, zumindest glaubte Howard das. Selbst mit über siebzig erfreute sie sich bester Gesundheit und dachte gar nicht daran auszuziehen. Derweil scheuchte Howard seine junge Familie um den halben Globus und von einer zweitklassigen Bildungsstätte zur nächsten: sechs Jahre in Upstate New York, elf in London, ein Jahr in einem Außenbezirk von Paris. Erst vor zehn Jahren hatte Claudia endlich losgelassen und war in eine Seniorenwohnanlage in Florida gezogen. Aus dieser Zeit stammte auch das Foto von Kiki, damals Verwaltungsangestellte in einem Krankenhaus und vorerst letzte Erbin von 83 Langham Drive. Auf dem Foto ist sie ganz Grinsen und Haarpracht und erhält gerade eine Auszeichnung für ein Bürgerprojekt. Schamlos schlingt sich dabei ein weißer Arm um ihre damals noch schlanke Hüfte in den engen Jeans; der Arm, am Ellbogen abgeschnitten, gehört Howard.
In jeder Ehe entbrennt kurz nach der Hochzeit der Kampf darüber, welche der beiden Familien, die von Mann oder Frau, in der eigenen Familienhistorie weiterlebt. Howard hatte diesen Kampf verloren und war nicht einmal traurig darum. Die Belseys, knickrige, engherzige Kleinbürger, waren keine Familie, derer man gerne gedachte. Und weil Howard es Kiki leicht gemacht hatte, konnte die ihrerseits großzügig sein. Auf dem ersten Treppenabsatz befindet sich eine großformatige Kohlezeichnung von Howards Vater, Harold, mit Schlägermütze, ein reines Renommierstück, das Howard so hoch oben angebracht hat, wie es gerade noch angeht. Howards Vater hält dabei den Blick gesenkt wie aus Verzweiflung über die exotische Richtung, in die sein Sohn die Belsey-Linie geführt hat. Howard selbst war ziemlich überrascht, als er unter all dem Kitsch, der nach dem Tod seiner Mutter bei ihm landete, dieses Bild entdeckte, es war mit Sicherheit das einzige Kunstwerk, das die Belseys je besessen haben. Doch genau wie Howard löste sich mit der Zeit auch das Bild von seiner niederen Herkunft. Viele ihrer amerikanischen Bekannten, allesamt gebildete Leute, hatten schon davor gestanden und fanden, dass solche Bilder heute gar nicht mehr gezeichnet würden, mit dieser geheimnisvollen Noblesse und eben typisch englisch. Kiki zufolge würden die Kinder, wenn sie einmal älter sind, froh sein, es zu besitzen. Wobei sie großzügig übersieht, dass die Kinder bereits älter sind, aber nicht froh. Howard hasst es einfach nur – wie überhaupt jede Protzmalerei und nicht zuletzt auch seinen Vater.
Auf Harold Belsey folgt Howard. Howard über die Jahrzehnte. Howard in den Siebzigern, Achtzigern, Neunzigern. Trotz mehrfachen Kostümwechsels bleiben bei ihm die wesentlichen Kennzeichen weitgehend erhalten. Seine Zähne, einzigartig in seiner Familie, sind auffällig gerade und regelmäßig; seine volle Unterlippe kompensiert bis zu einem gewissen Grad das Nichtvorhandensein der oberen; und seine Ohren fallen nicht auf – was will man mehr? Zwar verfügt er über kein Kinn, dafür aber über sehr große, sehr grüne Augen. Und er besitzt eine schlanke, aristokratische Nase. Im direkten Vergleich mit seinesgleichen schneidet er vor allem in zwei Kriterien gut ab: Haare und Gewicht. Beides hat sich kaum geändert. Seine Haare sind voll und kräftig, mit einem grau melierten Scheitel, den er seit Kurzem aber direkt ins Gesicht fallen lässt, wie zuletzt 1967: ein großer Erfolg. Auf dem Gruppenbild mit Nelson Mandela sieht man es am besten, Howard überragt seine Kollegen nicht nur, sondern hat auch mit Abstand die meisten Haare in der ganzen Philosophischen Fakultät. Je mehr wir uns dem Erdgeschoss nähern, desto öfter kommen Bilder von Howard. Howard mit Bermuda-Shorts und erschreckend weißen wachsartigen Knien; Howard im akademischen Tweed unter einem Baum, betupft mit Lichtflecken aus dem Himmel von Massachusetts; Howard in einer großen Halle als frisch ernannter Inhaber des Empson-Lehrstuhls für Ästhetik; dann Howard mit Baseballkappe und auf Emily Dickinsons Haus zeigend; aus unerfindlichem Grund auch einmal mit einem Barett; und in einem knallgelben Overall in Eatonville, Florida, zusammen mit Kiki, die mit der Hand ihre Augen beschirmt, entweder wegen Howard oder der Sonne oder der Kamera.
Auf dem mittleren Treppenabsatz blieb Howard stehen, um zu telefonieren. Er wollte mit Dr. Erskine Jegede sprechen, Soyinka-Professor für afrikanische Literatur und stellvertretender Direktor des Black-Studies-Department. Er setzte den Koffer ab und klemmte sein Flugticket unter den Arm. Er wählte und ließ es länger klingeln, obwohl er bei dem Gedanken litt, dass sein guter Freund nun panisch in seiner Mappe wühlte und unter mehrfachen Entschuldigungen aus der Bibliothek in die Kälte floh.
»Hallo?«
»Hallo, wer ist da? Ich bin in der Bibliothek.«
»Ersk – ich bin’s, Howard. Tut mir leid, ich hätte mich eher melden sollen.«
»Howard? Du bist nicht oben?«
Normalerweise ja. Normalerweise war er oben. Lesenderweise an seinem geliebten Arbeitsplatz Nr. 187 im obersten Stock des Greenman Building, Wellingtons College-Bibliothek. Jeden Samstag, bei jedem Wetter und egal, ob krank oder gesund. Dort las er den ganzen Morgen lang und traf sich am Mittag mit Erskine vor den Aufzügen in der Lobby. Auf dem Weg zum Bibliothekscafé legte ihm Erskine gern brüderlich die Hand auf die Schulter. Sie waren ein seltsames Paar. Erskine war fast zwei Köpfe kleiner als Howard und völlig kahl, mit einer Kopfhaut, die aussah wie poliertes Ebenholz und einem fassförmigen Thorax, den er, nicht untypisch bei untersetzten Männern, wie ein Federkleid vor sich hertrug. Erskine erlebte man auch nie ohne Anzug (Howard dagegen trug seit zehn Jahren stets die gleiche Art schwarzer Jeans), ein durchaus ehrwürdiger Eindruck, der durch einen braun-weißen Schnurr- und Knebelbart sowie 3D-Leberflecken auf Wangen und Nase abgerundet wurde. Bei ihrem gemeinsamen Mittagessen lästerte er herrlich über seine Kollegen, ohne dass diese jemals davon erfuhren. Seine Leberflecken taten einen erstaunlichen diplomatischen Dienst, und Howard hätte sich auch so ein freundliches Gesicht gewünscht. Nach dem Mittagessen trennten sie sich, was ihnen oft nicht leichtfiel, und jeder von ihnen kehrte bis zum Abend an seinen Arbeitsplatz in der Bibliothek zurück. Diese allsamstägliche Routine bereitete Howard große Freude.
»Ach, das ist aber unangenehm«, sagte Erskine auf Howards Neuigkeiten, und diese Reaktion bezog sich nicht nur auf Jeromes Situation, sondern auch darauf, dass sie auf ihr gewohntes Treffen verzichten mussten. Dann sagte er: »Armer Jerome. Er ist ein guter Junge. Aber jetzt will er irgendetwas beweisen.« Erskine legte eine Pause ein. »Fragt sich bloß, was.«
»Ausgerechnet Monty Kipps!«, wiederholte Howard verzweifelt. Doch von Erskine würde er bekommen, was er jetzt am dringendsten brauchte. Deshalb waren sie Freunde.
Erskines Anerkennung ließ nicht lange auf sich warten. »Mein Gott, Howard, wem sagst du das? Ich erinnere mich, damals bei den Straßenkämpfen in Brixton – das war anno 81, ich wollte auf BBC World-Service über mögliche Ursachen reden, Armut und Diskriminierung et cetera …« Howard genoss die Musikalität in dem nigerianisch gefärbten et cetera. »Und Monty, dieser Geistesgestörte, sitzt mit seiner Krawatte vom Trinidad Cricket-Club vor mir und sagt: ›Die Farbigen müssen sich um ihre Angelegenheiten selber kümmern, die Farbigen müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen.‹ Die Farbigen! Er drückt sich heute immer noch so aus. Wann immer wir einen kleinen Schritt vorwärtskommen, zieht Monty uns wieder zwei Schritte zurück. Traurig, kann man nur sagen. Er tut mir fast leid. Er ist schon zu lange in England. Das hat ihm nicht gutgetan.«
Howard am anderen Ende der Leitung sagte nichts darauf. Er suchte in seiner Laptoptasche nach dem Pass. Angesichts der Reise und der Schlacht, die ihn auf der anderen Seite des Atlantiks erwartete, fühlte er sich schon jetzt fix und fertig.
»Dabei werden seine wissenschaftlichen Arbeiten von Jahr zu Jahr schlechter. Und das Rembrandt-Buch ist meiner Ansicht nach regelrecht vulgär«, fügte er freundlich hinzu.
Howard hatte trotzdem ein schlechtes Gewissen, Erskine auf diese Weise zu einer unfairen Stellungnahme zu bewegen. Monty war ein Scheißkerl, sicher, aber er war kein Narr. Howard zufolge war Montys Rembrandt-Buch zwar rückschrittlich, verstockt und ärgerlich, essenzialistisch, aber es war weder vulgär noch dumm. Es war sogar ziemlich gut, detailgenau und gründlich. Und es hatte den großen Vorteil, dass es sich sauber zwischen zwei Buchdeckeln befand und in der ganzen englischsprachigen Welt vertrieben wurde, wohingegen Howards Buch noch als Loseblattsammlung existierte, die der Drucker, so schien ihm, beinahe angewidert ausgespuckt hatte.
»Howard?«
»Ja, ich bin noch dran. Aber ich muss jetzt gehen. Ich habe mir ein Taxi bestellt.«
»Dann pass auf dich auf, mein Freund. Und das mit Jerome … ich bin sicher, wenn du erst mal da bist, erweist sich die ganze Geschichte als Sturm im Wasserglas.«
Sechs Stufen vor dem Erdgeschoss überraschte ihn Levi. Schon wieder mit Damenstrumpf auf dem Kopf. Darunter ein Löwengesicht mit dem maskulinen Kinn, auf dem seit zwei Jahren die ersten Härchen sprießten, aber sich noch nicht wirklich durchgesetzt hatten. Sein Oberkörper war nackt, und er war barfuß. Seine schmale Brust roch nach Kakaobutter und war frisch rasiert. Levi streckte die Arme aus und versperrte ihm so den Weg.
»Yo! Was geht?«, fragte sein Sohn.
»Nichts. Ich muss weg.«
»Mit wem hast du telefoniert?«
»Erskine.«
»Du musst echt weg?«
»Ja.«
»Jetzt gleich?«
»Was soll eigentlich die Kopfbedeckung?«, fragte Howard seinerseits und berührte dabei Levis Kopf. »Ist das irgendein politisches Statement?«
Levi rieb sich die Augen. Er verschränkte die Arme im Rücken, gab sich selbst die Hand und streckte sich nach hinten, wobei sich sein Brustkorb ungeheuer dehnte. »Es ist nichts, Dad. Es ist nur, was es ist, nichts weiter«, sagte er gnomisch und biss sich in den Daumen.
»Also ist es …«, sagte Howard, als müsse er Levis Antwort in seine Sprache übersetzen, »… ist es eher ein ästhetisches Ding. Rein äußerlich.«
»Möglich«, sagte Levi und zuckte mit den Schultern. »Yo, es ist, was es ist. So zum Anziehen und so. Hält die Rübe warm, Mann. Rein praktisch.«
»Ja, aber dein Kopf sieht damit eher … so rund aus, glatt … wie eine Melone.«
Er drückte seinem Sohn freundlich die Schulter und zog ihn zu sich heran. »Gehst du heute zur Arbeit? Darfst du das Ding da überhaupt tragen, in diesem … diesem Plattenladen?«
»Och, das geht schon klar … Aber ich habe dir schon tausendmal gesagt, es ist kein Plattenladen, sondern ein Megastore … über sieben Etagen … Mann, manchmal bist du so was von …«, sagte Levi leise, drückte seine Lippen an Howards Hemd und blies, dass es knatterte. Dann trat er einen Schritt zurück und tastete ihn ab wie ein Türsteher. »Also du bist jetzt weg oder was? Und was sagst du Jerome? Womit fliegst du eigentlich?«
»Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Das ist von so einem Meilenkonto, die Uni hat den Flug gebucht. Hör mal, ich will doch nur, dass wir miteinander reden. Wie zwei erwachsene Menschen, mehr nicht.«
»Mann …«, sagte Levi und schnalzte mit der Zunge. »Kiki ist so was von sauer auf dich … klar, warum? Warum lässt du ihn nicht einfach in Ruhe? Das legt sich wieder. Jerome heiratet sowieso nie. Der findet doch nicht mal seinen eigenen Schwanz.«
Wenngleich Howard ihm das eigentlich nicht durchgehen lassen durfte, musste er Levi doch recht geben. Jeromes überlange Jungfräulichkeit (die offenbar erst jetzt an ihr Ende gelangt war) deutete nach Howards Meinung auf ein gespaltenes Verhältnis zur Welt und ihrer Bewohner hin, etwas, das er weder verstehen noch gutheißen konnte. Jerome war irgendwie nicht in seinem Körper zu Hause, und das hatte ihn an seinem Sohn schon immer gestört. Einen Vorteil hatte die Sache in London allerdings: Die Aura der moralischen Überlegenheit, die Jerome bisher umgeben hatte, war damit zerplatzt.
»Hör mal, wenn jemand dabei ist, einen schweren Fehler zu begehen«, sagte Howard, indem er das Problem verallgemeinerte, »kann ich nicht einfach danebenstehen und zugucken, bis sich alles von selber legt, wie du sagst.«
Levi überlegte einen Moment. »Na ja, angenommen, er heiratet wirklich, dann verstehe ich nicht, warum das auf einmal so schlimm sein soll. Ich meine, so bekommt er wenigstens die Chance auf ein bisschen Sex …«, sagte Levi und lachte tief und laut, wodurch sein Bauch Falten warf, aber eher wie ein Hemd als wie normale Haut. »So, wie es jetzt ist, kann er das nämlich komplett vergessen.«
»Levi, das ist nicht …«, begann Howard, doch im selben Moment stand ihm das Bild seines Sohns Jerome vor Augen: der ungleichmäßige Afro, das weiche, empfindsame Gesicht, die geradezu weiblichen Hüften, die Jeans, die immer ein bisschen zu hoch auf der Taille saß, das Goldkreuz, das ihm um den Hals hing – seine ganze Unschuld.
»Wie? Ist nicht wahr? Mann, du weißt es doch auch. Du hast doch selber gegrinst.«
»Natürlich ist das nicht per se schlimm, wenn er heiratet«, entgegnete Howard scharf. »Es ist ein bisschen komplizierter. Vor allem der Vater von dem Mädchen … ich sage mal so, so etwas können wir in dieser Familie nicht gebrauchen.«
»Klar …«, sagte Levi und zog seinem Vater die Krawatte an die richtige Stelle. »Ich verstehe aber nicht, was das wieder mit dem ganzen Scheiß zu tun hat.«
»Wir wollen nicht, dass Jerome sich seine Zukunft …«
»Wir?«, fragte Levi mit einer erhobenen Braue zurück, einem unmittelbaren Erbe seiner Mutter.
»Hör mal, brauchst du noch Geld oder so?«, fragte Howard. Er griff in seine Hosentasche und grub zwei wie Taschentücher zerknitterte Zwanzig-Dollar-Scheine aus. Selbst nach allen Jahren nahm er die schmutzig-grüne Haptik amerikanischer Banknoten nicht ernst. Er steckte sie einfach in Levis tief sitzende Jeans.
»Die Firma dankt, Pa«, sagte er in Nachahmung des breiten mütterlichen Südstaaten-Akzents.
»Keine Ahnung, was ihr da in dem Laden verdient …«, murmelte Howard.
Levi seufzte. »Doll ist das nicht, Mann. Doll ist das nicht.«
»Wenn du willst, rede ich mal mit denen …«
»Nein!«
Howard ging davon aus, dass sich sein Sohn für ihn schämte. Scham war ein Erbteil der männlichen Belsey-Linie. Wie peinlich Howard seinen eignen Vater fand, als er in Levis Alter war! Er hätte sich etwas Besseres gewünscht als ausgerechnet einen Metzger, jemanden, der den Kopf benutzte, um sein Geld zu verdienen, nicht Messer und Waage, jemanden, der mehr so war wie er, Howard, jetzt. Aber die Dinge änderten sich und die Kinder auch. Wäre Levi heute ein Metzger lieber?
»Ich meine«, sagte Levi und schwächte seine erste Reaktion umstandslos ab, »ich komm schon klar, mach dir keine Gedanken.«
»Verstehe. Hat deine Mutter noch eine Nachricht oder etwas Ähnliches hinterlassen?«
»Nachricht? Keine Ahnung, ich habe sie nicht mehr gesehen. Sie ist echt früh aus dem Haus.«
»Gut. Und du? Soll ich deinem Bruder etwas ausrichten?«
»Ja … sag ihm«, grinste Levi, wobei er sich links und rechts auf dem Geländer abstützte und die gestreckten Beine waagerecht in die Luft hob, »sag ihm: I’m just another black man caught up in the mix, tryna make a dollah outta fifteen cents!«
»Gut, mach ich.«
Es schellte an der Tür. Howard trat eine Stufe tiefer, küsste seinen Sohn auf den Hinterkopf, duckte sich unter ihm hindurch und ging zur Tür. Dahinter erwartete ihn ein bekanntes grinsendes Gesicht, das in der Kälte ganz grau geworden war. Howard hob einen Finger zur Begrüßung. Pierre kam aus Haiti, einer von vielen, die dieser problematischen Insel den Rücken gekehrt, in Neuengland Arbeit gefunden hatten und so dafür sorgten, dass Howard nicht selber fahren musste, was er nämlich ungern tat.
»Moment, wo ist eigentlich Zora?«, rief er noch in der Tür.
Levi zuckte die Schultern. »Wasweißich«, erwiderte er mit jenem seltsam eingeschmolzenen Kürzel, das mittlerweile seine Antwort auf beinahe jede Frage war. »Vielleicht schwimmen?«
»Bei diesem Wetter? Du lieber Himmel!«
»Mann, doch drinnen. Was dachtest du denn?«
»Okay, dann sag ihr nur auf Wiedersehen. Ich bin Mittwoch, nein, Donnerstag wieder da.«
»Yo! Geht klar, Dad. Mach’s gut.«
Im Radio des Taxis brüllten sich Männer in einem Französisch an, das für Howard nicht einmal als Französisch zu identifizieren war.
»Zum Flughafen, bitte«, sagte Howard über den Krach hinweg.
»Ja, okay. Aber wir müssen langsam fahren. Die Straßen sind nicht gut.«
»Aber bitte nicht zu langsam.«
»Terminal?«
Seine Aussprache war so hart, dass Howard erst dachte, er hätte den Titel eines Zola-Romans gehört.
»Wie bitte?«
»Wissen Sie, welches Terminal?«
»Oh. Nein … weiß ich nicht … aber ich schau mal nach, das muss hier irgendwo … keine Sorge, fahren Sie einfach weiter, ich finde es schon.«
»Und immer nur fliegen«, sagte Pierre eher melancholisch, lachte kurz und sah Howard durch den Rückspiegel an. Howard war erstaunt über die Breite seiner Nase, die sich gut auf beide Hälften seines freundlichen Gesichts ausdehnte.
»Ja, heute hier, morgen dort«, sagte Howard jovial, auch wenn es ihm nicht so viel und vor allem nicht so weit vorkam. Erst im Flugzeug merkte er es wieder. Er dachte einmal mehr an seinen Vater. Verglichen mit ihm war er, Howard, ein Phileas Fogg. Damals war die Möglichkeit, reisen zu können, der Schlüssel zum Königreich. Man träumte von einem Leben, das einem dies erlaubte. Durch die Seitenscheibe sah Howard einen Laternenpfahl in einer hüfthohen Schneewehe, an den zwei gefrorene Fahrräder angekettet waren, erkennbar allein an den äußersten Enden der Lenkergriffe. Er stellte sich vor, wie es war, morgens aufzuwachen, sein Fahrrad aus dem Schnee zu buddeln und ganz normal zur Arbeit zu fahren, so wie es die Belseys über Generationen getan hatten, doch er merkte, dass er sich das gar nicht vorstellen konnte. Einen Augenblick interessierte ihn dieser Gedanke: War es möglich, dass er sein Luxusleben schon gar nicht mehr wahrnahm?
Bei ihrer Rückkehr (und kurz bevor sie in ihr Arbeitszimmer ging) nutzte Kiki die Gelegenheit, in Howards Zimmer zu schauen. Es lag im Halbdunkel, die Vorhänge waren zugezogen. Aber sein Computer war noch an. Gerade als sie gehen wollte, wachte er auf und gab dieses Rauschen von sich, wie von einer elektronischen Wellenmaschine, die alle zehn Minuten ansprang, um uns daran zu erinnern, dass Weggehen nicht gestattet war, weil er regelmäßig gefüttert werden wollte. Kiki ging an den Computer und drückte eine Taste – der Bildschirm sprang an. In seinem Posteingang befand sich eine ungelesene Mail. Da Kiki völlig richtig davon ausging, dass sie von Jerome war (Howards Mailkontakte beschränkten sich sonst nur auf seinen Assistenten Smith J. Miller, Erskine Jegede und eine Reihe von Zeitungen und Zeitschriften), klickte sie die Zeile an.
Von: [email protected]
Datum: 21. November
Betreff: Bitte sofort lesen
Dad – mein Fehler, alles zurück. Ich hätte gar nichts sagen sollen. Es ist aus und vorbei – falls es jemals begann. Bitte bitte bitte sag niemandem etwas davon und vergiss das Ganze. Ich habe mich total zum Affen gemacht. Am liebsten würde ich mich irgendwo verkriechen und sterben.
Jerome
Kiki seufzte erschrocken auf, dann fluchte sie, drehte sich zweimal um die eigene Achse und umklammerte dabei ihr Halstuch, bis nach ihrem Verstand auch ihr Körper den Alarm einstellte. Denn im Grunde konnte sie überhaupt nichts tun. Howard saß längst eingeklemmt in einer viel zu engen Sitzreihe, suchte wahrscheinlich eine wie auch immer geartete Position für seine Knie – und für die Bücher, die er im Einstiegsgedränge noch ausgepackt hatte, ehe er sein Handgepäck in der Ablage verstaute. Er war nicht mehr aufzuhalten und zu erreichen auch nicht. Aufgrund seiner ausgeprägten Angst vor krebserregenden Stoffen fahndete er nicht nur auf jedem Etikett nach Diethylstilbestrol, ihn ängstigten auch Mikrowellen, und er hatte im Leben noch nie ein Handy besessen.
4
Beim Thema Wetter geben sich Neuenglands Bürger gern einer großen Täuschung hin. Wie oft hatte Howard in den vergangenen zehn Jahren von irgendeinem Blödmann aus Massachusetts, der Howards Akzent erkannte, den Satz gehört: Kalt da drüben in England, was? Doch Howard wusste: alles Unsinn. Zwar ist es in England im Juli und August nicht wärmer als an der amerikanischen Ostküste, möglicherweise auch nicht im Juni. Aber es ist im Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April und Mai wärmer, in allen Monaten also, in denen ein paar Grad mehr oder weniger einen Riesenunterschied machten. In England schneien keine Briefkästen zu. Und selten, dass Eichhörnchen vor Kälte zittern. Man muss auch nicht mit der Schneeschaufel seinen Mülleimer freilegen, und das aus einem einzigen Grund: In England ist es nie wirklich kalt. Es nieselt, und es geht ein strammer Wind; es kann auch hageln, und manchmal im Januar scheint die Zeit stillzustehen, dann hängt Wasser in der Luft, es wird kaum hell, und die Menschen können sich nicht ausstehen. Trotzdem, mit einem Pullover und einer wollgefütterten Wachstuchjacke ist man auf jedes Klimaereignis gut vorbereitet. Howard wusste das und war deshalb für den englischen November angemessen gekleidet, als er über seinem »guten« Anzug lediglich einen leichten Trenchcoat trug. Hochzufrieden beobachtete er die Frau ihm gegenüber, die in ihrem Gummimantel allmählich überhitzte und der die ersten Schweißtropfen vom Haaransatz über die Backe liefen. Er befand sich im Zug von Heathrow in die Stadt.
An Paddington Station gingen die Türen auf, und er trat in den warmen Smog des Bahnhofs. Er knüllte seinen Schal zusammen und stopfte ihn in die Tasche. Er war kein Tourist und hatte auch keinen Blick für die majestätische, reich verzierte Eisenkonstruktion dieses gigantischen Wintergartens. Er ging unverzüglich zum Ausgang, wo er sich eine Zigarette drehen konnte. Die Abwesenheit von Schnee war sensationell. Und wie schön, einmal ohne Handschuhe eine Zigarette in der Hand zu halten und sich ohne Kopfbedeckung der frischen Luft auszusetzen. Für gewöhnlich war Howard von der englischen Skyline wenig angetan, aber an diesem Tag erschien ihm der Anblick einer einzelnen Eiche oder eines Bürohauses vor dem reinen Blau des Himmels zu einer Landschaft von einzigartiger Schönheit gehörig. In einem schmalen Sonnenstreifen lehnte er sich an eine Säule, vor ihm eine Reihe schwarzer Taxis. Leute sagten, wohin sie wollten, und die Fahrer wuchteten hilfsbereit schwere Gepäckstücke in den Fond. Howard wunderte sich, als er zweimal in fünf Minuten das Fahrtziel »Dalston« hörte. Er selber war einst in diesem Slum zur Welt gekommen, Dalston, dreckigstes East End voller schmutziger Menschen, die ihn alle hatten zerstören wollen – nicht zuletzt die aus seiner eigenen Familie. Aber heute lebten dort offenbar völlig normale Leute. Die Blonde etwa in dem taubenblauen Wintermantel mit dem Laptop und dem Blumentopf in der Hand; der asiatische Bursche in dem billigen, glänzenden Anzug, der das Licht reflektierte wie getriebenes Metall; solche Leute hätten damals nie im Osten von London gewohnt. Howard warf seine Zigarette auf den Boden und stupste sie mit dem Schuh in den Rinnstein. Er ging wieder in den Bahnhof zurück, ließ sich erfassen vom Strom der Pendler, der ihn unsanft die Treppe hinab zur Underground beförderte. In einer U-Bahn ohne Sitzplätze, hart gegen einen entschlossenen Leser gedrückt und in ständiger Gefahr, den scharfkantigen Buchdeckel ans Kinn zu kriegen, versuchte er, sich seine Mission vor Augen zu führen. Aber zu den Hauptpunkten fiel ihm immer noch nichts ein, er wusste schlicht nicht, was er sagen sollte, wusste auch nicht, wie und zu wem. Der ganze Sachverhalt lag in einer Wolke aus Scham, aus der zwei pikenspitze Sätze hervorstachen:
Der dürftigen Argumentation zum Trotz hätte Belseys Beitrag gleichwohl sehr gewonnen, wäre ihm nicht entgangen, auf welches Bild ich mich beziehe. Sein Angriff richtet sich nämlich gegen das in München befindliche Selbstbildnis aus dem Jahr 1629. Aus meinem Artikel geht jedoch eindeutig hervor, dass ich mich ausschließlich auf jenes im selben Jahr entstandene Selbstbildnis mit Halsberge beziehe, welches in Den Haag hängt.