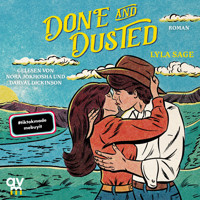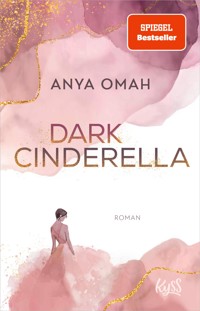17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Es gibt Bücher, die lange nachhallen. Dieses ist so eines. Steht auf meiner persönlichen Bestsellerliste jetzt ganz oben.» (Christine Westermann) Linda ist fünfzehn und würde am liebsten vor ein Auto laufen. Doch noch halten zwei Menschen sie davon ab: ihr einziger Freund Kevin, der daran verzweifelt, dass die Welt am Abgrund steht. Und Hubert, sechsundachtzig Jahre alt, ein Bademeister im Ruhestand, der seine Wohnung kaum mehr verlässt, Karotten toastet und auf seine Frau wartet, die vor sieben Jahren verstorben ist. Dreimal wöchentlich verbringt Linda den Nachmittag bei Hubert, um die polnische Pflegerin Ewa zu entlasten, die mit durchaus eigenwilligen Mitteln ihren Beruf ausübt. Feinfühlig und spielerisch begegnet Linda Huberts fortschreitender Demenz und versucht, den alten Bademeister im Leben zu halten. Bis das Schicksal ihre Pläne durchkreuzt … Petra Pellini erzählt mit Wärme und Humor vom Erwachsenwerden und Vergessen und von einer einzigartigen Freundschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Petra Pellini
Der Bademeister ohne Himmel
Roman
Über dieses Buch
«Es gibt zwei Menschen, die mich von der Sache mit dem Auto abhalten. Kevin und Hubert. Kevin wohnt um die Ecke, ist voll intelligent und Hubert wohnt im dritten Stock und ist voll dement.»
Linda ist fünfzehn. Hinter ihr liegt eine glücklose Kindheit, vor ihr nichts wirklich Greifbares. Am liebsten würde sie vor ein Auto laufen. Doch noch halten zwei Menschen sie davon ab: Ihr einziger Freund Kevin, der daran verzweifelt, dass die Welt am Abgrund steht. Und Hubert, sechsundachtzig Jahre alt, ein Bademeister im Ruhestand, der seine Wohnung kaum mehr verlässt, Karotten toastet und auf seine Frau wartet, die vor sieben Jahren verstorben ist. Dreimal wöchentlich verbringt Linda den Nachmittag mit Hubert, um die polnische Pflegerin Ewa zu entlasten, die mit durchaus eigenwilligen Mitteln ihren Beruf ausübt. Der Alltag gelingt mal mehr, meist weniger. Linda erzählt dem alten Bademeister ausgedachte Geschichten von den Sommern im Strandbad oder seiner Frau Rosalie, und tut alles, um ihn im Leben zu halten, aus dem sie doch eigentlich entfliehen möchte. Bis das Schicksal Lindas Pläne durchkreuzt…
Petra Pellini erzählt mit Wärme und Humor vom Erwachsenwerden und Vergessen, von einer einzigartigen Freundschaft und der tröstlichen Kraft von Freibadlärm.
Vita
Petra Pellini, geboren 1970 in Vorarlberg, lebt und arbeitet in Bregenz. Sie war lange in der Pflege demenzkranker Menschen tätig und gewann mit einem Auszug aus ihrem Debüt den Vorarlberger Literaturpreis 2021.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2024
Covergestaltung Designbüro Lübbeke Naumann Thoben
Coverabbildung Eric Zener
ISBN 978-3-644-02128-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1
Ich werde vor ein Auto laufen. Die Menschen werden sich um mich scharen und mit weit aufgerissenen Augen auf meine blutenden Wunden starren. Wenn mein linker Arm gut zu liegen kommt, werden sie den Säbelzahntiger auf meinem Unterarm sehen. Die Welt wird stillstehen und endlich wird jemand es aussprechen:
Das Mädchen braucht Hilfe!
Es gibt zwei Menschen, die mich von der Sache mit dem Auto abhalten. Kevin und Hubert. Kevin wohnt um die Ecke, ist voll intelligent und Hubert wohnt im dritten Stock und ist voll dement. Zweiundvierzig Jahre war Hubert Bademeister im Bregenzer Strandbad. Kevin kenne ich seit sechs Jahren, seit ich ihn am Schulweg mitnehmen musste. Ich erinnere mich an den gelben Flaum auf seinem Kopf. Haare konnte man das nicht nennen. Auf jeden Fall war Kevin mein Handgepäck, weil das eben so war, mit seiner alleinerziehenden Mutter und seinem gefährlichen Schulweg. Kevin war mein Klotz am Bein. Bis er neun war, gingen wir stumm nebeneinanderher. Kopfnicken zur Begrüßung. Kopfnicken zum Abschied. Erst als meine Eltern sich trennten, habe ich begonnen, ihn zu mögen. Er war der Einzige, der wusste, was bei mir zu Hause los war. Kevin kennt mich. Hubert jedoch kennt meine Geheimnisse. Bei ihm sind sie sicher, denke ich und bekomme einen Lachanfall.
Kevin und ich sehen uns, wann immer es geht. Hubert sehe ich montags, mittwochs und samstags in seiner gewohnten Umgebung, während seine 24-Stunden-Hilfe Luft schnappt. Gäbe es eine Leistungsbeurteilung für Demente, wäre Hubert Klassenbester. Er hat vergessen, wie man Besteck benutzt und dass man sein Essen isst, wenn es einem vor die Nase gestellt wird. Letzten Mittwoch habe ich ihm seine Haarbürste in die Hand gedrückt. «Mach mal selber, Hubert», habe ich gesagt.
Und er? Er wollte die Bürste dem Mann im Badezimmerspiegel geben. Das mit den Spiegeln, darüber sollte man mal nachdenken. Wenn wir es schon so genau nehmen mit der Gestaltung seiner Umgebung, dann weg mit den Spiegeln. Kein Mensch braucht fünf Spiegel in einer 60-m2-Wohnung. Letzten Freitag ist er über sein Spiegelbild erschrocken und die Woche zuvor hat er mit sich selbst zu streiten begonnen. Er wollte den Mann im Spiegel aus der Wohnung werfen. Ich kann das verstehen. Das mit dem Spiegel ist mir auch oft zu viel.
Ein Jahr ist es her, dass mich seine Tochter abgepasst hat, unten bei den Briefkästen. Die ganze Zeit über musste ich an diese Nachtfalter mit den hauchdünnen Flügeln denken, so zerbrechlich hat sie ausgesehen. Ohne Betreuung sei ihr Vater völlig aufgeschmissen, hat sie erklärt. Da haben wir etwas gemeinsam, habe ich mir gedacht.
2
Da sitzt er. Die Stimme des Radiosprechers steht zwischen uns. Ich ziehe den Stecker. Aus. Stille. Jetzt hat er mich entdeckt. Ich reiche ihm die Hand. Meine heiß. Seine kalt. Die Spiele sind eröffnet. Jedes Mal frage ich mich, ob er das Mädchen mit den langen, brünetten Haaren erkennt. Er nennt mich du. Ich glaube nicht, dass er mich als fremd einstuft, sonst müsste er die Polizei rufen, wenn ich plötzlich in seiner Wohnung stehe. Mit der Polizei kommt er mir nur, wenn er seine Sparbücher sucht. «Ist mein neues Hobby, mit Hubert Sparbücher suchen», sage ich zu seiner Tochter am Telefon.
Ewa, die polnische Pflegekraft, geht, ohne Gruß, schnell raus. Ich setze mich ihm gegenüber und überlege, ob zwölf Euro in der Stunde leicht oder schwer verdientes Geld sind. Wir spielen Memory, während seine Augen von Zeit zu Zeit zufallen. Ich übernehme seinen Part, spiele gegen mich und sehe zu, wie er gewinnt.
«Hunger, Hubert?», frage ich nach seinem dritten Sieg.
Ich entferne die Rinde vom Weißbrot und streiche Leberwurst darauf. Das mit der Streichwurst kostet mich richtig Überwindung. Ich schneide das Brot und stecke es ihm Stück für Stück in den Mund. Er kaut. Das ist die halbe Miete. «Und runterspülen», sage ich und halte ein Glas Johannisbeersaft an seine aufgesprungenen Lippen. Er nimmt einen winzigen Schluck und spuckt den Saft zurück ins Glas.
«Willst du mich vergiften?»
«Ja, genau», sage ich.
Immer, wenn ich seiner Vergiftungstheorie zustimme, rücken seine Augenbrauen eng aneinander. Ich verwerfe die Idee, mit der geblümten Serviette gegen seinen Mund zu tupfen. Jede Veränderung kann Ärger bringen.
Ist Hubert mit nichts aufzumuntern, ziehe ich drei Brockhaus-Bände aus dem Regal, staple sie übereinander, steige hinauf, hole tief Luft, halte mir die Nase zu und springe vom Beckenrand. Ich schwimme durchs Wohnzimmer. Brustschwimmen. Rückenschwimmen. Kraulen. Delfin. Das ganze Repertoire. Hubert lächelt mich mitleidig an. Lässt ihn der dritte Sprung vom Beckenrand unbeeindruckt, suche ich auf Youtube nach Filmmaterial über Freibäder. Hilft alles nichts, ziehen wir uns Rudi Carrell rein. Wann wird’s mal wieder richtig Sommer. 1975. Rudi sitzt in der Mitte eines runden Schwimmbeckens. Acht Frauen in roten Badeanzügen schwimmen um den Rudi. Exakt da liegt meine Schmerzgrenze. «Jetzt bin ich dran», sage ich und gebe Julien Bam, Pool Song, ein.
Die Zeit vergeht so langsam, dass ich mich frage, wer zuerst stirbt. Ich stecke das Radio wieder ein. Ein Sprecher berichtet vom Klimawandel. Die Medien sind schuld, dass ich meinen Plan bisher nicht durchgezogen habe. Der Gedanke, Kevin im Stich zu lassen, so richtig, das stresst mich. Wer soll ihm sagen, dass er etwas Warmes essen soll oder dass man einen PC auch ausschalten kann? Zudem schläft er kaum. Nächtelang hängt er im Netz, wie ein Fisch, recherchiert und liest den ganzen Müll. Die Tatsache, dass wir die Erde, das Klima, die Eisbären plattmachen und alle, die etwas zu sagen haben, egoistische Idioten sind, macht ihn fertig.
«Nicht gut für die Stimmung», sage ich, wenn er sich zu tief reinlehnt.
«Linda, du hast keine Ahnung», murmelt er.
Ewa nutzt ihre Pause auf die Millisekunde. Hubert sitzt auf der Eckbank in der Küche. Er atmet schnell. Schneller als sonst. Sein Gesicht ist grau. Ich öffne die Bestecklade, checke das Fensterbrett, taste in der Keksdose ins Leere. Offenbar hat Ewa die Zigaretten versteckt. 24-Stunden-Plage, denke ich und lege meine Hand auf Huberts Brust. Fragend schaut er mich an. Ich blicke auf das rechteckige Kästchen, dessen Form sich unter seinem Hemd abzeichnet, zerlege das Wort Herzschrittmacher, greife nach dem Bilderrahmen mit seinem Hochzeitsfoto und tippe mit dem Zeigefinger auf das Gesicht der Braut. Hubert zeigt kein Interesse. Nichts zu holen heute.
Als ich mich von Hubert verabschiede, habe ich ein ungutes Gefühl. Ewa fragt mich, was ich heute noch vorhabe.
«Was ich vorhabe? Nicht viel», antworte ich, «vielleicht ein bisschen Hausarbeit.»
«Auch ich», sagt Ewa und lacht, als hätte sie einen guten Witz gemacht. Hätte ich Geschwister, ließe sich die Hausarbeit mit ein bisschen Streit gerecht aufteilen, aber so bleibt, nachdem Papa seit Jahren weg ist, alles an mir hängen.
Mama schreibt schreckliche Listen:
Wäsche aufhängen.
Glas zum Container bringen.
Katzen-Klo reinigen.
Einkäufe – siehe Zettel
Wobei, ganz ehrlich: Ich mag ihre Listen. Sie halten mich vom Lernen ab.
3
Wenige Stunden später, ich will gerade unter die Dusche, kommt eine Nachricht von Ewa:
Hubert Spittal. Ewa.
Verdammt. Ich denke, dass man Spital mit einem T schreibt und wie gleichgültig Rechtschreibung sein kann und dass Hubert sich im Spital nicht zurechtfindet, weder mit Doppel-T noch mit einem. Schlecht. Ganz schlecht. Ich rufe Kevin an: «Hubert ist im Krankenhaus. Kannst du mitkommen?»
«Sorry, aber da bin ich der Falsche. In Krankenhäusern wird mir übel», höre ich ihn sagen.
Ich erkläre der Nachtschwester, dass Hubert ohne sein Wohnzimmer nicht funktioniert. Sie verweist auf den diensthabenden Arzt und fragt, wer ich bin. Gute Frage, denke ich, lese den Namen auf ihrem Namensschild und habe ihn im selben Augenblick vergessen. Ich verdränge das Bild, wie ich sterbend auf der Straße liege, und während die Krankenschwester Fachausdrücke wie Steine in meine Welt wirft, fühle ich, wie Tränen über meine heißen Wangen rinnen. «Ich bin die Bezugsperson von Herrn Raichl», sage ich, «seine Tochter ist verreist und seine Pflegerin spricht wenig Deutsch.» Ich gebe meine Handynummer an, nehme ein Taschentuch entgegen und warte. Ich spüre den Impuls, meine Handflächen auf mein Herz zu legen, aber das traue ich mich nicht. Ich male mir aus, wie der Diensthabende reagiert, wenn ich ihm sage, dass ich vor ein Auto laufe, wenn er Hubert sterben lässt. Im nächsten Moment fühle ich eine Hand auf meinem Rücken: «Sorry, hab Stuss geredet, tut mir krass leid.»
Erleichtert lege ich den Kopf an Kevins Schulter.
Der Diensthabende ist ein Kind, zumindest sieht er so aus. Hubert würde sein Leben niemals diesem Kind anvertrauen. Ich wische meine Tränen ab und richte mich auf. Jetzt sind wir gleich groß, wobei der Arzt die deutlich besseren Karten hat. Er muss nicht weinen. Ich fühle mich klein, sogar Kevin ist größer. Wie angeklebt liegt Kevins Hand auf meiner Schulter.
Da liegt er. Sanftes Licht fällt auf die Bettdecke. Sein Gesicht, irgendwo in der Dunkelheit – wie sein gelebtes Leben. Kevin sagt, er warte draußen. Ich nicke, hebe lautlos einen Stuhl ans Bett und setze mich.
«Ich bin es», sage ich und greife nach seiner Hand. Meine kalt. Seine heiß. Etwas stimmt nicht. Jemand legt einen Fels auf meine Brust. Immer, wenn etwas nicht stimmt, sehnt man sich nach Alltäglichem. Ich taste nach dem Puls an seinem Handgelenk. Sein Puls geht schnell, zu schnell. Tachykardie nennt man das, habe ich gelesen.
Kevins Leier kommt mir in den Sinn. «Wir sind zu schnell, zu hohe Frequenz», sagt er immer, «wie 5G, viel zu schnell, wir alle.»
Tachykardie, klingt schön. Generell klingen Diagnosen schön. Diabetes zum Beispiel könnte ein Stadtteil oder Tonsillitis könnte eine Pflanze sein, eher eine seltene als eine gewöhnliche. Sogar Influenza klingt zauberhaft. Hätte man mich als Kind gefragt, ob ich Influenza möchte, hätte ich viel davon gewollt. Selbst Myokarditis klingt nicht übel. Kennt man jedoch die Bedeutung, will man nichts davon. So oder so sind Diagnosen nicht von Vorteil. Ist wie mit den Hurrikanen, die will auch keiner, obwohl sie schöne Namen haben.
Acht Tage lang hat Hubert auf der Inneren gelegen, bis die Ärzte sich einig waren, dass er in häuslicher Betreuung besser aufgehoben ist. Hat ihm nicht gutgetan, der Ausflug ins Krankenhaus. Sagt ja schon der Name, dass dort nichts besser wird. Wer Augen im Kopf hat, sieht, dass Hubert stirbt. Jeden Tag wird er weniger. Nur mehr Haut und Knochen. Zudem scheint eine höhere Instanz die Löschtaste in seinem Gehirn zu bedienen.
Worte weg.
Fertigkeiten weg.
Erinnerungen weg.
Er macht auf Rückzug. Vielleicht verstehen wir uns deshalb so gut. Wir haben mehrere Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel halten wir uns nicht an Vorgaben. Wir stochern auch nicht in der Vergangenheit herum und wir machen keine Pläne für die Zukunft.
4
Dank der Nachmittage bei Hubert ist meine Woche gut strukturiert. Gegenüber meinen Klassenkameraden bin ich da klar im Vorteil. Ich brauche nicht zu überlegen, was ich mit meiner Zeit anfange.
«Man braucht eine Aufgabe, nicht wahr, Hubert», sage ich und zupfe an seinem Hemdkragen.
«Weg da», zischt er.
«Was ist mit dir?», frage ich.
«Aus dem Weg!» Er drängt mich beiseite. «Ich muss zum Fotografen.»
«Was willst du beim Fotografen?»
«Blöde Frage, mein Personalausweis wurde geklaut», zischt er, während er die Taschen seiner Jacke umstülpt.
Anfangs hatte ich keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Mittlerweile checke ich ein, schaue, wo der Schuh drückt, und finde Lösungen. Definitiv effektivere Lösungen als die anderen. Eigentlich ist es simpel. Entweder man taucht ein in seine Welt oder man lässt es bleiben. Gegen ihn zu arbeiten ergibt keinen Sinn, ihm etwas aufzudrängen, erst recht nicht. Ist wie beim Surfen, man geht mit der Welle. Wenn ich da an Ewa denke, wie sie den Kopf schüttelt, dass er ihr beinahe vom Hals fällt: «Macht, was will, macht, was will.»
«Logisch, macht, was will», sage ich, «ich mache auch, was will. Wir alle sollten macht, was will machen.»
Mittwochs gibt es seltener Zwischenfälle. Vielleicht liegt es daran, dass Hubert jahrelang mittwochs seinen freien Tag hatte. Wir sitzen in der Puppenküche. Puppenküche deswegen, weil ich von der Eckbank aus mit meinem großen Zeh den Einschaltknopf des Geschirrspülers bedienen kann. Wir schälen Gurken. Genauer gesagt, ich schäle Gurken. Hubert macht keine Hausarbeit. Hat er nie gemacht, hat alles Rosalie gemacht. Ewas Freundin Wanda hat einen Berg Gurken geerntet, die Ewa einwecken will.
«Man kann im Mai Gurken ernten?», frage ich.
«Wanda hat Gewächshaus», erklärt Ewa, «kommt Knoblauch, Karotte, Salz, Pfeffer, Lorbeerblatt, Wacholderbeeren, Senf und Essig.»
Hubert sitzt neben mir und blättert in der Tageszeitung. Der Geschirrspüler gurgelt. Es riecht nach Salbei, den Ewa in großen Büscheln mit roten Schleifen aufgehängt hat.
«So viel?», frage ich.
«Muss», sagt sie mit strengem Blick.
Meiner Meinung nach könnte man sich das Jahresabonnement für die Tageszeitung sparen. An der gestrigen Zeitung vom Nachbarn wäre alles dran, was Hubert braucht. Das Entscheidende an der Tageszeitung ist, dass Huberts Gesichtszüge weich werden, wenn er darin blättert. Alle paar Minuten schaut er hoch, rückt seine Lesebrille zurecht und horcht.
«Erwartest du jemanden?», frage ich.
«Meine Frau», sagt er und deutet zur Wohnungstür.
«Wo ist sie denn?»
«Einkaufen, müsste jeden Moment da sein.»
Dass Rosalie vor sieben Jahren verstorben ist, sage ich ihm nicht. Auf mich wirkt er, als wäre seine Welt in Ordnung.
Hausarbeit, die nicht er macht.
Das Rascheln der Zeitung.
Das Gurgeln des Geschirrspülers.
Das Warten auf Rosalie.
Laut Huberts Tochter waren ihre Eltern ein glückliches Paar. Jetzt, da Hubert die Frau auf dem Hochzeitsfoto nicht mehr erkennt, lässt sich das schlecht überprüfen. Im Grunde hat das mit dem Vergessen auch Vorteile. Nehmen wir an, so ein Rosenkrieg, wie ihn Mama erlebt hat, oder nehmen wir an, der Tag mit dem Auto wäre kommenden Frühling. Dann hätte Mama im Alter von zweiundvierzig eine Scheißscheidung hinter sich und die einzige Tochter durch Selbstmord verloren. Könnte sie diese ganze Tortur vergessen, wäre das Wellness pur, nicht wahr?
5
Bestimmt ist es nicht leicht für Ewa, so weit weg von daheim und Tag und Nacht mit Hubert zusammen zu sein – Knochenarbeit, wirklich! Trotzdem entscheide ich mich für eine klare Ansage: «Wenn du ihm noch einmal sagst, dass Rosalie tot ist, erzähle ich seiner Tochter, dass du ihn Punkt zwölf zum Essen zwingst und ihm die Schlaftablette um sechs statt um acht gibst.»
«Aber muss wissen», sagt Ewa.
«Muss gar nichts wissen», sage ich, «lass ihn in Frieden.»
Und während ich das Wohnzimmer mit großen Schritten verlasse, fällt mir ein, wie ich Ewa unter Druck setzen kann. Entschieden mache ich kehrt: «Sonst kannst du deinen Bonustag vergessen.»
Ewas Augen werden groß.
«Es reicht, wenn man einmal im Leben vom Tod seiner Frau erfährt. Das muss bei Gott nicht täglich sein!»
«Und Bonustag?» Ewa schaut wie ein Lamm.
«Kein Bonustag», zische ich.
Jeden zweiten Mittwoch ist Bonustag. Am Bonustag betreue ich Hubert eine Stunde länger als sonst, während Ewa ihre Freundinnen Wanda und Aleksandra trifft.
Kaffee trinken.
Handarbeiten.
Haare färben.
Nägel malen.
Schminktipps tauschen.
Internetgeschäfte.
Oft sagt Ewa, ihre Freundinnen seien Gold wert und dass beide einen besonderen Platz in ihrem Herzen haben.
Unglaublich, wie viele Menschen in Ewas Herz Platz haben, denke ich.
Die drei Freundinnen haben ein ähnliches Schicksal.
Wanda, gelernte Kfz-Mechanikerin, Firma kaputt.
Aleksandra, gelernte Kosmetikerin, Firma kaputt.
Ewa, Näherin, Firma kaputt.
Heute hat Ewa mich gebeten, eine halbe Stunde früher hier zu sein. In beiden Händen hält sie vollgestopfte Stofftaschen. Wer weiß, was sie wieder vorhat. «Musst du gleich los?», frage ich.
«Bisschen zu früh», sagt sie und lächelt.
Am Bonustag sieht man Ewa ihr Glück an.
«Die Internetgeschäfte laufen?», frage ich, während Ewa einen aufklappbaren Spiegel aus ihrer Handtasche hervorholt. Ewa nickt und beginnt, mit kleinen zupfenden Bewegungen ihre Wimpern zu sortieren.
«Die Menschen kaufen von Hand bestickte T-Shirts?»
«Viele, viele», antwortet sie und zieht ihre Mundwinkel bis zu den goldenen Kreolen an ihren Ohren. Ich schüttle den Kopf und nutze Ewas gute Laune für ein bisschen Konversation.
«Und dein Freund? Wie war noch mal sein Name?»
«Marek», sagt sie, «Marek Dabwroski.»
«Was macht ihr, wenn ihr euch in Polen trefft?»
«Spazieren, tanzen, kleine Reise, Sex nicht», sagt sie.
Ich versinke im Boden.
«Bin ledig, weil vegetarisch», sagt Ewa.
«Das ist doch Blödsinn, Ewa. Ich kenne niemanden, der so wunderbar Naleśniki bäckt und so akkurat Ordnung hält, wie du das machst. Der Mann, der dich bekommt, der kann sich glücklich schätzen.»
Ewa richtet sich auf und lächelt verlegen.
«Was hast du eigentlich gelernt, Ewa?»
«Erste-Hilfe-Kurs.»
«Und sonst?»
«Nix.»
«Nichts?»
«Näherin bei Firma, aber Firma kaputt.»
«Kam der Pleitegeier?»
«Warum Vogel?»
«Ach, vergiss es.»
Ewa positioniert sich breitbeinig, zeigt mir ihre Handflächen und sagt: «Hände, Gehirn und gesundkern.»
Ich lache laut, gehe auf sie zu und nehme sie in meine Arme.
«Kerngesund, Ewa, das heißt kerngesund.»
Ewa wird fünf Zentimeter kleiner und weint.
6
«Hilf mir doch mal», sage ich zu Hubert und lege ihm einen grünen Tupperware-Schäler in die rechte und eine mittelgroße Kartoffel in die linke Hand. Er dreht und wendet den Schäler, beschaut ihn genau, legt ihn wie ein rohes Ei auf den Tisch, kullert die Kartoffel hin und her, bringt sie neben dem Schäler zum Liegen und breitet behutsam die Zeitung darüber, als würde er ein Kind schlafen legen. «Was soll das denn», schimpfe ich und komme mir im nächsten Moment dumm vor. Könnte er mir erklären, was das soll, wäre ich zu Hause, Ewa bei Familie XY und der Nachtfalter könnte seine Flügel ausbreiten.
Vorgestern hat Huberts Tochter geweint. Man hat ihr angesehen, wie elend ihr zumute war. Ich habe mitbekommen, wie sie zu ihm sagte, sie meine, alles im Griff zu haben, aber es fühle sich verdammt noch mal nicht so an. «Sag doch auch mal was!», hat sie Hubert angeschrien, aber der war gerade damit beschäftigt, einzelne Trauben in ein Teeglas zu werfen. Sie war in die Küche gelaufen, Schultern bis zum Boden und tausend Tränen. Ich wollte zum Kühlschrank, machte auf der Schwelle kehrt, aber irgendwie war ich schon mittendrin im Schlamassel. So, wie sie drauf war, konnte ich sie nicht allein lassen. Gemeinsam haben wir Löcher in den PVC-Boden gestarrt. Irgendwann habe ich meine Hand auf ihre Flügel gelegt und ihr ein: «Ach, Linda, alles Scheiße», entlockt.
Jetzt nimmt Hubert die Zeitung, faltet sie, steht auf und öffnet nach und nach alle Küchenladen.
«Suchst du etwas?», frage ich.
Keine Antwort.
«Ich mache ein Glas Holunderblütensaft für dich. Selbst gemacht von Ewa», sage ich, verdünne den Sirup mit Wasser, schlecke das klebrige Zeug von meinen Fingern und halte ihm das Glas hin.
«Danke für den Durst», sagt Hubert und nimmt das Glas.
«Ach, Hubert», ich schüttle den Kopf, «du bist der Größte, der Größte von allen.»
Er stellt das Glas weg, ohne einen Schluck genommen zu haben.
«Hast du einen Clown gefrühstückt?», frage ich Hubert, als er gleich darauf das Fenster öffnet und eine Banane aufs Fensterbrett legt.
«Wo ist der Chef?», lautet seine Gegenfrage.
«Keine Ahnung, wo der Chef ist», sage ich, «der kann es sich leisten, sich in Luft aufzulösen. Chef sollte man sein.»
Ich nehme einen Apfel, öffne das Fenster und lege ihn neben die Banane. Apropos Fenster. Eine Sechsundneunzigjährige hat sich aus dem Fenster gestürzt, im Haus gegenüber. Tatsache, aus dem dritten Stock, vor drei Wochen. Leider war ich in der Schule.
Ende der Vorstellung.
Aus die Maus.
Niemand weiß, wie sie das gemacht hat. Ewa hat mir ihr Handy unter die Nase gehalten, Google Translate: Einsamkeit. Und dann hat sie herumgeschrien: «Menschen schlecht, arme Frau, arme Frau, Menschen schlecht!»
Hubert hat misstrauisch auf die schreiende Ewa geschaut. Ich habe mich ganz nah zu ihm gesetzt, in der Hoffnung, beruhigend auf ihn einzuwirken. Alles hat ein Ende, habe ich gedacht und meine warme Handfläche auf meinen Säbelzahntiger gelegt.
Manchmal schaue ich in Klein-Polen vorbei. So nenne ich Ewas Zimmer. Ihre Welt ist leicht zu durchschauen. Nach dem Fenstersturz waren fünf neue Vokabeln an ihrer Pinnwand:
Isolation
Rote Bete
anzünden
Katastrophe
Seele
Überhaupt ist Ewa nach dem Fenstersturz zwei Wochen in der Wohnung geblieben, hat keine Messe gehört, keinen Kuchen gebacken und sich nicht geschminkt.
«Er braucht eine Strickjacke», sage ich. Ewa verzieht keine Miene. Sie plagt sich mit dem WLAN. Vielleicht wäre Hubert in einem Pflegeheim besser aufgehoben. Er wäre von mehreren Betreuern umgeben und der eine Betreuer würde dem anderen auf die Finger schauen und bestimmt gäbe es zwei, drei Pflegerinnen, die mit Hubert auf dem Balkon rauchen würden. Hier gibt es nicht mal einen Balkon. Von einer stationären Einrichtung will der Nachtfalter nichts wissen. «Ein Seniorenwohnheim kommt überhaupt nicht infrage», sagt sie. Wir halten an Plan A fest. Plan A bedeutet: Existenzsicherung für Ewa und ihre Eltern, Taschengeld für mich, frieren in häuslicher Umgebung für Hubert. «Er braucht eine Strickjacke», wiederhole ich. «Ihm ist kalt.»
Ich stehe vor dem Kleiderschrank, öffne blitzschnell beide Schranktüren zeitgleich, als wollte ich jemanden überraschen. Die theatralische Inszenierung banaler Handlungen hält mich bei Laune. Stapelweise grau und grün. Ich zähle neun Strickjacken, hebe den Stapel hoch und greife nach der untersten. Gerechtigkeit muss sein.
Ich helfe Hubert in die Jacke, die dem Bademeister vor zwanzig Jahren gepasst hat. «Zuknöpfen», sage ich, positioniere mich vor ihm und zähle: «Eins, zwei», die Holzknöpfe gleiten durch meine Finger in die ausgeleierten Knopflöcher, «drei, vier.»
Zählen ist unsere Leidenschaft. Zählen ergibt Sinn. Wir zählen Schritte, Erbsen, Münzen. «Und fünf», sage ich.
«Und fünf, genau», wiederholt Hubert.
«Wenn deine Tochter anruft, sage ich, ich habe dich in der Jacke verloren.»
Hubert zieht die Augenbrauen hoch.
Ich kremple seine Ärmel um: «Zwei, drei.»
«Vier, fünf», sagt er.
Mit Strickjacke ist er ein anderer. Nur ich ziehe solche Rückschlüsse. Ich finde, Ewa und der Nachtfalter machen einen entscheidenden Fehler. Sie schließen von sich auf Hubert, dabei ist jeder Mensch ein Universum. «Beobachten ist der Schlüssel», sage ich zu Ewa und zeige mit meinem Zeige- und Mittelfinger auf meine Augen und dann auf Hubert, «ist dir aufgefallen, dass er mit Jacke länger sitzen bleibt, mehr isst und freundlicher antwortet?», frage ich.
Ewa nickt. Ich murmle vor mich hin, dass ich mir das alles nur einbilde.
«Die Jacke ist fast so alt wie du», sage ich. Hubert hat keine Ahnung, wie alt er ist. Vorhin hat er behauptet, seine Mutter sei fünfundsiebzig. «Willst du nicht nachrechnen, Hubert? Du bist sechsundachtzig und deine Mutter ist fünfundsiebzig?»
Er bleibt dabei. Stur wie Ewa.
7
Vorgestern im Deutschunterricht, ich war zu müde, um eine blöde Zusammenfassung über einen noch blöderen Zeitungsartikel über soziale Medien und Fake News zu schreiben, war mir die Schachtel mit den Schwimmflügeln in den Sinn gekommen. Und nachdem wir heute überall gesucht haben und auch Ewa keine Ahnung hat, wo wir sonst noch suchen könnten, bleibt mir nichts anderes übrig, als den Nachtfalter anzurufen.
«So groß ist die Wohnung doch gar nicht», sage ich zu Ewa, «Samstag hin oder her, wir rufen sie jetzt an.»
Ich lehne an der Küchenzeile und stelle das Handy auf Lautsprecher. Es klingelt einige Male, bis sie rangeht.
«Linda?», höre ich ihre Stimme. Bevor ich antworten kann, fragt sie, was wir machen und ob es ein Problem gibt.
«Ewa kocht vor», sage ich.
«Und was gibt es? Fleisch?», will sie wissen.
Jetzt wirft Ewa fünf Tomaten in einen Topf, schnaubt und packt den Kopfsalat, als wollte sie ihm etwas antun. Das eigentliche Problem ist, dass Hubert Fleisch liebt, Ewa Fleisch nicht anrührt und der Nachtfalter behauptet, Ewa könne Fleisch auch gar nicht zubereiten.
«Für meinen Vater ist Gemüse kein Essen», sagt sie.
Ich frage mich, wo diese Unterhaltung hinführen soll.
«Und wie reagiert er, wenn es kein Fleisch gibt?», hakt sie nach.
«Er sagt, wir sollen den Fraß selber fressen.»
«Das sagt er?»
«Genau das sagt er», antworte ich.
«Und was gibt Ewa ihm, wenn es ihm nicht schmeckt?» Ich stupfe Ewa aufmunternd mit meinem Ellbogen und verdrehe die Augen: «Na, Streichwurstbrote.»
«Aber davon kann man doch nicht leben.»
«Hubert schon», sage ich, «eigentlich wollte ich nur fragen, wo die Schachtel mit den Schwimmflügeln hingekommen ist.»
«Schwimmflügel? Ich glaube, die sind im Keller.»
«Warum im Keller?»
«Wofür braucht ihr sie denn?»
Ich seufze, bedanke mich und lege schnell auf.
«Wie viele?», fragt Hubert, als er die Schachtel sieht.
«Elf», antworte ich. Hubert stellt sich neben mich, vergräbt die Hände in den Hosentaschen und atmet tief aus, als ich die Schachtel öffne.
Original BEMA-Schwimmflügel, orangefarben, in unterschiedlichen Größen. Hubert knöpft seine Strickjacke auf, in einer Geschwindigkeit, als wäre es ein Klacks für ihn, und wirft die Jacke mit der Lässigkeit eines Zwanzigjährigen über den Polstersessel. Er reibt die Handflächen aneinander: «Wie viele?»
«Elf», wiederhole ich, «sieben Mädchen, vier Buben.»
«Alter?»
«Zwischen vier und sechs.»
«Unter 30 kg?»
«Alle unter 30 kg.»
Hubert nickt: «Größe 0 für alle.»
«Soll ich helfen?», frage ich.
Entrüstet schaut er mich an.
Jetzt ist Hubert Bademeister. Ein leiser Wind säuselt durchs Wohnzimmer. Kindergeschrei. Es riecht nach Chlor und Sonnencreme. Hubert sortiert Schwimmflügel nach Größen, überprüft ihre Funktionalität, pumpt sie auf und grinst, als hätte er in der Lotterie gewonnen. Ich bringe ihm sein weißes Cappy und setze es behutsam auf seinen Kopf.
«Wegen der Sonne», sage ich und schaue zur Wohnzimmerlampe hoch. Hubert bedankt sich und gibt mir ein Handzeichen, ich soll verschwinden. Weil ich mich nicht augenblicklich in Luft auflöse, rücken seine Augenbrauen eng aneinander. «Aus dem Weg», knurrt er.
«Alles bestens, Hubert», sage ich, ziehe mich zwei Schritte zurück und versuche den Augenkontakt mit ihm zu halten. «Deine Arbeit ist eine ernst zu nehmende Angelegenheit, nicht wahr?» Hubert nickt langsam und rückt sein Cappy zurecht. «Die Sicherheit der Badegäste ist entscheidend, besonders die der kleinen Gäste. Habe ich recht?», frage ich.
«Bei mir ist nie ein Kind ertrunken», sagt er prompt, «einmal war es knapp, aber ertrunken ist keines.»
In Gedanken wiederhole ich das oft Gehörte: Das Entscheidende an BEMA-Schwimmflügeln ist der ergonomisch geformte Steg zwischen den aufblasbaren Kammern an der Unterseite. Dadurch ergibt sich die Bewegungsfreiheit für die Schwimmschüler. Hat Hubert mir immer wieder erklärt, kann ich auswendig. Sollte ich Mathe nicht schaffen, geben die mir bestimmt eine Anstellung in der Schwimmflügelbranche.
Eine Stunde später sitzt Hubert erschöpft im Polstersessel. Elf Paar Schwimmflügel stehen am Rand des Teppichs Spalier.
«Gute Arbeit», sage ich. Hubert nickt zufrieden. Ich gebe ihm einen der Schwimmflügel. Er drückt gegen die Oberfläche, prüft die Ventilverschlüsse und legt den Schwimmflügel auf seine Oberschenkel.
«Gute Erfindung», sage ich und deute auf seinen Schoß. Das ist Huberts Stichwort, um mir die ganze Geschichte zu erzählen. Die ganze Geschichte von Bernhard Markwitz, der ausgebildeter Rettungsschwimmer war und der, nachdem seine Tochter im Alter von drei Jahren beinahe ertrunken wäre, Schwimmhilfen für die Arme erfand. Schwimmhilfen, die die ganze Welt eroberten.
«Woher kam dieser Markwitz?», frage ich.
«Hamburg», sagt Hubert, «gutes, altes Hamburg.»
«Warst du mal in Hamburg?»
«Ja, auf der Jahreshauptversammlung.»
«Ach, Hubert, du und deine Geschichten», sage ich, «möchtest du vielleicht einen Apfelkuchen, noch lau, ganz frisch.»
«Um Gottes willen, nein», sagt er, «Kuchen habe ich zu Hause.»
8
Bei den ersten Treffen habe ich mit Hubert stundenlang in Fotoalben geblättert. Das mit den Fotoalben war die Idee seiner Tochter. Da können wir ja gleich ein Familientreffen organisieren und ihn zwischen zwanzig Menschen setzen, bis er abdreht. Was soll das bringen? Schon damals hat er niemanden erkannt, und bei jedem Umblättern lag eine Anspannung in der Luft, als wollten die grinsenden Gesichter auf den Fotos erkannt werden. Warum sollte er die Menschen plötzlich erkennen, wo sie doch in seinem Hirn verloren gegangen sind? Totaler Mist. Mittlerweile weigere ich mich, mit ihm Fotoalben anzusehen. Es wäre besser, die Alben in den Keller zu tragen anstatt der Schwimmflügel. Soll einer die Welt verstehen. Für alle, die das nicht begreifen, empfehle ich, den eigenen Kopf aufs Fensterbrett neben unser Obstsortiment zu legen. Das Einzige, was ich damals richtig gemacht habe bei der Aktion mit den Fotoalben, war, dass ich gesagt habe, dass auch ich mir keine Namen merken kann. Doch Hubert war ohnehin der Schlauere gewesen. Er hat mit seiner Armbanduhr gespielt, die schon damals locker an seinem Handgelenk hing, und auf das Ziffernblatt getippt, als müsste er zu einem Termin. Jahreshauptversammlung, wahrscheinlich.
Heute weiß ich, dass Hubert und ich tatsächlich im selben Boot sitzen. Er weiß genauso wenig wie ich, worauf er zusteuert. Vorhin wollte er eine Karotte toasten und vorgestern, als ich sagte, er solle seine Suppe essen, hat er gemeint: «Wollen Sie die Suppe essen?» Und als ich ihm erklärte, wir seien per Du und er solle die Suppe essen, solange sie warm ist, meinte er, das habe er am Vortag bereits erledigt.
Überhaupt war vorgestern ein verrückter Nachmittag. Als ich ihn nach seiner Tochter fragte, behauptete er, er habe nie eine Tochter gehabt. Wie gut, dass der Nachtfalter nicht da war. Manchmal lache ich, weil seine Antworten derart komisch sind. Immer öfter jedoch bleibt mir das Lachen im Hals stecken. Hubert weiß nie, was als Nächstes zu tun ist, und er weiß weder, wer zu ihm gehört, noch, ob er zu jemandem gehört. Genau genommen hängt er in der Luft, und in der Luft zu hängen – darin bin ich Expertin – macht wirklich keinen Spaß.
Kann sein, dass ich das mit den Fragen bald einstellen werde. Immer öfter wird Hubert wütend, wenn ich ihn etwas frage.
«Wie alt bist du?», frage ich.
«Fünfzig», antwortet er.
«Und wie alt bin ich?», frage ich weiter.
Er schaut mich prüfend an: «Fünfzig.»
«Danke für die Blumen», sage ich. Und gleich darauf meine Lieblingsfrage: «Wie alt ist deine Mutter?»
«Alt genug, heiliger Bimbam», zischt er, greift nach dem Kugelschreiber, der hinter seinem Ohr klemmt, und wirft ihn an die Wand.
Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, schiebe ich ihm meinen Geografietest über den Tisch. «Kannst du das hier unterschreiben?»
Er greift hinter sein Ohr und fährt sich verlegen durchs Haar.
«Hier, nimm meinen», sage ich und gebe ihm meinen Lamy Al-star. Hubert kritzelt irgendwas auf meinen Geografietest.
«Danke, Hubert, das ist voll nett von dir.»
9
Heute früh wurden Ewa zwei Weisheitszähne herausoperiert. Klingt so, wie es aussieht. Ewas Gesicht ist ein Vollmond, mehrfarbig.
Deswegen soll ich hier übernachten. Das habe ich so oft gemacht wie Hubert Hausarbeit, nämlich nie. Was ich nachts hier soll? Keine Ahnung. Ewa versteht es auch nicht. Und der Nachtfalter? Sie besteht darauf, weil Ewa sich nach der Kieferoperation ausruhen soll. Schon vergangene Woche hatten wir deswegen eine Diskussion.
«Wegen bisschen Operation an Zähne», hatte Ewa gesagt und den Kopf geschüttelt.
«Mir völlig egal», hatte ich erwidert, «ob ich im dritten oder im ersten Stock schlafe.»
«Wir machen es so, wie ich es sage», hatte der Nachtfalter die Diskussion beendet.
«Ich kann die Würfelmatratze vorbeibringen», schlägt der Nachtfalter am frühen Abend am Telefon vor.
«Lass nur, wenn Hubert im Polstersessel schlafen kann, kann ich das auch», sage ich mit kräftiger Stimme und zwinkere Ewa zu, die einen Eisbeutel, der in einer löchrigen Socke steckt, an ihre Wange hält.
«Fünfzig Euro?», fragt der Nachtfalter. Ich ziehe eine stumme Grimasse.
«Zu wenig?», hakt sie nach.
«Nein, nein, fünfzig ist okay», antworte ich, so emotionslos wie möglich, und schwinge meine geballte Faust in die Luft. Fünfzig Euro für eine Nacht bei Hubert. Laut Ewa gibt es nachts nichts zu tun.
«Schläft wie Stein», behauptet sie, «nie munter vor sieben.»
Ich schicke Kevin eine WhatsApp-Nachricht: Habe Nachtdienst, beaufsichtige einen Stein und seine polnische Pflegerin für fünfzig Euro. Geil.
Zehn Sekunden später Kevins Kommentar: Nachts hat es der Planet leichter, weil sein Feind schläft. Lass uns die fünfzig Euro teilen.
Witzbold!!! Wie viele Weisheitszähne hat man? schreibe ich zurück.
Am meisten mag ich Hubert, wenn er diesen Ich-kenne-mich-nicht-aus-Blick hat. Dann feiere ich ihn richtig. Ich lege meinen Kopf auf die Armlehne des Polstersessels, in dem er sitzt, schmiege meine Wange an den groben Stoff und rieche diesen modrigen Geruch, den es bei mir zu Hause nicht gibt. Ich grabe meine linke Hand in den Spalt zwischen Lehne und Sitzfläche und mit meiner rechten Hand halte ich mich an Huberts Strickjacke fest. Ich mag es, dass Hubert mir vertraut, und ich bin mir sicher, er fühlt, wie gut ich es mit ihm meine. Dass auch er es gut mit mir meint, das weiß ich einfach. Ihm kann ich alles erzählen. Ihm sage ich, dass Mama, die Schulkollegen, die Lehrer mich nerven. Und ich erzähle ihm, wie sehr ich mich bemühe und wie anstrengend es ist, sich zu bemühen. «Das verstehst du doch, Hubert, nicht wahr?», sage ich, «dein Tag ist ja auch oft anstrengend.» Ich erzähle ihm brühwarm, dass ich nicht mehr leben will. Selbst dann noch bleibt Hubert entspannt. Ihn brauche ich nicht zu schonen, für ihn sind alle Worte gleich.
«Alle drei habt ihr zwölf Stunden geschlafen?», fragt Kevin erstaunt, als ich ihm von meinem Nachtdienst bei Hubert erzähle.
«So gut habe ich lange nicht mehr geschlafen», antworte ich und denke an den Fünfzig-Euro-Schein in meiner Handyhülle. Ich erzähle, wie witzig es vor dem Zubettgehen war und dass Hubert sich im Nachhinein an nichts erinnern wird, weil die Löschtaste in seinem Kopf immer mehr die Oberhand gewinnt.
«Von nichts zu wissen, ist eine angenehme Art, durchs Leben zu kommen», sagt Kevin. «Unwissend sind die meisten», behauptet er und deutet auf das Klassenfoto, das auf seinem Schreibtisch liegt.
Ich stütze mich mit beiden Händen ab und betrachte eingehend das Foto. Zwei von fünfundzwanzig Jugendlichen lächeln. Kein guter Schnitt, denke ich mir.
«Alles Loser. Keiner von denen könnte deinen Hubert betreuen», sagt Kevin.
«Wie kommst du darauf?»
«Na, kein Feingefühl. Kein Benehmen. Null Kreativität. Eben Loser.»
«Alle?», frage ich.
Kevin nickt.
Ich bin froh, dass Kevin mich nicht in den Kreis der Loser reiht und zack, Stempel drauf. Das mit den Stempeln geht ganz schnell, sieht man oft.
Flüchtling, Stempel drauf.
Arbeitslos, Stempel drauf.
Veganer, Stempel drauf.
«Bist du nicht zu streng?», frage ich.
«Bestimmt nicht, eher könnte man eins drauflegen.»
Wenn Kevin über die Menschheit herzieht, fühle ich mich in meinem Plan bestärkt. Ich muss nicht zwingend dabei sein, wenn hier alles den Bach runtergeht. Konsequent wäre es, mich vor dem achtzehnten Geburtstag zu verabschieden. Und ich möchte die Welt ordentlich verlassen. An dem Tag, an dem die Menschen auf meinen leblosen Körper auf der Straße starren, werden meine Haare ordentlich, meine Hausaufgaben gemacht und mein Zimmer aufgeräumt sein. Ich stelle mir die Szene schön vor und es ergibt richtig Sinn für die Passanten. «So ein junges Ding», wird einer sagen, «hat ihr Leben gar nicht gelebt.» Und dann wird er heimgehen und sein Kind umarmen. Ein anderer wird seinen Scheißjob kündigen. Ein Dritter wird nie mehr seine Frau schlagen. Die Welt wird besser werden.