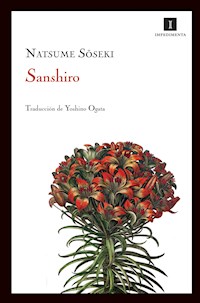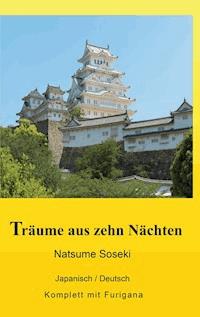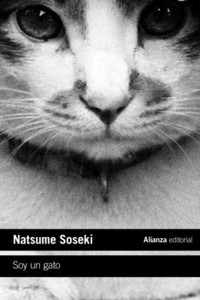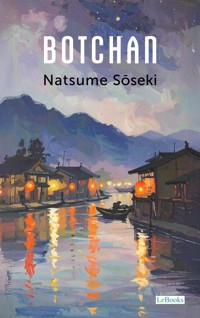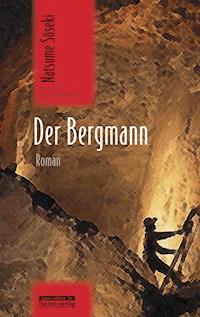
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BeBra Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junger Mann flieht aus seinem wohlhabenden Elternhaus. Verzweifelt und lebensmüde sucht er eine Möglichkeit, aus der Welt zu verschwinden – und findet sie, indem er sich zur Arbeit in einem Bergwerk verpflichtet. Das harte Leben unter Tage erweist sich als Wendepunkt in seinem Leben. Noch vor James Joyce, Marcel Proust und William Faulkner beschreibt Natsume Sōseki minutiös die Wahrnehmungen und Gedanken seines jugendlichen Antihelden. Was ist Identität? Worin besteht der eigene Charakter? Wer oder was trifft meine Entscheidungen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Natsume Sōseki
Der Bergmann
Aus Anlass des 100. Todesjahres von Natsume Sōseki (1867–1916).
Das Erscheinen dieses Buches wurde ermöglicht durch die großzügige finanzielle Unterstützung des Herausgebers.
japan edition
herausgegeben von Eduard Klopfenstein, Zürich
Die Schreibweise der japanischen Namen wurde in ihrer ursprünglichen japanischen Gestalt belassen, also erst der Familienname, dann der persönliche Name.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
Japanischer Originaltitel: Kōfu
Erstveröffentlichung des japanischen Originals 1908
ebook im be.bra verlag, 2016
© der Originalausgabe:
be.bra verlag GmbH
Berlin-Brandenburg, 2016
KulturBrauerei Haus 2
Schönhauser Allee 37, 10435 Berlin
Lektorat: Ingrid Kirschey-Feix, Berlin
Umschlag: Hauke Sturm (unter Verwendung eines Fotos von Gabriel M. Corvian)
ISBN 978-3-8393-2127-0 (epub)
ISBN 978-3-86124-920-7 (print)
www.bebraverlag.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Nachwort
Glossar
Danksagung
1
Eine ganze Weile schon laufe ich durch diesen Kiefernhain, und so ein Kiefernhain zieht sich viel länger hin, als er sich auf Bildern darstellt. Soweit ich auch gehe, nichts als Kiefern. Ich komme hier einfach auf keinen grünen Zweig. Da kann ich laufen, so viel ich will, solange sich bei den Kiefern nichts tut, hab ich keine Chance. Wär schlauer gewesen, ich hätte mich von Anfang an nur hingestellt und sie angestarrt, bis sie als erste wegschaun.
Gestern Abend gegen neun bin ich von Tōkyō los und die ganze Nacht hindurch wie verrückt einfach gen Norden marschiert. Am Ende war ich völlig kaputt. Dann war da weder eine Herberge noch hätte ich Geld dafür gehabt. Im Dunkeln bin ich eine kleine Kagura-Tanzbühne hinauf und hab da ein wenig geschlafen. Wohl ein Hachiman-Schrein.
Als ich vor Kälte aufwachte, war es noch nicht ganz hell. Ich hab mich rangehalten und bin bis hierhergekommen, aber nichts als Kiefern, da verliert man glatt die Lust am Laufen. Meine Beine sind ziemlich schwer geworden. Das Stapfen strengt an, als hingen Eisenhämmer an meinen Waden. Die Enden meines leicht gefütterten Kimonos hab ich natürlich hinten in den Gürtel hochgesteckt. Eine lange Hose trage ich eh nicht, könnte glatt zu einem Wettrennen antreten. Aber gegen all die Kiefern, keine Chance.
Eine Teebude. Im Schatten der angelehnten Schilfrohrmatte eine Kochstelle aus Lehm, darüber ein rostiger Teekessel. Eine Sitzbank ragt knapp zwei Fuß auf die Straße raus, zwei, drei Paar Strohsandalen baumeln von oben herab. Mir den Rücken zugewandt, sitzt da ein Mann in einer wattierten Jacke, von der ich nicht erkennen kann, ist es ein Hanten oder ein Dotera.
Im Vorübergehen unschlüssig, ob ich eine Pause einlegen soll, spähe ich hinein, da dreht sich besagter Mann in dieser Mischung aus Hanten und Dotera plötzlich zu mir um. Lachend entblößt er zwischen dicken Lippen seine vom Zigarettenteer schwarz gefärbten Zähne. Widerlich!, kommt es mir vor, da wird sein Gesicht schlagartig ernst. Gerade eben noch ins fesselnde Gespräch mit der Alten des Ladens vertieft, sieht er sich offenbar beim zufälligen Umwenden unversehens meinem Blick ausgesetzt. Jedenfalls beruhigt es mich etwas, dass mein Gegenüber ernst wird. Doch nicht lange und mir ist schon wieder mulmig. Denn nun beginnen die kalten Augen des mir mit ernster Miene zugewandten Mannes mit unglaublicher Geschwindigkeit von meinem Mund zur Nase, von der Nase zur Stirn bis oben zum Kopf zu gleiten. Kaum hat sein starrer Blick den Scheitel meines Mützenschirms erreicht, beginnt er, sich langsam wieder zu senken. Nun streift er mein Gesicht nur flüchtig, und wie sein Blick von der Brust abwärts bis zum Nabel gelangt, hält er kurz inne. Hier hängt mein Geldbeutel mit dem Metallbügel. Ganze zweiunddreißig Sen sind drin. Seine stechenden Augen bleiben auf diesen Geldbeutel unter meinem weißblauen Kurume-Kimono geheftet, selbst als der Blick unterhalb des Gürtels zu meinen Weichteilen kommt. Von da an abwärts sind nur die blanken Beine. Soviel er auch gaffen mag, da ist nichts Sehenswertes dran. Sie sind nur ein bisschen schwerer als gewöhnlich. Ausführlich wird diese bleierne Schwere angestarrt, bis der Blick schließlich hinab zu den Geta mit dem schwarzen Abdruck der großen Zehen wandert.
Wenn ich das so hinschreibe, klingt es, als wäre ich an einer Stelle verharrt und hätte ihn quasi aufgefordert, na, schaun Sie ruhig mal, aber dem war nicht so. In Wirklichkeit wurde mir der Gedanke, in der Teebude auszuruhn, just in dem Augenblick zuwider, als sich seine stechenden Augen in Bewegung setzten, und ich wollte schleunigst wieder losgehen. Aber dieser Vorsatz schien irgendwie nicht auf klarer Entschlossenheit zu beruhen. Noch bevor ich das Riemenband der Geta zwischen meine Zehen einklemmen und mich umdrehen konnte, war die Bewegung seines starrenden Blicks auch schon vorüber. Leider war er eben schneller. »Von oben bis unten mustern«, das klingt wer weiß wie umständlich, aber falsch gedacht. Mustern, das war das richtige Wort. Ganz die Ruhe selbst, das musste man ihm lassen, und dabei doch wieder unglaublich flink. Während ich doch an der Teebude vorübergehen wollte, dachte ich nur, was für Augen mit eigenartigen Kräften gibt es auf dieser Welt. Hätte ich mich wirklich nicht schneller abwenden können, bevor ich so in aller Ruhe gemustert wurde? Jetzt sah es ganz danach aus, als hätte ich mich, gründlich zum Besten gehalten und fortgeschickt, selber verabschieden wollen. Ich ganz der Gelackmeierte. Der andere stand groß da.
Als ich schließlich doch noch losging, empfand ich während der ersten paar Schritte eine seltsame Wut im Bauch. Aber keine zehn Meter, und das Wutgefühl war verflogen. Dafür wurden mir die Beine wieder schwer – jene eben, an denen je ein Eisenhammer hing; und mit solchen Beinen konnte man keine flinken Bewegungen machen. Nur weil man von jenen Glotzaugen von oben bis unten angegafft wurde, hieß das ja noch lange nicht, dass man ein Dummkopf war. So betrachtet war meine Wut völlig unbegründet.
2
Noch dazu konnte ich es mir gar nicht leisten, mir so eine Lappalie zu Herzen zu nehmen. Ich war von zu Hause ausgerissen, und ich hatte nicht die geringste Absicht, dorthin zurückzukehren. In Tōkyō wollte ich mich um keinen Preis mehr blicken lassen. Ich hatte auch nicht vor, mich auf dem Land einzurichten. Wenn ich pausierte, würden die mich einholen. Aber der Tag, an dem sich das Chaos lichtet, das sich bis gestern in meinem Kopf angestaut hatte, der würde wohl selbst auf dem Lande nicht so schnell kommen. Deshalb ging ich, aber da es ein Gehen ohne festes Ziel war, erschien mir die Welt nur wenige Schritte weit um mich herum verschwommen wie ein schlecht entwickeltes Foto. Noch dazu war nicht abzusehen, dass sich diese Verschwommenheit irgendwann aufklären würde, im Gegenteil, sie breitete sich grenzenlos vor meinen Augen aus. Egal, wie weit ich ging oder rannte, es würde zweifellos mein ganzes Leben lang so bleiben, seien es fünfzig, seien es sechzig Jahre. Ah, unerträglich! Ich ging auch keineswegs, um dieser trüben Aussicht zu entkommen, sondern nur, weil ich das Bleiben nicht aushielt. Ich wusste nur zu gut, dass es kein Entkommen gab, so sehr ich es auch versuchte.
Bereits als ich gestern Abend um neun von Tōkyō aufgebrochen war, hatte ich mir kaum Illusionen gemacht, aber jetzt im Gehen stellte ich fest, dass es das auch nicht sein konnte. Die Beine schwer wie Blei, die Kiefern standen Schlange bis zum Abwinken. Aber Beine hin, Kiefern her, am schlimmsten sah es in meinem Innern aus. Ich hatte keine Ahnung, warum ich ging, und trotzdem, von einer unbändigen Qual getrieben, ertrug ich keinen Augenblick ohne Gehen.
Dabei war mir, ich tauchte, je weiter ich ging, immer tiefer in diese vernebelte Welt ein, ohne je wieder herauszukommen. Wenn ich zurückblickte, dann war das sonnenhelle Tōkyō bereits Vergangenheit. Eine Welt, die ich weder mit Händen noch Füßen je wieder erreichen würde. Gerade so, als wären wir in verschiedenen Welten. Und dennoch, wie zum Hohn lag mir Tōkyō freundlich und heiter vor Augen. Derart hell strahlte es, dass ich ihm fast aus dem Schatten heraus zurufen wollte: »Hey, du!« In Richtung meiner Schritte tat sich hingegen nur düstere Ödnis auf. Schwankend verirrte ich mich darin – eine Ödnis, die sich den Rest meines Lebens vor mir ausbreiten würde – und davor war mir angst und bange.
Unerträglich, wie diese verhangene Welt um mich herum wucherte und meinen Vorsatz lähmte, bis zu meiner Läuterung zu marschieren. Jeder Schritt meiner vor Angst angewurzelten Beine, den ich von Angst getrieben machte, führte einen Schritt weiter in diese Angst hinein. Einerseits von Angst getrieben, andererseits davon gelähmt und wiederum keinen anderen Ausweg habend, als mich zu bewegen; nie mehr würde ich diesem Teufelskreis entkommen, soweit ich auch gehen mochte. Mein ganzes Leben lang würde ich inmitten dieser Angst marschieren. So sehr war alles vernebelt, dass ich mir wünschte, alles würde endlich ganz und gar dunkel werden. Wenn ich dann im Dunkeln immer weiter ins noch Dunklere vordringen würde, verschwände die zurückbleibende Welt in ewiger Finsternis, selbst meinen eigenen Körper würde ich nicht mehr mit eigenen Augen sehen können. Was wäre das für eine Erlösung!
Dummerweise wurde der Weg, auf dem ich ging, weder heller noch dunkler. Bis in alle Ecken hin erstreckte sich ein diffuses Einerlei und aus allen Ecken heraus kroch diese unberechenbare Unsicherheit. Dafür lohnte es sich nicht zu leben, aber anders herum konnte ich mich auch nicht zum Sterben durchringen. Ich wollte und musste einen menschenleeren Ort finden, unter allen Umständen, um dort ganz für mich allein zu leben. Und wenn mir das nicht gelang, sollte ich dann doch …
Eigenartig, selbst bei diesem Gedanken regte sich bei mir kaum noch was. Solange ich in Tōkyō gewesen war, gab es oft Situationen, wo ich drauf und dran war, es zu tun, und jedes Mal fuhr mir der Schrecken in die Glieder. Hinterher erfasste mich stets ein Entsetzen, und nicht selten hatte ich das Gefühl, gerade noch mal davongekommen zu sein. Jetzt hingegen spürte ich mit keiner Faser auch nur die geringste Spur von Schrecken oder Entsetzen. Ich war von einer derartigen Unsicherheit erfasst, da scherten mich Schrecken und Entsetzen einen feuchten Kehricht. Darüber hinaus hatte ich irgendwie das sichere Gefühl, dass jetzt gerade nicht der Zeitpunkt dafür sei. Vielleicht war es morgen oder übermorgen oder gar erst in einer Woche oder schlimmstenfalls niemals, kurz, ich war völlig ratlos. Instinktiv fühlte ich, dass es noch ein weiter Weg war, egal, ob bis zum Kegon-Wasserfall oder bis zum Krater des Asama-Vulkans. Aber bis einer nicht wirklich dort ankommt und es ernst wird, denkt sich keiner was dabei. Da reizte es schon mal, sich den letzten Schritt vorzustellen.
Solange mich aber diese vernebelte Welt nicht derart quälte, wirklich zum Äußersten zu gehen, und immer noch die Hoffnung bestand, davonzukommen, solange gab es auch einen guten Grund, die schweren Beine weiter eins vors andere zu setzen. Ich musste wohl einen Entschluss in diese Richtung gefasst haben. Aber das ist die spätere Analyse meiner psychischen Verfassung. Damals wollte ich einfach nur an irgendeinen dunklen Ort gelangen. Ich hatte das eine Ziel vor Augen: Du musst ins Dunkle. Jetzt kommt mir das ziemlich blöde vor, aber wenn es ums Ganze geht und wir gedrängt sind, den Tod als Ziel anzusteuern, dann wird uns selbst das zu einer Art Trost. Aber ich glaube, dabei muss der Tod noch möglichst weit weg sein. Zumindest trifft das auf mich zu. Denn wenn uns jenes Schicksal des Todes auf die Haut rückt, kann uns das keinen Trost mehr spenden.
3
Ich wollte einfach nur ins Dunkel hinein, ich musste. Mit diesem diffusen Gedanken marschierte ich drauflos, da rief plötzlich aus heiterem Himmel jemand hinter mir: »Hey! Hey!«
Es ist schon eigenartig, wie sehr du auch in Gedanken verloren bist, von hinten angesprochen, reagierst du ganz unwillkürlich. Ich hab mich umgedreht, als wäre nichts gewesen. Es geschah keineswegs in der Absicht zu reagieren. Aber in dem Augenblick, in dem ich mich umdrehte, wurde mir sogleich bewusst, dass ich reagierte. Ich war noch keine vierzig Meter von jener Teebude von vorhin entfernt. Da stand also jener Typ in dieser Kreuzung aus Hanten und Dotera, jetzt auf die Straße getreten, bleckte seine vom Zigarettenteer gefärbten Zähne und rief mir aus Leibeskräften nach. Seit ich gestern Abend aus Tōkyō aufgebrochen war, hatte ich mit keiner Menschenseele mehr gesprochen. Ich hätte auch nicht im Traum daran gedacht, dass mich jemand ansprechen würde. Ja, ich war der felsenfesten Überzeugung, mir fehlte geradezu jede Berechtigung dazu. Nun wurde ich plötzlich von einem freundlichen Gesicht, woraus zugegeben eine recht verwegene Zahnreihe hervorblickte, gerufen und energisch herangewunken, und sobald ich mich gedankenversunken umgedreht hatte, hellte sich schlagartig meine Stimmung auf. Ehe ich mich versah, bewegten sich meine Beine in Richtung auf den Mann zu. Um ehrlich zu sein, weder Gesicht und Aufmachung noch sein Benehmen gefielen mir sonderlich. Besonders nachdem er mich vorhin mit seinen stechenden Augen so unverschämt von oben bis unten gemustert hatte, war in mir etwas wie Abneigung aufgekeimt. Aber die war keine vierzig Meter später verduftet, und es war mir unerklärlich, dass ich jetzt sogar einen Hauch Sympathie empfand. Ich hatte ja gedacht, ich müsse unbedingt ins Dunkle. Indem ich also begann, wieder zum Teestand zurückzukehren, tat ich das genaue Gegenteil meiner ursprünglichen Absicht. Es lief darauf hinaus, dass ich mich wieder einen Schritt von diesem dunklen Ort entfernte. Und trotzdem freute ich mich sogar irgendwie über diese Umkehr.
Ich habe inzwischen die verschiedensten Erfahrungen gemacht, aber derlei Widersprüche sind überall anzutreffen. Das ist nicht nur mein persönliches Problem. Ich bin in letzter Zeit zur festen Überzeugung gekommen, dass es etwas wie Charakter einfach nicht gibt. Oft prahlen Schriftsteller zwar damit, sie würden diesen oder jenen Charakter beschreiben und gestalten. Und dann die Leser, die so tun, als würden sie alles verstehen, indem sie von diesem Charakter hier und jenem da reden. Erstere scheinen sich einen Spaß daraus zu machen, Lügen zu fabrizieren, und letztere sich daran zu ergötzen, diese Lügen zu lesen. Also mal ehrlich, etwas in sich klar Definiertes wie ein Charakter existiert schlichtweg nicht. Das, was da wirklich ist, das kann kein Schriftsteller niederschreiben, und wenn doch, kann man sich drauf verlassen, dass daraus kein Roman wird. Der reale Mensch ist seltsam undefinierbar. Eine derart undefinierbare Materie, dass sogar die Götter ihre liebe Mühe haben, sie in den Griff zu bekommen. Es kann natürlich sein, dass ich nur auf Grund meiner eigenen Undefinierbarkeit vorschnell daraus schließe, alle Menschen wären so wie ich. Das wäre selbstredend ungebührlich.
Wie dem auch sei, beim dunkelblauen Dotera angekommen, rief dieser mit anbiedernder Stimme: »Junger Kerl!«.
Er steckte seinen großen Kinnladen in seinen Kragen und blickte mir ins Gesicht. Da stand ich nun auf meinen beiden braungebrannten Beinen und fragte höflich: »Was gibt es denn?«.
Unter normalen Umständen hätte ich diesem Dotera, der mich hier mit »junger Kerl« abfertigte, keinesfalls so gutgelaunt geantwortet. Ein »Was?« oder ein »Häh?« hätten es da wohl auch getan. Aber in jenem Moment hatte ich das Gefühl, mit dem nun nicht gerade vertrauenerweckenden Dotera menschlich auf der gleichen Stufe zu stehen. Keineswegs hatte ich mich um irgendeines Vorteils willen absichtlich dazu herabgelassen. Und siehe da, auch der Dotera wandte sich im Tonfall von gleich zu gleich an mich.
»Braucht er keine Arbeit?«
Gerade eben noch hatte ich mich damit abgefunden, nichts anderes zu tun, als an einen dunklen Ort zu gehen, da traf mich die Frage nach Arbeit wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Mit stocksteifen Beinen und offenem Mund stand ich da und betrachtete geistesabwesend mein Gegenüber.
4
»Er da! Hat er keine Absicht zu arbeiten? Er wird doch irgendwas arbeiten müssen, oder?«
Der Dotera wiederholte seine Frage. Beim zweiten Mal hatte ich die Situation soweit begriffen, dass ich so recht und schlecht antworten konnte.
»Könnt schon arbeiten«, hörte ich mich sagen. Dass ich überhaupt diese Antwort, nennen wir es eine provisorische Erfindung meines Gehirns, über die Lippen brachte, kurz, mich einigermaßen fassen konnte, erfolgte lediglich aufgrund folgender mechanischer Gedankenreihung.
Ich wusste zwar nicht wohin, aber ich hatte fest vor, dorthin zu gehen, wo es keine Menschen gibt. Dennoch bin ich umgekehrt und auf den Dotera zugegangen, auch wenn ich mich, indem ich so ging, eines gewissen Selbstmitleids nicht ganz erwehren konnte. Trotzdem, dieser Dotera war ja schließlich auch ein Mensch. Dass jemand wie ich, entschlossen, einen menschenleeren Ort aufzusuchen, von einem einzigen Menschen zum Umkehren bewegt werden konnte, zeigte einerseits dessen ungeheure Anziehungskräfte, während es zugleich, indem ich genötigt wurde, quasi gegen meinen eigenen Willen zu handeln, ein schlagender Beweis meiner Schwäche war. Kurz, ich hatte die Absicht, an einen dunklen Ort zu gehen, genauer gesagt, war dazu gezwungen, aber beim geringsten Anlass ergriff ich die erstbeste Gelegenheit, in dieser mir vertrauten Welt zu bleiben.
Zum Glück hatte mich der Dotera von sich aus gerufen, und so konnte ich ohne große Bedenken meine Schritte zurücklenken. Das heißt aber, dass ich mir des unentschuldbaren Betrugs an meinem großen Ziel durchaus ein wenig bewusst war. Hätte mich dieser Dotera statt mit »Will er nicht arbeiten?«, mit der Frage angegangen, »Er da, will er ins flache Land oder in die Berge?«, dann hätte ich mich meines Zieles, das ich drauf und dran war zu verraten, zweifellos entsonnen. Schlagartig waren mir all die dunklen und menschenleeren Orte schrecklich und entsetzlich vorgekommen. So sehr war in mir bereits der Wunsch gekeimt, wieder in die irdische Welt zurückzukehren. Und es scheint, dass mit jedem Zuruf von dem Dotera und mit jedem Schritt, mit dem ich mich ihm näherte, dieses profane Gefühl an Stärke gewann.
Als ich mich schließlich mit meinen beiden blanken Beinen stracks vor den Dotera aufbaute, in dem Augenblick war der Gipfel meiner Weltlichkeit erreicht. Just in diesem Augenblick kam dieses »Will er denn nicht arbeiten?«. Dieser so simple Dotera hatte da eine Einladung ausgesprochen, die sich wunderbar meine Gemütsverfassung zunutze machte. Ob der unvermuteten Frage war ich im ersten Moment wie benommen, und aus der Benommenheit erwacht, war ich mit einem Schlag wieder zu einem höchst irdischen Menschen geworden. Sobald einer im Diesseits ist, muss er was zum Beißen haben. Dafür wiederum muss gearbeitet werden.
»Könnt schon arbeiten.« Die Antwort ging mir mühelos über die Lippen. »Na klar, kann ja gar nicht anders sein«, war deutlich im Gesichtsausdruck des Dotera zu lesen. Seltsam, ich konnte diesem Gesichtsausdruck nur voll zustimmen.
»Könnt schon arbeiten, aber um was für Arbeit handelt es sich denn eigentlich?«, hakte ich nach.
»Da verdienst du bestens, keine Lust, es zu probieren? Verdienst ’ne Menge, garantiert!«
Der sichtlich gut gelaunte Dotera strahlte über das ganze Gesicht und erwartete meine Antwort. Da lachte er, dieser Dotera, und das hatte nun aber auch gar nichts Einnehmendes. Das ganze Gesicht war so angelegt, dass es ihm nur schaden konnte, wenn es lachte. Aber irgendwie rührte mich dieses Lachen, und so antwortete ich prompt:
»Na gut, ich probier’s.«
»Du versuchst es? So ist’s recht! Junge, du wirst mächtig verdienen.«
»Ich muss da nicht groß verdienen …«
»Was?!«, stieß der Dotera mit seltsamer Stimme hervor.
5
»Was ist das eigentlich für eine Arbeit?«
»Wenn er’s macht, erzähl ich’s. Er macht’s doch oder? Stünd ja schön blöd da, wenn ich alles erzähl und er springt wieder ab«, versicherte sich der Dotera hastig.
»Hab vor, es zu machen.«
Meine Antwort kam diesmal nicht so leicht und natürlich daher. Musste sie mir förmlich herauspressen. Im Großen und Ganzen war ich bereit, alles zu machen, aber vermutlich wollte ich für alle Fälle einen Fluchtweg offen lassen. Daher sagte ich wohl auch nicht, »ich mach’s«, sondern »ich hab es vor«. –
Etwas eigenartig ist das schon, von sich selbst wie über einen beliebigen anderen zu schreiben, aber der Mensch an sich ist nun mal nicht berechenbar, daher lässt sich über ihn, und sei es über einen selbst, nichts wirklich mit Bestimmtheit sagen. Wenn es dann noch um Dinge aus der Vergangenheit geht, ist kaum noch zwischen einem selbst und anderen zu unterscheiden. Alles verwandelt sich in ein ständiges »wohl« und »vermutlich«. Man mag das hier verantwortungslos nennen, aber so verhält es sich nun mal. Ich werde von jetzt an bei allen vagen Stellen genauso verfahren. –
Der Dotera schien anzunehmen, dass nun alles abgemacht sei.
»Na also, komm rein. Wir wollen alles in Ruhe beim Tee bereden.«
Da hatte ich nichts dagegen und so betrat ich mit dem Dotera die Teebude, und als ich mich neben ihm niedergelassen hatte, servierte uns die Wirtin, eine schiefmäulige Person um die Vierzig, einen eigenartig riechenden Tee. Beim ersten Schluck kam mir plötzlich in den Sinn, wie sehr mir der Magen krachte. Entweder befiel mich gerade jetzt der Hunger oder ich war bereits hungrig und wurde nur daran erinnert. In meinem Geldbeutel waren zweiunddreißig Sen und ich überlegte gerade, ob ich etwas essen sollte, da fragte der Dotera, indem er mir von der Seite eine Packung Asahi hinhielt: »Junge, rauchst eine?«
Wie aufmerksam! Die Packung war an der einen Ecke aufgerissen, versteht sich, aber sie war auch verdreckt und völlig zerdrückt, so dass man sich nur zu leicht vorstellen konnte, wie alle Zigaretten darin zu einem einzigen Klumpen gequetscht waren. Da der Mann einen ärmellosen Dotera trug, scheint er die Packung, um einen passenden Aufbewahrungsort verlegen, in seine Arbeitsschürze vorne am Bauch hineingewurstelt zu haben.
»Nein danke, nicht nötig.«
Als ich ablehnte, zeigte er kein Anzeichen von Enttäuschung und fingerte sich mit seinen vor Dreck starrenden Fingernägeln eine der verklumpten Zigaretten heraus. Sie war völlig verschrumpelt und flach wie eine Schwertklinge – ob die es noch machte? Sie schien aber an keiner Stelle aufgerissen, und da qualmte er auch schon mit tiefen Zügen und ließ den Rauch durch die Nase ausströmen. Faszinierend, wie eine derart abenteuerlich behandelte Zigarette noch ihren Zweck erfüllte.
»Wie alt ist er denn?«
Der Dotera redet mich mal mit »er« mal mit »du« an, und mir war nicht ganz klar, wie er da unterschied. Soweit ich bisher erkennen konnte, titulierte er mich, wenn es ums Verdienen ging, mit »du«, darüber hinaus fiel er aber zum »er« zurück. Egal, ihm schien vor allem das Geldmachen am Herzen zu liegen.
»Ich bin neunzehn.«
In der Tat war ich damals genau neunzehn Jahre alt.
»Noch so jung!«, sagte die Wirtin mit dem schiefen Mund, die gerade mit dem Rücken zu uns ein Tablett abtrocknete. Da sie uns abgewandt war, konnte ich ihren Gesichtsausdruck nicht erkennen. Mir war nicht ganz klar, ob sie nur so vor sich hingesprochen, sich an Dotera oder gar an mich gewandt hatte. Auch Dotera schlug in die gleiche Bresche:
»Genau, mit neunzehn, da ist man jung. Das beste Alter zum Arbeiten.«
Das klang, als gelte es um alles in der Welt zu arbeiten. Indessen war ich schweigend vom Klappstuhl aufgestanden.
6
Vorne raus gab es eine Auslage für Süßigkeiten, worauf neben einem Gebäckkasten mit abgeblätterten Rändern ein großer Teller stand. Unter einem blauen Küchentuch schauten runde frittierte Manjū hervor. Ich wollte davon essen, deshalb erhob ich mich von meinem Platz und trat vor die Auslage. Beim näheren Betrachten des Manjū-Tellers sah ich, dass er von grausigen Fliegen übersät war. Kaum hielt ich vor dem Teller inne, stoben sie von den Schrittgeräuschen aufgescheucht in alle Richtungen auseinander.
Aber schon im nächsten Augenblick, als ich noch etwas benommen versuchte, mich wieder auf die frittierten Manjū zu konzentrieren, flogen die verscheuchten Fliegen wie auf ein Zeichen hin – Sturm vorüber, alles in Ordnung – mit einem Schlag zurück. Die mit gelblichem Fett getränkte Kruste wimmelte von schwarzen Punkten. Gerade überlegte ich, die Hand danach auszustrecken, da bildeten die schwarzen Punkte plötzlich kreuz und quer kleine Reihen, geradezu wie Sternbilder am klaren Nachthimmel, was mich wiederum ein wenig abschreckte. Verloren betrachtete ich den Teller.
»Wollen’S von den Manjū? Ganz frisch. Grade vorgestern ausgebacken.«
Ohne dass ich es bemerkt hatte, stand die Wirtin, die ihr Tablett abgewischt hatte, unvermittelt auf der anderen Seite der Süssigkeitenauslage. Überrascht blickte ich sie an. In dem Augenblick hob sie ihre knochige Hand über den Teller.
»Schrecklich, was für Fliegen.«
Sie wedelte zwei, drei Mal mit der hochgestellten Hand und verscheuchte die Fliegen.
»Wenn’S welche wollen, gebe ich Ihnen davon.«
Sie griff sich umgehend einen Holzteller vom Regal und setzte flink mit langen Bambusstäbchen sieben Stück darauf.
»Hier passt doch.«
Damit stellte sie den Holzteller auf den Klappstuhl, auf dem ich eben noch gesessen hatte. Was sollte ich machen, ich kehrte zurück und setzte mich neben dem Holzteller nieder. Und siehe da, die Fliegen kamen bereits angeflogen. Die Fliegen, die Manjū und den Holzteller betrachtend, wandte ich mich versuchsweise an den Dotera:
»Wie wär’s denn mit einem?«
Das war nicht unbedingt als Dank für die Asahi gedacht. Irgendwie wollte ich herausfinden, ob der Dotera diese vorgestern ausgebackenen und nun vor Fliegen starrenden Manjū essen oder verschmähen würde.
»Ah, bin so frei.«
Beherzt nahm er den obersten Manjū und stopfte ihn umstandslos in den Mund. Dem Anschein nach, wie er so mit seinem dicklippigen Mund mampfte, schien es gar nicht so schlecht zu schmecken. Kurz entschlossen packte ich ebenfalls einen vergleichsweise lecker aussehenden, sperrte meinen Mund auf und schob ihn hinein. Kaum ergoss sich der Ölgeschmack über meine Zunge, da fiel bereits die bittere Bohnenpaste über meine Geschmacksnerven her. Aber in dem Moment war es mir eigentlich nicht weiter zuwider. Als ich mir derart mühelos sowohl die Bohnenpaste, die Kruste als auch das Öl einverleibt hatte, streckte ich, als wäre es das Natürlichste der Welt, ganz zu meinem Erstaunen automatisch meine Hand zum Holzteller aus. Der Dotera hatte zu diesem Zeitpunkt schon den zweiten verschlungen und ging bereits zum dritten über. Im Vergleich zu mir war er unglaublich schnell. Und während des Essens schwieg er. Es sah ganz so aus, als hätte er alles Gerede von Arbeiten und Geld vergessen. Folglich waren die sieben Manjū innerhalb von zwei, drei Atemzügen verschwunden. Ich selbst hatte davon nur zwei abbekommen. Die anderen fünf hatte der Dotera in Blitzeseile weggeputzt. –
Etwas kann noch so ekelhaft ausschaun, und man mag zögern zuzugreifen, ist erst einmal ein Anfang gemacht, lässt sich alles ohne größere Überwindung verzehren. Das habe ich erst später im Berg aus tiefster Seele verstanden, und ist mir nunmehr schon fast eine abgedroschene Einsicht. Nur damals, als ich die Manjū aß, brannte ich krankhaft danach, noch mehr davon zu haben. Ich hatte Hunger! Noch dazu war mein Gegner dieser Dotera. Und wenn man sieht, wie er, ohne sich etwas dabei zu denken, selbst Manjū, an denen Sand klebte, wie nichts verdrückte, kam ein leichtes Gefühl von Konkurrenz auf. Da stellte sich schnell die Einsicht ein, dass hier Empfindlichkeiten rein gar nichts nützten, im Gegenteil, sie behinderten. Zuletzt bat ich die Wirtin um Nachschub.
7
Diesmal kein »Wie wär’s denn mit einem?«, sondern in dem Augenblick, als der Holzteller auf dem Klappstuhl zum Stehen kam, griff zuallererst ich beherzt zu. Schweigend ohne sein »Ah, bin so frei« langte auch der Dotera umstandslos zu. Den nächsten bezwang ich. Dann war wieder der Dotera am Zug. Abwechselnd brachten wir es so wieder auf sechs Stück, nun blieb noch einer. Zum Glück war ich an der Reihe, und bevor er zulangen konnte, hatte ich ihn mir gesichert. Umgehend orderte ich Nachschub.
»Hast ’nen gesegneten Appetit, Junge.«
Das war mir nicht weiter bewusst, aber er hatte Recht. Zunächst war es nur so, dass der Dotera die Macht hatte, meinen Appetit anzustacheln, indem er vor meinen Augen verschmauste, was ich ursprünglich erst gar nicht anrühren wollte. Er drückte sich aber so aus, als ob ich ganz allein auf eigene Verantwortung diese Menge verdrückt hätte. Ich hatte gute Lust, mich vor ihm zu rechtfertigen, mir fielen dazu aber nicht die richtigen Worte ein. Der Dotera war da auch irgendwie verantwortlich, das spürte ich nebelhaft, war mir aber im Unklaren darüber, um welche Art Verantwortung es sich handelte, daher ließ ich es auf sich beruhen.
»Junge, du scheinst frittierte Manjū über alles zu lieben, was?«
Was redete der da. Natürlich zählte ich Manjū, die vor zwei Tagen ausgebacken wurden und voller Sand und Fliegen waren, nicht zu meinen Leibspeisen. Trotzdem ließ sich natürlich kaum behaupten, dass man etwas verabscheut, von dem man drei ganze Teller voll verdrückt hat. Auch diesmal schwieg ich also. Da mischte sich plötzlich die Wirtin ein: »Unsere Manjū haben einen guten Ruf, die lässt sich jeder schmecken.«
Als ich sie so hörte, hatte ich das leise Gefühl, zum Narren gehalten zu werden. Ich versank stattdessen mehr und mehr in tiefes Schweigen. Da tönte der Dotera: »Es geht eben nichts über einen rechten Leckerbissen!«
Ich konnte nicht recht unterscheiden, ob er es ernst meinte oder ob er nur schmeicheln wollte. Jedenfalls waren mir im Moment die Manjū völlig egal, und ich wollte mehr zum Thema Arbeit erfahren.
»Um nochmals auf das Gespräch von vorhin zurückzukommen. Auf Grund verschiedener Umstände sehe ich mich veranlasst, mir meinen Unterhalt selbst zu verdienen, daher meine Frage, um was für Arbeit handelt es sich denn dabei?«
Ich suchte nun von mir aus das Gespräch. Der Dotera, der die Süßigkeitenauslage betrachtet hatte, wandte sich mir abrupt zu:
»Junge, da machst du echt Geld. Ungelogen, es geht um richtig gutes Geld, du musst das unbedingt machen.«
Wieder war ich »der Junge«, und es schien ihm sehr am Herzen zu liegen, dass ich gut verdiene. Ich betrachtete dieses Gesicht, mir nun wieder vollends zugewandt, das sich solche Mühe gab, mich zu überzeugen, und ich sah, dass das Fleisch seiner Wangen von den Backenknochen herabhing, um sich am Kinnrand wiederum zu einer kantigen dicken Wulst aufzuwerfen. Von draußen drang Sonnenlicht herein und darin zeichneten sich tiefe, bogenförmige Falten unterhalb seiner Nasenflügel ab. Bei dem Anblick erfasste mich irgendwie ein Grausen vor dem Geldmachen.
»Ich muss da nicht groß verdienen. Wenn’s ums Arbeiten geht, kein Problem. Wenn es sich nur um heilige Arbeit handelt, mach ich alles.«
Um des Doteras Wangen herum zeichnete sich ein Hauch von Fragezeichen ab, dann zog er jene bogenförmigen Falten nach beiden Seiten auseinander und entblößte freimütig seine vom Zigarettenteer überzogenen Zähne. Er ließ eine spezielle Art von Lachen vernehmen. Erst später kam mir der Gedanke, dass ihm der Begriff heilige Arbeit wohl nicht vertraut war. Er musste vor Mitleid grinsen, dass jemand, der ein ganzer Kerl sein wollte, nicht einmal die Bedeutung von Geldmachen kannte und derart verstiegenes Zeug von sich gab. Ich hatte bislang vorgehabt zu sterben. Ich hatte vorgehabt, wenn nicht zu sterben, an einen menschleeren Ort zu gehen. Da mir das alles nicht gelang, sah ich mich veranlasst, für mein Weiterleben zu arbeiten. Geldmachen oder nicht, diese Frage war mir in dem Augenblick völlig egal. Und nicht nur jetzt, auch als ich noch meinen Eltern in Tōkyō auf der Tasche lag, hatte ich nicht die Spur Interesse daran. Nicht nur das, Gewinnstreben als solches war mir zutiefst verhasst gewesen. Ich glaubte sogar, dass egal wo in Japan, ein jeder Mensch genauso dachte. Daher kam mir des Doteras permanentes Gerede vom Geldmachen äußerst seltsam vor; was will der denn bloß damit, fragte ich mich von Mal zu Mal. Es verärgerte mich nicht weiter. Dazu war ich gar nicht in der Stimmung und es entsprach auch nicht meiner Lage, es ließ mich einfach nur kalt, und dennoch hätte ich nicht im Traum gedacht, dass dies die süßesten Worte und die wirkungsvollste Methode sein sollten, um einen Menschen zu verführen. Deshalb wurde ich auch vom Dotera ausgelacht. Aber selbst da begriff ich das alles noch nicht. Im Nachhinein betrachtet, war das ziemlich dumm von mir.
8
Der Dotera, der auf diese besondere Art gelacht hatte, fragte nun sein spezielles Lachen halb unterdrückend in etwas ernsterem Ton:
»Hat er denn bis jetzt je schon mal gearbeitet?«
Was fragt er da, bin ich doch gestern erst aus meinem Elternhaus abgehaun. Als eigene Arbeit konnte ich nur meine Kendō-Übungen und das Baseball-Training anführen. Von Selbstverdientem hab ich bisher keinen einzigen Tag gelebt.
»Richtig gearbeitet hab ich bisher noch nicht. Aber von jetzt an bleibt mir nichts anderes übrig.«
»So wird es sein. Wenn du noch nie gearbeitet hast, … na ja, Junge, dann hast auch noch nie Geld gemacht, stimmt’s«, bekam ich da überflüssigerweise zu hören. Hier erübrigte sich jede Antwort und ich schwieg. Da erhob sich die Wirtin auf der anderen Seite der Auslage:
»Wenn man schon arbeitet, muss auch das Geld stimmen, was?«
»Genau«, pflichtete der Dotera bei, »Geldmachen, das sagt sich so leicht, aber in letzter Zeit laufen einem Stellen, die Kohle bringen, nicht gerade hinterher.«
Er klang gerade so, als würde er mir damit weiß Gott was Gutes tun.
»Genau!«, murmelte die Wirtin etwas verächtlich, und ohne weiter Notiz zu nehmen, ging sie nach hinten hinaus. Ich hatte irgendwie das Gefühl, diesem »Genau« folgt noch was, und blickte ihr arglos nach, aber sie ging nur zu einer riesigen Schwarzkiefer und fing an, im Stehen zu pinkeln. Hastig wandte ich meinen Blick ab und dem Dotera zu. Der begann wieder, Dank einzufordern.
»Weil ich’s bin, erzähl ich ihm, einem Wildfremden, von solch einer tollen Gelegenheit. Garantiert, davon würde keiner was erzählen, ist halt ein Superjob.«
Mir war das zu blöd und gab daher nur brav und steif zurück »Danke!«.
»Also, es handelt sich dabei um folgende Stelle.«
Während ich schweigend zuhörte setzte der Dotera gleich nach:
»Also, es handelt sich dabei um folgende Stelle. Es geht um Arbeit im Kupferbergwerk, und wenn ich mich für dich verwende, kannst du direkt zum Bergmann werden. Na hör mal, ist doch fantastisch, sofort zum Bergmann aufzusteigen!«
Ich fühlte mich zu einer Antwort gedrängt, konnte mich aber nicht im Geringsten von der Begeisterung des Doteras anstecken lassen und ihm beipflichten. Was war denn ein Bergmann schon, ein Arbeiter, der im Bergwerk unten im Stollen arbeitet. Es gibt ja die verschiedensten Berufe, und mir fiel dazu nur ein, dass es der Bergmann am härtesten von allen hatte, kurz, dass er der Niedrigste war, wie konnte ich da miteinstimmen, wenn mir jemand erzählte, direkt Bergmann zu werden, sei Gott weiß wie großartig! Ich war nicht wenig verwundert. Dass es unter dem Bergmann eine Reihe noch niedrigerer Berufe geben sollte, war für mich ebenso schwer vorzustellen, wie wenn jemand behauptete, nach Silvester seien es noch einige Tage bis Neujahr. Ich begann mich ernsthaft zu fragen, ob der Dotera solches Zeug nur daherredete, um sich über meine jugendliche Unerfahrenheit lustig zu machen und mich nach Strich und Faden zu betrügen. Er aber blieb ganz ernst.
»Kurz und gut, wenn ich dich da hinbring, kannst du gleich als Bergmann anfangen. Da hat man’s leichter. Im Handumdrehn spart man Geld und macht, wozu man Lust und Laune hat. Sogar eine Bank gibt’s da, wer möchte, kann sich dort jederzeit etwas zurücklegen. Nicht wahr, Wirtin, gleich von Anfang an Bergmann, das ist schon was.«
Damit übergab er das Gespräch der Wirtin, und sie sprach mit dem gleichen Gesichtsausdruck, mit dem sie vorhin hinter dem Haus stehend ihr Geschäft erledigt hatte.
»So isses, wer gleich Bergmann wird, schwimmt in vier, fünf Jahren nur so im Geld. … Schließlich erst neunzehn. … Im besten Arbeitsalter. … Wär jammerschade, jetzt nicht Geld zu machen.«
Wie im Selbstgespräch redete sie vor sich hin, Wort für Wort abgesetzt.
9
Kurzum, als hätten sie sich abgesprochen, war auch die Wirtin mit dem Dotera der Meinung, ich solle unbedingt Bergmann werden. Natürlich hatte ich nichts dagegen. Und wenn nichts daraus würde, wäre es auch in Ordnung. Irgendwie seltsam, so lammfromm wie damals war ich zum ersten Mal in meinem Leben. Egal welcher Unsinn da behauptet worden wäre, ich hätte immer nur brav genickt und zugehört. Offen gesagt, war alles, was sich so an Problemen und Verpflichtungen, an Gefühlen und Kummer das ganze letzte Jahr über angestaut hatte, explodiert und hatte einen Riesenkrach heraufbeschworen, mit dem Ergebnis, dass ich hier völlig orientierungslos gestrandet war. Bis gestern war schlicht ausgeschlossen gewesen, dass ich je derart lammfromm werden könnte, aber jetzt spürte ich auch nicht den geringsten Drang, gegen jemandem aufzubegehren. Dabei empfand ich weder etwas Widersprüchliches noch Fragwürdiges daran. Vermutlich hatte ich auch gar nicht die Muße dazu. Beim Menschen ist das einzig Konsistente der Körper. Aber nur weil der Körper konsistent ist, gehen viele davon aus, dass auch das Herz gleichermaßen gut geordnet ist, das heißt, auch wenn sie heute das genaue Gegenteil von gestern tun, gehen sie ungerührt davon aus, trotzdem immer noch der Gleiche wie zuvor zu sein. Kommt dann die Frage der Verantwortung auf den Tisch oder werden wir wegen unserer Unzuverlässigkeit zur Rede gestellt, warum antwortet dann keiner frei weg, ich hab zwar meine Erinnerungen, aber in Wirklichkeit herrscht in meinem Herzen ein völliges Durcheinander. Obwohl ich solche Widersprüche immer und immer wieder erlebt habe, empfinde selbst ich durchaus etwas wie Verantwortung, auch wenn ich sie kaum für einlösbar halte. Insofern ist der Mensch derart raffiniert geschaffen, dass er unausweichlich Opfer der Gesellschaft wird.
Denn wenn ich jetzt bemerke, wie wankelmütig und unberechenbar meine chaotische Seele war, wenn ich mich dabei ohne jegliches Wohlwollen wie einen Fremden analysiere und unverblümt beurteile, dann komme ich zu dem Schluss, dass es nichts Unzuverlässigeres als eben den Menschen gibt. Keiner, der sich seiner eigenen Seele bewusst ist, kann etwas wie ein Versprechen oder einen Schwur leisten. Und es ist der Gipfel brutaler Primitivität, jemanden mit einem dahingesagten Versprechen zu erpressen. Nahezu bei jedem Versprechen, das jemand versucht einzuhalten, obwohl das genau betrachtet meist unmöglich ist, wird eben das völlig ignoriert. Von freiem Handeln keine Spur. Wäre ich früher darauf gekommen, hätte ich mir womöglich sparen können, allen Menschen zu grollen, an ihnen zu leiden und aus Verzweiflung schließlich von zu Hause wegzurennen. Und wo ich schon von zu Hause weg und bis zu diesem Teestand hier gekommen war, wenn ich es immerhin geschafft hätte, objektiv und gelassen mein Verhalten gegenüber dem Dotera und der Wirtin damit zu vergleichen, wie ich bis gestern gewesen war, dann hätte ich alles doch ein bisschen besser begriffen.
Leider hatte ich damals mir selbst gegenüber nichts von einem Forschergeist. Ich war einfach nur vergrämt, böse, traurig, wütend, dann wieder tat mir alles leid, fand ich alles bedauernswert, war voller Weltschmerz und konnte doch nicht ohne die Menschen sein, hielt es einfach an keinem Ort mehr aus, rannte wie wahnsinnig los, blieb am Dotera hängen und verschlang jene frittierten Manjū.
Gestern war gestern, heute ist heute, vor einer Stunde war vor einer Stunde, eine halbe Stunde später eine halbe später, nur mir war das Gefühl für alles andere außer dem, was unmittelbar vor meinen Augen war, gänzlich abhandengekommen und meine Seele, die sich von jeher kaum richtig fassen konnte, fing an, ganz diffus zu werden, und mir war bald nicht mehr klar, ob sie überhaupt existierte; und noch dazu verschwammen die mächtigen Erinnerungen des vergangenen Jahres, wie der Traum einer Tragödie, zu einem Gefühl einer unheilschwangeren Wolke, die sich im grenzenlos leeren Raum ausbreitete.
Normalerweise hätte ich hier alle möglichen Spitzfindigkeiten angeführt; warum etwa sollte es gut sein, Bergmann zu werden, warum sollte es noch niedrigere Ränge als den Bergmann geben, oder auch, dass ich eben keiner bin, der nur um des Gewinns willen arbeitet, was soll denn gut daran sein, immer nur Geld zu machen und und und, ich hätte nicht klein beigegeben, ohne meinen Willen zu behaupten. Aber nichts davon, hab mich einfach nur lammfromm zurückgehalten. Und das nicht nur verbal, selbst im tiefsten Innern konnte ich nicht die Spur von Widerstand empfinden.
10
Damals schien ich zu denken, es sei in Ordnung, einfach nur zu arbeiten. Wenn ich nur arbeitete, – solange meine unstete Seele ziellos in meinem Körper irrlichterte, oder anders gesagt, solange durch Arbeit das, was nun einfach noch nicht sterben konnte, nicht mit Gewalt umgebracht wurde – schien es mir völlig egal, ob ich über oder unter dem Bergmann arbeitete, ob mit oder ohne Gewinn. Mir war es recht, wenn da nur irgendein Posten war, egal, was da über Ränge, Qualität oder Verdienst hinausposaunt wurde, egal, wie diese Übertreibungen meiner eigenen Meinung widersprachen, egal, wie berechnend diese Angeberei war, um mich da hineinzulocken, egal auch, dass darauf hereinzufallen bedeutete, dass es einen nicht geringen Makel in meinem Charakter hinterlassen würde, wollte ich als vernünftiger Mensch gelten. Das alles war mir herzlich egal. In so einer Situation wird der komplizierte Mensch furchtbar simpel.
Noch dazu verspürte ich, als ich Bergmann hörte, eine Art Freude. Ich war ja zum Ersten mit dem Entschluss von zu Hause ausgebrochen, um wahrscheinlich zu sterben. Das hatte sich zum Zweiten dahingehend gewandelt, dass ich, wenn ich nun schon nicht sterben musste, unbedingt an einen Ort wollte, wo es keine Menschen gab. Drittens, ehe ich mich versah, wandelte sich dieser Vorsatz erneut, indem ich mir nun vornahm, immerhin zu arbeiten. Wenn schon arbeiten, dann sollte es keine normale Arbeit sein, sondern eher an meiner zweiten, ja genauer besehen, an meiner ersten Bedingung orientiert sein. Von einer zur anderen Stufe wurde ich ja, ohne dass ich mir dessen bewusst war, meinen Vorsätzen untreu, aber auch während sich mein Gefühlszustand zusehends änderte, stellte sich dennoch eine Beziehung zum jeweils Vorherigen ein, und mich danach zurücksehnend wurde ich zum Nächsten weiter vorangetrieben. Der Entschluss, einfach zu arbeiten, bedeutete offenbar nicht, dass ich die zweite Bedingung abgeschüttelt oder mit der ersten ganz und gar gebrochen hätte. Arbeiten und dabei zugleich an einem Ort fern der Menschen, in einem dem Tod nahen Zustand Arbeit zu verrichten, darin kam mein letzter Entschluss meinem ersten Ziel doch auf seine Weise entgegen. Der Bergmann arbeitet, wie der Name schon sagt, im Berg unter Tage, fern vom Licht der Sonne. Er bleibt zwar im Diesseits, gräbt sich aber tief davon hinab und widmet sich im Dunkeln allein den Erzklumpen und bleibt so außer Reichweite der Stimmen der vergänglichen Welt. Mit Sicherheit eine düstere Angelegenheit. Auf der Welt wimmelte es zwar von Menschen, aber ich war überzeugt, niemand darunter war wie ich zum Bergmann geboren. Bergmann war für mich die wahre Berufung. – Damals sah ich natürlich das alles keineswegs derart klar, nur als ich »Bergmann« hörte, hatte ich ein Gefühl der Düsternis, und gerade die stimmte mich irgendwie froh. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, erscheint es mir wie die Geschichte eines Andern.
Ich wandte mich an den Dotera:
»Ich werde nach besten Kräften arbeiten. Machen Sie mich denn zum Bergmann?«
In generösem Ton meinte dieser: »Es ist gar nicht so leicht, es gleich zum Bergmann zu bringen. Aber wenn ich dich da empfehle, gibt es bestimmt keine Probleme.«
Ich dachte, wenn der das so sagt, wird es auch stimmen, und nach kurzem Schweigen fing plötzlich die Wirtin an: »Der Chōzō braucht da nur ein Wort für dich einlegen, dann bist du quasi schon Bergmann.«
Da erfuhr ich zum ersten Mal, dass der Name dieses Dotera Chōzō war. Als wir anschließend mit dem Zug fuhren, hab ich den Mann selber auch ein paar Mal beim Namen Chōzō gerufen. Aber wie man Chōzō genau schreibt, weiß ich bis heute nicht. Hier schreib ich den Namen einfach so, wie er gesprochen wird. Dieser Mann, der mich, als ich damals gerade von zu Haus weggerannt war, unvermittelt bei der Nase packte und mich in eine Richtung lenkte, die mir bis dahin völlig unvorstellbar gewesen war, gab damit meinem Leben die entscheidende Wende, und obwohl ich seinen Namen vom Hören kenne, kann ich ihn, so seltsam es klingt, nicht einmal exakt schreiben.
Da sich dieser Chōzō und die Wirtin darin einig waren, dass ich Bergmann werden sollte, war ich auch davon überzeugt, einer zu werden.
»Also, dann bitte ich inständig darum.«
Wie und wohin jemand, der in einer solchen Teebude herumsaß, losgehen und durch welche Formalitäten er zum Bergmann werden konnte, entzog sich allerdings völlig meiner Kenntnis.
11
Na, sei’s drum, wo es mir schon derart angepriesen wurde, da wird Chōzō bestimmt auf meine Bitte hin irgendwas unternehmen, daher schwieg ich und fragte gar nicht erst nach. Und siehe da, mit Schwung erhob er sich mit seinem Dotera-Hintern vom Klappstuhl.
»Ja dann, lass uns gleich mal losgehen. Junge, hast du alles beieinander? Pass auf, dass du nichts vergisst.«