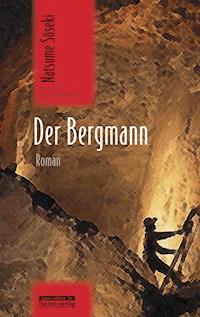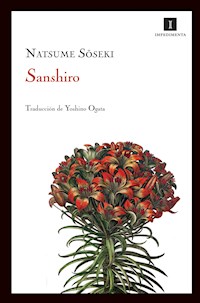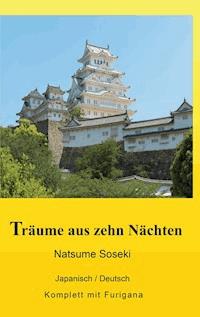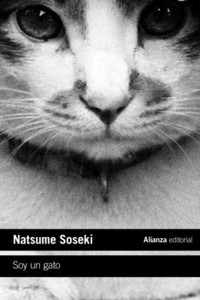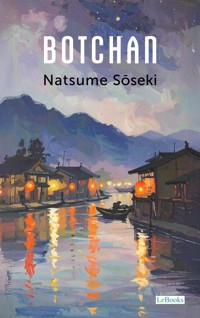24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einer der berühmtesten Romane der modernen japanischen Literatur – höchst amüsant und in bibliophiler Ausstattung. "Gestatten, ich bin ein Kater! Unbenamst bislang." Mit diesen Worten stellt sich der bekannteste Kater der japanischen Literaturgeschichte seinem Publikum vor. Bestens gebildet, hat er zwar noch keine Maus gefangen, in der Beobachtung von Menschen und ihren rätselhaften Marotten aber ist er ein Meister. Um diese Gabe zu entfalten, hat er sich den richtigen Haushalt ausgesucht, denn sein Herr gibt ihm zu sarkastischen Kommentaren und Witzeleien ausreichend Anlass: Der Mittelschullehrer Professor Rarus Schneutz hat den Charakter einer Auster. Verschroben, wie er ist, neigt er zu apathischem Dösen, Starrsinn und wilden theoretischen Diskussionen mit seinen Freunden, die allesamt lieber reden, als zu handeln. Natsume Sōsekis berühmtester Roman persifliert die Lebensweise der japanischen Mittelklasse um 1900. Die skurrilen Abenteuer seines tierischen Ich-Erzählers sind ein bis heute in vielen Sprachen gelesener heiterer Klassiker der Weltliteratur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1058
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Natsume Sōseki
Ich, der Kater
Roman
Aus dem Japanischen mit einem Nachwort und Anmerkungen von Otto Putz
Schöffling & Co.
Inhalt
Ich, der Kater
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nachwort
Ich, der Kater
1
Gestatten, ich bin ein Kater! Unbenamst bislang.
Wo ich geboren wurde, davon habe ich nicht die mindeste Ahnung. In Erinnerung geblieben ist mir lediglich, dass der Ort meiner Geburt düster und feucht war und ich kläglich vor mich hin miaute. An diesem Ort sah ich erstmals einen Menschen. Aber was heißt schon: einen Menschen! Ich sah, wie ich später erfuhr, einen Studiosus[1], einen Angehörigen jener Species, welche unter den Menschen als die grausamste angesehen wird. Man erzählt sich, dass diese Studiosi gelegentlich Angehörige meines Volkes fangen! kochen! und essen! Mir erschien jedoch die damalige Situation nicht besonders schreckerregend, da mein Kopf noch frei von allen Gedanken war. Nur ein Gefühl des Schwebens breitete sich in mir aus, als ich auf den Handteller des Studiosus befördert und in die Lüfte gehoben wurde. Nachdem ich es mir in seiner Hand etwas gemütlich eingerichtet hatte, da wurde ich, nach meiner Erinnerung, erstmalig eines sogenannten Menschen ansichtig. Das Gefühl, welches die Merkwürdigkeit dieses Wesens in mir auslöste, hat mich bis zum heutigen Tage nicht verlassen. Sein Gesicht, um damit zu beginnen, sein Gesicht also, welches doch nach allem vernünftigen Dafürhalten mit Haaren hätte geschmückt sein müssen, war blank wie der Bauch eines Kupferkessels. Seither bin ich manch einer Katze begegnet, auf ein derart verunstaltetes Wesen bin ich jedoch kein zweites Mal gestoßen. Doch dies war nicht der einzige Defekt: Aus der Mitte seines Gesichtes ragte ein fürchterlicher Vorsprung. Und aus den Löchern dieses Vorsprungs dampften von Zeit zu Zeit dicke Rauchwolken. Ja, fast erstickt wäre ich in diesem Qualm, und elend war es mir zumute. Dass es sich dabei um Tabak, den die Menschen rauchen, handelte, ist mir erst seit Kurzem bekannt.
Ich saß also eine Weile recht vergnügt in der Hand dieses Studiosus, als plötzlich alles mit einer entsetzlichen Geschwindigkeit zu rotieren begann. Ob der Studiosus rotierte oder ob nur ich alleine rotierte, wusste ich nicht zu sagen, auf jeden Fall drehte es mir die Augen im Kopf herum. Mir wurde übel. Als ich meine Lage schon für hoffnungslos ansah, tat es einen gewaltigen Schlag, und vor meinen Augen glänzten die Sterne. Bis hierhin reicht meine Erinnerung; was danach geschah, bleibt trotz eifrigsten Nachdenkens im Dunkeln.
Als ich wieder zu mir kam, war der Studiosus weg. Von meinen zahlreichen Geschwistern war auch kein einziges mehr zu sehen. Selbst meine teure Mutter war spurlos verschwunden. Und zu allem Unglück befand ich mich auch noch an einem Ort, der, ganz anders als mein Geburtsort, grässlich hell war. So hell, dass es schmerzte, die Augen zu öffnen. Du gute Güte! Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht! dachte ich mir und versuchte auf die Beine zu kommen, was mir aber größte Schmerzen bereitete. Heruntergerissen von meinem weichen Strohlager, fand ich mich hineingeschleudert in ein Gestrüpp aus Bambusgras.
Nach einigem Überlegen kroch ich schließlich aus dem Gestrüpp hinaus und sah mich einem großen Teich gegenüber. Ich setzte mich an diesen Teich und versuchte, die Lage zu klären: Was sollte ich nur tun?! Es stellte sich jedoch kein einziger nennenswerter Gedanke ein. Nach einer Weile fragte ich mich, ob mich der Studiosus vielleicht abholte, wenn ich weinen würde. Versuchsweise miaute ich ein wenig, aber niemand kam. Unterdessen strich schon der Wind über den Teich, und die Sonne begann zu sinken. In meinem Bauch breitete sich größte Leere aus. Ich wollte weinen, aber die Stimme versagte mir. Es musste also ohne Tränen gehen. Da mir nun alles recht war, beschloss ich, mich zu einem Ort aufzumachen, wo es etwas zu essen gab; ich begann, den Teich ganz langsam an seiner linken Seite zu den. Was entsetzlich mühsam war. Ich aber unterdrückte Schmerz und Pein und kroch, rücksichtslos gegen mich selbst, weiter und weiter, bis ich schließlich an einen Ort gelangte, wo es irgendwie nach Menschen roch. So verkehrt würde es nicht sein, hier hineinzukriechen, dachte ich mir und schlüpfte durch ein Loch im Bambuszaun. Die Vorsehung ist ein wundersames Ding: Wäre dieser Zaun nicht beschädigt gewesen, wäre ich womöglich noch am Wegesrand des Hungers gestorben. ›Wir lagern[2] im Schatten eines Baumes, wir schöpfen Wasser aus einem Fluss. Kein Ort, wo nicht das Walten des Karma zu spüren wäre‹, pflegt man zu sagen, und das ist wirklich gut gesagt! Dieses Loch im Bambuszaun dient mir bis zum heutigen Tage als Passage, wenn ich der kleinen Schildpatt im Nachbarhaus einen Besuch abstatte. Nun, ich war also in das Anwesen eingedrungen, war aber ratlos, was mein weiteres Vorgehen anbetraf. Bald würde es dunkel sein, mein Magen war leer, die Kälte war kalt, und es begann zu regnen: Angesichts dieser Lage war keine Minute mehr zu verlieren. Da mir nichts anderes blieb, ging ich Schritt für Schritt in die Richtung, aus der Licht und Wärme zu kommen schienen. Zu diesem Zeitpunkt, das ist mir mittlerweile klar, befand ich mich bereits im Inneren des Hauses. Hier sollte sich, nach dem Zusammentreffen mit dem Studiosus, abermals die Gelegenheit zu einer Begegnung mit Menschen ergeben. Und der erste Mensch, auf den ich im Hause stieß, war die Küchenmamsell. Diese war noch einmal um ein gutes Stück gewalttätiger, als der Studiosus es gewesen, und kaum hatte sie mich erblickt, ergriff sie mich ohne Vorwarnung am Genick und beförderte mich ins Freie. Das ist nichts und wird nichts! dachte ich, schloss die Augen und gab mein Geschick dem Himmel anheim. Hunger und Kälte aber waren einfach zu viel für mich. Ich wartete also auf einen Moment der Unachtsamkeit bei der Küchenmamsell und enterte abermals die Küche. Und flog stehenden Fußes wieder hinaus. Kaum hinausgeflogen, betrat ich die Küche wieder, und kaum wieder eingetreten, flog ich wieder hinaus, und ich erinnere mich, dass sich dieser Vorgang an die vier, fünf Male wiederholt hat. In diesen Minuten entwickelte ich eine aufrichtige Abneigung gegen die Mamsell. Dieser Groll ist erst vor Kurzem in meinem Herzen zur Ruhe gekommen, als es mir gelang, dieser Person eine Makrele, die für sie gedacht war, zu stehlen und die Rechnung, die zwischen uns noch offen war, so zu begleichen. Gerade als ich das letzte Mal gepackt und hinausgeworfen werden sollte, tauchte der Herr des Hauses auf und sprach: »Was soll denn dieser Lärm!« Die Mamsell wandte sich, mit meinem Genick in der Hand, dem Hausherrn zu und sagte, dass sie Ärger mit diesem obdachlosen Kätzchen hätte, da es, wie oft sie es auch hinauswürfe, in die Küche dieses ehrenwerten Hauses zurückkäme. Der Hausherr schaute mir eine Weile ins Gesicht und zwirbelte dabei die schwarzen Haare, welche sich unter seiner Nase befanden, meinte dann, sie solle mich, wenn dem so sei, eben hierbehalten, und verschwand im Inneren des Hauses. Ein Mann von vielen Worten schien er nicht zu sein. Die Mamsell schleuderte mich ärgerlich in die Küche. Auf diese Weise entschied ich mich endlich für dieses Haus, damit es mir als Wohnung dienen mochte.
Es geschieht nur selten, dass mein Hausherr und ich einander begegnen. Von Beruf soll er Lehrer sein. Sobald er von der Schule nach Hause kommt, betritt er sein Studierzimmer, das er dann für den Rest des Tages auch kaum mehr verlässt. Meine Mitbewohner halten ihn für einen exorbitanten Gelehrten. Und auch er selbst benimmt sich, als wäre er einer. In Wirklichkeit aber ist er mitnichten der Gelehrte, für den er gehalten wird. Von Zeit zu Zeit stehle ich mich zu seinem Studierzimmer und werfe einen Blick hinein, wobei ich oft feststellen muss, dass der Herr des Hauses ein Schläfchen hält. Manchmal besabbert er dabei das Buch, das er zu lesen angefangen hat. Er leidet an Dyspepsie, und seine Haut, die schlaff und kränklich wirkt, ist von einem gelblichen Schimmer überzogen. Dessen ungeachtet verleibt er sich Berge von Essen ein. Es ist jeden Tag dasselbe Lied: Erst verschlingt er einen Berg von Essen, dann schluckt er Takadiastase[3]. Hat er die Medizin geschluckt, schlägt er ein Buch auf. Und hat er zwei, drei Seiten gelesen, wird er schläfrig. Sabber tropft auf das Buch. Dies ist das Programm, das er allabendlich absolviert. Obwohl ich ein Kater bin, denke ich doch von Zeit zu Zeit: Lehrer, so scheint es meiner Wenigkeit, sind wahrhaft glückliche Wesen. Wer als Mensch geboren wird, der sollte Lehrer und nichts als Lehrer werden. Bei so viel Schlaf wäre es auch für eine Katze kein Ding der Unmöglichkeit, sich diesem Berufe gewachsen zu zeigen. Hört man allerdings den Herrn des Hauses sprechen, so gibt es niemanden, der so eine schwere Last zu tragen hätte wie ein Lehrer, und sooft ihn ein Freund besucht, verleiht er seiner Unzufriedenheit aufs Innigste Ausdruck.
In den Tagen, in denen ich mein Leben in diesem Haus aufnahm, war ich, von meinem Herrn einmal abgesehen, bei allen äußerst unpopulär. Wohin ich auch ging, ich wurde zurückgestoßen, und nirgendwo streckte sich mir die Hand eines Freundes entgegen. Wie wenig Hochschätzung man mir erweist, lässt sich auch daran erkennen, dass man bis zum heutigen Tage noch nicht einmal die Güte hatte, mir einen Namen zu geben. Da mir andere Türen verschlossen blieben, bemühte ich mich, sooft wie möglich an der Seite meines Herrn zu sein, der so freundlich gewesen war, mich in seinem Heim aufzunehmen. Ich hatte es mir zur Regel gemacht, bei seiner morgendlichen Zeitungslektüre auf seinen Knien zu liegen. Und wenn er nachmittags ein Schläfchen hielt, an seinem Rücken. Womit nicht unbedingt gesagt werden soll, dass ich ihn besonders schätze. Da ich aber ohne Schutz und Beistand war, wie hätte ich anders handeln können! Später bin ich dann, aufgrund verschiedener Erfahrungen, dazu übergegangen, morgens auf der Reisschüssel, abends auf dem Kotatsu[4] und an schönen Nachmittagen auf der Veranda zu ruhen. Das höchste Vergnügen aber ist es, bei Anbruch der Nacht ins Bett der Kinder zu schlüpfen und bei ihnen zu schlafen. Die Kinder des Hauses, zwei und vier Jahre alt, schlafen in einem Zimmer im selben Bett. Irgendwie gelingt es mir immer, mich zwischen die beiden zu quetschen, sobald ich ein Plätzchen ausfindig gemacht habe, das groß genug für mich zu sein verspricht; wenn aber unglücklicherweise eines der Kinder erwacht, endet alles in einem großen Fiasko. Die Kinder – insbesondere das kleinere der beiden verfügt über einen bösartigen Charakter – rufen dann: »Der Kater ist da! Der Kater ist da!« und fangen mitten in der Nacht zu plärren an, ohne sich um die späte Stunde zu scheren. Woraufhin mein Herr mit seiner nervösen Dyspepsie unweigerlich erwacht und aus dem Nachbarzimmer hereingeschossen kommt. Kürzlich hat er mir doch wahrhaftig mit einem Lineal die Arschbacken versohlt. Je länger ich mit Menschen unter einem Dach zusammenlebe und sie studiere, desto weniger komme ich an der Feststellung vorbei, dass sie selbstsüchtige und rücksichtslose Wesen sind. Insbesondere bei der Beschreibung des Verhaltens der Kinder, mit denen ich von Zeit zu Zeit das Lager teile, stoße ich schnell an die Grenzen der Sprache. Wenn es ihnen gerade in den Sinn kommt, lassen sie mich an den Füßen nach unten baumeln! zwingen mich dazu, einen Sack über dem Kopf zu tragen! schleudern mich in der Gegend herum! oder stopfen mich in den Herd! Hinzu kommt, dass ich, wenn ich auch nur ein wenig Tatendrang zeige, von den anderen Mitgliedern des Haushalts mit vereinten Kräften herumgehetzt und der Verfolgung preisgegeben werde. Erst kürzlich, als ich meine Krallen einen Augenblick lang an den Tatami[5] polierte, geriet die bessere Hälfte meines Herrn in größte Wut, und seither lässt sie mich kaum mehr in die mit Tatami ausgelegten Zimmer. Mag ich auch zitternd auf den Dielen des Küchenbodens hocken, sie lässt das völlig ungerührt. Auch die von mir verehrte Madame Weiß, welche schräg gegenüber wohnt, pflegt bei unseren Treffen zu sagen, dass es keine unmenschlicheren Wesen als die Menschen gibt. Madame Weiß hat vor wenigen Tagen vier reizende Kätzchen zur Welt gebracht. Der Studiosus aber, der in ihrem Haus wohnt, hat diese am dritten Tag nach ihrer Geburt zum Teich hinter dem Haus gebracht und allesamt ertränkt. Nachdem Madame Weiß mir unter Tränen sämtliche Details dieser Geschichte erzählt hatte, sagte sie, dass wir, das Volk der Katzen, den Kampf mit den Menschen aufzunehmen und sie auszurotten hätten, um die Liebe zwischen Eltern und Kindern zur Vollendung zu bringen und ein wundervolles Familienleben führen zu können. Ich teile diese Meinung rückhaltlos. Oder ein anderes Beispiel: Mademoiselle Schildpatt aus dem Nachbarhaus ist voller Empörung über die Menschen, weil ihnen, wie sie sagt, jegliches Verständnis für Besitzrechte fehlt. Unter den Mitgliedern unseres Volkes ist es Brauch, dass derjenige, welcher zuerst auf etwas stößt – gleichviel, ob es sich um den Kopf einer aufgespießten Trockensardine oder die dicke und leckere Magenwand einer Meeräsche handelt –, das Recht hat, es zu verspeisen. Und dieses Recht ist uns so heilig, dass der Finder sogar zu roher Gewalt greifen darf, falls jemand diese Übereinkunft verletzt. Allein, die Menschen verhalten sich, als würde eine derartige Rechtsvorstellung überhaupt nicht existieren, und rauben uns alles an kulinarischen Genüssen, was wir entdecken, zu ihrem höchsteigenen Nutzen. Im Vertrauen auf ihre Körperkräfte entreißen sie uns alles, was nach Sitte und Anstand für unseren Verzehr bestimmt gewesen ist. Madame Weiß lebt im Haus eines Soldaten, der Herr von Mademoiselle Schildpatt ist Advokat. Meine Einstellung zu diesem Problem ist nur deshalb optimistischer als die der beiden, weil ich im Haus eines Lehrers wohne. Wenn ich nur irgendwie Tag für Tag mein Auskommen finde, bin ich schon zufrieden! Nicht einmal der Stern der Menschen dürfte in alle Ewigkeit so hell strahlen wie in unseren Tagen. Nun ja, fassen wir uns in Geduld! Die Zeit der Katzen wird kommen!
Mir ist gerade, da die Rede ist von Selbstsucht und Eigensinnigkeit, eingefallen, wie der Vorstand unseres Haushalts eben wegen dieser rücksichtslosen Eigensinnigkeit einmal den Kürzeren zog, und davon will ich kurz erzählen. An sich kann mein Herr nichts, aber auch überhaupt nichts, besser als andere Menschen, dennoch überkommt ihn oft die Lust, sich an diesem und jenem und jenem und diesem zu versuchen. Er schreibt Haiku und schickt sie an den Hototogisu[6]; Shintaishi[7] schickt er an die Myōjō[8]; auf englisch verfasst er Prosatexte, die vor Fehlern nur so strotzen; und wenn es ihn gerade ankommt, widmet er sich enthusiastisch dem Bogenschießen oder studiert Nō-Gesänge, und bei wieder anderer Gelegenheit entlockt er seiner Violine brummende Töne: Erbarmungswürdigerweise führt weder das eine noch das andere zu irgendetwas. Dennoch ist er, wenn er etwas Neues beginnt, trotz seiner Dyspepsie, mit schrecklichem Eifer bei der Sache. Die Nō-Gesänge stimmt er auf dem Abtritt an, und dafür ist er von der Nachbarschaft mit dem Namen ›Maestro Abtritt‹ belegt worden, aber auch dies ficht ihn nicht im Geringsten an, und der Vers – welcher auch sonst? – »Ich bin Taira no Munemori[9]« erschallt immer wieder. Dies geht so weit, dass die Leute prustend hinter ihm herschreien: »Da kommt Taira no Munemori!« Ich weiß nicht, was sich mein Herr dabei gedacht hat, aber etwa einen Monat nach meiner Einquartierung in diesem Haus kam er am Zahltag aufgeregt mit einem großen Paket unterm Arm von der Schule zurück. Ich fragte mich, was er gekauft haben mochte, und es stellte sich heraus, dass es sich um Aquarellfarben, Pinsel und Papier von der Sorte Whatman handelte; ich gewann den Eindruck, dass sich mein Herr dazu entschlossen hatte, das Studium von Nō-Gesängen und das Verfassen von Haiku zugunsten der Malerei einzustellen. Und wie erwartet, saß er vom nächsten Tag an für eine geraume Zeit täglich in seinem Studierzimmer und malte Bild um Bild, sogar auf seine Nachmittagsschläfchen verzichtete er. Wenngleich auch niemand, der die Ergebnisse seiner Malerei sieht, zu sagen vermag, was er malte! Hielt er möglicherweise selbst nicht allzu viel von seinen Bildern? fragte ich mich, der ich Zeuge der folgenden Szene wurde – sie spielte sich zwischen ihm und einem Freund ab, der Ästhetik oder dergleichen betreibt –, als dieser zu Besuch bei uns war.
»Irgendwie läuft das nicht so recht mit meiner Malerei. Wenn ich mir die Bilder von anderen Leuten ansehe, habe ich das Gefühl, dass das jeder könnte, aber wenn man erst einmal selbst zum Pinsel greift, dann merkt man, wie schwierig das ist!« So weit mein Herr. Von welch tiefer Wahrheit seine Bemerkung doch durchdrungen ist! Sein Freund sah ihn über den Goldrand seiner Brille hinweg an und meinte: »Aber freilich! Natürlich malt man nicht schon vom ersten Tag an wie ein Meister, und man kann sowieso keine Bilder malen, wenn man nur von den Fantasien lebt, denen man in seinen eigenen vier Wänden nachhängt. Andrea del Sarto, der große Meister aus Italien, hat einmal Folgendes bemerkt: ›Beim Malen ist stets die Natur zu kopieren! Am Himmel stehen die Gestirne. Auf der Erde liegt funkelnder Tau. Es fliegen die Vögel. Es hasten die wilden Tiere. Im Teich schwimmen Goldfische. Auf einem winterlich kahlen Baum sitzen Krähen. Die gesamte Natur ist ein einziges Bild, das vom Leben durchpulst wird.‹ Wie wär’s also, wenn du es einmal mit realistischen Skizzen versuchen würdest, falls du tatsächlich Bilder malen willst, die eine Ähnlichkeit mit Bildern haben!«
»Wie!? Andrea del Sarto hat das einmal tatsächlich gesagt!? Und ich weiß nichts davon!! Wirklich ein trefflicher Ausspruch! Haargenau so ist es!«, sagte mein Herr mit grenzenloser Bewunderung. In den Augen hinter dem Goldrand der Brille flackerte ein spöttisches Lachen.
Als ich am nächsten Tag, wie gewöhnlich, auf der Veranda ein erquickendes Schläfchen hielt, trat mein Herr – und das war alles andere als gewöhnlich – aus seinem Studierzimmer und hantierte mit großer Betriebsamkeit hinter meinem Rücken herum. Plötzlich war ich wach und öffnete meine Augen einen Spalt weit, um zu sehen, was er tat: Und da war er und spielte Andrea del Sarto, als gelte es sein Leben. Bei seinem Anblick musste ich unwillkürlich lachen. Der Spott seines Freundes war nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen, und er benutzte tatsächlich mich als Opfer für seine erste Skizze. Geschlafen hatte ich bereits zur Genüge. Und jetzt hatte ich das unwiderstehliche Bedürfnis zu gähnen. Aber da mein Herr eigens zum Pinsel gegriffen hatte und so voller Enthusiasmus bei der Arbeit war, hatte ich nicht das Herz, mich zu bewegen, und übte mich in Geduld. Er war mit meinen Umriss fertig und kolorierte nun mein Gesicht. Und ich habe an dieser Stelle etwas zu bekennen. Ich bin als Katze keineswegs ein Erzeugnis von Meisterhand. Sei es mein Rücken, sei es mein Fell, sei es die Gestaltung meines Gesichtes: Weiß der Himmel, ich schätze mich in keinster Weise als gelungener ein als andere Katzen. Und doch sah ich mich außerstande, so hässlich ich auch sein mag, zwischen mir und der seltsamen Gestalt, die mein Herr gerade zeichnete, irgendeine Ähnlichkeit zu entdecken. Es fing bei der Farbe an: sie stimmte nicht. Wie bei den Katzen Persiens ist mein Fell von einem delikaten Hellgrau, das einen leichten Stich ins Gelbe aufweist, und in das Hellgrau eingearbeitet sind Tupfen, die wie Lack glänzen. Dies, zumindest dies ist eine Tatsache, die niemand bezweifeln kann, der im Kopfe Augen hat. Unter den Farben jedoch, die mein Herr verwendete, war weder Gelb noch Schwarz, war weder Grau noch Braun. Und wenn Sie meinen sollten, dass diese Farbe eine Mischung aus allem war, dann irren Sie sich ebenfalls. Alles, was sich konstatieren lässt, ist, dass es sich bei dieser Farbe um irgendeine Art von Farbe handelte. Und was noch befremdlicher war: Die Gestalt besaß keine Augen! Nun, da er mich im Schlafe porträtierte, war dies nicht gänzlich abwegig, da die Augen aber nicht einmal angedeutet waren, blieb offen, ob es sich um eine blinde oder um eine schlafende Katze handelte. Insgeheim war ich überzeugt, dass auch Andrea del Sarto dieses Bild für einen Fehlschlag gehalten hätte. Andererseits konnte ich nicht umhin, seinem Eifer Beifall zu zollen. Weswegen ich mich auch nicht bewegen wollte, soweit mir dies eben möglich war, aber seit geraumer Zeit verspürte ich Harndrang. Jeder einzelne Muskel in meinem Körper zuckte bereits. Als dann keine Sekunde mehr zu verlieren war, beging ich ungewollt die Taktlosigkeit, meine Vorderpfoten weit von mir zu strecken, meinen Kopf tief am Boden nach vorne zu schieben und mächtig zu gähnen. Und nun war es einerlei, ob ich noch länger den Braven spielte oder nicht. Da das ursprüngliche Konzept meines Herrn ohnehin schon zerstört war, konnte ich bei der Gelegenheit auch gleich hinter das Haus gehen und mein Geschäft verrichten; ich stand also auf und trabte gemächlich davon. Und was tat mein Herr!? Er brüllte mich mit einer Stimme, in der sich Enttäuschung und Wut vermischten, aus dem Zimmer heraus an und schrie: »Du verdammter Blödmann!« Mein Herr hat die enervierende Gewohnheit, Leute, die er beschimpft, ausnahmslos als ›verdammte Blödmänner‹ zu bezeichnen. Da damit sein Repertoire an Schimpfwörtern erschöpft ist, mag das hingehen, aber dass er nun, völlig unsensibel meinen Gefühlen gegenüber, mich, der ich bis dato stillgehalten hatte, einen ›verdammten Blödmann‹ nannte, war impertinent. Hätte er mir nur immer wenigstens ein kleines Lächeln geschenkt, wenn ich ihm auf den Rücken sprang, hätte ich diese ungerechtfertigte Beschimpfung hingenommen, aber obwohl er noch nie freudigen Herzens für mich etwas getan hat, was mir zu Frommen und Nutzen gewesen wäre, finde ich es doch bodenlos, mich einen ›verdammten Blödmann‹ zu nennen, nur weil ich zum Urinieren ging. Erfüllt von selbstgefälligem Dünkel, der sich aus ihrer Körperkraft ableitet, sind alle Menschen von einer erstaunlichen Überheblichkeit. Wenn nicht Wesen auftauchen, die, ein wenig stärker als die Menschen selbst, diese schikanieren werden, weiß ich nicht, welch ungeahnte Höhen ihre Anmaßung noch erreichen wird.
Diese Art von Anmaßung wäre ja noch zu ertragen, aber einmal hörte ich eine beklagenswerte Geschichte, die zeigt, dass die moralische Verkommenheit der Menschen ihre Unsensibilität bei Weitem übersteigt.
Hinter unserem Haus liegt ein Teefeld von etwa neunzig Fuß im Geviert. Es ist zwar nicht groß, aber wirklich ein herzerwärmend sonniges Plätzchen. Wenn unsere Kinder wieder einmal zu viel Radau machen, als dass ich in Ruhe und Frieden mein Mittagsschläfchen halten könnte, oder wenn mir die Langeweile schmerzhaft auf den Magen schlägt, pflege ich immer dorthin zu gehen, um mich moralisch wieder aufzurüsten. An einem milden Tag im Altweibersommer lenkte ich, um mir etwas Bewegung zu verschaffen, gegen zwei Uhr nachmittags nach einem postmittäglichen erholsamen Schläfchen meine Schritte zu diesem Teefeld. Ich schnupperte an den Wurzeln eines jeden Teestrauchs, und als ich zu dem Zedernzaun an der Westseite kam, lag da ein großer Kater auf einem Beet mit verwelkten Chrysanthemen, die er mit seinem Gewicht zusammendrückte. Er schlief wie ein Toter. Er lag seiner ganzen Länge nach ausgestreckt da und schnarchte so unbekümmert in den höchsten Tönen, als ob er mein Näherkommen nicht bemerken würde oder als ob es ihm völlig einerlei sei, selbst wenn er es bemerkte. Mir verschlug es einfach die Sprache, und Bewunderung erfüllte mich angesichts seines unerschrockenen Mutes: Sind Leute, die sich in fremde Gärten einschleichen, tatsächlich in der Lage, derart seelenruhig zu schlafen? Der Kater war von reinster Schwärze. Die Sonne, die ihren Zenit noch kaum überschritten hatte, warf ihre transparenten Strahlen auf sein Fell, und aus seinen glänzenden, kurzen Haaren schienen unsichtbare Flammen emporzulodern. Seine Statur war für eine Katze so grandios, dass man ihm den Titel Großfürst zugestehen musste. Er war ganz gewiss zweimal so groß wie ich. Erfüllt von Bewunderung und Neugierde, vergaß ich völlig meine Umgebung, trat vor ihn hin und betrachtete ihn andächtig: Der sanfte spätsommerliche Wind rührte leicht an die Zweige des Phoenixbaumes, die über den Zedernzaun hingen, und zwei, drei Blätter fielen auf das Dickicht der verwelkten Chrysanthemen. Mit einem Schlag riss der Großfürst seine kreisrunden Augen auf. Meine Erinnerung an diesen Anblick ist so deutlich wie an jenem Tag. Seine Augen strahlten, und dieses Strahlen übertraf in seiner Schönheit bei Weitem das Leuchten des Bernsteins, den die Menschen so sehr schätzen. Er lag völlig unbeweglich da. Das Licht, das gleichsam aus der Tiefe seiner Augen strahlte, ruhte auf meiner kleinen und schwachen Stirn, und er fragte, was zum Teufel ich denn sei. Mir dünkte zwar, dass seine Wortwahl für einen Großfürsten etwas vulgär war, da sich jedoch in der Tiefe seiner Stimme eine fürchterliche Kraft verbarg – sie hätte sogar einen Teufel oder Hund das Fürchten gelehrt –, erfüllte sie mich mit nicht geringer Ehrfurcht. Da ich befürchtete in die Bredouille zu geraten, wenn ich ihm nicht meinen Gruß entbot, antwortete ich so gefasst und kühl wie möglich: »Gestatten, ich bin ein Kater. Unbenamst bislang.« Mein Herz allerdings schlug in diesem Moment wesentlich heftiger als gewöhnlich. Er aber antwortete in einem reichlich überheblichen und ziemlich arroganten Tonfall: »Wat denn! Du und’n Kater!? Haste da noch Töne! Wo lebste denn eigentlich?« – »Ich gehöre zum Haushalt des Lehrers, der hier wohnt.« – »Det dacht ick mir. Biste nich’n bisschen arg dürr?« Er nahm den Mund ganz schön voll. Typisch Großfürst! Aus seiner Diktion schloss ich, dass er kaum aus gutem Hause stammen konnte. Wenn ich mir aber andererseits ansah, wie dick und fett er war, schien er wie ein König zu leben und an leckeren Mahlzeiten ganz gewiss keinen Mangel zu leiden. Ich konnte nicht anders, ich musste einfach fragen: »Und wer bist eigentlich du?« – »Ick bin Kater Schwarz, vom Rikschakutscher der!« Stolzer Ton, stolze Worte. Kater Schwarz vom Rikschakutscher war ein Rabauke, den in unserer Gegend jeder kannte. Da er im Haus des Rikschakutschers lebte, war er natürlich kräftig, gesellschaftlichen Umgang aber pflegte mit ihm fast niemand, weil er nicht über ein Gran Bildung verfügte. Jeder von uns ging ihm aus dem Weg. Als ich nun seinen Namen hörte, fühlte ich mich einerseits nicht ganz wohl in meiner Haut, gleichzeitig aber stieg in mir eine gewisse Verachtung auf. Ich wollte sehen, wie weit seine Ignoranz in Dingen der Gelehrsamkeit reichte, und dabei entwickelte sich folgendes Frage-und-Antwort-Spiel.
»Wen hältst du eigentlich für bedeutender: Rikschakutscher oder Lehrer?«
»Natürlich Rikschakutscher! Keene Frage, die sind stärker. Guck dir doch deenen Herrn an. Nüscht wie Haut und Knochen.«
»Du selbst siehst ja auch ziemlich kräftig aus. Kein Wunder, da du bei einem Rikschafahrer lebst. Wenn man dich so ansieht, scheinst du zu Hause ausreichend zu essen zu bekommen.«
»Ach weeßte, ick hab nich die Absicht, Hunger zu leiden, egal, wo ick ooch bin! Lass det man, det Herumstrolchen uff dem Teefeld. Mir nach! Und in wenja als eenem Monat wirste so anjefressen sein, dat dich keener mehr kennt!«
»Ich werde mir erlauben, später auf dieses Angebot zurückzukommen. Aber sieh dir doch mal unsere beiden Häuser an: Ich habe das Gefühl, dass mein Lehrer in einem größeren Haus wohnt als dein Rikschakutscher.«
»Blödmann! Magn Haus so jroß sein, wie et will, satt wirste davon nich!!«
Er schien ziemlich wütend zu sein, seine Ohren, die scharf wie Klingen waren, zuckten von einer Seite zur anderen, und schließlich stürmte er wild davon. Von da an gehörte ich zum Bekanntenkreis des Katers Schwarz vom Rikschakutscher.
Nach dieser Begegnung traf ich gelegentlich mit Kater Schwarz zusammen. Und bei jeder Begegnung nahm er, wie es sich eben für den Kater eines Rikschakutschers gehört, den Mund mehr als voll. Auch über jenen Fall von moralischer Verkommenheit, von dem ich weiter oben geschrieben habe, dass er mir zu Ohren gekommen sei, war ich in Wirklichkeit von Schwarz unterrichtet worden.
Eines Tages lagen ich und Kater Schwarz wie üblich auf der warmen Erde des Teefeldes herum und plauderten über dies und jenes, und als er mit einer Geschichte über seine Großtaten fertig war, die er immer wieder so erzählt, als würde er sie nicht zum hundertsten, sondern zum ersten Mal erzählen, stellte er mir folgende Frage: »Wie viele Mäuse haste denn schon jefangen?« Meine intellektuellen Fähigkeiten dürften weitaus höher entwickelt sein als die von Schwarz, mir war aber klar, dass ich, soweit es Körperkraft und Mut betraf, niemals einen Vergleich mit ihm aushalten konnte, sodass ich mich nun, konfrontiert mit dieser Frage, trotz meiner intellektuellen Fähigkeiten peinlich berührt fühlte. Da aber Tatsachen nun einmal Tatsachen sind, hatte es keinen Sinn, mich ins Reich der Fabeln zu begeben, und so antwortete ich: »Ich habe mir zwar immer wieder vorgenommen, eine zu fangen, bis jetzt aber ohne Erfolg.« Schwarz stieß ein fürchterliches Lachen aus, und ein wildes Zucken lief durch seine langen Schnurrbarthaare, die wie spitze Nadeln von seiner Nasenspitze aus in den Äther stachen. Irgendwie stellen Schwarz seine eigenen Prahlereien nie ganz zufrieden, und wenn man ihm nur hingebungsvoll zuhört und ein tiefes Schnurren der Bewunderung zustande bringt, kann man im Grunde mit ihm machen, was man will. Bald nachdem ich ihn kennengelernt hatte, hatte ich diesen Mechanismus begriffen, weshalb ich es auch jetzt nicht für ratsam hielt, mich mit meiner Unvollkommenheit zu verteidigen und so die Situation nur noch zu verschlimmern, und deshalb entschloss ich mich, ihn lieber zum Reden über seine eigenen verdienstvollen Taten zu bringen: Denn nichts geht über trüben Tee, den man nicht selber trinken muss. Also sprach ich artig: »In deinem reifen Alter dürftest du ja schon eine gewaltige Menge gefangen haben!« Er fiel tatsächlich auf mich herein. Wie ich erwartet hatte, stürzte er sich mit Kampfgeschrei auf diesen Köder, der ihm wie eine Lücke in einer Mauer erscheinen musste. Und so lautete seine stolze Antwort: »So doll isset jar nich, aber dreißig, vierzig werdens schon jewesen sein! Wenn et um Mäuse jeht, nehm ick et alleene mit hundert oder zweihundert auf, aba mit Wiesln, mit Wiesln hab ick meene Schwierigjeiten. Eenmal hatte ick mitm Wiesel eenen fürchterlichen Zusammenstoß.« – »Ja, was du nicht sagst!« Lob und Zustimmung für Kater Schwarz. Der blinzelte mit seinen großen Augen und fuhr fort: »’s war letztes Jahr beim jroßen Reinemachen. Mein Herr, der kriecht mitin Sack voller Kalk unter die Veranda, und – wat soll ick dir sajen! – da saust in Panik ein Riesenkerl von eenem Wiesel raus.« – »Du meine Güte!« Bewunderung für Kater Schwarz. »Nu, een Wiesel, denk ick ma. Wiesel sind ooch kaum jrößer wie Mäuse. Ick denk ma bloß: ›Det Miststück!‹ und sause hinter ihm her – und stell dir det mal vor! – ick treibe det Vieh schließlich in’n Abflussjraben!« – »Bravouröse Tat!« Stürmischer Beifall von meiner Seite. »Hat sich wat! Weeßte, als det Wiesel merkt, dass et ihm an den Kragen jeht, bläst det Vieh mir eenen Furz ins Jesicht. Himmel, wat’n widalicher Jestank! Seither, weeßte, wird ma übel, wenn ick een Wiesel seh!« An dieser Stelle seiner Erzählung hob er eine Vorderpfote und fuhr sich einige Male über die Nasenspitze, als stiege ihm der Odeur des letzten Jahres abermals in die Nase. Ich verspürte ein wenig Mitleid mit ihm. Also muntern wir ihn etwas auf, dachte ich, und fragte: »Wenn du aber eine Maus siehst, dann ist es doch sicher mit ihr aus! Du hast als Mäusejäger einen großen Namen, und du hast doch deswegen eine so wohlgenährte Figur und ein glänzendes Fell, weil du nur von Mäusen lebst!?« Meine Frage, mit der ich Schwarz schmeicheln wollte, hatte mysteriöserweise den entgegengesetzten Effekt. Mit einem tiefen Seufzer sagte er: »Et macht eenen janz krank, wenn man denkt, dat man schuftet, man fängt Mäuse, und wat ist det Erjebnis!? In dieser Welt jibt’s nix und niemand, det so uffjeblasen wie’n Mensch war. Alle Mäuse, die ick oder ooch nich icke jefangen habe, nehmen sie eenem wech und bringen see uff de Polizei. Und uff da Wache wissen die natürlich nich, wer die Maus jefangen hat, und jeben dem, der see bringt, jeweils fünf Sen. Und obwohl mein Herr dank meener Hilfe bereits eenen Yen und fünfzich Sen einjesackt hat, jibt er mir nich mal wat Ordentliches zu essen. Menschen, weeßte, sind Diebe, die sich nach außen hin wie Biedamänner jeben!« Es schien, als ob Kater Schwarz trotz seiner Ignoranz in geistigen Dingen diese Tatsache so weit begriffen hätte. Er sah fürchterlich zornig aus, und seine Rückenhaare sträubten sich. Ich fühlte mich plötzlich nicht mehr so besonders gut und ging unter irgendeinem Vorwand nach Hause. Ich fasste den unumstößlichen Entschluss, mich in Zukunft unter keinen Umständen mit einer Maus einzulassen. Aber ich wurde auch kein Gefolgsmann von Schwarz, um mit ihm hinter anderen Speisen als Mäusen herzujagen. Was mir in erster Linie gut kam, war Schlaf, Essen war nicht so wichtig. Es hat ganz den Anschein, dass auch ein Kater, sobald er im Hause eines Lehrers wohnt, die Eigenschaften eines Schulmeisters annimmt. Wenn ich nicht auf der Hut bin, werde auch ich möglicherweise schon bald an Dyspepsie leiden.
Weil wir gerade bei Lehrern sind: Kürzlich scheint auch mein Herr erkannt zu haben, dass seine Bemühungen um die Aquarellmalerei völlig hoffnungslos sind. Am 1. Dezember notierte er in sein Tagebuch Folgendes:
Traf bei unserer heutigen Versammlung zum ersten Mal Herrn XY. Soll ein ziemlich ausschweifendes Leben geführt haben, und er hat in der Tat etwas von einem Lebemann an sich. Da Leute seiner Art von den Frauen geliebt werden, ist es vermutlich zutreffender zu sagen, dass XY nicht ein ausschweifendes Leben geführt hat, sondern zu einem solchen verführt wurde. Seine Frau soll als Geisha gearbeitet haben. Wirklich beneidenswert! Die meisten Menschen, die sich abfällig über Lüstlinge äußern, besitzen selbst keinerlei Qualifikationen zu einem derartigen Leben. Auch unter jenen, die sich selbst für Lebemänner halten, gibt es viele, die keinerlei Qualifikationen für irgendwelche Ausschweifungen besitzen. Obwohl niemand sie zu einem derartigen Leben zwingt, machen sie ohne Sinn und Verstand weiter. Es ist gleichsam wie mit meinen Aquarellen: Keiner von uns dürfte jemals einen Meisterbrief erhalten. Und dennoch denkt jeder von sich, dass nur er ein Lebemann sei. Aber wenn dem so wäre, dass man nur in Lokalen Sake trinken und Geisha-Häuser frequentieren müsste, um ein Mann von Welt zu werden, dann könnte, im Lichte dieser Logik, auch ich ein exzellenter Aquarellmaler werden. Genauso wie es für meine Aquarelle besser ist, nicht gemalt zu werden, stehen Bauern und Hinterwäldler hoch über diesen debilen Männern von Welt.
Diese Theorie über die Männer von Welt findet nicht ganz meine Zustimmung. Und dass es beneidenswert sein soll, eine Geisha zur Frau zu haben, ist für einen Lehrer ein abgrundtief dummer Gedanke, der besser nicht laut ausgesprochen werden sollte. Berechtigt ist allerdings der kritische Blick, mit dem er seine Aquarelle sieht. Ungeachtet der Tatsache, dass auf diese Weise in ihm das Licht der Selbsterkenntnis entzündet wurde, verschwindet seine eitle Selbstgefälligkeit nicht so ohne Weiteres. Wir überspringen zwei Tage und finden am 4. Dezember folgenden Eintrag:
Träumte, dass irgendjemand ein Aquarell, das ich gestern Abend gemalt hatte und das einfach nicht gelingen wollte, von jenem Platz aufhob, an den ich es gefeuert hatte, es mit einem prächtigen Rahmen versah und im Oberlicht aufhängte. Nun da es gerahmt war, sah es, trotz meiner bescheidenen Fertigkeiten, plötzlich großartig aus. War überglücklich. Überzeugt, ein fabelhaftes Bild vor mir zu haben, war ich lange Zeit in seine Betrachtung versunken; als ich aber am Morgen erwachte, erkannte ich mit einer Klarheit, die der Transparenz der Strahlen der Morgensonne in nichts nachstand, dass das Bild immer noch so verunglückt war wie am Abend zuvor.
Selbst in seinen tiefsten Träumen scheint sich mein Herr nicht von den Obsessionen der Aquarellmalerei befreien zu können. Und somit ist sein Charakter nun wahrlich nicht dafür geschaffen, Aquarellmaler zu werden, geschweige denn einer jener Männer von Welt, wie sie mein verehrter Meister in seinem Tagebucheintrag beschrieb.
Einen Tag nachdem mein Herr von seinem Aquarellbild geträumt hatte, besuchte ihn nach langer Zeit wieder einmal der Ästhetiker mit der Goldbrille. Als er Platz genommen hatte, brach er mit folgender Frage das Schweigen: »Wie läuft’s mit der Malerei?« Mein Herr war die Ruhe selbst. »Ich bin deinem Rat gefolgt und habe es mit Skizzen versucht, und – was soll ich dir sagen! – ich habe das Gefühl, dass man beim Skizzieren die Formen der Dinge und delikate Farbwechsel begreift, Dinge also, die einem bis dato überhaupt nicht zu Bewusstsein gekommen sind. Mir scheint, dass sich infolge des großen Nachdrucks, den man im Westen seit einer Ewigkeit auf das Skizzieren legt, die Malerei dort so weit entwickelt hat. Justament wie Andrea del Sarto sagte!« Abermals große Bewunderung für Andrea del Sarto, und kein Sterbenswörtchen über seinen Tagebucheintrag. Lachend sagte der Spezialist für Ästhetik: »Um dir die Wahrheit zu gestehen, das war alles nur Humbug!« und kratzte sich am Kopf. »Was das?«, fragte mein Herr, der immer noch nicht bemerkte, dass er an der Nase herumgeführt worden war. »Tja, was das!? Die Sache mit Andrea del Sarto natürlich, für den du so tiefe Bewunderung hegst. Ich habe mir die ganze Geschichte nur ausgedacht. Ich hätte ja nicht vermutet, dass du mir derart bedingungslos glauben würdest, hahaha!« Der Spezialist für Ästhetik schien höchst entzückt. Ich verfolgte von der Veranda aus ihre Unterhaltung und konnte nicht umhin, mir schon einmal auszumalen, wie der heutige Tagebucheintrag meines Herrn lauten würde. Der Ästhetikspezialist ist ein Mann, der nur eine einzige Freude kennt: nämlich überall substanzlose Geschichten herumzuerzählen und damit die Leute auf den Arm zu nehmen. Er schien nicht im Geringsten zu bedenken, welche Auswirkungen die Andrea-del-Sarto-Affäre auf das Gemüt meines Herrn haben konnte, denn selbstgefällig setzte er seine hurtige Zunge wieder in Bewegung. »Nein, nein! Wenn ich von Zeit zu Zeit einen Scherz zum Besten gebe und die Leute das für bare Münze nehmen, erregt das ein ästhetisches Gefühl von beträchtlicher Komik in mir, und das amüsiert mich. Kürzlich erzählte ich einem Studenten, dass Gibbon[10], auf den Rat von Nicholas Nickleby[11] hin, aufhörte, sein epochales Monumentalwerk Die Geschichte der Französischen Revolution auf Französisch zu schreiben, und es auf Englisch erscheinen ließ, und dieser dent, der ein geradezu idiotisch gutes Gedächtnis hat, wiederholte auf einem Vortragsabend der ›Literarischen Gesellschaft Japans‹ in vollem Ernst und wortwörtlich diese Geschichte. War sehr spaßig! An diesem Abend waren übrigens an die hundert Zuhörer anwesend, und die hingen ausnahmslos voller Andacht an seinen Lippen. Und ich habe noch eine amüsante Geschichte für dich. Kürzlich war ich in Gesellschaft eines gewissen Literaten, und als das Gespräch auf Harrisons[12] Geschichtsroman Theophano kam, sagte ich, dass man unter Geschichtsromanen seinesgleichen nicht noch einmal finden würde. Als ich dann insbesondere die Szene, in der die Protagonistin stirbt, als eine Textpassage von atemberaubender Dämonie würdigte, nickte mir eine mir gegenübersitzende Persönlichkeit von Rang und Namen, die in ihrem ganzen Leben noch kein einziges Mal ›Davon habe ich keine Ahnung‹ gesagt hat, zustimmend zu und meinte, dass diese Stelle in der Tat nachgerade eine Perle der Prosakunst wäre. Wodurch hinwiederum mir klar wurde, dass dieser Mann, genauso wie ich selbst, niemals diesen Roman gelesen hatte.« Mein Herr mit seiner Dyspepsie bekam ganz große Augen und fragte: »Und was hättest du getan, wenn sich herausgestellt hätte, dass dein Gegenüber diesen Roman kannte, nachdem du diesen Unsinn verzapft hattest?« Das klang ganz so, als hätte er überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass jemand beschwindelt wurde; Sorgen schien er sich lediglich darüber zu machen, dass es peinlich werden könnte, wenn sich ein Schwindel als solcher entpuppt. Der Ästhetikspezialist blieb ungerührt. »Was für eine Frage! Dann hätte ich eben zum Beispiel gesagt, dass ich das Buch mit einem anderen verwechselt habe!«, versetzte er und lachte wiehernd. Der Ästhetikspezialist trägt zwar eine Goldbrille, aber charakterlich weist er Gemeinsamkeiten mit Schwarz vom Rikschakutscher auf. Mein Herr fabrizierte mit seiner Zigarette, Marke ›Hinode‹, Rauchringe und guckte, als wollte er sagen: Den Mut hätte ich nie! Und der Ästhetikspezialist guckte, als wollte er sagen: Mit Sicherheit nicht! Und darum kannst du das Malen auch sein sen! –, laut aber sagte er: »Doch genug der Scherze! Die Malerei ist wirklich ein schwieriges Gebiet. Leonardo da Vinci soll einmal einen Schüler angewiesen haben, einen Fleck an einer Klostermauer zu kopieren. Welch treffliche Anweisung! Wenn man sich in einem Klo einschließt und konzentriert die Wasserflecken an der Wand betrachtet, kommen von selbst ganz großartige Muster zum Vorschein. Du solltest wirklich deine Augen offenhalten und Skizzen nach der Natur anfertigen, du würdest dann nämlich mit Sicherheit etwas Interessantes zustande bringen.« – »Du willst mich wohl wieder reinlegen?!« – »Aber keineswegs! Der Rat ist wirklich Gold wert. Findest du den Vorschlag mit dem Klo nicht originell? Könnte ebenso gut auch von da Vinci stammen.« – »Ja, zweifellos originell«, sagte mein Herr, der schon halb kapituliert hatte. Ich habe jedoch den Eindruck, dass er bis zum heutigen Tag noch keine Skizzen auf dem Klo angefertigt hat.
Schwarz vom Rikschakutscher lahmt seit einiger Zeit. Sein Fell hat jeglichen Glanz verloren, und ihm gehen die Haare aus. Seine Augen, die ich schöner als Bernstein fand, sind voller Schleim. Vor allem zwei Dinge sind mir besonders aufgefallen: seine Niedergeschlagenheit und sein schlechter körperlicher Zustand. Als ich ihn zum letzten Mal in unserem Teefeld traf und ihn fragte, wie es ihm denn ginge, meinte er: »Ick hab die Nase voll von Wieselfürzen und der Trajestange vom Fischhändler.«
Die Ahornblätter, die in verschiedenen Rottöncn zwischen den Kiefern glühten, sind wie in einem Traum aus alten Zeiten abgefallen, und die roten und weißen Kamelien am Wasserbecken, die ein Blütenblatt nach dem anderen verloren haben, stehen nun vollkommen kahl da. Auf unserer Südveranda mit ihren achtzehn Fuß im Geviert geht die winterliche Sonne früh unter, und seitdem die Tage, an denen kein kalter Wind weht, äußerst selten geworden sind, habe ich das Gefühl, dass sich auch die Zeit für meine Mittagsschläfchen bedrohlich verkürzt hat. Mein Herr geht täglich zur Schule. Wieder zu Hause, vergräbt er sich in seinem Studierzimmer. Kommt Besuch, klagt er, dass ihn sein Leben anödet. Aquarelle malt er so gut wie nicht mehr. Und Takadiastase nimmt er auch nicht mehr, da die Arznei, wie er sagt, nichts bewirkt. Die beiden Kleinen gehen mit bewunderungswürdiger Regelmäßigkeit in den Kindergarten. Wieder zu Hause, singen sie Lieder, spielen Ball und lassen mich dann und wann am Schwanz baumeln.
Da ich weder Nahrhaftes noch Leckeres zu essen bekomme, bin ich schlank und rank wie eh und je; bei einigermaßen guter Gesundheit und ohne zu lahmen, verbringe ich Tag für Tag. Mäuse rühre ich unter keinen Umständen an. Unsere Küchenmamsell ist mir immer noch zuwider. Und noch niemand hat die Güte gehabt, mir einen Namen zu geben. Da aber nirgendwo alle Wünsche in Erfüllung gehen, habe ich die Absicht, mein Leben als namenloser Kater im Haus des Lehrers zu beschließen.
2
Seit Neujahr[1] bin ich mehr oder weniger berühmt: Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass ich, ein bloßer Kater, mich so in die Lage versetzt sehe, meine Nase etwas höher tragen zu können.
Früh am Neujahrsmorgen bekam mein Herr eine Ansichtskarte. Es handelte sich dabei um die Neujahrskarte von einem gewissen Freund meines Herrn, einem Maler. Der obere Teil der Karte war rot, der untere tiefgrün gehalten, und in der Mitte des Bildes war mit Pastellfarben ein Tier dargestellt, das zusammengekauert dalag. Mein Herr saß, wie es seine Art ist, in seinem Studierzimmer und betrachtete das Bild: von der Seite und der Länge nach. »Prächtige Farbgebung«, sagte er voller Bewunderung. Nachdem er seiner Bewunderung Ausdruck verliehen hatte, dachte ich mir, er würde die Karte weglegen – aber nein! –, er ließ seinen Blick abermals über sie wandern, zunächst über die Breitseite der Karte, dann über deren Längsseite. Er verdrehte seinen Körper; er streckte seine Arme aus und starrte auf das Bild, wie alte Leute es tun, wenn sie sich über ein Orakelbuch beugen; er drehte sich zum Fenster und hielt sich das Bild vor die Nase. Ich wünschte, er würde diese Prozedur beenden, da seine Knie zitterten und meine Lage mehr als unsicher war. Als nun endlich das heftige Beben seiner Knie nachließ, fragte er sich mit leiser Stimme, was das Bild wohl darstellen mochte. Es war also die Kolorierung der Karte, die mein Herr bewunderte, das darauf dargestellte Tier erkannte er jedoch nicht, weswegen er sich seit geraumer Zeit schrecklich abmühte, um dieses Rätsel zu lösen. Während ich mich fragte, ob das Bild tatsächlich so schwer zu begreifen war, öffnete ich vornehm zur Hälfte meine Augen und schenkte ihm einen gelassenen Blick: Es war, daran konnte kein Zweifel bestehen, ein Porträt von mir! Ich nehme kaum an, dass der Maler Sowieso wie mein Herr der Idee verfallen war, er könnte Andrea del Sarto sein, aber da er nun einmal Maler war, war meine Figur getreulich abgebildet, und auch die Farben stimmten. Zweifellos würde jeder, der das Bild sah, es als das Porträt einer Katze erkennen. Und dieses Porträt war so trefflich geraten, dass jeder, der über ein Quäntchen Urteilsvermögen verfügt, in aller Deutlichkeit erkennen musste, dass das Bild nicht irgendeine Katze zeigte, sondern mich. Als ich mich fragte, ob man sich wirklich derart schrecklicher Mühen unterziehen muss, um am Ende doch nicht zu erkennen, was klar zutage liegt, erfasste mich ein kleines Erbarmen mit den Menschen. Ich hätte, wenn es mir möglich gewesen wäre, meinem Herrn gerne zur Kenntnis gebracht, dass das Bild mich darstellte. Und wenn er dies nicht begriffen hätte, hätte ich ihm zumindest gerne begreiflich gemacht, dass das Bild eine Katze darstellte. Da jedoch die Menschen Tiere sind, denen der Himmel nicht die Gnade zuteilwerden ließ, die Sprache des Katzenvolkes zu verstehen, musste ich die Angelegenheit zu meinem Bedauern auf sich beruhen lassen.
An dieser Stelle möchte ich meinen Lesern doch mit aller Entschiedenheit eine Frage stellen: Für wen oder was halten sich denn eigentlich Menschen?!!? Ihre unselige Angewohnheit, mich gedankenlos in einem verächtlichen Ton ›Kater! Kater!‹ zu rufen, ist außerordentlich unbillig. Der Gedanke, dass Kühe und Pferde ihre Entstehung dem menschlichen Auswurf verdanken und Katzen aus dem Dung und Rossäpfeln von Kühen und Pferden produziert werden, dürfte bei Lehrern, die – nicht wissend von ihrer Unwissenheit – mit einem hochmütigen Gesicht herumlaufen, häufiger vorkommen, ist aber, objektiv betrachtet, intolerabel. Ja, sicher! Eine Katze ist nur eine Katze, aber nicht einmal wir entstehen auf eine derart primitive und simple Art und Weise. Für außenstehende Betrachter mag es den Anschein haben, dass Katze gleich Katze ist und jede Katze das Ebenbild einer anderen, von der sie nicht zu unterscheiden ist – geradeso, als ob nicht jede Katze über Charakteristika verfügte, die nur ihr zu eigen sind; mischt man sich aber in die Gesellschaft von Katzen, wird man bemerken, dass die Wirklichkeit weitaus komplizierter ist und der Spruch ›Tot caput tot mentes‹, der aus der Welt der Menschen stammt, ohne Modifikationen auch in unserer Welt mit Nutzen verwendet werden kann. Unsere Blicke, unsere Nasen, unser Fell und unser Gang: alles, aber auch alles ganz und gar voneinander verschieden. Angefangen von unseren Schnurrbärten bis hin zu der Anordnung unserer Ohren und der Art, wie wir unsere Schwänze hängen lassen: nicht ein Ding, dessen äußere Erscheinung wir mit einer anderen Katze teilten. Die einen sehen gut aus, die anderen sehen schlecht aus, die einen lieben dieses, die anderen verabscheuen jenes, die einen verfügen über Eleganz, die anderen sind taktlos: Die Unterschiede sind so groß, dass man sie getrost in der Nähe der Unendlichkeit ansiedeln kann. Aber ungeachtet der Existenz dieser offensichtlichen Unterschiede, ist es den Augen der Menschen, die, wie sie sagen, zur Erhebung ihrer Seelen oder was weiß ich gen Himmel gerichtet sind, unmöglich, Details in unserem Aussehen wahrzunehmen, und dass ihnen unsere inneren Qualitäten verschlossen bleiben, das versteht sich von selbst. Wirklich ein erbarmungswürdiger Zustand! Wie ich höre, gibt es seit Ewigkeiten den Ausspruch ›Gleich und gleich gesellt sich gern‹, und so verhält es sich in der Tat: Für Kuchenbäcker sind Kuchenbäcker zuständig und für Katzen Katzen. Von Katzen versteht niemand etwas, der nicht selbst eine Katze ist. Die Menschen mögen so hoch entwickelt sein, wie es ihnen beliebt, in dieser Angelegenheit zumindest sind sie nicht zu gebrauchen. Verschärft wird das Problem, um die Wahrheit zu sagen, dadurch, dass die Menschen bei Weitem nicht so bedeutend oder was weiß ich sind, wie sie selbst meinen. Und ein Mensch wie mein Herr – ein Mann, arm an Gefühlen für andere Wesen, ein Mann, der nicht einmal versteht, dass es die erste Pflicht der Liebe ist, sich gegenseitig restlos zu verstehen – ist von Natur aus ein hoffnungsloser Fall. Wie eine Auster mit einem schäbigen Charakter klammert er sich an seinem Studierzimmer fest, und noch nie hat er ein Wort an die Außenwelt gerichtet. Dabei läuft er mit einem Gesicht durch das Leben, als würde er alleine über ungeheuere Einsichten verfügen: Da lachen ja die Katzen! Als Beweis dafür, dass er über keine sonderlichen Einsichten verfügt, möge dienen, dass er auf der Karte tatsächlich nichts erkannte, obwohl sich mein Porträt vor seinen Augen befand. Abgeklärt murmelte er verrückte Dinge wie »Könnte vielleicht das Bild eines Bären sein, da wir uns ja im zweiten Jahr des Krieges gegen Russland[2] befinden!« Ich lag also auf den Knien meines Herrn und hing mit geschlossenen Augen diesen Gedanken nach, da kam auch schon das Dienstmädchen mit einer zweiten Postkarte. Ich warf einen Blick darauf: Ein Bild! Und das Bild war gedruckt und zeigte vier oder fünf europäische Katzen, wie sie auch nach Japan eingeführt werden, die in einer Reihe saßen und in Studien vertieft waren. In ihren Pfoten hielten sie Schreibfedern, vor ihnen lagen aufgeschlagene Bücher. Eine tanzte aus der Reihe, und zwar auf einer Ecke des Schreibtisches, und führte einen Katzen-Cha-Cha-Cha auf. Am oberen Rand der Karte hatte der Absender mit tiefschwarzer japanischer Tusche geschrieben: ›Gestatten, ich bin ein Kater!‹, und auf der rechten Seite stand sogar ein Haiku: ›Sie lesen Bücher! Sie tanzen und tanzen! Katzen im Lenz‹. Die Karte stammte von einem alten Schüler meines Herrn, und jedermann hätte schon auf den ersten Blick ihre Bedeutung erkennen müssen, mein tumber Herr aber, der noch nichts begriffen zu haben schien, verdrehte verwundert seinen Kopf und murmelte: »Ja, was denn! Schreiben wir das Jahr der Katzen?« Ihm schien immer noch nicht aufgegangen zu sein, wie berühmt ich mittlerweile bin.
In diesem Moment brachte das Mädchen die dritte Karte. Und dieses Mal eine ohne Bild. ›Ein glückliches Neues Jahr!‹, hieß es da, und weiter: ›Ich wäre Ihnen auch sehr zu Dank verpflichtet, wenn Sie dem Kater die freundlichsten Grüße übermitteln ten.‹ Mein Herr, so langsam er auch von Begriff ist, schien nun, da die Botschaft mehr als deutlich war, zu begreifen; er brummte, als wäre ihm endlich ein Licht aufgegangen, und schaute mir ins Gesicht. Ich hatte den Eindruck, dass in seinem Blick, ganz anders als bislang, so etwas wie Respekt lag. Und dieser Blick war auch, wie ich meinen möchte, nur recht und billig, wenn man bedenkt, dass mein Herr, dessen Existenz von der Öffentlichkeit bis vor Kurzem nicht zur Kenntnis genommen worden ist, es zur Gänze mir zu verdanken hatte, wenn er nun plötzlich zu Ansehen gelangt.
In diesem Moment ertönte das helle Bimmeln der Glocke an der Eingangstür. Wahrscheinlich ein Besucher, und wenn es denn einer sein sollte, würde ihn das Mädchen schon hereinbitten. Da ich mich entschlossen hatte, niemals vor die Tür zu gehen, wenn nicht gerade der Laufbursche vom Fischhändler kam, blieb ich seelenruhig auf den Knien meines Herrn sitzen. Der sah mit besorgtem Blick zum Eingang, als könnte ein Zinswucherer oder dergleichen ins Zimmer marschiert kommen. Es schien ihm mehr als zuwider zu sein, Neujahrsbesucher zu empfangen und mit ihnen ein Schälchen Sake zu trinken. Ein derart verschrobener Mensch verdient schon wieder Applaus. Wenn ihm das schon so zuwider ist, sollte er am Neujahrstag in aller Frühe das Haus verlassen, aber dazu fehlt ihm der Mut: Mehr und mehr offenbarte sich das wahre Wesen einer Auster. Nach einer Weile kam das Mädchen herein und meldete, ein Herr Kaltmond sei zu Besuch da. Kaltmond war, wie man sich erzählte, ein alter Schüler meines Herrn, der nach dem Abschluss seines Studiums eine weitaus glänzendere Position als sein früherer Lehrer erreicht hatte. Aus einem mir unbekannten Grund kommt er oft zu uns zu Besuch. Und kaum ist er da, reiht er Phrase an Phrase: Eine Frau scheine ihn zu lieben, nein, keine Frau scheine ihn zu lieben, das Leben sei herrlich, nein, doch zu beschwerlich, es sei fantastisch und zutiefst romantisch. Es ist rätselhaft genug, dass er einen Menschen wie meinen Herrn, der am Verwelken ist, aufsucht und gerechnet ihm all diese Geschichten erzählt, noch interessanter aber ist, dass mein austernartiger Herr sich diese Geschichten auch anhört und Kaltmond gelegentlich sogar zustimmt.
»Tut mir leid, dass ich dich so lange vernachlässigt habe. Aber da ich seit Ende des letzten Jahres in zahlreiche Unternehmungen verwickelt bin, haben mich – obwohl ich dich immer wieder besuchen wollte – meine Füße nicht in deine Richtung getragen.« Mit dieser rätselhaften Bemerkung eröffnete Kaltmond das Gespräch und nestelte dabei an den beiden Bändern seines Haori[3]. »Und wohin haben dich deine Füße getragen?« Mein Herr machte ein ernstes Gesicht und zerrte am Ärmelaufschlag seines schwarzen Haori mit dem Familienwappen. Der Haori ist aus Baumwolle, und seine Ärmel sind so kurz, dass das dünne Seidenfutter links und rechts einen halben Zoll herausschaut. »Hähä, in eine etwas andere Richtung!« Kaltmond lachte. Ich bemerkte, dass einer seiner Vorderzähne fehlte. »Was ist mit deinem Zahn passiert?« Mein Herr wechselte das Thema. »Ja, um die Wahrheit zu sagen, ich habe irgendwo Pilze gegessen …« – »Was, sagst du, hast du gegessen?« – »Pilze! Pilze habe ich gegessen. Als ich die Kappe eines Pilzes abbeißen wollte, brach ein Vorderzahn ab.« – »Was denn! Ein Biss in einen Pilz, und dir bricht ein Vorderzahn ab? Das riecht ja sehr nach Senilität! Das ist vielleicht der Stoff, aus dem Haiku gemacht werden, für eine Liebesgeschichte aber taugt der Vorfall nicht!«, sagte mein Herr und schlug mir mit der flachen Hand leicht auf den Kopf. »Aah! Ist das der Kater, von dem alle Welt spricht? Ganz schön beleibt, oder?! Mit dieser Figur dürfte er selbst für Schwarz vom Rikschakutscher ein ernsthafter Gegner sein. Prächtiger Bursche!« Kaltmond sang ein hohes Lied auf mich. »In der letzten Zeit ist er ziemlich groß geworden«, sagte mein Herr und schlug mich wieder selbstgefällig auf den Kopf. Kaltmonds Lob erfüllte mich mit Stolz, aber mein Kopf schmerzte ein wenig. »Vorgestern Nacht gaben wir ein kleines Konzert.« Kaltmond kehrte zu seinem eigentlichen Gesprächsthema zurück. »Wo?« – »Wo auch immer! Das dürfte doch wohl belanglos sein. Wir hatten bei dem Konzert, das wirklich unterhaltsam war, drei Violinen, die von einem Klavier begleitet wurden. Weißt du, wenn man drei Violinen zur Verfügung hat, kann sich das Ergebnis immer hören lassen, auch wenn schlecht gespielt wird. Zwei der Violinen wurden von Frauen gespielt, und ich saß zwischen den beiden und spielte die dritte. Ich selbst hatte den Eindruck, gut gespielt zu haben.« – »Hm. Die Frauen, von denen du sprichst, wer waren die?«, fragte mein Herr neiderfüllt. Eigentlich ist mein Herr jemand, der für gewöhnlich mit verschlossener Miene durch das Leben geht – indifferent wie ein dürrer Baum und kalt wie ein Stein, in Wirklichkeit aber sind ihm Frauen alles andere als gleichgültig. Einmal las er einen europäischen Roman, in dem ein Mann vorkam, der sich unweigerlich ein wenig in fast alle Damen verliebte, denen er begegnete. In dem Buch wurde ironisch vermerkt, dass der Mann sich, grob geschätzt, in knapp 70 % aller Damen verliebte, die an ihm vorübergingen, und mein Herr bewunderte das sehr, da er darin eine essenzielle Wahrheit erblickte. Fragt man mich nun, wieso dieser liebestolle Mann das Leben einer Auster führt, so weiß ich darauf keine einzige Antwort. Manche sagen: wegen einer unglücklichen Liebschaft; andere meinen: wegen seines schwachen Magens; und wieder andere: er hätte kein Geld und wäre feige veranlagt. Aber wie dem auch sei! Da mein Herr zu unbedeutend ist, um in der Geschichte der Meiji-Zeit eine Rolle zu spielen, bekümmert mich das nicht. Tatsache ist allerdings, dass Neid aus seiner Frage nach den Gefährtinnen von Kaltmond sprach. Kaltmond nahm sich mit seinen Stäbchen amüsiert ein Stückchen Fischwurst vom Vorspeisenteller und biss mit seinen Vorderzähnen die Hälfte davon ab. Ich fragte mich besorgt, ob nicht wieder ein Zahn abbrechen würde, aber nichts brach ab. »Wer die Frauen waren? Nun, die beiden sind Töchter aus gutem Hause. Niemand, den du kennen würdest«, antwortete Kaltmond kühl. »Tatsäch!«, sagte mein Herr, und das »lich!« dachte er sich. Ich weiß nicht, ob Kaltmond der Ansicht war, sein Besuch habe nun lange genug gedauert, auf den Fall sagte er drängend: »Heute haben wir doch wirklich schönes Wetter! Wir könnten gemeinsam einen Spaziergang machen, falls du Zeit hast. Die ganze Stadt ist auf den Beinen, da Port Arthur[4] gefallen ist.« Meinem Herrn stand deutlich ins Gesicht geschrieben, dass ihn weniger der Fall von Port Arthur interessierte als vielmehr alles, was mit den Geigerinnen zusammenhing; er überlegte eine Weile und schien dann zu einem Entschluss gekommen zu sein. »Also, lass uns gehen!« sagte er und stand entschlossen auf. Wie immer trug er seinen Baumwoll-Haori mit dem Wappen und darunter einen gefütterten Seiden-Kimono. Diesen Kimono, der angeblich ein Erinnerungsstück an seinen Bruder ist, trägt und trägt er nun schon seit zwanzig langen Jahren, und das Ergebnis ist entsprechend. Denn selbst Seidenkimonos, die für ihre Strapazierbarkeit bekannt sind, überstehen es nicht unbeschadet, wenn sie zwanzig Jahre lang getragen werden. An verschiedenen Stellen ist der Stoff bereits sehr dünn, und wenn man ihn gegen das Licht hält, sieht man die Nähte der Flicken durchscheinen, mit denen der Kimono von innen ausgebessert wurde. Der Kleidung meines Herrn ist nicht anzusehen, ob wir Dezember oder den ersten Monat eines neuen Jahres schreiben. Und auch der Unterschied zwischen Werktag und Feiertag ist seiner Kleidung nicht bekannt. Geht mein Herr aus dem Haus, verschwendet er keinen Gedanken an sein Äußeres, sondern geht einfach. Ob er keine anderen Kleider besitzt oder ob er doch andere besitzt und sich nur deswegen nicht umzieht, weil ihm das zu beschwerlich ist, weiß ich nicht zu sagen. Mir scheint jedoch, dass man zumindest sein Desinteresse für Kleidung nicht mit einer unglücklichen Liebschaft in Verbindung bringen kann.
Nachdem Kaltmond und mein Herr gegangen waren, erlaubte ich mir, den Rest der Fischwurst, von der Kaltmond ein Stück abgebissen hatte, zu mir zu nehmen. Zu den Katzen von gewöhnlichem Schlage gehöre ich ja mittlerweile nicht mehr. Ich verfüge in reichlichem Maße über die nämlichen Qualitäten wie die Katzen von Momokawa Jōen[5] oder die Katze von Gray[6]