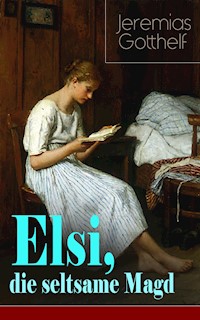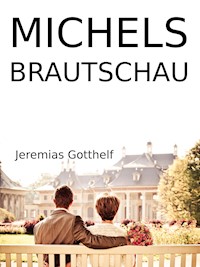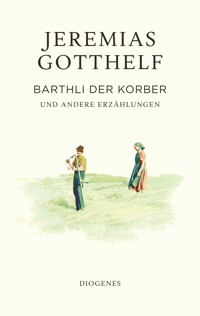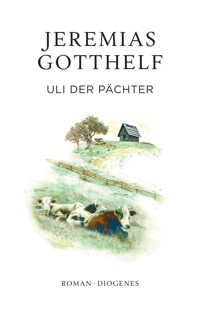0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jeremias Gotthelf
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Eine Erzählung Jeremias Gotthelfs: Hansli wuchs in Armut auf, sein Vater starb früh, seine Mutter war kränklich. Um nicht betteln zu müssen erlernte er das Handwerk des Besenbinders. Auf seinen Wegen nach Thun und Bern, die er unternahm, um seine Besen zu verkaufen, lernte er ein Mädchen kennen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Titelblatt
Jeremias Gotthelf
Der Besenbinder von Rychiswyl
Erzählung (1852)
Der Besenbinder
Glücklich möchten alle Menschen werden. Wenn sie reich wären, würden sie auch glücklich sein, meinen die meisten, meinen, Glück und Geld verhielten sich zusammen wie die Kartoffel zur Kartoffelstaude, die Wurzel zur Pflanze. Wie irren sie sich doch gröblich, wie wenig verstehen sie sich auf das Wesen der Menschen und haben es doch täglich vor Augen!
Die Heilige Schrift sagt, denen, die Gott lieben, täten alle Dinge zum Besten dienen, und so ist es auch. Geld ist und bleibt Geld, aber die Herzen, mit denen es zusammenkommt, sind so gar verschieden; daher erwächst aus den verschiedenen Ehen von Herz und Geld ein so verschiedenes Leben, und je nach diesem Leben bringt das Geld Glück oder Unglück. Aufs Herz kommt es an, ob man durch Geld glücklich oder unglücklich werde. Klar hat Gott eigentlich dies an die Sonne gelegt, aber leider sehen die Menschen gar selten klar die klarsten Dinge, machen sie vielmehr dunkel mit ihrer selbstgemachten Weisheit. Am Besenbinder von Rychiswyl greifen wir aus den hundert Exempeln, an welchen wir die obige Wahrheit angeschaut, eins heraus, welches ein Herz zeigen soll, dem Geld Glück brachte.
Besen sind bekanntlich ein schreiendes Bedürfnis der Zeit und waren das freilich schon seit langen Zeiten. Derartige Bedürfnisse, die täglich und wöchentlich befriedigt sein wollen, gibt es viele in jedem Haus und allenthalben Menschen, welche es sich freiwillig zur angenehmen Pflicht machen, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Immer weniger achtet man der Personen, welche dieses tun, wenn man nur das Nötige kriegt und so wohlfeil als möglich. Ehedem war es nicht so: ehedem ward das Besenmannli, das Eierfraueli, das Tuft- oder Sandmeitschi usw. so gleichsam zur Familie gerechnet; es war ein festes Verhältnis, man kannte die Tage, an welchen die Personen erschienen; je nachdem sie in Hulden standen, ward ihnen etwas Absonderliches verabreicht, und fehlten sie um einen Tag, so entschuldigten sie sich das nächste Mal, als hätten sie eine Sünde begangen, und sprachen von ihrem Kummer, man möchte vielleicht geglaubt haben, sie kämen nicht mehr, und sich daher anderweitig versorgt. Sie betrachteten ihre Häuser als die Sterne an ihrem Himmel, gaben sich alle Mühe, sie gut zu bedienen, und wenn sie mit diesem Gewerbe aufhörten oder sich selbst auf einen höheren Zweig beförderten, so gaben sie sich alle Mühe, einem Kinde, einer Base, einem Vetter oder sonst so wem zu ihrer Stelle zu verhelfen. Es war da ein gegenseitig Band von Anhänglichkeit und Vertrauen, welches leider in unserer kalten Zeit, wo alle Familienwärme sich immer mehr verflüchtigt, immer lockerer und loser wird.