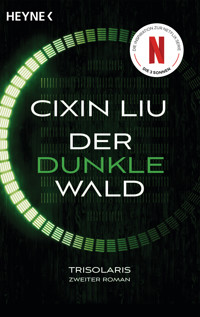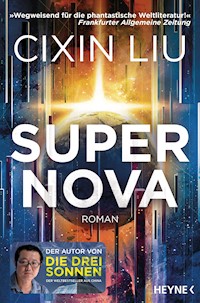14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das neue Buch vom Autor des Weltbestsellers »Die drei Sonnen«, jetzt als große TV-Serienverfilmung auf Netflix
Mit seinem Weltbestseller »Die drei Sonnen« hat sich Cixin Liu in die Weltgeschichte der spekulativen Literatur eingeschrieben. Zusammen mit »Der dunkle Wald« und »Jenseits der Zeit« hat Lius Trisolaris-Trilogie den Horizont der Science-Fiction verschoben. In der vorliegenden Sammlung von Erzählungen, Essays und Interviews gibt Cixin Liu erstmals Einblick in die Entstehungsgeschichte seines literarischen Denkens. Was hat Liu zur Science-Fiction gebracht? Kann ein Schmetterling einen Krieg verhindern? Welche Spezies ist der wahre Herrscher des Erdballs? Was sehen wir, wenn wir von den Sternen her zur Erde zurückblicken? 19 Texte, in denen Cixin Liu die Weiten des kosmischen Erzählens durchmisst …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Mit seinem Weltbestseller »Die drei Sonnen« hat sich Cixin Liu in die Weltgeschichte der spekulativen Literatur eingeschrieben. In der vorliegenden Sammlung von Erzählungen, Essays und Interviews gibt Cixin Liu erstmals Einblick in die Entstehungsgeschichte seines literarischen Denkens. Was hat Liu zur Science-Fiction gebracht? Kann ein Schmetterling einen Krieg verhindern? Welche Spezies ist der wahre Herrscher des Erdballs? Was sehen wir, wenn wir von den Sternen zur Erde zurückblicken? Neunzehn Texte, in denen Cixin Liu die Weiten des kosmischen Erzählens durchmisst …
Der Autor
Cixin Liu ist der erfolgreichste chinesische Science-Fiction-Autor. Er hat lange Zeit als Ingenieur in einem Kraftwerk gearbeitet, bevor er sich ganz seiner Schriftstellerkarriere widmen konnte. Seine Romane und Erzählungen wurden bereits viele Male mit dem Galaxy Award prämiert. Cixin Lius Roman »Die drei Sonnen« wurde 2015 als erster chinesischer Roman überhaupt mit dem Hugo Award ausgezeichnet und wird international als ein Meilenstein der Science-Fiction gefeiert. Zusammen mit den beiden Folgebänden »Der dunkle Wald« und »Jenseits der Zeit« wurde die Trisolaris-Trilogie als TV-Serie 3 Body Problem für Netflix verfilmt.
Mehr über Cixin Liu und seine Werke finden Sie auf
Cixin Liu
DER BLICK VON DEN STERNEN
Erzählungen und Essays
Aus dem Chinesischen von
Karin Betz, Johannes Fiederling und Marc Hermann
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Dieser Band ist zuerst in englischer Übersetzung unter dem Titel
A VIEWFROMTHESTARS
bei Tor Books, Tom Doherty Associates, New York, erschienen.
Ausführliche Hinweise zu den Erstveröffentlichungen der chinesischen Originaltexte sowie ein ausführliches Werkverzeichnis der auf Deutsch erschienenen Bücher von Cixin Liu finden Sie im Anhang.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstausgabe 03/2025
Copyright © 2024 by Cixin Liu ()
German translation copyrights © FT Culture (Beijing) Co., Ltd. ()
Co-published by Chongqing Publishing House Co., Ltd. ()
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München,
unter Verwendung von Shutterstock
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-32493-3V002
diezukunft.de
Inhalt
Zeit genug
Walgesang
Eine Reise auf der Suche nach dem Zuhause
Der Bote
Dreißig Jahre Außergewöhnliches im Alltäglichen
Schmetterling
Eine oder einhunderttausend Erden
Gedanken zum Abschluss der Trisolaris-Trilogie
Science-Fiction vs. Fantasy
Glaubensbekenntnis
Das Ende des Mikrokosmos
Poetische Science-Fiction
Gegenläufige Zivilisationsausbreitung
Schicksal
Die Dunkler-Wald-Theorie
Die Welt in fünfzig Jahren
Der Einstein-Äquator
Ein Gespräch über »Kugelblitz«
Wir sind Science-Fiction-Fans
Cixin Liu bei Heyne
Erläuterungen zu Schreibweise und Aussprache
Der Blick von den Sternen
Zeit genug
Übersetzt von Johannes Fiederling
Geschrieben am 21. September 2015 in Yangquan, Shanxi. »Zeit genug« wurde 2016 als Vorwort für den Sammelband »Das schlechteste aller Universen und die beste aller Welten – Liu Cixins Science-Fiction-Rezensionen und -Essays« von Sichuan Science & Technology Press veröffentlicht.
Ein brütend heißer Abend vor über vierzig Jahren. Das Haus, in dem wir wohnten, war einfach und ebenerdig. Ventilator, Klimaanlage und Fernseher sollten erst über ein Jahrzehnt später Einzug halten, damals gehörten diese Geräte noch in die Welt von morgen, ins Reich der Science-Fiction. Die Erwachsenen saßen draußen im Freien, fächelten sich Luft zu und plauderten, während ich allein drinnen saß, schweißtriefend und in ein Buch versunken. Es war mein erster Science-Fiction-Roman, »Die Reise zum Mittelpunkt der Erde« von Jules Verne. Ich war von der Lektüre geradezu berauscht, als mir plötzlich jemand das Buch aus der Hand nahm. Es war mein Vater. Im ersten Moment zuckte ich zusammen, denn ein paar Tage zuvor hatte ich mir heftige Schelte eingefangen, weil ich »Roter Fels« gelesen hatte. Mein Vater hatte das Buch anschließend einkassiert. (Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, aber selbst Klassiker der Revolutionsliteratur wie »Roter Fels« und »Das Lied der Jugend« waren damals verboten.) Doch an meinem neuen Lesestoff hatte er nichts auszusetzen. Stumm reichte er mir das Buch zurück. Ich war eben im Begriff, mich erneut in der Welt von Jules Verne zu verlieren, als mein Vater schon im Gehen von der Tür her zu mir sagte: »Diese Art Roman nennt man Science-Fiction.«
Es war das erste Mal, dass mir dieser aus zwei Wörtern zusammengesetzte Begriff zu Ohren kam, der mein Leben prägen sollte. Ich weiß noch, wie erstaunt ich war, dass alles, was in diesem Buch geschah, lediglich Fiktion sein sollte. Ausgedacht. Ich hatte es für die Schilderung wahrer Begebenheiten gehalten! Jule Vernes Schreibstil war derart realistisch, und außerdem fand sich bei kaum einer der zahlreichen chinesischen Ausgaben von »Reise zum Mittelpunkt der Erde«, die vor Beginn der Kulturrevolution in Umlauf kamen, auf dem Einband ein Hinweis darauf, dass es sich um einen Science-Fiction-Roman handelte, so auch auf meiner nicht.
»Alles hier drin hat sich jemand ausgedacht?«, fragte ich ungläubig.
»Ja, aber es beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen«, antwortete mein Vater.
Mit diesem einfachen, aus drei Sätzen bestehenden Dialog war der Grundgedanke formuliert worden, der meine spätere Arbeit in diesem Genre prägen sollte.
Lange Zeit habe ich die Veröffentlichung meiner ersten Kurzgeschichte im Jahr 1999 als Beginn meiner Science-Fiction-Karriere angesehen. Das liegt zwar inzwischen gut sechzehn Jahre zurück, aber eigentlich muss ich die Anfänge meines Schaffens noch einmal rund zwanzig Jahre davor ansiedeln, bei meiner ersten Geschichte aus dem Jahr 1978. Darin erhält die Erde Besuch von Außerirdischen. Gegen Ende machen sie dem Protagonisten ein kleines Abschiedsgeschenk: eine weiche, dünne Membran, so klein, dass sie in eine Hand passt. Ein Luftballon, sagen sie. Der Protagonist nimmt ihn mit nach Hause und versucht, ihn aufzupusten, zunächst mit dem Mund, dann mit einer Luftpumpe und schließlich mit einem Hochleistungsgebläse. Am Schluss wird aus der dünnen Membran eine prächtige Luftstadt, größer noch als Peking. Ich schickte mein Manuskript damals an das Literaturmagazin Neuer Hafen (Xingang) in Tianjing, bekam jedoch nie eine Rückmeldung.
In den folgenden zwanzig Jahren, bis »Walgesang« erschien, habe ich nie wirklich aufgehört zu schreiben, auch wenn es einige längere Pausen gab. In dieser Zeit, spätestens seit Beginn der Achtzigerjahre, wurde die klassische Prämisse, die mein Vater und ich damals in drei Sätzen zusammengefasst hatten, im Genre zunehmend in Zweifel gezogen und schließlich komplett aufgegeben. Das Jahrzehnt, das folgte, war geprägt von einem gewaltigen Zustrom neuer Ideen und Konzepte, die die chinesische Science-Fiction-Szene wie ein Schwamm in sich aufsog. Ich kam mir vor wie ein einzelner Wachposten auf einem Territorium, für das sich niemand mehr interessierte, eine Ödnis, in der man lediglich von Zeit zu Zeit auf ein paar von Unkraut überwucherte Ruinen stieß. Die Erinnerung an die Einsamkeit, die ich damals empfand, ist mir noch immer greifbar. Zeitweilig war es so schlimm, dass ich einen Versuch unternahm, mich der Gegenseite anzudienen, um von dort aus subversiv für die eigene Sache zu kämpfen. Das Ergebnis waren die Romane »China 2185« und »Supernova«. Ich wollte der marginalisierten Science-Fiction damit eine Chance auf Verbreitung geben, doch tief im Innern hielt ich weiter an meinem Terrain fest. Letztendlich gab ich den Wunsch wieder auf, Romane zu schreiben, und wandte mich erneut dem Verfassen von Kurzgeschichten sowie meiner eigenen Auffassung von Science-Fiction zu.
Als ich begann, meine Geschichten in Science Fiction World (Kehuan Shijie) zu veröffentlichen, stellte ich mit einigem Erstaunen und großer Freude fest, dass mein Terrain gar nicht so verödet und leer war, wie ich gedacht hatte. Es gab durchaus noch andere Menschen dort. Dass wir uns nie begegnet waren, lag allein daran, dass ich nicht hartnäckig und ausdauernd genug nach ihnen gerufen hatte. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass diese Gefilde sogar ziemlich dicht bevölkert waren. Ich traf auf immer mehr und immer größere Grüppchen, Pulks und Verbände, und irgendwann wurde klar, dass sie nicht nur hier in China existieren, sondern auch in den USA und anderswo. Wir alle zusammen machen es möglich, dass die Science-Fiction ihren Platz unter dem Himmel behält, und die letzten fünfzehn Jahre meines Schaffens sind geprägt davon.
Science-Fiction-Literatur nimmt in China eine besondere Stellung ein. Keiner anderen Literaturgattung werden mehr theoretische Auseinandersetzungen gewidmet, mehr tiefgreifende Forschung und Analyse zuteil, mehr neue Ideen und Gedanken angetragen. Es gibt Topoi, über die seit dreißig, vierzig Jahren ergebnislos gestritten wird, während ebenso unermüdlich neue Thematiken und Fragestellungen aufgeworfen, erforscht und diskutiert werden. Niemand nimmt die theoretische und konzeptionelle Seite ernster als wir Science-Fiction-Autoren, niemand hat mehr Angst davor, den Anschluss an die Avantgarde zu verlieren. Und so kam es zu einem seltsamen Phänomen.
Es ist jetzt einen Monat her, seit mir der Hugo Award verliehen wurde. In diesem Monat hatte ich Gelegenheit, mit noch mehr Menschen aus noch mehr Bereichen und Gesellschaftsschichten über Science-Fiction zu sprechen: dem chinesischen Vizepräsidenten, dem Bürgermeister meiner Stadt, dem Lehrpersonal der Mittelschule, den Klassenkameradinnen und -kameraden meiner Tochter, Verkehrspolizisten, Kurierfahrern, dem auf Schweineköpfe spezialisierten Metzger von nebenan … Dabei ist mir bewusst geworden: Was man in der SF-Szene und in akademischen Zirkeln diskutiert, hat kaum noch etwas mit dem zu tun, was Menschen außerhalb dieser Kreise unter Science-Fiction verstehen.
Auf der einen Seite stehen die Mitglieder der Szene, alles in allem vielleicht ein paar Hundert Leute; auf der anderen der Schweinekopfverkäufer, die Kurierfahrer, die Verkehrspolizisten, die Klassenkameradinnen und -kameraden meiner Tochter, das Lehrpersonal der Mittelschule, der Bürgermeister, der chinesische Vizepräsident – alles in allem etwa 1,3 Milliarden Menschen. Wer mag wohl recht haben? Ehrlich gesagt, halte ich die Auffassung unserer Seite zwar nach wie vor für die einzig richtige, aber in Anbetracht der Lage regt sich zumindest der eine oder andere Zweifel in mir.
Ein bekannter Schriftsteller hat einmal gesagt, die klassische Literatur, vertreten durch Größen wie Tolstoi und Balzac, sei eine langsam und Stein um Stein aufgeschichtete Mauer – und die moderne und postmoderne Literatur eine Leiter, mit der sie sich im Handumdrehen erklimmen lässt.
Dieses Bild gibt sehr gut die innere Einstellung der Science-Fiction-Szene wieder. Wir wollen stets über etwas hinaus, vergessen dabei jedoch, dass es Dinge gibt, die sich nicht überspringen lassen, die erlebt werden wollen, so wie man nicht einfach zum Erwachsensein übergehen kann, ohne Kindheit und Pubertät durchlaufen zu haben. Zumindest, was Science-Fiction-Literatur angeht, will die Wand eben doch erst Stein um Stein hochgezogen werden. Denn sonst lässt sich die Leiter nirgendwo anlehnen.
Diese Sammlung von Erzählungen und Essays umfasst den Großteil dessen, was ich während der vergangenen fünfzehn Jahre meiner etwa fünfunddreißigjährigen Laufbahn als Science-Fiction-Autor an nicht-fiktionalen Texten darüber verfasst habe. In den zwanzig Jahren davor habe ich nie über Science-Fiction geschrieben. Auch bei Durchsicht meiner Tagebücher aus jener Zeit ließ sich kein Wort zu diesem Thema finden.
Wer sich diese Texte zu Gemüte führt, wird einige rote Fäden entdecken. Der Prozess eines langsamen Wegdriftens von blinder Überzeugung hin zu mehr Toleranz, von heißblütiger Euphorie hin zu mehr Gelassenheit. Mir ist spät bewusst geworden, dass es viele unterschiedliche Sorten von Science-Fiction-Literatur gibt. Ich habe begriffen, dass Science-Fiction auch ganz ohne Wissenschaft auskommen kann, dass sie ihr Augenmerk statt auf das Weltall und die Zukunft ebenso gut auf die Erde und die Realität von heute richten kann oder sogar nur auf unser Innenleben. Jede dieser Spielarten hat ihre Daseinsberechtigung, und jede von ihnen kann neue Klassiker hervorbringen.
Gleichzeitig bleibt die auf jenem kurzen, drei Sätze umfassenden Wortwechsel mit meinem Vater fußende Prämisse in mir so fest und unverrückbar wie ein Felsmassiv. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie die existenzielle Basis jeder Science-Fiction-Literatur darstellt. Und meine Essays reflektieren dies.
Die chinesische Science-Fiction mag sich vor hundert Jahren auf den Weg gemacht haben, sie ist dennoch gerade erst im Aufbruch. Ihr steht noch viel bevor, und es bleibt Zeit genug, sich in sie zu verlieben.
Walgesang
Erzählung
Übersetzt von Marc Hermann
Geschrieben im Januar 1999 in Niangziguan. »Walgesang« wurde zuerst in Heft 6/1999 der Zeitschrift Science Fiction World veröffentlicht.
Big Warner stand am Bug seiner Jacht und blickte nachdenklich auf die ruhige Oberfläche des Atlantischen Ozeans. Eigentlich war er alles andere als grüblerisch veranlagt – er war ein Mann der Tat und handelte instinktiv. Doch in letzter Zeit waren die Dinge kompliziert geworden.
Er sah keineswegs wie der leibhaftige Teufel aus, als den ihn die Medien so gern porträtierten. In Wahrheit wirkte er eher wie der Weihnachtsmann. Er hatte einen durchdringenden Blick, aber davon abgesehen trug er auf seinem rundlichen Gesicht stets ein offenherziges, liebenswürdiges Lächeln zur Schau. Eine Waffe hatte er nie dabei, bis auf das kleine hübsche Taschenmesser in seiner Hemdtasche. Er benutzte dieses Messer zum Obstschälen und zum Töten, und bei beidem lächelte er.
An Bord seiner Dreitausend-Tonnen-Luxusjacht hatte Big Warner neben achtzig Untergebenen und zwei dunkelhäutigen jungen Südamerikanerinnen auch fünfundzwanzig Tonnen reines Heroin – den Ertrag von zwei Jahren aus dem Labor, das er im südamerikanischen Dschungel betrieben hatte, bis es vor zwei Monaten von kolumbianischen Regierungstruppen umzingelt wurde. Bei dem Versuch, die Ware in Sicherheit zu bringen, fanden sein jüngerer Bruder und über dreißig seiner Männer im Kugelhagel den Tod. Um ein neues Labor zu erbauen – vielleicht in Bolivien oder sogar im südostasiatischen Goldenen Dreieck –, benötigte er dringend das Geld, das seine Fracht einbringen würde. Nur so konnte er sein Lebenswerk retten, das Drogenimperium, das er so mühsam errichtet hatte. Doch inzwischen trieb er schon über einen Monat auf hoher See und hatte noch immer kein einziges Gramm seiner kostbaren Ladung auf das US-amerikanische Festland schaffen können.
Den Stoff einfach durch den Zoll zu schmuggeln war unmöglich. Seit der Erfindung von Neutrino-Detektoren flog bei der Kontrolle jede noch so kleine Drogenmenge auf. Vor einem Jahr hatten sie das Heroin deshalb in Stahlblöcke eingeschlossen, die für die einheimische Schwerindustrie deklariert waren und von denen jeder ein gutes Dutzend Tonnen wog, und dennoch hatten die Detektoren die heiße Ware mühelos aufgespürt.
Danach war Big Warner auf eine verblüffende Idee gekommen: Mit Leichtflugzeugen – normalerweise billigen Cessnas – ließ er jeweils rund fünfzig Kilogramm Ware über Miami einfliegen; sobald der Pilot die Küste passiert hatte, sprang er mit der Fracht am Körper per Fallschirm ab. Das Flugzeug ging dabei zwar jedes Mal verloren, aber die zentnerschwere Ware sorgte trotzdem für einen dicken Gewinn. Die Methode schien unschlagbar, bis die Amerikaner ein riesiges Luftüberwachungssystem aus Satelliten und landgestütztem Radar errichteten, das sogar einen abgesprungenen Piloten entdecken und verfolgen konnte. Die mutigen jungen Burschen, die Warner engagiert hatte, waren noch nicht gelandet, da wartete am Boden schon die Polizei auf sie.
Daraufhin hatte Warner versucht, die Ware mit kleinen Booten an Land zu schmuggeln, doch das Ergebnis war sogar noch verheerender: Seit sämtliche Schnellboote der Küstenwache mit Neutrino-Detektoren ausgerüstet waren, konnten sie in einem Umkreis von dreitausend Metern jede Droge an Bord eines fremden Boots aufspüren. Warner war sogar auf die Idee verfallen, Mini-U-Boote einzusetzen, doch das Unterwasser-Überwachungsnetz, das die Amerikaner schon zu Zeiten des Kalten Kriegs entwickelt und seitdem perfektioniert hatten, machte jedes derartige U-Boot bereits weit vor der Küste ausfindig.
Big Warner war mit seinem Latein am Ende. Und er hasste die Wissenschaftler, die ihm all das eingebrockt hatten. Andererseits konnten ebendiese Wissenschaftler ihm vielleicht auch helfen. Also hatte er seinem jüngsten Sohn, der in Amerika studierte, befohlen, sich nach einem fähigen Kopf umzuschauen. »Am Geld soll es nicht scheitern«, hatte er ihm noch mit auf den Weg gegeben. Und heute Vormittag nun kam Warner junior mit einem anderen Boot, stieg an Bord der Jacht und verkündete seinem Vater: »Ich habe deinen Mann gefunden, Papa! Er ist ein Genie. Ich habe ihn an der Caltech kennengelernt.«
»Pff!« Big Warner rümpfte die Nase. »Drei Jahre hast du nun schon an dieser Caltech vergeudet, und noch immer ist kein Genie aus dir geworden. Glaubst du vielleicht, Genies wachsen auf Bäumen?«
»Aber er ist wirklich ein Genie, Papa!«
Warner drehte sich um und machte es sich auf einem Liegestuhl auf dem Vorderdeck bequem. Er nahm sein hübsches Taschenmesser hervor und schälte eine Ananas, während die beiden jungen Südamerikanerinnen ihm die fleischigen Schultern massierten. Unterdessen schlenderte auch der Gast herbei, den sein Sohn mitgebracht hatte und der vorher abseits an der Reling gestanden und aufs Meer geblickt hatte. Er wirkte erschreckend mager – sein Hals war so dürr, dass man sich wunderte, wie er den unverhältnismäßig großen Kopf tragen konnte. Man fühlte sich unwillkürlich an einen Alien erinnert, so grotesk war das Missverhältnis zwischen seinem Kopf und dem Rest des Körpers.
»Das ist Dr. David Hopkins. Er ist Meeresbiologe«, stellte Warner junior ihn vor.
»Ich habe gehört, Sie können uns helfen, Mister«, begrüßte Warner ihn mit seinem Weihnachtsmannlächeln.
»Ja, das kann ich. Ich kann Ihre Ware an Land bringen«, antwortete Hopkins mit ausdrucksloser Miene.
»Und wie wollen Sie das anstellen?«, fragte Warner träge.
»Mit einem Wal.«
Auf einen Wink von Warner junior hin trugen zwei seiner Männer ein absonderliches Objekt herbei: eine kleine stromlinienförmige Tauchkabine aus einem Material, das wie durchsichtiges Plastik aussah. Die Kabine war einen Meter hoch und zwei Meter lang und bot im Innern ungefähr so viel Platz wie ein Kleinstwagen. Vor den zwei Sitzen war ein Armaturenbrett mit einem einfachen Minibildschirm angebracht, dahinter hatte man noch Platz für die Ladung freigelassen.
»Diese Tauchkabine hat ein Fassungsvermögen von zwei Personen und einer Tonne Fracht«, erläuterte Hopkins.
»Und wie soll dieses Ding da unter Wasser fünfhundert Kilometer bis an die Küste von Miami zurücklegen?«
»Im Maul eines Wals.«
Warner brach in ein Gelächter aus, das hell und hoch begann, bis es sich zu einem tiefen Gebrüll steigerte. Er pflegte damit so gut wie alle Gefühle auszudrücken: Freude, Wut, Skepsis, Verzweiflung, Angst, Traurigkeit. Wann immer er auf diese Weise lachte, wusste nur er selbst, was er damit sagen wollte.
»Cleveres Kerlchen! Und wie viel muss ich diesem Walfisch bezahlen, damit er dorthin schwimmt, wo ich ihn haben will?«
»Wale sind keine Fische, sondern Meeressäuger. Sie müssen das Geld nur mir geben. Ich habe im Gehirn des betreffenden Wals bereits eine Bioelektrode und einen Computer installiert, der externe Signale empfangen und in Gehirnwellen des Wals umwandeln kann. Mit diesem Gerät« – Hopkins nahm einen Gegenstand aus der Tasche, der an die Fernbedienung eines Fernsehers erinnerte – »kann ich von außen sämtliche Aktivitäten des Tiers steuern.«
Nun lachte Warner noch brüllender. »Hahahaha … Der Bursche hat zu viel Pinocchio geschaut! Haha … Ahaha …« Er krümmte sich so sehr vor Lachen, dass er keine Luft mehr bekam und ihm die Ananas aus der Hand fiel. »Haha … Diese Marionette … äh, Pinocchio … die wurde doch auch zusammen mit diesem alten Knacker von dem großen Fisch verschlungen! Haha …«
»Papa, hör ihm doch bitte mal zu!«, bat Warner junior. »Sein Plan könnte wirklich funktionieren.«
»Ahahaha … Pinocchio und der Alte waren doch sogar ziemlich lange im Bauch von diesem Fisch und haben da drin … hahahaha … eine Kerze angezündet … hahahaha …«
So abrupt, als hätte man eine Lampe ausgeschaltet, brach Warners Gelächter wieder ab. Nur sein Lächeln verschwand nicht. Er fragte eine der jungen Frauen hinter ihm: »Was ist noch mal passiert, wenn Pinocchio geflunkert hat?«
»Dann ist seine Nase ganz lang geworden.«
Warner erhob sich, in der einen Hand das Taschenmesser, mit dem er eben noch die Ananas geschält hatte, während er mit der anderen Hand Hopkins am Kinn packte und seinen Kopf nach hinten drückte, um seine Nase zu begutachten. Sein Gast ließ sich von alldem nicht aus der Ruhe bringen.
»Und?«, fragte Warner lächelnd die Frauen. »Was meint ihr: Wird seine Nase schon länger?«
»O ja, Boss!«, säuselte eine. Offenbar bereitete es ihr und ihrer Gefährtin Vergnügen, dabei zuzuschauen, wie ihr Chef andere quälte.
»Na, dann wollen wir ihm mal helfen«, brummte Warner, und noch bevor sein Sohn ihn davon abhalten konnte, hatte er mit der rasiermesserscharfen Schneide seines Taschenmessers Hopkins ein Stück der Nasenspitze abgeschnitten. Doch sein Opfer ließ das alles – auch das Blut, das ihm nun über den Mund lief – mit unerschütterlicher Ruhe über sich ergehen. Als der Drogenboss den Griff von seinem Kinn löste, blieb Hopkins einfach mit hängenden Armen stehen, als gehörte die Nase nicht zu seinem Gesicht.
»Schafft mir dieses Genie in sein Dingsda und schmeißt ihn ins Meer«, befahl Warner mit einem flüchtigen Wink seiner Hand. Nachdem zwei stämmige Südamerikaner Hopkins in die durchsichtige kleine Tauchkabine gedrückt hatten, ergriff Warner die Fernbedienung und reichte sie dem Erfinder durch die Luke, und das so gütig wie der Weihnachtsmann, der einem Kind ein Spielzeug übergibt. »Hier – und jetzt ruf deinen geliebten Fisch! Hahaha …«
Wieder brach er in sein schallendes Gelächter aus, doch kaum platschte die Tauchkabine unter großem Gespritze ins Wasser, verstummte sein Lachen und wich einem für ihn ungewöhnlichen Ernst.
»Irgendwann hättest du dir da drin noch den Tod geholt«, sagte er zu seinem Sohn.
Die durchsichtige kleine Tauchkabine schwankte so zerbrechlich und hilflos wie eine Luftblase auf der Meeresoberfläche.
Plötzlich schrien die beiden jungen Frauen auf. Aus über zweihundert Meter Entfernung brandete mit erschreckender Geschwindigkeit eine mächtige Woge heran, die sich bald in zwei hohe Wellen aufteilte. Zwischen ihnen erhob sich ein schwarzer Berggrat.
»Das ist ein Blauwal«, raunte Warner junior seinem Vater ins Ohr. »Er ist achtundvierzig Meter lang. Hopkins hat ihn nach dem Meeresgott der griechischen Mythologie benannt: Poseidon.«
Ein paar Dutzend Meter vor der Tauchkabine verschwand der Berggrat wieder. Stattdessen erhob sich nun eine gewaltige Schwanzflosse wie ein mächtiges schwarzes Schiffssegel über dem Wasser. Dicht vor der Tauchkabine tauchte der gigantische Kopf des Wals wieder auf. Er öffnete sein ungeheures Maul und verschluckte die Tauchkabine so beiläufig, als hätte ein gewöhnlicher Fisch eine Brotkrume verputzt. Danach begann der Wal, die Jacht zu umrunden. Erhaben rauschte der lebende Berg um sie herum, und dabei klatschten tosende Wogen an die Schiffsseite – ein Schauspiel, das selbst dem sonst so überheblichen Big Warner eine nie gekannte Ehrfurcht einflößte. Es war, als hätte sich ihm ein Gott offenbart, eine Inkarnation der übernatürlichen Kräfte des Meeres, ja, der Natur schlechthin.
Nachdem der Wal eine Runde um die Jacht gedreht hatte, wandte er sich um und nahm geradewegs Kurs auf das Schiff. Als sein Kopf gleich daneben aus dem Wasser auftauchte, dämmerte den Besatzungsmitgliedern erst, wie riesenhaft der Koloss wirklich war. Klar und deutlich sahen sie nun die felsenartig raue Haut, die von Entenmuscheln übersät war. Dann öffnete der Wal sein Maul und spie die Tauchkabine wieder aus. In einer beinahe waagerechten Linie segelte die Kabine über die Reling und krachte aufs Deck. Die Luke ging auf, und Hopkins stieg heraus. Abgesehen von seiner Nase, deren Blut inzwischen einen Teil seines Hemds getränkt hatte, war er wohlauf.
»Wo bleibt denn der Arzt? Seht ihr nicht, dass sich unser Doktor Pinocchio verletzt hat?«, polterte Warner lauthals, als wäre er unschuldig an der Wunde.
»Ich heiße Hopkins, David Hopkins«, korrigierte ihn sein Gast nachdrücklich.
»Ich nenne dich Pinocchio«, beharrte Warner mit seinem Weihnachtsmannlächeln.
Einige Stunden später stiegen beide in die Tauchkabine. Hinter ihren Sitzen war eine Tonne Heroin in wasserdichten Beuteln verstaut. Warner hatte sich entschlossen, selbst mitzukommen – er brauchte den Adrenalinkick, um sein träges Blut in Wallung zu bringen. Dies war zweifellos die erregendste Reise, die er in seinem Leben unternommen hatte. Behutsam ließen seine Matrosen die Tauchkabine an einer Trosse hinab aufs Meer, ehe sich die Jacht gemächlich entfernte.
Sofort fühlten die beiden Insassen, wie die Wellen unter ihnen schwankten. Im Schein der untergehenden Sonne ragte die Kabine nur noch zur Hälfte aus dem Wasser. Hopkins drückte einige Tasten an seiner Fernbedienung, um den Wal herbeizurufen. Sie hörten das dumpfe Rauschen von Wasser, das in der Ferne aufgewühlt wurde. Das Geräusch schwoll rasch an, bis das riesige Maul des Wals über dem Wasser erschien und auf sie zuraste. Im Nu schien die Kabine in einen schwarzen Abgrund gesogen zu werden. Die Helligkeit schwand zu einem schmalen Schlitz und erlosch schließlich gänzlich in Finsternis. Mit einem krachenden Mahlen schnappten die riesigen Barten zu, die der Wal anstelle von Zähnen im Maul trug. Danach überkam die beiden menschlichen Eindringlinge ein Gefühl von Schwerelosigkeit, als sausten sie einen Fahrstuhl hinunter – offensichtlich tauchte der Wal schon in die Tiefe hinab.
»Großartig, Pinocchio! Hahaha …« In der Dunkelheit brach Warner in erneutes Gelächter aus, das seine Angst nur notdürftig verschleierte.
»Lassen Sie uns jetzt unsere Kerze anzünden, Sir«, erwiderte Hopkins. Er klang unbeschwert und heiter. Hier war er in seinem Element.
Auch Warner hörte das heraus, was seine Angst nur noch steigerte. Unterdessen leuchtete an der Decke der Kabine ein Lämpchen auf, das ein schwaches blaues Licht verströmte.
Warners Blick fiel als Erstes auf eine lange Reihe weißer, mehr als mannshoher Säulen, die draußen vor der Kabine aufragten. Die Säulen, die sich zum Ende hin verjüngten, waren zu einem Gatter verschränkt. Das, durchzuckte es Warner, mussten die Zähne des Wals sein! Er hatte noch nie von Barten gehört.
Die Kabine schien auf einem weichen, sich windenden Morast gelandet zu sein. Über ihr spannte sich ein Gewölbe, das von bogenförmig geschwungenen mächtigen Knochen getragen wurde. Morast und Gewölbedach fielen nach hinten zu einem riesigen schwarzen Schlund ab, der sich unaufhörlich bewegte. Als Warner begriff, dass es sich dabei um den Rachen des Wals handelte, brach er in erneutes hysterisches Gelächter aus. Rings um die Kabine waberten Dunstschwaden, die der Höhle im blauen Dämmerschein das Aussehen einer magischen Grotte verliehen.
Als auf dem kleinen Monitor vor ihnen eine Seekarte mit den Bahamas und der Region rings um Miami angezeigt wurde, begann Hopkins mit seiner Fernbedienung den Wal zu »steuern«. Auf der Karte erschien die vorgesehene Schiffsroute, die exakt zu dem von Warner gewünschten Zielort führte.
»Jetzt hat unsere Reise begonnen«, bemerkte Hopkins. »Poseidon ist schnell. In etwa fünf Stunden können wir unser Ziel erreichen.«
»Werden wir hier drin auch nicht ersticken?«, fragte Warner, der sich angestrengt bemühte, seine Angst zu verbergen.
»Aber nein. Wie ich schon sagte: So ein Wal ist ein Säugetier, das heißt, er benötigt Sauerstoff wie wir. Um uns herum ist genügend Sauerstoff vorhanden, er durchläuft nur unsere Filteranlage, und dann können wir ganz normal weiteratmen.«
»Pinocchio, du bist ein echter Teufelskerl! Wie hast du das alles nur geschafft? Wie hast du zum Beispiel die Elektrode und den Computer in das Gehirn von diesem Dickerchen hineinbekommen?«
»Allein kann man das nicht bewerkstelligen. Zuerst mussten wir den Wal betäuben, und dafür benötigten wir fünfhundert Kilogramm Narkotikum. Das Ganze war ein militärisches Forschungsprojekt, das Milliarden Dollar verschlungen hat. Ich war der Leiter. Poseidon ist eigentlich Eigentum der US-Marine. Während des Kalten Kriegs brachte man mit seiner Hilfe Spione und Sondereinsatzkommandos an die Küsten der Warschauer-Pakt-Staaten. Ich habe auch noch einige andere Projekte geleitet. Zum Beispiel implantierten wir unsere Elektroden auch in die Gehirne von Delfinen und Haien. Wir haben Sprengstoff an die Tiere geschnallt und konnten sie so in lenkbare Torpedos verwandeln. Ich habe viel für unser Land getan, aber dann haben sie den Verteidigungshaushalt zusammengestrichen und mich einfach hinausgeworfen. Als ich unser Forschungsinstitut verlassen habe, habe ich Poseidon mitgenommen. In den letzten Jahren haben wir beide alle Weltmeere bereist.«
»Aber wenn du jetzt deinen Poseidon für so eine Sache einsetzt, hast du da nicht gewisse moralische, äh … Bedenken? Das klingt in deinen Ohren sicher lächerlich, wenn einer wie ich von Moral redet, aber in meinem südamerikanischen Labor hatte ich viele Chemiker und Ingenieure mit solchen Bedenken.«
»Damit habe ich überhaupt kein Problem, Sir. Dass wir Menschen diese unschuldigen Kreaturen für unsere schmutzigen Kriege missbraucht haben, stellt doch schon den Gipfel der Unmoral dar. Ich habe enorm viel für unser Land und unsere Armee geleistet, da habe ich jetzt auch das Recht auf eine angemessene Belohnung – und wenn die Gesellschaft mir diese Belohnung verwehrt, dann hole ich sie mir eben einfach selbst.«
»Hahahaha … Da hast du recht! Hahaha …« Plötzlich verstummte Warner. »Hör mal. Was ist denn das für ein Geräusch?«
»Poseidon spritzt eine Nebelfontäne. Er atmet. Unsere Kabine ist mit einem hochempfindlichen Sonar ausgestattet, der alle Außengeräusche verstärken kann. Hören Sie mal.«
Warner vernahm ein Brummen, das, begleitet vom Klatschen der Wellen, erst an- und dann abschwoll, ehe es schließlich allmählich erstarb.
»Das war ein Zehntausend-Tonnen-Tanker.«
Plötzlich setzten sich die riesigen Hornplatten, die der Wal anstelle von Zähnen trug, in Bewegung. Tosende Wassermassen fluteten herein, und im Nu stand die Tauchkabine komplett unter Wasser. Auf einen Knopfdruck von Hopkins hin verschwand die Seekarte vom Monitor. Stattdessen erschien nun ein komplexes Wellenmuster – ein Elektroenzephalogramm der Gehirnwellen des Wals.
»Oh! Poseidon hat einen Fischschwarm entdeckt. Jetzt will er erst mal ein bisschen was spachteln.«
Hinter dem sich weit öffnenden Maul des Wals taten sich vor den Kabineninsassen die unermesslichen schwarzen Tiefen des Ozeans auf. Plötzlich blitzte ein Fischschwarm vor ihnen auf. Dichte Scharen wogten durch das Maul herein und prallten heftig gegen die Kabine, deren Insassen sich auf einmal von Unmengen Fischen umgeben fanden. Unzählige Leiber, die im Lampenschein silbern glitzerten, wimmelten um sie herum. Die Tiere ahnten nichts von ihrem Schicksal. Sie glaubten, es habe sie in eine große Korallenhöhle verschlagen. Undeutlich konnten Warner und Hopkins hinter all dem Gewimmel erkennen, wie sich die Barten mit einem Krachen schlossen. Das Maul jedoch blieb geöffnet, und die Fische wogten mit einem heftig zischenden Schwall Wasser zurück, bis sie an den Barten wie an einem Gatter hängen blieben. Warner begriff, dass der Wal das Meerwasser abließ. Der Druck, mit dem Wasser und Fische zurückgepresst wurden, war so enorm, dass das Wasser unter seinen staunenden Augen senkrecht hinausschoss. Im Nu war es gänzlich abgeflossen. Zurück blieb ein wild durcheinanderhüpfender und -zappelnder Berg von Fischen vor dem Gatter aus Barten. Dann begann sich der weiche Untergrund, auf dem die Kabine ruhte, auf und ab zu schlängeln und die Fischmassen mit einer raschen, wellenartigen Bewegung nach hinten zu tragen. Als Warner dämmerte, was es damit auf sich hatte, packte ihn am ganzen Körper eisiges Entsetzen.
»Keine Sorge«, beruhigte ihn Hopkins, der um die Angst seines Passagiers wusste. »Poseidon wird uns nicht hinunterschlucken. Er kann uns von den Fischen auseinanderhalten, so wie wir, wenn wir einen Kürbiskern essen, zwischen der Schale und dem Kern unterscheiden können. Unsere kleine Kabine behindert ihn zwar ein wenig bei der Nahrungsaufnahme, aber daran hat er sich schon gewöhnt. Notfalls, wenn die Fischschwärme besonders groß sind, spuckt er die Kabine vor dem Essen einfach für eine Weile aus.«
Warner atmete auf und setzte zu einem erneuten Gelächter an, merkte aber, dass ihm dafür die Kraft fehlte. Wie gelähmt verfolgte er, wie der Fischberg langsam an der reglos verharrenden Kabine vorbei auf den schwarz klaffenden Schlund hinter ihnen transportiert wurde, bis die zwei oder drei Tonnen Fisch mit einem Getöse wie von einem Bergsturz darin verschwanden.
Der Schock saß Warner so tief in den Knochen, dass er lange kein Wort mehr über die Lippen brachte. Endlich stupste Hopkins ihn an. »Wie wär’s mit ein bisschen Musik?« Er drehte den Lautsprecher des Sonars auf.
Ein tiefes Rumoren drang an Warners Ohren. Verständnislos blickte er Hopkins an.
»Das ist Walgesang. Poseidon singt.«
Mit der Zeit erkannte Warner hinter den dumpfen, unregelmäßigen Klängen einen Rhythmus, ja, sogar eine Melodie. »Wozu macht er denn das? Ist er auf Partnersuche?«
»Es ist mehr als das. Wir Meeresbiologen erforschen diesen Gesang schon seit Langem, aber wir können seine wahre Bedeutung noch immer nicht ergründen.«
»Vielleicht hat er ja gar keine Bedeutung.«
»Im Gegenteil, seine Bedeutung ist so tief, dass sie das menschliche Begriffsvermögen übersteigt. Wir Forscher glauben, dass es sich um eine musikalische Sprache handelt – aber um eine, die vieles ausdrückt, was jenseits aller menschlichen Sprachen liegt.«
Es klang, als sänge die Seele des Meeres durch den Wal hindurch. In diesem Gesang schlugen Blitze in den urzeitlichen Ozean ein, und das Leben regte sich klein und schimmernd wie ein Glühwürmchen in der Ursuppe; in diesem Gesang öffnete das Leben furchtsam und doch neugierig die Augen und kroch auf geschuppten Füßen zum ersten Mal an Land, wo die Vulkane noch immer brodelten; in diesem Gesang ging das Imperium der Dinosaurier in einem Kälteeinbruch zugrunde, und so verflog die Zeit, das Antlitz der Erde wandelte sich immer von Neuem, und nachdem sich die Gletscher zurückgezogen hatten, spross in der ersten Wärme intelligentes Leben wie ein zartes Grasbüschel; in diesem Gesang erhob sich – unwirklich zuerst wie ein Schemen – auf allen Kontinenten die Zivilisation, und Atlantis versank unter gewaltigem Getöse im Meer. Schlacht um Schlacht färbte die Meere rot mit Blut, unzählige Reiche stiegen auf und gingen unter, flüchtig wie Schall und Rauch …
Während der Wal aus seinem unermesslichen, in graue Vorzeit zurückreichenden Gedächtnis schöpfte, um das Lied des Lebens zu singen, ahnte er nichts von dem nichtigen Bösen, das sich in seinem Maul verbarg.
Gegen Mitternacht erreichte er die Küste von Miami. Alles lief erstaunlich glatt. Um nicht zu stranden, hielt der Wal über zweihundert Meter von der Küste entfernt an. Es war eine Vollmondnacht, und Warner und Hopkins konnten deutlich die Palmenhaine am Ufer erkennen. Acht Schmuggler in leichten Taucheranzügen nahmen die Ware in Empfang. Bald hatten sie die gesamte Tonne Fracht an Land geschafft und bezahlten anstandslos den hohen Preis, den Warner verlangte. Obendrein versprachen sie auch noch, in Zukunft so viel abzunehmen, wie der Gangsterboss liefern konnte. Sie konnten kaum glauben, wie scheinbar mühelos er und sein Gehilfe in ihrer kleinen Tauchkabine die engmaschig überwachte Küstenzone überwunden hatten. Anfangs – Hopkins hatte Poseidon zuvor bereits in sichere Entfernung manövriert – hatten sie sich sogar gefragt, ob die beiden Ankömmlinge dort auf hoher See wirklich Menschen aus Fleisch und Blut oder Spukgespenster waren.
Eine halbe Stunde später, als die Schmuggler längst abgezogen waren, kommandierte Hopkins den Wal zurück. Mit zwei Koffern voller Dollar traten sie ihre Rückreise an.
»Großartig, Pinocchio!«, jubelte Warner. »Den Gewinn von heute kannst du ganz allein einsacken. In Zukunft machen wir dann halbe-halbe. Jetzt bist du steinreich! Hahaha … Gut zwei Dutzend Touren haben wir noch vor uns, dann haben wir unsere über zwanzig Tonnen Ware vertickt.«
»Ich glaube, wir werden nicht so viele Touren brauchen. Wenn ich ein paar kleine Verbesserungen an der Kabine vornehme, sollten wir zwei bis drei Tonnen auf einmal transportieren können.«
»Hahahaha … Großartig!«
Während ihrer ruhigen Unterwasserreise schlief Warner ein. Irgendwann rüttelte ihn Hopkins wieder wach. Mit einem Blick auf die Seekarte und die Fahrtroute stellte er fest, dass sie schon zwei Drittel des Wegs zurückgelegt hatten. Alles schien normal. Hopkins machte ihn auf das akustische Signal aufmerksam, das sie von einem fremden Schiff empfingen, doch solche Geräusche waren Warner inzwischen so vertraut, dass er seinen Gehilfen nur fragend anblickte. Erst als er eine Weile weiterlauschte, dämmerte ihm, dass etwas nicht stimmte: Anders als früher war das Geräusch diesmal gleichbleibend laut.
Das Schiff verfolgte den Wal.
»Seit wann geht das schon so?«, fragte Warner.
»Seit einer halben Stunde, obwohl ich in der Zeit mehrfach den Kurs geändert habe.«
»Wie kann das sein? Die Küstenwache würde doch keinen Neutrino-Scan bei einem Wal vornehmen.«
»Und selbst wenn – sie würden ja gar keine Drogen bei uns entdecken.«
»Außerdem: Wenn sie uns hopsnehmen wollten, hätten sie das doch ganz bequem an der Küste vor Miami machen können. Wieso sollten sie so lange damit warten?«
Verständnislos blickte Warner auf den Monitor mit der Seekarte: Sie hatten bereits die Floridastraße passiert und näherten sich der kubanischen Küste.
»Poseidon muss mal Luft holen«, erklärte Hopkins. »Wir müssen kurz auftauchen. Zehn, fünfzehn Sekunden sollten reichen.« Er ergriff seine Fernbedienung und drückte darauf, während Warner bedächtig nickte. Beide spürten den Druck, der auf ihnen lastete, als der Wal emportauchte. Im Nu waren sie an der Meeresoberfläche und hörten ringsum die Wogen klatschen.
Plötzlich drang ein dumpfes Dröhnen aus dem Sonar, und die Tauchkabine erbebte. Als das Sonar erneut aufwummerte, geriet der Wal in Panik. Die Kabine rollte in seinem Maul umher und schlug mehrmals so heftig krachend gegen die Barten, dass die beiden Insassen beinahe in Ohnmacht gefallen wären.