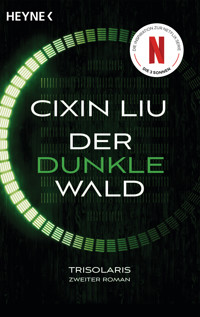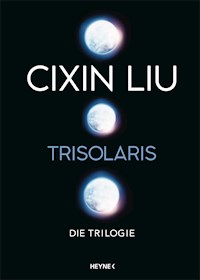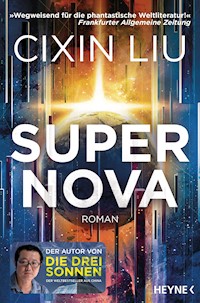16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
An seinem vierzehnten Geburtstag muss der junge Chen miterleben, wie seine Eltern vor seinen Augen getötet werden. Ein mehrere Tausend Grad heißer Feuerball fährt in das alte Haus und verwandelt alles in Asche – ein Kugelblitz. Fortan hat Chen nur noch ein Ziel im Leben: Er will diesem rätselhaften Naturphänomen auf den Grund gehen und es erforschen. Der Weg dorthin führt ihn weit weg von seiner Heimat in der Provinz, über sturmgepeitschte Gebirge bis tief hinab in die Geheimlabore des Verteidigungsministeriums. Dort macht Chen schließlich eine atemberaubende Entdeckung, die ihn an die Grenzen der Physik führt und ihn vor eine Entscheidung stellt: Wem gilt seine Loyalität – seiner Obsession mit Kugelblitzen, seinen Auftraggebern im Ministerium oder allein der Wissenschaft?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
An seinem vierzehnten Geburtstag muss der junge Chen miterleben, wie seine Eltern vor seinen Augen getötet werden. Ein mehrere Tausend Grad heißer Feuerball fährt in das alte Haus und verwandelt alles in Asche – ein Kugelblitz. Fortan hat Chen nur noch ein Ziel im Leben: Er will diesem rätselhaften Naturphänomen auf den Grund gehen und es erforschen. Der Weg dorthin führt ihn weit weg von seiner Heimat in der Provinz, über sturmgepeitschte Gebirge bis tief hinab in die Geheimlabore des Verteidigungsministeriums. Dort macht Chen schließlich eine atemberaubende Entdeckung, die ihn an die Grenzen der Physik führt und ihn vor eine Entscheidung stellt: Wem gilt seine Loyalität – seiner Obsession mit Kugelblitzen, seinen Auftraggebern im Ministerium oder allein der Wissenschaft?
Der Autor
Cixin Liu ist einer der erfolgreichsten chinesischen Science-Fiction-Autoren. Er hat lange Zeit als Ingenieur in einem Kraftwerk gearbeitet, bevor er sich ganz seiner Schriftstellerkarriere widmen konnte. Seine Romane und Erzählungen wurden bereits viele Male mit dem Galaxy Award prämiert. Cixin Lius Roman Die drei Sonnen wurde 2015 als erster chinesischer Roman überhaupt mit dem Hugo Award ausgezeichnet und wird international als ein Meilenstein der Science-Fiction gefeiert.
Von Cixin Liu sind im Heyne Verlag erschienen:
Die drei Sonnen · Der dunkle Wald · Jenseits der Zeit · Die wandernde Erde · Spiegel · Weltenzerstörer · Kugelblitz
Besuchen Sie uns auf:
Cixin Liu
KUGELBLITZ
Roman
Aus dem Chinesischen
von Marc Hermann
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Original ist unter dem Titel (Qiúzhuàng shăndiàn) bei
Sichuan Science & Technology Press, Chengdu, erschienen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 06/2020
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2000 by Cixin Liu ()
German rights authorized by FT Culture Co., Ltd., Beijing
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlagillustration: Stephan Martinière
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-24532-0V001
diezukunft.de
Inhalt
Prolog
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
Nachwort
Anmerkungen
Erläuterungen zu Schreibweise und Aussprache
Chinesische Science-Fiction bei Heyne
Die Beschreibung der Eigenschaften
und des Verhaltens von Kugelblitzen
in diesem Buch beruht auf
historischen Tatsachenberichten.
Prolog
Es war mein Geburtstag, doch daran erinnerte ich mich erst, als meine Eltern am Abend die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen anzündeten und wir uns zu dritt um die vierzehn kleinen Flammen herum setzten.
Draußen tobte ein Gewitter, und das Universum schien aus nichts anderem als aus dicht aufeinanderfolgenden Blitzen und unserer kleinen Wohnung zu bestehen. Im blauen Licht der Blitze zeichneten sich die Regentropfen überscharf ab; für einen Moment schienen sie zu erstarren und hingen wie glitzernde Kristallketten dicht an dicht zwischen Himmel und Erde. Bei ihrem Anblick durchzuckte mich ein Gedanke: Wie faszinierend eine solche Welt doch wäre! Ringsum begleitet von einem feinen Klirren ginge man inmitten von lauter Kristallschnüren durch die Straßen. Doch wie sollte eine solch anmutige, lichte Welt einem heftigen Gewitter trotzen!
Die Welt, die ich sah, hatte sich schon immer von der Welt der anderen unterschieden. Ich wollte die Welt verändern – das war die einzige Erkenntnis, die ich damals über mich selbst gewonnen hatte.
Seit das Gewitter am frühen Abend losgebrochen war, folgten Blitze und Donnerschläge immer rascher aufeinander. Anfangs rief mir noch jeder Blitz jene Kristallwelt, die so flüchtig vor mir aufgeschienen war, wieder in Erinnerung, während ich angespannt den dazugehörigen Donnerschlag erwartete. Doch dann kamen die Blitze so geballt, dass ich nicht mehr unterscheiden konnte, welcher Donner zu welchem Blitz gehörte.
Nichts führt einem so eindrucksvoll vor Augen, wie kostbar das eigene Zuhause ist, wie ein entfesseltes Gewitter. Beim Gedanken an die grauenvolle, bedrohliche Welt dort draußen empfindet man es als überwältigendes Glück, von der Wärme der eigenen vier Wände umfangen zu werden. In solchen Momenten fühlt man mit jeder Kreatur, die im Freien, ohne Dach über dem Kopf, zitternd Sturm und Gewitter überstehen muss. Am liebsten würde man das Fenster öffnen, um ihnen allen Zuflucht zu gewähren, doch man wagt es nicht, denn die Außenwelt erscheint einem so entsetzlich, dass man davor zurückschreckt, auch nur den kleinsten Hauch von ihr in sein behagliches Zuhause eindringen zu lassen.
»Ach ja, das Leben …« Den Blick auf die Flammen geheftet, leerte mein Vater sein Bier in einem Zug. »Unberechenbar ist es, nichts als Wahrscheinlichkeit und Glück, wie ein Zweig, der in einem Bach treibt und an einem Stein hängen bleibt oder von einem Strudel gepackt wird …«
»Wie soll der Junge denn das in seinem Alter verstehen!«, warf meine Mutter ein.
»Er ist alt genug!«, widersprach mein Vater. »Er ist reif genug, um die Wahrheit über das Leben zu erfahren.«
»Als wüsstest du darüber Bescheid!«, frotzelte sie.
»Aber ja doch! Natürlich weiß ich Bescheid!« Mein Vater kippte das nächste halbe Bier hinunter und wandte sich mir zu. »Eigentlich, mein Sohn, ist es gar nicht schwer, ein wunderbares Leben zu führen. Ich verrate dir, wie: Du suchst dir irgendein kniffliges Problem, über das sich alle Welt den Kopf zerbricht – am besten ein mathematisches, zu dessen Lösung du nur ein Blatt Papier und einen Bleistift brauchst. Zum Beispiel die Goldbach’sche Vermutung oder Fermats Letzten Satz. Oder du nimmst dir ein rein naturphilosophisches Problem, für das du nicht einmal Papier und Stift benötigst – zum Beispiel den Ursprung des Universums. Und dann verschreibst du dich mit Leib und Seele der Lösung dieses Problems, aber dabei darf es dir im Grunde nur auf die Arbeit, nicht auf den Erfolg ankommen. Vor lauter Hingabe wirst du gar nicht merken, dass dein Leben wie im Flug vorübergeht. Das meinen die Leute, wenn sie sagen, dass jemand einen Halt gefunden hat.
Oder du entscheidest dich für das Gegenteil und machst das Geldverdienen zu deinem einzigen Lebensinhalt. Du denkst nur darüber nach, wie du noch mehr Geld scheffeln kannst, ohne dich zu fragen, was du damit anstellen sollst. Noch im Angesicht des Todes wirst du dich an deinen Haufen Gold klammern wie Balzacs Vater Grandet und sagen: ›Das stärkt mich!‹ Der Schlüssel zu einem wundervollen Leben ist also irgendetwas, das dich fasziniert. Mich zum Beispiel …« Er zeigte auf die kleinformatigen Aquarelle, die überall im Zimmer an den Wänden hingen. Seine Bilder waren sehr konventionell und bieder gemalt und gaben nicht den geringsten Anflug von Genie zu erkennen. Sie spiegelten den Schein der Blitze wie flimmernde Monitore. »Mich fasziniert das Malen, auch wenn ich weiß, dass aus mir kein zweiter van Gogh mehr wird.«
»Das ist wahr«, sinnierte meine Mutter. »Idealisten und Zyniker bemitleiden einander, aber in Wahrheit sind sie beide glücklich dran.«
Meine Eltern, die sonst immer sehr geschäftig waren, hatten sich auf einmal in Philosophen verwandelt, so als feierten sie ihren eigenen Geburtstag.
»Mama, halt mal still!«, rief ich dazwischen und zupfte aus ihrer Haarpracht, die so dicht und pechschwarz war, ein weißes Haar heraus. Genauer gesagt erwies sich das Haar als zur Hälfte weiß und zur Hälfte schwarz.
Mein Vater hielt das Haar vor die Lampe und musterte es. Im Schein der Blitze glomm es wie ein Glühfaden. »Soweit ich weiß, ist dies das erste weiße Haar deiner Mutter überhaupt – jedenfalls das erste, das wir entdeckt haben.«
»Jetzt reicht’s aber! Für dieses eine wachsen mir nun sieben weiße Haare nach!« Verärgert riss ihm meine Mutter das Haar aus der Hand und warf es beiseite.
»Tja, so ist das Leben.« Mein Vater zeigte auf die Kerzen auf dem Kuchen und sagte: »Stell dir vor, du nimmst so eine kleine Kerze und stellst sie in der Wüste Gobi auf. Wenn gerade kein Wind weht, kannst du sie vielleicht sogar anzünden. Und dann gehst du fort. Was würdest du fühlen, wenn du aus der Ferne noch einmal zu der Flamme zurückblicken würdest? Mein Junge, so ist das Leben: zerbrechlich und flüchtig. Ein Hauch, und es erlischt.«
Schweigend betrachteten wir die Flammen, als wären sie eine Schar kleiner Lebewesen, die wir sorgsam aufgezogen hatten. Sie zitterten im kalten bläulichen Licht, das durch die Fenster hereinfiel.
Draußen ging eine neue Kaskade heftiger Blitze nieder.
In diesem Moment drang er durch die Wand ins Zimmer ein, gleich neben einem Ölgemälde, das eine Orgie griechischer Götter zeigte – so als wäre er ein Gespenst, das dem Bild entsprungen war. Er war so groß wie ein Basketball und verströmte verschwommenes rotes Licht. Anmutig schwebte er über unseren Köpfen und zog einen dunkelroten Schweif hinter sich her. Seine Flugbahn war unberechenbar, und sein Schweif zog verwirrend komplizierte Bahnen in der Luft über uns. Im Flug gab er ein dumpfes Pfeifen von sich, in dessen tiefen Grundton sich ein schrilles Heulen mischte, als wäre er ein Geist, der in einer urzeitlichen Einöde eine primitive Flöte blies.
Erschrocken packte meine Mutter meinen Vater mit beiden Händen – eine Bewegung, die mich für den Rest meines Lebens schmerzlich verfolgen sollte. Hätte meine Mutter das nicht getan, wäre mir vielleicht zumindest ein Elternteil erhalten geblieben.
Der kugelförmige Geist schwebte weiter, als suchte er etwas. Endlich hatte er sein Ziel gefunden. Er verharrte einen halben Meter über dem Kopf meines Vaters, während sein Heulen noch tiefer wurde und schubweise ertönte wie Hohngelächter.
In diesem Moment konnte ich sein halb durchsichtiges, rot leuchtendes Inneres erkennen: Es wirkte unendlich tief, und aus seinem bodenlosen Abgrund wirbelten blaue Funken empor wie Sterne und stürzten einem Geist entgegen, der mit Überlichtgeschwindigkeit durch das All rauschte.
Wie ich später erfuhr, erreichte die Energiedichte in seinem Innern zwanzig- bis dreißigtausend Joule pro Kubikzentimeter. Zum Vergleich: Ein Sprengstoff wie TNT entwickelt nicht mehr als zweitausend Joule pro Kubikzentimeter. Doch auch wenn die Temperatur in seinem Innern auf über zehntausend Grad steigen konnte, blieb seine Oberfläche kalt.
Mein Vater hielt eine Hand über sich – nicht um das Ding zu berühren, sondern um seinen Kopf zu schützen. Doch kaum hatte er den Arm ausgestreckt, schien seine Hand eine Anziehungskraft auszuüben, die das Ding an sich zog wie die Spitze eines Blatts einen Tautropfen.
Mit einem grellen weißen Blitz und einem ohrenbetäubenden Knall explodierte die Welt um mich herum.
Als sich meine geblendeten Augen wieder erholt hatten, bot sich mir ein Anblick, der mich mein Leben lang begleiten sollte: Als hätte jemand in einer Bildbearbeitungssoftware den Graustufenmodus gewählt, waren die Körper meiner Eltern schlagartig schwarz-weiß geworden – oder besser gesagt: aschgrau, denn schwarz waren nur die Schatten, die das Lampenlicht in Furchen und Falten warf. Grau wie Marmor waren meine Eltern. Noch immer reckte mein Vater eine Hand über sich, während meine Mutter sich vornüberbeugte und seinen anderen Arm gepackt hielt. Aus den Gesichtern dieser beiden Statuen blickten ihre versteinerten Augen noch immer wie lebendig.
Ein seltsamer Geruch schwängerte die Luft – wie ich später erfuhr, war es der Geruch von Ozon.
»Papa!«, schrie ich. Keine Antwort.
»Mama!«, schrie ich. Keine Antwort.
Der Moment, in dem ich mich den beiden Statuen näherte, war der grauenerregendste meines Lebens. Das Grauen, das ich bis dahin kannte, hatte mich zumeist in meinen Träumen heimgesucht, und in meinen Albträumen hatte mich mein waches Unterbewusstsein vor dem seelischen Zusammenbruch bewahrt, indem es meinem Bewusstsein aus einem entlegenen Winkel zugerufen hatte: Das ist ein Traum. Auch nun schrie mir eine Stimme in meinem Innern aus Leibeskräften diese Worte zu – es war die einzige Kraft, die mich noch aufrechthielt, während ich auf meine Eltern zuging. Ich streckte eine zitternde Hand nach meinem Vater aus. Als meine Finger die aschgraue Oberfläche seiner Schultern berührten, hatte ich das Gefühl, als durchstieße ich eine äußerst dünne und brüchige Schale. Ich hörte ein leises Knacken wie von einem Glas, das man im tiefsten Winter mit kochendem Wasser füllt, sodass es zerplatzt, und vor meinen Augen fielen die beiden Statuen in sich zusammen wie zwei kleine Lawinen.
Auf dem Teppich bildeten sich zwei Aschehaufen. Das war alles, was von meinen Eltern übrig blieb.
Die Holzstühle, auf denen sie eben noch gesessen hatten, standen unverändert dort, nur dass sie nun von einer Ascheschicht bedeckt waren. Ich strich die Asche weg – die Sitzflächen waren vollkommen unversehrt geblieben und fühlten sich kalt an. Die Öfen in den Krematorien, das wusste ich, brauchten dreißig Minuten, um einen menschlichen Körper bei zweitausend Grad Celsius restlos zu Asche zu verbrennen. Also dachte ich: Das ist ein Traum.
Wie verloren sah ich mich im Zimmer um, und mein Blick fiel auf das Bücherregal: Hinter der Glastür stiegen dichte Schwaden aus weißem Rauch von den Brettern auf. Als ich hinüberging und die Tür öffnete, zerstob der Rauch, und ich sah, dass ein Drittel der Bücher zu Asche zerfallen war, und zwar von derselben Farbe wie die beiden Haufen auf dem Teppich. Die Regalbretter jedoch zeigten keinerlei Brandspuren. Das ist ein Traum.
Aus dem halb geöffneten Kühlschrank sah ich Dampf aufsteigen, und als ich auch hier die Tür öffnete, entdeckte ich, dass das tiefgefrorene Hähnchen gar war und appetitlich duftete. Auch die Garnelen und der Fisch im Tiefkühlfach waren gar. Der Kühlschrank selbst jedoch war heil geblieben, und der Kompressor sprang gerade lautstark an. Das ist ein Traum.
Ich spürte, dass mit mir irgendetwas nicht stimmte. Als ich mein Sakko öffnete, fiel eine Ladung Asche von mir ab – das Hemd, das ich getragen hatte, war restlos verbrannt, das Jackett darüber jedoch unversehrt geblieben, weshalb ich zunächst nichts bemerkt hatte. Als ich die Sakkotaschen befühlte, verbrannte ich mir die Hand, denn mein PDA war zu einem glühend heißen Plastikklumpen geschmolzen. Dies musste ein Traum sein, und zwar ein höchst absonderlicher!
Wie betäubt setzte ich mich wieder auf meinen Stuhl. Die beiden kleinen Aschehaufen, die auf der anderen Seite des Tisches auf dem Teppich lagen, konnte ich von meinem Platz aus nicht erkennen, doch ich wusste, dass sie da waren. Draußen ebbten Blitz und Donner ab, und schließlich hörte es auf zu regnen. Dann lugte der Mond zwischen den Wolken hervor und warf einen geisterhaften Silberglanz durch die Fenster. Wie betäubt blieb ich sitzen und rührte mich nicht von der Stelle; in meinem Bewusstsein existierte die Welt nicht mehr, ich trieb in einer grenzenlosen Leere.
Irgendwann – ich weiß nicht, wie viel Zeit verstrichen war – weckte mich die Morgensonne, die durch das Fenster drang. Wie betäubt stand ich auf, um zur Schule zu gehen. Ich tastete erst nach meinem Ranzen und dann nach der Tür, so als herrschte ringsum Dunkelheit, denn mein Blick verlor sich in einer unendlichen Ferne.
Als sich mein Geisteszustand nach einer Woche wieder halbwegs normalisiert hatte, erinnerte ich mich als Erstes daran, dass ich an jenem Abend Geburtstag gehabt hatte. Doch in meinem Kuchen hätte nur eine einzige Kerze, nein, gar keine stecken sollen, denn in jener Nacht hatte für mich ein neues Leben angefangen. Ich war nicht mehr derselbe Mensch wie vorher.
Genau wie mein Vater kurz vor seinem Tod gesagt hatte, war auch ich von nun an von etwas fasziniert, und ich wollte das wundervolle Leben leben, von dem er gesprochen hatte.
ERSTER TEIL
Universität
Pflichtkurse: Höhere Mathematik, Theoretische Mechanik, Hydromechanik, Theoretische und praktische Informatik, Programmierung und Programmiersprachen, Dynamische und synoptische Meteorologie, Chinesische Meteorologie, Statistische Vorhersagen, Mittel- und langfristige Wettervorhersagen, Numerische Vorhersagen.
Wahlpflichtkurse: Planetarische Zirkulation, Meteorologische Diagnostik und Analyse, Starkregen und Mesometeorologie, Gewittervorhersage und -prävention, Tropische Meteorologie, Klimawandel und kurzfristige Klimaprognosen, Radar- und Satellitenmeteorologie, Luftverschmutzung und Stadtklima, Höhenmeteorologie, Wechselwirkungen zwischen Ozean und Atmosphäre.
Fünf Tage vorher war ich, nachdem ich alle meine Angelegenheiten zu Hause geregelt hatte, zum Studium in eine ferne Stadt im Süden gezogen. Als ich zum letzten Mal die Tür meines leeren Zuhauses geschlossen hatte, wusste ich, dass ich damit meine Kindheit für immer hinter mir ließ. Von nun an würde ich eine Maschine sein, die nur ein einziges Ziel verfolgte.
Doch beim Anblick des Curriculums, das die nächsten vier Jahre meines Studentenlebens in Beschlag nehmen sollte, beschlich mich wachsende Enttäuschung. Die meisten der behandelten Gegenstände waren für mich nicht von Interesse, während einige andere, die ich umso bedeutsamer fand, zum Beispiel Elektromagnetismus und Plasmaphysik, in der Aufstellung fehlten. Mir dämmerte, dass ich mich womöglich für das falsche Fach eingeschrieben hatte. Vielleicht hätte ich besser Physik und nicht Atmosphärenforschung gewählt.
Also vergrub ich mich in der Bibliothek und widmete beinahe all meine Zeit einigen wenigen Fächern: Mathematik, Elektromagnetismus, Hydromechanik und Plasmaphysik. Ich besuchte fast nur noch diejenigen Kurse, die diese Inhalte berührten, und schwänzte den restlichen Unterricht. Das bunte Studentenleben blieb mir fremd und gleichgültig. Nachts pflegte ich erst gegen ein oder zwei Uhr in mein Wohnheim zurückzukehren, und nur wenn ich dann einen meiner Zimmergenossen im Traum den Namen seiner Freundin murmeln hörte, wurde mir bewusst, dass es auch noch ein anderes Leben gab.
Eines Nachts glaubte ich, ich wäre wieder einmal der Einzige in jenem Lesesaal, der sich dem Abendstudium widmete, doch als ich von meinem dicken Buch über Partielle Differentialgleichungen aufsah, begegnete mein Blick dem von Dai Lin, einer hübschen Studentin aus meiner Klasse. Sie saß mir gegenüber, hatte aber kein Buch vor sich liegen, sondern beobachtete mich nur, das Kinn auf die Hände gestützt. Allerdings hätte der Ausdruck, mit dem sie mich betrachtete, ihre Scharen von Bewunderern nicht in Verzückung versetzt: Sie sah mich – ich weiß nicht, wie lange schon – an, als hätte sie in ihren Reihen einen feindlichen Spion entdeckt, einen Alien.
»Du bist eigenartig«, sagte sie. »Man merkt, dass du nicht einfach nur ein Bücherwurm bist. Du bist extrem konzentriert.«
»Na und? Ihr anderen verfolgt doch auch Ziele, oder?«, fragte ich leichthin zurück. Vielleicht war ich der einzige männliche Student in der Klasse, der noch nie ein Wort mit ihr gewechselt hatte.
»Unsere Ziele sind vage, aber du verfolgst bestimmt ein ganz konkretes Ziel.«
»Du verfügst über eine gute Menschenkenntnis«, erwiderte ich kühl, während ich meine Bücher zusammenräumte und aufstand. Ich empfand als Einziger kein Bedürfnis, mich vor ihr wichtigzutun, und das flößte mir ein Gefühl der Überlegenheit ein.
»Wonach suchst du?«, rief sie mir hinterher, als ich schon an der Tür war.
»Das würde dich nicht interessieren«, erwiderte ich, ohne mich umzudrehen.
Als ich draußen in der stillen Herbstnacht zum Sternenhimmel aufblickte, glaubte ich aus der Luft die Stimme meines Vaters zu hören: »Der Schlüssel zu einem wundervollen Leben ist etwas, das dich fasziniert.« Nun fühlte ich am eigenen Leib die Wahrheit seiner Worte. Mein Leben glich einem Geschoss, das durch die Luft rauschte, von nichts als der Sehnsucht beseelt, an seinem Ziel zu explodieren. Dieses Ziel versprach keinerlei materiellen Nutzen, doch wenn ich es erreichen würde, wäre mein Leben vollendet. Ich wusste nicht, was mich zu jenem Punkt zog, ich wusste nur, dass ich ihn anvisieren wollte, und das war genug. Der Impuls, der mich antrieb, gründete in der tiefsten Natur des Menschen. Seltsamerweise hatte ich bis dahin noch keinerlei Forschungsliteratur zu meinem Gegner studiert. Wir beide glichen zwei Rittern, die sich ihr Leben lang auf das eine entscheidende Duell vorbereiten, doch solange ich mich dafür noch nicht gewappnet fühlte, würde ich meinen Feind weder ins Visier nehmen noch über ihn nachgrübeln.
Im Nu waren drei Semester vergangen. Ich erlebte diese Zeit als ein einziges Kontinuum, das von den Semesterferien nicht durchbrochen wurde, denn weil ich kein Zuhause mehr hatte, hatte ich auch die Ferien ausnahmslos auf dem Campus verbracht. Nur in der Nacht vor dem Frühlingsfest, als ich draußen die Böller hörte, dachte ich an mein Leben, bevor er aufgetaucht war – ein Leben, das mir nun unwirklich fern vorkam. In den Nächten, wenn die Heizung im Wohnheim ausgeschaltet wurde, machte die Kälte meine Träume außerordentlich lebendig, und ich glaubte, meine Eltern würden mir darin erscheinen, doch das taten sie nicht.
Mir kam eine indische Legende in den Sinn. Sie handelte von einem König, der, als seine innig geliebte Gemahlin verstorben war, den Entschluss fasste, zu ihrem Andenken ein Mausoleum von unerhörter Pracht zu errichten. Er widmete einen Großteil seines Lebens dem Bau dieses Mausoleums, doch als es endlich vollendet war und er im Innern der Grabstätte den Sarg seiner verstorbenen Gattin erblickte, brummte er nur: »Wie unpassend sich dieses Ding hier ausnimmt! Schafft es fort.«
Meine Eltern waren längst fortgegangen, und nun nahm er jeden Winkel meines Herzens in Beschlag.
Doch was dann geschah, machte meine einfache Welt wieder kompliziert.
Seltsame Phänomene I
In den Sommerferien nach meinem zweiten Studienjahr fuhr ich in meine Heimatstadt. Ich wollte die alte Wohnung meiner Eltern vermieten, um mein weiteres Studium zu finanzieren.
Als ich zu Hause ankam, war es bereits dunkel. Ich tastete nach dem Schloss, und als ich die Tür aufgestoßen und das Licht eingeschaltet hatte, erwartete mich der vertraute Anblick. Der Tisch, auf dem in jener Gewitternacht mein Geburtstagskuchen gestanden hatte, nahm noch immer die Mitte des Wohnzimmers ein, und rings um ihn standen noch immer die drei Stühle, auf denen wir damals gesessen hatten. Es war, als wäre ich erst gestern fortgegangen.
Erschöpft ließ ich mich auf das Sofa fallen und musterte mein altes Zuhause. Irgendetwas stimmte nicht. Anfangs war es nur ein vages Gefühl, das jedoch immer schärfer hervortrat, wie ein verborgenes Riff, das man auf einer Fahrt durch den Nebel zuerst nur erahnt. Endlich, als das Gefühl überdeutlich wurde, erkannte ich seine Quelle:
Es war, als wäre ich erst gestern fortgegangen.
Ich nahm die Tischfläche genauer in Augenschein: Sie war nur von einer dünnen Staubschicht bedeckt – allzu dünn, gemessen daran, dass ich vor zwei Jahren ausgezogen war.
Ich ging ins Badezimmer, um mir den Schweiß und den Staub vom Gesicht zu waschen. Als ich das Licht einschaltete, erblickte ich mich selbst klar und deutlich im Spiegel – allzu klar. Der Spiegel hätte nicht so sauber sein sollen. Ich erinnerte mich noch gut daran, wie ich als Grundschüler einmal mit meinen Eltern in den Sommerurlaub gefahren war: Wir waren nur eine Woche fort gewesen, doch als wir zurückkamen, konnte ich mit dem Finger ein Strichmännchen in den Staub auf dem Spiegel zeichnen. Nun jedoch hinterließ mein Finger auf dem Glas keine Spuren.
Ich drehte den Wasserhahn auf. Nach zwei Jahren hätte das Wasser rostbraun sein sollen, doch es war kristallklar.
Nachdem ich mir das Gesicht gewaschen und ins Wohnzimmer zurückgekehrt war, fiel mir ein weiteres Detail auf: Als ich mich vor zwei Jahren angeschickt hatte, das Haus zu verlassen, hatte ich mich an der Türschwelle noch einmal rasch umgeblickt, um auch ja nichts zu vergessen, und dabei war mein Blick auf ein Glas gefallen, das auf dem Tisch stand. Im ersten Moment wollte ich noch mal zurückgehen, um das Glas umzudrehen, damit es nicht einstaubte, doch weil mir das Gepäck so schwer auf der Schulter lastete, verwarf ich den Gedanken wieder. Ich erinnerte mich noch ganz deutlich an dieses Detail.
Nun jedoch stand ebendieses Glas umgedreht auf dem Tisch!
In diesem Moment kamen die Nachbarn, die Licht bei mir gesehen hatten, an die Tür. Sie hatten manche warmen Worte für mich übrig, wie sie ein verwaister Student erwarten kann, und versprachen mir, sich für mich um die Vermietung der Wohnung zu kümmern. Für den Fall, dass ich nach meinem Abschluss nicht mehr nach Hause kommen sollte, boten sie mir auch ihre Hilfe dabei an, die Wohnung zu einem guten Preis zu verkaufen.
»Anscheinend ist es hier in der Umgebung viel sauberer geworden, seit ich weggegangen bin«, bemerkte ich beiläufig.
»Sauberer? Du musst wohl mal zum Augenarzt! Seit das neue Stromkraftwerk drüben bei der Brauerei letztes Jahr in Betrieb gegangen ist, ist doppelt so viel Staub in der Luft! Wo findet man heutzutage schon noch einen Ort, an dem es sauberer wird?«
Ich blickte auf die hauchfeine Staubschicht auf dem Tisch, sagte aber nichts. Doch als sie sich von mir verabschiedeten, konnte ich mir die Frage nicht verkneifen, ob einer von ihnen vielleicht einen Schlüssel zu meiner Wohnung hätte. Daraufhin wechselten sie erstaunte Blicke miteinander und versicherten mir, das sei nicht der Fall. Ich glaubte ihnen. Ursprünglich hatte es fünf Wohnungsschlüssel gegeben, von denen drei noch intakt waren. Vor zwei Jahren hatte ich alle drei mitgenommen; einen trug ich jetzt bei mir, während die anderen beiden weit weg in meinem Wohnheimzimmer lagen.
Nachdem die Nachbarn gegangen waren, überprüfte ich alle Fenster: Sie waren fest geschlossen und wiesen keinerlei Spuren von Beschädigung auf.
Die beiden übrigen Schlüssel hatten meine Eltern bei sich getragen. In jener Nacht waren sie geschmolzen. Ich werde nie vergessen, wie ich aus den Aschehaufen meiner Eltern die beiden unförmigen Metallklumpen herausklaubte. Auch diese zwei Schlüsselbünde, die erst geschmolzen und dann wieder erstarrt waren, bewahrte ich nun in meinem fernen Wohnheimzimmer auf – zum Gedenken an jene unvorstellbare Energie.
Nachdem ich eine Weile dagesessen hatte, begann ich zusammenzuräumen, was ich mitnehmen oder anderswo lagern wollte, wenn die Wohnung vermietet wäre. Zuerst suchte ich die Aquarelle meines Vaters zusammen. Sie gehörten zu den wenigen Dingen in dieser Wohnung, an denen ich wirklich hing. Erst nahm ich die paar Bilder ab, die an den Wänden hingen, dann holte ich die anderen aus dem Schrank und verstaute alle, die ich finden konnte, in einem Karton. Im untersten Bücherregal bemerkte ich schließlich noch ein weiteres Aquarell, das ich vorher übersehen hatte, weil es mit der Leinwand nach unten lag. Bevor ich es zu den anderen in den Karton legte, warf ich noch einen Blick darauf – und meine Aufmerksamkeit war sofort gefesselt.
Es war ein Landschaftsbild, das die Szenerie vor unserer Wohnung zeigte: eine triste Kulisse aus einigen düsteren vierstöckigen alten Häusern und ein paar Pappelreihen. Unter seiner Staubschicht wirkte das Bild vollkommen leblos. Als drittklassiger Hobbymaler war mein Vater ziemlich faul gewesen. Er ging kaum einmal aus dem Haus, um nach der Natur zu malen; stattdessen wurde er es nie müde, die immer gleiche trostlose Szenerie vor unserer Wohnung nachzubilden. Es gebe keine trivialen Sujets, pflegte er zu sagen, nur mittelmäßige Maler. Leider war er selbst auch ein solcher gewesen, und wenn er die triste Szene mit seinem uninspirierten Pinsel kopierte, wirkte sie nur noch seelenloser. Andererseits hatte er eben dadurch den trostlosen Alltag einer nordchinesischen Stadt so glaubhaft eingefangen. Jedenfalls unterschied sich das Bild in meinen Händen auf den ersten Blick in nichts von all den anderen Bildern im Karton.
Doch ein Detail stach mir ins Auge: ein Wasserturm, der sich durch seine Farbenpracht – er erinnerte mich an eine Purpurwinde – von den umliegenden alten Gebäuden abhob. Auch an diesem Turm war eigentlich nichts Bemerkenswertes, schließlich stand er tatsächlich dort draußen. Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich, wie sich seine hohe Silhouette schwarz gegen die Lichter der Stadt abzeichnete.
Nur war dieser Wasserturm erst vollendet worden, nachdem ich schon angefangen hatte zu studieren. Als ich vor zwei Jahren meine Heimatstadt verlassen hatte, war er nur ein halb fertiger Rohbau gewesen, umgeben von Baugerüsten.
Ein Schauder durchlief mich, und mir fiel das Bild aus der Hand. Es war ein Abend im Hochsommer, doch ein kalter Windstoß schien durch die Wohnung zu wehen.
Ich legte das Bild zu den anderen, und nachdem ich den Karton fest verschlossen hatte, machte ich mich daran, weiter aufzuräumen. Doch so angestrengt ich auch versuchte, mich auf das zu konzentrieren, was ich tat, mein Geist glich einer Nadel, die an einem Faden aufgehängt ist, während der Karton ein starker Magnet war. Wenn ich mich bemühte, konnte ich die Nadel in eine andere Richtung lenken, doch sobald ich in meiner Anstrengung nachließ, schwang die Nadel sogleich zurück in ihre alte Stellung. Von draußen pochte der Regen leise an die Fenster, doch ich wurde das Gefühl nicht los, dass dieses Klopfen aus dem Karton hervordrang.
Schließlich hielt ich es nicht länger aus. Ich rannte zu dem Karton zurück und öffnete ihn, nahm das Bild heraus und trug es ins Badezimmer, wobei ich darauf achtete, es mit dem Motiv nach unten zu halten. Dann zog ich ein Feuerzeug heraus und zündete das Bild an einer Ecke an. Als es zu einem Drittel verbrannt war, konnte ich dem Drang, es umzudrehen, nicht länger widerstehen. Der Wasserturm wirkte nun noch lebendiger, so als könnte er jeden Moment aus dem Papier hervortreten. Ich sah den Flammen dabei zu, wie sie das Aquarell verschlangen: Während sie sich durch die Wasserfarben fraßen, nahmen sie eine eigentümliche, verführerische Färbung an. Als kaum noch etwas von dem Bild übrig war, warf ich die Überreste in das Waschbecken und beobachtete, wie das Feuer erlosch. Dann drehte ich den Wasserhahn auf und spülte die Asche weg. Nachdem ich den Hahn wieder zugedreht hatte, fiel mein Blick auf den Beckenrand, und ich bemerkte etwas, das ich vorher, als ich mir das Gesicht gewaschen hatte, übersehen hatte.
Mehrere Haare. Lange Haare.
Die Haare waren weiß – manche zur Gänze, sodass sie mit der Beckenoberfläche fast verschmolzen, andere nur zur Hälfte, sodass die schwarzen Anteile hervorstachen. Ich konnte sie unmöglich vor zwei Jahren hier verloren haben, denn so lange Haare hatte ich nie gehabt – von so weißen ganz zu schweigen. Behutsam las ich eines der halb weißen Haare auf.
Für dieses eine wachsen mir nun sieben weiße Haare nach …
Ich schüttelte das Haar so heftig ab, als hätte ich mir die Finger verbrannt. Langsam schwebte es herab und hinterließ in der Luft einen Schweif, der aus den flüchtigen Abbildern vieler Haare bestand, so als wäre mein Sehsinn auf einmal viel träger geworden. Doch statt auf dem Beckenrand zu landen, löste sich das Haar auf halber Höhe in Nichts auf. Ich suchte die Haare auf dem Becken: Auch sie waren spurlos verschwunden.
Nachdem ich den Kopf lange unter den aufgedrehten Wasserhahn gehalten hatte, tappte ich wie benommen ins Wohnzimmer zurück. Ich setzte mich auf das Sofa und lauschte dem Regen, der zu einem Wolkenbruch angeschwollen war, allerdings ohne Blitz und Donner. Der Regen klopfte an die Fenster wie ein Mensch, nein, viele Menschen, die leise auf mich einredeten, als wollten sie mich an etwas erinnern. Lange hörte ich zu, bis ich allmählich die Worte zu vernehmen glaubte, die all diese Stimmen unentwegt wiederholten und die in meinen Ohren immer realer klangen:
Damals in der Nacht war ein Gewitter, damals in der Nacht war ein Gewitter, damals in der Nacht war ein Gewitter …
Wieder blieb ich in einer Gewitternacht in der Wohnung meiner Eltern sitzen, bis der Morgen heraufdämmerte und ich erneut wie betäubt mein altes Zuhause verließ. Ich wusste, ich ließ etwas für immer zurück, und ich wusste, ich würde nie mehr wiederkehren.
Kugelblitz
Ich musste mich ihm stellen, denn mit dem neuen Semester begann auch mein Kurs in Atmosphärischer Elektrizität.
Der Dozent, ein Professor namens Zhang Bin, war um die fünfzig; er war weder groß noch klein, trug eine Brille, die weder dick noch dünn war, sprach mit einer Stimme, die weder hoch noch tief klang, kurz: Er war ein höchst durchschnittlicher Mensch. Das Einzige, was ihn von den meisten anderen unterschied, war die Tatsache, dass eines seiner Beine ein klein wenig lahmte, doch das bemerkte man nur, wenn man genau darauf achtete.
An jenem Nachmittag blieben nach der Vorlesung nur er und ich im Hörsaal zurück. Er räumte auf dem Podium seine Sachen zusammen, ohne auf mich zu achten. Die spätherbstliche Abendsonne warf ihr goldenes Licht in den Saal, und draußen waren die Fensterbänke mit goldgelben Blättern bedeckt. Auf einmal kam mir, der ich sonst so nüchtern war, der Gedanke, was für eine poetische Jahreszeit dies doch war.
Ich stand auf und ging nach vorn zum Pult. »Professor Zhang, darf ich Sie etwas fragen, das mit dem heutigen Unterricht nichts zu tun hat?«
Er warf mir einen flüchtigen Blick zu und nickte, ehe er sich wieder seinen Sachen zuwandte.
»Was können Sie mir über Kugelblitze sagen?« Zum ersten Mal sprach ich das Wort aus, das ich so lange schon tief in mir herumgetragen hatte.
Zhangs Hände verharrten, und er blickte auf, doch nicht zu mir, sondern zur Abendsonne, als wäre sie der Gegenstand meiner Frage gewesen. »Was wollen Sie wissen?«, erwiderte er nach einigen Sekunden.
»Alles.«
Regungslos starrte er weiter in die Sonne, die sein Gesicht in ihr Licht tauchte. Der Sonnenschein war um diese Uhrzeit noch ziemlich intensiv, und ich wunderte mich, dass ihm das Licht nicht zu grell war.
»Zum Beispiel die historischen Berichte darüber«, präzisierte ich meine Frage notgedrungen.
»In Europa sind schon aus dem Mittelalter die frühesten Berichte überliefert. In China hat Zhang Juzheng in der Ming-Zeit einen relativ ausführlichen Bericht verfasst. Aber die erste glaubhafte wissenschaftliche Aufzeichnung stammt erst aus dem Jahr 1837, und die wissenschaftliche Welt nimmt den Kugelblitz erst seit vierzig Jahren als Naturphänomen ernst.«
»Und welche Theorien gibt es darüber?«
»Viele«, antwortete er knapp. Er wandte den Blick von der Sonne ab, räumte seine Sachen aber nicht weiter zusammen, sondern schien in Gedanken versunken.
»Und was besagen die traditionellen Theorien?«
»Eine besagt, dass es sich dabei um einen Plasmawirbel von hoher Temperatur handelt und dass die Fliehkraft, die von der rasend schnellen Rotation in seinem Innern erzeugt wird, mit dem äußeren atmosphärischen Druck einen Gleichgewichtszustand eingeht, der über längere Zeit stabil bleibt.«
»Und die anderen Theorien?«
»Eine andere besagt, dass ein Kugelblitz energetisch stabil ist, weil er auf einer chemischen Reaktion eines Hochtemperatur-Gasgemischs beruht.«
»Können Sie mir noch mehr darüber erzählen?« Ich musste ihm jeden Satz aus der Nase ziehen.
»Es gibt auch noch die Maser-Soliton-Theorie, derzufolge ein Kugelblitz von einem atmosphärischen Maser mit einem Volumen von mehreren Kubikmetern erzeugt wird. Ein Maser entspricht einem Laser, nur dass er deutlich schwächer ist, aber bei einem großen Luftvolumen kann er ein lokales elektrisches Feld mit Solitonen hervorbringen, was dann als Kugelblitz sichtbar wird.«
»Und was ist mit den aktuellen Theorien?«
»Auch davon gibt es jede Menge. Eine Theorie, die relativ viel Aufmerksamkeit erregt hat, ist die von Abrahamson und Dinniss von der University of Canterbury in Neuseeland. Demnach entsteht ein Kugelblitz im Wesentlichen, indem ein Netzwerk aus Silizium-Nanopartikeln durch Oxidation verbrennt. Aber es gibt noch alle möglichen anderen Theorien. Manche Leute glauben sogar, ein Kugelblitz resultiere aus einer kalten Kernfusion in der Luft.«
Zhang hielt eine Weile inne, ehe er endlich mit weiteren Informationen herausrückte. »Hierzulande hat jemand am Institut für Atmosphärenforschung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften eine atmosphärische Plasmatheorie aufgestellt, die auf Gleichungen aus der elektromagnetischen Hydromechanik basiert. Mit dem dabei entwickelten Wirbel-Soliton-Resonator-Modell lassen sich bei geeigneten Temperaturrandbedingungen mithilfe von numerischen Verfahren zur Lösung von Gleichungen theoretisch die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Existenz eines mittelgroßen Plasmawirbels – eines Feuerballs – in der Atmosphäre herleiten.«
»Und was halten Sie von diesen Theorien?«
Er schüttelte bedächtig den Kopf. »Um eine dieser Theorien zu verifizieren, müsste man erst einmal im Labor einen Kugelblitz erzeugen, aber das ist bis jetzt noch niemandem gelungen.«
»Wie viele Augenzeugenberichte gibt es in China?«
»Viele. Wahrscheinlich über tausend. Die berühmteste Sichtung stammt aus dem Jahr 1998: CCTV hat damals einen Dokumentarfilm über die Hochwasserbekämpfung am Yangtse gedreht und dabei unabsichtlich eine klare Aufnahme von einem Kugelblitz gemacht.«
»Eine letzte Frage, Professor Zhang: Gibt es auch chinesische Wissenschaftler aus der atmosphärischen Physik, die mit eigenen Augen einen Kugelblitz gesehen haben?«
Zhang blickte erneut aus dem Fenster zur Abendsonne. »Ja.«
»Und wann war das?«
»Im Juli 1962.«
»Und wo?«
»Auf dem Jadekaiser-Gipfel des Taishan.«
»Wissen Sie, wo dieser Augenzeuge jetzt ist?«
Er schüttelte den Kopf und warf einen Blick auf seine Uhr. »Sie sollten jetzt in die Mensa gehen.« Mit diesen Worten nahm er seine Sachen und marschierte auf den Ausgang zu.
Ich holte ihn ein und überschüttete ihn mit den Fragen, die mir so viele Jahre auf dem Herzen gelegen hatten: »Professor Zhang, können Sie sich ein Objekt von der Gestalt eines Feuerballs vorstellen, das mühelos Wände durchdringen und einen Menschen augenblicklich in Asche verwandeln kann, obwohl es bei seinem Flug keine spürbare Wärme abgibt? Es gibt einen Bericht von einem Ehepaar, das im Schlaf zu Asche verbrannt wurde, während die Decke, unter der es geschlafen hatte, keinerlei Brandspuren aufwies! Können Sie sich vorstellen, dass ein solches Objekt in Ihren Kühlschrank eindringt und schlagartig alle Tiefkühlprodukte dampfend heiß und gar macht, während der Kühlschrank selbst unversehrt weiterarbeitet? Können Sie sich vorstellen, dass dieses Objekt Ihr Hemd verbrennt, ohne dass Sie etwas davon merken? Können die Theorien, die Sie erwähnt haben, all das erklären?«
»Keine dieser Theorien ist hieb- und stichfest«, erwiderte er, ohne stehen zu bleiben.
»Und wenn wir den Bereich der atmosphärischen Physik verlassen? Glauben Sie, dass die gesamte heutige Physik oder die Naturwissenschaften überhaupt eine Erklärung für dieses Phänomen liefern könnten? Macht Sie das denn gar nicht neugierig? Ihr Desinteresse ist für mich noch irritierender als der Anblick eines Kugelblitzes!«
Zhang hielt inne und blickte mir zum ersten Mal in die Augen. »Sie haben einen Kugelblitz gesehen?«
Ich stutzte einen Moment. »Das war nur bildlich gesprochen.«
Ich fühlte mich außerstande, dem stumpfsinnigen Menschen, der dort vor mir stand, mein intimstes Geheimnis anzuvertrauen. Genau diese Gleichgültigkeit gegenüber den tiefsten Mysterien der Natur erfüllte die ganze Gesellschaft. Für die Wissenschaft war diese Mentalität verheerend. Gäbe es weniger Wissenschaftler dieses Schlags, hätte die Menschheit jetzt vielleicht schon Alpha Centauri erreicht!
»Die atmosphärische Physik ist eine angewandte Wissenschaft«, dozierte Zhang. »Und der Kugelblitz ist ein extrem seltenes Phänomen. Deshalb wird er weder in der ›Internationalen Blitzschutznorm für bauliche Anlagen‹IEC/TC-81 noch in der chinesischen ›Blitzschutznorm für Gebäude‹ von 1993 berücksichtigt. Eine intensive Beschäftigung damit verspricht also wenig Ertrag.«
Mit einem solchen Menschen konnte ich nicht reden. Ich dankte ihm und ging davon. Immerhin bedeutete es schon einen großen Fortschritt, dass er überhaupt die Existenz von Kugelblitzen einräumte! Erst 1963 hatte die wissenschaftliche Welt die Existenz dieses Phänomens offiziell anerkannt. Vorher hatte man alle Augenzeugenberichte als Halluzinationen abgetan. Am 19. März 1963 erblickte Roger Jennison, ein Professor für Physikalische Elektronik an der britischen University of Kent, an Bord eines Flugzeugs, das von New York nach Washington unterwegs war, mit eigenen Augen einen Kugelblitz von etwa zwanzig Zentimetern Durchmesser, der durch das Cockpit in das Flugzeug eindrang und den Mittelgang des Passagierraums entlangflog.
An diesem Abend gab ich erstmals auf Google den Suchbegriff ball lightning (Kugelblitz) ein. Ich machte mir nicht viel Hoffnung, doch zu meiner Überraschung meldete die Suchmaschine über vierzigtausend Ergebnisse. In diesem Moment kam es mir zum ersten Mal so vor, als betrachtete die ganze Menschheit jenes Phänomen, dem ich mein Leben widmen wollte.
Ein neues Semester brach an und mit ihm ein glühend heißer Sommer. Für mich jedoch hatte er eine neue Bedeutung gewonnen: Der Sommer würde mit Gewittern einhergehen, und das würde mich ihm ein Stück näher bringen.
Eines Tages suchte Zhang Bin mich unvermittelt auf. Mein Unterricht bei ihm war mit dem letzten Semester beendet, und ich hatte ihn beinahe vergessen.
»Herr Chen«, sagte er zu mir, »ich habe gehört, dass Sie keine Eltern mehr haben und Ihre finanzielle Situation angespannt ist. Ich brauche für ein Projekt in den Sommerferien noch einen Assistenten – wollen Sie das nicht machen?«
Ich fragte ihn, um was für ein Projekt es sich handelte.
»Es geht um eine parametergestützte Analyse von Blitzschutzeinrichtungen für eine geplante Eisenbahnstrecke in der Provinz Yunnan. Damit verbunden ist noch ein zweites Ziel: In der neuen nationalen Blitzschutznorm, die gerade in Arbeit ist, soll die derzeitige landesweite Richtzahl von 0,015 für die Blitzschlagdichte je nach den lokalen Gegebenheiten neu festgesetzt werden. Wir werden dafür als Beobachter in Yunnan fungieren.«
Ich willigte ein. Meine Finanzen waren zwar tatsächlich nicht üppig, aber ich wäre auch ohne diesen Job über die Runden gekommen. Doch hier bot sich mir zum ersten Mal die Gelegenheit, mit der realen Blitzforschung in Kontakt zu kommen.
Unsere Arbeitsgruppe umfasste über ein Dutzend Leute, die in fünf Teams aufgeteilt waren. Die Teams waren auf eine so ausgedehnte Region verstreut, dass zwischen ihnen Hunderte Kilometer lagen. Mein Team bestand neben einem Fahrer und einigen Versuchshelfern im Kern nur aus drei Personen: mir selbst, Zhang Bin und einem seiner Masterstudenten namens Zhao Yu. Als wir unsere Forschungszone erreicht hatten, quartierten wir uns in der Wetterstation des dortigen Kreises ein.
Am nächsten Morgen hatten wir gutes Wetter und konnten mit unserer Feldarbeit beginnen. Während wir aus dem kleinen Zimmer, das uns als provisorisches Lager diente, unsere Apparate und Ausrüstung zum Wagen trugen, fragte ich Zhang Bin: »Professor Zhang, welche geeigneten Verfahren gibt es, um die interne Struktur von Blitzen zu erforschen?«
Er warf mir einen bohrenden Blick zu – anscheinend wusste er, was ich im Sinn hatte. »Angesichts des Bedarfs unserer derzeitigen nationalen Bauprojekte stellt die Erforschung der physikalischen Struktur von Blitzen keine vorrangige Aufgabe dar. Am dringlichsten sind im Moment umfassende statistische Untersuchungen.« Wann immer ich eine Frage stellte, die auch nur entfernt mit Kugelblitzen zu tun hatte, gab er eine solche ausweichende Antwort. Augenscheinlich verabscheute er jede Forschung, die keinen unmittelbaren praktischen Nutzen versprach.
An seiner Stelle beantwortete Zhao Yu meine Frage: »Dafür gibt es nur wenige Verfahren. Im Moment können wir nicht mal die elektrische Spannung direkt messen. Wir müssen sie indirekt über die gemessene Stromstärke berechnen. Um die physikalische Struktur von Blitzen zu erforschen, benutzt man meistens das hier.« Er zeigte auf ein röhrenförmiges Gebilde, das in einer Ecke des Lagerraums stand. »Das ist ein Magnetstahlschreiber zum Aufzeichnen der Amplitude und Polarität des Blitzstroms. So ein Gerät besteht aus einem Material mit einem relativ hohen Restmagnetismus, und wenn die Leitung im Innern mit einem Blitz in Kontakt kommt, kann man anhand des Restmagnetismus, der auf dem Gerät verbleibt, die Amplitude und Polarität berechnen. Das hier ist ein Modell aus 60Si2Mn-Federstahl, aber es gibt auch welche aus Kunststoffröhren, Klingenkernen oder Eisenpulver.«
»Und werden wir das auch benutzen?«
»Na klar! Wozu sollten wir es sonst mitschleppen? Allerdings werden wir es erst später brauchen.«
Die erste Phase unseres Einsatzes bestand darin, in der Beobachtungszone ein Blitzortungssystem zu installieren. Die Signale wurden über eine große Zahl verstreuter Blitzmessempfänger gesammelt und an einen Computer weitergeleitet, der automatisch eine Statistik der Zahl, Frequenz und Verteilung der Blitzeinschläge erstellte. Weil dieses System nur zählte und ortete und keine physikalischen Daten erfasste, war es für mich nicht von Interesse. Unsere Tätigkeit erschöpfte sich in diesem Stadium weitgehend darin, die Sensoren im Freien zu installieren. Es war eine Knochenarbeit. Wenn wir Glück hatten, konnten wir die Sensoren an Strom- oder Sendemasten anbringen, doch in den meisten Fällen mussten wir die nötigen Masten selbst aufstellen. Nach einigen Tagen hörten unsere Versuchshelfer gar nicht mehr auf zu jammern.
Zhao Yu war ein Mensch, der sich für nichts interessierte, am wenigsten für sein Studienfach. Bei der Arbeit schob er auf die lange Bank, so viel er nur konnte, und drückte sich, wann immer es ging. Anfangs staunte er noch über den Dschungel ringsum, doch bald, als sich der Reiz des Neuen erschöpft hatte, wirkte er nur noch lustlos. Immerhin war er ein sehr umgänglicher Mensch, und wir kamen gut miteinander zurecht.
Jeden Abend, wenn wir in die Kreisstadt zurückkehrten, zog sich Zhang Bin auf sein Zimmer zurück, um sich in die Messergebnisse des jeweiligen Tages zu vertiefen, während Zhao Yu die Gelegenheit nutzte, um sich aus unserer Unterkunft zu stehlen. Dabei schleppte er mich stets mit auf ein Bier in einer der primitiven Gassen, die zumeist nicht einmal über elektrischen Strom verfügten. Der Anblick der alten Holzhütten im flackernden Kerzenschein versetzte uns in eine Zeit zurück, in der es noch keine atmosphärische oder sonstige Physik, ja, noch überhaupt keine Wissenschaft gegeben hatte, sodass wir für eine Weile die Wirklichkeit vergaßen. Eines Abends, als wir mit vom Alkohol benebelten Köpfen bei Kerzenschein in einer kleinen Kneipe saßen, sagte Zhao Yu zu mir: »Die Leute hier im Dschungel hätten bestimmt eine perfekte Erklärung für dich, wenn sie deinen Kugelblitz gesehen hätten.«
»Ich habe sie gefragt«, antwortete ich. »Sie kennen solche Blitze schon lange und haben auch schon längst eine Erklärung dafür parat: Geisterlaternen.«
»Das reicht doch, oder?« Er breitete die Hände aus. »Ich finde das einfach perfekt. Mit deinen Theorien von irgendwelchem Plasma und irgendwelchen Soliton-Resonatoren bist du auch nicht schlauer. Je moderner, desto komplizierter – mir geht das gegen den Strich.«
Ich schnaubte verächtlich. »Einen Studenten mit deiner Arbeitseinstellung kann auch nur jemand wie Professor Zhang tolerieren.«
»Hör mir bloß auf mit dem.« Er winkte mit dem Schwung des Betrunkenen ab. »Wenn der seine Schlüssel verlieren würde, würde er sie nicht da suchen, wo er sie gerade hat klirren hören, sondern sich ein Lineal und ein Stück Kreide besorgen, den Zimmerboden in ein Gitternetz aufteilen und dann Feld für Feld absuchen …«
Wir brachen in schallendes Gelächter aus.
»Leute wie er eignen sich nur für die Art von Arbeit, die in der Zukunft ausschließlich von Maschinen erledigt wird. Kreativität und Fantasie haben für solche Leute keine Bedeutung, und in der Wissenschaft verstecken sie ihre Durchschnittlichkeit hinter ihrer sogenannten Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit. Du hast es ja selbst gesehen: An den Unis wimmelt es von diesen Typen. Andererseits finden diese Leute, die Feld um Feld absuchen, am Ende auch etwas, und deshalb kommen sie auch beruflich ganz gut über die Runden.«
»Und was hat Zhang Bin gefunden?«
»Ich glaube, er war mal für die Entwicklung einer Blitzschutzbeschichtung für Hochspannungsleitungen verantwortlich. Rein vom Blitzschutzaspekt her war diese Beschichtung ziemlich gut. Wenn man die Leitungen damit ausgestattet hätte, hätte man sich das Erdseil, das ganz oben verläuft, sparen können. Allerdings waren die Kosten ziemlich hoch, und eine Umrüstung im großen Maßstab wäre unterm Strich teurer gewesen als konventionelle Erdseile. Deshalb hatte die Erfindung am Ende doch keinen praktischen Wert und hat ihm nur ein paar Artikel und einen zweitklassigen Wissenschaftspreis aus der Provinz eingebracht. Ansonsten hat er anscheinend nichts vorzuweisen.«
Endlich trat das Projekt in das Stadium ein, dem ich so sehr entgegengefiebert hatte, und wir begannen, die physikalischen Parameter der Blitze zu erfassen. Wir installierten eine große Zahl Magnetstahlschreiber und Blitzantennen, und nach jedem Gewitter sammelten wir die Messgeräte ein, in die ein Blitz eingeschlagen hatte, um die Daten auszuwerten. Dabei mussten wir sehr behutsam vorgehen: Wir durften die Geräte keinen Erschütterungen aussetzen und mussten sie von Stromleitungen und anderen Magnetfeldquellen fernhalten, die ihren Restmagnetismus und damit ihre Messgenauigkeit hätten beeinflussen können. Dann lasen wir die Daten mit einem Feldstärkemessgerät ab – also im Wesentlichen mit einem Kompass, dessen Nadel die Magnetfeldstärke und Polarität anzeigte – und entmagnetisierten jeden Apparat mit einem entsprechenden Gerät, ehe wir sie wieder an ihre ursprünglichen Positionen zurückbrachten. Dort sollten sie den nächsten Blitz erwarten.
Auch wenn sich die konkrete Arbeit in diesem Stadium so eintönig und mühselig wie zuvor gestaltete, war ich doch mit großer Begeisterung bei der Sache – immerhin war dies das erste Mal, dass ich eigenhändig quantitative Blitzmessungen durchführte. Zhao Yu dagegen nutzte meinen Eifer, um sich noch mehr vor der Arbeit zu drücken. Wenn unser Professor nicht da war, schob er kurzerhand alle Arbeit mir zu und spazierte zum nahen Flüsschen, um zu angeln.
Die von den Magnetstahlschreibern gemessene Stromstärke lag im Durchschnitt bei ungefähr zehntausend Ampere, doch einmal erreichte sie auch einen Spitzenwert von hunderttausend Ampere, woraus sich eine Spannung von nicht weniger als einer Milliarde Volt in dem betreffenden Blitz errechnen ließ.
»Was glaubst du, was unter so extremen physikalischen Bedingungen entsteht?«, fragte ich Zhao Yu.
»Nichts Besonderes«, tat er meine Frage ab. »Bei einer Kernexplosion oder einem Hochenergiebeschleuniger wird wesentlich mehr Energie freigesetzt, und trotzdem wird dabei auch nicht das erzeugt, an das du denkst. Die atmosphärische Physik ist eine sehr profane Disziplin, aber du mystifizierst sie. Ich bin das genaue Gegenteil von dir: Ich pflege das Heilige zu etwas Gewöhnlichem zu machen.« Bei diesen Worten weidete er sich am Anblick des üppig grünen Regenwalds rings um die Wetterstation. »Bleib du ruhig auf der Jagd nach deiner mysteriösen Feuerkugel. Ich genieße lieber das gewöhnliche Leben.«
Sein Masterstudium neigte sich schon dem Ende entgegen, und er hatte nicht die Absicht, noch zu promovieren.
Nach unserer Rückkehr an die Universität nahm ich in meiner Freizeit und in den Semesterferien an einigen weiteren Projekten von Zhang Bin teil. Seine methodische Pedanterie ging mir zwar manchmal auf die Nerven, doch dafür war er im Umgang unkompliziert und verfügte über eine reiche praktische Erfahrung. Vor allem aber lag sein Fachgebiet meinem Interessenfokus am nächsten.
Aus diesen Gründen entschied ich mich nach dem Bachelorabschluss für ihn als Betreuer im Masterstudium.
Wie erwartet stieß mein Wunsch, meine Masterarbeit über Kugelblitze zu schreiben, auf seine entschiedene Ablehnung. So umgänglich er sonst war – auch gegenüber Drückebergern wie Zhao Yu –, so wenig kompromissbereit gab er sich in dieser Angelegenheit.
»Junge Leute sollten ihre Zeit nicht mit so abstrusen Dingen vertun«, erklärte er.
»Die Existenz von Kugelblitzen wird von der Wissenschaft allgemein anerkannt – daran ist doch nichts abstrus!«
»Ich bleibe dabei: Etwas, das nicht einmal in den internationalen und nationalen Blitzschutznormen Berücksichtigung findet, ist ohne Bedeutung! In Ihrem Bachelorstudium konnten Sie sich noch ein oberflächliches, aber breites Wissen aneignen, indem Sie die Methoden der Grundlagenfächer erlernt haben, aber für einen Masterstudenten ist das nicht mehr akzeptabel.«
»Aber Professor Zhang, die atmosphärische Physik ist doch im Wesentlichen schon zu einem Grundlagenfach geworden. Abgesehen von der Bedeutung, die sie für die Ingenieurswissenschaften hat, kommt ihr auch die Aufgabe zu, neue Erkenntnisse über die Welt zu gewinnen.«
»Aber bei uns in China kommt es zuallererst darauf an, sich in den Dienst des wirtschaftlichen Aufbaus zu stellen.«
»Selbst wenn das so sein sollte: Hätte man bei dem Tanklager in Qingdao bei den Blitzschutzmaßnahmen auch die Gefahr von Kugelblitzen berücksichtigt, hätte man die Katastrophe von 1989 wahrscheinlich vermeiden können.«
»Was die Brandursache von damals angeht, handelt es sich lediglich um Spekulation, und die Kugelblitzforschung selbst enthält sogar noch mehr spekulative Elemente. Von nun an müssen Sie sich in Ihrem Studium unter allen Umständen von solchen schädlichen Faktoren fernhalten.«
In dieser Angelegenheit rannte ich bei ihm einfach gegen eine Mauer an. Doch angesichts der Tatsache, dass ich mich anschickte, mein ganzes Leben meiner Mission zu widmen, fiel die Frage, womit ich mich in meinen zwei Jahren als Masterstudent beschäftigte, kaum ins Gewicht. Also fügte ich mich Zhang Bins Willen und arbeitete an einem Projekt zu einem computergestützten Blitzschutzsystem.
Zwei Jahre später endete meine Zeit als Masterstudent reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse.
Gerechterweise musste ich zugeben, dass ich von Zhang Bin viel gelernt hatte: von seiner Gewissenhaftigkeit in technischen Details, seiner experimentellen Kompetenz und seiner reichen ingenieurstechnischen Erfahrung. Das, was eigentlich im Zentrum meines Wissensdrangs stand, hatte er mir zwar nicht vermittelt, doch das hatte ich schon zwei Jahre zuvor in Kauf genommen.
Auch über sein Privatleben hatte ich in dieser Zeit wenig erfahren: Seine Frau war in jungen Jahren gestorben und hatte ihm keine Kinder hinterlassen; er führte schon seit Langem ein Junggesellendasein und pflegte kaum soziale Kontakte. Äußerlich war sein eintöniges Leben dem meinen nicht unähnlich, doch mir schien, dass eine solche Lebensweise zu ihrem Gelingen eine Mission voraussetzte, die alles andere in den Hintergrund drängte – »irgendetwas, das dich fasziniert«, um es mit den Worten meines Vaters zu sagen, ein »konkretes Ziel«, wie jene hübsche Kommilitonin es sechs Jahre zuvor in der Bibliothek formuliert hatte. Zhang Bin dagegen kannte weder Ziele noch Leidenschaften, er widmete sich mechanisch seinen langweiligen anwendungsbezogenen Projekten, die er als reine Arbeit ohne jeden Lustgewinn betrachtete. Mit genau derselben Nüchternheit stand er auch der Jagd nach Ruhm und Reichtum gegenüber. Wenn sich seine Haltung tatsächlich darin erschöpfte, musste er sein Leben als ziemlich qualvoll empfinden, und ich hatte Mitleid mit ihm.
Ich selbst fühlte mich durchaus noch nicht gewappnet, um das Mysterium des Kugelblitzes zu ergründen. Im Gegenteil, all das Wissen, das ich mir in den vergangenen sechs Jahren angeeignet hatte, hatte mir nur noch eindringlicher vor Augen geführt, wie schwächlich ich vor ihm dastand. Anfangs hatte ich meine Energie hauptsächlich auf die Physik verwandt, doch mit der Zeit dämmerte mir, dass die gesamte Physik selbst ein einziges großes Mysterium darstellte, und wer ihren Pfad bis zum Ende beschritt, dem wurde schon die bloße Existenz des Universums fraglich. Wenn man jedoch anerkannte, dass der Kugelblitz kein übernatürliches Phänomen war, sollte ein vergleichsweise elementares physikalisches Wissensniveau genügen, um ihn zu verstehen: im Bereich des Elektromagnetismus die Maxwell’schen Gleichungen und in der Strömungslehre die Navier-Stokes-Gleichungen. (Später sollte ich erkennen, wie oberflächlich und naiv dieser Gedanke war.) Doch verglichen mit Kugelblitzen nahmen sich alle bislang bekannten elektromagnetischen und hydromechanischen Strukturen simpel aus, und wenn ein Kugelblitz tatsächlich eine komplexe Struktur war, die sich im Einklang mit den fundamentalen Gesetzen von Elektromagnetismus und Hydromechanik in einem stabilen Gleichgewicht befand, musste er ein mathematisch höchst kompliziertes Phänomen sein – ähnlich dem Go, das trotz seiner einfachen Regeln und der Beschränkung auf schwarze und weiße Steine das komplexeste Spiel der Welt darstellt.
Folglich war ich überzeugt, was ich nun bräuchte, wäre erstens, zweitens und drittens: Mathematik. Ohne komplexe mathematische Instrumente würde ich das Rätsel des Kugelblitzes unmöglich lösen können. Doch solche Instrumente waren ähnlich schwer zu beherrschen wie eine Herde wilder Pferde, und auch wenn Zhang Bin fand, meine mathematischen Fähigkeiten würden die üblichen Anforderungen in der atmosphärischen Physik bereits weit übersteigen, gab ich mich doch keinen Illusionen darüber hin, wie viel mir noch fehlte, um den Kugelblitz zu erforschen. Sobald ich komplexen elektromagnetischen und fluiden Strukturen begegnete, zeigte mir die Mathematik ihre Furcht einflößende Fratze; obskure partielle Differenzialgleichungen breiteten sich vor mir aus wie ein Gewirr aus Galgenschlingen, und komplizierte Matrizes zeichneten sich so drohend vor mir ab, als wären es messergespickte Fallen.
Bevor ich mich ernsthaft meiner Mission widmen konnte, hatte ich unendlich viel zu lernen, das wusste ich. Noch war die Zeit nicht reif, um das universitäre Umfeld zu verlassen. Also entschloss ich mich zu promovieren.
Mein Doktorvater war ein renommierter Professor namens Gao Bo, der am Massachusetts Institute of Technology promoviert hatte. Er war das genaue Gegenteil von Zhang Bin. Anfangs hatte sein Spitzname meine Aufmerksamkeit erregt: Feuerball. Erst später erfuhr ich, dass dieser Beiname nichts mit Kugelblitzen zu tun hatte – wahrscheinlich rührte er von seinem quirligen Geist und seinem feurigen Temperament her. Als ich ihm vorschlug, meine Dissertation über Kugelblitze zu schreiben, war er sofort einverstanden. Nicht er, sondern ich trug Bedenken: Schließlich würde ein solches Forschungsprojekt zu seiner experimentellen Bestätigung eine große Anlage zur Simulation von Blitzen erfordern – eine Anlage, wie es sie in ganz China nur einmal gab. Und natürlich würde mir niemals das Privileg zuteilwerden, diese Anlage zu benutzen.
Doch Gao Bo sah darin kein Problem.
»Passen Sie mal auf: Alles, was Sie brauchen, sind ein Bleistift und ein Blatt Papier. Sie müssen ein mathematisches Modell eines Kugelblitzes entwickeln, das in sich widerspruchsfrei ist. Ihr Modell sollte theoretisch originell und mathematisch makellos sein, und man sollte es am Computer durchspielen können. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein theoretisches Kunstwerk erschaffen.«
Meine Bedenken ließen mir noch immer keine Ruhe. »Aber wird man meine Arbeit überhaupt annehmen, wenn ich auf jeglichen Versuch eines experimentellen Nachweises verzichte?«
Er tat meine Befürchtung mit einer Handbewegung ab. »Die schwarzen Löcher hat man doch auch akzeptiert! Sehen Sie sich doch nur mal an, wie weit die theoretische Beschäftigung damit in der Astrophysik schon gediehen ist und wie viele Wissenschaftler davon leben, obwohl der direkte Beweis ihrer Existenz bis heute aussteht! Bei Kugelblitzen weiß man wenigstens, dass sie existieren. Wenn Ihre Arbeit die Kriterien erfüllt, die ich Ihnen eben genannt habe, und trotzdem durchfällt, dann nehme ich meinen Hut, und wir beide lassen die Uni ihren Scheiß allein machen!«
Gaos Ansichten kamen mir genauso überzogen vor wie die von Zhang Bin, der für mich das andere Extrem verkörperte – ich war nicht darauf aus, ein theoretisches Kunstwerk zu erschaffen. Trotzdem war ich froh, Gaos Doktorand sein zu dürfen.
Als die Semesterferien anbrachen, entschloss ich mich, meine Heimatstadt und meine alten Nachbarn, die mir so viel geholfen hatten, zu besuchen. Denn mir schwante, dass ich in Zukunft vielleicht kaum noch die Gelegenheit dazu finden würde.
Als der Zug durch die Provinz Shandong fuhr und im Bahnhof von Tai’an hielt, pochte mein Herz auf einmal schneller beim Gedanken daran, was Zhang Bin mir erzählt hatte: Hier in der Nähe, auf dem Jadekaiser-Gipfel des Taishan, hatte ein Atmosphärenphysiker mit eigenen Augen einen Kugelblitz gesehen. Kurz entschlossen stieg ich auf halbem Weg aus, um auf den Taishan zu steigen.
Lin Yun I
Ich nahm ein Taxi zum Mittleren Himmelstor. Eigentlich wollte ich mit der Seilbahn weiter auf den Gipfel fahren, doch als ich die lange Menschenschlange sah, machte ich mich lieber zu Fuß an den Aufstieg. Der Berg war in dichten Nebel gehüllt, und zu beiden Seiten des Wegs zeichnete sich der Wald als vage Masse aus schwarzen Schemen ab, die ein kleines Stück weiter aufwärts in weißem Dunst verschwand. Am Wegrand tauchten immer wieder Steininschriften aus längst vergangenen Zeiten auf und versanken im nächsten Moment wieder im Nebel.
Seitdem ich mit Zhang Bin nach Yunnan gereist war, überkam mich jedes Mal ein Gefühl der Frustration, wenn ich mich in der freien Natur aufhielt. Beim Anblick dieser lebendigen natürlichen Welt und des Mysteriums, das sie mit ihrer für den menschlichen Geist unfassbaren Komplexität und Wandelbarkeit darstellte, konnte ich mir kaum vorstellen, dass der Mensch sie jemals mit den dünnen Fäden einiger Gleichungen würde einfangen können. Mir kam dann immer ein Satz des alten Einstein in den Sinn: »Jedes Blatt vor dem Fenster lässt die menschliche Wissenschaft kindisch und kraftlos erscheinen.«
Doch meine Mutlosigkeit wich bald einer wachsenden körperlichen Erschöpfung, denn vor mir dehnte sich die steinerne Treppe immer weiter in den Nebel, und das Südliche Himmelstor schien jenseits der Troposphäre zu liegen.
In diesem Moment sah ich sie zum ersten Mal. Sie erregte meine Aufmerksamkeit, weil sie sich so von den anderen Touristen ringsum abhob. Sonst begegnete ich lauter Pärchen, und stets hockte die Frau erschöpft auf einer Stufe, während der Mann keuchend danebenstand und sie zum Weitergehen zu überreden versuchte. Und immer, wenn ich jemanden überholte oder gelegentlich von jemandem überholt wurde, hörte ich sein heftiges Schnaufen. Ich versuchte angestrengt, mit einem Lastenträger Schritt zu halten, denn aus dem Anblick seines breiten bronzefarbenen Rückens schöpfte ich die Kraft zum Weitersteigen. Da huschte eine weiße Gestalt an uns beiden vorbei, eine junge Frau, die in ihrer weißen Bluse und der weißen Jeans wie verdichteter Nebel wirkte. Inmitten des zähflüssig voranrinnenden Menschenstroms nahm sich ihr anmutig federnder Schritt geradezu schwerelos aus, und ich hörte nicht das leiseste Keuchen von ihr, während sie an mir vorüberglitt.
Einen Moment später blickte sie sich noch einmal um, aber nicht zu mir, sondern zu dem Lastenträger, und ihr Gesichtsausdruck war ruhig und verriet nicht die geringste Erschöpfung. Mit ihrer zierlichen Figur schien sie den für uns andere strapaziösen Bergpfad so mühelos emporzuschweben, als spazierte sie eine Allee entlang, und eine kurze Weile später war sie schon im Nebel verschwunden.
Als ich endlich das Südliche Himmelstor erreichte, war das Wolkenmeer, aus dem der Gipfel emporragte, schon in das Rot der untergehenden Sonne getaucht.
Mit schweren Schritten schleppte ich mich zur Wetterwarte auf dem Jadekaiser-Gipfel. Als die Mitarbeiter dort erfuhren, wer ich war und was ich bei ihnen suchte, schienen sie nichts Besonderes daran zu finden. Offensichtlich kamen ständig Meteorologen zu dieser berühmten Station, um die unterschiedlichsten Beobachtungen anzustellen. Der Stationsleiter, so teilte man mir mit, habe etwas im Tal zu erledigen, weshalb man mir seinen Stellvertreter vorstellte. Als wir einander sahen, entfuhr uns beiden ein Ausruf freudigen Erstaunens: Der stellvertretende Leiter war Zhao Yu.
Seit unserer Reise nach Yunnan waren über drei Jahre vergangen. Auf meine Frage, was ihn an diesen wunderlichen Ort verschlagen hatte, antwortete er: »Ich habe ein bisschen Ruhe gesucht. Die Welt da unten geht mir verdammt auf die Nerven!«
»Dann wärst du besser Mönch hier im Dai-Tempel geworden.«
»Dort ist es mit der Ruhe inzwischen auch vorbei. Und du? Immer noch auf der Jagd nach deinem Phantom?«
Ich erzählte ihm, was mich hierher geführt hatte.
»1962?« Er schüttelte den Kopf. »Das ist viel zu lange her. Seitdem sind hier Generationen von Leuten gewesen! Wahrscheinlich weiß niemand mehr von dieser Sache.«