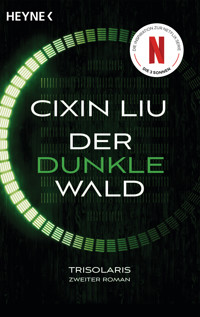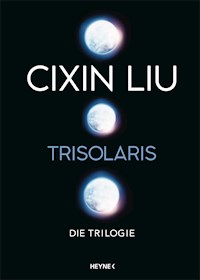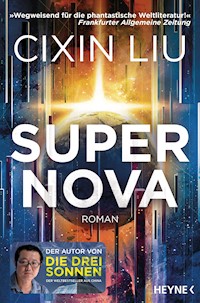
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der letzte Tag der Menschheit ist angebrochen. Eine gewaltige Strahlenwolke, ausgelöst durch eine Sternexplosion acht Jahre zuvor, wird schon bald alle Menschen über dreizehn Jahren töten. Seit acht Jahren läuft der Countdown, und seitdem werden die Kinder und Jugendlichen der Welt auf eine Zukunft allein vorbereitet. Einige von ihnen jedoch wollen gar nicht so weitermachen wie zuvor. Sie träumen von einer neuen, einer besseren Zukunft für sich und ihren Planeten. Dies ist ihre Geschichte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Der letzte Tag der Menschheit ist angebrochen. Eine gewaltige Strahlenwolke, ausgelöst durch eine Sternexplosion acht Jahre zuvor, wird schon bald alle Menschen über dreizehn Jahren töten. Seit acht Jahren läuft der Countdown, und seitdem werden die Kinder und Jugendlichen der Welt auf eine Zukunft allein vorbereitet. Einige von ihnen jedoch wollen gar nicht so weitermachen wie zuvor. Sie träumen von einer neuen, einer besseren Zukunft für sich und ihren Planeten. Dies ist ihre Geschichte …
Der internationale Bestsellerautor Cixin Liu im Heyne Verlag:
Romane: Die drei Sonnen · Der dunkle Wald · Jenseits der Zeit · Kugelblitz · Supernova
Erzählungen: Die wandernde Erde · Spiegel · Weltenzerstörer
Der Autor
Cixin Liu ist einer der erfolgreichsten chinesischen Science-Fiction-Autoren. Er hat lange Zeit als Ingenieur in einem Kraftwerk gearbeitet, bevor er sich ganz seiner Schriftstellerkarriere widmen konnte. Seine Romane und Erzählungen wurden bereits viele Male mit dem Galaxy Award prämiert. Cixin Lius Roman »Die drei Sonnen« wurde 2015 als erster chinesischer Roman überhaupt mit dem Hugo Award ausgezeichnet und wird international als ein Meilenstein der Science-Fiction gefeiert.
Mehr zu Cixin Liu und chinesischer Science-Fiction auf: diezukunft.de
Besuchen Sie uns auf:
CIXIN LIU
SUPERNOVA
Roman
Aus dem Chinesischen
von Karin Betz
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Original ist unter dem Titel (Chaoxinxing Jiyuan) bei Chongqing Publishing & Media Co., Ltd., erschienen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Übersetzerin dankt der VG Wort und dem Programm Neustart Kultur des BKM für die Förderung durch ein Stipendium.
Deutsche Erstausgabe 12/2021
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2003 by Cixin Liu ()
German rights authorized by FT Culture Co., Ltd., Beijing
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung
by Wilhelm Heyne Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 23, 81673 München
Umschlagillustration: Stephan Martinière
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-24533-7V002
diezukunft.de
Inhalt
Prolog
1Der tote Stern
2Die Auswahl
3Das Große Lernen
4Die Übergabe der Welt
5Der Beginn eines neuen Zeitalters
6Die Zeit des Überdrusses
7Bonbonstadt
8Nordamerikas Zeit der Bonbonstadt
9Der Supernova-Krieg
10Genesis
Epilog
Erläuterungen zu Schreibweise und Aussprache
Chinesische Science-Fiction bei Heyne
Für meine Tochter Liu Jing
Möge sie in einer glücklichen Welt leben
Prolog
Als es geschah, war die Erde ein Planet im Universum.
Als es geschah, war Peking eine Stadt auf der Erde.
Inmitten des Lichtermeers dieser Stadt lag eine Schule, und in einem ihrer Klassenzimmer fand gerade die Abschlussfeier für die sechste Jahrgangsstufe statt. Wie bei solchen Anlässen üblich, redeten die Kinder über ihre Hoffnungen und Sehnsüchte für die Zukunft.
»Ich will General werden!«, sagte Lü Gang, ein schmächtiger Junge, der jedoch einen für sein Alter ungewöhnlichen Machtinstinkt an den Tag legte.
»Wie langweilig!«, kommentierte ein anderer Junge. »Es gibt doch gar keine Kriege, und Generäle machen nichts außer Truppenübungen.«
»Ich will Ärztin werden«, sagte ein Mädchen namens Lin Sha leise und wurde sofort dafür verlacht.
»Ausgerechnet du! Neulich auf dem Land hast du dir schon beim Anblick von Raupenkokons in die Hose gemacht. Und du willst jemanden mit dem Skalpell aufschneiden können?«
»Meine Mutter ist Ärztin«, gab sie zaghaft zurück.
Zheng Chen, die junge Klassenlehrerin, die gedankenverloren zum Fenster hinaus auf die Lichter der Stadt gestarrt hatte, richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Klasse.
»Und du, Xiaomeng? Was willst du werden, wenn du groß bist?«, fragte sie das sehr einfach gekleidete Mädchen, das genau wie sie aus dem Fenster gestarrt hatte. In den großen, lebhaften Augen des Mädchens lag eine für ihr Alter ungewöhnliche Melancholie.
»Wir haben zu Hause wenig Geld, daher werde ich wohl nur auf die Berufsschule gehen«, sagte sie seufzend.
»Und du, Huahua?«
Die Frage richtete sich an einen hübschen, aufgeweckten Jungen, in dessen großen Augen ein strahlendes Dauerstaunen lag, als wäre die Welt für ihn ein einziges farbenprächtiges Feuerwerk.
»Die Zukunft ist so aufregend, dass ich mich gar nicht entscheiden kann. Aber egal, was ich werde, ich will der Beste sein!«
Die anderen wollten Spitzensportler werden oder Diplomaten. Als ein Mädchen sagte, sie wolle Lehrerin werden, verstummte das Gespräch.
»Das ist keine leichte Aufgabe«, sagte die Klassenlehrerin schließlich leise und starrte wieder zum Fenster hinaus.
»Habt ihr gewusst, dass Frau Zheng schwanger ist?«, flüsterte ein Mädchen.
»Ich weiß. Und gerade dann, wenn das Baby kommen soll, will die Schule Stellen streichen. Es sieht gar nicht gut aus für sie«, flüsterte ein Junge zurück.
Zheng Chen hörte natürlich jedes Wort. »Darüber mache ich mir jetzt wirklich keine Gedanken«, lachte sie. »Ich denke darüber nach, in welcher Welt wir leben werden, wenn mein Kind in eurem Alter sein wird.«
»Warum denn das?«, fragte ein magerer Junge. Sein Name war Yan Jing, aber weil er wegen seiner Kurzsichtigkeit eine Brille mit sehr dicken Gläsern trug, nannten ihn alle nur »Brille«. »Wer weiß schon, was die Zukunft bringt? Vorhersagen lässt sich sowieso nichts.«
»Mithilfe der Wissenschaft lässt sich vieles vorhersagen«, widersprach Huahua. »Außerdem gibt es Futurologen.«
Brille schüttelte den Kopf. »Gerade die Wissenschaft sagt uns, dass sich die Zukunft nicht voraussagen lässt. Was die Futurologen erzählen, sind vage Vermutungen, denn die Welt ist nun einmal ein chaotisches System.«
»Das hast du, glaube ich, schon einmal behauptet. Irgendwo schlägt ein Schmetterling mit den Flügeln, und anderswo kommt deshalb ein Sturm auf.«
»Ganz genau«, nickte Brille. »Ein chaotisches dynamisches System.«
»Ich wäre gern dieser Schmetterling«, sagte Huahua.
Brille schüttelte den Kopf. »Du hast nichts verstanden. Jeder von uns ist ein Schmetterling, jedes Sandkorn und jeder Regentropfen sind ein Schmetterling, und genau deshalb lässt sich die Welt nicht vorhersehen.«
»Du hast einmal etwas von einer Unschärferelation erzählt …«
»Genau. Das Verhalten von Elementarteilchen lässt sich nicht vorausberechnen, und deshalb gilt das für die ganze Welt. Und dann gibt es noch die Hypothese von multiplen Welten. Wenn du eine Münze wirfst, teilt sich die Welt in zwei, und in der einen Welt ist der Kopf oben, in der anderen die Zahl …«
Zheng Chen lachte. »Du bist selbst der beste Beweis dafür. Als ich so alt war wie du, hätte ich nie geglaubt, dass ein Schüler der sechsten Klasse eines Tages so viel wissen könnte.«
»Brille hat eine Menge Bücher gelesen!«, tönte es aus den Reihen der Schüler.
»Ihr Kind wird bestimmt ganz außergewöhnlich, Frau Zheng«, sagte Huahua. »Wer weiß, ob ihm nicht eines Tages die Gentechnik Flügel wachsen lassen kann!«
Alle lachten.
»Kommt!« Die Klassenlehrerin stand auf. »Werft einen letzten Blick auf das Schulgelände.«
Sie folgten ihrer Lehrerin hinaus auf den Hof. Alle Gebäude ringsum lagen fast vollständig im Dunkeln, und die fernen Lichter der Stadt verliehen dem Campus eine dämmrige Stille. Sie gingen an zwei weiteren Unterrichtsgebäuden vorbei, an der Verwaltung, der Bibliothek. Hinter der langen Reihe aus Sonnenschirmbäumen lag der Sportplatz. In der Mitte des Platzes scharten sich fünfundvierzig Schülerinnen und Schüler um ihre Lehrerin. Zheng Chen reckte die Arme zum Himmel, wo die Sterne wegen der Großstadtlichter nur schwach erkennbar waren. »Auf das Ende eurer Kindheit!«, rief sie.
Peking war eine Stadt auf der Erde.
Die Erde war ein Planet im Universum.
Eine scheinbar unbedeutende Geschichte: Fünfundvierzig Kinder schließen den ersten Teil ihrer Schulausbildung ab und setzen ihren Lebensweg fort.
Eine ganz gewöhnliche Nacht: eine Momentaufnahme im kontinuierlichen Fluss der Zeit von der grenzenlosen Vergangenheit in die grenzenlose Zukunft. »Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen«, philosophierte zwar einst ein alter Grieche, aber der Fluss der Zeit ist immer derselbe, er fließt im immer gleichen Rhythmus, endlos und ewig wie das Leben und die Geschichte.
So dachten die Menschen in dieser Stadt. So dachten die Menschen in Nordchina, die Menschen ganz Asiens und sämtliche kohlenstoffbasierten Lebewesen namens Menschen auf dem Planeten Erde. Das ewige tröstliche Schaukeln des Flusses der Zeit wiegte sie in diesem Teil der Welt in einen sanften Schlaf; sie waren überzeugt, dass diese heilige Ewigkeit von nichts und niemandem je zerstört werden konnte und sie bei Sonnenaufgang ein Morgen erwartete wie an unzähligen Tagen zuvor. Dieses tief im Bewusstsein eines jeden von ihnen schlummernde Vertrauen gönnte ihnen auch in dieser Nacht die gleichen Träume, die schon unzählige Generationen vor ihnen gewebt hatten.
Es war eine ganz gewöhnliche Schule in einem stillen Winkel der Stadt in einer sternfunkelnden Nacht.
Fünfundvierzig Dreizehnjährige und ihre junge Klassenlehrerin sahen zum Sternenhimmel auf. Stier, Orion und der Große Hund, die Sternbilder des Winters, versanken bereits am westlichen Horizont. Lyra, Herkules und Waage, die Sternbilder des Sommers, waren schon lange erkennbar. Jeder Stern ein fernes Auge, das der menschlichen Welt aus den Tiefen des Universums zublinzelte. Doch in dieser Nacht war der Blick aus dem Universum anders als sonst.
Diese Nacht war der Anfang vom Ende der Geschichte, wie der Mensch sie kannte.
1
Der tote Stern
Ende
Innerhalb eines Radius von zehn Lichtjahren von der Erde hatte die Astronomie im Weltraum elf Sterne entdeckt, nämlich Proxima Centauri, Alpha Centauri A und Alpha Centauri B, die zusammen ein Dreigestirn bildeten, das durch die gegenseitige Anziehungskraft umeinander kreiste; die beiden Doppelsterne Sirius A und Sirius B und Luyten 726-8 A und Luyten 726-8 B, und vier Einzelsterne, nämlich Barnards Pfeilstern, Wolf 359, Lalande 21185 und Ross 154. Die Astrophysik schloss nicht aus, dass weitere Sterne, entweder extrem schwach leuchtende oder von interstellarem Staub verborgene, noch auf ihre Entdeckung warteten.
In dieser Gegend des Weltraums hatten Astronomen eine starke Ansammlung von kosmischem Staub bemerkt, wie eine schwarze Wolke, die über das nächtliche Meer des Universums zog. Als sie die auf einem Satelliten installierten UV-Teleskope auf die weit entfernte Wolke richteten, stellten sie ein Absorptionsmaximum von 216 Nanometern fest, was die Vermutung nahelegte, dass die kosmische Staubwolke aus Kohlenstoff-Mikropartikeln bestand. Ihr Reflexionsgrad legte nahe, dass die Kohlenstoffpartikel mit einer dünnen Eisschicht überzogen waren. Die Partikel waren zwischen zwei und zweihundert Nanometer groß, was ungefähr der Wellenlänge des sichtbaren Lichts entsprach und den Staub undurchsichtig machte.
Diese Wolke verbarg einen acht Lichtjahre von der Erde entfernten Stern, dreiundzwanzigmal so groß wie die Sonne und mit dem Siebenundsechzigfachen ihrer Masse. Er hatte bereits die Hauptreihe verlassen und war soeben in die Endphase seiner langen Evolution eingetreten. Wir nennen ihn den Sterbenden Stern.
Selbst wenn der Sterbende Stern ein Erinnerungsvermögen besessen hätte – an seine Kindheit hätte er sich nicht mehr erinnert, denn seine Geburt lag fünfhundert Millionen Jahre zurück. Seine Mutter war ein anderer Sternennebel. Teilchenstrahlung aus dem Zentrum der Galaxis störte die Ruhe des Nebels, und sämtliche Teilchen ballten sich aufgrund der Schwerkraft in einem Zentrum. Dieser stattliche Sandsturm dauerte zwei Millionen Jahre. Irgendwann fusionierten in seinem Zentrum Wasserstoffatome zu Helium. Der Sterbende Stern wurde als atomarer Hochofen geboren.
Nach einer dramatischen Kindheit und einer turbulenten Jugend hielt der durch die permanente Kernfusion in seinem Inneren entstehende Strahlungsdruck seine äußeren Schichten stabil. Damit trat der Sterbende Stern in seine lange mittlere Lebensphase ein, eine Entwicklungsphase, die im Vergleich zu den Stunden, Minuten und Sekunden seiner Kindheit in hundert Millionen Jahren berechnet werden muss und dem endlosen Sternenmeer der Galaxis einen weiteren ruhigen Leuchtpunkt bescherte. Eine Ruhe, die sich bei einer Annäherung an seine Oberfläche im Flug schnell als trügerisch erweisen würde. Der Stern war ein atomares Flammenmeer, auf dem donnernd gigantische, rot glühende Wellen tobten, deren Gischt hochenergetische Partikel wie einen Platzregen in den Weltraum schleuderten. Aus den Tiefen des Sterns wurde immense Energie freigesetzt, die sich in gleißenden Wellen entlud, über denen andauernde nukleare Wirbelstürme wüteten. Tiefrotes Plasma, verzerrt von einem starken Magnetfeld, schoss in Millionen Kilometern langen Protuberanzen in den Weltraum hinaus wie eine wogende rote Algenkolonie … die Größe des Sterbenden Sterns war für das menschliche Gehirn unermesslich. Im Verhältnis zur Größe dieses Feuermeers im Weltraum war die Erde wie ein Basketball im Pazifik.
Im Grunde hätte der Sterbende Stern mit seiner scheinbaren Helligkeit von –7,5 deutlich am von der Erde sichtbaren Nachthimmel leuchten müssen, wäre da nicht der kosmische Staub gewesen, der drei Lichtjahre entfernt vor ihm einen anderen Stern ausbrütete und das Licht des Sterbenden Sterns auf seinem Weg zur Erde blockierte. Sonst hätte er die Geschichte der Menschheit mit der fünffachen Leuchtkraft von Sirius, dem hellsten Stern an unserem Himmel, erleuchtet – hell genug, um in einer mondlosen Nacht Schatten zu werfen, und sein träumerisch blaues Sternenlicht hätte die Welt ein wenig romantischer gemacht.
Der Sterbende Stern brannte vierhundertachtzig Millionen Jahre lang, aber trotz seines glorreichen Lebens zwang ihn der kalte und grausame Energieerhaltungssatz zu einigen unvermeidlichen Veränderungen in seinem Inneren: Das Fusionsfeuer verbrauchte Wasserstoff, und mehr und mehr des dabei entstehenden Heliums sedierte im Zentrum des Sterns. Dieser Prozess ging für einen Sterbenden Stern dieser Größenordnung außerordentlich langsam vonstatten. Die gesamte Geschichte der Menschheit war für ihn nur ein Fingerschnippen. Doch vierhundertachtzig Millionen Jahre später zeitigte der Wasserstoffverbrauch ein spürbares Ergebnis – es hatte sich so viel chemisch träges Helium angehäuft, dass seine Energiequelle versiegte. Der Sterbende Stern war alt geworden.
Es waren jedoch andere, komplexere Gesetze der Physik, die dafür sorgten, dass der Sterbende Stern sein Leben auf spektakuläre Weise aushauchen sollte. Die Dichte des Heliums in seinem Innern nahm zu, und die fortgesetzte Kernfusion des umgebenden Wasserstoffs produzierte Temperaturen, die hoch genug waren, um das Helium im Innern zu entzünden und eine Fusionsreaktion auszulösen, die es schlagartig in einem atomaren Inferno auslöschte, das den Sterbenden Stern mit einem ungeheuer starken Licht erstrahlen ließ. Da die durch Heliumfusion entstehende Kernenergie nur ein Zehntel der durch Wasserstoff entstehenden ausmachte, schwächte diese Anstrengung den Stern nur noch mehr – Heliumblitz nennen Astrophysiker dieses Phänomen. Drei Jahre später erreichte sein Licht die kosmische Staubwolke, in der das rote Licht mit seiner relativ langen Wellenlänge erfolgreich die kosmische Barriere durchdrang. Nach einer Reise von fünf weiteren Jahren traf das rote Licht auf einen wesentlich kleineren, überaus gewöhnlichen Stern, die Sonne, und eine Handvoll kosmischen Staubs im Bann ihrer Gravitation, den die Menschheit Pluto, Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur und natürlich Erde nennt. Es war das Jahr 1775.
An jenem Abend starrte auf der Nordhalbkugel der Erde – genauer gesagt, in der englischen Kurstadt Bath, vor der Konzerthalle eines noblen Vergnügungsparks – der in Deutschland geborene Organist Friedrich Wilhelm Herschel durch sein selbst gebautes Teleskop begierig in den Sternenhimmel. Er war so fasziniert von der Pracht der Milchstraße, dass er sein ganzes Leben Teleskopen widmete. Hätte seine Schwester Caroline ihn nicht, während er vor der Linse hockte, löffelweise gefüttert, wäre er wohl darüber verhungert. Während dieser bemerkenswerte Astronom des achtzehnten Jahrhunderts sein Leben vor dem Teleskop verbrachte und dabei fast siebzigtausend Himmelskörper auf der Sternenkarte vermerkte, entging ihm in dieser Nacht allerdings dieser eine, für die Menschheit ausgesprochen bedeutungsvolle Stern. In jener Nacht tauchte im Sternbild Auriga am westlichen Himmel, genau zwischen Capella und Beta Aurigae, ein roter Stern auf. Mit einer Magnitude von 4,5 war er zwar für einen gewöhnlichen Betrachter nur schwer zu entdecken, selbst wenn man seine genaue Position kannte. Für einen Astronom jedoch leuchtete er wie eine gewaltige Lampe, die Herschel vermutlich nicht entgangen wäre, hätte er das Firmament wie die frühen Astronomen prä-galileiischer Zeiten mit bloßem Auge betrachtet, statt es an seine Linse zu pressen. Und diese Entdeckung hätte möglicherweise den Lauf der Menschheitsgeschichte zwei Jahrhunderte später verändert. Aber seine ganze Aufmerksamkeit galt dem gerade einmal zwei Fuß messenden, in eine völlig andere Richtung zeigenden Teleskop. Bedauerlicherweise wiesen auch die Teleskope der Observatorien in Greenwich, auf der Insel Hven und überhaupt der ganzen Welt gerade in eine ganz andere Richtung …
Das rote Licht im Sternbild Auriga schien die ganze Nacht lang, doch in der darauffolgenden war es erloschen.
In derselben Nacht desselben Jahrs drangen auf dem Nordamerika genannten Kontinent achthundert britische Soldaten auf leisen Sohlen in Bostons Westen vor. In ihren roten Uniformen wirkten sie wie eine Reihe nächtlicher Geister. Im kühlen Wind der Frühlingsnacht hielten sie ihre Mausergewehre gepackt und hofften, vor Tagesanbruch die siebenundzwanzig Kilometer von Boston entfernte Stadt Concord zu erreichen, wo sie im Auftrag von Thomas Gage, dem Gouverneur von Massachusetts, das Waffenarsenal der sogenannten Minutemen zerstören und ihre Anführer verhaften sollten. Doch als sich im Morgengrauen die Umrisse von Wäldern, Hütten und Weidezäunen abzuzeichnen begannen, stellten die Männer erstaunt fest, dass sie nicht weiter als bis zu der Kleinstadt Lexington gelangt waren. Plötzlich sprühten aus dem Dickicht vor ihnen Funken, und ohrenbetäubende Gewehrsalven erschütterten die Stille des nordamerikanischen Sonnenaufgangs, gefolgt von durch die Luft zischenden Kugeln. Es war das erste Zucken der Vereinigten Staaten von Amerika im Bauch ihrer Mutter.
Auf dem ausgedehnten Kontinent auf der gegenüberliegenden Seite des Pazifischen Ozeans jedoch hatte eine andere Kulturnation bereits fünf Jahrtausende überdauert. Zahllose Menschen waren auf diesem uralten Territorium soeben auf dem Weg in die Hauptstadt des alten Kaiserreichs, beladen mit klassischen Schriften, die sie aus allen Ecken des Landes zusammengetragen hatten. Zwei Jahre zuvor war auf kaiserlichen Befehl hin die Enzyklopädie Siku Quanshu,Gesammelte Schriften der vier Schatzkammern, begonnen worden, und immer noch flossen aus allen Himmelsrichtungen kontinuierliche Ströme von Büchern in der Hauptstadt zusammen. Kaiser Qianlong persönlich inspizierte in einer riesigen hölzernen Halle in der Verbotenen Stadt die Reihen der in den vergangenen beiden Jahren gesammelten Bücherkisten mit den kanonischen Werken für die Enzyklopädie. Sie waren bereits in vier große Kategorien aufgeteilt: Klassiker, Geschichtswerke, Philosophen und Sammlungen.
Ohne seine Diener, allein in Begleitung dreier mit Pfauenfedern geschmückter Großsekretäre, betrat der Kaiser andächtig das riesige Lagerhaus. Dai Zhen, Yao Nai und Ji Yun leuchteten ihm mit Laternen den Weg. Diese drei waren die wahren Editoren der Enzyklopädie, und nicht die kaiserlichen Vettern, die offiziell in ihrem Impressum als solche genannt wurden. Die vier Männer gingen gemessenen Schritts an den hohen Kisten vorüber, die im fahlen Schein der Laternen in die Höhe ragten wie die Türme schwarzer Stadtmauern. Sie kamen zu einem Haufen sehr alter, beschriebener Bambusstreifen. Ehrfürchtig nahm Qianlong ein Bündel in die zitternde Hand. Das flackernde gelbe Licht der Laternen warf winzige Leuchtpunkte auf die Bambusstreifen, die ihn anstarrten wie die Pupillen der Vergangenheit. Vorsichtig legte er die Bambusstreifen wieder hin, hob den Kopf und blickte sich um. Er wähnte sich in der Schlucht eines abgelegenen Büchergebirges, einer Schlucht im Gebirge der Zeit, und zwischen den Bücherklippen flatterten leise die Geister aus den zahllosen Schriften der letzten fünftausend Jahre umher. »Man soll die Geister der Vergangenheit ruhen lassen, Euer Majestät«, flüsterte einer der Editoren.
Unvorstellbar weit draußen im Weltraum setzte der Sterbende Stern seinen Weg zum Jüngsten Tag fort. Immer wieder traten Heliumblitze auf, aber von geringerem Ausmaß als der erste. Aus dem durch Heliumfusion erzeugten Kohlenstoff und Sauerstoff entstand ein neuer Kern, der sich sofort entzündete und Neon, Schwefel und Silizium produzierte. Dabei tauchte eine riesige Menge Neutrinos im Inneren des Sterns auf, geisterhafte Partikel, die unablässig die Energie des Kerns verbrauchten, ohne mit einer anderen Substanz zu interagieren, und allmählich konnte der Kern des Sterbenden Sterns seine äußere Schicht nicht mehr stützen und die Schwerkraft, die dem Stern zu seiner Existenz verholfen hatte, bewirkte jetzt das genaue Gegenteil. Durch den Druck der Gravitation schrumpfte der Sterbende Stern zu einer kompakten kleinen Kugel, der unglaubliche Druck zertrümmerte die Kerne seiner Elementarteilchen, Neutronen drängten sich dicht aneinander. Ein Teelöffel des Sterbenden Sterns entsprach jetzt einer Masse von Millionen Tonnen. Zuerst brach der Kern in sich zusammen, dann kollabierte die von nichts mehr gehaltene äußere Schicht in den dichten Kern und löste unmittelbar eine erneute Kernfusion aus.
Ein blendend weißer Blitz spaltete das Universum, der Sterbende Stern zerbarst in Hunderte Millionen Fragmente und eine gigantische Menge Staub. Damit kam ein fünfhundert Millionen Jahre umspannendes Epos von Gravitation und Sonnenfeuer an sein Ende. Die enorme Energie des Sterbenden Sterns entlud sich in einer Sturzflut aus elektromagnetischer und hochenergetischer Partikelstrahlung in alle Richtungen. Drei Jahre nach der Explosion durchstieß der Tsunami seiner Energie mühelos jene kosmische Staubwolke, die auf dem Weg zur Sonne lag.
Zum Zeitpunkt der Explosion des Sterbenden Sterns erlebte die acht Lichtjahre entfernte Menschheit gerade eine Zeit großen Wohlstands. Obwohl sie wusste, dass ihr Planet nicht mehr als ein Staubkorn im Universum war, hatte sie diese Tatsache längst noch nicht mental akzeptiert. Im eben vergangenen Jahrtausend hatte sie gelernt, die enorme Kraft der Kernspaltung und der Kernfusion nutzbar zu machen und mittels auf Siliziumchips gebannter, elektrischer Impulse komplexe Denkapparate herzustellen, und glaubte sich in der Lage, den Weltraum zu erobern. Niemand ahnte, dass die Strahlung des Sterbenden Sterns mit Lichtgeschwindigkeit auf dem Weg zu ihrem blauen Planeten war.
Nachdem es die vier Sterne des Zentaur passiert hatte, verbrachte das Licht des Sterbenden Sterns vier weitere Jahre im weiten, einsamen Weltraum, bis es den Rand des Sonnensystems erreichte. In dieser Gegend, in der sich nichts außer schweiflosen Kometen tummelte, traf die Energie des Sterbenden Sterns zum ersten Mal auf einen Boten der Menschheit. Über eine Milliarde Kilometer von der Erde entfernt zog ein menschengemachtes Objekt einsam durch den Raum in Richtung Milchstraße: die Voyager, eine interstellare Raumsonde, die in den Siebzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts von der Erde aus gestartet war. Mit ihrer zur Erde hin geöffneten Parabolantenne sah sie aus wie ein eigenartiger Regenschirm. Die Sonde trug die Visitenkarte der Menschheit bei sich, eine vergoldete Kupferplatte, auf der zwei nackte Menschen eingraviert waren, eine Schallplatte mit einer Audiobotschaft des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, die an außerirdische Zivilisationen gerichtet war, sowie Aufnahmen vom Klang der Meere, von Vogelstimmen und, unter vielen anderen Musikstücken, auch die traditionelle chinesische Melodie Liushui.
Als dieser Bote auf das Licht des Sterbenden Sterns traf, wurde er im Nu zu einem Stück glühendem Metall. Zum ersten Mal bekam die Erde damit die Grausamkeit des Weltalls zu spüren. Durch den plötzlichen Temperaturanstieg vom absoluten Nullpunkt verzog sich die Parabolantenne, und die Heftigkeit der Hochenergiestrahlung überforderte den Geigerzähler, der nur noch Nullen ausgab. Bevor die integrierten Schaltkreise von der radioaktiven Strahlung zerstört wurden, blieben die UV-Sonde und die Magnetfeldinstrumente noch ganze zwei Sekunden lang funktionstüchtig, in denen Voyager eine Reihe von unglaublichen Daten an ihre Schöpfer auf der Erde sendete, die allerdings wegen des Schadens, den ihre Antenne genommen hatte, die hochempfindlichen Antennenreihen in Nevada und Australien niemals erreichen sollten. Doch das machte nichts mehr, denn schon kurz darauf sollte die Menschheit das Unglaubliche am eigenen Leib erfahren und ermessen können.
Das starke Licht des Sterbenden Sterns drang in das Sonnensystem vor, brachte Plutos kristallene blaue Oberfläche aus festem Stickstoff zum Dampfen und traf bald auf Neptun und Uranus. Es ließ ihre Ringe durchsichtig glänzen. In dem Augenblick, als die Abschlussfeier der Schüler begann, streifte der Sturm aus Hochenergiepartikeln Saturn und Jupiter, wobei er ihre flüssigen Oberflächen phosphoreszierte. Es dauerte eine weitere halbe Stunde, bis die Energie den Mond erreichte, ihr blendendes Licht auf das Mare Imbrium und den Kopernikuskrater warf und die Fußspuren erhellte, die Neil Armstrong und Buzz Aldrin vier Jahrzehnte zuvor dort hinterlassen hatten – unter den Augen von mehreren Hundert Millionen Fernsehzuschauern auf dem nahen blauen Planeten, die in diesem aufregenden Moment überzeugt gewesen waren, dass das ganze Universum nur ihretwegen existierte.
Eine Sekunde später hatte der Sterbende Stern seine achtjährige Reise durch den Weltraum zur Erde vollendet.
Die Mitternachtssonne
Es ist schon Mittag!
Das war der erste Gedanke der Schüler, als sie ihre Sehkraft wiedererlangten. Das grelle Licht, das sie vorübergehend geblendet hatte, war so plötzlich gekommen, als hätte es jemand mit einem kosmischen Schalter angeknipst.
Es war genau zwanzig Uhr achtzehn, aber die Jugendlichen standen im hellen Mittagslicht. Sie sahen zum azurblauen Himmel hinauf und schnappten nach Luft. Sie fröstelten. Das war weder der Himmel noch das Blau, das sie kannten. Es war ein erschreckendes Schwarzblau, wie auf einem überbelichteten Film. Und es erschien ungewöhnlich sauber, als hätte der Himmel ein Gesichtspeeling hinter sich, bei dem alles Gräulich-Weiße von seinem reinen, rohen blauen Fleisch heruntergeschält worden war, das jeden Augenblick zu bluten anfangen konnte. Die Stadt erstrahlte unter diesem Licht, doch das Licht dieser Sonne ließ die Schüler aufschreien.
Das ist nicht unsere Sonne!
Das Licht, das durch den nächtlichen Himmel zu ihnen drang, war zu grell, um direkt hineinzusehen, doch durch die Fingerritzen ihrer Hände, die sie schützend vor die Augen hielten, erspähten sie eine Sonne, die nicht rund war. Es war ein formloser Fleck wie irgendein Stern am Sternenhimmel, nur viel größer. Von einem fernen Punkt im Universum strahlte sein intensives weißes Licht mit einer scheinbaren Helligkeit von –51,23, fast eine Größenordnung stärker als die Sonne, streute sich in der Atmosphäre und machte den Stern zu einer riesigen, blendenden Spinne am westlichen Himmel.
Der Sterbende Stern tauchte sehr plötzlich auf und erreichte binnen Sekunden höchste Leuchtkraft. Zuerst sahen ihn die Menschen auf der östlichen Hemisphäre der Erde, wo er sofort eine nie da gewesene Panik auslöste, die sich über die ganze Welt ausbreitete. Die Welt stand still, niemand war mehr zu vernünftigem Denken und Handeln fähig. Am Atlantik, an den Westküsten Europas und Afrikas, war das Phänomen am gewaltigsten. Hier ein Augenzeugenbericht von einem Beobachter im Atlantik:
Bei Tagesanbruch entdeckten wir etwas Ungewöhnliches: Nachdem die Sonne über dem Meer aufgegangen war, ergoss sich fortgesetzt Licht über den östlichen Meereshorizont, gleißendes Licht von einer unbekannten Quelle unterhalb der Wasseroberfläche, als ob dort eine riesige Lampe verborgen läge. Das Licht wurde stärker. Der seltsame Anblick beunruhigte die ganze Mannschaft. Aus den Funkgeräten und dem Radio kam nur Rauschen. Der zweite Sonnenaufgang wurde heller und heller, auch die rosa Morgenwolken am Horizont leuchteten in einem blendenden Licht, wie Glühfäden …
Unsere Angst nahm mit der Intensität des Lichts zu. Wir wussten, dass die Quelle dieses Lichts irgendwann aufsteigen würde, aber niemand wusste, was wir zu sehen bekommen sollten. Drei Stunden nach Sonnenaufgang erlebten wir schließlich den zweiten Sonnenaufgang. Als wäre im Universum ein gigantischer Schweißer am Werk, so beschrieb es unser Kapitän später sehr treffend. Von den beiden Sonnen, die nun am Himmel standen, war unsere alte Sonne die fürchterlichste, sie schien so dunkel im Vergleich zu der neuen Sonne, geradezu schwarz! Nicht jeder konnte mit diesem Albtraum umgehen, einige tollten wie die Irren auf dem Deck umher, andere sprangen über Bord …
(Aus: Albert G. Harris, Zeugen des Sterbenden Sterns. London, Jahr 6 des Zeitalters der Supernova)
Noch bevor sich die Kinder auf dem Sportplatz wieder gefasst hatten, brach ein Blitzgewitter los, weil sich die Atmosphäre durch die Strahlung des Sterbenden Sterns ionisierte. Lange, violette Lichtbögen spannten sich über den Himmel, dicht an dicht. Ohrenbetäubender Donner ertönte, als wollte er die Welt zweiteilen.
»Schnell zurück ins Klassenzimmer!«, rief Lehrerin Zheng, und alle rannten los und hielten schützend die Hände über den Kopf, während der Donner über ihnen tobte, als würde gerade die ganze Welt zusammenstürzen. Im Gebäude angekommen, scharten sich die zitternden Jugendlichen um ihre Lehrerin. Durch die eine Fensterseite drang das Licht des Sterbenden Sterns und malte deutliche rechteckige Schatten auf den Boden, von der anderen Fensterseite her zuckten blauviolette elektrische Blitze durch das Klassenzimmer. Der ganze Raum war statisch aufgeladen. Jedes Metallteil an ihrer Kleidung sprühte knisternd winzige Funken, die Haare standen ihnen zu Berge, und ihre Haut kribbelte, als wären ihre Kleiderstoffe mit feinen Nadeln gespickt.
Hier ist die Aufzeichnung einer Nachrichtentransmission zwischen der letzten Besatzung der russischen Raumstation Mir, dem Kosmodrom Baikonur in Kasachstan und der US-Amerikanischen Raumfähre Zeus, bevor die Mir den Orbit verließ.
Kommandant: D.A. Wortschew
Flugingenieur: B.G. Tinowich
Maschinenbauingenieur: Y.N. Bikowski
Umweltingenieur: F. Lefsen
Stationsarzt: Nikita Kasjanenko
Mannschaft: Joe La Mure, Festkörperphysiker; Alexander Androw, Astrophysiker
EM-KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL:
10:20’10’’ MIR: Don ruft Baikonur! Don ruft Baikonur! Basis, bitte melden! Basis, bitte bestätigen.
(Keine Antwort. Rauschen.)
10:21’30’’, BASIS: Hier Basis Baikonur! Baikonur ruft Don. Bitte melden.
(Keine Antwort. Rauschen.)
INFRAROT-KOMMUNIKATION:
10:23’20’’, MIR: Basis, hier spricht Mir. Zu starke Störungen im Hauptsystem, daher haben wir die Notkommunikation aktiviert. Bitte antworten.
10:23’25’’, BASIS: Wir hören euch, aber das System ist instabil.
10:23’25’’, MIR: Problem bei der Ausrichtung der Sende- und Empfangseinheiten. Die automatische Ausrichtungskontrolle ist durch Strahlung beeinträchtigt, weshalb wir auf manuelle optische Orientierung zurückgreifen müssen.
10:23’37’’, BASIS: Kümmert euch um die Reparatur der vorhandenen Sende- und Empfangsanlagen. Wir übernehmen die Kontrolle.
10:23’42’’, MIR: Erledigt.
10:23’43’’, BASIS: Signal normal!
10:23’46’’, MIR: Basis, könnt ihr uns sagen, was passiert ist? Wie nennen wir das Ding, das plötzlich aufgetaucht ist?
10:23’56’’, BASIS: Wir wissen nicht mehr als ihr. Nennt es eben »Stern X«! Bitte sendet die relevanten Daten.
10:24’01’’, MIR: Wir übertragen das Datenmaterial des integrierten Strahlenmessgeräts, des Gammastrahlenmessers, des UV-Strahlenmessers, von Gravimeter, Magnetometer, Geigerzähler, Sonnenwindmesser, Neutrino-Detektor, mit Beginn 10 Uhr. Außerdem 136 Sicht- und Infrarotaufnahmen. Bitte empfangen.
10:24’30’’, MIR: (Datenübertragung)
10:25’00’’, MIR: Unser Weltraumteleskop hat Stern X seit seinem ersten Auftreten erfasst. Nach unseren Übertragungsmaßen ist es weder möglich, seinen Winkeldurchmesser zu schätzen, noch haben wir eine eindeutige Parallaxe. Dr. Androw ist der Ansicht, dass diese Beobachtungen zusammen mit der empfangenen Energie bedeuten, dass es sich bei Stern X um einen Stern außerhalb des Sonnensystems handelt. Das ist natürlich nur eine Hypothese, denn unsere Daten sind nicht ausreichend, und wir sind auf die Messungen der Basis angewiesen.
10:25’30’’, BASIS: Was habt ihr auf der Erde beobachtet?
10:25’36’’, MIR: Nach unseren Beobachtungen von Äquatorialwolken zu urteilen, bewegt sich ein gigantischer Taifun mit einer geschätzten Geschwindigkeit von sechzig Metern pro Sekunde von der Äquatorregion nordwärts, möglicherweise aufgrund der ungleichmäßigen, plötzlichen Hitzeeinwirkung auf die Erde durch Stern X. Ach, und außerdem starke ultraviolette Strahlung und blaue Lichtzuckungen in den beiden Polregionen, wahrscheinlich Blitze, die sich gerade in niedrigere Breitengrade ausbreiten.
10:26’50’’, BASIS: Bitte um eigenen Statusbericht.
10:27’05’’, MIR: Es sieht gar nicht gut aus. Der bordeigene Flugsteuerungscomputer ist vollständig durch Hochenergiestrahlen zerstört worden, das Backup-System ebenso. Die Bleiabschirmung ist außer Funktion. Die Monokristallin-Silizium-Solarbatterien sind vollkommen zerstört, und die chemischen Batterien sind stark beschädigt, weshalb wir jetzt allein von den schwachen Atombatterien im Innenraum abhängig sind. Wir haben ein ernsthaftes Stromversorgungsproblem, weshalb wir das Lebenserhaltungssystem in der Hauptkapsel abschalten mussten. Auch das Lebenserhaltungssystem der Druckkabine funktioniert nicht richtig, und wir müssen bald unsere Raumanzüge anlegen.
10:28’20’’, BASIS: Unter den gegebenen Umständen erscheint es nicht geraten, im Orbit zu bleiben. Eine weiche Landung ist wegen des Ausfalls der Systeme allerdings auch nicht machbar. Die amerikanische Raumfähre Zeus befindet sich im niedrigen Orbit 3340. Sie lag im Erdschatten und hat daher nur geringen Schaden genommen. Zeus ist noch in der Lage zum Wiedereintritt. Wir haben Kontakt aufgenommen, und die Amerikaner sind bereit, euch nach den Bestimmungen des Weltraumabkommens zur Rettung von Astronauten aufzunehmen. Die Parameter zur Geschwindigkeitsdrosselung und zum Motorantrieb folgen …
10:30’33’’, MIR: Basis bitte kommen, der Raumstationsarzt möchte mit euch sprechen.
10:30’40’’, MIR: Hier spricht der Stationsarzt. Ich glaube, der Transfer ist sinnlos, bitte macht die Operation rückgängig.
10:30’46’’, BASIS: Wir bitten um Erläuterung.
10:30’48’’, MIR: Sämtliche Astronauten an Bord der Station haben eine tödliche Strahlendosis von fünftausendeinhundert Rad abbekommen. Wir haben nur noch wenige Stunden zu leben. Selbst wenn wir es auf die Erde zurück schaffen, würde es keinen Unterschied machen.
10:31’22’’, BASIS: (Schweigen)
10:31’57’’, MIR: Hier spricht der Kommandant. Bitte gestattet uns den Verbleib auf der MIR. Diese Raumstation ist die äußerste Station der Menschheit, um Stern X zu beobachten. In den uns verbleibenden Stunden werden wir unsere Pflicht bis zum Letzten erfüllen. Wir werden die ersten Astronauten sein, die im Weltraum sterben. Falls das jemals möglich sein sollte, bitten wir darum, unsere Asche auf dem Terrain unserer Heimat zu verstreuen.
(Auszug aus: Wladimir Konew, Eine Geschichte des russischen Raumfahrtprogramms in der Alten Zeit, Band 5. Moskau, Jahr 17 des Zeitalters der Supernova)
Eine Stunde und fünfundzwanzig Minuten lang erleuchtete der Sterbende Stern das Universum. Dann verschwand er plötzlich. Erst jetzt waren Radioteleskopantennen in der Lage, seine Überreste auszumachen – ein schnell rotierender Neutronenstern, der in festen Zeitintervallen elektromagnetische Impulse aussendete.
Die Gesichter an die Fenster gepresst, sahen die Schüler dem Sonnenuntergang zu, der keiner war, und blauschwarze Nacht senkte sich auf diesen eigentümlichen Abend. Das Licht des Sterbenden Sterns verblasste zu einem Zwielicht, das den halben Himmel einnahm, bis es rasch zu einem den Stern begrenzenden Leuchtkreis schrumpfte und dabei die Farbe von Dunkelviolett zu Weiß änderte. Der Himmel war nun beinahe ganz dunkel, vereinzelte Sterne waren zu sehen. Der Leuchtkreis um den Sterbenden Stern schrumpfte weiter, bis er ganz verschwunden war. Von der gleißenden Lichtquelle blieb nur noch ein glänzender Punkt übrig. Als der Nachthimmel wieder sein gewöhnliches Erscheinungsbild angenommen hatte, überstrahlte er zunächst noch immer alle anderen Sterne, dann war er nur noch ein Stern unter den unzähligen Sternen der Galaxien, und fünf Minuten später verschwand der Sterbende Stern endgültig in den Tiefen des Universums.
Als die Blitze aufgehört hatten, rannten die Kinder aus dem Klassenzimmer und fanden sich in einer phosphoreszierenden Welt wieder. Alles unter dem Nachthimmel, die Bäume, die Häuser, der Boden leuchtete neongrün, als wäre die Erde und alles, was darauf wuchs und stand, zu durchsichtiger Jade geworden, wobei eine tief in ihr verborgene Quelle aus grünlichem Mondlicht ihren Schein durch die Jadewelt schickte. Grün leuchtende Wolken zogen über den Himmel, und Schwärme aufgeschreckter Vögel flogen vorbei wie leuchtend grüne Flattergeister. Was den Kindern den größten Schreck einjagte, war allerdings, dass sie selbst grün leuchteten, wie auf einem Fotonegativ oder wie eine Horde Geister.
»Hab ich’s nicht gesagt? Alles kann passieren …«, murmelte Brille.
Erst als die Lichter des Klassenzimmers wieder angingen, genauso wie die Lichter der ganzen Stadt, fiel den Schülern auf, dass der Strom ausgefallen war. Mit der Rückkehr des elektrischen Lichts verblasste das neongrüne Leuchten. Doch kaum dachten sie erleichtert, die Welt wäre wieder wie zuvor, mussten sie feststellen, dass der Schrecken noch kein Ende genommen hatte.
Ein rotes Licht leuchtete im Nordosten, und kurz darauf stiegen an jenem Teil des Nachthimmels dunkelrote Wolken auf, als kündeten sie von einem neuen Morgen.
»Jetzt geht wirklich die Sonne auf!«
»Quatsch! Es ist elf Uhr nachts.«
Erst als sich die roten Wolken stark verdichtet hatten und den halben Himmel bedeckten, begriffen die Kinder, dass die Wolken selbst leuchteten. Als die Wolken direkt über ihnen waren, erkannten sie, dass die Wolken aus großen Lichtbändern bestanden, die vom Himmel herabhingen wie wehende Gardinen.
»Polarlichter!«, rief einer.
Die Polarlichter bedeckten bald den ganzen Himmel, und in der darauffolgenden Woche tanzten rund um den Globus rote Lichtbänder am Nachthimmel.
Eine Woche später, als die Polarlichter verschwunden und die funkelnden Sterne zurück waren, begann der letzte, glorreiche Satz der Supernova-Sinfonie. Ein leuchtender Sternennebel tauchte genau an der Stelle auf, an der sich vor wenigen Tagen der Sterbende Stern befunden hatte. Die magnetischen Hochenergieimpulse störten die Staubwolke der Explosion auf, die im Bereich des für Menschen sichtbaren Lichts Synchrotonstrahlung verströmte. Der Nebel wuchs ungefähr zur Größe zweier Vollmonde an. Der rosettenförmig strahlende Sternennebel, der später Rosennebel getauft wurde, verströmte ein seltsames, kaltes blaues Licht, das jedem Detail auf der Erde einen Silberglanz verlieh, der so hell strahlte wie ein Vollmond und das funkelnde Lichtermeer der Stadt verblassen ließ.
Von da an sollte der Rosennebel über die Geschichte der Menschheit scheinen, bis die Erben der Herrschaft der Dinosaurier über den Planeten ausgerottet oder unsterblich geworden waren.
2
Die Auswahl
Das Auftauchen des Sterbenden Sterns war für die Menschheit unzweifelhaft ein großes Ereignis. Die früheste Aufzeichnung einer Supernova stammte von einer Orakelknocheninschrift von dreizehnhundert vor Christus und die jüngste aus dem Jahr neunzehnhundertsiebenundachtzig, in dem eine Supernova außerhalb der Galaxis in Richtung der Großen Magellanschen Wolke, etwa hundertsiebzigtausend Lichtjahre von der Erde entfernt. Aus astronomischer Sicht war es falsch zu sagen, dass sich diese letzte Supernova sozusagen vor unseren Augen abgespielt hatte; »auf unseren Wimpern« wäre in diesem Fall präziser.
Aber die Faszination der Welt von diesem Ereignis hielt nicht länger an als zwei Wochen. Die Wissenschaft fing gerade erst an, den Vorgang zu untersuchen, und die Philosophie und die Künste zogen aus dem Ereignis Inspiration, die bald Früchte tragen würde. Der Rest der Menschheit kehrte einfach zum normalen Leben zurück. Gewiss wurde mit Interesse verfolgt, wie groß der Rosennebel werden und wie sich seine Form verändern würde, aber das geschah eher beiläufig.
Zwei für die Menschheit relevante Entdeckungen fanden daher zunächst kaum Beachtung …
In einer stillgelegten Mine in Südamerika lag ein riesiger, mit zehntausend Tonnen unbewegtem Wasser gefüllter Tank. Er war Teil einer rund um die Uhr von vielen hochempfindlichen Sensoren beobachteten Anlage. Es handelte sich um eine der Versuchsanordnungen zur Entdeckung von Neutrinos. Neutrinos würden, nachdem sie fünfhundert Meter Gestein durchdrungen hatten, im Wasser des Tanks winzige Blitze auslösen, so winzig, dass man sie nur mit hochempfindlichen Messgeräten aufspüren konnte. Dort hatten an jenem Tag der Physiker Dr. Andrew Anderson und der Ingenieur Miguel Nord Dienst. Nord, der sich zu Tode langweilte, zählte die Wasserflecken, die im fahlen Licht auf den Gesteinswänden glitzerten. Er atmete einmal tief die schwere, feuchte unterirdische Luft ein und seufzte. Hier unten fühlte er sich wie in einem Grab. Er zog seine in einer Schublade verborgene Whiskyflasche hervor. Wortlos hielt Anderson ihm sein Glas hin. Früher war der Physiker strikt gegen Trinken am Arbeitsplatz gewesen und hatte einmal einen Ingenieur deswegen gefeuert, aber inzwischen war es ihm egal. In den fünf Jahren, die die beiden nun einen halben Kilometer unter Tage verbracht hatten, war in diesem Tank kein einziger Blitz aufgezuckt, und sie rechneten auch nicht mehr damit. Doch in diesem Augenblick schlug der Blitzmelder an, die himmlische Musik, auf die sie so lange gewartet hatten!
Die Whiskyflasche fiel zu Boden und zersprang in tausend Stücke. Sie stürzten zum Monitor. Er war vollkommen schwarz. Verstört sahen sie einander an. Der Ingenieur kam als Erster zur Besinnung und eilte aus dem Kontrollraum zum Wassertank, der etwas von einem hohen, fensterlosen Gebäude hatte. Durch eine kleine Luke spähte er hinein, wo er mit bloßem Auge den geisterhaften blauen Blitz auf dem Wasser tanzen sah, so heftig, dass die hochempfindlichen Messgeräte den Übersättigungszustand erreicht hatten. Sie gingen zurück in den Kontrollraum, wo Dr. Anderson sich die Sache über ein anderes Messgerät gebeugt genauer ansah.
»Neutrinos?«, fragte Nord.
Anderson schüttelte den Kopf. »Dieses Teilchen hat eindeutig Masse.«
»Dann könnte es nicht bis hierher vorgedrungen sein. Die Interaktion mit den Gesteinsschichten hätte es aufgehalten.«
»Es gab eine Interaktion. Was wir beobachtet haben, ist seine Sekundärstrahlung.«
Nord starrte ihn entgeistert an. »Sind Sie verrückt geworden? Wie stark müsste es sein, um durch fünfhundert Meter Gestein hindurch Sekundärstrahlung zu produzieren?«
Am Medizinischen Zentrum der Stanford Universität kam der Hämatologe Dr. Peter Grant zum Labor, um die Testergebnisse für zweihundert Proben abzuholen, die er tags zuvor abgegeben hatte.
»Habt ihr denn genug Betten auf der Station?«, fragte der Laborchef, während er ihm den Packen Laborberichte aushändigte.
»Wie meinen Sie das?«
Der Laborchef deutete mit dem Kinn auf die Laborberichte. »Wo haben Sie denn all die bedauernswerten Kerle aufgetrieben? Tschernobyl?«
Grant ging die Berichte durch. »Legen Sie es eigentlich verdammt noch mal darauf an, gefeuert zu werden, House? Das waren Kontrollproben von gesunden Patienten, zu rein statistischen Zwecken!«, wütete er. »Können Sie nicht gefälligst sorgfältiger arbeiten?«
Der Laborchef starrte Grant an. In seinem Blick lag ein so tiefes Entsetzen, dass der Hämatologe Gänsehaut bekam. Dann packte er Grant am Ärmel und zog ihn zu sich ins Labor.
»Was soll das? Sind Sie noch ganz bei Trost?«, protestierte Grant.
»Ich nehme Ihnen Blut ab, und mir auch. Und euch auch!«, sagte er an die Laborassistenten gewandt. »Blutabnahme, aber schnell!«
Zwei Tage vor dem Schulbeginn nach den Sommerferien wurde der Schuldirektor mitten in einer Lehrerkonferenz ans Telefon gerufen. Er kehrte mit einem sehr ernsten Gesicht zurück, winkte Zheng Chen zu sich und verließ unter den erstaunten Blicken des Kollegiums den Konferenzraum.
»Trommeln Sie sofort Ihre Klasse zusammen, Frau Zheng.«
»Wieso das? Das Schuljahr hat doch noch gar nicht angefangen.«
»Ich meine die Abschlussklasse.«
»Das ist noch schwieriger. Sie gehen auf fünf verschiedene Mittelstufenschulen, und ich weiß nicht einmal, wann ihr Schuljahr anfängt. Inwiefern sind wir überhaupt noch für sie zuständig?«
»Das Studiensekretariat wird Sie unterstützen. Der Anruf kam direkt von der Erziehungskommission!«
»Hat Direktor Feng gesagt, was ich machen soll, wenn ich sie alle zusammenhabe?«
Der Schuldirektor merkte, dass sie ihn nicht richtig verstanden hatte. »Ich rede nicht von Direktor Feng, ich rede von der Staatlichen Erziehungskommission!«
Die Abschlussklasse zusammenzubringen war gar nicht so schwer, wie Zheng Chen es sich vorgestellt hatte. Es dauerte nicht lange, bis alle fünfundvierzig Schüler in ihre alte Schule zurückgekehrt waren, nachdem ihre neuen Schulen sie informiert hatten, dass es sich um eine dringende Angelegenheit handelte.
Zheng Chen und die Schüler warteten eine gute halbe Stunde lang im Klassenzimmer und hatten keine Ahnung, was sie erwartete. Schließlich hielten eine Limousine und ein kleinerer Wagen vor dem Gebäude, und drei Männer stiegen aus. Der Schuldirektor stellte den Verantwortlichen Herrn als Zhang Lin von der Sonderkommission vor.
»Sonderkommission?«, fragte Zheng Chen.
»Eine neu aufgestellte Organisation«, antwortete Zhang Lin vage. »Ihre ehemaligen Schüler müssen für einige Zeit von ihren Familien getrennt werden. Wir werden die Erziehungsberechtigten informieren. Da Sie mit der Klasse gut vertraut sind, kommen Sie auch mit. Sie müssen nichts mitnehmen. Gehen wir.«
»Aber warum so überstürzt?«
»Es kommt auf jede Sekunde an.«
Der Bus verließ mit den fünfundvierzig Schülern die Stadt Richtung Westen. Zhang Lin setzte sich neben Zheng Chen und ging das Schülerregister durch. Als er fertig war, starrte er geradeaus und sagte kein Wort, genau wie die beiden anderen jüngeren Männer. Zheng Chen fiel ihre ernsten Mienen auf, aber sie wagte es nicht, Fragen zu stellen. Die Atmosphäre übertrug sich auch auf die Kinder, die während der Fahrt kaum den Mund aufmachten. Sie fuhren am Sommerpalast vorbei, weiter nach Westen in Richtung Westberge und dann durch eine abgelegene, von Bäumen gesäumte Straße entlang durch die Berge, bis zu einem großen, abgeschlossenen Gelände, dessen Tor von drei bewaffneten Männern bewacht wurde. Auf dem Gelände befand sich eine Reihe von Bussen wie ihrer, aus denen andere Schulkinder ausstiegen, etwa im gleichen Alter wie Zheng Chens Schüler.
Sie war gerade ausgestiegen, als sie jemanden ihren Namen rufen hörte. Es war ein Lehrer aus Schanghai, den sie einmal auf einer Konferenz kennengelernt hatte. Ein Blick auf die Jugendlichen in seinem Umfeld verriet ihr, dass es sich ebenfalls um Schüler der Unterstufe handelte.
»Das ist meine Klasse«, sagte er.
»Eben aus Schanghai angereist?«, fragte Zheng Chen.
»Ja. Wir sind gestern Abend informiert worden und haben die ganze Nacht damit zugebracht, die Schüler zusammenzutrommeln.«
»Gestern Abend? Wie seid ihr denn so schnell hergekommen? Selbst mit dem Flugzeug dauert es länger.«
»Ein Charterflug.«
Sie sah ihn fragend an.
»Ich weiß auch nicht mehr«, sagte der Lehrer aus Schanghai.
»So wie ich.« Zheng Chen fiel ein, dass dieser Kollege ebenfalls an einem Sonderprojekt für sogenannten Qualitätsunterricht teilgenommen hatte. Vier Jahre zuvor hatte das Erziehungsministerium das Sternprojekt lanciert, ein groß angelegtes Unterfangen, für das landesweit in den Großstädten Pilotklassen bestimmt worden waren, um Lehrmethoden abseits des traditionellen Schulunterrichts auszuprobieren. Die Idee hinter dem Projekt war, die interdisziplinären Fähigkeiten der Schüler zu fördern. Dazu gehörte auch Zheng Chens Klasse.
Sie sah sich um. »Sieht so aus, als wären hier nur Sternprojektklassen.«
»So ist es. Insgesamt vierundzwanzig, etwa tausend Jugendliche aus fünf Städten.«
Im Laufe des Nachmittags sammelten Mitarbeiter zusätzliche Informationen über die Klassen und legten für jeden Schüler ein umfangreiches Dossier an. Erst am Abend hatten sie frei und konnten ihre Eltern anrufen, um ihnen mitzuteilen, dass sie an einem Sommercamp teilnahmen. Der Sommer war allerdings schon vorbei.
Am nächsten Morgen bestiegen die Jugendlichen noch vor Sonnenaufgang die Busse und fuhren weiter. Nach fünfundvierzig Minuten Fahrt durch die Berge erreichten sie ein Tal, umgeben von sanften Hügeln, die sicher bald in flammend roten Herbstfarben leuchten würden. Noch waren sie sommerlich grün. Durch das Tal wand sich ein schmaler Fluss, seicht genug, um mit hochgekrempelten Hosenbeinen hindurchzuwaten. Die rund tausend Jugendlichen versammelten sich auf einem großen Platz neben der Straße. Einer der Verantwortlichen stellte sich auf einen Felsblock und richtete das Wort an sie.
»Liebe Schülerinnen und Schüler! Nachdem ihr aus dem ganzen Land hier zusammengekommen seid, möchte ich euch über den Zweck eurer Reise aufklären. Wir werden ein groß angelegtes Spiel spielen.«
Es war offensichtlich, dass der Mann nicht gewohnt war, mit jungen Menschen umzugehen. Sein Auftreten und die ernste Miene ließen ihn nicht gerade wie einen Spielleiter wirken. Dennoch ging ein aufgeregtes Raunen durch die Schülerreihen.
»Seht«, sagte er, wobei er auf das Tal zeigte, »dort werden wir unser Spiel beginnen. Jede der vierundzwanzig Klassen bekommt ein Stück Land in der Größe von drei bis vier Quadratkilometern zugeteilt. Auf diesem Stück Land, bitte hört gut zu, auf diesem Stück Land werdet ihr einen eigenen kleinen Staat errichten!«
Der letzte Satz ließ die Schüler aufhorchen. Tausend Augenpaare richteten sich fragend auf den Sprecher.
»Unser Spiel wird fünfzehn Tage dauern. In diesen fünfzehn Tagen werdet ihr von dem Ertrag des Landes leben, das euch zugeteilt wird.«
Die Schüler jubelten.
»Ruhe, bitte. Hört gut zu. Die vierundzwanzig Gebiete sind mit Zelten, Feldbetten, Brennstoffen, Essen und Trinkwasser ausgestattet. Diese Mittel sind jedoch nicht gleichmäßig verteilt. So werden sich auf einem Staatsgebiet mehr Zelte, aber weniger Nahrung finden, auf einem anderen mehr Nahrung als Zelte. Eins ist sicher: Die Menge an Vorräten ist nicht für den gesamten Zeitraum ausreichend. Euch stehen zwei Wege offen, um an zusätzliche Mittel zu kommen. Erstens könnt ihr Handel treiben. Ihr könnt überschüssige Vorräte von bestimmten Mitteln an Nachbarstaaten vertreiben. Das wird jedoch nicht zum Überleben reichen, denn, wie gesagt, die Mittel sind insgesamt zu knapp. Was bedeutet, dass ihr zweitens Produktion aufbauen müsst, also unerschlossenes Land bebauen, säen, bewässern und so weiter. Natürlich haben wir nicht genug Zeit, um auf die Ernte zu warten. Stattdessen wird euch von der Spielleitung auf der Grundlage eurer Anbauleistung die entsprechende Menge an Nahrung zugeteilt. Alle vierundzwanzig Staatsgebiete liegen am Ufer des Flusses, der euch als Wasserquelle dient, um eure Felder zu bewässern.
Außerdem werdet ihr eure Staatsoberhäupter bestimmen, je drei mit ebenbürtiger Macht ausgestattete Anführer, die zusammen die höchste Entscheidungsmacht besitzen. Ihr richtet eure eigenen Verwaltungsorgane ein und stellt die Weichen für die Politik eures Staats, Entwicklungspläne, Leitlinien der Außenpolitik und so weiter. Wir werden uns nicht einmischen. Und: Eure Bürger können sich frei bewegen, jeder darf in dem Staat leben, den er für besser hält.
Wir gehen nun dazu über, das Territorium für die einzelnen Staaten aufzuteilen. Als Erstes müsst ihr eurem Land einen Namen geben und diesen dem Direktorium mitteilen, alles andere bleibt euch überlassen. Ich möchte nur noch einmal betonen, dass dieses Spiel sehr, sehr wenige Regeln hat. Das Schicksal und die Zukunft dieser kleinen Staaten liegen in euren Händen, Kinder! Ich hoffe, ihr werdet blühende und starke Nationen daraus machen.«
Ein so großartiges Spiel hatten die Jugendlichen noch nie gespielt. Ohne zu zögern, rannten sie los, um die zugewiesenen Territorien einzunehmen.
Unter der Leitung von Zhang Lin fanden Zheng Chens Schüler schnell zu ihrem Staatsgebiet. Ein weißer Zaun umgab das Land, das sich vom Flussufer auf einen Hügel hinauf erstreckte. Dort, wo Fluss und Hügel aufeinandertrafen, waren säuberlich Zelte und Vorräte angeordnet. Die Jugendlichen stürzten an Zheng Chen und Zhang Lin vorbei darauf zu, um darin herumzustöbern. Zheng Chen hörte, wie sie überrascht aufschrien. Sie zwängte sich durch die Schar, um nachzusehen, und blieb wie angewurzelt stehen.
Auf einer grünen Plane lag eine Reihe Maschinengewehre.
Obwohl sie keine Ahnung von Waffen hatte, wusste sie instinktiv, dass es sich nicht um Spielzeuggewehre handelte. Sie nahm eins der Gewehre in die Hand, spürte sein Gewicht, roch das Schmieröl, nahm den kalten Glanz des Gewehrlaufs in Augenschein. Neben den Gewehren standen drei grüne Metallkästen. Sie öffneten einen davon, und zum Vorschein kamen goldglänzende Kugeln.
»Sind das echte Gewehre?«, fragte ein Schüler Zhang Lin, als er zu der Gruppe stieß.
»Natürlich. Diese Maschinengewehre gehören zur neuesten Ausstattung unserer Armee. Sie sind leicht und handlich und durch den zusammenlegbaren Schaft ideal für Kinder.«
»Wow!« Aufgeregt wogen die Schüler die Pistolen in den Händen.
»Halt! Nicht anfassen!«, rief Zheng Chen. »Was soll das?«, fragte sie Zhang Lin.
»Waffen gehören zur wesentlichen Ausstattung eines Staats.«
»Haben Sie eben gesagt, sie seien … geeignet für Kinder?«
»Ach, keine Sorge«, sagte er lächelnd. Er nahm ein Paar Kugeln aus einem Munitionskasten. »Diese Munition ist nicht tödlich. Sie besteht aus zwei Drahtkugeln in einer Plastikhülse, so leicht, dass sie nach dem Abfeuern schnell an Geschwindigkeit verlieren und niemanden verletzen können. Die Drahtkugeln sind jedoch stark elektrostatisch aufgeladen und versetzen ihrem Ziel einen Stromschlag von Zehntausenden Volt Stärke, was ausreicht, um einen Menschen zu Fall zu bringen und das Bewusstsein verlieren zu lassen. Da die Spannung nicht sehr hoch ist, wird das Opfer sich rasch erholen und keine bleibenden Schäden davontragen.«
»Wie kann ein elektrischer Schlag harmlos sein?«
»Diese Munition wurde zunächst für den Polizeigebrauch entwickelt und ist sowohl an Tieren wie an Menschen getestet worden. In westlichen Ländern wurde die Polizei schon in den 1980er-Jahren damit ausgestattet, und es gab bei zahlreichen Einsätzen keinen einzigen Todesfall.«
»Und wenn man sie ins Auge bekommt?«
»Man kann Augenschutz verwenden.«
»Und was, wenn der Getroffene von einer Anhöhe stürzt?«
»Genau deshalb haben wir ein relativ ebenes Gelände gewählt. Natürlich muss ich gestehen, dass wir unmöglich absolute Sicherheit garantieren können, aber die Verletzungsgefahr ist minimal.«
»Und Sie beabsichtigen tatsächlich, Dreizehnjährigen diese Waffen zu überlassen, um sie gegen andere Dreizehnjährige zu richten?«
Zhang Lin nickte.
Zheng Chen wurde kreidebleich. »Warum keine Spielzeugpistolen?«
Er schüttelte den Kopf. »Krieg gehört zur Geschichte jedes Landes. Wir müssen eine möglichst wirklichkeitsgetreue Atmosphäre schaffen, um verlässliche Ergebnisse zu erhalten.«
»Ergebnisse? Wozu?« Sie starrte ihn mit ängstlichen Augen an, als wäre er ein Ungeheuer. »Was hat das hier alles eigentlich zu bedeuten?«
»Beruhigen Sie sich, Frau Zheng. Unsere Anordnungen sind noch vergleichsweise moderat. Aus zuverlässigen Quellen wissen wir, dass die Jugendlichen in einigen Ländern sogar echte Munition verwenden dürfen.«
»Andere Länder? Spielt denn die ganze Welt dieses Spiel?«
Wie betäubt sah sie sich um. Sie wusste nicht, ob sie wachte oder träumte. Dann riss sie sich zusammen, strich sich das Haar zurück und sagte: »Bitte lassen Sie mich und meine Schüler nach Hause fahren.«
»Ich bedaure, aber das wird nicht möglich sein. In dieser Gegend herrscht Kriegsrecht. Es handelt sich, wie gesagt, um eine äußerst wichtige Angelegenheit …«
Zheng Chen verlor erneut die Fassung. »Das ist mir egal. Ich werde das nicht zulassen. Ich bin Lehrerin, ich folge meinen Pflichten und meinem Gewissen.«
»Sie können mir glauben, dass auch wir unserem Gewissen folgen, und unsere Pflichten wiegen weitaus schwerer. Diese beiden Gründe sind es, die uns zum Handeln zwingen.« Er blickte ihr mit tiefem Ernst in die Augen. »Vertrauen Sie uns.«
»Lassen Sie die Kinder gehen!«
»Vertrauen Sie uns.«
Die Stimme hinter ihr kam ihr sonderbar bekannt vor, obwohl sie nicht sofort sagen konnte, woher. Die Jugendlichen starrten verblüfft auf einen Punkt hinter Zheng Chen. Als sie sich umdrehte, sah sie eine kleine Gruppe von Erwachsenen, deren Anblick ihr Gefühl verstärkte, sich außerhalb der Realität zu bewegen. Seltsamerweise beruhigte sie das. In den Männern weiter hinten erkannte sie hochrangige Politiker des Landes, die sie schon häufig in den Nachrichten gesehen hatte, aber die Ersten, die sie erkannte, waren die beiden Herren direkt vor ihrer Nase. Der Staatspräsident und der Premierminister.
»Es kommt Ihnen vor wie ein Albtraum, nicht wahr?«, fragte der Präsident freundlich.
Sie nickte stumm.
»Das ist nicht verwunderlich«, sagte der Premierminister. »So ging es uns anfangs auch. Aber wir haben uns schnell daran gewöhnt.«
»Ihre Arbeit ist von großer Bedeutung für das Schicksal des Landes und des Volks«, sagte der Präsident. »Wir werden Ihnen später alles erklären, und dann werden Sie stolz darauf sein, was Sie geleistet haben und noch leisten werden, Genossin.«
Die Gruppe war schon auf dem Weg zum angrenzenden Territorium, als der Premierminister noch einmal auf Zheng Chen zutrat. »Für den Augenblick genügt es zu verstehen, dass die Welt schon nicht mehr das ist, was sie einmal war.«
»Los, lasst uns unserem kleinen Land einen Namen geben«, begann Brille.
Die Morgensonne lugte über den Hügelkamm und tauchte das Tal in goldenes Licht.
»Wie wär’s mit Sonnenland?«, schlug Huahua vor. Als sein Vorschlag ringsum Zustimmung erntete, fuhr er fort: »Wir sollten eine Flagge malen.«
Unter den Beständen fand sich ein Stück weißes Leinen. Huahua zog einen dicken Marker aus seiner Schultasche und zeichnete einen Kreis darauf. »Da haben wir eine Sonne. Hat einer von euch einen roten Filzstift, um sie auszumalen?«
»Aber dann hätten wir eine japanische Flagge«, sagte eine Mitschülerin.
Xiaomeng übernahm den Marker und zeichnete ein paar große Augen und einen Lachmund in die Sonne und außen herum lange Striche als Sonnenstrahlen. Mit dieser Flagge konnten sich alle anfreunden. Im Zeitalter der Supernova wurde diese mit unbeholfener Kinderhand gezeichnete Flagge als ein kostbares Artefakt im Staatlichen Geschichtsmuseum verwahrt.
»Und die Nationalhymne?«
»Nehmen wir einfach das Lied der Jungen Pioniere.«
Als die Sonne vollständig über dem Hügel aufgegangen war, hissten die Schüler in der Mitte ihres Staatsgebiets feierlich die Flagge.
»Warum war es dir wichtig, zuerst eine Flagge und eine Nationalhymne zu bestimmen?«, fragte Zhang Lin nach der Zeremonie Huahua.
»Ein Staat braucht das, als … Symbole. Wenn wir das Land über seine Symbole wahrnehmen, stärkt das den Zusammenhalt.«
Zhang Lin machte sich Notizen.
»Haben wir etwas falsch gemacht?«, fragte einer der Jugendlichen.
»Nein. Alle Entscheidungen liegen bei euch, wie gesagt. Handelt so, wie es euch passt. Meine Aufgabe besteht allein darin zu beobachten, ohne mich einzumischen. Das gilt auch für Sie, Frau Zheng«, fügte er an.
Die Dreizehnjährigen machten sich daran, ihre Staatsoberhäupter zu wählen, und wählten ohne Diskussionen Huahua, Brille und Xiaomeng zum Führungstrio. Huahua beauftragte Lü Gang mit der Aufstellung einer Armee, für die sich gleich fünfundzwanzig Freiwillige meldeten. Nur zwanzig von ihnen konnten mit Maschinengewehren ausgestattet werden, aber Lü Gang versprach den anderen fünf, dass die Waffen in den nächsten Tagen rotieren sollten. Xiaomeng ernannte Lin Sha zur Gesundheitsministerin, womit sie die Verantwortung für die Medikamentenvorräte und die Versorgung von Patienten trug. Die Einrichtung weiterer staatlicher Ämter und Institutionen verschoben sie auf später.
Dann begannen sie, sich auf ihrem Terrain häuslich einzurichten, und machten Platz für das erste Zelt. Doch kaum waren ein paar von ihnen hineingekrochen, stürzte das Zelt ein, und sie mussten sich mühevoll wieder herausarbeiten. Irgendwie machte das aber auch Spaß, befanden sie, und bis mittags hatten sie erfolgreich eine Handvoll Zelte errichtet und mit Feldbetten versehen. Damit hatten sie immerhin schon einen Platz zum Schlafen.
Vor dem Mittagessen schlug Xiaomeng vor, zunächst eine Inventarliste über die vorhandenen Vorräte an Nahrung und Wasser anzulegen und einen genauen Nutzungsplan für den täglichen Verbrauch zu erstellen. Es sei sinnvoll, in den ersten beiden Tagen den Verbrauch bestmöglich einzuschränken, denn sobald sie mit der Kultivierung des Landes begannen, brauchten sie mehr zu essen. Außerdem gelte es zu bedenken, dass sie bei Schwierigkeiten mit dem Anbau mit Nahrungsknappheit rechnen müssten. Ihre Versorgung durch die Administration oder die Nachbarländer zu gewährleisten könnte dauern. Die anderen maulten. Warum sollten sie sich nicht nach Herzenslust satt essen können, nachdem sie schon den ganzen Vormittag geschuftet hatten? Xiaomeng musste ihre ganze Überzeugungskunst aufbringen.
Währenddessen stand Zhang Lin an der Seite und machte sich Notizen.
Nach dem Mittagessen besuchten sie ihre Nachbarländer, um ein paar zusätzliche Zelte und Werkzeuge, die sie für den Anbau benötigten, zu erhandeln. Dabei nahmen sie ihre Umgebung etwas gründlicher in Augenschein. Flussaufwärts von ihnen lag die Republik Galaktika, flussabwärts lag Riesenland. Das Land am gegenüberliegenden Flussufer hieß Emailland, und dessen Nachbarländer flussaufwärts waren Raupenland und Blaublumenland, die ihre Namen aus der umgebenden Natur gezogen hatten. Die achtzehn anderen Ministaaten des Tals schienen zu weit weg, um für sie von Interesse zu sein.
Der darauffolgende Tag und die beiden Nächte waren das Goldene Zeitalter für die Welt des Tals. Die Jugendlichen sprühten vor Begeisterung für ihr neues Leben. Einen Tag später begannen die Länder, den Hügel mit einfachem Gerät wie Schaufeln und Hacken in Ackerland zu verwandeln, und schleppten Flusswasser in großen Eimern herbei, um das Land zu bewässern. Nachts leuchteten zu beiden Seiten des Flusses Lagerfeuer auf, und im Tal hallten die Lieder und das Lachen der Kinder wider. Die Welt des Tals war ein einziges wunderbares Märchenland.
Aber der goldene Märchenglanz wich bald den grauen Wolken der Wirklichkeit.
Als die Freude am Neuen verschwand, ließ auch ihr Eifer beim Erschließen von Ackerland nach. Erschöpft kehrten die Kinder abends von der Arbeit zurück und fielen in ihre Betten, sobald sie die Zelte betraten. Bald gab es weder nächtliche Lagerfeuer noch gemeinsames Liedersingen. Stille legte sich über das Tal.
Die ungleiche Ressourcenverteilung zwischen den Staaten fiel mehr und mehr ins Gewicht. Obwohl sie nicht weit voneinander entfernt lagen, verfügten einige Staaten über weichen, fruchtbaren Boden, der leicht zu beackern war, während bei anderen das harte, steinige Land selbst nach großer Anstrengung wenig abwarf. Sonnenland gehörte zu den dürrsten Gebieten, aber schlimmer noch als die miserable Qualität des Bodens am Hügel war die große Uferfläche, die dem Land zugeteilt war. Die Verwaltung hatte vorgegeben, dass die Flussebene allein zu Wohnzwecken dienen durfte und jeder Nahrungsmittelanbau dort nicht zählte. Bei manchen Ländern war es nicht weit vom Fluss bis zum Hügel, und die Kinder konnten Ketten bilden, um die Wassereimer vom Fluss zum Hügelland weiterzureichen, was eine Menge Arbeit sparte. Doch seine breite Flussaue bedeutete für Sonnenland einen langen Weg vom Fluss zum Hügel, sodass jeder Eimer Wasser weit geschleppt werden musste.
Brille hatte eine Idee. Sie könnten am Fluss einen Damm aus großen Steinen errichten. Dann würde das Wasser zwar immer noch überfließen, aber der Wasserpegel würde steigen, und sie könnten über einen Graben das Flusswasser bis zu einer Grube am Fuß des Hügels leiten. Zehn Landarbeiter wurden für dieses Projekt abgestellt. Doch kaum hatten sie die Arbeit aufgenommen, schon hagelte es heftige Proteste von den Nachbarstaaten flussabwärts, Riesenland und Kornblumenland. Brille versuchte zwar, ihnen auseinanderzusetzen, dass der Damm nur den Wasserstand auf ihrem eigenen Terrain erhöhe, ohne einen Einfluss auf die Wassermenge oder den Wasserpegel flussabwärts zu nehmen, aber die beiden Staaten blieben bei ihrem Widerstand. Huahua fand, sie sollten ungeachtet der Proteste ihren Plan verfolgen, aber Xiaomeng kam nach einiger Überlegung zu dem Schluss, dass sie es sich besser nicht mit den Nachbarstaaten verderben sollten. Es sei auf lange Sicht besser, das gute Klima mit den Nachbarn zu wahren, statt es wegen kurzfristiger Ziele zu gefährden. Der Fluss sei die einzige Wasserquelle für alle Anrainerstaaten, und darum sei alles, was ihn betreffe, mit Umsicht zu behandeln. »Sonnenland sollte sich einen guten Ruf unter den Nachbarn erarbeiten«, meinte sie.
Brille betrachtete die Angelegenheit mehr als Machtfrage, doch obwohl Lü Gang davon überzeugt war, dass die Armee ihre Sicherheit im Fall eines Konflikts garantieren könnte, hielt er es für unvernünftig, einen Konflikt mit gleich zwei Nachbarstaaten zu provozieren. Anstatt den Damm zu errichten, gruben sie einen doppelt so tiefen Kanal zwischen Fluss und Hügel, der letztendlich sehr viel weniger Wasser zur Grube transportierte als geplant. Dennoch beschleunigte das Bewässerungssystem die Kultivierung der Anbaufläche.
Sonnenland hatte die Aufmerksamkeit des Direktoriums auf sich gezogen. Eine weitere Person gesellte sich an die Seite ihres Beobachters Zhang Lin.
Am vierten Tag nahmen die Konflikte und Streitigkeiten zwischen den Staaten im Tal sprunghaft zu, meistens ging es dabei um Güterverteilung und die damit verbundenen Tauschgeschäfte. Die Kinder brachten wenig Geduld für zähe Verhandlungen auf, und es dauerte nicht lange, bis die ersten Schüsse fielen. Noch war die Situation kein einziges Mal eskaliert, und nicht alle Staaten im Tal waren gleichermaßen beteiligt. In der Umgebung von Sonnenland blieb die Situation verhältnismäßig stabil. Bis zum siebten Tag, als ein Konflikt um das Trinkwasser diese Stabilität ins Wanken brachte.