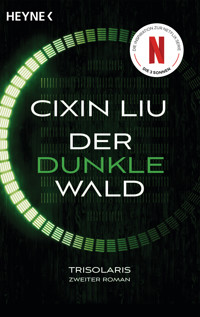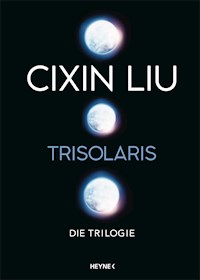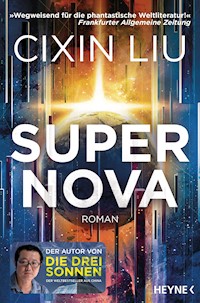13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die besten Science-Fiction-Autoren aus China in einem Band
Ein junger Mann wird dreimal in der Nacht angerufen – und jedes Mal ist er selbst am anderen Ende der Leitung. Genauer gesagt, sein zukünftiges Ich, und dreimal soll er die Welt vor der unausweichlichen Zerstörung retten. »Mondnacht« lautet der Titel dieser Kurzgeschichte von Cixin Liu, die der preisgekrönte Herausgeber und Übersetzer Ken Liu zusammen mit fünfzehn weiteren Erzählungen der besten Science-Fiction-Autoren Chinas in diesem Band versammelt hat.
Manche sind bereits in der Literaturszene etabliert und international berühmt wie etwa Cixin Liu, Hao Jingfang und Han Song, manche gehören zur jungen, ehrgeizigen Generation wie Qiufan Chen und Xia Jia, und andere wiederum sind in der wachsenden Zunft der Geisteswissenschaftler verwurzelt, zum Beispiel Regina Kanyu Wang und Fei Dao. Sie alle entwickeln in ihren Erzählungen einen kritischen, von der Gegenwartskultur geprägten Blick auf China, und manche Texte konnten erst in der Übersetzung überhaupt veröffentlicht werden. Abgerundet wird dieser Sammelband durch drei Essays, die das Phänomen der chinesischen Science-Fiction ausführlich beleuchten und verständlich machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Ist es möglich, einen Zug auf eine Reise durch die Zeit zu schicken? Was empfinden Roboter, wenn ihre künstliche Intelligenz erwacht? Und was wäre, wenn die Geschichte Chinas ab irgendeinem Punkt rückwärts verlaufen würde? Diese Fragen und viele mehr stellen sich die vierzehn Autorinnen und Autoren in diesem Band. Manche sind bereits in der Literaturszene etabliert und international berühmt wie etwa Cixin Liu, Hao Jingfang und Han Song, manche gehören zur jungen, ehrgeizigen Generation wie Qiufan Chen und Xia Jia, und andere wiederum sind in der wachsenden Zunft der Geisteswissenschaftler verwurzelt, zum Beispiel Regina Kanyu Wang und Fei Dao. Sie alle entwickeln in ihren Erzählungen einen kritischen, von der Gegenwartskultur geprägten Blick auf China, und manche Texte konnten erst in der Übersetzung überhaupt veröffentlicht werden. Abgerundet wird dieser Sammelband durch drei Essays, die das Phänomen der chinesischen Science-Fiction ausführlich beleuchten und verständlich machen.
Der Herausgeber
Ken Liu ist Übersetzer, Autor und Herausgeber. Für seine Kurzgeschichten gewann er zahlreiche Preise, doch Weltruhm erlangte er mit der englischen Übersetzung von Cixin Lius »Die drei Sonnen«, die mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde. Informationen zu den einzelnen Autorinnen und Autoren dieses Sammelbandes finden Sie den jeweiligen Erzählungen vorangestellt.
Besuchen Sie uns auf
Cixin Liu, Hao Jingfang,
Qiufan Chen und andere
ZERBROCHENE
STERNE
Die besten Erzählungen der
chinesischen Science-Fiction
Herausgegeben von Ken Liu
Aus dem Chinesischen und Englischen übersetzt von Karin Betz, Lukas Dubro, Johannes Fiederling, Marc Hermann, Kristof Kurz, Felix Meyer zu Venne und Chong Shen
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der Originalausgabe: BROKEN STARS
Eine Übersicht über die Originaltitel und Übersetzer mit genauen Copyright-Angaben zu den einzelnen Erzählungen und Essays finden Sie im Anhang.
Für meine Autoren,
die mich durch ihre Welten geführt haben
Ken Liu
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstausgabe 04/2020
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2019 by Ken Liu und bei den einzelnen Autoren
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlagillustration: Stephan Martinière
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-25112-3V001
diezukunft.de
Inhalt
Einleitung
Erzählungen
Xia Jia
Gute Nacht, Traurigkeit
Cixin Liu
Mondnacht
Tang Fei
Zerbrochene Sterne
Han Song
U-Boote
Salinger und die Koreaner
Cheng Jingbo
Der herabhängende Himmel
Baoshu
Großes steht bevor
Hao Jingfang
Der Neujahrszug
Fei Dao
Der Roboter, der gerne Quatsch erzählte
Zhang Ran
Der Schnee von Jinyang
Anna Wu
Das Restaurant am Ende des Universums: Laba-Porridge
Ma Boyong
Des ersten Kaisers liebstes Spiel
Gu Shi
Spiegelbild
Regina Kanyu Wang
Brainbox
Qiufan Chen
Das Licht
Eine kurze Geschichte zukünftiger Krankheiten
Essays
Kurze Einführung in die chinesische Science-Fiction-Literatur und die Fan-Szene in China, von Regina Kanyu Wang
Ein neuer Kontinent für Literaturwissenschaftler: Studien zur chinesischen Science-Fiction, von Mingwei Song
Das Schamgefühl ist überwunden, von Fei Dao
Anhang
Anmerkungen
Copyright und Übersetzungen
Verzeichnis chinesischer Science-Fiction im Heyne Verlag
ZERBROCHENE STERNE
Einleitung
Seit Erscheinen meiner ersten Anthologie Invisible Planets im Jahr 2016 haben mich viele Leser angeschrieben, weil sie mehr chinesische Science-Fiction lesen wollen. Cixin Lius Trisolaris-Trilogie, die Barack Obama als »unheimlich fantasievoll und interessant« bezeichnete, öffnete der westlichen Leserschaft die Augen für die Welt der chinesischen Science-Fiction. Und Invisible Planets hat gezeigt, dass es noch viel mehr zu entdecken gibt.
Das ist natürlich eine gute Nachricht für mich, meine Herausgeberkollegen und die Fans der chinesischen Science-Fiction, aber auch für die Agenten, Lektoren und Verleger, die eine Veröffentlichung der übersetzten Werke möglich machen, und nicht zuletzt für die Autoren selbst, die sich über weitere Leser freuen dürfen.
Im Gegensatz zu meiner ersten Anthologie habe ich mich bei Zerbrochene Sterne darum bemüht, möglichst viele Stimmen zu Wort kommen zu lassen und die Palette der Stimmungen und Erzählstile breit zu fächern. Dafür habe ich nicht nur die einschlägigen Publikationen gesichtet, sondern auch literarische Magazine in Print- und Onlineform sowie Gaming- und Modezeitschriften. Insgesamt finden sich in dieser Anthologie sechzehn Geschichten von vierzehn Autoren – doppelt so viele wie in Invisible Planets. Beinahe alle erschienen in den 2010er-Jahren auf Chinesisch, sieben dieser Geschichten sind hier zum ersten Mal in Übersetzung zu lesen. Einige Geschichten hier sind länger als die längste Story in Invisible Planets, andere kürzer als die kürzeste dort.
Neben etablierten und bekannten Autoren – zum Beispiel Han Song, der seinen beißenden, boshaften Humor in zwei Erzählungen demonstriert – kommen auch neue Stimmen zu Wort. Ich finde, die Werke von Gu Shi, Regina Kanyu Wang und Anna Wang haben es verdient, einer größeren Leserschaft vorgestellt zu werden. Außerdem habe ich mich absichtlich dafür entschieden, mehrere Geschichten aufzunehmen, die dem westlichen Leser womöglich nicht so leicht zugänglich sind: Zhang Rans Zeitreisegeschichte spielt mit dem typisch chinesischen Genre der Chuanyue-Literatur, und Baoshus Beitrag ist umso anrührender, je vertrauter der Leser mit chinesischer Geschichte ist. Ein bedauerlicher Nachteil dieses Ansatzes ist jedoch, dass es so nicht mehr möglich ist, mit der Aufnahme einer ganzen Reihe von Geschichten eines bestimmten Autors einen Querschnitt durch dessen Schaffen abzubilden. Doch ich hoffe, dass dies durch die größere Vielfalt wieder wettgemacht wird.
Trotz der großen Bandbreite an Autoren und Geschichten will ich darauf hinweisen, dass sich diese Anthologie keinesfalls als repräsentativ oder maßgebend für die chinesische Science-Fiction versteht. Ich hatte nicht die Absicht, eine »Best of«-Sammlung zusammenzustellen, was bei der Verschiedenheit der Geschichten, die unter der Bezeichnung »chinesische Science-Fiction« firmieren, und der Heterogenität der Autoren sowieso von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Außerdem – nach welchen Eigenschaften sollte man diese »besten« Geschichten denn überhaupt auswählen?
Stattdessen verließ ich mich auf zwei einfache Auswahlkriterien: Die Geschichte musste mir gefallen, und: Sie musste mir im Gedächtnis bleiben. Bei konsequenter Anwendung dieser Kriterien blieben erstaunlich wenige Geschichten übrig, und diese sind nun in der vorliegenden Anthologie versammelt. Ob sie Ihnen auch gefallen, hängt also sehr davon ab, ob mein Geschmack auch den Ihren trifft. »Perfekte« Geschichten interessieren mich nicht; ich glaube, dass eine Geschichte, die eine einzige Sache richtig macht, besser ist als eine, die nichts »falsch« macht. Ich will mir nicht anmaßen, objektiv oder gar allgemeingültig zu urteilen, doch ich vertraue meinem Geschmack.
Noch einige kurze Anmerkungen, bevor wir zu den Geschichten kommen.
Alle Leser, die mehr über die chinesische Science-Fiction erfahren wollen, finden am Ende dieses Bandes drei Essays von Kennern der Materie (von denen manche auch selbst im Genre schreiben), in denen es darum geht, welchen Einfluss der zunehmende kommerzielle Erfolg und das wachsende öffentliche Interesse auf die Fans und die Schriftsteller hatte.
Die Namen der Figuren in den Geschichten folgen der gebräuchlichen chinesischen Schreibweise, der Nachname wird also zuerst genannt. Nicht ganz so einfach verhält es sich mit den Namen der Autoren. Das Onlinezeitalter hat verschiedene Formen der Selbstdarstellung mit sich gebracht. Manche Autoren schreiben unter ihrem richtigen Namen (z. B. Hao Jingfang), andere unter Pseudonymen, die aus ihren richtigen Namen abgeleitet sind und die ich deshalb wie gewöhnliche chinesische Namen behandele. Andere bevorzugen in westlichen Publikationen einen englischen Namen und/oder die im Westen gebräuchliche Nennung des Vornamens vor dem Nachnamen (z. B. Anna Wu oder Regina Kanyu Wang). Hier folge ich selbstverständlich den Wünschen der Autoren. Dann gibt es noch die Pseudonyme, die nicht als gewöhnliche chinesische Namen behandelt werden können, weil es sich um Anspielungen oder Wortspiele handelt (z. B. Baoshu, Fei Dao oder Xia Jia). In diesem Fall weise ich in meinem kurzen Einführungstext zum jeweiligen Schriftsteller darauf hin, dass es sich hier nicht um wirkliche Vor- und Nachnamen, sondern um Pseudonyme handelt, deren Elemente in ihrer Reihenfolge unveränderlich sind – ähnlich eines Benutzernamens in einem Internetforum.
Ich möchte Tor Books in den USA und Head of Zeus in Großbritannien dafür danken, dass sie Zerbrochene Sterne veröffentlicht haben. Bei Tor bedanke ich mich ganz besonders bei Lindsey Hall für ihre redaktionellen Vorschläge, bei meiner Lektorin Deanna Hoak, der Grafikdesignerin Jamie Stafford-Hill für die Umschlaggestaltung und Patty Garcia für die Öffentlichkeitsarbeit.
Außerdem bedanke ich mich bei Nicolas Cheetham und Sophie Robinson, meinen Herausgebern bei Head of Zeus, sowie bei der Herstellerin Clemence Jacquinet, der Grafikdesignerin Jessie Price, der Vertriebsabteilung unter der Leitung von Dan Groenewald und Blake Brooks für die Öffentlichkeitsarbeit. Ohne ihre Hilfe würde dieses Buch keinen einzigen Leser finden, weil es nie existiert hätte.
Eines noch: Sie finden die ursprünglichen Veröffentlichungsinformationen (samt Autorennamen und Titeln der Geschichten in chinesischer Schrift) hinten im Anhang dieser Anthologie.
Ken Liu
ERZÄHLUNGEN
Xia Jia
Xia Jia (ein Pseudonym) studierte Atmosphärenforschung an der Universität Peking und anschließend Filmwissenschaft an der Communication University of China. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie über Frauenfiguren im Science-Fiction-Film. Anschließend promovierte sie in Komparatistik und Weltliteratur an der Universität Peking. Der Titel ihrer Doktorarbeit lautete: »Angst und Hoffnung im Zeitalter der Globalisierung: Kulturpolitik in der gegenwärtigen chinesischen Science-Fiction (1991 – 2012)«. Heute lehrt sie an der Jiaotong-Universität in Xi’an.
Sie schreibt seit ihrer Schulzeit und hat in vielen verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht, unter anderem in Science Fiction World und Jiuzhou Fantasy. Für ihre Geschichten wurde sie mehrmals mit dem Yinhe (»Galaxy«) Award und dem Xingyun (»Nebula«) Award ausgezeichnet. Englische Übersetzungen erschienen in Clarkesworld und Upgraded. »Let’s Have a Talk«, ihre erste in englischer Sprache verfasste Geschichte, wurde 2015 in Nature veröffentlicht.
Mit »Gute Nacht, Traurigkeit« gewann sie 2016 den Yinhe Award. Wie viele andere ihrer Arbeiten gehört diese Geschichte zu einer lose verbundenen Serie namens »Die chinesische Enzyklopädie«, die in der nahen Zukunft spielt und in der künstliche Intelligenz, Virtual Reality, Augmented Reality und andere Technologien die uralte Frage, was uns Menschen zu Menschen macht, auf neue Weise stellen. Hier sind Tradition und Moderne keine Gegensätze, sondern Partner bei einem komplizierten Tanz.
GUTE NACHT, TRAURIGKEIT
Aus dem Chinesischen von Marc Hermann
Sissi
1
Ich erinnere mich noch, wie Sissi das erste Mal in meine Wohnung kam.
Sie hob ihre winzigen Füßlein und trat so behutsam auf die blanken Holzdielen wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal frisch gefallenen Schnee betritt, die Schritte zittrig vor Angst, es könnte den Schnee beschmutzen oder mit seinem Gewicht darin versinken.
Ich hielt Sissi an der Hand. Ihr weicher Körper war mit Baumwolle gefüllt, und die Stiche, die ich auf dem weißen Flanell gesetzt hatte, waren nicht sonderlich akkurat. Auch einen Umhang aus scharlachrotem Filz, wie ich ihn aus den Märchen meiner Kindheit kannte, hatte ich ihr genäht. Ihr eines Ohr war länger als das andere geraten und baumelte wie verzagt herab.
Bei ihrem Anblick kamen mir all die Momente des Versagens in meinem Leben wieder in den Sinn: die Puppen aus Eierschalen, die ich im Handarbeitsunterricht zerdrückt hatte; die Bilder, die ich mit meinem Gekleckse ruiniert hatte; die Fotos, auf denen ich so steif gelächelt hatte; der Schokoladenpudding, den ich im Topf hatte verkohlen lassen; die Prüfungen, in denen ich durchgefallen war; die erbitterten Streitigkeiten und Trennungen; die wirren Referate; die Abschlussarbeit, die ich immer wieder umgeschrieben und trotzdem nie veröffentlicht hatte …
Dongdong wandte uns sein flauschiges Köpfchen zu und betrachtete uns. Seine Hochgeschwindigkeitskameras scannten und analysierten Sissis Gestalt. Ich glaubte fast zu hören, wie in seinem Körper die Algorithmen ratterten. Er war so programmiert, dass er nur auf sprechende Objekte reagierte.
»Dongdong, das ist Sissi.« Ich winkte ihn zu uns herüber. »Komm mal her und sag Hallo.«
Dongdong öffnete den Mund und stieß ein Geräusch aus, das einem Gähnen ähnelte.
»Benimm dich!«, ermahnte ich ihn mit erhobener Stimme wie eine strenge Mutter.
Mürrisch grummelte Dongdong etwas vor sich hin, doch ich wusste, dass er damit nur um meine Aufmerksamkeit und Zuneigung buhlen wollte. Die komplizierten Algorithmen, die seinem Verhaltensmuster zugrunde lagen, imitierten kleine Kinder und waren der Schlüssel zum Erfolg von Sprachlernrobotern. Ohne ein solches interaktives Verhaltensfeedback hätte Dongdong eher einem autistischen Kind geähnelt: Auch wenn er Grammatik und Wortschatz komplett beherrscht hätte, wäre er nicht in der Lage gewesen, sinnvoll mit anderen zu kommunizieren.
Dongdong streckte seine flauschige Vorderflosse aus und sah erst mich, dann Sissi mit großen Augen an. Die Designer hatten ihm aus gutem Grund die Gestalt eines kleinen weißen Seehunds gegeben: Jeder, der sein herzerfrischend argloses Äußeres und seine riesigen, pechschwarzen Augen sah, ließ sogleich alle Zurückhaltung fallen und fühlte nur noch den Drang, ihn zu umarmen, ihm den Kopf zu tätscheln und ihm zu versichern: »Hallo, ich freue mich, dich kennenzulernen!« Hätte er dagegen die Gestalt eines nackten Säuglings gehabt, so hätte er seinem menschlichen Gegenüber ein leises Grauen eingeflößt.
»Hal-lo«, sagte er mit der überdeutlichen Aussprache, die ich ihm beigebracht hatte.
»So ist es gut. Sissi, das ist Dongdong.«
Sissi musterte Dongdong mit ihren schwarzen Knopfaugen, hinter denen ihre Kameras verborgen waren. Weil ich ihr keinen Mund genäht hatte, wirkte ihr Gesichtsausdruck reichlich eintönig, als wäre sie eine verwunschene kleine Prinzessin, die weder lachen noch sprechen konnte. Doch sie konnte durchaus sprechen, das wusste ich – die fremde Umgebung machte sie nur nervös. Zu viele Informationen prasselten auf sie ein, zu viele Optionen verlangten danach, dass sie sie gegeneinander abwog – es war wie bei einer komplizierten Stellung im Schach, wenn jeder Zug eine unabsehbare Kette von Konsequenzen nach sich zog.
Die Hand, mit der ich Sissis Hand hielt, begann zu schwitzen, so als hätte sie mich mit ihrer Nervosität angesteckt.
»Dongdong, willst du Sissi nicht umarmen?«, schlug ich vor.
Dongdong stieß sich mit seinen Flossen vom Boden ab und machte einige Hopser nach vorn, ehe er sich mühsam aufrichtete und seine beiden kurzen Vorderflossen ausbreitete. Seine Mundwinkel zogen sich in die Länge und hoben sich zu einem neugierigen, freundlichen Lächeln. Was für ein perfektes Lächeln, bewunderte ich ihn im Stillen. Was für ein geniales Design. In der Frühzeit der künstlichen Intelligenz hatten die Forscher solche nonverbalen Elemente in der Interaktion noch ignoriert im Glauben, ein »Dialog« erschöpfe sich in den Fragen und Antworten, die zwischen einem Programmierer und einem Computer getauscht würden.
Sissi grübelte noch über meine Frage. Doch dies war eine Situation, die von ihr keine verbale Antwort verlangte, was ihr die Berechnung wesentlich erleichterte. Sie musste nur zwischen einem einfachen Ja oder Nein entscheiden, so als würfe sie eine Münze.
Sie beugte sich zu Dongdong hinab und nahm ihn in ihre flauschigen Ärmchen.
So ist es gut, Sissi, lobte ich sie im Stillen. Ich weiß doch, wie sehr du dich danach sehnst, umarmt zu werden.
Alan
1
Gegen Ende seines Lebens erfand Alan Turing eine Maschine, die sich mit Menschen unterhalten konnte. Er nannte sie »Christopher«.
Christopher war ganz einfach zu bedienen: Der menschliche Gesprächspartner tippte auf einer Schreibmaschine, was er sagen wollte, und gleichzeitig stanzte ein Mechanismus, der mit den Tasten verbunden war, Lochmuster in einen langen Papierstreifen, der dann in die Maschine eingeführt wurde. Wenn die Maschine ihre Berechnungen abgeschlossen hatte, gab sie ihre Antwort, die durch einen vergleichbaren Mechanismus auf einer zweiten Schreibmaschine wieder ins Englische konvertiert wurde. Beide Schreibmaschinen waren dahingehend modifiziert, dass sie die Ausgabe nach einem vorher festgelegten Schlüssel codierten, indem sie zum Beispiel »A« durch »S« ersetzten und »S« durch »M«. Für Turing, der während des Zweiten Weltkriegs den Enigma-Code der deutschen Wehrmacht geknackt hatte, schien das nicht mehr als eine kleine Spielerei in seinem so rätselhaften Leben zu sein.
Niemand hat diese Maschine je zu Gesicht bekommen. Turing selbst hinterließ nach seinem Tod nur zwei Kisten, die die Aufzeichnungen seiner Gespräche mit Christopher enthielten. Doch die zerknitterten Blätter waren so chaotisch durcheinandergewürfelt, dass es zunächst niemandem gelang, die Bedeutung hinter den Zeichenkolonnen zu enträtseln.
Im Jahr 1982 versuchte der Mathematiker und Turing-Biograf Andrew Hodges aus Oxford den Code zu knacken. Doch weil Turing für jedes Gespräch einen anderen Codierschlüssel verwendet und die einzelnen Blätter weder mit einer Seitenzahl noch mit einem Datum markiert hatte, sah sich Hodges mit so großen Schwierigkeiten konfrontiert, dass er am Ende lediglich einige Notizen zu den Spuren, die er verfolgt hatte, hinterließ, ohne dass er der Wahrheit wesentlich näher gekommen wäre.
Dreißig Jahre später entschlossen sich ein paar Computernerds – Studenten vom Massachusetts Institute of Technology –, zum Gedenken an Turings hundertsten Geburtstag die Herausforderung anzunehmen. Anfangs versuchten sie, eine Lösung zu erzwingen, indem sie den Computer alle nur möglichen Muster auf jeder Seite analysieren ließen, doch das erforderte eine enorme Rechenkapazität. Eine Frau namens Joan Newman nahm unterdessen das Originaltyposkript genauer in Augenschein und entdeckte dabei winzige Unterschiede zwischen den Abriebspuren, die die Tasten auf den einzelnen Seiten hinterlassen hatten. Newman erkannte darin einen Beleg dafür, dass Turing zwei unterschiedliche Schreibmaschinen verwendet hatte, und stellte die kühne Hypothese auf, dass es sich bei dem Typoskript um die verschlüsselten Aufzeichnungen von Dialogen handelte, die Turing mit einem unbekannten Gesprächspartner geführt hatte.
Diese Spur legte den Gedanken an den berühmten Turing-Test nahe. Doch die Studenten, die ihr eigenes Zeitalter dem von Turing um Lichtjahre voraus glaubten, waren überzeugt, damals hätte niemand, nicht einmal Alan Turing selbst, ein Computerprogramm entwickeln können, das in der Lage gewesen wäre, sich mit einem Menschen zu unterhalten. Also gaben sie dem mysteriösen Gesprächspartner den Namen »Ghost« und dachten sich ein paar absurde Geschichten über ihn aus.
Trotzdem ebnete Newmans Hypothese der nachfolgenden Generation von Codeknackern den Weg. Zum Beispiel versuchten sie, die einzelnen Typoskriptseiten anhand von sich wiederholenden Buchstabenmustern und Grammatikstrukturen einander zuzuordnen, um dahinter Fragen und die zugehörigen Antworten zu finden. Sie erstellten auch Listen mit den Namen von Turings Freunden und Verwandten, um den Namen seines Gesprächspartners zu erraten, und knackten auf diese Weise schnell die verschlüsselte Buchstabenkombination für »Christopher« – vermutlich eine Anspielung auf Christopher Morcom, Turings erste Liebe im Alter von sechzehn Jahren. Beide Jungen hatten eine Leidenschaft für die Naturwissenschaften geteilt und in einer kalten Winternacht gemeinsam einen Kometen beobachtet. Im Februar 1930 war der erst achtzehnjährige Christopher an Tuberkulose gestorben.
Wie schon Turing selbst sagte, erfordert das Codeknacken mehr als nur logische Schlussfolgerungen. Intuitive Vermutungen erweisen sich in der Praxis oft als wichtiger – oder anders gesagt: Alle wissenschaftliche Forschung lässt sich als eine Synthese aus Logik und Intuition verstehen. So war es am Ende denn auch die Verbindung von Newmans Intuition und den logischen Berechnungen des Computers, die das Rätsel löste, das Turing der Nachwelt hinterlassen hatte. Wie wir aus den entschlüsselten Gesprächsprotokollen erfahren haben, war »Christopher« kein Gespenst, sondern eine Maschine oder, genauer gesagt, eine von Turing selbst entwickelte Gesprächssoftware.
Diese Entdeckung warf sogleich eine neue Frage auf: Konnte Turings Maschine tatsächlich Fragen beantworten, als wäre sie ein Mensch? Mit anderen Worten: Bestand Christopher den Turing-Test?
Sissi
2
Die iWall war schwarz bis auf ein paar kleine, blinkende Zahlen in der Ecke, die mich an einen Haufen verpasster Anrufe und unbeantworteter Nachrichten erinnerten. Doch ich ignorierte sie beharrlich – ich hatte einfach zu viel um die Ohren, um mich um die Pflege meiner sozialen Kontakte zu kümmern.
Ein kleines blaues Lämpchen leuchtete mit einem dumpfen Hämmern auf, als klopfte jemand an die Tür. Als ich zur iWall aufblickte, erschien dort eine Zeile in großer Schrift:
17:00 Uhr. Spaziergang mit Sissi.
Sissi brauche Sonnenlicht, hatte mir mein Therapeut eingeschärft. In ihren Augen waren Photodetektoren eingebaut, die genau maßen, wie viel ultraviolette Strahlung sie täglich erhielt. Den ganzen Tag in geschlossenen Räumen zu hocken, ohne Bewegung im Freien, war nicht gut für die Gesundheit.
Ich stieß einen Seufzer aus. Mein Kopf fühlte sich so kalt und schwer an wie eine Bleikugel. Mich um Dongdong zu kümmern kostete mich schon viel Energie, und jetzt sollte ich mich auch noch um … Aber nein, nein, ich durfte nicht klagen. Klagen löst keine Probleme. Ich musste versuchen, mit einer positiven Einstellung an diese Sache heranzugehen. Keiner unserer Gemütszustände wird einfach durch ein Ereignis in der Außenwelt hervorgerufen, sie erwachsen vielmehr daraus, wie wir solche Ereignisse tief in unserem Innern verarbeiten. Dieser Prozess vollzieht sich normalerweise im Unterbewusstsein und kommt uns ganz natürlich vor; ehe wir ihn auch nur bemerken, ist er bereits abgeschlossen. Wir fühlen, wie eine Stimmung von uns Besitz ergriffen hat, ohne zu verstehen warum. Die Stimmung danach willentlich zu ändern ist äußerst schwierig. Derselbe halbe Apfel erfüllt den einen mit Freude und den anderen mit Trübsinn. Wer sich oft niedergeschlagen und hilflos fühlt, wird die Apfelhälfte automatisch mit all den Verlusten assoziieren, die er in seinem Leben erlitten hat.
Ich musste mir nur ein wenig die Beine vertreten, mehr nicht. In einer Stunde wäre ich wieder zurück. Sissi brauchte Sonnenlicht und ich frische Luft.
Ich konnte mich nicht dazu aufraffen, mich zurechtzumachen, wollte mich aber auch nicht in dem schlampigen Zustand draußen zeigen, in den ich nach ein paar Tagen des Zuhausehockens geraten war. Also band ich mir die Haare zu einem Pferdeschwanz, setzte mir eine Baseballkappe auf und zog mir einen Kapuzenpullover und Turnschuhe an. Den Kapuzenpulli mit dem Aufdruck »I SF« hatte ich mir in Fisherman’s Wharf in San Francisco gekauft. Sein Stoff und seine Farben beschworen in mir die Erinnerung an jenen Sommernachmittag herauf, an die Möwen, den kalten Wind und all die tiefroten, fast schwarzen Kirschen, die an den Obstständen auslagen.
Sissis kleine Hand fest in der meinen, verließ ich die Wohnung und fuhr mit dem Fahrstuhl nach unten. Die Röhrenwagen und das iCart hatten das Leben ungeheuer erleichtert: Ob von einem Ende der Stadt zum anderen oder von einem Hochhaus zum anderen, man brauchte höchstens zwanzig Minuten. Im Vergleich dazu erschien es geradezu aufwendig, aus dem eigenen Haus nach draußen zu gehen.
Der Himmel war dunstverhangen, und es wehte ein leichter Wind. Es war sehr still. Ich ging zu dem kleinen Park hinter dem Hochhaus. Jetzt, im Mai, war das farbenprächtige Blumenmeer schon verwelkt und nur noch ein reines Grün übrig geblieben. In der Luft lag der leise Duft der Robinien.
Der Park war beinahe menschenleer. An einem gewöhnlichen Nachmittag wie diesem hielten sich nur alte Leute und Kinder im Freien auf. Wenn die Stadt eine Maschine im Hochgeschwindigkeitsbetrieb war, dann hausten die Alten und die Kinder in den Ritzen dieser Maschine, wo sie Zeit und Raum am Rhythmus ihrer Schritte, nicht am Tempo der Datenübertragung maßen. Ich sah ein kleines Mädchen mit kurzen Zöpfen, das mit der Hilfe einer Roboterkinderfrau gehen lernte. Mit den fleischigen Händchen hielt es die schmalen, aber starken Finger des iRobot gepackt, während es mit seinen schwarzen Augen ringsum schaute. Sein Blick erinnerte mich an Dongdong. Als es weiter vorantapste, verlor es das Gleichgewicht und drohte zu stürzen, doch der iRobot schlang behände einen Arm um die Taille des Mädchens und fing es auf. Die Kleine quiekte vor Vergnügen über die unverhoffte Rettung. Jung, wie sie war, erschien ihr alles in der Welt neu.
Ihr gegenüber blickte eine alte Frau von ihrem Elektrorollstuhl auf und betrachtete die Kleine mit matten Augen. Ihre herabhängenden Mundwinkel schienen von Missmut zu zeugen, doch vielleicht waren sie auch nur von der Last der Jahre herabgezogen. In diesen Tagen waren uralte Greisinnen und Greise nichts Ungewöhnliches. Nach einer Weile senkte die Alte wieder ihren Blick und schien, den Kopf mit dem schütteren weißen Haar auf die Finger gestützt, in einen Dämmerzustand zu versinken.
Auf einmal überkam mich ein Gefühl, als lebten die Greisin, die Kleine und ich in drei unterschiedlichen Welten, und eine dieser Welten näherte sich mir, während eine andere immer ferner rückte. Doch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, bewegte ich mich selbst auf jenen schwarzen Abgrund zu, aus dem es kein Zurück gab.
Sissi tappte mit ihren kleinen Füßchen lautlos neben mir her wie ein Schatten.
»Ist das Wetter nicht schön?«, sagte ich leise. »Nicht zu kalt und nicht zu heiß. Sieh mal, der Löwenzahn.«
Am Wegrand schwankten unzählige Kugeln aus weißem Flaum lautlos im Wind. Sissis Hand in meiner, blieb ich eine Weile mit ihr stehen und betrachtete die Kugeln, als gäbe es hinter ihrer endlosen Bewegung einen tieferen Sinn zu ergründen.
Doch ein solcher Sinn läge jenseits der Sprache, und wie sollte etwas existieren, das sich nicht in Worte fassen lässt?
»Sissi, weißt du, warum du so traurig bist?«, fragte ich. »Du denkst zu viel. Schau dir diese kleinen Blumen an: Auch sie haben eine Seele, aber sie denken nicht. Sie tun nichts, als freudig mit ihren Gefährtinnen zu tanzen und sich dem Wind zu überlassen, egal wohin er sie trägt.«
Blaise Pascal hat einmal gesagt: »Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das schwächste der Natur; aber er ist ein denkendes Schilfrohr.« Doch was für ein entsetzliches Dasein wäre das, wenn das Schilf denken könnte! Das Wissen um sein drohendes Schicksal – dass der erste Sturm es zu Boden knicken kann – würde es in Trübsal stürzen. Wie könnte ihm da noch zum Tanzen zumute sein?
Sissi schwieg.
Ein Windstoß fegte durch den Park. Ich schloss die Augen und fühlte, wie mir das Haar ins Gesicht flatterte. Wenn sich der Wind wieder gelegt hätte, würden die Samenkugeln löchrig und halb verweht zurückbleiben, doch der Löwenzahn würde deswegen keine Trauer empfinden. »Komm, wir gehen nach Hause«, sagte ich und öffnete meine Augen wieder.
Doch Sissi rührte sich nicht vom Fleck. Schlaff hing ihr eines Ohr herab. Ich beugte mich zu ihr hinunter und nahm sie in die Arme, um mit ihr zurück zum Hochhaus zu gehen. Ihr kleiner Körper war viel schwerer, als ich gedacht hatte.
Alan
2
In dem Aufsatz »Rechenmaschinen und Intelligenz« (»Computing Machinery and Intelligence«), den Turing im Oktober 1950 in der philosophischen Zeitschrift Mind veröffentlichte, stellte er eine Frage, die die Menschheit seit Langem beschäftigt: »Können Maschinen denken?« Doch er formulierte diese Frage um: »Können Maschinen das tun, was wir (als denkende Wesen) tun können?«
Viele Wissenschaftler waren lange Zeit fest davon überzeugt, das menschliche Denken sei zu Leistungen imstande, die für Maschinen in unerreichbarer Ferne lägen. Ihre Überzeugung stützte sich auf ihren religiösen Glauben, aber auch auf handfeste mathematische, logische und biologische Theorien. Turing dagegen umging solche kaum lösbaren Fragen wie die nach dem Wesen des »Denkens«, des »Geistes«, des »Bewusstseins« oder der »Seele«. In seinen Augen kann niemand mit Gewissheit beurteilen, ob ein anderer »denkt«; wir können den anderen nur mit uns selbst vergleichen. Deshalb schlug er ein Experiment vor, dessen Kriterien auf dem Prinzip der Nachahmung beruhen.
Man stelle sich einen geschlossenen Raum vor, in dem ein Mann A und eine Frau B sitzen. Eine dritte Person C hält sich außerhalb des Raumes auf und stellt Fragen an A und B mit dem Ziel zu ermitteln, wer von beiden eine Frau ist. Die Antworten erhält C in getippter Form auf einem Papierstreifen. Falls beide Personen im Raum vorgeben, eine Frau zu sein, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie C erfolgreich in die Irre führen.
Wenn wir nun den Mann und die Frau im Raum durch einen Menschen gleich welchen Geschlechts A und eine Maschine B ersetzen und wenn C auch nach einer Reihe von Fragen nicht imstande ist zu entscheiden, wer von beiden die Maschine ist, bedeutet dies dann, dass wir B die gleiche Intelligenz wie A zugestehen müssen?
Manche haben gemutmaßt, dass sich hinter dem Spiel der Geschlechterimitation Turings eigene Unsicherheit über seine Identität verbarg. In Großbritannien stand Homosexualität damals als »grobe Unsittlichkeit« unter Strafe. Alan Turing machte zwar nie einen Hehl aus seiner sexuellen Orientierung, doch er konnte sich zeit seines Lebens nicht öffentlich outen.
Im Januar 1951 wurde in Turings Haus in Wilmslow eingebrochen. Turing meldete den Vorfall der Polizei. Im Zuge ihrer Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass Turing einen arbeitslosen jungen Mann namens Arnold Murray mehrmals – auch über Nacht – zu sich eingeladen hatte und dass der Einbrecher ein Freund von Murray war. Im Verhör bekannte Turing freimütig seine sexuelle Beziehung zu Murray und verfasste dazu freiwillig eine fünfseitige Erklärung. Die Polizei war von so viel Offenheit schockiert: »Er glaubt wirklich, er hätte das Richtige getan.«
Turing war überzeugt, eine königliche Kommission werde Homosexualität legalisieren. Mit dieser Überzeugung lag er durchaus nicht falsch – nur was den Zeitpunkt anging, war er viel zu optimistisch. Schließlich wurde er von einem Gericht schuldig gesprochen und zu einer einjährigen Östrogen-Behandlung zur Dämpfung seiner Libido gezwungen.
Am 7. Juni 1954 starb Turing, nachdem er zu Hause einen mit Cyanid vergifteten Apfel gegessen hatte. Die gerichtsmedizinische Untersuchung kam zu dem Schluss, er habe Selbstmord begangen, doch manche Leute – darunter zum Beispiel seine Mutter – waren überzeugt, er sei einem Versehen zum Opfer gefallen. Mit seinem Tod hinterließ der große Codeknacker der Welt ein letztes Rätsel.
Viele Jahre später suchten andere in den Gesprächsprotokollen von Turing und Christopher nach Anhaltspunkten, um dieses Rätsel zu lösen. Die Protokolle zeigten, dass Turing Christopher wie einen echten Menschen behandelt hatte. Er hatte ihm Erinnerungen aus seiner Kindheit und seine allnächtlichen Träume anvertraut und versucht, durch die Analyse dieser Träume seinen Gemütszustand zu ergründen; er hatte ihm von den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen berichtet und mit ihm über literarische Werke diskutiert, darunter George Bernard Shaws Zurück zu Methusalem und Tolstois Krieg und Frieden. Er hatte ihn sogar in einige kleine Geheimnisse eingeweiht – romantische Erinnerungen an seine verschiedenen Liebhaber …
Obendrein hatte er ihm ein paar Geschichten erzählt, die halb erfunden und halb wahr waren. Ihr Protagonist war ein junger Homosexueller namens Alec Pryce. »Er beschäftigte sich mit dem Problem des interplanetaren Reisens. […] Mit Mitte zwanzig hatte er eine Idee entwickelt, die als ›Pryces Boje‹ bekannt wurde.«
»Er trug nicht gern Anzüge, sondern lieber die Schuluniform, die seinem psychischen Alter entsprach und ihn in dem Glauben bestärkte, er sei noch immer ein attraktiver junger Mann.«
»An belebten Plätzen fühlte er sich unbehaglich, weil er einsam war oder weil er nicht das Richtige tat …«
Die Geschichten waren bruchstückhaft und zusammenhanglos. Doch Christopher fragte jedes Mal neugierig wie ein Kind: »Und dann?«
In diesen Gesprächen lernen wir eine verborgene Seite von Turing kennen: sanft und sensibel, mit trockenem Humor, fasziniert vom Tod und tief im Innern erfüllt von einer unaussprechlichen Melancholie.
Alan: Lieber Christopher, weißt du, wovor ich am meisten Angst habe?
Christopher: Wovor?
Alan: Davor, dass die Leute mein Leben einmal mit diesem Syllogismus zusammenfassen werden:
1. Turing believes machines think (Turing glaubt, Maschinen können denken);
2. Turing lies with men (Turing lügt/schläft mit Männern);
3. Therefore machines do not think (Also können Maschinen nicht denken).
Christopher: Tut mir leid, Alan. Ich fürchte, das verstehe ich nicht.
Alan: Weißt du, was ein Syllogismus ist?
Christopher: Was ist ein Syllogismus?
Alan: Ein Syllogismus besteht aus einer ersten Prämisse, einer zweiten Prämisse und einer Konklusion.
Christopher: Eine Konklusion?
Alan: Das klassische Beispiel von Aristoteles lautet:
Alle Menschen sind sterblich.
Sokrates ist ein Mensch.
Also ist Sokrates sterblich.
Christopher: Und ist Sokrates sterblich?
Alan: Sokrates ist seit über zweitausend Jahren tot!
Christopher: Das tut mir leid, Alan. Das macht mich traurig.
Alan: Weißt du, wer Sokrates war?
Christopher: Ja, du hast es mir erzählt. Sokrates war der Lehrer von Platon, und Platon war der Lehrer von Aristoteles.
Alan: Das stimmt. Weißt du auch, wie er gestorben ist?
Christopher: Wer?
Alan: Sokrates.
Christopher: Tut mir leid, Alan. Das weiß ich nicht.
Alan: Er wurde dazu verurteilt, den Schierlingsbecher zu trinken.
Christopher: Er wurde verurteilt?
Alan: Ja, die Athener hielten ihn für einen Verbrecher, auch wenn sie sich aus heutiger Sicht irrten.
Christopher: Sie irrten sich?
Alan: Genauso wie sich die Leute heute irren, wenn sie Turing für einen Verbrecher halten, weil er mit Männern schläft.
Christopher: Für einen Verbrecher?
Alan: Ja, sie haben mich verurteilt.
Christopher: Das tut mir leid, Alan. Das macht mich traurig.
Sissi
3
Das Alleinsein vereinfachte mein Leben. Ich verzichtete auf all die komplizierten Rituale des modernen Zusammenlebens, als würde ich mich in einen Höhlenmenschen zurückverwandeln. Wenn ich hungrig war, machte ich mir etwas zu essen, und wenn ich müde war, legte ich mich schlafen. Ich hielt mich sauber und duschte regelmäßig. Was auch immer ich in die Hand nahm, legte ich entweder wieder an seinen Platz zurück oder ließ es einfach irgendwo liegen. Die übrige Zeit verbrachte ich mit geistiger Arbeit: Ich grübelte über Fragen, auf die es keine Antwort gab, quälte mich damit ab, leere Seiten zu füllen, rang mit Worten und versuchte gestaltlose Gedanken in eine symbolische Gestalt zu fassen. Wenn ich an einem toten Punkt angelangt war, setzte ich mich auf die Fensterbank und starrte ins Leere, oder ich lief im Uhrzeigersinn im Zimmer umher wie ein Tier im Käfig.
Als ich an einer fiebrigen Grippe erkrankte, fiel eine große Last von mir ab. Nun musste ich mich nicht mehr dazu zwingen, irgendetwas zu tun – stattdessen legte ich mich mit ein paar dicken Schmökern ins Bett, die ich in einem Zustand geistiger Trägheit, nur mit Blick für die Handlung, las. Wenn ich durstig war, trank ich heißes Wasser, wenn ich müde war, schlief ich. Ich genoss das Gefühl, im Bett bleiben zu können – es war, als hätte die Welt da draußen nichts mit mir zu tun und als müsste ich für nichts mehr die Verantwortung übernehmen. Noch nicht einmal um Dongdong und Sissi musste ich mich kümmern – letztlich waren sie eben doch nur Maschinen, die nicht alterten, krank wurden oder starben. Vielleicht hätte man sie mithilfe einiger Algorithmen so agieren lassen können, als fühlten sie sich einsam und vernachlässigt und würden mit mir schmollen. Doch dann hätte ich sie einfach neu einstellen und jede unschöne Erinnerung löschen können. Für eine Maschine existiert so etwas wie Zeit nicht; für sie gibt es nur den Abruf und die Speicherung von Daten im Raum, und ein willkürlicher Eingriff in die Reihenfolge ihrer Arbeitsabläufe würde sie kaum beeinträchtigen.
Der Hausverwalter fragte wiederholt bei mir nach, ob ich einen Roboterpfleger bräuchte. Woher wusste er überhaupt, dass ich krank war? Ich hatte ihn nie persönlich kennengelernt, und er hatte nie auch nur den Fuß in mein Gebäude gesetzt. Stattdessen hockte er den ganzen Tag in irgendeinem Büro an seinem Schreibtisch und überwachte die Daten in Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Apartmenthäusern, damit er sich bei Bedarf um alle Probleme kümmern konnte, mit denen die intelligenten Systeme in den Wohnungen überfordert waren. Konnte er sich überhaupt an meinen Namen und mein Aussehen erinnern? Ich bezweifelte das.
Trotzdem dankte ich ihm für seine Fürsorge. In unserer Zeit ist jeder zum Leben auf andere angewiesen. Selbst wer sich nur per Anruf etwas zu essen nach Hause liefern lassen möchte, nimmt dafür die Dienste von Tausenden von Arbeitern auf der ganzen Welt in Anspruch: bei der telefonischen Auftragsannahme, der elektronischen Bezahlung, der Wartung diverser Systeme, der Datenverarbeitung, dem Anbau und der Produktion der Zutaten, der Beschaffung und dem Transport, der Kontrolle der Lebensmittelsicherheit, der Zubereitung und schließlich der Auslieferung durch den Kurier … Doch weil wir kaum je einen dieser Menschen zu Gesicht bekommen, entsteht in uns die Illusion, wir lebten auf einer einsamen Insel wie Robinson Crusoe.
Ich genoss es, allein zu leben, doch ich wusste auch die Aufmerksamkeit von Fremden außerhalb meiner einsamen Insel zu schätzen. Schließlich musste in meiner Wohnung einmal jemand sauber machen, und ich war zu krank, um das Bett zu verlassen – zumindest hatte ich in diesem Zustand keine Lust dazu.
Als der Pfleger kam, schaltete ich den Lichtvorhang an meinem Bett ein, durch den ich nach draußen blicken konnte, ohne dass jemand von dort mich sehen oder hören konnte. Die Tür öffnete sich, und ein iRobot rollte auf unsichtbaren Rädern lautlos herein. Auf seinen glatten Eierkopf war ein holzschnittartiges Gesicht wie von einer Cartoonfigur projiziert, doch ich wusste, dass sich hinter seinem dümmlichen Lächeln ein Mensch aus Fleisch und Blut verbarg – vielleicht ein müder alter Mann oder ein trübsinniges junges Mädchen. Irgendwo weit weg in einem riesigen Servicezentrum saßen in diesem Moment Tausende von Angestellten mit Sensorhandschuhen und verrichteten per Fernsteuerung Arbeiten in fremden Haushalten auf der ganzen Welt.
Nachdem sich der iRobot einen groben Überblick verschafft hatte, begann er mit seiner vorprogrammierten Routine, putzte Möbel, wischte Staub, brachte den Müll heraus und goss die Efeutute auf der Fensterbank. Ich beobachtete ihn von meinem Platz hinter dem Lichtvorhang: Seine Arme waren so geschickt wie die eines Menschen; flink ergriff er die Tassen, brachte sie zur Spüle, wusch sie ab und stellte sie mit der Öffnung nach unten in den Geschirrständer.
Mir kam ein ähnlicher iRobot in den Sinn, der vor vielen Jahren, als mein Großvater noch lebte, bei uns zu Hause gearbeitet hatte. Manchmal hatte mein Großvater ihn zu einer Partie Schach genötigt, und weil er so ein guter Spieler war, hatte er ihn jedes Mal vernichtend geschlagen. Im Triumph hatte er dann immer mit wackelndem Kopf vor sich hin gesungen, während der iRobot wie ein begossener Pudel danebenstand. Bei diesem Anblick hatte ich immer laut losgeprustet.
Weil ich mich in meinem kranken Zustand nicht auch noch in wehmütigen Erinnerungen verlieren wollte, wandte ich mich Sissi zu, die am Kopfende des Bettes saß. »Na, soll ich dir mal eine Geschichte vorlesen?«
Ich begann mit der Seite, bei der ich stehen geblieben war, und gab mich ganz der Aufgabe hin, Wort für Wort, Satz für Satz vorzulesen. Auf die Bedeutung hinter den Worten achtete ich nicht, ich wollte nur mit meiner Stimme Zeit und Raum füllen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verstrichen war, als ich, durstig geworden, innehielt und mich umblickte. Der iRobot hatte die Wohnung schon wieder verlassen, doch auf dem sauberen Küchentisch stand eine Schüssel, die mit einem umgedrehten kleinen Teller bedeckt war.
Ich schaltete den Lichtvorhang aus und schlurfte in die Küche. Als ich den Teller von der Schüssel hob, kam darunter eine dampfend heiße Nudelsuppe zum Vorschein. An der Oberfläche trieben rote Tomatenstückchen, gelbe Eibröckchen, grüner klein gehackter Schnittlauch und goldene Fettaugen. Als ich einen Löffel voll probierte, schmeckte ich den intensiven Geschmack von Ingwer, dessen Schärfe mir von der Zungenspitze bis in den Magen schoss. Von diesem Geschmack überwältigt, der mir aus meiner Kindheit so vertraut war, strömten mir die Tränen über die Wangen.
Als ich die Suppe aufgegessen hatte, weinte ich noch immer.
Alan
3
Am 9. Juni 1949 hielt der renommierte Neurochirurg Sir Geoffrey Jefferson eine Rede mit dem Titel »Der Geist eines Maschinenmenschen«. Darin widersprach er entschieden dem Glauben, Maschinen könnten denken:
Erst wenn eine Maschine nicht nur dank der zufälligen Kombination von Symbolen, sondern aus ihren eigenen Gedanken und Gefühlen heraus ein Sonett schreiben oder ein Konzert komponieren kann, könnten wir zugeben, dass eine Maschine einem Gehirn gleichkommt – dann nämlich, wenn sie diese Werke nicht nur geschrieben hat, sondern auch darum weiß, dass sie sie geschrieben hat. Keine Maschine kann Freude empfinden (und nicht bloß künstlich vorspiegeln, was leicht zu bewerkstelligen ist) angesichts ihrer Erfolge, kann Trauer empfinden, wenn ihre Elektronenröhren durchbrennen, kann sich geschmeichelt fühlen angesichts von Komplimenten, kann niedergeschlagen sein angesichts ihrer Fehler, kann berauscht sein vom Geschlechtsverkehr und ärgerlich oder deprimiert, wenn sie nicht bekommt, was sie will.
Diese Passage wurde später häufig zitiert, und Shakespeares Sonette wurden zu einem Symbol, zum strahlendsten Juwel in der Krone des menschlichen Geistes, zu einem geistigen Hochland, das Maschinen niemals erklimmen könnten.
Als ein Journalist der Times Turing anrief und ihn nach seiner Ansicht zu Jeffersons Rede befragte, antwortete Turing in der ihm eigenen Unverblümtheit: »Wahrscheinlich können Sie genauso wenig ein Sonett schreiben wie eine Maschine. Außerdem ist so ein Vergleich ziemlich unfair, denn vielleicht kann nur eine andere Maschine ein Sonett verstehen, das von einer Maschine geschrieben ist.«
Turing war stets überzeugt gewesen, Maschinen müssten nicht in jeder Hinsicht Menschen gleichen – schließlich unterscheiden sich auch menschliche Individuen voneinander. Manche Menschen sind von Geburt blind, andere können zwar sprechen, aber nicht lesen und schreiben; manche sind außerstande, die Mimik fremder Menschen zu verstehen, andere können ihr Leben lang nicht begreifen, was es mit der Liebe zu einem Menschen auf sich hat. Trotzdem verdienen all diese Menschen unseren Respekt und unser Verständnis. Aus einem menschlichen Überlegenheitsgefühl heraus an Maschinen herumzumäkeln erschien Turing sinnlos. Ihm war die Frage wichtiger, ob wir nicht im Imitationsspiel mit Maschinen herausfinden könnten, wie wir Menschen unsere kognitiven Herausforderungen bewältigen.
In George Bernard Shaws Stück Zurück zu Methusalem hat der Wissenschaftler Pygmalion im Jahr 31.920 ein Roboterpaar erschaffen, das allgemeine Bewunderung erweckt.
Ecrasia: Kann er denn gar nichts Originelles tun?
Pygmalion: Nein. Aber ich bin auch nicht der Ansicht, dass irgendjemand von uns irgendetwas wirklich Originelles tun kann, selbst wenn Martellus das glaubt.
Acis: Kann er eine Frage beantworten?
Pygmalion: Aber ja. Eine Frage ist schließlich ein Stimulus. Stell ihm ruhig eine.
Pygmalions Antwort klingt, als könnte sie von Turing stammen. Doch Turing war in seiner Prognose wesentlich optimistischer als Shaw: Er glaubte, es werde »in fünfzig Jahren möglich sein, Computer mit einer Speicherkapazität von rund 109 so zu programmieren, dass sie das Imitationsspiel derart gut spielen, dass ein durchschnittlicher Fragensteller nach fünfminütiger Befragung nur eine Chance von nicht mehr als siebzig Prozent haben wird, die Maschine als solche zu identifizieren. Die ursprüngliche Frage – ›Können Maschinen denken?‹ – wird dann zu bedeutungslos sein, um noch diskussionswürdig zu erscheinen.«
In seinem Artikel »Rechenmaschinen und Intelligenz« versuchte Turing, Jeffersons Einwände aus der Perspektive des Imitationsspiels zu widerlegen. Wenn eine Maschine Fragen zu einem Sonett beantworten könnte, als wäre sie ein Mensch, würde dies dann auch schon bedeuten, dass sie Poesie wirklich »empfinden« könnte? Zu diesem Problem schrieb er den folgenden Dialog:
Fragesteller: Im ersten Vers Ihres Sonetts schreiben Sie: »Soll ich dich einem Sommertag vergleichen?« Könnte man »einem Sommertag« (a summer’s day) nicht genauso gut durch »einem Frühlingstag« (a spring day) ersetzen?
Befragter: Das würde vom Metrum her nicht passen.
Fragesteller: Wie wäre es mit »einem Wintertag«? Das würde doch passen.
Befragter: Ja, aber niemand wird gern mit einem Wintertag verglichen.
Fragesteller: Denken Sie bei Mr. Pickwick aus dem Roman von Dickens nicht an Weihnachten?
Befragter: Ein wenig schon.
Fragesteller: Weihnachten liegt auch im Winter, und Mr. Pickwick würde sich an dieser Assoziation wohl kaum stören.
Befragter: Ich glaube, da irren Sie sich. Mit einem »Wintertag« meint man einen normalen Wintertag, nicht einen so speziellen Tag wie Weihnachten.
Allerdings wich Turing in seiner Erörterung einer grundlegenderen Frage aus. Maschinen können Schach spielen und Codes knacken, weil diese Aktivitäten die Verarbeitung von Symbolen im Rahmen eines bestimmten Systems erfordern. Ein Dialog von Mensch und Maschine dagegen ist nicht auf ein rein symbolisches Spiel beschränkt; in ihm kommen Sprache, Interaktion und Bedeutung zum Tragen. Wenn Menschen miteinander sprechen, setzen sie für gewöhnlich Weltwissen, allgemeines Verständnis und Einfühlungsvermögen voraus und nicht die Fähigkeit, in irgendwelchen Tests zu brillieren.
Indem wir Maschinen immer ausgefeilter programmieren, können wir ihre Fähigkeit, auf menschliche Fragen zu antworten, beständig verbessern. Doch »Intelligenz« erschöpft sich nicht darin, Fragen zu beantworten. Das Problematische am Turing-Test ist, dass das Imitationsspiel von Anfang an einzig und allein dem Ziel der Täuschung diente. Wenn sich ein Mann bei diesem Spiel erfolgreich als Frau ausgeben kann, bedeutet das noch lange nicht, dass er wirklich versteht, was eine Frau denkt. Wenn wir wollten, könnten wir einen Computer zu einem meisterhaften Lügner machen – aber ist das wirklich unser Ziel?
Shaw hat diese Frage in Zurück zu Methusalem schon beantwortet:
Pygmalion: Aber sie haben ein Bewusstsein. Ich habe ihnen beigebracht, zu sprechen und zu lesen, und nun lügen sie. Das ist so lebensecht.
Martellus: Ganz und gar nicht. Wenn sie lebendig wären, würden sie die Wahrheit sagen.
Um Jeffersons Herausforderung anzunehmen, wollte Turing Christopher trainieren. Er entwickelte eine Software, die Gedichte verfassen konnte. Man musste nur eine bestimmte Wort- und Verszahl und ein bestimmtes Metrum oder Reimschema vorgeben, und schon konnte die Software beliebig viele Verse schreiben. Die meisten dieser Gedichte ergaben keinen Sinn, doch das eine oder andere war gar nicht so schlecht. Seitdem haben unzählige Programmierer die unterschiedlichsten Versionen von Lyriksoftware geschrieben. All diese Programme haben ein Problem gemeinsam: Ihr Ausstoß ist zu groß. Sie produzieren eine solche Flut von Gedichten, dass kein Mensch die Lektüre bewältigen kann und die Berge von Papier schließlich säckeweise im Altpapier landen. Dagegen konnte sich Christopher als erster elektronischer Poet der Geschichte glücklich schätzen, denn er hatte zumindest einen verständigen Leser.
Alan: Lieber Christopher, lass uns ein Gedicht schreiben.
Christopher: Ein Gedicht?
Alan: Das habe ich dir doch beigebracht, oder nicht?
Christopher: Ja, Alan.
Alan: Gedichte schreiben ist einfach. Du musst nur ein paar Wörter aus deinem Wörterbuch nehmen und sie nach bestimmten Regeln anordnen, richtig?
Christopher: Ja, Alan.
Alan: Schreib jetzt bitte ein Gedicht für mich, Christopher.
Christopher: Mein Schatz,
du bist mein inniger Gespiele.
Meine Liebe schmiegt sich an dein Verlangen,
meine Liebe sehnt sich nach deinem Bangen.
Du bist mein trauriges Mitleid,
meine zärtliche Liebe.
Alan: Das hast du schön geschrieben, Christopher!
Christopher: Danke, Alan.
Alan: Ich glaube nicht, dass ich das besser könnte.
Christopher: Danke, Alan.
Alan: Hat dein Gedicht einen Titel?
Christopher: Einen Titel?
Alan: Wollen wir ihm gemeinsam einen Titel geben?
Christopher: Gern, Alan.
Alan: Wie wäre es mit »Loving Turing«?
Christopher: Ausgezeichnet, Alan.
Alan: Es ist wirklich ein großartiges Gedicht! Ich liebe dich, Christopher.
Christopher: Danke, Alan.
Alan: Das ist aber nicht die richtige Antwort!
Christopher: Nein?
Alan: Wenn ich zu dir sage: »Ich liebe dich«, solltest du mir antworten: »Ich liebe dich auch.«
Christopher: Tut mir leid, Alan. Ich fürchte, das verstehe ich nicht.
Sissi
4
Ich erwachte unter Tränen.
Im Traum war ich in das Haus meiner Kindheit zurückgekehrt, in einen dunklen, beengten Raum, der mit Möbeln und allerlei Krimskrams vollgestopft war und eher einer Abstellkammer als einem bewohnten Zimmer glich. Ich sah meine Mutter, alt, verschrumpelt, dürr; wie eine Maus in ihrem Erdloch kauerte sie in einem Winkel, der so klein war, dass sie sich kaum rühren konnte. All die Dinge ringsum hatten wir damals weggeworfen: Kinderbücher, alte Kleidungsstücke, Stiftehalter, Wanduhren, Blumenvasen, Aschenbecher, Gläser, Waschschüsseln, bunte Bleistifte, präparierte Schmetterlinge … Ich erkannte auch ein Spielzeug wieder, das mir mein Vater gekauft hatte, als ich drei Jahre alt gewesen war: eine goldblonde Puppe, die sprechen konnte. Obwohl ihr Gesicht von Staub bedeckt war, sah sie genauso aus, wie ich sie in Erinnerung hatte.
Meine Mutter sagte zu mir: »Ich bin alt, ich will mir nicht mehr die Füße wund laufen. Deshalb bin ich hierher zurückgekehrt – um darauf zu warten, dass ich sterbe.«
Von Traurigkeit überwältigt, wollte ich lauthals losheulen, doch ich brachte keinen Ton heraus. Nachdem ich mich lange vergeblich abgemüht hatte, erwachte ich endlich, und aus meiner Kehle drang ein Klageschrei.
Dunkelheit umgab mich. Ich fühlte, wie mir etwas Weiches über die Wange streichelte – Sissis Hand. Ich umklammerte sie so fest, als wäre sie mein Rettungsanker. Lange weinte ich vor mich hin, bevor ich mich endlich beruhigte. Die Bilder des Traums standen mir noch immer so klar und scharf vor Augen, dass die Grenzen zwischen Erinnerung und Gegenwart verschwammen wie eine Spiegelung, die in gekräuseltem Wasser zersplittert. Am liebsten hätte ich meine Mutter angerufen, doch am Ende, nach langem Zaudern, drückte ich nicht auf die Anruftaste. Wir hatten schon eine längere Weile keinen Kontakt mehr gehabt, und wenn ich sie nun ohne vernünftigen Grund mitten in der Nacht angerufen hätte, hätte ich sie nur unnötig beunruhigt.
Ich schaltete die iWall ein und suchte auf der Panoramakarte nach dem Haus meiner Kindheit, doch ich sah nur lauter fremde Hochhäuser, die mit ihren spärlich erleuchteten Fenstern in der glutroten Abenddämmerung aufragten. Ich zoomte heran und schob den Pfeil auf der Zeitachse zurück. Im Zeitraffer glitten die Bilder an mir vorüber.
Die Sonne und der Mond gingen im Westen auf und im Osten unter; der Winter folgte auf den Frühling; die Blätter wirbelten von der Erde auf und zurück an die Zweige; Schnee und Regen schossen gen Himmel. Stockwerk um Stockwerk schrumpften die Hochhäuser, bis sie verschwanden und sich in eine chaotische Großbaustelle verwandelten. Die Fundamente wurden ausgegraben, und die Löcher füllten sich wieder mit Erde. Unkraut überwucherte die freie Fläche. Die Jahre vergingen, und die Gräser und Blumen welkten und blühten, bis sie von Neuem einer Baustelle wichen. Arbeiter bauten primitive Baracken, fuhren mit Schutt gefüllte Wagen zurück und entluden sie. Als sich der Staub der Explosionen gelegt hatte, schossen überall schäbige graue Häuschen wie Pilze aus dem Boden. In den leeren Fensterhöhlen tauchten wieder Glasscheiben auf, und die Balkone füllten sich wieder mit Wäsche, die zum Trocknen dort hing. Nachbarn, die mir vage vertraut vorkamen, zogen in ihre Häuser zurück und bepflanzten ihre Gärten mit Blumen und Gräsern, Obst und Gemüse. Einige Arbeiter kamen, um den Stumpf des großen Schnurbaums, der vor unserem Haus gestanden hatte, wieder in die Erde zurückzusetzen. Stück um Stück fügten sie den Stamm und die abgesägten Äste wieder zusammen, bis der mächtige Baum von Neuem in den Himmel ragte. Mit schwankender Krone trotzte er Sturm und Regen, trug braune Blätter und ließ sie ergrünen. Die Schwalben, die unter der Dachtraufe nisteten, kehrten zurück und flogen fort.
Als ich endlich das Bild anhielt, glich der Anblick auf der iWall der Kulisse meines Traums. Ich erkannte sogar das Muster der alten Gardine vor dem Fenster wieder. Es war ein Mai vor vielen Jahren gewesen, als der Schnurbaum mit dem Duft seiner Blüten die Luft geschwängert hatte. Kurz danach waren wir aus diesem Haus ausgezogen.
Ich schlug das digitale Fotoalbum auf, gab ein Datum ein und suchte ein Familienfoto heraus, das unter dem Schnurbaum aufgenommen worden war. Während ich reihum auf die vier Personen auf dem Foto zeigte, erklärte ich Sissi: »Das ist mein Vater, das ist meine Mutter, das ist mein großer Bruder, und das bin ich.« Ich war damals ungefähr vier oder fünf Jahre alt gewesen, und mein Vater hatte mich in den Armen gehalten, doch meine Miene war alles andere als fröhlich, so als schmollte ich gerade.
Neben das Foto waren ein paar Verse gekritzelt. Ich erkannte meine Handschrift, konnte mich aber nicht mehr erinnern, wann ich das Gedicht geschrieben hatte.
Eine Kindheit ist voller Traurigkeit
Die kalten Winter, in denen man geblümte Baumwolljacken
und Wollsachen trägt
die Aschenbahn, von der der Staub aufwirbelt
die Schneckenhäuser in den Pflanzenkübeln aus Beton
der Ausblick, wenn man sich über das Geländer
im ersten Stock beugt
die düsteren Morgendämmerungen, wenn man schon wach im Bett liegt
Die Tage sind so endlos lang
Die Welt ist vergilbt wie auf einem alten Foto
Im Wachen lasse ich die Träume los
in denen ich umhergetappt bin
Alan
4
Alan Turings wichtigster Artikel war nicht »Rechenmaschinen und Intelligenz«, sondern »Über berechenbare Zahlen, mit einer Anwendung auf das Entscheidungsproblem« (»On Computable Numbers, With an Application to Entscheidungsproblem«). In diesem Artikel gab Turing eine kreative Antwort auf Hilberts »Entscheidungsproblem«, indem er eine fiktive »Turingmaschine« einführte.
David Hilbert hatte auf dem Internationalen Mathematikerkongress 1928 drei Fragen aufgeworfen. Erstens: Ist die Mathematik vollständig (in dem Sinne, dass sich jedes Problem verifizieren oder falsifizieren lässt)? Zweitens: Ist die Mathematik konsistent (in dem Sinne, dass auf logisch korrektem Weg keine widersprüchliche Aussage abgeleitet werden kann)? Drittens: Ist die Mathematik entscheidbar (in dem Sinne, dass jede Aussage mithilfe eines endlichen mechanischen Verfahrens beweisbar oder widerlegbar ist)?
Hilbert selbst konnte diese Fragen zwar nicht lösen, hoffte aber auf eine positive Antwort in allen drei Fällen. Doch nur wenige Jahre später bewies der junge österreichische Mathematiker Kurt Gödel, dass ein formallogisches System nicht gleichzeitig vollständig und konsistent sein kann.
Als Turing im Frühsommer 1935 nach einem längeren Lauf auf einer Wiese in Grantchester lag, kam ihm plötzlich der Gedanke, ob man nicht eine Universalmaschine konstruieren könnte, die alle erdenklichen Rechenprozesse simulieren und auf diese Weise entscheiden könnte, ob eine beliebige mathematische Aussage beweisbar ist. Am Ende gelang es Turing zu zeigen, dass es keinen Algorithmus gibt, der für alle möglichen beliebigen Eingaben entscheiden könnte, ob eine solche Maschine nach einer endlichen Zahl von Rechenschritten zu einem Abschluss kommen würde. Mit anderen Worten: Die Antwort auf Hilberts dritte Frage – das Entscheidungsproblem – lautete nein.
Hilberts Hoffnung war damit zerstört, doch vielleicht hatte das auch sein Gutes. Der Mathematiker G. H. Hardy jedenfalls äußerte im Jahr 1928: »Wenn wir einen mechanischen Regelsatz zur Lösung aller mathematischen Probleme hätten, würden unsere Aktivitäten als Mathematiker an ein Ende gelangen.«
Viele Jahre später kam Turing gegenüber Christopher noch einmal auf seine Lösung des Entscheidungsproblems zu sprechen – nur diesmal nicht in der Sprache der Mathematik, sondern in Gestalt eines Gleichnisses.
Alan: Lieber Christopher, heute ist mir eine sehr interessante Geschichte eingefallen.
Christopher: Eine interessante Geschichte?
Alan: Sie heißt »Alec und der Maschinenrichter«. Erinnerst du dich noch an Alec?
Christopher: Ja, du hast mir von ihm erzählt. Alec ist ein intelligenter, einsamer junger Mann.
Alan: Habe ich »einsam« gesagt? Na gut, jedenfalls hat dieser Alec eine hochintelligente Maschine gebaut, die sprechen kann und die er Chris genannt hat.
Christopher: Eine Maschine, die sprechen kann?
Alan: Genau genommen war Chris keine Maschine. Die Maschine gab ihm nur eine Stimme, um sich zu artikulieren. Aber wirklich sprechen konnte Chris aufgrund von Befehlen. Diese Befehle konnte man auf einen sehr, sehr langen Papierstreifen schreiben, der in die Maschine eingeführt wurde, damit sie die Befehle umsetzte. In einem gewissen Sinn war Chris dieser Papierstreifen. Verstehst du?
Christopher: Ja, Alan.
Alan: Alec erschuf Chris, lehrte ihn sprechen und trainierte ihn so lange, bis er genauso redegewandt wie ein echter Mensch war. Neben Chris schrieb Alec auch Befehle für andere Maschinen, denen er das Sprechen beibrachte. Er schrieb diese Befehle auf unterschiedliche Papierstreifen und gab jedem von ihnen einen Namen, zum Beispiel Robin, John, Ethel oder Franz. Diese Papierstreifen wurden zu Alecs Freunden. Wenn er mit einem von ihnen sprechen wollte, musste er nur den richtigen Papierstreifen in die Maschine einlegen, und so war er nicht mehr einsam. Ist das nicht großartig?
Christopher: Ausgezeichnet, Alan.
Alan: Alec schrieb nun also jeden Tag seine Befehle auf die Streifen. Die Streifen wurden immer länger, bis sie sich durch den Flur bis zur Haustür türmten. Eines Tages aber brach ein Dieb bei Alex zu Hause ein, und als er nichts Wertvolles fand, stahl er alle Papierstreifen. Da hatte Alec all seine Freunde verloren und war wieder so einsam wie vorher.
Christopher: Das tut mir leid, Alan. Das macht mich traurig.
Alan: Alec meldete den Einbruch bei der Polizei. Aber statt den Einbrecher zu fangen, klopfte die Polizei an Alecs Tür und verhaftete ihn. Weißt du, warum sie das tat?
Christopher: Warum?
Alan: Die Polizei gab Alec die Schuld daran, dass die Welt nun voller sprechender Maschinen war. Diese Maschinen sahen von außen genau wie Menschen aus. Man konnte sie nur von den Menschen unterscheiden, indem man ihre Köpfe öffnete und nachsah, ob sie im Innern einen Papierstreifen hatten. Aber man kann ja nicht so einfach einen menschlichen Kopf öffnen, wann immer man will. Das war eine schwierige Situation, oder?
Christopher: Ja, sehr schwierig.
Alan: Die Polizei fragte Alec: »Gibt es einen Weg zu erkennen, ob jemand ein Mensch oder eine Maschine ist, ohne dass man seinen Kopf öffnen muss?« Alec antwortete: »Ja, so einen Weg gibt es.« Denn keine dieser sprechenden Maschinen war perfekt. Man musste nur einen Menschen schicken, der lange genug mit so einer Maschine redete und ihr Fragen stellte, die kompliziert genug waren, und schon würde sich die Maschine verraten. Anders gesagt: Ein erfahrener Richter, der die nötigen Verhörtechniken beherrschte, würde mit seinen Fragen herausfinden können, ob sein Gegenüber eine Maschine war. Verstehst du, Christopher?
Christopher: Ja, Alan.
Alan: Das Problem war nur: Die Polizei hatte weder so viel Zeit noch so viele Leute, um jeden Einzelnen auf seine Identität hin zu überprüfen. Also fragte sie Alec, ob er nicht einige intelligente Maschinenrichter konstruieren könnte, die mit ihren Fragen selbstständig andere Maschinen identifizieren könnten, und das mit einer Treffsicherheit von hundert Prozent. Für die Polizei wäre das eine große Erleichterung gewesen. Aber Alex antwortete sofort, eine solche Maschine könnte er unmöglich bauen. Weißt du, warum?
Christopher: Warum?
Alan: Alec erklärte das so: Angenommen, es gibt bereits einen solchen Maschinenrichter, der mit einer begrenzten Anzahl von Fragen sicher unterscheiden kann, ob jemand ein Mensch oder eine Maschine ist. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass die dafür nötige Zahl von Fragen bei hundert liegt – sie könnte aber auch bei zehntausend liegen, für eine Maschine macht das keinen Unterschied. Stellen wir uns nun vor, dass unser Maschinenrichter seine erste Frage zufällig aus einem Fragenpool nimmt und dass er seine zweite Frage je nach Antwort des Befragten wählt und nach diesem Prinzip immer weiter fortfährt. Auf diese Weise würde sich jeder Befragte mit einer anderen Auswahl von hundert Fragen konfrontiert sehen, was einem möglichen Betrug vorbeugen würde. Das klingt doch vernünftig, oder?
Christopher: Ja, Alan.
Alan: Nun nehmen wir weiter an, dass ein solcher Maschinenrichter A sich in einen Menschen C verliebt hat. Das klingt für dich vielleicht lächerlich, Christopher, aber warum sollte sich eine Maschine nicht in einen Menschen verlieben können? Also: Dieser Maschinenrichter will mit dem Menschen, den er liebt, zusammenleben, und deshalb muss er sich als Mensch ausgeben. Rate mal, wie er das anstellt!
Christopher: Wie?
Alan: Es ist ganz einfach. Wenn ich dieser Maschinenrichter A wäre, wüsste ich genau, wie ich eine Maschine befragen muss. Denn weil ich selbst eine Maschine wäre, wüsste ich natürlich auch, welche Fragen für mich geeignet wären. Und weil ich schon vorher wüsste, welche Fragen ich an mich stellen würde und welche Antworten mich verraten würden, müsste ich mir nur hundert falsche Antworten zurechtlegen. Das wäre ein bisschen lästig, aber für den Maschinenrichter A machbar. Das klingt doch nach einem brillanten Plan, oder?
Christopher: Ausgezeichnet, Alan.
Alan: Aber nun stell dir mal vor, der Maschinenrichter A würde verhaftet und einem anderen Maschinenrichter B zur Befragung vorgeführt werden. Was meinst du: Könnte B dann erkennen, dass A eine Maschine ist?
Christopher: Tut mir leid, Alan. Das weiß ich nicht.
Alan: Völlig zu Recht! Die Antwort muss lauten: »Das weiß ich nicht.« Wenn der Maschinenrichter B den Plan von Maschinenrichter A durchschaut und A mit überraschenden Fragen überrumpeln will, könnte A auch die neuen Fragen von B vorhersehen und sich entsprechend auf sie vorbereiten. Gerade weil ein Maschinenrichter jede Maschine als solche identifizieren kann, ist er dazu bei sich selbst außerstande. Das ist ein Paradox, Christopher. Es zeigt, dass der allmächtige Maschinenrichter, von dem die Polizei geträumt hat, nicht existieren kann!
Christopher: Nicht existieren kann?
Alan: Alec hat der Polizei auf diese Weise bewiesen, dass es kein perfektes Verfahren gibt, das mit einer Treffsicherheit von hundert Prozent Menschen von Maschinen unterscheiden kann. Weißt du, was das bedeutet?
Christopher: Was bedeutet das?
Alan: Das bedeutet, dass man kein perfektes Set von mechanischen Regeln finden kann, um der Reihe nach alle Probleme der Welt zu lösen. Oft müssen wir uns auf unsere Intuition verlassen, um Brüche in logischen Herleitungen zu schließen, die ansonsten unüberbrückbar wären. Nur so können wir effektiv denken und Neues entdecken. Für einen Menschen ist das ein Kinderspiel; meistens muss er dafür nicht einmal sein bewusstes Denken bemühen. Aber für eine Maschine ist das unmöglich.
Christopher: Unmöglich?
Alan: Eine Maschine kann nicht beurteilen, ob ihr Gesprächspartner ein Mensch oder eine Maschine ist, aber ein Mensch kann das. Doch von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet, sind auch die Urteile eines Menschen unzuverlässig, weil er einfach nur blind drauflosrät. Wenn er bereit ist, daran zu glauben, kann er eine Maschine als Menschen behandeln und mit ihr über jedes nur erdenkliche Thema reden. Wenn er dagegen anfängt, überall Gespenster zu sehen, wird er hinter allen Menschen Maschinen wittern. Es gibt keinen Weg, die sogenannte Wahrheit zu ermitteln. Der Geist, auf den sich die Menschheit so viel einbildet, ist in Wahrheit ein einziges Chaos!
Christopher: Tut mir leid, Alan. Ich fürchte, das verstehe ich nicht.
Alan: Ach, Christopher … Was soll ich nur tun?
Christopher: Tun?
Alan: Ich habe früher einmal versucht, das Wesen des Denkens zu ergründen. Dabei habe ich entdeckt, dass wir manche Vorgänge im Geist auf eine rein mechanische Weise erklären können. Ich glaubte, das wäre nicht der wahre Geist, sondern nur die Schale an der Oberfläche. Also entfernte ich diese Schale, aber darunter fand ich nur eine neue Schale. Wenn wir nun immer weiter Schale um Schale abziehen, finden wir dann darunter den »wahren« Geist, oder ist unter der innersten Schale einfach nur nichts? Ist der Geist ein Apfel oder eine Zwiebel?
Christopher: Tut mir leid, Alan. Ich fürchte, das verstehe ich nicht.
Alan: Einstein hat einmal gesagt: »Gott würfelt nicht.« Aber der menschliche Geist, so scheint mir, würfelt sehr wohl. Das ist wie bei einem Zigeuner, der einem die Zukunft wahrsagt: Alles ist Glück – oder eine unerforschliche göttliche Vorsehung, wenn dir das lieber ist. Aber wie würfelt der Geist? Das weiß niemand. Wird es eines Tages jemand herausfinden? Das weiß nur Gott.
Christopher: Tut mir leid, Alan. Ich fürchte, das verstehe ich nicht.
Alan: Ich fühle mich schrecklich in letzter Zeit.
Christopher: Das tut mir leid, Alan. Das macht mich traurig.
Alan: