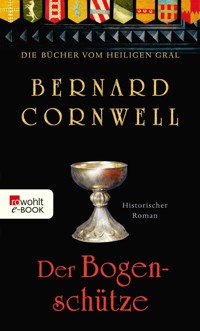
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Bücher vom Heiligen Gral
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
«Das ist spektakulär und verdammt gut: Krieg und Folter, Liebe, Lust und Verlust.» (The Times) Am Ostermorgen 1342 wird ein englisches Küstendorf von vier französischen Schiffen überfallen, angeführt von einem geheimnisvollen schwarzen Ritter, der sich «Harlekin» nennt. Schnell brennt der ganze Ort, und aus der Kirche wird ein Schatz gestohlen: eine alte Lanze, sie soll Sankt Georg gehört haben, dem Schutzheiligen der englischen Könige. Als einer der wenigen überlebt der Sohn des Pfarrers, der ihm im Sterben verrät: Der Mann in Schwarz ist ein Verwandter. Thomas schwört, den Frevel zu rächen. Doch er ahnt nicht, wie sehr sein Schicksal mit dem des Harlekins verbunden ist und wie gefährlich seine Reise wird. Denn der Feind scheint die mächtigste Waffe des Christentums zu besitzen: den Heiligen Gral. Der Auftakt einer großen Mittelalter-Trilogie vom Meister des historischen Romans. «Das Buch ist randvoll mit tollen Figuren und aufregenden Szenen und bestätigt ein weiteres Mal Cornwells Ruf als Meister des historischen Romans.» (Daily Mail)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Ähnliche
Bernard Cornwell
Die Bücher vom Heiligen Gral. Der Bogenschütze
Historischer Roman
Über dieses Buch
«Das ist spektakulär und verdammt gut: Krieg und Folter, Liebe, Lust und Verlust.» (The Times)
Am Ostermorgen 1342 wird ein englisches Küstendorf von vier französischen Schiffen überfallen, angeführt von einem geheimnisvollen schwarzen Ritter, der sich «Harlekin» nennt. Schnell brennt der ganze Ort, und aus der Kirche wird ein Schatz gestohlen: eine alte Lanze, sie soll Sankt Georg gehört haben, dem Schutzheiligen der englischen Könige. Als einer der wenigen überlebt der Sohn des Pfarrers, der ihm im Sterben verrät: Der Mann in Schwarz ist ein Verwandter. Thomas schwört, den Frevel zu rächen. Doch er ahnt nicht, wie sehr sein Schicksal mit dem des Harlekins verbunden ist und wie gefährlich seine Reise wird. Denn der Feind scheint die mächtigste Waffe des Christentums zu besitzen: den Heiligen Gral.
Der Auftakt einer großen Mittelalter-Trilogie vom Meister des historischen Romans.
«Das Buch ist randvoll mit tollen Figuren und aufregenden Szenen und bestätigt ein weiteres Mal Cornwells Ruf als Meister des historischen Romans.» (Daily Mail)
Impressum
Die Originalausgaben erschienen 2001 unter dem Titel «Harlequin» bei HarperCollins, London, und unter dem Titel «The Archer’s Tale» bei HarperCollins, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © der deutschen Übersetzung von Claudia Feldmann by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2004/Ullstein Verlag
«Harlequin», «The Archer’s Tale» Copyright © 2001 by Bernard Cornwell
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung thinkstockphotos.de; Angelo Hornak/Kontributor/Getty Images; Photo Scala, Florence
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen
ISBN Printausgabe 978-3-499-25833-6 (2. Auflage 2012)
ISBN E-Book 978-3-644-45911-3
www.rowohlt.de
Der Bogenschütze ist für Richard und Julie Rutherford-Moore
«… viele tödliche Schlachten wurden geschlagen, Menschen wurden niedergemetzelt, Kirchen ausgeraubt, Seelen zerstört, junge Frauen und Mädchen entjungfert, wohlanständige Ehefrauen und Witwen entehrt; Städte, Adelssitze und Häuser wurden niedergebrannt, und auf den Straßen drohten Raub, Grausamkeiten und Hinterhalte. Angesichts dieser Taten ist die Gerechtigkeit gescheitert. Der christliche Glaube ist verdorrt, der Handel versiegt, und so viel anderes Übel ist aus diesen Kriegen erstanden, dass es weder in Worte gefasst noch aufgezählt noch niedergeschrieben werden kann.»
Johann der Gute, König von Frankreich, 1360
Prolog
Der Schatz von Hookton wurde am Ostermorgen des Jahres 1342 gestohlen.
Es war ein Heiligtum, eine Reliquie, die an den Dachbalken der Kirche hing, und es war höchst ungewöhnlich, dass ein so kostbares Objekt in einem so unbedeutenden Dorf aufbewahrt wurde. Manche Leute sagten, es habe dort nichts zu suchen, es gehöre in einen Schrein in einer Kathedrale oder einer großen Abtei, während andere, viele andere, meinten, es sei gar nicht echt. Nur Dummköpfe leugneten, dass Reliquien gefälscht wurden. Glattzüngige Männer zogen über Englands Nebenstraßen und verkauften ausgebleichte Knochen, die angeblich von den Fingern oder Zehen oder Rippen irgendwelcher Heiliger stammten, und manchmal stammten die Knochen sogar von Menschen, meistens jedoch von Schweinen, aber dennoch kaufte das Volk sie und betete zu ihnen. «Sollen die Leute doch zum heiligen Guinefort beten», sagte Vater Ralph mit spöttischem Lachen. «Sie beten zu Schinkenknochen, zu Schinkenknochen! Zum heiligen Schwein!»
Vater Ralph war derjenige, der den Schatz nach Hookton gebracht hatte, und er wollte nichts davon wissen, ihn in eine Kathedrale oder Abtei bringen zu lassen. Daher hing er nun seit acht Jahren in der kleinen Kirche und sammelte Staub und Spinnweben, die silbern glitzerten, wenn die Sonne durch das hohe Fenster des Westturms fiel. Spatzen hockten auf dem Schatz, und an manchen Morgen hingen Fledermäuse von seinem Schaft. Er wurde selten gereinigt und so gut wie nie heruntergeholt. Nur manchmal befahl Vater Ralph, eine Leiter zu holen und den Schatz von den Ketten zu lösen, an denen er hing, und dann betete er bei ihm und strich mit der Hand darüber. Er prahlte nie damit. Andere Kirchen oder Klöster hätten eine solche Kostbarkeit dazu genutzt, Pilger anzulocken, doch Vater Ralph wimmelte Besucher ab. «Das ist bloß Tand», sagte er, wenn ein Fremder ihn auf die Reliquie ansprach. «Vollkommen wertlos.» Wenn die Besucher nicht lockerließen, wurde er wütend. «Es ist Tand, wertloser Tand!» Vater Ralph war schon einschüchternd genug, wenn er nicht wütend war, aber wenn sein Gemüt sich erhitzte, wurde er zu einem wilden Dämon, und sein lodernder Zorn beschützte den Schatz, obgleich Vater Ralph der Ansicht war, sein bester Schutz sei Unwissenheit, denn wenn die Menschen nichts über ihn wussten, würde Gott ihn bewachen. Und das tat Er auch eine Zeitlang.
Hooktons Abgelegenheit trug viel zu diesem Schutz bei. Das winzige Dorf lag an Englands Südküste, wo die Lipp, ein kleiner Fluss, über einen Kiesstrand ins Meer floss. Ein halbes Dutzend Fischerboote liefen von dort aus, des Nachts geschützt vom «Hook», einer Felszunge, die sich um den letzten Abschnitt der Lipp schlang. Allerdings war das Meer bei dem berühmten Sturm von 1322 über den Hook hinweggepeitscht und hatte alle Boote auf dem oberen Strandabschnitt zertrümmert. Das Dorf hatte sich von diesem Schicksalsschlag nie so recht erholt. Vor dem Sturm waren neunzehn Boote vom Hook ausgelaufen, doch nun, zwanzig Jahre später, zogen nur noch sechs kleine Kähne über die Wellen jenseits der gefährlichen Sandbank der Lipp. Die übrigen Dorfbewohner arbeiteten in den Salzpfannen oder hüteten Schafe und Rinder auf den Hügeln hinter der Ansammlung von strohgedeckten Hütten, die sich um die kleine Kirche drängten. Das war Hookton: ein Ort mit Booten, Fisch, Salz und Vieh, dahinter grüne Hügel, in seiner Mitte Ahnungslosigkeit und davor das weite Meer.
Wie jeder andere Ort der Christenheit hielt auch Hookton vor dem Osterfest eine Nachtwache ab, und in jenem Jahr 1342 wurde diese feierliche Pflicht von fünf Männern absolviert, die zusahen, wie Vater Ralph die Ostersakramente weihte und das Brot und den Wein dann auf den weiß geschmückten Altar legte. Die Oblaten lagen in einer schlichten Tonschale, bedeckt mit einem weißen Leintuch, während der Wein sich in einem silbernen Becher befand, der Vater Ralph gehörte. Dieser Becher war Teil seines Geheimnisses. Vater Ralph war sehr groß, fromm und viel zu gelehrt, um ein einfacher Dorfpfarrer zu sein. Es ging das Gerücht, er hätte Bischof werden können, aber der Teufel habe ihn mit bösen Träumen heimgesucht, und die Leute wussten, dass man ihn, bevor er nach Hookton gekommen war, in der Zelle eines Mönchsklosters eingesperrt hatte, weil er von Dämonen besessen war. Im Jahr 1334 hatten die Dämonen ihn verlassen, und er wurde nach Hookton geschickt, wo er die Dorfleute damit erschreckte, dass er den Möwen predigte oder am Strand auf und ab ging, seine Sünden beweinte und sich die Brust mit scharfkantigen Steinen einritzte. Er heulte wie ein Hund, wenn die Schlechtigkeit zu schwer auf seinem Gewissen lastete, aber er fand in dem abgelegenen Dorf auch eine Art Frieden. Er baute sich ein großes Holzhaus, in das er mit seiner Haushälterin einzog, und er freundete sich mit Sir Giles Marriott an, der der Lord von Hookton war und in einem Herrenhaus drei Meilen nördlich des Dorfes wohnte.
Sir Giles war natürlich ein Edelmann, und das war Vater Ralph anscheinend auch, trotz seiner wilden Mähne und der wütenden Stimme. Er sammelte Bücher, und die waren neben dem Schatz, den er in die Kirche gebracht hatte, das größte Wunder von Hookton. Manchmal, wenn er seine Tür offen ließ, kamen die Leute und starrten neugierig die siebzehn ledergebundenen Exemplare an, die auf dem Tisch lagen. Die meisten waren in Latein verfasst, aber ein paar auch auf Französisch, der Muttersprache von Vater Ralph. Nicht das Französisch Frankreichs, sondern das der Normannen, die Sprache der Herrscher Englands, und die Dorfleute nahmen an, ihr Pfarrer müsse von edler Geburt sein, obwohl niemand es wagte, ihn direkt zu fragen. Sie hatten alle Angst vor ihm, aber er erfüllte seine Pflichten ihnen gegenüber; er taufte sie, verheiratete sie, nahm ihnen die Beichte ab, erteilte ihnen Absolution, las ihnen die Leviten und beerdigte sie, aber er verbrachte seine Zeit nicht mit ihnen. Er ging allein umher, mit grimmiger Miene, wild zerzaustem Haar und finsterem Blick, aber die Dorfbewohner waren trotzdem stolz auf ihn. In den meisten ländlichen Kirchen hockten träge, teiggesichtige Pfarrer, die kaum gebildeter waren als ihre Gemeindemitglieder, aber Hookton besaß mit Vater Ralph einen richtigen Gelehrten, zu gebildet, um sich unters Volk zu mischen, vielleicht ein Heiliger, vielleicht von edler Abstammung, ein selbst erklärter Sünder, möglicherweise verrückt, aber unleugbar ein echter Priester.
Vater Ralph segnete die Sakramente und warnte die fünf Männer, in der Nacht vor Ostern gehe Luzifer um, und der habe nur eines im Sinn, nämlich die heiligen Sakramente vom Altar zu stehlen, sie müssten also das Brot und den Wein sorgsam bewachen. Nachdem der Priester die Kirche verlassen hatte, blieben sie auch eine Weile pflichtbewusst auf den Knien und sahen zu dem silbernen Becher hinüber, in den ein Wappen geprägt war. Das Wappen zeigte ein Fabelwesen, einen Greif, der einen Kelch in den Klauen hielt, und dieses edle Gerät nahmen die Dorfeinwohner als Beweis, dass Vater Ralph tatsächlich ein hochgeborener Mann war, den seine Besessenheit in die Tiefe gerissen hatte. Der silberne Becher schimmerte im Licht zweier dicker Kerzen, die die ganze lange Nacht hindurch brennen würden. Die meisten Dörfer konnten sich keine richtigen Osterkerzen leisten, aber Vater Ralph erstand jedes Jahr zwei von den Mönchen in Shaftesbury, und die Dorfbewohner schlichen sich in die Kirche, um sie anzuschauen. Doch in dieser Nacht, nachdem die Dunkelheit hereingebrochen war, sahen nur die fünf Männer die hohen, reglos brennenden Flammen.
In den größeren Kirchen des Christentums hielten Ritter diese alljährliche Nachtwache ab. Sie knieten in voller Rüstung, ihre Waffenröcke bestickt mit steigenden Löwen, niederstoßenden Falken, Axtblättern und Adlern mit ausgebreiteten Flügeln, die Helme mit Federbüschen verziert. Doch in Hookton gab es keine Ritter, und nur der jüngste der Männer, der Thomas hieß und ein Stück abseits der anderen vier saß, hatte eine Waffe. Es war ein altes, stumpfes und leicht rostiges Schwert.
«Glaubst du, das alte Ding wird dem Teufel Angst einjagen?», fragte John.
«Mein Vater hat gesagt, ich soll es mitbringen.»
«Was will dein Vater mit einem Schwert?»
«Er wirft nie etwas weg, das weißt du doch», sagte Thomas und wog das Schwert in der Hand. Es war schwer, aber er hob es mit Leichtigkeit; mit seinen achtzehn Jahren war er groß und sehr kräftig. Die Leute in Hookton mochten ihn, denn obwohl er der Sohn des reichsten Mannes im Ort war, arbeitete er hart. Er liebte nichts so sehr wie einen Tag auf See, wo er die geteerten Netze einholte, die seine Hände aufrissen. Er wusste, wie man ein Boot führte, und war kräftig genug, um ordentlich zu rudern, wenn der Wind ihn im Stich ließ; er konnte Fallen stellen, mit dem Bogen schießen, ein Grab ausheben, ein Kalb verschneiden, ein Dach mit Stroh decken oder den ganzen Tag Heu ernten. Er war ein hochgewachsener, knochiger, schwarzhaariger Landjunge, aber Gott hatte ihm einen Vater gegeben, der wollte, dass Thomas nach Höherem strebte. Sein Sohn sollte Priester werden, und daher hatte Thomas gerade sein erstes Semester in Oxford absolviert.
«Was machst du da in Oxford?», fragte Edward ihn.
«Lauter nutzloses Zeug», sagte Thomas. Er strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, das ebenso hager war wie das seines Vaters. Er hatte leuchtend blaue Augen mit ein wenig schweren Lidern, ein ausgeprägtes Kinn und ein schnell aufblitzendes Lächeln. Die Mädchen im Dorf fanden ihn gut aussehend.
«Gibt’s in Oxford auch Mädels?», fragte John mit anzüglichem Grinsen.
«Mehr als genug», erwiderte Thomas.
«Erzähl das lieber nicht deinem Vater», meinte Edward, «sonst kriegst du wieder eins übergezogen. Sehr geschickt mit der Peitsche, der Alte.»
«Das kannst du laut sagen», stimmte Thomas ihm zu.
«Er will nur dein Bestes», sagte John. «Das kann man einem Vater doch nicht verübeln.»
Und ob Thomas es ihm verübelte. Er hatte es ihm immer verübelt. Jahrelang hatte er mit seinem Vater gestritten, und nichts brachte den Zorn zwischen ihnen so zum Kochen wie Thomas’ Vorliebe fürs Bogenschießen. Der Vater seiner Mutter war Bogenschütze im Weald gewesen, und Thomas hatte bei seinem Großvater gelebt, bis er fast zehn gewesen war. Dann war sein Vater mit ihm nach Hookton gegangen, wo Thomas den Jäger von Sir Giles Marriott kennengelernt hatte, der ebenfalls ein hervorragender Bogenschütze war, und der Jäger war sein neuer Lehrer geworden. Mit elf Jahren hatte Thomas seinen ersten Bogen angefertigt, doch als die Waffe aus Eibenholz seinem Vater unter die Augen gekommen war, hatte er sie über seinem Knie zerbrochen und mit den Überresten seinen Sohn verprügelt. «Du bist kein einfacher Mann», hatte sein Vater gebrüllt und mit den zersplitterten Holzleisten auf seinen Rücken, Kopf und Beine eingedroschen, doch weder die Worte noch die Schläge hatten irgendetwas genützt. Und da Thomas’ Vater meist mit anderen Dingen beschäftigt war, hatte der Junge Zeit genug, seiner Begeisterung nachzugehen.
Mit fünfzehn war er ein ebenso guter Bogenschütze wie sein Großvater und hatte ein instinktives Gespür dafür, wie er einen Eibenstock formen musste, sodass die Innenseite aus dem dichten Kernholz bestand, die Außenseite hingegen aus dem elastischeren Splintholz, denn wenn der Bogen gespannt wurde, versuchte das Kernholz stets, in die Gerade zurückzukehren, und das Splintholz war der Muskel, der dies ermöglichte. Für Thomas’ wachen Geist vereinte ein guter Bogen in sich Eleganz, Schlichtheit und Schönheit. Mit seiner Glätte und Kraft war ein guter Bogen wie ein flacher Mädchenbauch, und in jener Nacht, als Thomas in der Kirche von Hookton die Osterwache absolvierte, musste er an Jane denken, die in dem kleinen Wirtshaus des Dorfes bediente.
John, Edward und die beiden anderen Männer hatten über Dorfgeschehnisse gesprochen: die Lammpreise auf dem Markt von Dorchester, den alten Fuchs auf dem Lipp Hill, der in einer einzigen Nacht eine ganze Schar Gänse gerissen hatte, und den Engel, der über den Dächern von Lyme gesehen worden war.
«Die haben bestimmt zu tief ins Glas geschaut», sagte Edward.
«Ich seh auch Engel, wenn ich saufe», meinte John.
«Du meinst Jane, was?», erwiderte Edward. «Sieht wirklich aus wie ’n Engel, die Kleine.»
«Benimmt sich aber nicht so», sagte John. «Das Mädel ist nämlich schwanger.» Und alle vier Männer richteten ihre Blicke auf Thomas, der mit Unschuldsmiene zu dem Schatz unterm Kirchendach hinaufschaute. In Wirklichkeit fürchtete Thomas, dass das Kind tatsächlich von ihm war, und hatte eine Heidenangst, was sein Vater sagen würde, wenn er davon erfuhr, doch in dieser Nacht tat er so, als wüsste er nichts von Janes Schwangerschaft. Er sah nur zu dem Schatz hinauf, der halb von einem Fischernetz verdeckt wurde, das zum Trocknen aufgehängt worden war, während die vier älteren Männer nach und nach eindösten. Ein kalter Luftzug ließ die beiden Kerzenflammen aufflackern. Irgendwo im Dorf heulte ein Hund, und die ganze Zeit über, ohne Anfang und Ende, konnte Thomas den Herzschlag des Meeres hören, die Wellen, die auf den Kies brandeten und mit einem Rauschen zurückflossen, kurz innehielten und dann wieder aufbrandeten. Er lauschte auf das Schnarchen der vier Männer und betete, sein Vater möge nie etwas von der Sache mit Jane erfahren. Doch das war ziemlich unwahrscheinlich, denn sie drängte Thomas zur Heirat, und er wusste nicht, was er tun sollte. Vielleicht, so dachte er, sollte er einfach fortlaufen, Jane und seinen Bogen nehmen und davonlaufen, aber er war unentschlossen, und so starrte er weiter zur Reliquie hinauf und betete zu ihrem Heiligen um Hilfe.
Der Schatz war eine Lanze. Sie war riesig, mit einem Schaft so dick wie der Unterarm eines Mannes, doppelt so lang wie ein ausgewachsener Mann und wahrscheinlich aus Esche, obgleich sie so alt war, dass niemand es mit Genauigkeit sagen konnte. Das Alter hatte den geschwärzten Schaft ein wenig verbogen, wenn auch nicht viel, und die Spitze war nicht aus Eisen oder Stahl, sondern aus einem Stück angelaufenem Silber, das mit einem Dorn am Holz befestigt war. Der Schaft erweiterte sich nicht zu einem Handschutz oberhalb des Griffes, sondern war ebenmäßig wie ein Speer oder Stachelstock; tatsächlich sah die Reliquie fast wie ein übergroßer Ochsensporn aus, aber kein Bauer würde je einen Ochsensporn mit einer Silberspitze versehen. Dies war eine Waffe, eine Lanze.
Doch es war nicht irgendeine beliebige Lanze. Es war die Lanze, mit der der heilige Georg den Drachen getötet hatte. Es war Englands Lanze, denn der heilige Georg war Englands Schutzheiliger, und das machte sie zu einem unermesslich kostbaren Schatz, auch wenn sie unter dem spinnwebverhangenen Dach von Hooktons Kirche hing. Viele Leute meinten, es könne nicht die Lanze des heiligen Georg sein, doch Thomas glaubte daran, und er stellte sich gerne vor, wie der Staub unter den Hufen des Pferdes von St. Georg aufwirbelte und der Atem des Drachen in höllischen Flammen loderte, als das Pferd sich aufbäumte und der Heilige mit der Lanze ausholte. Das Sonnenlicht musste sich strahlend wie Engelsflügel in St. Georgs Helm gespiegelt haben, und Thomas hörte in seiner Vorstellung das Brüllen des Drachen, das Peitschen seines stachelbewehrten Schwanzes, das angstvolle Wiehern des Pferdes, er sah, wie der Heilige sich in seinen Steigbügeln erhob und die Silberspitze der Lanze in die schuppige Haut des Ungeheuers stieß. Sie drang direkt ins Herz, und die Todesschreie des Drachen mussten bis in den Himmel gedröhnt haben, als er sich blutend am Boden wand. Dann hatte sich der Staub gelegt, das Blut des Drachen war im Sand geronnen, der heilige Georg hatte die Lanze herausgezogen, und irgendwie war sie dann in Vater Ralphs Besitz gelangt. Aber wie? Der Priester verriet es nicht. Doch dort hing sie, eine große, dunkle Lanze, schwer genug, den Schuppenpanzer eines Drachen zu durchdringen.
In dieser Nacht betete Thomas zum heiligen Georg, während Jane, die schwarzhaarige Schönheit, deren Bauch sich gerade über ihrem ungeborenen Kind zu runden begann, in der Schankstube des Wirtshauses schlief und Vater Ralph laut in seinen Albträumen schrie, voller Angst vor den Dämonen, die sich im Dunkel um ihn scharten, und den Hexen, die kreischend auf dem Hügel tanzten, während die endlose Brandung an den Kieseln des Hook zerrte. Es war die Nacht vor Ostern.
Thomas erwachte vom Krähen der Hähne und sah, dass die teuren Kerzen fast bis auf die Zinnleuchter heruntergebrannt waren. Graues Licht schimmerte durch das Fenster über dem weiß geschmückten Altar. Eines Tages, so hatte Vater Ralph dem Dorf versprochen, würde dieses Fenster in leuchtenden Farben funkeln und den heiligen Georg zeigen, wie er mit der silberbesetzten Lanze den Drachen erlegte, doch noch war der steinerne Rahmen mit Hornscheiben gefüllt, die das Innere der Kirche uringelb schimmern ließen.
Thomas stand auf, weil er pinkeln musste, und da ertönten die ersten markerschütternden Schreie aus dem Dorf.
Denn Ostern war angebrochen, Christus war auferstanden, und die Franzosen waren gelandet.
Die Plünderer kamen aus der Normandie, mit vier Schiffen, die den nächtlichen Westwind ausgenutzt hatten. Ihr Anführer, Guillaume d’Evecque, war ein erprobter Krieger, der in der Gascogne und Flandern gegen die Engländer gekämpft und zwei Raubzüge durch Südengland angeführt hatte. Beide Male hatte er seine Schiffe sicher nach Hause gebracht, voll beladen mit Wolle, Silbergerät, Vieh und Frauen. Er lebte in einem eleganten Steinhaus auf der Île Saint-Jean in Caen, wo man ihn als Ritter zu Wasser und zu Lande bezeichnete. Er war dreißig Jahre alt, breitschultrig, windgegerbt und blond, ein fröhlicher Mann, der sich nicht allzu viele Gedanken machte und sein Geld auf dem Meer mit Piraterie und auf dem Festland mit Ritterdiensten verdiente. Und nun war er nach Hookton gekommen.
Es war ein unbedeutender Ort, der kaum große Beute versprach, doch Guillaume d’Evecque war für diesen Auftrag angeheuert worden, und selbst wenn er in Hookton nicht fündig wurde, wenn er nicht einmal eine einzige Münze von einem der Dorfleute erbeutete, würde er immer noch gut entlohnt werden, denn man hatte ihm eintausend Livres für diese Expedition versprochen. Der Vertrag war unterzeichnet und mit einem Siegel versehen, und er garantierte d’Evecque die eintausend Livres sowie alles, was er in Hookton an Beute ergatterte. Einhundert Livres waren bereits ausgezahlt worden, und den Rest bewahrte Bruder Martin in der Abbaye aux Hommes in Caen für ihn auf. Alles, was d’Evecque tun musste, um die restlichen neunhundert Livres zu verdienen, war, mit seinen Booten nach Hookton zu segeln, mitzunehmen, wonach ihm der Sinn stand, aber den Inhalt der Kirche dem Mann zu überlassen, der ihm diesen großzügigen Vertrag angeboten hatte. Dieser Mann stand jetzt in dem führenden Schiff an d’Evecques Seite.
Es war ein junger Mann, noch keine dreißig, groß und schwarzhaarig, der selten sprach und noch weniger lächelte. Er trug ein teures Kettenhemd, das ihm bis zu den Knien reichte, und darüber einen Waffenrock aus tiefschwarzem Leinen, der kein Abzeichen trug. Dennoch vermutete d’Evecque, dass der Unbekannte von edler Geburt war, denn er besaß die Arroganz des Adels und das Selbstvertrauen der Privilegierten. Er war ganz sicher kein normannischer Adliger, denn die kannte d’Evecque alle, und ebenso wenig schien er aus dem nahe gelegenen Alençon oder Maine zu stammen, denn mit diesen Truppen war d’Evecque schon oft genug geritten. Eher ließ sein gelblicher Teint darauf schließen, dass er aus einer der Mittelmeerprovinzen kam, vielleicht aus dem Languedoc oder der Dauphine, und die da unten waren alle verrückt. Verrückt wie die Hunde. Guillaume d’Evecque kannte nicht einmal seinen Namen.
«Manche nennen mich den Harlekin», hatte der Fremde auf seine Frage geantwortet.
«Harlekin?» Beunruhigt hatte d’Evecque sich bekreuzigt. «Ihr meint, wie der hellequin, der Anführer der Teufelsschar?»
«In Frankreich hellequin», hatte der Mann erwidert, «und in Italien arlecchino. Es ist alles dasselbe.» Er hatte gelächelt, und irgendetwas an dem Lächeln hatte d’Evecque gesagt, dass er seine Neugier besser bezähmte, wenn er die restlichen neunhundert Livres bekommen wollte.
Der Mann, der sich Harlekin nannte, blickte jetzt hinüber zum dunstverschleierten Ufer, an dem verschwommen ein gedrungener Kirchturm, eine Ansammlung ineinanderverschachtelter Dächer und leichter Rauch von den glimmenden Feuern der Salzpfannen zu erkennen waren. «Ist das Hookton?», fragte er.
«Das behauptet er jedenfalls», erwiderte d’Evecque mit einer Kopfbewegung zum Kapitän.
«Dann möge Gott sich ihrer Seelen erbarmen», sagte der Mann. Er zog sein Schwert, obwohl die vier Schiffe noch eine halbe Meile vom Ufer entfernt waren. Die Genueser Armbrustschützen, die für die Reise angeheuert worden waren, bekreuzigten sich und begannen, die Sehnen ihrer Waffen zu spannen, während Guillaume d’Evecque befahl, das Banner am Hauptmast zu hissen. Es war eine blaue Flagge mit drei herniederstoßenden gelben Falken, die Flügel ausgebreitet und die Krallen gespreizt, im Anflug auf ihre Beute. D’Evecque konnte die Salzfeuer riechen und die Hähne am Ufer krähen hören.
Die Hähne krähten noch immer, als der Bug seines Schiffes auf den Kies auflief.
D’Evecque und der Harlekin waren die Ersten, die an Land gingen, doch dicht hinter ihnen folgte ein Trupp Armbrustschützen, professionelle Soldaten, die ihr Geschäft verstanden. Ihr Anführer ging mit ihnen über den Strand und durch das Dorf, um den Zugang zum Tal dahinter abzusperren, wo sie jeden Dorfbewohner abfangen würden, der mit seinen Wertsachen zu fliehen versuchte. Die übrigen Männer von d’Evecque würden die Häuser plündern, während die Matrosen am Strand blieben und die Boote bewachten.
Es war eine lange, kalte und unruhige Nacht auf See gewesen, doch jetzt kam die Belohnung. Vierzig bewaffnete Soldaten fielen in Hookton ein. Sie trugen Helme und Kettenhemden über gepolsterten Wämsern mit Lederrücken, waren mit Schwertern, Äxten oder Speeren bewaffnet, und sie hatten einen Freibrief zum Plündern. Die meisten von ihnen waren Veteranen von d’Evecques früheren Beutezügen und wussten, was sie zu tun hatten: die morschen Türen eintreten und als Erstes die Männer töten. Die Frauen konnten ruhig schreien, aber die Männer mussten getötet werden, denn die leisteten den stärksten Widerstand. Ein paar Frauen liefen davon, aber die Armbrustschützen würden sie aufhalten. Sobald die Männer getötet waren, konnte das Plündern beginnen, und das dauerte, denn die Bauern versteckten stets alles, was wertvoll war, und die Verstecke mussten erst einmal gefunden werden. Man musste die Dächer einreißen, die Brunnen überprüfen und in den Lehmböden stochern, aber vieles war gar nicht versteckt. Da gab es Schinken, die auf das erste Mahl nach der Fastenzeit warteten, Gestelle voll geräuchertem oder getrocknetem Fisch, Haufen von Netzen, gute Kochtöpfe, Rocken und Spindeln, Eier, Fässer mit Butter und Salz – alles bescheidene Dinge, aber wertvoll genug, um sie in die Normandie mitzunehmen. In einigen Häusern fanden sich kleine Ansammlungen von Münzen, und ein Haus, das des Priesters, war eine wahre Fundgrube an Silbergerät, Kerzenleuchtern und Krügen. Dort gab es sogar ein paar Ballen guten Wolltuches, ein großes geschnitztes Bett und ein brauchbares Pferd im Stall. D’Evecque warf einen Blick auf die siebzehn Bücher, ließ sie jedoch achselzuckend liegen, nachdem er die Bronzeschlösser von den Einbänden abgerissen hatte. Sie konnten zusammen mit dem Haus verbrennen.
Er musste die Haushälterin des Priesters töten, was er bedauerte. D’Evecque war nicht zimperlich, wenn es darum ging, Frauen zu töten, aber es brachte keine Ehre ein, und so sah er davon ab, solange die Frauen keinen Ärger machten, aber die Haushälterin des Priesters wehrte sich mit aller Kraft. Sie schlug mit einem Bratspieß auf d’Evecques Soldaten ein, beschimpfte sie als Hurensöhne und Teufelsbrut, und schließlich streckte er sie mit seinem Schwert nieder, weil sie sich weigerte, ihr Schicksal hinzunehmen.
«Dummes Weib», sagte er und trat über ihren Leichnam hinweg, um in die Feuerstelle zu schauen. Im Kamin hingen zwei prächtige Schinken zum Räuchern. «Hol sie runter», befahl er einem seiner Männer und überließ es dann ihnen, das Haus zu durchsuchen, während er sich in die Kirche begab.
Vater Ralph, der von den Schreien seiner Gemeindemitglieder aufgewacht war, hatte eine Soutane übergestreift und war zur Kirche gelaufen. D’Evecques Leute hatten ihn aus Respekt in Ruhe gelassen, doch kaum in der kleinen Kirche angekommen, hatte der Priester begonnen, auf die Eindringlinge einzuschlagen, bis der Harlekin dazukam und den Soldaten befahl, ihn festzuhalten. Sie packten ihn bei den Armen und drückten ihn gegen den Altar mit seinem österlich weißen Antependium.
Mit dem Schwert in der Hand verbeugte sich der Harlekin vor Vater Ralph. «Gott zum Gruße, Mylord», sagte er.
Vater Ralph schloss kurz die Augen, vielleicht im Gebet, doch es sah mehr nach Verärgerung aus. Dann blickte er in das gutaussehende Gesicht des Harlekins. «Ihr seid der Sohn meines Bruders», sagte er und klang ganz und gar nicht wahnsinnig, nur voller Bedauern.
«In der Tat.»
«Wie geht es Eurem Vater?»
«Er ist tot», erwiderte der Harlekin, «genau wie sein Vater und Eurer.»
«Gott gebe ihrer Seele Frieden», sagte Vater Ralph.
«Und wenn Ihr tot seid, alter Mann, werde ich der Graf sein, und unsere Familie wird wieder zu Ruhm und Macht kommen.»
Vater Ralph lächelte halb, schüttelte den Kopf und sah hinauf zu der Lanze. «Sie wird Euch nichts nützen», sagte er, «denn ihre Macht wird nur den Tugendhaften zuteil. Widerlichen Abschaum wie Euch wird sie nicht unterstützen.» Dann stieß Vater Ralph einen seltsam wimmernden Laut aus und starrte hinunter auf die Stelle, wo sein Neffe ihm das Schwert in den Bauch gestoßen hatte. Er versuchte zu sprechen, doch es kam kein Wort heraus. Dann ließen ihn die Soldaten los, und er glitt vor dem Altar zu Boden. Blut sammelte sich in seinem Schoß.
Der Harlekin wischte sein Schwert an dem mit Wein befleckten Altartuch ab und befahl einem von d’Evecques Männern, eine Leiter zu holen.
«Eine Leiter?», fragte der Soldat verwirrt.
«Sie decken ihre Dächer, oder nicht? Also haben sie irgendwo eine Leiter. Finde sie.» Der Harlekin schob sein Schwert zurück in die Scheide und blickte hinauf zur Lanze des heiligen Georg.
«Ich habe sie mit einem Fluch belegt», sagte Vater Ralph mit schwacher Stimme. Er war bleich, lag im Sterben, klang jedoch seltsam ruhig.
«Euer Fluch, Mylord, interessiert mich nicht mehr als der Furz einer Wirtshausmagd.» Der Harlekin warf einem der Soldaten die Zinnleuchter zu, schnappte sich die Oblaten aus der Tonschale und stopfte sie sich in den Mund. Er griff nach der Schale, betrachtete ihre nachgedunkelte Oberfläche und stellte sie wieder auf den Altar, da sie für ihn wertlos war. «Wo ist der Wein?», fragte er Vater Ralph.
Vater Ralph schüttelte den Kopf. «Calix meus inebrians», sagte er, und der Harlekin lachte nur. Vater Ralph schloss die Augen, so sehr brannte der Schmerz in seinen Eingeweiden. «O Gott», stöhnte er.
Der Harlekin kniete sich neben seinen Onkel. «Tut es weh?»
«Wie Feuer», sagte Vater Ralph.
«Ihr werdet in der Hölle schmoren, Mylord», sagte der Harlekin, und als er sah, dass Vater Ralph seinen verwundeten Bauch zusammenpresste, um den Blutfluss einzudämmen, riss er ihm die Hände weg und trat ihm mit Wucht in den Magen. Vater Ralph keuchte vor Schmerz und rollte sich zusammen. «Ein Geschenk von Eurer Familie», sagte der Harlekin. Dann wandte er sich ab, als eine Leiter hereingebracht wurde.
Das Dorf hallte wider von Schreien, denn die meisten der Frauen und Kinder waren noch am Leben, und ihr Martyrium hatte gerade erst begonnen. Alle jüngeren Frauen wurden sofort von d’Evecques Männern vergewaltigt, und die hübschesten von ihnen, darunter auch Jane aus dem Wirtshaus, wurden auf die Boote verschleppt, um sie mit in die Normandie zu nehmen, wo sie die Huren oder Frauen von d’Evecques Soldaten werden würden. Eine der Frauen schrie, weil ihr Säugling in ihrem Haus zurückgeblieben war, aber die Soldaten verstanden sie nicht und schlugen sie, bis sie verstummte. Dann stießen sie sie zu den Matrosen, die sie auf den Kies drückten und ihr die Röcke hochrissen. Sie weinte sich die Seele aus dem Leib, als ihr Haus abbrannte. Gänse, Schweine, Ziegen, sechs Kühe und das gute Pferd des Priesters wurden zu den Booten getrieben, während die Möwen kreischend über den Himmel zogen.
Die Sonne war kaum hinter den östlichen Hügeln aufgegangen, und das Dorf hatte bereits mehr Beute gebracht, als Guillaume d’Evecque zu hoffen gewagt hatte.
«Wir könnten ins Inland vordringen», schlug der Hauptmann seiner Genueser Armbrustschützen vor.
«Wir haben, wofür wir hergekommen sind», widersprach der schwarz gekleidete Harlekin. Er hatte die unhandliche Lanze des heiligen Georg auf dem Rasen des Kirchhofs abgelegt und fixierte die alte Waffe, als versuche er, ihre Macht zu begreifen.
«Was ist das?», fragte der Armbrustschütze.
«Nichts, womit du etwas anfangen könntest.»
D’Evecque grinste. «Wenn Ihr damit zustoßt, zersplittert sie wie Elfenbein.»
Der Harlekin zuckte die Achseln. Er hatte gefunden, was er gesucht hatte, und d’Evecques Meinung interessierte ihn nicht.
«Gehen wir landeinwärts», schlug der Armbrustschütze erneut vor.
«Vielleicht ein paar Meilen», sagte d’Evecque. Er wusste, dass die gefürchteten englischen Bogenschützen bald nach Hookton kommen würden, aber wahrscheinlich nicht vor Mittag, und er fragte sich, ob es vielleicht noch ein Dorf in der Nähe gab, das zu plündern lohnte. Er sah zu, wie ein angsterfülltes Mädchen, vielleicht elf Jahre alt, von einem Soldaten zum Strand geschleppt wurde. «Wie viele Tote?», fragte er.
«Bei uns?» Der Hauptmann schien überrascht über die Frage. «Keine.»
«Nicht bei uns, bei denen.»
«Dreißig oder vierzig. Und ein paar Frauen.»
«Und wir haben nicht mal einen Kratzer!», freute sich d’Evecque. «Wäre doch ein Jammer, jetzt aufzuhören.» Er blickte fragend zu seinem Auftraggeber, doch der Mann in Schwarz schien sie völlig vergessen zu haben. Der Hauptmann stieß nur ein Grunzen aus, was d’Evecque erstaunte, da er angenommen hatte, der Armbrustschütze sei erpicht darauf, die Plünderung fortzuführen. Doch dann sah er, dass das Grunzen nicht von mangelnder Begeisterung ausgelöst worden war, sondern von einem weiß gefiederten Pfeil, der seine Brust durchbohrt hatte. Der Pfeil war durch das Kettenhemd und das gepolsterte Wams geglitten wie eine Ahle durch ein Leintuch und tötete den Hauptmann fast augenblicklich.
D’Evecque warf sich flach auf den Boden, und kaum einen Herzschlag später zischte ein weiterer Pfeil über ihn hinweg und landete mit dumpfem Aufprall im Rasen. Der Harlekin packte die Lanze und lief Richtung Strand, während d’Evecque sich hastig in den Schutz des Kirchentors flüchtete. «Armbrüste!», brüllte er. «Armbrüste!»
Denn jemand leistete Widerstand.
Thomas hatte die Schreie gehört und war, wie die anderen vier Männer, zum Tor gegangen, um nachzusehen, was sie zu bedeuten hatten. Doch kaum waren sie am Portal angekommen, war ein Trupp bewaffneter Männer im Kirchhof aufgetaucht, deren Helme und Kettenhemden in der Morgendämmerung dunkelgrau schimmerten.
Edward warf das Tor zu, rammte den Riegel in die Halterung und bekreuzigte sich. «Gütiger Jesus», sagte er fassungslos und zuckte zusammen, als von außen eine Axt gegen das Holz donnerte. «Gib her!» Er riss Thomas das Schwert aus der Hand.
Thomas überließ es ihm. Die Dorfbewohner hatten immer gedacht, Hookton sei viel zu klein, um geplündert zu werden, doch das Kirchentor zersplitterte vor Thomas’ Augen, und er wusste, es konnten nur die Franzosen sein. Überall entlang der Küste erzählte man sich Geschichten von solchen Überfällen, und Gebete wurden gesprochen, um das Volk vor Plünderungen zu bewahren, doch nun waren die Feinde gekommen, und die dröhnenden Schläge ihrer Äxte hallten in der Kirche wider.
Thomas war von Panik ergriffen, doch das war ihm nicht bewusst. Er wusste nur, dass er aus der Kirche verschwinden musste, und so lief er los und sprang auf den Altar. Mit dem rechten Fuß stieß er gegen den Silberbecher, trat ihn beiseite und kletterte auf den Sims des großen Ostfensters, dessen gelbe Hornplatten er zerschlug, dass die Splitter auf den Kirchhof flogen. Er sah Männer in rot und grün gefärbten Waffenröcken am Wirtshaus vorbeilaufen, doch keiner von ihnen blickte in seine Richtung, als er in den Kirchhof hinuntersprang und zum Graben rannte, wo er sich die Kleider zerriss, als er sich durch die Dornenhecke auf der anderen Seite wand. Er lief über die Straße, sprang über den Gartenzaun seines Vaters und hämmerte an die Küchentür, doch statt einer Antwort schlug eine Handbreit von seinem Gesicht entfernt ein Armbrustbolzen in den Türsturz. Thomas duckte sich und lief zwischen den Bohnenreihen hindurch zum Stall, in dem sein Vater das Pferd stehen hatte. Die Zeit reichte nicht, um das Tier zu retten, und so kletterte er auf den Heuboden, wo er seinen Bogen und die Pfeile versteckt hatte. In der Nähe schrie eine Frau. Hunde heulten. Die Franzosen traten unter lautem Gebrüll die Türen ein. Thomas packte seinen Bogen und die Tasche mit den Pfeilen, riss das Stroh von den Dachbalken, schob sich durch die Lücke und sprang hinunter in den Obstgarten des Nachbarn.
Er rannte, als sei der Teufel hinter ihm her. Ein weiterer Bolzen landete im Rasen, als er zum Lipp Hill lief und zwei der Armbrustschützen seine Verfolgung aufnahmen, doch Thomas war jung und stark und schnell. Er lief eine Wiese voller Schlüsselblumen und Gänseblümchen hinauf, sprang über ein Gatter, das eine Lücke in der Hecke verschloss, und wandte sich dann nach rechts, zur Kuppe des Hügels. Er lief, bis er zu dem Wald kam, der an der Rückseite des Hügels begann, und ließ sich auf einem von Glockenblumen übersäten Abhang zu Boden fallen, um wieder zu Atem zu kommen. Er lauschte auf die Lämmer, die auf einem Feld in der Nähe standen, hörte jedoch nichts Ungewöhnliches. Die Armbrustschützen hatten die Verfolgung aufgegeben.
Thomas blieb eine ganze Weile zwischen den Glockenblumen liegen, doch schließlich schlich er sich vorsichtig wieder zur Hügelkuppe, von wo er eine Handvoll alter Frauen und Kinder sehen konnte, die einen weiter entfernten Hügel hinaufliefen. Sie waren offenbar den Schützen entkommen und würden sicher gen Norden fliehen, um Sir Giles Marriott zu warnen, doch Thomas schloss sich ihnen nicht an, sondern bewegte sich wieder hügelabwärts, bis zu einem Gehölz aus Haselsträuchern, in dessen Schutz er zusehen konnte, wie sein Dorf starb.
Männer trugen ihre Beute zu den vier ausländischen Schiffen, die auf dem Kies des Hook lagen. Das erste Dach wurde in Brand gesetzt. Zwei Hunde lagen tot auf der Straße, daneben eine fast nackte Frau, die zu Boden gedrückt wurde, während Franzosen ihre Kettenhemden lüpften, um sich abwechselnd an ihr zu vergehen. Thomas erinnerte sich, wie sie vor einiger Zeit einen Fischer geheiratet hatte, dessen erste Frau im Kindbett gestorben war. Sie war so scheu und glücklich gewesen, doch jetzt trat ihr einer der Franzosen gegen den Kopf, als sie versuchte, von der Straße zu kriechen, und schüttete sich aus vor Lachen. Thomas sah, wie Jane zu den Booten gezerrt wurde, und schämte sich, weil er erleichtert war, dass er nun seinem Vater nichts von seinem Fehltritt zu sagen brauchte. Weitere Häuser gingen in Flammen auf, als die Franzosen brennendes Stroh auf die Dächer warfen, und Thomas sah zu, wie der Rauch in immer dichteren Wirbeln in den Himmel stieg. Dann schlich er zwischen den Haselsträuchern hindurch bis zu einer Weißdornhecke, deren üppige weiße Blüten ihm Sichtschutz boten. Dort spannte er seinen Bogen.
Es war der beste Bogen, den er je gemacht hatte. Er war aus einem Holzstab geschnitzt, der von einem gesunkenen Schiff ans Ufer gespült worden war. Ein ganzes Dutzend dieser Stäbe war vom Südwind an Hooktons Kiesstrand getrieben worden, und der Jäger von Sir Giles Marriott hielt es für italienische Eibe, denn es war das schönste Holz, das er je gesehen hatte. Thomas hatte elf der dichtgewachsenen Stäbe in Dorchester verkauft, aber den besten hatte er behalten. Er hatte ihn zurechtgeschnitzt, die Enden unter Dampf gebogen, um ihnen einen leichten Schwung gegen die Wuchsrichtung zu geben, und den Bogen dann mit einer Mischung aus Ruß und Leinöl bemalt. Er hatte die Mischung in der Küche seiner Mutter aufgekocht, während sein Vater unterwegs gewesen war, und Thomas’ Vater hatte nie etwas davon erfahren. Allerdings beschwerte er sich gelegentlich über den Geruch, und dann behauptete Thomas’ Mutter, sie habe ein Gift gegen die Ratten zusammengebraut. Der Bogen musste bemalt werden, um ihn vor dem Austrocknen zu schützen, denn sonst würde das Holz brüchig werden und unter dem starken Zug der Sehne zerbrechen.
Nach dem Trocknen hatte die Farbe einen sattgoldenen Ton angenommen, genau wie die Bogen, die Thomas’ Großvater früher im Weald angefertigt hatte, aber Thomas wollte ihn dunkler haben, und so hatte er mehr Ruß in das Holz gerieben und ihn mit Bienenwachs versiegelt. Diese Prozedur hatte er zwei Wochen lang wiederholt, bis der Bogen so schwarz war wie der Schaft von der Lanze des heiligen Georg. An den Spitzen hatte er zwei Hornkerben eingefügt, an denen die Sehne befestigt wurde, die aus miteinander verflochtenen und mit Hufkleber getränkten Hanfsträngen bestand. An der Stelle, wo der Pfeil angelegt wurde, hatte er die Sehne mit zusätzlichen Hanfsträngen verstärkt. Er hatte seinem Vater ein paar Münzen gestohlen, um in Dorchester Pfeilspitzen zu kaufen, dann hatte er aus Eschenzweigen und Gänsefedern Schäfte angefertigt, und an diesem Ostermorgen hatte er dreiundzwanzig von diesen guten Pfeilen in seiner Tasche.
Thomas spannte die Sehne, nahm einen weiß gefiederten Pfeil aus der Tasche und sah hinüber zu den drei Männern vor der Kirche. Sie waren ein gutes Stück entfernt, aber der schwarze Bogen war fast mannsgroß, und die Kraft in seinem Eibenbauch war furchterregend. Einer von den Männern trug ein einfaches Kettenhemd, der zweite einen schmucklosen schwarzen Waffenrock und der dritte einen rot-grünen Waffenrock über seinem Kettenhemd. Thomas nahm an, dass der am buntesten Gekleidete der Anführer sein musste, und so sollte er sterben.
Thomas’ linke Hand zitterte, als er den Bogen spannte. Sein Mund war trocken, und er war voller Angst. Er wusste, dass er danebenschießen würde, und so senkte er den Arm und lockerte die Spannung der Sehne. Erinnere dich, beschwor er sich. Erinnere dich an alles, was du gelernt hast. Ein Bogenschütze zielt nicht, er tötet. Alles passiert im Kopf, in den Armen, in den Augen, und einen Mann zu töten ist nicht anders, als eine Hirschkuh zu erlegen. Ziehen und loslassen, das war alles, und deshalb hatte er zehn Jahre lang geübt, bis das Ziehen und Loslassen so selbstverständlich war wie das Atmen und so fließend wie das Wasser, das aus einer Quelle entspringt. Sieh hin und lass los, denk nicht darüber nach. Spann die Sehne und lass Gott den Pfeil lenken.
Der Rauch über Hookton verdichtete sich, und Thomas spürte gewaltigen Zorn in sich aufsteigen wie schwarze Galle. Er drückte seine linke Hand vor und zog mit der rechten zurück, ohne den Blick von dem rot-grünen Waffenrock zu wenden. Er zog, bis sich die Sehne neben seinem rechten Ohr befand, dann ließ er los.
Es war das erste Mal, dass Thomas von Hookton auf einen Menschen schoss, und sobald der Pfeil von der Sehne sprang, wusste er, dass es ein guter Schuss war, denn der Bogen zitterte nicht. Der Pfeil folgte der geplanten Bahn, und Thomas sah zu, wie er sich hügelabwärts neigte und sich mit Wucht in den rot-grünen Waffenrock bohrte. Er schoss einen zweiten Pfeil ab, doch der Mann im Kettenhemd duckte sich und flüchtete hinter das Kirchentor, während der dritte Mann die Lanze nahm und Richtung Strand lief, wo ihn der Rauch verbarg.
Thomas hatte noch einundzwanzig Pfeile übrig. Je einen für die Heilige Dreifaltigkeit, dachte er, und einen für jedes Jahr seines Lebens, und dieses Leben war in Gefahr, denn ein Dutzend Armbrustschützen stürmte auf den Hügel zu. Er schoss einen dritten Pfeil ab und lief dann zurück durch die Haselsträucher. Plötzlich überkam ihn Euphorie, ein Gefühl von Macht und Befriedigung.
In dem Augenblick, als der erste Pfeil gen Himmel schoss, wusste er, mehr wollte er nicht vom Leben. Er war ein Bogenschütze. Oxford konnte ihm gestohlen bleiben, denn er hatte sein Glück gefunden. Thomas stieß einen Freudenschrei aus, als er den Hügel hinaufrannte. Armbrustbolzen schossen durch die Haselsträucher, und er bemerkte, dass sie im Flug einen tiefen, fast summenden Ton von sich gaben. Dann war er über die Hügelkuppe hinweg und lief ein kleines Stück westwärts, bevor er sich wieder Richtung Kuppe wandte. Er hielt kurz inne, um einen weiteren Pfeil abzuschießen, dann drehte er sich wieder um und lief weiter.
Thomas führte die Genueser Armbrustschützen in einem Todestanz – vom Hügel zu den Hecken, über Wege, die er seit seiner Kindheit kannte –, und dumm, wie sie waren, folgten sie ihm, denn ihr Stolz gestattete es ihnen nicht, sich einzugestehen, dass sie ihm unterlegen waren. Doch sie waren unterlegen, und zwei starben, bevor das Horn vom Strand erschallte und die Plünderer zu den Schiffen rief. Da machten die Schützen kehrt und hielten nur inne, um Armbrust, Börse, Kettenhemd und Waffenrock eines ihrer Toten aufzulesen. Doch als sie sich über den Leichnam beugten, tötete Thomas einen weiteren von ihnen, und von da an rannten die Überlebenden einfach nur, so schnell sie konnten.
Thomas folgte ihnen hinunter in das raucherfüllte Dorf. Er lief am Wirtshaus vorbei, das lichterloh brannte, und zum Strand, wo die vier Schiffe gerade zurück ins Wasser geschoben wurden. Die Matrosen stießen sich mit den langen Rudern ab und pullten hinaus auf See. Die drei besten Boote von Hookton nahmen sie mit, die übrigen steckten sie in Brand. Das Dorf stand ebenfalls in Flammen, und das Stroh wirbelte in Funken und Rauch und brennenden Fetzen gen Himmel. Thomas schoss einen letzten, nutzlosen Pfeil vom Ufer ab und sah zu, wie er kurz hinter den flüchtenden Plünderern ins Meer fiel. Dann wandte er sich um und ging durch das stinkende, brennende, blutbespritzte Dorf zurück zur Kirche, dem einzigen Gebäude, das die Plünderer nicht in Brand gesetzt hatten. Die vier anderen Männer der Nachtwache waren tot, aber Vater Ralph lebte noch. Er saß mit dem Rücken an den Altar gelehnt. Der Saum seiner Soutane war durchtränkt von frischem Blut, und sein langes Gesicht war unnatürlich bleich.
Thomas kniete sich neben den Priester. «Vater?»
Vater Ralph öffnete die Augen und sah den Bogen. Er zog eine Grimasse, aber es war nicht zu erkennen, ob vor Schmerz oder aus Missbilligung.
«Hast du ein paar von ihnen getötet, Thomas?», fragte der Priester.
«Ja», antwortete Thomas, «eine ganze Menge.»
Vater Ralph verzog erneut das Gesicht, und ein Schauer überlief ihn. Thomas hielt ihn für einen der stärksten Männer, die er je gekannt hatte, vielleicht voller Fehler, aber so kraftvoll wie ein Eibenbogen. Doch nun lag er im Sterben, und in seiner Stimme lag ein Wimmern. «Du willst kein Priester werden, Thomas, nicht wahr?», fragte er ihn auf Französisch, seine Muttersprache.
«Nein», antwortete Thomas in derselben Sprache.
«Du wirst Soldat», sagte der Priester, «wie dein Großvater.» Er hielt inne und stöhnte, als der Schmerz erneut seinen Leib durchzuckte. Thomas wollte ihm helfen, aber es gab nichts mehr, was er hätte tun können. Der Harlekin hatte Vater Ralph sein Schwert in den Bauch gestoßen, und nur Gott konnte den Priester jetzt noch retten.
«Ich habe mich meinem Vater widersetzt», sagte der Sterbende, «und er hat mich verstoßen und enterbt, und von dem Tag an wollte ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber du, Thomas, du bist wie er. Genau wie er. Und du hast dich mir immer widersetzt.»
«Ja, Vater», sagte Thomas. Er nahm die Hand seines Vaters, und der Priester wehrte sich nicht.
«Ich habe deine Mutter geliebt», sagte Vater Ralph, «das war meine Sünde, und du bist die Frucht dieser Sünde. Ich dachte, wenn du Priester wirst, könntest du dich über die Sünde erheben. Sie überflutet uns, Thomas, sie überflutet uns. Sie ist überall. Ich habe den Teufel gesehen, Thomas, mit meinen eigenen Augen, und wir müssen ihn bekämpfen. Nur die Kirche vermag das. Nur die Kirche.» Tränen rannen über seine unrasierten, hohlen Wangen. Er sah an Thomas vorbei hinauf zum Dach des Kirchenschiffs. «Sie haben die Lanze gestohlen», sagte er traurig.
«Ich weiß.»
«Einer meiner Vorfahren brachte sie aus dem Heiligen Land hierher», sagte Vater Ralph. «Ich habe sie meinem Vater gestohlen, und heute hat der Sohn meines Bruders sie uns gestohlen.» Seine Stimme war leise. «Er wird Böses damit tun. Bring sie zurück, Thomas. Bring sie zurück.»
«Das werde ich», versprach Thomas ihm. In der Kirche begann sich Rauch auszubreiten. Die Plünderer hatten sie zwar nicht in Brand gesteckt, aber das Strohdach hatte durch die herumfliegenden Funken Feuer gefangen. «Ihr habt gesagt, der Sohn Eures Bruders hat sie gestohlen?»
«Dein Vetter», flüsterte Vater Ralph mit geschlossenen Augen. «Der Mann in Schwarz. Er ist gekommen und hat sie mitgenommen.»
«Wer ist er?»
«Böse», sagte Vater Ralph, «böse.» Er stöhnte und schüttelte den Kopf.
«Wer ist er?», fragte Thomas noch einmal.
«Calix meus inebrians», flüsterte Vater Ralph kaum hörbar. Thomas wusste, dass das eine Zeile aus einem Psalm war, die so viel bedeutete wie «mein Becher macht mich trunken», und er nahm an, sein Vater phantasierte, während seine Seele sich von seinem Körper zu lösen begann.
«Sagt mir, wer Euer Vater war!», drängte Thomas. Was er meinte, war: Sagt mir, wer ich bin. Sagt mir, wer Ihr seid, Vater. Doch Vater Ralph hatte die Augen geschlossen, obwohl seine Finger sich noch immer fest um Thomas’ Hand klammerten. «Vater?» Der Rauch sank nieder und zog durch das Kirchenfenster ab, das Thomas bei seiner Flucht zerschlagen hatte. «Vater?»
Doch sein Vater sagte nichts mehr. Er starb, und Thomas, der sein ganzes Leben gegen ihn gekämpft hatte, weinte wie ein Kind. Zu manchen Zeiten hatte er sich seines Vaters geschämt, doch an jenem rauchverhangenen Ostermorgen begriff er, dass er ihn liebte. Die meisten Priester erkannten ihre Kinder nicht an, aber Vater Ralph hatte Thomas nie versteckt. Er hatte die Welt denken lassen, was sie wollte, und sich frei dazu bekannt, dass er nicht nur ein Priester, sondern auch ein Mann war, und wenn es eine Sünde war, dass er seine Haushälterin liebte, dann war es eine süße Sünde, die er niemals verleugnete, auch wenn er Reuebekenntnisse ablegte und fürchtete, dass er im Jenseits dafür würde büßen müssen.
Thomas zog seinen Vater vom Altar fort. Er wollte nicht, dass sein Leichnam verbrannte, wenn das Dach einstürzte. Der Silberbecher, den Thomas versehentlich zu Boden gestoßen hatte, lag unter der blutdurchtränkten Soutane des Priesters, und Thomas steckte ihn ein, bevor er den Leichnam in den Kirchhof hinausschleifte. Er legte seinen Vater neben den Mann in dem rot-grünen Waffenrock und hockte sich weinend daneben, in dem Bewusstsein, dass er bei seiner ersten Osterwache versagt hatte. Der Teufel hatte die Sakramente gestohlen, die Lanze des heiligen Georg war fort, und Hookton war tot.
Am Mittag kam Sir Giles Marriott mit einem großen Gefolge von Männern, die mit Bogen und Hellebarden bewaffnet waren. Sir Giles selbst trug Rüstung und Schwert, doch es war kein Feind mehr da, der bekämpft werden konnte, und Thomas war der Einzige, der im Dorf noch lebte.
«Drei gelbe Falken auf blauem Grund», sagte Thomas zu Sir Giles.
«Wie bitte?», fragte Sir Giles verwirrt. Er war der Gutsherr und mittlerweile ein alter Mann, obwohl er seinerzeit sowohl gegen die Schotten als auch gegen die Franzosen zu Felde gezogen war. Er war ein guter Freund von Thomas’ Vater gewesen, doch er verstand Thomas nicht, der ihm wie ein wilder Wolf erschien.
«Drei gelbe Falken auf blauem Grund», wiederholte Thomas rachelüstern. «Das war das Wappen des Mannes, der all dies getan hat.» War es das Wappen seines Vetters? Er wusste es nicht. Sein Vater hatte ihm so viele Fragen hinterlassen.
«Ich weiß nicht, wessen Abzeichen das ist», sagte Sir Giles, «aber ich werde bei Gottes Eingeweiden beten, dass er dafür in der Hölle schmort.»
Es gab nichts zu tun, bis die Brände von selbst erloschen. Erst dann konnten die Leichen aus der Asche geholt werden. Die verbrannten Toten waren verkohlt und durch die Hitze auf groteske Weise zusammengeschrumpft, sodass selbst die größten Männer aussahen wie Kinder. Die toten Dorfbewohner wurden für ein ordnungsgemäßes Begräbnis in den Kirchhof gebracht, aber die Leichen der vier Armbrustschützen wurden zum Strand geschleift und dort vollständig entkleidet.
«Hast du sie getötet?», fragte Sir Giles Thomas.
«Ja, Sir.»
«Dann danke ich dir.»
«Meine ersten toten Franzosen», sagte Thomas voller Hass.
«Nein», sagte Sir Giles und hob den Waffenrock eines der Männer auf, um Thomas das Abzeichen eines grünen Kelches zu zeigen, das auf den Ärmel gestickt war. «Sie stammen aus Genua. Die Franzosen heuern sie als Armbrustschützen an. Ich habe seinerzeit auch etliche von ihnen getötet, aber es kommen immer wieder neue nach. Weißt du, was das für ein Abzeichen ist?»
«Ein Becher?»
Sir Giles schüttelte den Kopf. «Der Heilige Gral. Sie glauben, sie haben ihn in ihrer Kathedrale. Man hat mir erzählt, es sei ein prachtvolles grünes Stück, aus einem Smaragd geschnitzt und von einem der Kreuzzüge mitgebracht. Ich würde ihn gerne einmal sehen.»
«Dann werde ich ihn Euch bringen», sagte Thomas grimmig, «so wie ich auch unsere Lanze zurückbringen werde.»
Sir Giles blickte aufs Meer hinaus. Die Schiffe der Plünderer waren längst verschwunden, und es war nichts zu sehen außer der Sonne auf den Wellen. «Warum sind sie nur hierher gekommen?», fragte er.
«Wegen der Lanze.»
«Ich glaube nicht mal, dass sie echt war», sagte Sir Giles. Er hatte ein rotes Gesicht, schlohweißes Haar und mittlerweile eine recht kräftige Statur. «Es war nur ein alter Speer, weiter nichts.»
«Doch, sie ist echt», widersprach Thomas. «Und deshalb sind sie hergekommen.»
Sir Giles beließ es dabei. «Dein Vater», sagte er stattdessen, «hätte sich gewünscht, dass du deine Studien fortsetzt.»
«Meine Studien sind beendet», sagte Thomas kategorisch. «Ich gehe nach Frankreich.»
Sir Giles nickte. Er war sicher, dass der Junge einen weit besseren Soldaten als Priester abgeben würde. «Willst du als Bogenschütze gehen?», fragte er mit einem Blick auf den langen Bogen an Thomas’ Schulter. «Oder willst du in mein Gefolge eintreten und den Schwertkampf erlernen?» Er lächelte verhalten. «Du bist von edler Geburt, weißt du das?»
«Nein, ich bin ein Bastard», sagte Thomas.
«Dein Vater stammte aus einer adligen Familie.»
«Wisst Ihr, aus welcher?»
Sir Giles zuckte die Achseln. «Er wollte es mir nie verraten, und wenn ich nachbohrte, sagte er nur, Gott sei sein Vater und die Kirche seine Mutter.»
«Und meine Mutter war die Haushälterin eines Priesters und die Tochter eines Bogenschützen. Ich werde als Bogenschütze nach Frankreich gehen.»
«Als Soldat ist die Ehre größer», wandte Sir Giles ein, doch Thomas wollte keine Ehre. Er wollte Rache.
Sir Giles ließ ihn wählen, was er von den toten Feinden haben wollte, und Thomas nahm ein Kettenhemd, ein paar hohe Stiefel, ein Messer, ein Schwert, einen Gürtel und einen Helm. Es war alles von einfacher Qualität, aber brauchbar, und nur das Kettenhemd musste geflickt werden, weil er einen Pfeil durch die Ringe gejagt hatte. Sir Giles sagte, er schulde seinem Vater noch Geld, was stimmen mochte oder auch nicht, aber er gab es Thomas, zusammen mit einem vierjährigen Wallach. «Du wirst ein Pferd brauchen», sagte er, «denn heutzutage sind die Bogenschützen alle beritten. Geh nach Dorchester», riet er Thomas, «dort findest du bestimmt jemanden, der Bogenschützen sucht.»
Die Leichen der Genueser wurden enthauptet, ihre Körper einfach liegen gelassen und die vier Köpfe auf Pflöcke gespießt und am Kiesstrand des Hook aufgereiht. Die Möwen pickten den Toten die Augen aus und zerrten an ihrer Haut, bis nur noch die nackten Schädel übrig waren, die mit leerem Blick aufs Meer hinausstarrten.
Doch Thomas sah die Schädel nicht mehr. Er hatte seinen schwarzen Bogen genommen, den Kanal überquert und war in den Krieg gezogen.
Teil 1 Bretagne
Es war Winter. Ein kalter Morgenwind wehte vom Meer herüber und brachte einen säuerlichen Salzgeruch und einen peitschenden Regen mit, der unweigerlich die Kraft aus den Bogensehnen ziehen würde, wenn er nicht bald nachließ.
«Wenn ihr mich fragt», sagte Jake, «ist das nichts wie gottverdammte Zeitverschwendung.»
Niemand beachtete ihn.
«Wären wir bloß in Brest geblieben», grummelte er. «Schön gemütlich beim Feuer. Mit ’nem Becher Ale.»
Wiederum keine Reaktion.
«Vielleicht sehen wir ja die Amsel wieder?», meinte Sam und sah zu den Bogenschützen hinüber.
«Vielleicht tut sie uns einen Gefallen und jagt dir einen Bolzen in den Mund», knurrte Will Skeat.
Die «Amsel» war eine Frau, die jedes Mal, wenn die Truppe einen Angriff versuchte, auf den Stadtmauern erschien und sich am Kampf beteiligte. Sie war jung, hatte schwarzes Haar, trug einen schwarzen Umhang und schoss mit einer Armbrust. Beim ersten Angriff, als Will Skeats Bogenschützen in der Vorhut gewesen waren und vier Männer verloren hatten, waren sie nah genug gewesen, um die Amsel deutlich zu sehen, und sie hatten sie alle schön gefunden, obwohl nach einem Winterfeldzug voller Niederlagen, Kälte, Schlamm und Hunger beinahe jede Frau schön aussah. Dennoch war an der Amsel etwas Besonderes.
«Die Armbrust lädt sie aber nicht selbst», sagte Sam, unbeirrt von Skeats mürrischer Bemerkung.
«Natürlich nicht, du Holzkopf», erwiderte Jake. «Keine Frau ist stark genug, um ’ne Armbrust zu spannen.»
«Doch, die Träge Mary», sagte ein anderer Mann. «Hat Muskeln wie ’n Ochse, die Frau.»
«Und sie schießt mit geschlossenen Augen», sagte Sam, der immer noch bei der Amsel war. «Hab ich selbst gesehen.»
«Ja, weil du rumgeträumt hast, statt deine verdammte Arbeit zu tun», schnaubte Will Skeat. «Also halt die Klappe, Sam.»
Sam war der jüngste von Skeats Männern. Er behauptete, er sei achtzehn, wusste es aber selbst nicht genau, weil er nicht mitgezählt hatte. Er war der Sohn eines Tuchhändlers, hatte das Gesicht eines Cherubs, braune Locken und ein Herz so schwarz wie die Sünde. Doch er war ein guter Bogenschütze; niemand kam in Will Skeats Dienste, wenn er nicht gut war.
«In Ordnung, Männer», sagte Skeat, «macht euch bereit.»
Er hatte die Bewegung im Lager hinter ihnen gesehen. Auch der Feind würde sie bald bemerken, die Kirchenglocken würden Alarm läuten, und auf den Stadtmauern würden sich die Verteidiger mit ihren Armbrüsten sammeln. Die Armbrüste würden ihre Bolzen in die Angreifer rammen, und Skeats Aufgabe bestand darin, diese Armbrustschützen mit seinen Pfeilen von der Mauer zu schießen. Schön wär’s, dachte er grimmig. Die Verteidiger würden sich hinter den Zinnen verstecken, um seinen Männern kein Ziel zu bieten, und somit würde dieser Angriff gewiss genauso enden wie die vorigen fünf, nämlich mit einer Niederlage.
Der ganze Feldzug war eine einzige Niederlage. William Bohun, der Earl of Northampton, der die kleine englische Armee anführte, hatte diesen Winterfeldzug in der Hoffnung unternommen, eine Bastion in der nördlichen Bretagne zu erobern, doch der Angriff auf Carhaix war eine peinliche Schlappe gewesen, die Verteidiger von Guingamp hatten die Engländer ausgelacht, und die Mauern von Lannion hatten sämtlichen Angriffen standgehalten. Sie hatten Tréguier eingenommen, aber da diese Stadt keine Mauern besaß, war es keine große Leistung und der Ort nicht geeignet, um dort eine Festung einzurichten. Nun, da das bittere Jahr sich dem Ende zuneigte und es nichts Besseres zu tun gab, hatten die Truppen des Earls sich vor dieser kleinen Stadt versammelt, die kaum mehr war als ein ummauertes Dorf, doch selbst dieser armselige Steinhaufen widerstand der Armee. Der Earl hatte Angriff um Angriff versucht, und jedes Mal waren sie zurückgeschlagen worden. Die Engländer waren mit einem Hagel von Armbrustbolzen beschossen, die Sturmleitern von der Brustwehr gestoßen worden, und bei jeder Niederlage waren die Verteidiger in Jubel ausgebrochen.
«Wie heißt dieses gottverdammte Kaff?», fragte Skeat.
«La Roche-Derrien», antwortete ein hochgewachsener Bogenschütze.
«Das weißt du natürlich, Tom», sagte Skeat. «Du weißt ja alles.»
«Stimmt, Will», erwiderte Thomas ernst. «Da hast du vollkommen recht.»
Die anderen Bogenschützen lachten.
«Nun, wenn du so viel weißt», sagte Skeat, «dann sag mir noch mal, wie diese elende Stadt heißt.»
«La Roche-Derrien.»
«Dämlicher Name», sagte Skeat. Er hatte graues Haar und ein schmales Gesicht, und er besaß fast dreißig Jahre Felderfahrung. Er stammte aus Yorkshire und hatte seine Laufbahn als Bogenschütze im Kampf gegen die Schotten begonnen. Da er nicht nur Geschick, sondern auch Glück gehabt hatte, war es ihm gelungen, bei Plünderungen Beute zu machen, Schlachten zu überleben und innerhalb der Armee aufzusteigen, bis er wohlhabend genug gewesen war, eine eigene Truppe zusammenzustellen. Mittlerweile führte er siebzig Soldaten und ebenso viele Bogenschützen an, die er in den Dienst des Earl of Northampton gestellt hatte, und das war der Grund, weshalb er jetzt hinter einer nassen Hecke einhundertfünfzig Schritt von den Mauern einer Stadt entfernt hockte, deren Name sich ihm einfach nicht einprägen wollte. Seine Soldaten waren im Lager, wo sie sich nach dem letzten gescheiterten Angriff einen Tag ausruhen durften. Will Skeat hasste Niederlagen.
«La Roche wie?», fragte er Thomas.
«Derrien.»
«Was zum Henker soll das heißen?»
«Das, muss ich gestehen, weiß ich leider auch nicht.»
«Gütiger Jesus», sagte Skeat in gespieltem Erstaunen, «er weiß doch nicht alles.»
«Es ist allerdings sehr nahe an derrière, was ‹Hintern› bedeutet», fügte Thomas hinzu. «Ich würde es am ehesten mit ‹der Felsen des Hinterns› übersetzen.»
Skeat öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, doch in dem Moment begann die erste von La Roche-Derriens Kirchenglocken Alarm zu läuten. Es war die gesprungene Glocke, die so grell klang, und innerhalb von Sekunden stimmten die anderen Kirchen ein, sodass der feuchte Wind von ihrem Dröhnen erfüllt war. Als Antwort ertönte ein gedämpfter Kampfschrei der Engländer, als die Angriffstruppen das Lager verließen und die Straße zum südlichen Stadttor hinaufmarschierten. Die Männer an der Spitze trugen Leitern, der Rest Schwerter und Äxte. Der Earl of Northampton führte den Angriff an, wie er es stets getan hatte, unübersehbar in seiner Rüstung, die halb von einem Waffenrock mit seinem Emblem aus Löwen und Sternen bedeckt war.
«Ihr wisst, was ihr zu tun habt!», bellte Skeat.
Die Bogenschützen stellten sich auf, spannten die Sehnen und schossen. Es waren keine Ziele auf den Mauern, da die Verteidiger sich hinter die Brustwehr duckten, doch das Prasseln der stählernen Pfeilspitzen sollte sie in Deckung halten. Die weiß gefiederten Pfeile zischten im Flug. Zwei weitere Einheiten von Bogenschützen unterstützten sie, wobei viele von ihnen steil in die Luft schossen, sodass ihre Pfeile senkrecht auf den Rand der Mauer hinunterstießen, und Skeat war überzeugt, niemand könne unter diesem Hagel aus Stahlspitzen überleben, doch sobald der angreifende Trupp des Earls sich auf hundert Schritt genähert hatte, zischten die ersten Armbrustbolzen aus der Mauer hervor.
In der Nähe des Tores befand sich eine Bresche. Sie war von einem Katapult geschlagen worden, dem einzigen Belagerungsgerät, das noch halbwegs funktionierte, und es war eine armselige Bresche, denn die großen Wurfsteine hatten lediglich das obere Drittel der Mauer durchbrochen, und die Stadtbewohner hatten die Lücke mit Holz und Stoffbündeln gestopft. Doch es war immerhin eine Schwachstelle in der Mauer, und die Männer mit den Leitern stürmten johlend darauf zu, während die Armbrustbolzen sich in ihre Körper bohrten. Männer stolperten, fielen, krümmten sich und starben, doch es überlebten genug, um zwei Leitern an der Bresche aufzustellen, und die ersten Soldaten begannen den Aufstieg. Die Bogenschützen schossen, so schnell sie konnten, um die Stelle oberhalb der Bresche freizuhalten,





























