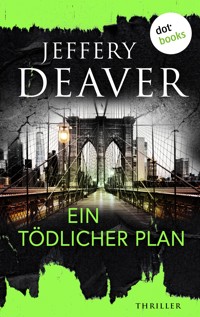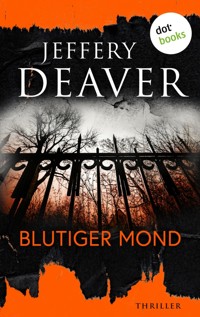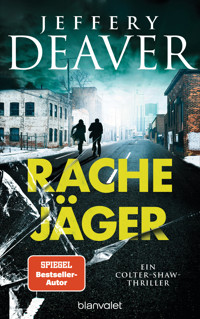10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Colter Shaw
- Sprache: Deutsch
Colter Shaw findet jede vermisste Person – auch wenn es ihn selbst das Leben kosten könnte ... Der zweite Band der spektakulären neuen Thriller-Reihe von SPIEGEL-Bestsellerautor Jeffery Deaver.
Colter Shaw spürt vermisste Personen auf, mit den ausgesetzten Belohnungen verdient er seinen Lebensunterhalt. Doch dann nimmt ein Auftrag eine tragische Wendung, und Shaw muss herausfinden, wie es dazu kommen konnte. Seine Suche nach Antworten führt ihn zu einer undurchsichtigen Organisation, die sich als Selbsthilfegruppe ausgibt. Shaw tritt der Gruppe bei – denn er hat den Verdacht, dass diese weitaus perfidere Ziele als Trauerbewältigung verfolgt. Alles deutet darauf hin, dass es sich um eine gefährliche Sekte handelt, die alles dafür tun würde, ihre Geheimnisse zu bewahren. Und bald werden die ersten Mitglieder misstrauisch …
Lesen Sie auch Band 1 der unabhängig voneinander lesbaren Colter-Shaw-Reihe: »Der Todesspieler«.
Kennen Sie auch schon die Lincoln-Rhyme-Thriller? Ein Muss für alle Deaver-Fans!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Colter Shaw spürt vermisste Personen auf, mit den ausgesetzten Belohnungen verdient er seinen Lebensunterhalt. Doch dann nimmt ein Auftrag eine tragische Wendung, und Shaw muss herausfinden, wie es dazu kommen konnte. Seine Suche nach Antworten führt ihn zu einer undurchsichtigen Organisation, die sich als Selbsthilfegruppe ausgibt. Shaw tritt der Gruppe bei – denn er hat den Verdacht, dass diese weitaus perfidere Ziele als Trauerbewältigung verfolgt. Alles deutet darauf hin, dass es sich um eine gefährliche Sekte handelt, die alles dafür tun würde, ihre Geheimnisse zu bewahren. Und bald werden die ersten Mitglieder misstrauisch …
Lesen Sie auch Band 1 der unabhängig voneinander lesbaren Colter-Shaw-Reihe: Der Todesspieler
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Weitere Informationen unter: www.jeffery-deaver.de
Von Jeffery Deaver bereits erschienen
Der Knochenjäger · Letzter Tanz · Der Insektensammler · Das Gesicht des Drachen · Der faule Henker · Das Teufelsspiel · Der gehetzte Uhrmacher · Der Täuscher · Opferlämmer · Todeszimmer · Der Giftzeichner · Der talentierte Mörder · Der Komponist · Der Todbringer · Der Todesspieler
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
JEFFERY DEAVER
DER BÖSE HIRTE
Thriller
Deutsch von Thomas Haufschild
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »The Goodbye Man« bei G. P. Putnam’s Son, an imprint of Penguin Random House LLC, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2020 by Gunner Publications, LLC
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Rainer Schöttle
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotive: © Paul Sheen/Trevillion Images; www.buerosued.de
JaB · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28538-8V001
www.blanvalet.de
Für Jane Davis, mit grenzenloser Dankbarkeit
Welch eine Reise hinter mir liegt, welch Dinge ich gesehen habe … Gebt mir einen Krug Wasser und einen menschlichen Leib. Gebt mir Luft zum Atmen und eine kräftige Brise, auf der ich aus der Unterwelt emporsteige.
Das altägyptische Totenbuch
EINS DER MANN AUF DER KLIPPE
1 11. Juni, 14.00 Uhr
Ihm blieben nur Sekunden.
Nach links ausweichen? Oder nach rechts?
Ins abschüssige Unterholz? Oder über den schmalen Seitenstreifen auf die Steilwand zu?
Nach links.
Instinktiv.
Colter Shaw riss das Lenkrad des Kia herum und bremste stoßweise, um auf der Bergstraße nicht ins Schleudern zu geraten. Der Mietwagen, der bestimmt fünfundsechzig Sachen draufgehabt hatte, verfehlte nur haarscharf den Felsbrocken, der einen schroffen Hügel hinuntergerollt und mitten auf der Straße gelandet war, und tauchte ins Dickicht ein. Shaw hätte sich das Geräusch von zwei Zentnern Gestein, die durch Sträucher und über Geröll walzten, irgendwie dramatischer vorgestellt, aber das alles lief fast lautlos ab.
Und links erwies sich als die richtige Wahl.
Hätte er sich für rechts entschieden, wäre das Auto gegen einen Granitausläufer geprallt, der von hohem beigefarbenem Gras verdeckt wurde.
Shaw, der vor beruflichen Entscheidungen viel Zeit darauf verwandte, die prozentuale Wahrscheinlichkeit von nachteiligen Entwicklungen einzuschätzen, wusste andererseits, dass man sich manchmal auf sein Würfelglück verlassen musste.
Die Airbags lösten nicht aus, und er blieb unverletzt. Aber er war in dem Kia gefangen. Zu seiner Linken erstreckte sich ein Meer aus Mahonien, auch bekannt als Oregons offizielle Staatsblumen, deren nadelspitze Stachelzähne mühelos durch Kleidung und Haut drangen. Dort konnte er also schon mal nicht aussteigen. Auf der anderen Seite sah es deutlich besser aus: etwas Fingerkraut in fröhlich gelber Juniblüte und ein Forsythiengestrüpp.
Shaw stieß die Beifahrertür mehrmals hintereinander auf und drängte so die verschlungenen Pflanzen zurück. Dabei wurde ihm bewusst, dass der Angreifer den Zeitpunkt gut abgepasst hatte. Wäre der Felsbrocken früher aufgeschlagen, hätte Shaw problemlos bremsen können. Und bei etwas mehr Verzögerung wäre Shaw der Waffe zuvorgekommen und nun immer noch auf der Straße unterwegs.
Denn eine Waffe musste es gewesen sein.
Im Bundesstaat Washington waren Erdbeben und alle möglichen seismischen Aktivitäten zwar prinzipiell nichts Ungewöhnliches, aber in dieser Gegend hatte in letzter Zeit gar nichts gebebt. Und Brocken dieser Größe blieben normalerweise liegen, sofern man sie nicht absichtlich weghebelte – damit sie vor oder auf Autos landeten, mit denen Menschen einen flüchtigen bewaffneten Verbrecher verfolgten.
Shaw zog sein braun kariertes Sakko aus und zwängte sich durch den Spalt zwischen Tür und Rahmen. Er war gut in Form, ganz wie man es bei jemandem erwarten würde, der in seiner Freizeit senkrechte Felswände emporkletterte. Trotzdem blieb er in der nur etwa fünfunddreißig Zentimeter breiten Öffnung stecken. Er drückte die Tür von sich, wich ins Auto zurück und stieß sie dann erneut wiederholt auf, um die Lücke allmählich zu weiten.
Auf der anderen Straßenseite ertönte lautes Rascheln und Knacken. Der Mann, der Shaw den Felsbrocken in den Weg gerollt hatte, arbeitete sich nun den Hügel hinunter durch den dichten Bewuchs in seine Richtung vor, während Shaw noch darum kämpfte, sich zu befreien. In der Hand des Mannes blitzte etwas auf. Eine Schusswaffe.
Als Sohn eines Survival-Fanatikers und als gewissermaßen auch eigenständiger Überlebensfachmann kannte Shaw zahllose Wege, den Tod zu überlisten. Andererseits war er Felskletterer und begeisterter Motocross-Fahrer und hatte beruflich mit Mördern und entlaufenen Schwerkriminellen zu tun, die vor nichts zurückschreckten, um auf freiem Fuß zu bleiben. Daher war der Tod für ihn ein vertrauter und allgegenwärtiger Begleiter. Doch nicht die Aussicht auf das Ende machte ihm zu schaffen, denn das war für jeden ohnehin unausweichlich. Viel schlimmer für ihn wäre eine unheilbare Verletzung seines Rückgrats gewesen, der Augen oder Ohren, die ihn zum Krüppel machen oder die Welt auf ewig in Finsternis oder Stille versinken lassen würde.
Schon als Kind hatte Shaw unter den drei Geschwistern als »der Rastlose« gegolten. Heutzutage, als erwachsener und ebenso ruheloser Mann, wusste er, dass eine solche Behinderung die reinste Hölle für ihn sein würde.
Er schob sich weiter durch den Spalt.
Fast geschafft.
Na los, komm schon …
Ja!
Nein.
Gerade als er sich vollständig frei wähnte, blieb seine Brieftasche, die hinten links in seiner schwarzen Jeans steckte, an irgendwas hängen.
Der Angreifer hielt inne, beugte sich durch das Unterholz vor und hob die Waffe. Shaw hörte, wie der Hahn gespannt wurde. Ein Revolver.
Und zwar ein großer. Als er abgefeuert wurde, riss der Mündungsknall mehrere grüne Blätter von den Zweigen.
Das Projektil ging fehl und ließ ein Stück neben Shaw die Erde aufspritzen.
Wieder ein Klicken.
Der Mann schoss erneut.
Diese Kugel fand ihr Ziel.
2 11. Juni, 8.00 Uhr, sechs Stunden zuvor
Shaw manövrierte sein neun Meter langes Winnebago-Wohnmobil durch die gewundenen Straßen von Gig Harbor im Bundesstaat Washington.
Der etwa siebentausend Einwohner große Ort wirkte sowohl idyllisch als auch ein wenig heruntergekommen. Wie der Name besagte, handelte es sich um einen Hafen, gut geschützt und mit dem Puget Sound durch eine schmale Durchfahrt verbunden, auf der nun Freizeit- und Fischerboote entlangglitten. Der Winnebago rollte an mehreren Fabriken und Werkstätten vorbei, teils noch in Betrieb, teils schon lange stillgelegt, die alle mit dem Bau von Booten oder deren unzähligen Bestand- und Zubehörteilen zu tun hatten. Für Colter Shaw, seit jeher eine echte Landratte, sah es so aus, als könne man jede Minute eines jeden Tages damit zubringen, ein Boot zu warten, zu reparieren, zu putzen und zu verwalten, ohne auch nur ein einziges Mal damit in See zu stechen.
Ein Schild kündigte die Segnung der Flotte in der Mitte des Hafenbeckens an, doch die Daten verrieten, dass die Zeremonie bereits vor einigen Tagen stattgefunden haben musste.
SPORT- UNDFREIZEITBOOTESINDWILLKOMMEN!
Der Branche ging es vielleicht nicht mehr so gut wie früher, und die Organisatoren wollten das Ereignis dadurch aufwerten, dass sie Anwälte, Ärzte und Geschäftsleute mit ihren Kabinenkreuzern in den Kreis der Fischerboote aufnahmen – immer vorausgesetzt, die Segnung fand tatsächlich in einer Kreisformation statt.
Shaw, ein professioneller Prämienjäger, war wegen eines Auftrags hier – so bezeichnete er für gewöhnlich seine Tätigkeit. Fälle wurden von Polizisten untersucht und von Staatsanwälten vor Gericht gebracht. Wenngleich Shaw in den letzten Jahren eine Vielzahl von Straftätern verfolgt hatte und womöglich einen guten Detective abgegeben hätte, wollte er sich nicht den Hierarchien und Vorschriften unterwerfen, die mit einer solchen Anstellung einhergingen. Es stand ihm frei, Aufträge ganz nach Belieben anzunehmen oder abzulehnen. Und er konnte sie auch jederzeit abbrechen.
Diese Freiheit bedeutete ihm viel.
So dachte Colter Shaw nun über das Hassverbrechen nach, das ihn hergeführt hatte. Auf der ersten Seite des Notizbuchs, das er bei diesen Ermittlungen führen würde, standen die Informationen, die seine Disponentin ihm mitgeteilt hatte:
Ort: Gig Harbor, Pierce County, Washington State.
Prämie ausgesetzt für Informationen zur Ergreifung und Verurteilung zweier Personen:
Adam Harper, 27, wohnhaft in Tacoma.Erick Young, 20, wohnhaft in Gig Harbor.Sachverhalt: In dem Bezirk hat sich eine Reihe von Hassverbrechen ereignet, darunter Schmierereien (Hakenkreuze, die Zahlen 88 [Nazi-Symbol] und 666 [Zeichen des Teufels]) auf Synagogen und einem halben Dutzend Kirchen, vornehmlich mit überwiegend schwarzen Gemeinden. Am 7. Juni wurde die Brethren Baptist Church von Gig Harbor verunstaltet und ein brennendes Kreuz davor aufgepflanzt. Ursprünglich wurde vermeldet, die Kirche selbst sei in Brand gesteckt worden, aber das entsprach nicht der Wahrheit. Ein Hausmeister und ein Laienprediger (William DuBois und Robinson Estes) liefen nach draußen und stellten sich den zwei Verdächtigen entgegen. Harper schoss die beiden Männer daraufhin mit einer Faustfeuerwaffe nieder. Der Prediger konnte inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden, der Hausmeister liegt weiterhin auf der Intensivstation. Die Täter sind mit einem roten Toyota Pick-up geflohen, zugelassen auf Adam Harper.
Beteiligte Behörden: das Amt für Öffentliche Sicherheit des Pierce County in Abstimmung mit dem US-Justizministerium, das derzeit prüft, ob es sich um ein Hassverbrechen in Zuständigkeit des Bundes handelt.
Anbieter und Höhe der Belohnung:
Prämie eins: 50 000 Dollar, ausgesetzt vom Pierce County, garantiert durch den Kirchenrat von West-Washington (und den Hauptspender des Betrags, Ed Jasper, Gründer von Micro-Enterprises NA).Prämie zwei: 900 Dollar, ausgesetzt von Erick Youngs Eltern und Familienangehörigen.Besonderheiten: Dalton Crowe ist auf die Belohnung aus.
Dieser letzte Umstand gefiel Shaw gar nicht.
Crowe war ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse. Der Mittvierziger hatte nach seinem Militärdienst eine Sicherheitsfirma an der Ostküste eröffnet, damit aber wenig Erfolg gehabt und den Laden wieder geschlossen. Seitdem arbeitete er als freier Sicherheitsberater, Söldner und von Zeit zu Zeit auch als Prämienjäger. Shaws und Crowes Wege hatten sich mehrere Male gekreuzt, bisweilen auch gewaltsam. Sie gingen diesen Beruf unterschiedlich an. Crowe interessierte sich so gut wie nie für vermisste Personen, sondern jagte stets gesuchte Verbrecher oder entflohene Strafgefangene. Wenn man einen solchen Flüchtigen mit einer legalen Waffe und in Notwehr erschoss, bekam man trotzdem die Belohnung und landete meistens nicht hinter Gittern. Mit diesem Ansatz war Crowe das genaue Gegenteil von Shaw.
Shaw war sich nicht sicher gewesen, ob er den aktuellen Auftrag übernehmen wollte. Zwei Tage zuvor hatte er noch auf einem Gartenstuhl im Silicon Valley gesessen und eigentlich geplant, einer anderen Angelegenheit nachzugehen. Diese zweite Mission war persönlicher Natur und hatte mit seinem Vater und einem Geheimnis aus der Vergangenheit zu tun – einem Geheimnis, für das Shaw sich beinahe ein paar Kugeln in Ellbogen und Kniescheiben eingefangen hätte, aus der Pistole eines Killers mit dem komischen Namen Ebbitt Droon.
Das Risiko, verletzt zu werden, schreckte Shaw jedoch nicht ab, zumindest nicht, solange es sich in vernünftigem Rahmen hielt. Daher wollte er die Suche nach dem versteckten Schatz seines Vaters auch unbedingt fortsetzen.
Dann aber war er zu dem Schluss gelangt, dass die Ergreifung zweier offenkundiger Neonazis Priorität besaß, zumal die beiden bewaffnet waren und bereit schienen, über Leichen zu gehen.
Das Navigationsgerät lotste ihn nun durch die hügeligen und kurvenreichen Straßen von Gig Harbor, bis er die gesuchte Adresse fand, ein hübsches eingeschossiges Wohnhaus, dessen heiterer gelber Anstrich in krassem Gegensatz zu dem wolkenverhangenen grauen Himmel stand. Shaw sah in den Spiegel und strich sich das kurze, eng anliegende blonde Haar glatt. Es war nach einem zwanzigminütigen Nickerchen etwas zerzaust, Shaws einziger Pause während der zehnstündigen Fahrt von San Francisco hierher.
Er hängte sich seine Computertasche über die Schulter, stieg aus dem Wohnmobil, ging zur Haustür und klingelte.
Larry und Emma Young baten ihn hinein, und er folgte dem Ehepaar ins Wohnzimmer. Shaw schätzte die beiden auf Mitte vierzig. Ericks Vater hatte schütteres graubraunes Haar und trug eine beigefarbene Stoffhose sowie ein kurzärmeliges, makellos weißes T-Shirt. Er war glatt rasiert. Emma kaschierte ihre Figur mit einem rosafarbenen Glockenkleid. Sie hatte für den Besucher frisches Make-up aufgelegt, ahnte Shaw. Verschwundene Kinder bedeuteten einen großen Einschnitt, sodass regelmäßige Duschen und persönliche Kleinigkeiten oft vernachlässigt wurden. Nicht so hier.
Zwei Stehlampen verbreiteten Kreise aus heimeligem Licht im ganzen Raum. Die Tapete trug ein Muster aus gelben und rostbraunen Blumen, und auf der dunkelgrünen Auslegeware lagen orientalisch anmutende Teppiche, wie man sie im Baumarkt bekam. Ein angenehmes Zuhause. Bescheiden.
An einer Garderobe neben der Tür hing eine braune Arbeitsjacke. Sie war aus dickem Stoff und ziemlich fleckig. Auf der Brust war der Name Larry eingestickt. Shaw vermutete, dass der Mann als Mechaniker arbeitete.
Auch die Eheleute nahmen Shaw prüfend in Augenschein: das Sakko, die schwarze Jeans, das graue Button-Down-Hemd, die schwarzen Slipper. Also mehr oder weniger seine gängige Berufskleidung.
»Bitte setzen Sie sich, Sir«, sagte Larry.
Shaw entschied sich für einen bequemen, dick gepolsterten Lehnsessel aus leuchtend rotem Leder. Die Youngs nahmen gegenüber von ihm Platz. »Haben Sie seit unserem Gespräch etwas von Erick gehört?«
»Nein, Sir«, sagte Emma Young.
»Was ist der letzte Stand seitens der Polizei?«
»Er und dieser andere Mann, Adam, sind angeblich noch irgendwo hier in der Gegend«, sagte Larry. »Der Detective glaubt, dass die beiden Geld zusammenkratzen, also es sich irgendwo leihen oder vielleicht stehlen …«
»So etwas würde er nicht tun«, warf Emma ein.
»Das denkt aber die Polizei«, erklärte Larry. »Ich sage doch nur, was die mir erzählt haben.«
Die Mutter schluckte schwer. »Er hat noch nie … Ich meine, ich …« Sie fing an zu weinen – erneut. Ihre Augen waren bei Shaws Ankunft zwar trocken, aber gerötet und angeschwollen gewesen.
Er zog ein Notizbuch aus der Computertasche und nahm seinen Delta-Titanio-Galassia-Füllfederhalter schwarz, mit drei orangefarbenen Ringen zur Spitze hin. Shaw wollte mit dem Schreibgerät weder angeben, noch empfand er es als besonderen Luxus. Er machte sich im Verlauf seiner Aufträge nur umfangreiche Notizen und musste seine Hand dabei auf diese Weise weniger anstrengen. Außerdem bereitete das Schreiben ihm so ein wenig Freude.
Shaw notierte sich nun das Datum und die Namen der beiden Eheleute. Dann blickte er auf und bat um nähere Einzelheiten über das Leben des Sohnes: Erick studierte und hatte einen Teilzeitjob. Derzeit waren Semesterferien. Er wohnte noch zu Hause.
»Hat Erick früher schon mal mit Neonazis oder anderen Extremistengruppen zu tun gehabt?«
»Herrje, nein«, murmelte Larry, als könne er die Frage langsam nicht mehr hören.
»Das ist doch alles verrückt«, sagte Emma. »Er ist ein guter Junge. Na ja, es gab ein paar Schwierigkeiten, so wie bei allen anderen auch. Mit Drogen – ich meine, nach allem, was passiert ist, kann man das verstehen. Er hat sie bloß mal ausprobiert. Die Schule hat angerufen. Ohne Polizei. Das haben die gut geregelt.«
Larry verzog das Gesicht. »Pierce County gilt als das Meth- und Drogenzentrum des Staates. Sie sollten mal die ganzen Zeitungsartikel sehen. Vierzig Prozent von all dem Meth in Washington wird hier bei uns hergestellt.«
Shaw nickte. »Hat Erick Meth genommen?«
»Nein, dieses Oxy-Zeug. Nur vorübergehend. Er hat auch Antidepressiva eingenommen. Nimmt er immer noch.«
»Sie haben gerade gesagt ›nach allem, was passiert ist‹. Was meinen Sie damit?«
Die beiden sahen sich an. »Wir haben vor sechzehn Monaten unseren jüngeren Sohn verloren.«
»Wegen Drogen?«
Emmas Hand, die auf ihrem Oberschenkel lag, ballte sich zur Faust und zerknitterte das Kleid. »Nein. Er war auf seinem Fahrrad unterwegs und wurde von einem Betrunkenen überfahren. O Gott, das war schlimm. So schlimm. Und am schlimmsten für Erick. Es hat ihn verändert. Die zwei haben sich sehr nahegestanden.«
Brüder, dachte Shaw, der nur zu gut verstand, was für komplizierte Gefühle mit einer solchen Beziehung einhergingen.
»Aber er würde niemanden verletzen«, sagte Larry. »Und nichts Böses tun. Das hat er noch nie. Außer diese Sache bei der Kirche.«
»Das war er nicht«, herrschte seine Frau ihn an. »Du weißt, dass er das nicht war.«
»Laut den Zeugen hat Adam geschossen«, sagte Shaw. »Ich habe noch nichts über die Herkunft der Waffe gehört. Besitzt Erick eine? Oder hat er eventuell Zugang dazu?«
»Nein.«
»Dann dürfte es sich um die Waffe seines Freundes handeln.«
»Seines Freundes?«, fragte Larry. »Adam war keiner seiner Freunde. Wir hatten noch nie von ihm gehört.«
Emma wickelte sich geistesabwesend den Saum ihres Kleides um die geröteten Finger. Eine Angewohnheit. »Der hat auch das mit dem Kreuz gemacht, es angezündet. Und die Schmierereien. Alles! Adam hat Erick gekidnappt. So muss es gewesen sein. Er hatte eine Waffe und hat Erick gezwungen, mit ihm zu kommen. Hat ihm sein Auto abgenommen und ihn ausgeraubt.«
»Die beiden waren aber mit Adams Wagen unterwegs, nicht mit dem von Erick.«
»Das kann ich erklären«, behauptete die Mutter. »Erick war bestimmt so geistesgegenwärtig und hat den Schlüssel weggeworfen.«
»Hat er ein eigenes Bankkonto?«
»Ja«, sagte der Vater des Jungen.
Demnach würden die Eltern nichts von etwaigen Abhebungen wissen. Die Polizei konnte das herausfinden, auch hinsichtlich der Bankfilialen, die Erick aufgesucht hatte. Vermutlich war das bereits geschehen.
»Wissen Sie, über wie viel Geld er verfügt? Könnte er damit sehr weit kommen?«
»So etwa zweitausend Dollar, schätze ich.«
Shaw hatte sich im Raum umgeschaut und dabei vornehmlich auf die Fotos der beiden Söhne der Youngs geachtet. Erick sah gut aus, mit buschigem braunem Haar und unbeschwertem Lächeln. Aus den Medien kannte Shaw auch schon zwei Bilder von Adam Harper. Es waren zwar keine Polizeifotos, doch der junge Mann blickte jeweils argwöhnisch in die Kamera. Er trug kurzes blondes Haar mit blauen Strähnchen und wirkte ausgemergelt.
»Ich werde der Sache nachgehen und versuchen, Ihren Sohn zu finden.«
»Oh, gern, bitte«, sagte Larry. »Sie sind ganz anders als dieser grobe Kerl.«
»Den konnte ich nicht ausstehen«, murmelte Emma.
»Dalton Crowe?«
»Ja, so hieß er. Ich habe zu ihm gesagt, er solle verschwinden. Ich würde ihm keine Belohnung zahlen. Er hat gelacht und erwidert, die könne ich mir sonst wohin stecken. Er sei sowieso hinter dem großen Betrag her, Sie wissen schon – den fünfzigtausend, die das County ausgesetzt hat.«
»Wann war er hier?«
»Vorgestern.«
Shaw notierte sich: D. C. sucht Anbieter auf. 9. Juni.
»Lassen Sie mich Ihnen erläutern, wie ich vorgehe. Es wird Sie nichts kosten, solange ich Erick nicht gefunden habe. Ich berechne auch keine Spesen. Falls ich ihn ausfindig mache, schulden Sie mir die besagten neunhundert Dollar.«
»Es sind inzwischen eintausendsechzig Dollar«, verkündete Larry stolz. »Einer meiner Cousins hat sich beteiligt. Ich wünschte, es wäre mehr, aber …«
»Ich weiß, Sie möchten, dass ich Erick zu Ihnen heimbringe. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Es wird nach ihm gefahndet, und ich würde mich dadurch strafbar machen.«
»Wegen Beihilfe«, sagte Emma. »Das kenne ich aus dem Fernsehen.«
Colter Shaw lächelte eigentlich nur selten, aber bei Treffen wie diesen schien es die Anbieter zu beruhigen. »Ich nehme aber auch niemanden in Gewahrsam. Mein Geschäft sind Informationen, nicht Jedermann-Festnahmen. Falls es mir gelingt, Erick aufzuspüren, werde ich die Polizei nicht davon in Kenntnis setzen, solange nicht sichergestellt ist, dass weder ihm noch einer anderen Person Gefahr droht. Sie werden einen Anwalt benötigen. Kennen Sie einen?«
Die beiden sahen sich ein weiteres Mal an. »Uns hat mal jemand bei einem Vertrag beraten«, sagte Larry.
»Nein, Sie brauchen einen Strafverteidiger. Ich besorge Ihnen ein paar Namen.«
»Wir haben nicht das … Oder wir könnten vielleicht einen Kredit auf unser Haus aufnehmen.«
»Das werden Sie wohl müssen. Erick braucht einen fähigen Rechtsbeistand.«
Shaw überflog seine Notizen. Seine Handschrift war sehr klein und wegen ihrer Ebenmäßigkeit sogar mal als graziös bezeichnet worden. Das Notizbuch war unliniert. Shaw hatte das nicht nötig. Jede Zeile verlief perfekt waagerecht.
Während der nächsten zwanzig Minuten stellte Shaw weitere Fragen, und das Ehepaar antwortete ihm. Im Verlauf der Unterredung gewann er den Eindruck, dass der unerschütterliche Glaube an die Unschuld ihres Sohnes nicht gespielt war; die beiden konnten einfach nicht akzeptieren, dass der Sohn, den sie kannten, zu einem solchen Verbrechen fähig sein würde. Schon der bloße Gedanke erschien ihnen absurd. Adam Harper musste der einzige Täter sein.
Als Shaw der Ansicht war, vorläufig genug erfahren zu haben, steckte er Stift und Notizbuch ein, stand auf und verabschiedete sich. Die Eltern versprachen, ihm mitzuteilen, was sie von der Polizei erfuhren oder ob Erick womöglich Freunde oder Verwandte kontaktiert und um Geld oder anderweitige Hilfe gebeten hatte.
»Danke«, sagte Emma an der Tür und schien in Erwägung zu ziehen, ihn zu umarmen. Sie beließ es dabei.
Es war der Ehemann, der von seinen Gefühlen überwältigt wurde. Er bekam keinen zusammenhängenden Satz heraus und drückte Shaw schließlich einfach die Hand. Dann wandte Larry sich ab, bevor die erste Träne rollte.
Auf dem Weg zu seinem Winnebago dachte Shaw an den einen Punkt, den er Emma und Larry verschwiegen hatte: dass er von den Familienangehörigen keine Belohnung einforderte, falls die gesuchte Person nicht mehr am Leben sein sollte. Es hätte nichts genützt, diese Möglichkeit auch nur zu erwähnen, wenngleich Shaw insgeheim befürchtete, dass Erick Young ermordet worden war, sobald Adam Harper keine Verwendung mehr für ihn gehabt hatte.
3
Wieso sollte ich mit Ihnen reden?« Der Mann schnaubte verächtlich.
Er trug eine verblichene, rissige braune Lederjacke, dazu Jeans und Stiefel. Adam Harpers Vater Stan war gerade damit beschäftigt, an einem Kai Kartons voller Motoröl aufzustapeln. Offenbar bereitete der Schiffsausrüster eine Lieferung vor, die ein Zubringerboot hier abholen würde.
Die Luft roch durchdringend nach Kiefernholz, Treibgut und Petroleum.
»Ich helfe Erick Youngs Familie bei der Suche nach ihrem Sohn. Nach Kenntnis der Polizei waren er und Adam zusammen unterwegs.«
»Ich wette, es geht Ihnen um die Belohnung.«
»Ja, das stimmt. Können Sie mir irgendetwas Hilfreiches über Adam verraten? Wohin er gehen würde? Welche Freunde oder Verwandte er aufsuchen könnte?«
»Stecken Sie das weg.« Er wies auf das Notizbuch und den Stift in Shaws Hand.
Shaw schob beides in seine Jackentasche.
»Ich habe keine Ahnung.« Harper war stämmig wie ein Baum, mit rotblondem grau meliertem Haar und gesunder Gesichtsfarbe, wobei die Nase etwas geröteter wirkte als die Wangen.
Ericks Familie hatte für die Suche nach ihrem entflohenen Sohn Geld aufgeboten; Stan Harper hatte das nicht. Vielleicht hoffte er ja, Adam könne sich erfolgreich dem Zugriff entziehen. Harper hatte jedenfalls keine Veranlassung, mit Shaw zu reden. Trotzdem mauerte er nicht. Nicht wirklich. Drei Kartons später drehte er sich zu Shaw um. »Er hat schon immer Probleme gemacht. War launisch und unberechenbar. Hat gesagt, es sei, als würden ständig Bienen um seinen Kopf schwirren. Das war auch für uns nicht einfach, das dürfen Sie mir glauben. Ihn hat das nicht interessiert. Er war nur auf sich selbst fixiert. In der Schule gab es dauernd Ärger, immer wieder klingelte das Telefon. Adam und ich haben uns manches Mal deswegen in die Haare gekriegt.« Ein Blick zu Shaw. »Aber so ist das bei Vätern und Söhnen. Das passiert jedem. Als er von der Schule abgegangen ist und sich Arbeit auf dem Bau gesucht hat, wurde es etwas besser. Aber meistens war er bloß Tagelöhner. Aus jeder Festanstellung wurde er postwendend wieder gefeuert.«
Bei der nächsten Frage musste Shaw vorsichtig sein. Nach seiner Erfahrung wurde blinder Eifer oft von den Eltern an die Kinder vererbt, genau wie die Haarfarbe oder eine Veranlagung für Herzkrankheiten. Er scheute sich nicht, Rassisten offen auf ihre Einstellung anzusprechen, aber im Augenblick ging es ihm darum, Informationen zu sammeln. »Dieser Vorfall bei der Kirche … das Kreuz, die Schmierereien. Hat er je davon gesprochen, dass er so etwas vorhatte?«
»Nicht dass ich wüsste. Doch ich muss gestehen, dass er und ich kaum je miteinander geredet haben. Nach Kellys Tod – dem Tod meiner Frau – hat er sich sogar noch mehr zurückgezogen. Das hat ihn kalt erwischt. Für mich war klar, dass sie sterben würde, und ich habe versucht, mich irgendwie darauf vorzubereiten. Adam wollte einfach nicht wahrhaben, was vor sich ging … Er hat es schlicht ausgeblendet.«
»Vertreten Freunde von ihm rechtsextreme Ansichten? Hat er sich in entsprechenden Kreisen aufgehalten?«
»Was sind Sie? Ein Kopfgeldjäger?«
»Mein Beruf ist es, Leute zu finden.«
Ob diese Antwort ausreichend war oder Fragen offenließ, vermochte Shaw nicht zu sagen. Harper hob mühelos zwei große Kartons auf einmal an. Das mussten mehr als zwanzig Kilo sein.
»Ich weiß zwar nichts Konkretes, aber er war … wie soll ich sagen? Leicht zu beeindrucken. Er hat mal ein paar Musiker kennengelernt, und plötzlich wollte er ein Heavy-Metal-Star werden. Ein ganzes Jahr lang hat er von nichts anderem geredet. Dann war es vorbei damit, und er wollte Skateboards bauen und verkaufen. Daraus wurde aber nie was. Während der Highschool ist er in schlechte Gesellschaft geraten, hat Ladendiebstähle begangen und Drogen genommen. Er hat alles gemacht, was seine Freunde von ihm wollten. Wissen Sie, als die Polizei mir den Vorfall bei der Kirche geschildert hat, war ich nicht überrascht. Jedenfalls nicht sonderlich. Ich dachte mir, er ist irgendwie ausgerastet. Seit dem Tod seiner Mutter hat sich viel in ihm aufgestaut.«
Stan ging zum Rand des Kais, spuckte aus und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund.
»Diesen Erick sollten Sie sich mal genauer ansehen.«
»Bei ihm deutet nichts auf rechtsextreme Kontakte hin«, erwiderte Shaw. »Er ist auch nicht einschlägig vorbestraft.«
Harpers Augen verengten sich. »Adam ist übrigens mal für eine Weile verschwunden. Er war so ungefähr drei oder vier Wochen weg. Nachdem Kelly gestorben war. Er ist einfach gegangen, und als er zurückkam, hatte er sich verändert. Es ging ihm besser, er war nicht mehr so launisch. Ich fragte ihn, wo er gewesen sei. Er sagte, er könne nicht darüber reden. Vielleicht hat er da ein paar dieser Arschlöcher getroffen.«
»Wo?«
»Keine Ahnung.«
»Gibt es Freunde, mit denen ich sprechen könnte?«
Harper zuckte die Achseln. »Weiß ich nicht. Er war kein Kind mehr, verstehen Sie? Er hatte sein eigenes Leben. Und wir haben auch nicht am Telefon gequatscht wie er und seine Mama.« Harper erhielt eine SMS und verschickte eine Antwort. Sein Blick schweifte über das ruhige Hafenbecken. Dann zurück zu den Kartons.
»War er hetero?«, fragte Shaw.
»Sie meinen … im Sinne von nicht schwul?«
Shaw nickte.
»Was soll denn diese Frage?«
»Ich benötige so viele Fakten wie möglich.«
»Ich hab ihn immer nur mit Frauen gesehen. Mit keiner besonders lange.« Ein Seufzen. »Wir haben alles mit ihm versucht. Eine Therapie. Ja, das war ein guter Witz. Medikamente. Natürlich immer nur die teuersten. Und das alles zusätzlich zu Kellys Rechnungen für Ärzte und Krankenhausaufenthalte.« Er wies auf den Schuppen, der als Firmensitz von Harper Ship Services, Inc. fungierte. »Sehe ich etwa so aus, als könnte ich mir die goldene Versicherungskarte leisten?«
»Und nichts hat bei Adam funktioniert?«
»Kaum etwas. Abgesehen von diesen drei oder vier Wochen, die er wo auch immer gewesen ist.« Der letzte Karton wanderte auf den Stapel. »Vielleicht hat er Spaß daran gefunden, Kreuze anzuzünden und Kirchen zu beschmieren. Scheiße, wer kann das schon wissen? Und jetzt hab ich Papierkram zu erledigen.«
Shaw gab ihm eine Visitenkarte mit seiner Telefonnummer. »Falls Sie von ihm hören.«
Der Mann schob sich die Karte in die Gesäßtasche und lächelte zynisch, was wohl besagen sollte: Damit du dir dein Blutgeld verdienen kannst.
»Mr. Harper, ich möchte, dass den beiden nichts passiert.«
Harper wandte sich ab, hielt aber nach ein paar Schritten inne.
»Es war so unglaublich frustrierend. Manchmal wollte man ihn einfach nur schütteln und anschreien: ›Reiß dich gefälligst zusammen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Find dich endlich damit ab.‹«
* * *
Zurück im Winnebago bereitete Shaw sich einen Becher starken honduranischen Kaffee zu, gab ein wenig Milch hinein und setzte sich an den Tisch.
Während der nächsten halben Stunde telefonierte er mit einigen Verwandten der Youngs. Sie waren durchaus hilfsbereit, konnten aber keine nützlichen Informationen beisteuern. Danach kamen Ericks Freunde an die Reihe. Diejenigen, die mit Shaw sprechen wollten, wussten aber auch nicht, wo Erick sich aufhalten könnte, und brachten zumeist ihr Entsetzen darüber zum Ausdruck, dass er an einem Hassverbrechen beteiligt gewesen war. Ein Klassenkamerad sagte jedoch, seit dem Tod seines Bruders »ist er einfach … einfach nicht mehr derselbe, verstehen Sie?«.
Shaw setzte sich mit Tom Pepper in Verbindung, einem ehemaligen FBI-Agenten und Freund, mit dem er hin und wieder zum Felsklettern ging. Pepper mochte sich nicht mehr im aktiven Dienst befinden, war aber innerhalb der Strafverfolgungsbehörden so gut vernetzt wie eh und je und besaß zudem eine umfassende Sicherheitsfreigabe. Darüber hinaus hatte er immer noch Spaß an Ermittlungsarbeit, und so zog Shaw ihn bisweilen zurate. Diesmal bat er ihn um den Namen eines der hier zuständigen Ermittler, entweder vom Amt für Öffentliche Sicherheit des Pierce County oder von der örtlichen FBI-Dienststelle.
Die Beziehung zwischen einem Prämienjäger und der Polizei ist mitunter kompliziert. Die Behörden haben keine Einwände gegen Hinweistelefone wie Crimewatch, die als Anlaufstelle für anonyme Informanten dienen sollen. Aktiven Ermittlern wie Shaw stehen die Cops aber sehr zögerlich gegenüber. Im Gegensatz zu Tippgebern haben Prämienjäger nämlich schon so manchen Fall behindert, was gelegentlich sogar zur Flucht eines Verdächtigen kurz vor der geplanten Festnahme führte. Oder sie wurden bei ihren Nachforschungen verletzt oder getötet, was für die Polizei einen Haufen Scherereien bedeutete.
Andererseits hatte Peppers Name einiges an Gewicht und folglich auch seine Zusicherung, Shaw würde niemandem in die Quere kommen und sich vermutlich sogar als hilfreich erweisen. Der leitende Detective des Pierce County, Chad Johnson, brachte Shaw daraufhin binnen zehn Minuten auf den aktuellen Stand, den Shaw sich sogleich notierte. Johnson lieferte auch nähere Einzelheiten zu Adam Harper und ergänzte damit die Aussage des Vaters.
Nach dem Telefonat machte Shaw sich einen weiteren Becher Kaffee und blätterte seine Notizen durch.
7. Juni. Gegen 18.30 Uhr begab Erick Young sich zum Forest-Hills-Friedhof an der Martinsville Road in Gig Harbor. Dort liegt sein Bruder Mark begraben, der vor sechzehn Monaten verstorben ist. Erick suchte das Grab regelmäßig auf.
Kurze Zeit später wurde Erick auf dem Friedhof laut Zeugenaussagen in Begleitung von Adam Harper gesehen. Bis dahin war ein Kontakt zwischen ihm und Harper nicht bekannt.
Gegen 19.30 Uhr wurden der Polizei Schüsse bei der Brethren Baptist Church gemeldet. Die Opfer – ein Laienprediger und ein Hausmeister – gaben an, dass zwei junge Männer, die später als Adam und Erick identifiziert wurden, ein Kreuz vor der Kirche aufgepflanzt und angezündet hätten. Die Kirche wurde außerdem mit Hakenkreuzen und Schmähungen beschmiert.
Als der Prediger und der Hausmeister nach draußen liefen und die Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollten, zog Adam eine Waffe und schoss die beiden nieder.
Die Verdächtigen flohen dann in Adams zehn Jahre altem roten Toyota Pick-up, zugelassen in Washington State. Ericks Wagen wurde später geparkt beim Friedhof gefunden.
Keiner von Ericks Social-Media-Einträgen lässt rassistische Tendenzen erkennen. Adam ist weder bei Facebook noch bei Twitter oder Instagram aktiv.
Keiner der beiden ist schwul, eine sexuelle Beziehung daher unwahrscheinlich.
Keiner von Ericks Verwandten oder Freunden hat von ihm gehört. Nach ihrer Kenntnis gibt es auch keinen speziellen Ort, den er aufsuchen würde.
Die behördlich veranlasste forensische Untersuchung ergab einen Zusammenhang zwischen den verunglimpfenden Schmierereien an der Brethren Baptist Church und ähnlichen Vorfällen im Pierce County während der letzten anderthalb Jahre.
Die Verdächtigen halten sich mutmaßlich immer noch im Umkreis von Tacoma auf, da sowohl Adam als auch Erick während der letzten Tage ihre Bankkonten geleert haben und der Pick-up zweimal von der Verkehrsüberwachung erfasst wurde. Das Geld soll vermutlich die Flucht an ein weit entferntes Ziel finanzieren.
Erick Young hat eine Teilzeitstelle in einer Resozialisierungseinrichtung für Jugendliche und absolviert an einem örtlichen Community College ein Bachelor-Studium. Er hatte Bestnoten in Mathe, Geschichte und Biologie, doch nach dem Tod seines Bruders litt er unter Stimmungsschwankungen, seine Leistungen verschlechterten sich, und er fehlte oft unentschuldigt bei der Arbeit. Dann machte auch noch seine Freundin mit ihm Schluss, und seine Eltern beschrieben ihn als »verwirrt und verletzlich«.
Adam Harper leidet seit Längerem unter Depressionen und anderen emotionalen Problemen. Er gilt als ziellos. Er hat das Community College besucht, aber nie abgeschlossen. Seinen Lebensunterhalt hat er zumeist mit handwerklicher Arbeit verdient.
Er wurde wegen Ladendiebstahls und kleinerer Drogenvergehen festgenommen. Bei ihm deutet nichts offen auf rassistische Neigungen hin, aber sein Vater berichtet von einer drei- oder vierwöchigen Abwesenheit. Hat er sich dabei einer Extremistengruppe angeschlossen?
Adam hat wenige Freunde. Soweit die Polizei sie ausfindig machen konnte, wissen weder sie noch seine Angehörigen, an wen er sich wenden oder an welchen Ort er womöglich fliehen würde.
Seine Wohnung, ein kleines Apartment im Osten von Tacoma, wurde durchsucht. Es fanden sich keine Hinweise auf extremistische Ansichten oder Kontakte.
Die benutzte Waffe war ein Smith-&–Wesson-Revolver, Modell Police Special, Kaliber 38, registriert auf Adams Vater.
Die Telefone der Verdächtigen sind ausgeschaltet.
Für beide Männer wurde ein Reisepass ausgestellt; Ericks befindet sich immer noch bei seinen Eltern.
Das Überwachungsvideo einer Wechselstube zeigt zwei Männer mit Sonnenbrillen und Kapuzenpullovern, die 500 US-Dollar in kanadische Dollar tauschen. Von der Statur her könnten es die Verdächtigen sein.
Shaw überflog die Einträge, lehnte sich zurück, schloss die Augen und ließ das Gelesene auf sich wirken, um daraus Folgerungen über den Vorfall und die Beteiligten ziehen zu können.
Sein Telefon summte. Es war Chad Johnson.
»Detective?«
»Wir haben die beiden, Mr. Shaw.«
Das bedeutete für Shaw einen neuen Geschwindigkeitsrekord, auch wenn ihm das kein Geld einbrachte. Doch wenigstens konnte er sich nun wieder seiner anderen Mission widmen: dem Geheimnis seines Vaters.
Echo Ridge …
»Wurde jemand verletzt? Haben sie Widerstand geleistet?«
Eine Pause. »Oh, wir haben sie noch nicht in Gewahrsam. Ich wollte sagen, wir haben sie ausfindig gemacht. Sie sind in Adams Pick-up unterwegs, erst nach Norden auf der Interstate 5, dann über Nebenstraßen, aber weiterhin in nördlicher Richtung. Um nach Kanada zu fliehen, schätze ich. Unser Team bereitet den Zugriff vor. Mit insgesamt zehn … Personen.«
Vor dem letzten Wort stockte er kurz. Shaw vermutete, dass man Johnson erst kürzlich darauf trainiert hatte, möglichst nicht mehr die rein männliche Sprachform zu benutzen.
»In einer Stunde müssten wir sie haben.«
»Gut.«
»Tut mir leid wegen der Belohnung, Sir.«
Er klang dabei nicht allzu bekümmert, fand Shaw. Vielleicht steuerten der Kirchenrat und das Hightech-Wunderkind Ed Jasper nicht die vollständige Belohnung bei und der Rest der Summe wäre von Johnsons Budget abgezweigt worden.
Shaw bedankte sich bei ihm, trank noch ein paar Schlucke Kaffee, schickte dann eine Nachricht an Mack McKenzie, seine Privatdetektivin mit Sitz in D. C., und erbat von ihr drei bestimmte Informationen. Wenig später traf ihre Antwort ein, so umfassend und präzise wie von ihr gewohnt.
Shaw las den Text aufmerksam, konsultierte eine Landkarte und ließ den Motor des Winnebago an. Er rollte von Stan Harpers Parkplatz, musterte die anderen Wagen – sowohl die abgestellten als auch die fahrenden Exemplare – und bog auf die unebene Straße ein. Dann verließ er Gig Harbor in östlicher Richtung und folgte den Anweisungen des Navigationsgeräts zu einem Wohnwagenpark, wo er den Winnebago zurücklassen und per Uber-Taxi einen Autoverleih aufsuchen wollte, um eine Stufenhecklimousine oder einen SUV zu mieten. Unterwegs reizte er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit gerade so weit aus, dass man ihn nicht wegen der Überschreitung anhalten würde.
Er konnte sich keine Verzögerung leisten. Die Zeit war mehr als knapp.
Wenige Stunden später lenkte Shaw seinen gemieteten Kia achtzig Kilometer östlich von Tacoma durch die herrliche Berglandschaft kurz vor dem Mount-Rainier-Nationalpark. Gewundene Straßen, Panoramaansichten, grüne Wälder und glänzende, schartige Felsformationen, die wie nasse Knochen aussahen.
Nach einer steil ansteigenden Serpentine erreichte er ein gerades Stück Strecke und beschleunigte den Wagen. Rechts von ihm ragte eine Steilwand auf.
Dann nahm er plötzlich eine Bewegung wahr.
Der Felsbrocken rollte direkt auf die Straße vor ihm zu.
Ihm blieben nur Sekunden.
Nach links ausweichen? Oder nach rechts?
4 11. Juni, 14.00 Uhr, Gegenwart
Diese Kugel fand ihr Ziel …
Ein Steinadler – aufgeschreckt durch den lauten Revolverknall, der durch das Tal rollte – erhob sich majestätisch in die Lüfte und ließ die störenden Menschen tief unter sich zurück.
Colter Shaw wandte den Kopf und bemerkte das große Einschussloch im rechten Vorderreifen des Kia. Der Wagen sackte in die Knie.
Shaw konnte sich endlich losmachen, schob sich durch die Forsythien und sah den Schützen die Straße überqueren. Der vollbärtige Mann streifte sich Pollenstaub und Kletten von seinen Ärmeln und der Jeans.
Dalton Crowe war fünf Zentimeter größer als Shaw, der immerhin eins zweiundachtzig maß. Seine breiten Schultern und der massige Brustkorb steckten in einem schwarz-rot karierten Holzfällerhemd. Dazu trug er eine Latzhose mit Tarnmuster und einen reich verzierten, abgenutzten Gürtel, dessen dunkle Farbe ungleichmäßig schimmerte. Das Holster für den langläufigen Revolver war nach Cowboy-Art geschnitten, braun, schillernd und mit verchromten Nieten.
Die beiden Männer hatten einander diverse Narben zugefügt, jeweils in ungefähr gleicher Anzahl, Länge und Tiefe. Die Blutergüsse und Prellungen waren längst wieder abgeklungen. Bei diesen Auseinandersetzungen hatte es sich nicht um Kämpfe auf Leben und Tod gehandelt, sondern einfach nur um den Wettstreit zweier Prämienjäger. In einem der Fälle hatte Crowe versucht, Shaw aufzuhalten, um selbst die volle Belohnung für einen entflohenen Häftling einstreichen zu können, während Shaw verhindern wollte, dass Crowe den in die Enge getriebenen und unbewaffneten Mann kurzerhand niederschoss.
Crowe erreichte nun Shaws Fahrbahnseite und warf einen Blick auf den Reifen. »Hmm.«
»Du hast in meine Richtung gefeuert«, sagte Shaw, nur leise tadelnd, denn er hatte sich nicht wirklich bedroht gefühlt. Ihm war von vornherein klar gewesen, dass hinter dem Felsbrocken und dem Schuss Crowe stecken musste und nicht etwa die beiden Gesuchten, Adam Harper und Erick Young.
Für einen so kräftigen Kerl, den man sich gut in der Kluft der Hells Angels vorstellen konnte, besaß Crowe eine seltsam hohe Stimme. »Ach was, Shaw, da irrst du dich. Ich habe dich vor einer Schlange gerettet.« Er stammte aus Birmingham, Alabama, und sprach mit dem Akzent der dortigen Bevölkerung. »Einer Wald-Klapperschlange, und zwar einer verdammt großen.«
Shaw suchte den Boden ab. »Wo ist sie denn?«
»Na ja, ich wollte sie ja bloß verscheuchen. Was mir auch gelungen ist, wie du siehst. Ich mag nämlich sämtliche Geschöpfe Gottes, auch Klapperschlangen. Tut mir leid wegen deinem Reifen.«
Shaw wies auf den Felsbrocken, der die Straße vollständig blockierte.
Crowe machte sich nicht die Mühe, auch hierzu eine Geschichte zu erfinden.
»Diese Jungs gehören mir, Shaw. Adam und Erick. Ich werde sie aufspüren und abliefern. Ich war schon vor dir in Gig Harbor. Also pack deinen Krempel und mach dich auf den Heimweg.«
»Wie hast du mich gefunden?«, fragte Shaw.
»Ich bin eben der Beste, ganz einfach.« Crowe steckte den Revolver ein. Shaw fragte sich, ob er die Waffe wohl jemals am Zeigefinger herumwirbeln ließ wie die Typen in den Western. Shaw hatte mal mit angesehen, wie jemand sich bei einem solchen Manöver selbst in die Achselhöhle schoss. Die menschliche Dummheit kennt keine Grenzen.
»Mehr hab ich dazu nicht zu sagen. Und jetzt muss ich den gelben Volkswagen einholen.«
Shaws Augenbrauen zogen sich zusammen. »Woher weißt du, dass sie …?« Seine Stimme erstarb, als hätte er Crowe versehentlich bestätigt, was dieser bis dahin nur vermutete.
»Ha! So, nun kümmere dich mal lieber um deinen Reifen. Rufst du den Automobilklub oder machst du das selbst?« Crowe ließ den Blick in die Runde schweifen, hinüber zu dem Felsbrocken und dann zurück zu Shaw. »Auf diesen Straßen, in so einem Brotkasten von Auto … da könntest du wirklich zu Schaden kommen. Natürlich nicht durch mich, der deinen Hintern vor Klapperschlangen bewahrt. Aber jemand könnte auch auf dich anlegen. Das fände ich ganz schrecklich.«
Nachdem er seine Drohung an den Mann gebracht hatte, drehte Crowe sich um, stapfte jenseits des Felsbrockens ein Stück die Straße hinauf und verschwand im Gebüsch. Kurz darauf kam dort sein silberner SUV zum Vorschein und entfernte sich von Shaw. Crowe streckte seine Hand aus dem Fenster des Bronco. War das ein Winken oder eine obszöne Geste?
Shaw wählte den Notruf und meldete der Staatspolizei den herabgestürzten Felsen. Es handelte sich zwar um ein gerades Stück Strecke, und das Hindernis war in beiden Richtungen aus fünfzig Metern Entfernung deutlich zu erkennen, doch es lag nun mal in Colter Shaws Natur, andere Menschen vor Schaden zu bewahren, auch wenn sie durch eigenes Verschulden in Gefahr gerieten. Ein Fahrer, der nicht auf die Straße, sondern auf sein Smartphone schaute, mochte die Ohrfeige durch den Airbag vielleicht verdient haben, aber nicht seine Kinder.
Die nächsten Minuten verbrachte Shaw mit der Überprüfung der Reifen und dem vorsichtigen Zurücksetzen aus dem stacheligen Unterholz. Er musste den Wagen aufschaukeln und die Räder drehten ein paarmal durch, aber schließlich rollte der Kia wieder auf den Asphalt.
Shaw wechselte den Reifen und nahm sich die Radkästen vor, bis er den Peilsender fand, den Crowe dort versteckt hatte. Er schaltete das Gerät aus und verstaute es in seinem Rucksack.
Dann wendete er und fuhr in die Richtung, aus der er gekommen war, genau entgegengesetzt zu Dalton Crowe. Shaw vergewisserte sich auf der Landkarte und schätzte, dass er Erick Young und Adam Harper in weniger als einer halben Stunde abfangen würde.
5
Es hatte etwas Mühe und Zeitaufwand bedeutet, doch das Problem Dalton Crowe musste gelöst werden.
Die Selbsteinschätzung des Mannes – »Ich bin eben der Beste« – traf nämlich in keiner Weise zu. Crowe war ein zweckmäßig agierender Spürhund ohne besonderes Talent und ein schlichtweg lausiger Beschatter. Daher wusste Shaw, dass Crowe ihn in Gig Harbor von Anfang an verfolgt hatte. Schon bei den Youngs war ihm der silberne SUV aufgefallen, der einige Türen weiter am Straßenrand parkte, genau vor einem Haus, in dessen Rasen ein Schild die bevorstehende Zwangsversteigerung ankündigte. Das allein war nicht unbedingt verdächtig, aber Shaw merkte es sich.
Als er sich wieder auf den Weg machte, fuhr er an dem SUV vorbei, und der Fahrer beugte sich zum Handschuhfach hinüber, als wolle er nicht gesehen werden. Gleich darauf fuhr auch der Bronco los und folgte dem Winnebago, und zwar den ganzen Weg bis zur Firma von Adams Vater, dem Schiffsausrüster.
Das konnte niemand anders als Dalton Crowe sein, der offenbar seit seiner Ankunft in der Hafenstadt das Haus der Youngs überwachte, nur für den Fall, dass der Junge, der sich bekanntermaßen noch in der Gegend aufhielt, dorthin zurückkehren würde.
In dem Moment hatte Shaws Mission sich verzweigt: erst Crowe loswerden, dann Adam und Erick finden.
Also hatte Shaw sich einen entsprechenden Plan überlegt.
Das Amt für Öffentliche Sicherheit nahm an, die beiden jungen Männer seien von Tacoma aus in nördlicher Richtung unterwegs, anscheinend auf der Flucht nach Kanada, wenn man die Aufnahmen aus der Wechselstube berücksichtigte.
Shaw war sich jedoch zu achtzig Prozent sicher, dass Adam und Erick nicht in dem roten Pick-up saßen.
Er hielt ein anderes Vorgehen für weitaus logischer und hatte Mack daher per E-Mail drei Fragen gestellt:
In welchem Viertel von Tacoma gibt es am meisten Bandenkriminalität?Wo liegt in oder bei diesem Viertel der nächste Busbahnhof?Wo in der Region um Seattle und Tacoma werden gestohlene Fahrzeuge am ehesten ausgeschlachtet?Die Antwort hatte gelautet: im Viertel Manitou; eine Western-Express-Station an der Evans Street; eine Vielzahl von Orten, jedoch mit einer gewissen Häufung von Schrottplätzen und Werkstätten im südlichen Teil von Seattle.
Shaw war überzeugt, dass die beiden sich verkleidet und kanadische Dollar eingetauscht hatten, um den Ermittlern vorzutäuschen, sie wollten nach Norden fliehen. Das allein reichte aber noch nicht aus. Sie mussten die Aufmerksamkeit außerdem auf Adams Auto lenken. Da Erick mit jugendlichen Straftätern arbeitete, wusste er wahrscheinlich über die Unterwelt des Pierce County Bescheid und würde den Pick-up an genau der richtigen Stelle platzieren können – mit dem Schlüssel unter dem Fahrersitz oder in einem der Radkästen »versteckt«. Kurze Zeit später würden ein paar Autodiebe sich den Wagen unter den Nagel reißen und nach Süd-Seattle fahren, um ihn in seine Einzelteile zu zerlegen.
Unterdessen waren Adam und Erick ein paar Blocks zu dem Busbahnhof an der Evans Street gegangen, hatten sich Fahrkarten gekauft und die Stadt verlassen.
Nachdem Shaw von Harpers Firma am Hafen aufgebrochen war, hatte er den Winnebago zu einem Campingplatz östlich von Tacoma gefahren und dort abgestellt. Ein Uber-Taxi brachte ihn zu einem nahen Autoverleih, wo er den Kia mietete und mit ihm ins Viertel Manitou fuhr. Crowe folgte ihm unbeholfen die ganze Zeit.
Shaw parkte vor einer Bodega, ging hinein und erkaufte sich mit einem Schmiergeld von zwanzig Dollar sowie dem Erwerb mehrerer Tüten Lebensmittel, die er gar nicht benötigte, das Recht, sich zur Hintertür hinauszuschleichen.
Von dort aus ging er zum Busbahnhof, der sich als wesentlich teureres Pflaster erwies. Es kostete Shaw fünfhundert Dollar, um den Zielort zu erfahren, für den die zwei Jungs sich Tickets gekauft hatten – eine Kleinstadt namens Hope’s Corner, hundertdreißig Kilometer südöstlich von Tacoma, unweit des Mount-Rainier-Nationalparks.
Das war eine gute Nachricht, denn sie bedeutete, dass alle beide noch am Leben waren.
Shaw kehrte quer durch die Bodega und zum Vordereingang hinaus zu seinem Wagen zurück und verstaute die Einkäufe im Kofferraum. Als er sich in den Verkehr einreihte, war der silberne SUV nicht weit hinter ihm. Crowe hatte die Gelegenheit genutzt und inzwischen den Peilsender am Kia angebracht.
Dann ging der Spaß los.
Shaw fuhr auf Umwegen in die generelle Richtung von Hope’s Corner, legte aber alle zwanzig Kilometer eine kurze Pause ein, um ein Wasser, einen Kaffee oder einen Snack zu kaufen – oder noch eine überflüssige Straßenkarte. Dabei stellte er den Verkäufern und anderen Kunden stets die gleiche Frage.
»Sagen Sie mal, ist hier ein gelber VW Käfer durchgekommen? Zwei meiner Freunde sind damit unterwegs. Wir wollten zum Angeln nach Wuikinuxv Falls, aber es gab eine Planänderung, und ich kann die beiden nicht erreichen. Die gehen einfach nicht ans Telefon.«
Der Sinn dieser Übung war die Irreführung Crowes, was das Fahrzeug und Ziel der Verdächtigen betraf. Nachdem der Mann sich mithilfe des Felsbrockens nun einen vermeintlichen Vorsprung verschafft hatte, jagte er einem farbenfrohen, nicht existierenden Auto hinterher zu einem Ort, dessen Name sich nur schwierig aussprechen und noch schwieriger buchstabieren ließ … und der in genau der entgegengesetzten Richtung von Hope’s Corner lag, wo die Verdächtigen sich in Wahrheit aufhielten.
Colter Shaw rollte nun am Ortseingangsschild von Hope’s Corner vorbei und verschaffte sich einen Überblick. Es gab hier einen Imbiss, eine Autowerkstatt, einen Gemischtwarenladen und zwei Tankstellen, von denen eine außerdem als Bushaltestelle diente; dort mussten die Verdächtigen ausgestiegen sein.
Darüber hinaus verfügte der Flecken über einen Aussichtspunkt, von dem aus man eine großartige Sicht auf den Mount Rainier hatte, den höchsten Berg des Bundesstaats. Er zählte zu den weltweit sechzehn Decade Volcanoes und galt als überaus gefährlich. Shaw wusste das, weil er und Tom Pepper mal erwogen hatten, hier klettern zu gehen. Doch obwohl derzeit kein Ausbruch drohte, stellten die Hänge und Flanken eine große Herausforderung dar, denn sie bestanden hauptsächlich aus Eis und Schnee. Das hätte eine spezielle Klettertechnik erfordert, die Shaw und Pepper nicht besonders reizte.
Shaw hielt mit dem Kia an einer Zapfsäule der größeren Tankstelle, tankte nach und inspizierte den Schaden von seinem Abstecher ins Unterholz. Nur ein paar Kratzer und Beulen. Dennoch natürlich teuer. Doch Shaw machte sich keine Sorgen; er mietete stets mit Vollkaskoversicherung. Nachdem er fertig war, fuhr er mit dem Wagen zu einer schattigen Stelle neben dem Gemischtwarenladen. Er stieg aus, ging zum Kofferraum, öffnete ihn und vergewisserte sich, dass niemand in der Nähe war und ihn auch keine Überwachungskamera erfasst hatte. Dann holte er seine Waffe hervor – eine kompakte Glock 42, Kaliber 380, verdeckt getragen in einem Blackhawk-Polymerholster. Er lud die Pistole durch und steckte sich das Holster rechts in den Hosenbund, sodass die Halteklammer fest an seinem Gürtel anlag; wie schnell man die Waffe auch ziehen mag, es nützt alles nichts, wenn man das Holster unfreiwillig mitzieht.
So, nun musste er herausfinden, wo genau die beiden Verdächtigen waren.
Shaw überlegte. Der Bus war laut Fahrplan vor dreißig Minuten hier eingetroffen. Waren sie von hier aus per Anhalter weitergefahren? Wollten sie zu Freunden irgendwo in der Nähe?
Weder Adam noch Erick schien ein Neonazi zu sein, aber vielleicht war das alles nur Tarnung. Immerhin kamen die verunglimpfenden und rassistischen Schmierereien seit mehr als einem Jahr im Pierce County vor, und nie war jemand erwischt worden. Nun, da man sie identifiziert und zur Flucht gezwungen hatte, trafen sie sich hier womöglich mit ihren Gesinnungsgenossen. Im Hinblick auf Hass- und Rassistenorganisationen besaß der Staat Washington eine wenig rühmliche Geschichte, wusste Shaw dank mehrerer zur Fahndung ausgeschriebener Verbrecher, deren Prämien er sich entlang der Westküste verdient hatte. Es gab hier im Staat fast zwei Dutzend einschlägiger aktiver Extremistengruppen, darunter zwei Ableger des Ku-Klux-Klans.
Vom Aussichtspunkt aus ließ Shaw den Blick über die weitläufige Landschaft schweifen, in der man mühelos ein Milizlager verstecken könnte.
Oder hatten die Jungs nach den Schüssen einfach nur Panik bekommen und waren so weit geflohen, wie ihre finanziellen Mittel dies gestatteten? Zu einem Freund, der ihnen Unterschlupf gewähren würde – einem Freund, von dem zu Hause niemand wusste?
Also, wie lautet die Einschätzung?, fragte Shaw sich.
Die Chance, dass sie hier aus dem Bus gestiegen und zu Fuß in die Wildnis aufgebrochen waren? Fünfzehn Prozent. In diesem Gelände benötigte man einiges an Ausrüstung, dazu die entsprechende Fitness und Kenntnisse über das Leben in freier Natur, über die die beiden jungen Männer nicht zu verfügen schienen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich mit jemandem treffen wollten, der sie an einen anderen Ort fuhr? Vierzig Prozent.
Eine Weiterreise per Anhalter auf einer der Querstraßen, die nach Osten und Westen aus Hope’s Corner hinausführten? Denkbar, aber schwierig; hier herrschte generell nur wenig Verkehr. Shaw entschied sich für zwanzig Prozent.
Die Zuflucht zu einem Freund? Fünfzehn Prozent.
Und es gab noch eine Option. Hielten sie sich weiterhin in Hope’s Corner auf?
Shaw hatte sein braunes Sakko angezogen. Damit seine Pistole auch wirklich unsichtbar blieb, zog er zudem das Hemd aus der Hose. Seine Genehmigung zum verdeckten Tragen einer Waffe besaß in diesem Staat Gültigkeit, aber er wollte vermeiden, dass jemand die Glock bemerkte und zu neugierig wurde.
Dann schlenderte er durch den Ort und hielt nach den beiden Gesuchten Ausschau.
Sie befanden sich in keinem der zwei Tankstellengebäude.
Danach kam der Gemischtwarenladen an die Reihe. Shaw betrat die niedrige, durchhängende Holzveranda und ging hinein, die Hand in der Nähe der Waffe. Kein Erick, kein Adam.
Er ging auf die Toilette, die er ohnehin aufsuchen musste; dort waren sie auch nicht.
Der Laden war eine Mischung aus Geschäft und Restaurant, an dessen rissigem Linoleumtresen ein halbes Dutzend Gäste saß. Shaw nahm sich eine Dose Reifendichtmittel, denn er hatte ja keinen Ersatzreifen mehr, und setzte sich auf einen der Barhocker, um ein Truthahnsandwich und einen großen Becher Kaffee zum Mitnehmen zu bestellen. Dann ging er mit der Tüte und der Dose zur Kasse und reichte seine Rechnung einem Mann mittleren Alters, dessen beigefarbenes Polyesterhemd mit einem Kettenmuster bestickt war.
Shaw legte einen Hundertdollarschein vor ihn hin.
Der Mann verzog das Gesicht. »Tut mir leid, Mister, darauf kann ich nicht herausgeben.«
»Ich will kein Wechselgeld.«
Der Mann merkte auf.
»Der Sohn eines Freundes von mir ist weggelaufen. Ich helfe dabei, ihn zu finden. Er war mit einem anderen Kerl unterwegs und könnte mit dem Bus aus Tacoma hergekommen sein.«
Einer der Gründe, weshalb Shaw sich vor Arbeitsbeginn gründlich rasierte, seine Schuhe putzte und ein gebügeltes Hemd und ein Jackett anzog, war der Wunsch, seriös zu wirken. Als würde er wirklich einem Freund bei der Suche nach dessen Sohn helfen. Er schenkte dem Mann ein weiteres Theaterlächeln.
»Hier ist ein Bild von ihm.« Er zeigte ein Foto von Erick vor. Der Junge trug darauf seine Football-Montur.
Shaw fragte sich, ob der Kassierer wohl die Nachrichten aus Tacoma verfolgte und von den Schüssen bei der Kirche gehört hatte. Anscheinend nicht. Der Mann fragte nur: »Auf welcher Position spielt er?«
»Receiver«, improvisierte Shaw. »Manchen Pass kann er sogar einhändig fangen.«
»Ist nicht wahr.«
»Doch, kann er.«
»Wieso ist er abgehauen?«
Shaw zuckte die Achseln. »Er ist eben noch ein halbes Kind.«
Der Geldschein verschwand in der Tasche des Mannes. »Ja, die beiden waren vor einer halben Stunde hier. Sie haben etwas zu essen und Wasser gekauft. Und ein Wegwerftelefon. Dazu eine Prepaidkarte.«
»Haben Sie mitbekommen, wohin die beiden wollten?«
»Nein.«
»Was liegt denn hier in Fußwegentfernung?«
Ein Achselzucken. »Keine Ahnung. In den Vorbergen gibt es mindestens ein Dutzend Hütten.« Noch ein Achselzucken, das wohl besagen sollte: Viel Spaß bei der Suche.
»Kann man als Wanderer andere Ortschaften erreichen?«
»Kommt drauf an, wer da wandert. Es ist ein ganz schönes Stück, aber man könnte es an einem Tag schaffen. Nach Snoqualmie Gap. Hieß früher mal Clark’s Gap. Nach Lewis und Clark. Dann wurde das zu Snoqualmie geändert. Ein indianisches Wort. Heißt so viel wie ›grimmiger Stamm‹. Manchen Leuten hat die Änderung nicht gepasst. Man kann es mit dem politisch korrekten Scheiß auch übertreiben.« Er hatte Shaw von oben bis unten gemustert, vielleicht, um sich von seiner weißen Hautfarbe zu überzeugen, bevor er diesen Kommentar abgab – ohne zu wissen, dass Shaw tatsächlich ein wenig indianisches Blut in den Adern hatte. »Es ist aber eigentlich beides Blödsinn.«
Shaw begriff nicht und schüttelte fragend den Kopf.
»Lewis und Clark waren nie in dieser Gegend, und den Snoqualmie River suchen Sie hier ebenfalls vergeblich. Da könnte man den Ort genauso gut New York, Los Angeles oder Podunk nennen. Vielleicht waren die beiden Jungs ja dahin unterwegs.« Er runzelte kurz die Stirn. »Wissen Sie, da gibt es auch noch dieses Dings in den Bergen etwas außerhalb – von Snoqualmie Gap, meine ich. Manchmal fragen Leute nach dem Weg dorthin.«
»Welches Dings?«
»Eine Art Refugium.«
»Für Separatisten? Neonazis?«
»Nein, das nicht. Mehr so für New-Age-Typen. Hippies. Das war vor Ihrer Zeit.«
Shaw war zwar in der Bay Area geboren, aber lange nach den Blumenkindern und dem 1967er Summer of Love. Doch er wusste, was Hippies waren.
Er wandte sich einer Landkarte zu, die an der Wand hing. Dort sah er Snoqualmie Gap, einen kleinen Ort in ungefähr fünfzehn Kilometern Entfernung von Hope’s Corner. In dem bergigen Gelände bedeutete das eine ziemlich anstrengende Wanderung.
»Und wo ist dieses Refugium?«
Der Kassierer kniff die Augen zusammen. »Ungefähr da, würde ich sagen.« Er zeigte auf ein Tal in den Bergen, bei einem großen See. Es lag etwa zehn oder elf Kilometer von Snoqualmie Gap entfernt, erreichbar über eine Staatsstraße und dann über die schmale Harbinger Road.
Zu Fuß würde man drei oder vier Stunden nach Snoqualmie Gap und weitere drei Stunden bis zu dem Refugium benötigen, sofern es überhaupt das Ziel der beiden war.
»Auf dem Weg hierher war auf den Straßen nicht viel los. Kann man per Anhalter nach Snoqualmie gelangen?«
»Man kann. Die nicht.«
»Warum?«
»Dieser Typ, mit dem der Sohn Ihres Freundes unterwegs ist … den würde ich nicht mal als Mutprobe zu mir ins Auto lassen. Sein Blick ist so komisch.«
Shaw bedankte sich bei dem Mann und wandte sich zum Gehen.
»He, Mister?«
Er drehte sich um.
Der Kassierer hatte die Stirn in Falten gelegt. »Sie haben vergessen, Ihre Rechnung zu bezahlen.« Er warf einen Blick auf den Zettel. »Das macht dann elf achtundzwanzig, bitte.«
6
Zehn Minuten später war Shaws Auftrag erledigt.
Er fand Adam Harper und Erick Young auf der Old Mill Road vor, etwa drei Kilometer außerhalb von Hope’s Corner und noch ein ganzes Stück von Snoqualmie Gap entfernt.
Shaw hielt auf einem schmalen Seitenstreifen und schaute zu seiner Linken nach unten. Die Straße hier verlief wegen des enormen Gefälles in Spitzkehren und führte hinab in ein Tal, in dem ein Fluss blausilbern glitzerte. Auf der anderen Seite stieg die Fahrbahn dann wieder in die Hügel empor.
Die jungen Männer befanden sich fünfzehn Meter unterhalb und stapften voran wie Collegekids auf einem Wochenendausflug. Jeder der beiden trug einen Rucksack. Adam hielt eine große Feldflasche. Erick zeigte gerade auf den steilen Anstieg, der ihnen jenseits der Brücke bevorstand. Adam sagte etwas, und Erick nickte.
Sie wirkten völlig unbekümmert.
Shaw nahm sie genau in Augenschein und konnte bei keinem von beiden eine Pistole erkennen, die sich in der Jackentasche abgezeichnet, oder einen Kolben, der daraus hervorgeragt hätte.
Erick griff in das Seitenfach seines Rucksacks und zog eine Plastiktüte heraus. Dörrfleisch, glaubte Shaw. Der Junge aß ein Stück und bot Adam davon an, der aber mit einem Kopfschütteln ablehnte. Die Verdächtigen erreichten das Ende des geraden Serpentinenteils und bogen nach links in die nächste Kehre ein. Shaw sah ihnen dabei zu. Die folgende Gerade wölbte sich auf halber Strecke auf eine Klippe hinaus. Es ging dort senkrecht hinab, und man hatte an der Kante einige Felsen als eine Art Leitplanke aufgereiht. Die zwei jungen Männer setzten sich auf einen dieser Steine, der die Größe eine Parkbank besaß. Erick aß noch etwas von dem Dörrfleisch, und Adam telefonierte mit jemandem.
Shaw zog seine Landkarte zurate und stellte fest, dass sie sich in Hammond County befanden. Dann rief er das zuständige Sheriff’s Office an. Man stellte ihn zum Sheriff persönlich durch, einem Mann namens Welles. Shaw informierte ihn über das Verbrechen in Pierce County und teilte ihm mit, er habe die beiden Verdächtigen gefunden. Der Sheriff überlegte kurz und erkundigte sich dann nach Shaws aktuellem Standort.
»Ich werde an der Kreuzung der Staatsstraße vierundsechzig und der Old Mill Road sein.«
»Okay, Sir. Lassen Sie mich das nur schnell überprüfen, und dann machen wir uns auf den Weg.«
Shaw wendete den Kia und fuhr die Old Mill Road zurück zu der Kreuzung in einem knappen Kilometer Entfernung. Er zog es vor, die Gesetzeshüter getrennt von Erick und Adam zu treffen, denn er kannte die Gewohnheiten und das Auftreten der hiesigen Deputys nicht und wollte vermeiden, dass sie mit heulenden Sirenen anrauschten und die harten Cops markierten. Das hätte die Verdächtigen nämlich zum Schießen verleiten können … oder zur Flucht ins Unterholz. Falls das geschah, würde es zu einer echten Plackerei werden, ihnen zu folgen, vor allem, falls sie sich trennten. Außerdem war dies ein beunruhigend gefährliches Gelände: steile Klippen, halsbrecherische Abhänge, reißende Stromschnellen. Der Fluss da unten sah zwar wunderschön aus, aber Shaw wusste, dass er kalt wie Metall im Januar sein und seine Fließgeschwindigkeit mehr als dreißig Kilometer pro Stunde betragen würde.
Shaw erreichte die Kreuzung und parkte dort. Wenig später trafen drei Streifenwagen und ein Zivilfahrzeug ein – ein schlammbespritzter SUV. Shaw und die Männer stiegen aus. Es waren fünf. Von jugendlichen Anfang zwanzig bis irgendwo im mittleren Alter. Welles, der Sheriff, war um die fünfzig und beleibt. Sein blondes Haar stand in seltsamem Widerspruch zu seinen Augen, die braun wie altes Leder waren.
Alle trugen graue Uniformen, nur nicht der Größte, ein schlanker und grobknochiger Bartträger in grün-schwarzem Flecktarn, dessen dunkle sandfarbene Baseballmütze mit dem Schirm nach hinten auf seinem Kopf saß. Er hatte eine militärische Ausstrahlung und konnte sich mit Anfang vierzig durchaus schon im Ruhestand befinden. Zwanzig Jahre Dienstzeit und fertig. Das verblichene Namensschild an seiner Jacke war schief; man hatte es von einer Uniform abgetrennt und auf die Jägerkluft aufgenäht. Dodd, J. Der SUV gehörte ihm. Der Pathfinder schien zwar zivil zu sein, doch Shaw entdeckte auf dem Armaturenbrett eine blaue Signalleuchte. Während die anderen Shaw in seinem Sakko und den Stadtschuhen neugierig musterten, blieb Dodds Miene ausdruckslos.
Welles trat vor und umschloss mit seiner Pranke Shaws Hand. »Sind Sie Kopfgeldjäger?«
»Nein.« Das war für Shaw nie infrage gekommen, denn dann hätte er meistens irgendwelchen flüchtigen Junkies hinterherlaufen müssen, deren Kaution zu verfallen drohte. Männer wie die waren oft tatsächlich so dumm, sich bei ihren Eltern oder Freundinnen zu verstecken.
Er erwähnte die Belohnung.
Ein oder zwei Augenbrauen hoben sich.