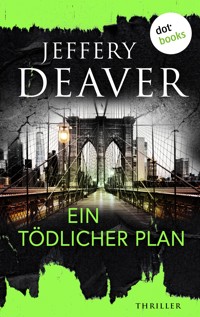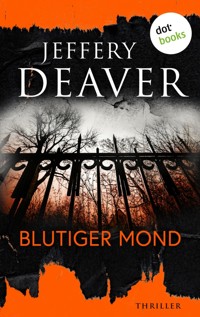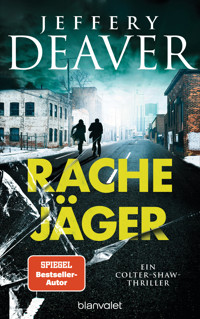9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lincoln-Rhyme-Thriller
- Sprache: Deutsch
Der 12. Fall für Lincoln Rhyme und Amelia Sachs.
Zwei Wochen nach einem brutalen Mord in Manhattan ist Detective Amelia Sachs dem vermeintlichen Killer dicht auf den Fersen. Sie liefert sich mit ihm eine Verfolgungsjagd in einem Einkaufszentrum in Brooklyn, als es dort zu einem technischen Defekt an einer der Rolltreppen kommt – mit verheerenden Folgen. Die Stufen brechen ein, ein Mann stürzt und wird vom Getriebe zerquetscht. Kurz darauf erkennen Amelia und ihr Partner Lincoln Rhyme, dass es sich bei dem Ereignis keineswegs um einen Unfall handelte. Der Täter verwandelt Alltagsgegenstände und intelligente Technologien in Mordwaffen – und er plant offensichtlich weitere Anschläge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Zwei Wochen nach einem brutalen Mord in Manhattan ist Detective Amelia Sachs dem vermeintlichen Killer dicht auf den Fersen. Sie liefert sich mit ihm eine Verfolgungsjagd in einem Einkaufszentrum in Brooklyn, als es dort zu einem technischen Defekt an einer der Rolltreppen kommt – mit verheerenden Folgen. Die Stufen brechen ein, ein Mann stürzt und wird vom Getriebe zerquetscht. Kurz darauf erkennen Amelia und ihr Partner Lincoln Rhyme, dass es sich bei dem Ereignis keineswegs um einen Unfall handelt. Der Täter verwandelt Alltagsgegenstände und intelligente Technologien in Mordwaffen – und er plant offensichtlich weitere Anschläge.
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Jeffery Deaver
Der talentierte Mörder
Thriller
Ins Deutsche übertragen von Thomas Haufschild
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Gunner Publications, LLC
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Rainer Schöttle
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Richard Nixon/Arcangel Images
AF · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18698-2 V003 www.blanvalet.de
Für Will und Tina Anderson und die Jungs …
Der Feind befindet sich in unseren Mauern. Gegen unseren eigenen Luxus, unsere eigene Dummheit und unsere eigene Kriminalität müssen wir kämpfen.
Cicero
I STUMPFE GEWALT
Dienstag
1
Manchmal hat man einfach Glück.
Amelia Sachs war mit ihrem kastanienbraunen Ford Torino auf Brooklyns Henry Street unterwegs. Es gab hier zahlreiche Geschäfte, und sie ließ ihren Blick beiläufig über den Verkehr und die Fußgänger schweifen, als sie auf einmal den Verdächtigen entdeckte.
Wie wahrscheinlich war das denn?
Das ungewöhnliche Erscheinungsbild von Täter 40 spielte dabei natürlich eine Rolle. So groß und vergleichsweise dünn, wie er war, hob er sich von den anderen Passanten ab. Das allein hätte allerdings kaum ausgereicht, um ihn hier in der Menge auffallen zu lassen. Doch als er zwei Wochen zuvor sein Opfer erschlagen hatte, war er laut einer Zeugenaussage mit einem blassgrünen, karierten Sakko und einer Baseballmütze der Braves bekleidet gewesen. Sachs hatte folgerichtig – wenngleich ohne viel Hoffnung – eine entsprechende Fahndung herausgegeben und sich dann den anderen Aspekten der Ermittlungen zugewandt … und anderen Fällen; die Detectives der Abteilung für Kapitalverbrechen hatten viel um die Ohren.
Vor einer Stunde jedoch hatte ein Streifenpolizist vom 84. Revier, der unweit der Brooklyn Heights Promenade zu Fuß seine Runde drehte, Sachs – den leitenden Detective in diesem Fall – verständigt, dass er den Verdächtigen möglicherweise gesichtet habe. Der Mord war am späten Abend auf einem verlassenen Baustellengelände verübt worden, und der Täter hatte offenbar keine Ahnung von der Zeugenaussage, denn ansonsten wäre er wohl kaum so leichtsinnig gewesen, erneut diese Kleidung zu tragen. Der uniformierte Beamte hatte den Verdächtigen im Gedränge aus den Augen verloren, aber Sachs war dennoch in die fragliche Gegend gerast und hatte Verstärkung angefordert, obwohl dieser Teil der Stadt weiträumig von zahllosen Passanten bevölkert wurde, die schon allein durch ihre schiere Menge Schutz vor Entdeckung boten. Die Chance, Mr. Vierzig hier noch aufspüren zu können, war praktisch gleich null, hatte Sachs enttäuscht bei sich gedacht.
Doch, Teufel noch mal, da vorn war er plötzlich und eilte mit langen Schritten voran. Groß, hager, grünes Jackett, Mütze, das volle Programm. Sachs konnte von hinten lediglich nicht erkennen, welches Vereinsemblem auf der Kappe prangte.
Sie hielt auf einer Busspur an, warf die NYPD-Parkerlaubnis auf das Armaturenbrett des klassischen Muscle Car und stieg aus. Ein lebensmüder Fahrradfahrer raste an ihr vorbei und verfehlte sie nur um wenige Zentimeter. Er schaute über die Schulter zurück, nicht etwa verärgert, sondern um anscheinend einen genaueren Blick auf das ehemalige Mannequin zu werfen, eine hochgewachsene Rothaarige mit entschlossener Miene und einer Waffe an der Hüfte ihrer schwarzen Jeans.
Sachs machte sich zu Fuß an die weitere Verfolgung des Killers.
Sie bekam ihn nun etwas genauer zu sehen. Der schlaksige Mann machte wirklich auffallend große Schritte, und seine langen, wenngleich schmalen Füße steckten in Joggingschuhen, die sich hier auf dem aprilfeuchten Beton deutlich besser für einen Sprint eignen würden als Amelias Stiefel mit den Ledersohlen. Ein Teil von ihr wünschte sich, der Mann wäre argwöhnischer und würde sich mal umschauen, damit sie einen Blick auf sein Gesicht werfen könnte, denn das war nach wie vor unbekannt. Aber nein, er trottete einfach in seiner seltsamen Gangart voran, die langen Arme an den Seiten und auf seiner hängenden Schulter einen Rucksack an einem der beiden Trageriemen.
Sachs fragte sich, ob darin wohl die Mordwaffe lag: der Kugelhammer mit dem auf einer Seite abgerundeten Kopf, der eigentlich Metallkanten glätten und Nieten flach klopfen sollte. Mit diesem Teil des Hammerkopfes war der Mord nämlich begangen worden, nicht mit der Nagelklaue am gegenüberliegenden Ende. Die Erkenntnis, womit man Todd Williams den Schädel eingeschlagen hatte, stammte aus einer Datenbank namens Waffenwirkungen auf den menschlichen Körper, ursprünglich angelegt von Lincoln Rhyme für die New Yorker Polizei und Gerichtsmedizin, genauer gesagt aus dem dortigen Abschnitt Nummer drei: Trauma durch stumpfe Gewalt.
Obwohl es sich um Rhymes Datenbank handelte, hatte Sachs die Analyse allein durchführen müssen. Ohne Rhyme.
Ihr Magen zog sich unwillkürlich zusammen. Amelia zwang sich, den Gedanken beiseitezuschieben.
Und rief sich erneut die Verletzungen ins Gedächtnis. Der neunundzwanzigjährige Mann aus Manhattan war auf schreckliche Weise erschlagen und ausgeraubt worden. Er hatte nach der Arbeit einen schwer angesagten Klub namens 40° Nord besuchen wollen, der – wie Sachs inzwischen wusste – nach dem Breitengrad seiner Lage im East Village benannt war.
Täter 40 – der seinen Spitznamen wiederum dem Klub verdankte – überquerte nun an einer grünen Ampel die Straße. Was für eine kuriose Statur er doch hatte. Bei mindestens einem Meter neunzig Körpergröße konnte er nicht mehr als fünfundsechzig oder siebzig Kilo wiegen.
Sachs sah, welches Ziel er ansteuerte, und ließ es über die Funkzentrale an ihre Verstärkung weitergeben: ein fünfgeschossiges Einkaufszentrum an der Henry Street. Sie folgte dem Verdächtigen hinein, hielt aber diskret Abstand.
Mr. Vierzig schwamm im Strom der Kunden mit. Die Leute in dieser Stadt befanden sich wie summende Atome stets in Bewegung, scharenweise Menschen aller Altersgruppen, Geschlechter, Hautfarben und Größen. New York funktionierte nach einem eigenen Takt, und so traf man hier ungeachtet der nachmittäglichen Stunde Geschäftsleute außerhalb ihrer Büros und Schüler außerhalb ihrer Klassenräume an, wie sie Geld ausgaben, aßen, umherliefen, sich in den Geschäften umsahen, Nachrichten auf ihren Smartphones tippten oder sich unterhielten.
Und dadurch Amelia Sachs’ Zugriffsplan beträchtlich verkomplizierten.
Vierzig fuhr hoch in den ersten Stock und schritt zielstrebig weiter durch die hell erleuchteten Gänge, die so austauschbar aussahen wie in jedem beliebigen Einkaufszentrum der USA. Aus Richtung der Imbisse roch es nach Öl und Zwiebeln, und aus den offenen Türen der Kaufhäuser wehte der Duft der Parfümerieabteilungen heran. Sachs fragte sich einen Moment lang, was Vierzig hier wohl vorhatte oder kaufen wollte.
Womöglich ging es ihm um sein leibliches Wohl, denn er betrat eine Starbucks-Filiale.
Sachs stellte sich hinter eine Säule neben der Rolltreppe, ungefähr sechs Meter vom Eingang des Franchiseladens entfernt. Sie achtete sorgfältig darauf, außer Sicht zu bleiben, denn der Mann durfte keinen Verdacht schöpfen. Er bewegte sich zwar nicht auf die charakteristische, etwas hüftsteife Weise, die jedem erfahrenen Polizisten verraten hätte, dass er eine Pistole bei sich trug, aber das musste nichts bedeuten. Und falls er Sachs bemerkte und das Feuer eröffnete, konnte das zu einem Blutbad führen.
Sie warf einen schnellen Blick in das Lokal und sah, dass er zwei Sandwiches aus der Auslage nahm und dann anscheinend ein Getränk bestellte. Oder sogar zwei. Er bezahlte und verschwand seitlich aus Amelias Blickfeld, um auf seinen Cappuccino oder Mokka zu warten. Irgendwas Ausgefallenes. Gewöhnlichen Filterkaffee hätte man ihm sofort serviert.
Würde er bleiben oder gehen? Zwei Sandwiches. Erwartete er jemanden? Oder wollte er das eine jetzt und das andere später essen?
Sachs überlegte. Wo war der beste Ort für den Zugriff? Draußen auf der Straße, gleich hier im Ladenlokal oder lieber in einem der Gänge des Einkaufszentrums? Ja, alles hier war voller Leute. Die Straße draußen aber auch. Keine der Alternativen gefiel ihr so richtig.
Es vergingen einige Minuten, und er war immer noch drinnen. Sein Getränk musste inzwischen fertig sein, doch er schien nicht an Aufbruch zu denken. Ein spätes Mittagessen, vermutete Sachs. Aber allein oder in Gesellschaft?
Wodurch ein ohnehin komplizierter Zugriff noch ein ganzes Stück schwieriger werden würde.
Sie erhielt einen Anruf.
»Amelia, hier ist Buddy Everett.«
»Hallo«, sagte sie leise zu dem Streifenbeamten vom 84. Revier. Sie kannten sich gut.
»Wir sind draußen. Dodd und ich. Und drei weitere Kollegen in einem zweiten Wagen.«
»Er ist im Starbucks im ersten Stock.«
In diesem Moment verließ ein Lieferjunge die Filiale mit mehreren Pappschachteln, auf denen das Starbucks-Logo prangte, die Meerjungfrau. Das bedeutete, es gab keinen Hinterausgang und Vierzig saß in der Falle. Ja, es waren andere Kunden im Laden, die in Gefahr geraten konnten, aber weniger als in den Gängen oder auf der Straße.
»Ich will ihn mir hier schnappen«, sagte Sachs zu Everett.
»Da drinnen, Amelia? Okay.« Eine Pause. »Bist du sicher?«
Der geht mir nicht durch die Lappen, dachte Sachs. »Ja. Kommt sofort her.«
»Sind unterwegs.«
Ein schneller Blick ins Innere, dann zurück in Deckung. Sie konnte ihn noch immer nicht ausmachen. Er musste im hinteren Teil sitzen. Amelia schob sich nach rechts und dann näher auf die offene Eingangstür des Lokals zu. Wenn sie ihn nicht sehen konnte, dann er sie auch nicht.
Sie und das Team würden seitlich …
Da ließ auf einmal ein gellender Schrei dicht hinter ihr Sachs zusammenzucken. Jemand litt grässliche Schmerzen, und der Laut war dermaßen roh und schrill, dass man nicht erkennen konnte, ob die Stimme zu einem Mann oder einer Frau gehörte.
Das kam vom oberen Ende der Rolltreppe, die aus dem Erdgeschoss hierher führte.
O Gott …
Die Metallplatte, auf die man beim Verlassen der Treppe trat, war aufgeklappt, und jemand war offenbar in den laufenden Antrieb gefallen.
»Hilfe! Nein! Bitte, bitte, bitte!« Es war ein Mann. Dann verschmolzen die Worte abermals zu einem Schrei.
Kunden und Angestellte gerieten schockiert in Aufruhr. Die Leute auf der betreffenden Rolltreppe machten kehrt oder sprangen seitlich über den Handlauf. Auch von der benachbarten Treppe, die nach unten führte, sprangen einige Menschen ab und landeten unsanft auf dem Boden. Vielleicht fürchteten sie, ebenfalls verschlungen zu werden.
Sachs schaute zu dem Starbucks.
Von 40 keine Spur. War ihm die Dienstmarke oder Waffe an ihrem Gürtel aufgefallen, als er wie alle anderen in die Richtung des Tumults gestarrt hatte?
Amelia verständigte Everett über den Unfall und wies ihn an, die Funkzentrale zu benachrichtigen und alle Ausgänge im Blick zu behalten, weil Täter 40 womöglich Lunte gerochen und die Flucht ergriffen habe. Dann eilte sie zu der Rolltreppe und bemerkte, dass jemand den Nothaltknopf betätigt hatte. Die Stufen wurden langsamer und blieben schließlich stehen.
»Halten Sie das an, halten Sie das an!« Gefolgt von weiteren Schreien des Opfers.
Sachs erreichte die klaffende Öffnung. Knapp zweieinhalb Meter unter ihr steckte ein Mann mittleren Alters – fünfundvierzig oder fünfzig – im Antrieb der Treppe fest. Der Motor lief immer noch, trotz des Nothalts. Wahrscheinlich wurde der Antrieb durch den Knopf lediglich ausgekuppelt. Der arme Kerl lag auf der Seite, hing an der Taille fest und schlug auf das Getriebe ein. Die Zahnräder hatten sich tief in seinen Leib gegraben. Blut durchtränkte seine Kleidung und lief auf den Boden des Schachts. Der Mann trug ein weißes Hemd mit Namensschild; anscheinend arbeitete er in einem der Geschäfte hier.
Sachs ließ den Blick über die Menge schweifen. Es waren mehrere Angestellte und ein paar Wachleute darunter, aber niemand tat irgendetwas, um zu helfen. Entsetzte Gesichter. Einige der Leute schienen den Notruf gewählt zu haben, aber die meisten nahmen mit ihren Mobiltelefonen Fotos und Videos auf.
»Hilfe ist unterwegs«, rief Sachs nach unten. »Ich bin vom NYPD. Ich komme jetzt zu Ihnen.«
»O Gott, tut das weh!« Weitere Schreie. Sachs konnte sie in ihrer Brust vibrieren fühlen.
Die Blutung musste gestoppt werden, wusste sie. Und außer dir wird niemand einen Finger rühren. Also los!
Sie stemmte die Metallklappe weiter auf. Amelia Sachs trug keinen Schmuck außer einem Ring mit blauem Stein. Sie zog ihn sich nun vom Finger, um nicht damit zwischen die Zahnräder zu geraten. Zwar wurde das eine Getriebe durch den Körper des Opfers blockiert, aber der Antrieb der Nachbartreppe lief weiter auf Hochtouren. Sachs bemühte sich nach Kräften, ihre Klaustrophobie zu ignorieren, und machte sich an den Abstieg. Es gab eine schmale Metallleiter für die Mechaniker, aber die war voller Blut. Der Mann schien sich beim Sturz an der scharfen Kante der Luke geschnitten zu haben. Sachs hielt sich gut fest, denn falls sie abrutschte und fiel, würde sie auf dem Mann und unmittelbar neben dem zweiten Getriebe landen. Einmal verloren ihre Füße den Halt, und ihre Armmuskeln verkrampften sich, um sie vor dem Fall zu bewahren. Ihr Stiefel streifte die laufenden Zahnräder, die sofort eine Furche in den Absatz frästen und am Aufschlag der Jeans zupften. Sachs riss ihr Bein zurück.
Dann war sie unten … Moment, Moment, sagte oder dachte sie und meinte damit sowohl den Mann als auch sich selbst.
Die Schreie des armen Teufels ließen nicht nach. Sein aschfahles, verzerrtes Antlitz glänzte vor Schweiß.
»Bitte, o Gott, o Gott …«
Sachs schob sich vorsichtig an dem zweiten Getriebe vorbei und geriet auf dem Blut zweimal ins Rutschen. Dann zuckte plötzlich das Bein des Mannes unfreiwillig vor und traf sie voll an der Hüfte. Sie kippte genau auf die Zahnräder zu.
Amelia fand im letzten Moment Halt, das Gesicht nur wenige Zentimeter von dem Getriebe entfernt. Sie rutschte erneut weg. Fing sich wieder. »Ich bin von der Polizei«, wiederholte sie. »Der Krankenwagen wird jede Minute hier sein.«
»Es ist schlimm, ganz schlimm. Es tut so höllisch weh, so verdammt weh.«
»He, da oben!«, rief Amelia. »Jemand vom Personal soll dieses Ding hier abschalten! Nicht bloß die Treppe, sondern den Motor! Drehen Sie den Saft ab!«
Verflucht, wo blieb die Feuerwehr? Sachs nahm die Verletzung in Augenschein. Sie hatte keine Ahnung, was sie machen sollte. Sie zog ihre Jacke aus und presste sie gegen das zerfetzte Fleisch seines Bauchs und Unterleibs. Es half kaum, die Blutung zu stillen.
»Ah, ah, ah«, wimmerte er.
Amelia trug in ihrer Gesäßtasche ein überaus illegales, aber sehr scharfes Springmesser bei sich. Konnte sie nicht einfach die Leitung kappen? Nein, hier waren nirgendwo Kabel zu sehen. Wie kann man eine solche Maschine konstruieren und dabei nicht an einen Abschaltknopf denken? Herrje. Diese Inkompetenz machte sie rasend.
»Meine Frau«, flüsterte der Mann.
»Ganz ruhig«, redete Sachs ihm gut zu. »Es kommt alles wieder in Ordnung.« Doch sie wusste, dass das nicht stimmte. Sein Körper war schwer verstümmelt. Der Mann würde nie mehr derselbe sein, auch wenn er überlebte.
»Meine Frau. Sie ist … Können Sie ihr etwas ausrichten? Und meinem Sohn? Sagen Sie den beiden, dass ich sie liebe.«
»Das können Sie ihnen selbst sagen, Greg.« Der Name stand auf dem Schild an seinem Hemd.
»Sie sind ein Cop«, keuchte er.
»Ja, genau. Und gleich kommt der Krankenwagen …«
»Geben Sie mir Ihre Waffe.«
»Meine …?«
Wieder Schreie. Tränen liefen ihm über das Gesicht.
»Bitte, geben Sie mir Ihre Waffe! Wie lässt sie sich abfeuern? Erklären Sie es mir!«
»Das kann ich nicht tun, Greg«, flüsterte sie und legte ihm eine Hand auf den Arm. Mit der anderen wischte sie ihm den Schweiß von der Stirn.
»Es tut so weh … ich halte das nicht mehr aus.« Ein Schrei, der lauter war als die anderen. »Ich will, dass es vorbei ist!«
Sie hatte noch nie einen Blick so ohne jede Hoffnung gesehen.
»Bitte, um Gottes willen, geben Sie mir Ihre Waffe!«
Amelia Sachs zögerte, griff dann an ihre Seite und zog die Glock aus dem Holster.
* * *
Eine Polizistin.
Nicht gut. Nicht gut.
Diese große Frau. Schwarze Jeans. Hübsches Gesicht. Und, oh, die roten Haare …
Eine Polizistin.
Ich habe sie an der Rolltreppe zurückgelassen und bewege mich durch die Menschenmenge im Einkaufszentrum.
Sie hat nicht mitbekommen, dass ich sie bemerkt hatte, glaube ich, aber das hatte ich. O ja. Ich konnte sie ganz deutlich sehen. Der Schrei des Mannes, der in diese Maschine gefallen ist, hat alle anderen dazu veranlasst, sich sofort dorthin umzuwenden. Außer ihr. Sie hat stattdessen nach mir in dieser hübschen Starbucks-Filiale Ausschau gehalten.
Ich habe die Pistole und die Dienstmarke an ihrem Gürtel gesehen. Das war keine normale Kundin und auch keine Privatschnüfflerin, sondern ein echter Cop. Wie bei Blue Bloods. Sie …
Nanu? Was war das denn?
Ein Schuss. Ich verstehe zwar nicht allzu viel davon, aber ich habe auch schon mal eine Pistole abgefeuert. Und das gerade eben war zweifellos eine gewesen.
Seltsam. Ja, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Hatte die Polizistin – nennen wir sie Rotschopf – etwa jemand anders verhaften wollen? Schwer zu sagen. Immerhin habe ich so einiges auf dem Kerbholz. Da wären zum Beispiel die Leichen, die ich vor einer Weile in diesem schlammigen Tümpel bei Newark versenkt habe, beschwert mit Hanteln, wie dicke Leute sie sich kaufen, sechseinhalb Mal benutzen und dann nie wieder. In den Zeitungen hatte kein Wort davon gestanden, aber nun ja, es war schließlich New Jersey. Gewissermaßen jedermanns Friedhof. Ein Toter? Ach, das lohnt die Nachricht nicht; die Mets haben mit sieben Punkten Vorsprung gewonnen! Oder sie könnte wegen des Zwischenfalls hinter mir her sein, der sich wenig später in einer dunklen Nebenstraße in Manhattan ereignet hatte, die Klinge saust, die Kehle klafft. Oder vielleicht wegen der Baustelle hinter dem Klub 40° Nord, wo ich mal wieder einen Schädel hübsch zu Brei geschlagen habe.
Hat mich an einem dieser Orte etwa jemand beim Schlitzen oder Zertrümmern beobachtet und den Cops beschrieben?
Schon möglich. Ich bin nun mal von, tja, sagen wir ungewöhnlicher Statur.
Also sollte ich wohl lieber davon ausgehen, dass Rotschopf hinter mir her ist. Vorsicht ist besser als Nachsicht … Ich muss weg von hier und den Kopf einziehen, mich ein Stück ducken. Zum Glück ist es einfacher, sich zehn Zentimeter kleiner zu machen als größer.
Aber dieser Schuss? Wie passte der ins Bild? Hatte sie jemanden erwischt, der sogar noch gefährlicher war als ich? Ich muss später unbedingt die Nachrichten einschalten.
Das Gedränge nimmt immer mehr zu, die Leute haben es eilig. Die meisten achten nicht auf mich großen, dürren Kerl mit den langen Füßen und Fingern. Sie wollen bloß weg von den Schreien und dem Pistolenschuss. Die Geschäfte leeren sich, die Tische vor den Imbissen auch. Alle haben Angst vor Terroristen, vor verrückten Typen in Tarnanzügen, die die Welt in Stücke stechen, hacken oder ballern wollen, weil sie so wütend oder vollkommen übergeschnappt sind. ISIS. Al-Qaida. Milizen. Alle stehen unter Strom.
Ich biege nun ab, schiebe mich zwischen Socken und Männerunterhosen durch.
Die Henry Street, Ausgang vier, liegt direkt vor mir. Soll ich diese Tür wählen?
Erst mal überlegen. Ich atme tief durch. Nichts überstürzen. Zunächst mal sollte ich das grüne Jackett und die Mütze loswerden. Mir was Neues kaufen. Ich betrete einen Billigladen und zahle bar für einen italienischen blauen Blazer aus chinesischer Fertigung. Rumpflänge neunzig Zentimeter, Glück gehabt. Die Größe ist selten. Dazu ein Fedora-Hut, wie die Hipster ihn tragen. Der Junge hinter dem Tresen – mit Wurzeln im Mittleren Osten, wie es aussieht – tippt den Betrag in die Kasse ein, ohne von seinem Smartphone aufzublicken. Wie unhöflich. Am liebsten möchte ich ihm den Schädel einschlagen. Wenigstens schaut er mir nicht ins Gesicht. Das wiederum ist gut. Ich verstaue das alte Sakko, das karierte grüne, in meinem Rucksack. Das Jackett stammt von meinem Bruder, daher werfe ich es nicht weg. Die Baseballmütze lege ich dazu.
Der chinesische Italo-Hipster tritt wieder hinaus auf den Gang des Einkaufszentrums. Also, welcher Fluchtweg? Die Henry Street?
Nein. Das wäre unklug. Draußen werden jede Menge Cops sein.
Ich schaue mich um. Hierhin, dorthin. Ah, ein Durchgang, laut Schild Nur für Personal – und für mich. Der führt bestimmt zu einer Laderampe.
Ich stoße die Tür auf, als würde ich hierhin gehören, mit den Knöcheln, nicht der Handfläche (natürlich wegen der Abdrücke).
Was für ein perfektes Timing, denke ich so bei mir: die Rolltreppe mit Rotschopf direkt daneben, als die Schreie losgehen. Ich bin wirklich ein Glückspilz.
Mit gesenktem Kopf gehe ich ruhig den Korridor entlang. Niemand hält mich auf.
Oh, da am Haken hängt ja eine Baumwolljacke mit Namensschild. Ich nehme das kleine glänzende Rechteck ab und hefte es mir an die Brust. Ab jetzt bin ich der freundliche Mitarbeiter Mario. Ich sehe zwar nicht nach einem Mario aus, aber ich kann jetzt nicht wählerisch sein.
Vor mir öffnet sich eine Tür, und zwei junge Männer treten auf den Gang, einer braun, der andere weiß. Ich nicke ihnen zu. Sie nicken zurück.
Hoffentlich ist keiner von denen Mario. Oder sein bester Kumpel. Falls doch, muss ich in meinen Rucksack greifen, und wir wissen ja, was das bedeutet: entschlossene Hiebe, brechende Schädel. Ich gehe an ihnen vorbei.
Gut.
Oder doch nicht. Einer der beiden ruft: »He!«
»Ja?«, frage ich, die Hand in der Nähe des Hammers.
»Was ist denn da draußen los?«
»Ein Raubüberfall, glaube ich. Vielleicht auf den Juwelier.«
»Die waren da immer zu geizig für Sicherheitsleute. Das hätte ich ihnen vorher sagen können.«
Sein Kollege: »Die hatten doch nur billigen Scheiß. Zirkone und so. Wer würde seinen Hintern für so was riskieren?«
Ich sehe ein Schild, auf dem Lieferungen steht, und folge gehorsam dem Pfeil.
Vor mir kann ich Stimmen hören. Ich bleibe stehen und spähe um die Ecke. Ein kleiner schwarzer Wachmann, dürr wie ich, ein bloßes Zweiglein. Er spricht in sein Funkgerät. Ich könnte ihn mit dem Hammer mühelos zerschmettern. Könnte sein Gesicht in zehn Teile zerlegen. Und dann …
O nein. Warum ist das Leben nur so gemein?
Zwei weitere kommen hinzu. Einer weiß, einer schwarz. Beide doppelt so schwer wie ich.
Ich weiche zurück. Und dann wird es noch schlimmer. Hinter mir, vom anderen Ende des Korridors, durch den ich gerade hergekommen bin, werden ebenfalls Stimmen laut. Womöglich Rotschopf und andere Cops, um den Bereich hier zu durchsuchen.
Und der einzige Ausgang, direkt vor mir, wird von drei Mietbullen versperrt, die nur darauf lauern, auch endlich mal Knochen brechen zu dürfen … oder wenigstens ihre Elektroschocker oder das Pfefferspray einzusetzen.
Mittendrin stecke ich und kann weder vor noch zurück.
2
»Wo ist er?«
»Wir suchen noch, Amelia«, antwortete Buddy Everett, der Streifenbeamte vom 84. Revier. »Sechs Teams. Alle Ausgänge sind abgedeckt, entweder durch uns oder den Sicherheitsdienst. Er muss hier irgendwo stecken.«
Sie wischte sich mit einer Starbucks-Serviette soeben das Blut vom Stiefel. Genauer gesagt, sie versuchte es, leider vergebens. Ihre Jacke steckte in einer Mülltüte, die sie ebenfalls von den Mitarbeitern des Kaffeeladens erhalten hatte. Das Kleidungsstück war vielleicht nicht unrettbar verloren, aber derzeit mit Blut durchtränkt, also konnte sie es kaum anziehen. Der junge Beamte musterte verunsichert die Flecke auf Amelias Händen. Auch Cops sind natürlich nur Menschen. Irgendwann gewöhnen sie sich an solche Anblicke, manche früher, andere später, aber Buddy Everett war noch jung.
Er schaute durch seine rot gerahmte Brille zu der offenen Luke der Rolltreppe. »Was ist mit …?«
»Er hat es nicht geschafft.«
Ein Nicken. Everett betrachtete Sachs’ blutige Stiefelabdrücke auf dem Boden.
»Und du hast keine Ahnung, in welche Richtung er verschwunden ist?«, fragte er.
»Nein.« Sie seufzte. Zwischen dem Moment, in dem Täter 40 sie bemerkt haben könnte und die Flucht ergriffen hatte, und dem Eintreffen der Verstärkung waren nur wenige Minuten verstrichen. Doch das schien ausgereicht zu haben, ihn unsichtbar werden zu lassen. »Okay. Ich helfe euch bei der Suche.«
»Am besten im Keller. Das da unten ist ein echtes Labyrinth.«
»Kein Problem. Aber schickt auch Leute raus auf die Straße. Falls er mich tatsächlich gesehen hat, muss er so schnell wie möglich nach draußen gerannt sein.«
»Machen wir, Amelia.«
Der junge Beamte mit dem Brillengestell von der Farbe trocknenden Blutes nickte und ging los.
»Detective?«, erklang hinter ihr eine Männerstimme.
Sachs drehte sich um und sah einen stämmigen Latino vor sich, ungefähr fünfzig Jahre alt, mit marineblauem Nadelstreifenanzug und gelbem Hemd. Seine Krawatte war makellos weiß. Eine solche Kombination war kein häufiger Anblick.
Sie nickte.
»Captain Madino.«
Er reichte ihr die Hand. Seine dunklen Augen richteten sich unter halb geschlossenen Lidern prüfend auf sie. Es war ein irgendwie fesselnder Blick, nicht auf erotische Weise, sondern als Teil der Ausstrahlung, die einflussreichen Männern – und auch manchen Frauen – gelegentlich zu eigen war.
Madino gehörte vermutlich zum 84. Revier und hatte nichts mit dem Fall Täter 40 zu tun, der der Abteilung für Kapitalverbrechen oblag. Er war wegen des Unfalls hier, wenngleich die Polizei sich wohl bald wieder davon zurückziehen würde, sofern man nicht zu dem Schluss gelangte, dass bei der Wartung der Rolltreppe strafbare Fahrlässigkeit vorgelegen hatte, was überaus selten vorkam. Dennoch würden es Madinos Leute sein, die den Schauplatz sicherten.
»Was ist passiert?«, fragte er.
»Das kann Ihnen die Feuerwehr wahrscheinlich besser erklären als ich. Ich habe hier einen Mordverdächtigen beschattet. Ich weiß nur, dass es bei der Rolltreppe zu irgendeiner Fehlfunktion gekommen und ein Mann mittleren Alters in den Antrieb gefallen ist. Ich bin zu ihm gelaufen und habe versucht, seine Blutung zu stoppen, konnte aber nicht viel ausrichten. Er hat eine Weile durchgehalten, doch am Ende blieb nur TATF.«
Tod am Tatort festgestellt.
»Was war mit dem Nothalt?«
»Jemand hat den Knopf gedrückt, aber dadurch wird bloß die Treppe angehalten, nicht der Hauptmotor. Das Getriebe läuft weiter. Es hat sich in seinen Unterleib und Bauch gegraben.«
»O Mann.« Die Lippen des Captains wurden schmal. Er trat vor und schaute in den Schacht. Madino ließ keine Reaktion erkennen. Er hielt seine Krawatte fest, damit sie nicht nach vorn schwang und gegen den Handlauf stieß. Das Blut war bis nach dort oben gelangt. Emotionslos drehte er sich wieder zu Sachs um. »Sie waren da unten?«
»Ja.«
»Das muss heftig gewesen sein.« Sein mitfühlender Blick wirkte aufrichtig. »Warum haben Sie Ihre Waffe abgefeuert?«
»Wegen des Motors«, erklärte Sachs. »Er ließ sich nicht abschalten, jedenfalls konnte ich keinen Schalter finden. Und auch keine Leitung, die ich hätte durchschneiden können. Ich konnte ja nicht einfach aufstehen und nach dem Schalter suchen oder nach oben klettern, um jemand anders aufzufordern, die Stromzufuhr zu unterbrechen; ich musste weiter Druck auf die Wunde ausüben. Also habe ich dem Motor eine Kugel in die Spule gejagt, damit das Getriebe den Mann nicht vollständig in Stücke riss. Leider war es zu dem Zeitpunkt schon zu spät für ihn. Die Sanitäter sagen, er hat achtzig Prozent seines Blutes verloren.«
Madino nickte. »Immerhin haben Sie Ihr Bestes gegeben, Detective.«
»Es hat nicht gereicht.«
»Was hätten Sie denn sonst tun können?« Er blickte wieder zu der offenen Luke. »Wegen des Schusses wird es die übliche Untersuchung geben, aber nach Lage der Dinge dürfte das bloß eine Formalität sein. Machen Sie sich keine Sorgen.«
»Danke, Captain.«
Im Gegensatz zu dem, was man im Kino oder Fernsehen vorgesetzt bekommt, feuert ein Polizist seine Waffe nur selten ab und muss sich stets dafür verantworten. Er darf nur schießen, wenn er sein Leben oder das Leben eines Unbeteiligten für akut gefährdet hält oder wenn ein bewaffneter Verbrecher flieht. Dann aber muss er schießen, um zu töten, nicht um zu verwunden. Und eigentlich darf eine Glock auch nicht als eine Art Schraubenschlüssel zweckentfremdet werden, um eine wild gewordene Maschine abzuschalten.
Sobald ein Cop – ob im Dienst oder nicht – seine Waffe abfeuert, kommt ein Vorgesetzter des zuständigen Reviers an den Schauplatz des Geschehens, um die Waffe des Beamten zu sichern und zu inspizieren. Danach beruft er eine Schusswaffenkommission ein, die unter dem Vorsitz eines Captains stehen muss. Da es hier durch den Schuss keinen Toten oder Verletzten gegeben hatte, brauchte Sachs sich weder einem Drogen- und Alkoholtest zu unterwerfen noch sich für die vorgeschriebenen drei Tage beurlauben zu lassen. Und da auch kein Dienstvergehen vorlag, musste sie ihre Waffe nicht abliefern, sondern nur vorlegen, damit der Captain sie in Augenschein nehmen und sich die Seriennummer notieren konnte.
Das tat Sachs nun: Sie ließ geschickt das Magazin aus dem Griff gleiten, lud die Glock einmal durch, um die Patrone aus der Kammer zu befördern, und hob diese vom Boden auf. Dann reichte sie die Waffe an Madino weiter. Er schrieb sich die Seriennummer auf und gab die Pistole zurück.
»Ich reiche Ihnen so schnell wie möglich meinen Bericht ein«, fügte Amelia hinzu.
»Das hat keine Eile, Detective. Es dauert ohnehin eine Weile, die Kommission zusammenzutrommeln, und wie es aussieht, haben Sie gerade genug andere Dinge um die Ohren.« Madino warf noch einen Blick in den Schacht. »Gott segne Sie, Detective. Nicht viele Leute hätten sich nach dort unten gewagt.«
Sachs drückte die ausgeworfene Patrone in das Magazin, schob es zurück in die Glock und lud die Waffe durch, damit sich wieder ein Schuss in der Kammer befand. Die Streifenbeamten vom 84. Revier hatten beide Rolltreppen abgesperrt, daher eilte Amelia zu den Aufzügen, um ins Untergeschoss zu fahren und bei der Suche nach Täter 40 behilflich zu sein. Doch dann blieb sie stehen, denn Buddy Everett kam angelaufen.
»Er ist weg, Amelia. Aus dem Gebäude geflohen.« Die Augen hinter seinen Brillengläsern sahen sowohl vergrößert als auch verzerrt aus.
»Auf welchem Weg?«
»Über die Laderampe.«
»Ich dachte, die würde bewacht. Wenn nicht durch uns, dann durch den Sicherheitsdienst.«
»Der Täter stand wohl um die Ecke und hat ihnen zugerufen, der Verdächtige habe sich in einem Lagerraum versteckt. Sie sollten unbedingt ihre Handschellen, Pfeffersprays und wer weiß was noch mitbringen. Du kennst doch diese privaten Wachleute – die spielen nur zu gern mal echter Polizist. Alle dort sind Hals über Kopf zu dem Lagerraum gerannt. Und der Täter konnte seelenruhig das Gebäude verlassen. Die Überwachungskamera hat ihn aufgenommen – mit neuem, dunklem Jackett und einem Hut – wie er an der Rampe die Leiter nach unten steigt und in Richtung der Lkw-Stellplätze verschwindet.«
»Wohin genau?«
»Das hat die Kamera nicht mehr erfasst. Keine Ahnung.«
Sie zuckte die Achseln. »U-Bahnen? Busse?«
»Die Videoaufnahmen an den Haltestellen haben nichts ergeben. Wahrscheinlich ist er zu Fuß gegangen oder hat sich ein Taxi genommen.«
Um zu einem der fünfundachtzig Millionen Orte zu fahren, die in Betracht kamen.
»Ein dunkles Jackett, sagst du? Wieder ein Sakko?«
»Wir haben uns in den entsprechenden Geschäften umgehört. Niemand hat gesehen, dass jemand mit seiner Statur etwas gekauft hätte. Wir kennen also noch immer nicht sein Gesicht.«
»Können wir an der Laderampe nicht seine Fingerabdrücke von der Leiter nehmen?«
»Oh, auf dem Video sieht man, wie er vorher Handschuhe anzieht.«
Schlau. Dieser Kerl ist schlau.
»Eines noch. Er hatte seinen Kaffeebecher und die Sandwichverpackungen dabei. Falls er sie weggeworfen hat, haben wir sie jedenfalls noch nicht finden können.«
»Ich setze die Spurensicherung darauf an.«
»He, wie ist es mit Captain Weiße Krawatte gelaufen? Oh, das sollte ich wohl besser nicht laut sagen.«
Sie lächelte. »Dann habe ich es eben überhört.«
»Er malt sich bereits aus, wie er sein Büro dekorieren wird, sobald er Gouverneur ist.«
Das erklärte das gediegene Erscheinungsbild. Ein hohes Tier mit Ambitionen. Gut, wenn man so jemanden auf seiner Seite hatte.
Gott segne Sie …
»Es ist einwandfrei gelaufen. Wie es aussieht, steht er wegen des Schusswaffengebrauchs hinter mir.«
»Er ist ein anständiger Kerl. Versprich ihm einfach, dass du ihn wählen wirst.«
»Und ihr macht mit der Suche weiter.«
»Alles klar.«
Ein Inspektor der Feuerwehr kam auf Sachs zu, und sie schilderte auch ihm den Ablauf der Ereignisse bei der Rolltreppe. Zwanzig Minuten später traf aus dem riesigen Hauptgebäude der New Yorker Spurensicherung in Queens das Team ein, das dem Fall Täter 40 zugewiesen worden war. Amelia begrüßte die zwei Techniker, die sie schon von früheren Fällen her kannte – einen Mann und eine Frau, beide Afroamerikaner und Mitte dreißig. Sie wollten mit ihren schweren Rollkoffern die Treppe ansteuern.
»Nicht dorthin«, sagte Sachs. »Das war ein Unfall. Darum kümmern sich die Feuerwehr und das Acht-Vier. Ihr müsst euch die Starbucks-Filiale vornehmen.«
»Was hat sich denn hier zugetragen?«, fragte die Frau und ließ den Blick durch das Ladenlokal schweifen.
»Ein Kapitalverbrechen«, warf ihr Partner ein. »Hast du gesehen, was der Frappuccino kostet?«
»Unser Verdächtiger hat hier ein spätes Mittagessen eingenommen. An einem der hinteren Tische, das müsst ihr bei den Angestellten erfragen. Groß, dünn, grün kariertes Jackett, Atlanta-Baseballmütze. Viel dürfte dort nicht zu finden sein. Er hat seinen Becher und die Verpackungen mitgenommen.«
»Ich hasse es, wenn sie nicht ausgiebig ihre DNS verbreiten.«
»Das kannst du laut sagen.«
»Aber ich hoffe, dass er die Sachen irgendwo in der Nähe weggeworfen hat.«
»Kannst du das ›Irgendwo‹ irgendwie eingrenzen?«, fragte die Frau.
Beim Anblick des Starbucks-Personals war Sachs tatsächlich eine Idee gekommen. »Eventuell. Aber das wäre nicht hier im Gebäude. Ich überprüfe das selbst, und ihr kümmert euch um den Laden hier.«
»Das habe ich schon immer so an dir gemocht, Amelia. Wir dürfen es warm und gemütlich haben, und du wagst dich hinaus in die finstere Kälte.«
Sachs beugte sich vor und zog einen blauen Tyvek-Overall aus dem Koffer, den einer der Techniker gerade geöffnet hatte.
»Der Ablauf ist wie immer, Amelia? Wir packen alles zusammen und schaffen es zu Lincoln nach Hause?«
Sachs’ Miene versteinerte. »Nein, nehmt alles mit nach Queens. Ich leite den Fall vom Büro aus.«
Die beiden Techniker wechselten einen Blick und sahen dann wieder Sachs an. »Geht es Rhyme gut?«, fragte die Frau.
»Habt ihr es etwa noch nicht gehört?«, entgegnete Sachs angespannt. »Lincoln arbeitet nicht mehr für das NYPD.«
3
»Die Antwort ist da.«
Eine Pause, während die Worte von den glänzenden, verschrammten Wänden widerhallten, deren Farbe akademisch grün war. Also wie Galle.
»Die Antwort. Sie mag auf der Hand liegen, wie bei einem blutigen Messer mit den Fingerabdrücken und der DNS des Täters, versehen mit seinen Initialen und einem Vers seines Lieblingsdichters. Oder sie liegt im Verborgenen, und es gibt bloß drei unsichtbare Liganden – und was ist ein Ligand? Wer weiß es?«
»Ein Geruchsmolekül, Sir«, meldete sich eine zittrige männliche Stimme.
»Im Verborgenen, wie gesagt«, fuhr Lincoln Rhyme fort. »Die Antwort mag aus drei Geruchsmolekülen bestehen. Aber sie ist da. Die Verbindung zwischen Mörder und Opfer, die uns zu seiner Tür führen und die Geschworenen dazu bewegen kann, ihm für die nächsten zwanzig oder dreißig Jahre ein neues Zuhause zuzuweisen. Wer kann mir Locards Prinzip erklären?«
Aus der ersten Reihe ertönte eine feste Frauenstimme: »Bei jedem Verbrechen kommt es zu einem Spurenaustausch zwischen dem Täter und dem Schauplatz oder dem Opfer, meistens sogar beides. Edmond Locard, der französische Kriminalist, hat in diesem Zusammenhang von ›Staub‹ gesprochen, aber damit das gemeint, was wir heute als ›Partikelspuren‹ bezeichnen.« Die Frau neigte den Kopf und schob sich eine lange kastanienbraune Haarsträhne aus dem herzförmigen Gesicht. »Paul Kirk hat dazu geschrieben: ›Spuren können keinen Meineid begehen‹«, fuhr sie fort. »›Sie sind auch stets vorhanden. Nur wenn sie nicht gefunden, untersucht und verstanden werden, verlieren sie ihren Wert.‹«
Lincoln Rhyme nickte. Korrekte Antworten können bestätigt, sollten aber nie besonders gelobt werden; das war den Einblicken vorbehalten, die über das Grundsätzliche hinausgingen. Dennoch war er beeindruckt, denn er hatte bislang noch keine Lektüre vorgegeben, in der die Arbeit des großen französischen Kriminalisten behandelt wurde. Sein Blick schweifte mit verwunderter Miene über die Anwesenden. »Haben Sie sich alle notiert, was Miss Archer gesagt hat? Einige von Ihnen offenbar nicht. Warum nur?«
Kugelschreiber huschten über das Papier, Laptop-Tastaturen klickten, und Finger tanzten lautlos auf den zweidimensionalen Tasten von Tablet-Computern.
Dies war erst die zweite Seminarstunde der Einführung in die Spurensicherung, und noch waren nicht alle Gepflogenheiten etabliert. Das Gedächtnis der Studenten mochte rege und gut geschult sein, doch es war nicht unfehlbar. Außerdem nahm man eine Information durch die Niederschrift nicht nur zur Kenntnis, sondern eignete sie sich an.
»Die Antwort ist da«, wiederholte Rhyme, nun ja, professoral. »In der Kriminalistik – der forensischen Wissenschaft – gibt es kein einziges Verbrechen, das nicht gelöst werden kann. Es ist alles nur eine Frage der geistigen Beweglichkeit, Raffinesse und Anstrengung. Wie weit werden Sie gehen, um den Täter zu identifizieren? Auch diese Frage hat bereits, genau, Paul Kirk in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts gestellt.« Er schaute kurz zu Juliette Archer. Rhyme hatte sich bisher nur ein paar der Namen gemerkt. Archers war der erste gewesen.
»Captain Rhyme?«, fragte ein junger Mann im hinteren Teil des Seminarraums, in dem etwa dreißig Studenten saßen. Ihr Alter reichte von Anfang zwanzig bis Mitte vierzig, doch die jüngeren überwogen. Der Fragesteller musste trotz seiner modischen Stachelfrisur irgendwie mit der Polizei zu tun haben. Zwar war Rhymes Rang zum Zeitpunkt seines gesundheitlich bedingten Ausscheidens aus dem Polizeidienst vor vielen Jahren kein Geheimnis – er fand sich nicht nur im Dozentenverzeichnis der Hochschule, sondern auch in Zehntausenden von Google-Treffern –, aber es war unwahrscheinlich, dass jemand, der in keiner Verbindung zum NYPD stand, ihn damit ansprechen würde.
Mit einer sachten Bewegung der rechten Hand ließ der Professor nun seinen komplizierten Elektrorollstuhl zu dem Studenten herumschwenken. Rhyme war querschnittsgelähmt und konnte unterhalb des Halses nur den linken Ringfinger und – nach mehreren operativen Eingriffen – nun auch seinen rechten Arm und die Hand eingeschränkt bewegen. »Ja?«
»Nur so ein Gedanke. Locard hat von ›Partikeln‹ beziehungsweise ›Staub‹ gesprochen?« Dabei schaute er kurz zu Archer, die vorn links in der ersten Reihe saß.
»Korrekt.«
»Könnte es denn nicht auch zu einer psychologischen Übertragung kommen?«
»Wie meinen Sie das?«
»Mal angenommen, der Täter droht dem Opfer mit Folter, bevor er es tötet. Das Opfer wird mit einem entsetzten Gesichtsausdruck gefunden. Daraus können wir ableiten, dass der Täter ein Sadist ist. Das könnte man seinem psychologischen Profil hinzufügen. Womöglich lässt sich so das Feld der Verdächtigen eingrenzen.«
»Gestatten Sie mir eine Frage«, erwiderte Rhyme. »Hat Ihnen diese Buchreihe gefallen? Harry Potter? Die Filme auch, richtig?« Normalerweise interessierte er sich nicht für kulturelle Phänomene, es sei denn, sie könnten zur Aufklärung eines Falls beitragen, was jedoch so gut wie nie geschah. An Harry Potter kam aber auch er nicht vorbei.
Der junge Mann kniff die dunklen Augen zusammen. »Ja, natürlich.«
»Aber Ihnen ist schon bewusst, dass es sich dabei um Fiktion handelt und das alles nicht wirklich existiert?«
»Ja, voll und ganz.«
»Und Sie werden mir zustimmen, dass Zauberer und Zaubersprüche, Voodoo, Geister, Telekinese und Ihre Theorie über den Austausch psychologischer Elemente an Tatorten nichts …?«
»… in unserer Muggel-Welt verloren haben, wollen Sie sagen?«
Einige der Studenten lachten auf.
Rhymes Augenbrauen zogen sich zu einem V zusammen, allerdings nicht wegen der Unterbrechung; er mochte es, wenn jemand frech und nicht auf den Kopf gefallen war. »Keineswegs. Ich wollte sagen, dass jede der von mir genannten Theorien erst noch empirisch bewiesen werden muss. Zeigen Sie mir objektive Studien mit mehrfach nachgewiesenen Resultaten Ihrer vorgeblichen psychologischen Übertragungen sowie einer validen Anzahl von Beispielen und Kontrollverfahren, die diese Theorie unterstützen, und ich werde sie als gültig anerkennen. An Ihrer Stelle würde ich mich aber nicht darauf verlassen. Je mehr man sich auf die eher vagen Aspekte einer Ermittlung konzentriert, desto weniger Aufmerksamkeit kann man der viel wichtigeren Aufgabe widmen. Und die wäre?«
»Die Untersuchung der Spuren.« Wieder Juliette Archer.
»Tatorte verändern sich wie ein Löwenzahn, den man anpustet. Jene drei Liganden sind als einzige übrig, wo es kurz zuvor noch Millionen gegeben hat. Ein Regentropfen kann den winzigen Fleck mit der DNS des Mörders wegwaschen, wodurch keine Chance mehr besteht, ihn anhand der CODIS-Datenbank zu identifizieren und seinen Namen zu erfahren, seine Adresse, seine Telefon- und Sozialversicherungsnummer … und seine Hemdgröße.« Lincoln Rhymes Blick schweifte quer durch den Raum. »Hemdgröße war ein Scherz.« Die Leute neigten dazu, jedes seiner Worte für bare Münze zu nehmen.
Der Hipster-Cop nickte, schien aber nicht überzeugt zu sein. Rhyme war beeindruckt. Er fragte sich, ob der Student wohl tatsächlich Nachforschungen zu dem Thema anstellen würde. Rhyme hoffte es. An der Theorie konnte eventuell etwas dran sein.
»Monsieur Locards Staub – Partikelspuren also – wird uns in einigen Wochen noch näher beschäftigen. Heute geht es zunächst mal darum, dass wir überhaupt Staub zum Analysieren erhalten. Unser Thema lautet Schutz der Beweise. So etwas wie einen jungfräulichen Tatort gibt es nicht. Er existiert einfach nicht. Ihre Aufgabe ist es jedoch, die Kontamination so gering wie möglich zu halten. Und welche Art der Verunreinigung steht an erster Stelle?« Er wartete keine Antwort ab, sondern fuhr sogleich fort. »Die durch andere Cops – oft, sogar meistens, durch Vorgesetzte. Wie halten wir die hohen Tiere, die es vor die Fernsehkameras drängt, vom Tatort fern, ohne dabei unseren Job zu verlieren?«
Das Gelächter erstarb, und das Seminar begann.
Lincoln Rhyme war im Laufe der Jahre immer mal wieder als Dozent tätig gewesen. Das Unterrichten bereitete ihm zwar kein besonderes Vergnügen, aber er glaubte fest daran, dass die Spurenanalyse unerlässlich für die Aufklärung eines Verbrechens war. Und er wollte sichergehen, dass die forensischen Wissenschaftler dem höchstmöglichen Standard genügten – seinem Standard nämlich. Viele Schuldige kamen frei oder erhielten milde Strafen, die der Schwere ihrer Vergehen bei Weitem nicht angemessen waren. Und manch Unschuldiger landete hinter Gittern. Vor einem Monat hatte Rhyme daher entschieden, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um eine neue Generation von Kriminalisten angemessen in Form zu bringen.
Er hatte seine offenen Kriminalfälle abgeschlossen und sich um eine Stelle bei der John Marshall School for Criminal Justice beworben, die lediglich zwei Blocks entfernt von seinem Stadthaus am Central Park West lag. Genau genommen hatte er sich gar nicht bewerben müssen. Als er eines Abends mit einem Staatsanwalt, den er von früher kannte, bei einem Drink zusammensaß, erzählte er davon, dass er vielleicht das Metier wechseln und als Dozent arbeiten wolle. Der Mann, der nebenberuflich an der John Marshall School lehrte, trug diesen Wunsch offenbar weiter, woraufhin der Vorstand der Fakultät sich kurz darauf bei Rhyme meldete. Rhyme nahm an, dass seine Reputation ihn als guten Fang dastehen ließ, denn er würde die Aufmerksamkeit der Medien erregen, zusätzliche Studenten anlocken und dadurch vermutlich für ein deutliches Einnahmeplus bei den Studiengebühren sorgen. Man einigte sich auf zwei Seminare: diesen Einführungskurs und die Fortgeschrittene chemische und mechanische Analyse von an Verbrechensschauplätzen häufigen Substanzen unter Einbeziehung der Elektronenmikroskopie. Es war bezeichnend für Rhymes guten Ruf, dass die Teilnehmerliste des zweiten Kurses sich fast so schnell wie die des ersten füllte.
Die meisten der Studierenden arbeiteten bereits für die Strafverfolgungsbehörden oder strebten eine Tätigkeit dort an. Nicht nur beim NYPD, sondern auch auf Staats- und Bundesebene. Einige würden sich auf kommerzielle forensische Analysen verlegen und für Privatdetektive, Firmen und Anwälte arbeiten. Ein paar waren Journalisten und einer ein Schriftsteller, der in seinen Büchern keine Fehler begehen wollte. (Was Rhyme durchaus begrüßte; er war selbst die Hauptfigur einer Reihe von Romanen, die auf seinen Fällen basierten, und hatte den Autor schon mehrfach auf die falsche Darstellung gewisser Aspekte der Tatortarbeit hingewiesen. »Müssen Sie denn immer so übertreiben?«)
Nachdem er den Anwesenden nun einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten zum Schutz eines Tatorts gegeben hatte, bemerkte Rhyme die fortgeschrittene Uhrzeit und erklärte die heutige Sitzung für beendet. Die Studenten verließen den Raum. Rhyme fuhr zu der Rampe, die von der niedrigen Bühne führte.
Als er am unteren Ende anlangte, war außer ihm nur noch eine Person anwesend.
Juliette Archer saß nach wie vor in der ersten Reihe. Die Mittdreißigerin hatte ziemlich bemerkenswerte Augen, die Rhyme schon bei der ersten Seminarstunde letzte Woche aufgefallen waren. Weder die menschliche Iris noch das Kammerwasser enthalten blaue Pigmente; der Farbton ist dem Melanin der Epithelzellen sowie der Rayleigh-Streuung zu verdanken. Archers Augen waren leuchtend himmelblau.
Er fuhr zu ihr. »Locard. Sie haben etwas ergänzende Lektüre betrieben. Mit meinem Buch. Dorther stammt Ihr Zitat.« Er hatte sein eigenes Lehrbuch nicht auf die Leseliste des Seminars gesetzt.
»Neulich beim Abendessen war mir eben nach einem Glas Wein und etwas zum Lesen.«
»Aha.«
»Und?«, fragte sie.
Mehr war nicht nötig. Sie bezog sich auf eine Anfrage von letzter Woche … und mehrere telefonische Nachrichten seitdem.
Ihre strahlenden Augen blieben unverwandt auf sein Gesicht gerichtet.
»Ich glaube, das wäre keine so gute Idee«, sagte er.
»Keine gute Idee?«
»Wenig hilfreich, meine ich. Für Sie.«
»Da bin ich anderer Ansicht.«
Zumindest redete sie nicht lange um den heißen Brei herum. Archer ließ das Schweigen eine Weile wirken. Dann verzog sie ihren ungeschminkten Mund zu einem Lächeln. »Sie haben mich überprüft, nicht wahr?«
»Allerdings.«
»Haben Sie mich denn für eine Spionin gehalten? Die sich bei Ihnen einschmeicheln will, um geheime Fallinterna oder so was zu stehlen?«
Der Gedanke war ihm gekommen. Dann zuckte er die Achseln, wozu er trotz seiner körperlichen Verfassung fähig war. »Bloß aus Neugier.« Rhyme hatte in der Tat diverse Dinge über Juliette Archer in Erfahrung gebracht. Die Frau besaß Master-Abschlüsse in Gesundheitswesen und Biowissenschaft. Sie hatte als Feld-Epidemiologin für die Abteilung für übertragbare Krankheiten der New York Institutes of Health in Westchester gearbeitet. Nun wollte sie sich beruflich neu orientieren und zur forensischen Wissenschaft wechseln. Zurzeit wohnte sie in Downtown SoHo, dem Loft-Distrikt. Ihr elfjähriger Sohn war ein erstklassiger Fußballer. Sie selbst hatte einige wohlwollende Kritiken für ihre Ausdruckstanzdarbietungen in Manhattan und Westchester erhalten. Vor ihrer Scheidung hatte sie in Bedford, New York, gelebt.
Nein, sie war keine Spionin.
Sie sah ihm immer noch in die Augen.
»Also gut«, sagte er, einer plötzlichen Regung folgend, was bei ihm überaus selten vorkam.
Ein förmliches Lächeln. »Danke. Ich kann sofort anfangen.«
Eine Pause. »Morgen.«
Archer wirkte belustigt und nickte verschmitzt. Als hätte sie ihren Terminvorschlag mühelos durchsetzen können, verzichte aber großmütig darauf, ihren Triumph auszukosten.
»Brauchen Sie die Adresse?«, fragte Rhyme.
»Die habe ich.«
Anstatt sich die Hände zu reichen, nickten sie einander zu und besiegelten die Vereinbarung. Archer lächelte erneut, und dann bewegte ihr rechter Zeigefinger sich zu dem Touchpad ihres eigenen Rollstuhls, eines silbernen Storm Arrow, wie auch Rhyme ihn – allerdings in Rot – bis vor ein paar Jahren benutzt hatte. »Wir sehen uns dann.« Sie wendete und fuhr den Gang entlang zur Tür hinaus.
4
Das frei stehende Haus war aus roten Backsteinen gemauert. Die Farbe ähnelte der von Buddy Everetts Brillengestell, aber auch der von getrocknetem Blut und Eingeweiden. Unter den gegebenen Umständen drängte sich der Vergleich einfach von selbst auf.
Amelia Sachs zögerte und betrachtete den warmen Lichtschein aus dem Innern, der immer wieder flackerte, wenn einer der Besucher zwischen Lampe und Fenster entlangging. Bisweilen ähnelte der Effekt einem Stroboskop, so groß war die Anzahl der Gäste in dem kleinen Haus.
Der Tod führt all jene zusammen, die sich dem Opfer oder der Familie auch nur im Entferntesten verbunden fühlen.
Sachs verharrte immer noch.
In all den Jahren als Polizistin hatte sie schon Dutzende Male eine Todesnachricht überbringen müssen. Sie war gut darin und spulte nicht bloß die Zeilen ab, die von den Psychologen auf der Akademie gelehrt wurden. (»Ihr Verlust tut mir sehr leid.« – »Haben Sie jemanden, an den Sie sich wenden können, falls Sie Unterstützung brauchen?« Bei einem solchen Skript musste man einfach improvisieren.)
Doch heute Abend lag die Sache anders. Denn Sachs konnte sich nicht entsinnen, jemals in genau dem Moment zugegen gewesen zu sein, wenn die Elektronen eines Opfers die Zellen verließen – oder, sofern man spirituell veranlagt war, der Geist aus dem Körper wich. Sie hatte im Augenblick des Todes ihre Hände auf Greg Frommers Arm gelegt. Und so sehr sie sich am liebsten vor diesem Gang gedrückt hätte, stand sie bei dem Mann im Wort. Sie würde es nicht brechen.
Amelia schob nun das Holster weiter nach hinten und somit außer Sicht. Das schien irgendwie angemessen zu sein, obwohl sie keine rationale Erklärung dafür fand. Zuvor war sie zu ihrem Haus gefahren – ebenfalls in Brooklyn, gar nicht weit weg von hier –, um zu duschen und sich umzuziehen. Nun würde man nur noch mit Luminol und einer alternativen Lichtquelle ein Tröpfchen Blut an ihr ausfindig machen können.
Sie stieg die Vordertreppe hinauf und klingelte.
Ein hochgewachsener Mann mit Hawaiihemd und orangefarbenen Shorts öffnete die Tür. Sachs schätzte ihn auf Mitte fünfzig. Dies war natürlich nicht die offizielle Trauerfeier; die würde später kommen. Das Treffen heute Abend war die spontane Reaktion von Freunden und Verwandten, um ihre Hilfe anzubieten, Essen vorbeizubringen und von der Trauer abzulenken und sie gleichzeitig zu teilen.
»Hallo«, sagte er. Seine Augen waren so rot wie die Blumenkette um den Hals des Papageis auf seinem Bauch. Frommers Bruder? Er sah ihm jedenfalls sehr ähnlich.
»Ich bin Amelia Sachs vom NYPD. Ist Mrs. Frommer wohl in der Verfassung, sich kurz mit mir zu unterhalten?« Sie sagte dies freundlich, ohne jeden Beiklang von Beamtentum.
»Bestimmt. Bitte kommen Sie rein.«
Das Haus enthielt wenig Mobiliar, und die Stücke passten nicht zueinander und waren abgewetzt. Die vereinzelten Bilder an den Wänden sahen nach Supermarktware aus. Frommer, so wusste Amelia inzwischen, hatte als Verkäufer zum Mindestlohn in einem Schuhgeschäft des Einkaufszentrums gearbeitet. Das Fernsehgerät hier war klein, der Kabelreceiver das Basismodell. Eine Spielkonsole stand nicht dabei, obwohl es hier mindestens ein Kind geben musste – in der hinteren Ecke lehnte ein Skateboard an der Wand, verschrammt und mit Textilklebeband umwickelt. Auf dem Boden neben einem schäbigen Beistelltisch lag ein Stapel Mangas, japanische Comics.
»Ich bin Gregs Cousin Bob.«
»Es tut mir so leid, was geschehen ist.« Manchmal verfiel man eben doch in die Routine.
»Wir konnten es gar nicht glauben. Meine Frau und ich wohnen in Schenectady und sind so schnell wie möglich hergekommen.« Er wiederholte: »Wir konnten es gar nicht glauben. Dass er … na ja, bei einem solchen Unfall ums Leben kommt.« Ungeachtet des tropischen Kostüms nahm Bob plötzlich eine Achtung gebietende Haltung ein. »Jemand wird dafür bezahlen. So etwas hätte nie passieren dürfen.«
Einige der anderen Anwesenden nickten ihr zu und musterten ihre sorgfältig ausgewählte Kleidung: wadenlanger dunkelgrüner Rock, schwarze Bluse, schwarzes Jackett. Sie war wie zu einer Beerdigung angezogen, allerdings nicht speziell für diesen Besuch, sondern generell. In dunklen Sachen gibt man einfach ein schlechteres Ziel ab.
»Ich hole Sandy.«
»Danke.«
Am anderen Ende des Raumes stand ein etwa zwölfjähriger Junge bei einem Mann und zwei Frauen in den Fünfzigern. Das runde Sommersprossengesicht des Kindes war rot verweint, sein Haar völlig zerzaust. Sachs konnte sich vorstellen, dass der Junge, völlig aufgelöst durch den Tod seines Vaters, im Bett gelegen hatte, bevor die Gäste eingetroffen waren.
»Ja, hallo?«
Sachs drehte sich um. Die schlanke blonde Frau war sehr blass, was in starkem und verstörendem Kontrast zu ihrem leuchtend roten Lippenstift und der Haut unter ihren bemerkenswert grünen Augen stand. Ihr dunkelblaues Sommerkleid war zerknittert, und obwohl ihre Schuhe sich im Stil sehr ähnlich waren, stammten sie von verschiedenen Paaren.
»Ich bin Amelia Sachs von der Polizei.«
Ihre Dienstmarke zeigte sie nicht vor. Dazu bestand kein Anlass.
Sachs fragte, ob sie unter vier Augen miteinander sprechen könnten.
Schon komisch, wie viel einfacher es war, die Glock auf einen unter Drogen stehenden Straftäter zu richten, der in vierzig Schritten Entfernung mit seiner eigenen Waffe auf dich zielte, oder vom vierten in den zweiten Gang herunterzuschalten, während man mit achtzig Sachen um die Kurve schleuderte und den Drehzahlmesser in den roten Bereich trieb, damit irgendein Mistkerl nicht entwischte.
Reiß dich zusammen. Du schaffst das.
Sandy Frommer führte Sachs auf den hinteren Teil des Hauses zu, quer durch das Wohnzimmer in eine winzige Kammer, die – so sah Amelia beim Eintreten – das Zimmer des Jungen war, mit Superhelden-Postern und -Comics, herumliegenden Jeans und Pullovern sowie einem zerwühlten Bett.
Sachs schloss die Tür. Sandy blieb stehen und sah sie ängstlich an.
»Ich bin zufällig vor Ort gewesen, als Ihr Mann gestorben ist. Ich war bei ihm.«
»Ach, herrje.« Einen Moment lang wirkte sie völlig verwirrt. Dann schien sie sich wieder zu fangen. »Ein Polizist war hier, um mir Bescheid zu geben. Ein netter Mann. Er war nicht im Einkaufszentrum, als es passiert ist. Jemand hat ihn angerufen. Er war von unserem Revier hier. Vielleicht kennen Sie ihn, ein asiatischer Mann. Officer, meine ich.«
Sachs schüttelte den Kopf.
»Es war schlimm, nicht wahr?«
»Ja, das war es.« Sie konnte das Geschehene nicht beschönigen. Man hatte es bereits in den Nachrichten gemeldet. Natürlich nicht mit allen blutigen Einzelheiten, aber Sandy würde letztlich die medizinischen Berichte zu Gesicht bekommen und genau erfahren, was Greg Frommer in seinen letzten Minuten auf Erden hatte durchmachen müssen. »Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich an seiner Seite war. Ich habe seine Hand gehalten, und er hat ein Gebet gesprochen. Und er hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass er Sie und Ihren Sohn geliebt hat.«
Als wäre es plötzlich unendlich wichtig, ging Sandy zum Schreibtisch ihres Sohnes, auf dem ein alter Desktop-Computer stand. Daneben lagen zwei Getränkedosen, eine davon zerdrückt. Und eine leere, flache Chipstüte. Sie nahm die Dosen und warf sie in den Abfalleimer. »Ich hätte meinen Führerschein verlängern lassen müssen. Er ist nur noch zwei Tage gültig. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Ich arbeite als Zimmermädchen. Wir haben immer so viel zu tun. Mein Führerschein läuft in zwei Tagen ab.«
Demnach würde sie bald Geburtstag haben.
»Kann Ihnen jemand hier behilflich sein, den Behördengang zu erledigen?«
Sandy hob ein weiteres Fundstück auf, eine leere Eisteeflasche, und warf auch sie in den Müll. »Sie hätten sich nicht herbemühen müssen. Das hätte nicht jeder getan.« Jedes einzelne Wort schien ihr Schmerzen zu bereiten. »Vielen Dank.« Ihr jenseitiger Blick richtete sich kurz auf Sachs, dann zum Boden. Sie legte die Pullover in den Wäschekorb, griff in ihre Jeans, brachte ein Papiertaschentuch zum Vorschein und tupfte sich die Nase ab. Sachs fiel auf, dass die Jeans von Armani war, aber ziemlich ausgebleicht und abgetragen – und das nicht auf die vorgewaschene Weise, mit der die fabrikneuen Sachen im Laden landeten. (Als ehemaliges Mannequin hatte sie nichts für solche nutzlosen Trends übrig.) Die Hose war entweder gebraucht gekauft worden oder stammte aus einer Zeit, in der die Familie besser situiert gewesen war, wie Sachs vermutete.
Damit lag sie womöglich richtig, denn sie bemerkte nun ein gerahmtes Foto auf dem Tisch des Jungen – er und sein Vater standen mit Angelausrüstung neben einem Privatflugzeug. Das Bild war einige Jahre alt, und im Hintergrund ragten die Berge Kanadas oder Alaskas auf. Ein anderer Schnappschuss zeigte die Familie auf Logenplätzen bei einem Autorennen, offenbar dem Indy 500.
»Kann ich etwas für Sie tun?«
»Nein, Officer. Oder Detective? Oder …?«
»Amelia.«
»Amelia. Was für ein hübscher Name.«
»Wird Ihr Sohn damit fertig?«
»Bryan … Ich weiß nicht, wie er das verkraften wird. Im Moment ist er wütend, glaube ich. Oder wie betäubt. Wir sind beide wie betäubt.«
»Wie alt ist er? Zwölf?«
»Ja, genau. Die letzten Jahre waren hart. Und das ist ein schwieriges Alter.« Ihre Lippe zitterte. »Wer ist dafür verantwortlich?«, fragte sie barsch. »Wie konnte so etwas passieren?«
»Das weiß ich nicht. Die Stadt wird das untersuchen. Die Leute sind sehr kompetent.«
»Wir vertrauen uns diesen Dingern an. Aufzügen, Gebäuden, Flugzeugen, U-Bahnen! Wer auch immer die konstruiert, muss doch auf die Sicherheit achten. Woher sollen wir denn wissen, ob sie gefährlich sind? Uns bleibt doch gar nichts anderes übrig, als uns auf sie zu verlassen!«
Sachs drückte ihre Schulter und fürchtete schon, dass die Frau gerade einen Nervenzusammenbruch erlitt. Aber Sandy fing sich schnell wieder. »Danke, dass Sie hergekommen sind, um mir das zu sagen. Das hätte nicht jeder getan.« Anscheinend war ihr nicht klar, dass sie sich wiederholte.
»Noch mal: Falls ich etwas tun kann …« Sachs drückte ihr eine ihrer Visitenkarten in die Hand. Das wurde einem auf der Akademie nicht beigebracht, und in Wahrheit wusste Amelia auch nicht, womit sie der Frau hätte behilflich sein können. Sie handelte hier nach Gefühl.
Die Karte verschwand in der Tasche der Jeans, die ursprünglich mal dreistellig gekostet hatte.
»Ich mache mich jetzt auf den Weg.«
»Oh, ja. Danke noch mal.«
Sandy nahm das schmutzige Geschirr ihres Sohnes, verließ vor Sachs das Zimmer und verschwand in der Küche.
Vorn beim Flur sprach Sachs erneut Frommers Cousin Bob an. »Was meinen Sie, wie hält Sandy sich?«
»Nun ja, wie man es wohl erwarten würde. Meine Frau und ich werden tun, was wir können. Aber wir haben selbst drei Kinder. Ich könnte die Garage ausbauen, hab ich mir gedacht. Ich bin ein passabler Handwerker. Mein Ältester auch.«
»Wie meinen Sie das?«
»Unsere Garage. Die ist frei stehend, Sie wissen schon. Für zwei Autos. Und mit Heizung, denn ich habe meine Werkbank da drinnen.«
»Die beiden sollen bei Ihnen wohnen?«
»Bei irgendjemandem müssen sie ja wohnen, und ich wüsste nicht, wer sonst in Betracht käme.«
»In Schenectady?«
Bob nickte.
»Dieses Haus gehört ihnen nicht? Es ist gemietet?«
»Richtig.« Er senkte die Stimme. »Und sie sind schon zwei Monate im Rückstand.«
»Hatte er denn keine Lebensversicherung?«
Bob verzog das Gesicht. »Nein. Die hat er sich längst auszahlen lassen. Brauchte das Geld. Wissen Sie, Greg hatte beschlossen, etwas zurückzugeben. Also hat er vor einigen Jahren seinen Job gekündigt und mit jeder Menge wohltätigem Zeug angefangen. Wegen seiner Midlife-Crisis oder was auch immer. Die Teilzeitstelle im Einkaufszentrum hat es ihm erlaubt, ehrenamtlich in Suppenküchen und Obdachlosenheimen zu arbeiten. Gut für ihn, schätze ich. Doch für Sandy und Bry war es hart.«
Sachs verabschiedete sich und ging zur Tür.
Bob begleitete sie und sagte: »Oh, aber verstehen Sie das nicht falsch.«
Sie wandte sich um und hob eine Augenbraue.
»Glauben Sie nicht, Sandy hätte es bedauert. Sie hat die ganze Zeit hinter ihm gestanden, ohne sich je zu beklagen. Und, Mann, haben die beiden sich geliebt!«
* * *
Ich gehe auf meine Wohnung in Chelsea zu, meinen Mutterleib. Mein Refugium, ein guter Ort.
Und schaue mich natürlich immer wieder nach Verfolgern um.
Niemand in Sicht, auch nicht Rotschopf, die Polizistin.
Nach dem Schreck im Einkaufszentrum bin ich Meile um Meile durch Brooklyn gelaufen, bis zu einer weit entfernten U-Bahn-Linie. Unterwegs habe ich noch eine weitere neue Jacke gekauft und gegen die bisherige ausgetauscht, ebenso die Kopfbedeckung – wieder eine Baseballmütze, aber diesmal sandfarben. Mein Haar ist blond, kurz und schütter, doch draußen bleibt es am besten bedeckt, hab ich mir gedacht.
Warum den Shoppern unnötig Stoff liefern?
Ich beruhige mich allmählich. Endlich fängt mein Herz nicht mehr bei jedem Streifenwagen an zu rasen.
Der Heimweg dauert ewig. Chelsea ist sehr, sehr weit von Brooklyn entfernt. Hab mich gefragt, woher der Name wohl stammt. Chelsea. Ich glaube, ich hab mal gehört, es sei nach einem Ort in England benannt. Es klingt jedenfalls englisch. Haben die da nicht eine Sportmannschaft, die so heißt? Oder war das bloß der Name einer Person?
Die Straße, meine Straße, die Zweiundzwanzigste Straße ist laut, aber ich hab dicke Fenster. Mein Mutterleib, wie schon gesagt. Es gibt eine Dachterrasse, und mir gefällt es da oben. Niemand sonst aus dem Haus geht dorthin, soweit ich weiß. Manchmal sitze ich da und wünschte, ich wäre Raucher, denn auf einem Hausdach zu sitzen, zu rauchen und die Stadt zu betrachten scheint mir eine intensive und ganz und gar zeitlose New-York-Erfahrung zu sein.
Ich kann von dort aus die Rückseite des Chelsea Hotels sehen. Da wohnen Berühmtheiten, also wirklich dauerhaft. Musiker, Schauspieler, Künstler. Ich sitze auf meinem Gartenstuhl, beobachte die Tauben, Wolken, Flugzeuge und ganz generell den Ausblick und lausche, ob ich die Musiker in dem Hotel mal was spielen höre, aber bis jetzt hatte ich noch nie Glück.
Nun erreiche ich den Hauseingang. Ein weiterer Blick über die Schulter. Keine Cops. Kein Rotschopf.
Ich gehe rein und die Korridore entlang. Die Wände sind dunkelblau gestrichen und … irgendwie krankenhausig