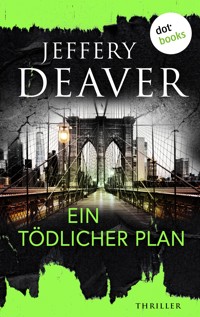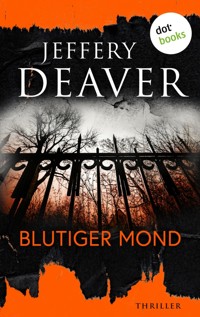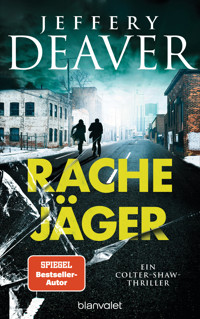9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lincoln-Rhyme-Thriller
- Sprache: Deutsch
Sie fanden die Liebe fürs Leben – doch nur der Tod ist für immer … Der 14. Fall für Lincoln Rhyme und Amelia Sachs.
Der Tatort, mit dem Amelia Sachs sich konfrontiert sieht, ist einer der schrecklichsten ihrer Karriere: In einem Juweliergeschäft wurden einem branchenberühmten Diamantenhändler sowie einem jungen Paar die Kehlen durchgeschnitten. Noch im Todeskampf hielten die Verliebten sich an den Händen. Der Killer macht offenbar Jagd auf Paare und lauert ihnen in ihren glücklichsten Momenten auf. Und er scheint fest entschlossen, auch alle Zeugen aus dem Weg zu räumen, die den Ermittlern Lincoln Rhyme und Amelia Sachs – selbst frisch verheiratet – helfen könnten, das Morden zu stoppen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Der Tatort, mit dem Amelia Sachs sich konfrontiert sieht, ist einer der schrecklichsten ihrer Karriere: In einem Juweliergeschäft wurden einem branchenberühmten Diamantenhändler sowie einem jungen Paar die Kehlen durchgeschnitten. Noch im Todeskampf hielten die Verliebten sich an den Händen. Der Killer macht offenbar Jagd auf Paare und lauert ihnen in ihren glücklichsten Momenten auf. Und er scheint fest entschlossen, auch alle Zeugen aus dem Weg zu räumen, die den Ermittlern Lincoln Rhyme und Amelia Sachs – selbst frisch verheiratet – helfen könnten, das Morden zu stoppen.
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet undwww.twitter.com/BlanvaletVerlag
Jeffery Deaver
Der Todbringer
Thriller
Ins Deutsche übertragen von Thomas Haufschild
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The Cutting Edge« bei Grand Central Publishing, New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Gunner Publications, LLC Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Redaktion: Dr. Rainer Schöttle Covergestaltung: www.buerosued.de Covermotiv: plainpicture/Hanka SteidleAF · Herstellung: sam
Für die Texas-Truppe:
Dan, Ellen, Wyatt, Bridget, Ingrid, Eric und meine Lieblingscowgirls Brynn, Sabrina und Shea.
Ich habe den Engel im Marmor gesehen und so lange gemeißelt, bis ich ihn befreit hatte.
Michelangelo
I
DAS KONZIPIEREN
Samstag, 13. März
1
»Ist es hier sicher?«
Er überlegte kurz. »Sicher? Wieso sollte es das nicht sein?«
»Ich mein ja nur. Hier ist nicht gerade viel los.« Die Frau sah sich in der düsteren, heruntergekommenen Eingangshalle um, deren uralter Linoleumboden so abgenutzt war, als hätte man ihn mit einer Schleifmaschine behandelt. Außer ihnen war niemand hier. Sie standen vor dem Aufzug des Gebäudes, mitten im Diamantenviertel von Midtown Manhattan. Da heute Samstag war – Sabbat, der jüdische Ruhetag –, hatten viele Geschäfte und Firmen geschlossen. Der Märzwind heulte und stöhnte.
»Wir kommen schon klar«, sagte William, ihr Verlobter. »Hier spukt es nur unter der Woche.«
Sie lächelte, aber nur für einen Moment.
Menschenleer, ja, dachte William. Und trübselig. Wie die meisten Bürogebäude in Midtown aus den … Dreißigern? Vierzigern? Aber bestimmt war es hier nicht unsicher.
Wenngleich technisch veraltet. Wo blieb denn bloß der Aufzug? Verdammt.
»Keine Sorge«, sagte William. »Wir sind hier nicht in der South Bronx.«
»Du warst noch nie in der South Bronx«, merkte Anna gutmütig an.
»Doch, ich hab mir mal ein Spiel der Yankees angesehen.« Und früher hatte sein Weg zur Arbeit ihn täglich durch die South Bronx geführt, sogar einige Jahre lang. Aber davon wusste Anna nichts.
Hinter den dicken Metalltüren hörte man Zahnräder und Kabelwinden rotieren. Unter lautem Knarren und Quietschen.
Der Aufzug. Tja, der war vielleicht tatsächlich nicht sicher. Aber die Chance, dass Anna zwei Etagen die Treppe hinaufsteigen würde, ging gegen null. Seine Verlobte, durchtrainiert, blond und selbstbewusst, hielt sich gut in Form, besuchte regelmäßig ein Sportstudio und war auf charmante Weise von ihrem feuerroten Fitnessarmband besessen. Es lag also nicht an der körperlichen Anstrengung, dass sie ihm mit ihrem herrlich sarkastischen Blick eine Absage erteilte. Nein, der Grund war, wie sie es einst ausgedrückt hatte, dass man als Frau das Treppenhaus eines solchen Gebäudes prinzipiell meiden sollte.
Auch wenn der Anlass ein freudiger war.
Annas praktische Veranlagung meldete sich zu Wort – mal wieder. »Und du findest die Idee wirklich gut, Billy?«
Er war darauf vorbereitet. »Aber natürlich.«
»Es ist so viel Geld!«
Ja, wohl wahr. Doch William hatte seine Hausaufgaben gemacht und wusste, dass er für die sechzehntausend Dollar auch eine entsprechende Qualität erhalten würde. Der Stein, den Mr. Patel in die Weißgoldfassung für Annas hübschen Finger einsetzte, hatte anderthalb Karat, einen Prinzessschliff und den Farbton F, dessen feines Weiß sehr nahe am absolut farblosen Idealwert D lag. Die Reinheit war mit IF bewertet – internally flawless –, was fast perfekter Lupenreinheit entsprach, abgesehen von einigen winzigen Makeln (Mr. Patel hatte erklärt, dass man sie »Einschlüsse« nannte), die nur ein Experte unter starker Vergrößerung überhaupt wahrnehmen würde. Der Diamant war nicht perfekt und nicht riesig, aber dennoch ein herrliches Stück Kohlenstoff, das einem unter Mr. Patels Juwelierlupe schier den Atem raubte.
Und, was am wichtigsten war, Anna liebte den Ring.
William hätte beinahe gesagt: Man heiratet schließlich nur einmal. Doch er biss sich, Gott sei Dank, gerade noch rechtzeitig auf die Zunge. Denn es traf zwar auf Anna zu, aber nicht auf ihn. Sie störte sich nicht an seiner Vergangenheit oder ließ es sich jedenfalls nicht anmerken, aber am besten brachte er das Thema gar nicht erst zur Sprache (was auch der Grund dafür war, dass sie nichts von seinen fünf Jahren als Berufspendler aus Westchester wusste).
Wo zum Teufel blieb dieser Aufzug?
William Sloane drückte erneut den Knopf, obwohl der schon leuchtete. Sie mussten beide darüber lachen.
Hinter ihnen öffnete sich die Tür zur Straße, und ein Mann trat ein. Im ersten Moment war er nur ein Umriss vor dem hellen Hintergrund der dreckigen Türscheibe, und William verspürte einen Anflug von Beklemmung.
Ist es hier sicher …?
Womöglich hatte er etwas zu voreilig geantwortet. Wenn sie in zehn Minuten dieses Gebäude verließen, würde der Gegenwert einer Immobilienanzahlung an Annas Finger stecken. Er sah sich um und stellte beunruhigt fest, dass es hier keine Überwachungskameras gab.
Doch der Mann kam näher, lächelte freundlich und nickte ihnen zu, um sich dann wieder seinem Smartphone zu widmen. Er war blass, trug eine dunkle Jacke und eine Strickmütze und hielt neben dem Telefon ein Paar Wollhandschuhe in der Hand – alles passend zu diesem außergewöhnlich frostigen Märztag. Und er hatte einen Aktenkoffer dabei. Offenbar arbeitete er in diesem Gebäude … oder wollte vielleicht einen Ring für seine Verlobte bei Patel abholen. Von ihm drohte keine Gefahr. Und selbst wenn – William war ebenfalls ein fleißiger Sportstudiobesucher und Fitnessarmbandträger, daher bestens in Form und notfalls fähig, mit einem Kerl dieser Statur fertigzuwerden. Eine Vorstellung, die sich wohl jeder Mann hin und wieder ausmalte.
Endlich kam der Aufzug, und die Türen glitten quietschend auseinander. Der Mann ließ dem Paar mit einer Geste den Vortritt.
»Bitte sehr.« Er sprach mit einem Akzent, den William nicht einordnen konnte.
»Danke schön«, sagte Anna.
Ein Nicken.
Im zweiten Stock öffnete sich die Tür, und der Mann bedeutete ihnen erneut mit ausgestreckter Hand, sie mögen vorangehen. William nickte ihm zu. Dann folgten er und Anna dem langen dunklen Korridor zu den Räumen von Patel Designs.
Jatin Patel war ein interessanter Mann, ein Einwanderer aus Surat im Westen Indiens, dem Zentrum der dortigen – und inzwischen auch weltweiten – Diamantenverarbeitung. Als William und Anna hier einige Wochen zuvor ihre Bestellung aufgegeben hatten, war Patel in Plauderlaune gewesen und hatte erzählt, dass die meisten Schmuckdiamanten der Welt dort geschliffen würden, in winzigen Werkstätten zweifelhaften Ursprungs, oft angesiedelt in Mietskasernen, heiß und schmutzig, mit mangelhafter Belüftung. Nur die wertvollsten Steine würden heutzutage noch in New York, Antwerpen oder Israel bearbeitet. Dank seines besonderen Geschicks sei es ihm gelungen, sich von den vielen Tausend anderen Schleifern in Surat abzuheben und genug Geld anzusparen, um in die Vereinigten Staaten auszuwandern und hier ein Geschäft zu eröffnen.
Er verkaufe zwar Schmuck und Diamanten an Endabnehmer – zum Beispiel an das baldige Ehepaar Sloane –, sei aber in erster Linie bekannt für das Schleifen hochwertiger Rohdiamanten.
Der Einblick in die Schmuckbranche hatte William bei diesem früheren Besuch regelrecht fasziniert. Ihm war zudem nicht entgangen, dass Patel bei manch harmloser Frage einsilbig reagierte und das Gespräch in eine andere Richtung lenkte. Offenbar besaß das Diamantengeschäft auch einige zwielichtige Seiten, über die lieber Stillschweigen bewahrt werden sollte. Man denke nur an die afrikanischen Blutdiamanten, die von Warlords und Terroristen zur Finanzierung ihrer schrecklichen Verbrechen genutzt wurden. (Der Prinzessschliff, den William zu kaufen gedachte, war als ethisch einwandfrei zertifiziert. William fragte sich dennoch unwillkürlich, wie verlässlich diese Zusicherung sein mochte. Stammte denn der Brokkoli, den er gestern Abend gedünstet hatte, auch wirklich aus biologischem Anbau, wie das Schild im Laden behauptete?)
Er bemerkte, dass der Mann aus dem Aufzug an der Nachbartür von Patels Geschäftsräumen stehen blieb und die Klingel betätigte.
Demnach war mit ihm alles in Ordnung.
William schüttelte über sich selbst den Kopf und klingelte bei Patel Designs. »Ja?«, ertönte es aus der Gegensprechanlage. »Wer ist da? Mr. Sloane?«
»Ja, wir sind’s.«
In diesem Moment kam William Sloane ein Gedanke. Wie in vielen alten Geschäftsgebäuden waren die Eingänge auf diesem Flur alle mit Oberlichtern versehen – waagerechten Fenstern über den Türen. Das von Patel hatte man mit dicken Metallstäben gesichert. Gleichwohl konnte man erkennen, dass drinnen Licht brannte. Doch nebenan – wo der Mann aus dem Aufzug stand – war alles dunkel.
Dort hielt niemand sich auf.
Nein!
Von hinten näherten sich plötzlich Schritte. William keuchte erschrocken auf, fuhr herum und sah den Mann auf sie zustürzen, das Gesicht nun hinter einer Skimaske verborgen. Der Fremde stieß sie in den kleinen Raum, in dem Patel hinter einem Tresen saß. Dabei ging der Eindringling so grob vor, dass Anna stürzte und mit einem Aufschrei hart auf dem Boden aufschlug. William wollte eingreifen, erstarrte jedoch, als der Mann, der inzwischen auch seine Handschuhe trug, eine schwarze Pistole auf ihn richtete.
»O Gott, nein! Bitte!«
Trotz seines Alters und des stattlichen Bauches stand Jatin Patel flink auf und wollte anscheinend einen Alarmknopf drücken. Er schaffte es nicht. Der Mann sprang zum Tresen vor und hieb ihm mit der Waffe ins Gesicht. Es gab ein grauenhaftes Geräusch. William hörte einen Knochen brechen.
Der Diamantenhändler schrie auf. Patels ohnehin fahler Teint wurde noch etwas bleicher.
»Hören Sie«, sagte William. »Ich kann Ihnen Geld geben. Und Sie können unseren Ring haben.«
»Nehmen Sie ihn!«, rief Anna. Und zu Patel: »Geben Sie ihm den Ring. Geben Sie ihm alles, was er will.«
Der Mann holte abermals mit der Pistole aus und schlug sie Patel wieder und wieder ins Gesicht. Patel flehte ihn wimmernd um Gnade an und sackte hilflos zu Boden. »Sie können mein Geld haben!«, stammelte er. »Viel Geld! Was auch immer Sie wollen! Bitte, bitte hören Sie auf.«
»Lassen Sie ihn in Ruhe«, rief Anna.
»Maul halten!« Der Mann sah sich im Raum um und schaute auch kurz zur Decke. Eine Videokamera war auf sie alle gerichtet. Dann nahm er den Tresen in Augenschein, den Schreibtisch dahinter und mehrere dunkle Zimmer im Hintergrund.
William streckte dem Fremden eine offene Hand entgegen, um keine Bedrohung darzustellen, und ging zu Anna. Er legte ihr eine Hand um die Taille und half ihr auf. Sie zitterte.
Der Räuber riss das Kabel einer Lampe aus einer Wandsteckdose. Dann brachte er aus seiner Tasche ein Teppichmesser zum Vorschein und schob mit dem Daumen die Klinge heraus. Er legte die Pistole hin, trennte zwei lange Stücke von dem Kabel ab, reichte eines davon an Anna weiter und wies auf William. »Hände fesseln.« Wieder dieser Akzent. Europäisch? Skandinavisch?
»Mach es. Das geht in Ordnung«, forderte William sie mit sanfter Stimme auf. »Er hätte uns erschießen können«, fügte er flüsternd hinzu. »Aber das will er nicht. Fessle mir die Handgelenke.«
»Fest.«
»Ja.«
Anna gehorchte mit zitternden Fingern.
»Hinlegen.«
William ließ sich zu Boden sinken.
Na klar, der Kerl musste zuerst die größte Gefahr ausschalten – ihn. Dann fesselte der Fremde Anna, ohne dabei Patel aus den Augen zu lassen, und stieß sie neben William zu Boden, sodass sie Rücken an Rücken lagen.
Auf einmal durchzuckte William ein erschreckender Gedanke, kalt wie ein Schwall Eiswasser. Der Mann hatte vor dem Überfall die Skimaske aufgesetzt, um sein Gesicht vor der Kamera zu verbergen.
Doch anfangs hatte er keine Maske getragen. Weil er sicherstellen musste, dass die Kunden ihm Zutritt zu Patels Geschäft verschaffen würden. Wahrscheinlich hatte er auf ein Paar gewartet, dem er zu einem vielversprechenden Ziel für seinen Raub folgen konnte.
Die Überwachungskamera hier im Raum hatte sein Gesicht nicht erfasst.
Aber William und Anna konnten ihn beschreiben.
Und das konnte nur eines bedeuten. Der Räuber hatte sie gefesselt, damit sie sich nicht wehren würden, wenn er sie ermordete.
Der Mann kam nun näher, stand über ihnen und blickte auf sie herab.
»Hören Sie, bitte …«
»Pssst.«
William schickte ein Stoßgebet zum Himmel. Falls es denn sein muss, dann hoffentlich mit der Pistole. Das wäre schnell und schmerzlos. Er drehte den Kopf und warf mit Mühe einen Blick nach oben. Der Mann hatte die Waffe auf dem Tresen liegen gelassen.
Nun hockte der Kerl sich neben sie beide und hob das Teppichmesser.
William lag immer noch Rücken an Rücken mit Anna. Schluchzend streckte er eine Hand so weit wie möglich aus und tastete nach ihr. War das ihre linke Hand? Und hätte an dem Finger, den er nun streichelte, beinahe ein anderthalbkarätiger Diamant im Prinzessschliff gesteckt, mit nur winzigen Makeln und nahezu farblos?
2
So sah sein Leben aus.
Der heutige Tag war typisch. Um sechs Uhr morgens aufgestanden, an einem Samstag, ist das zu fassen? Seiner Mutter geholfen, die Vorratskammer und alle Küchenregale leer zu räumen, um sauber zu machen und neues Kontaktpapier auszulegen. Danach das Auto gewaschen – an einem so nasskalten, trostlosen Tag! Zum Abschied seine Eltern umarmt und dann mit der Bahn von ihrem Haus in Queens die ganze Strecke bis nach Brooklyn gefahren, um etwas für Mr. Patel zu erledigen.
Und schließlich mit einer anderen Linie nach Manhattan, wo die Steine darauf warteten, von ihm geschliffen zu werden. Er saß nun in einem der schaukelnden Waggons auf dem Weg nach Norden.
Samstag. Wenn alle anderen zum Brunch gingen, ins Theater oder Kino … oder ins Museum.
Oder in eine Galerie.
Das war einfach nicht fair.
Ach, er brauchte gar kein Unterhaltungsprogramm. Vimal Lahori hätte sich schon darüber gefreut – er hätte es sogar vorgezogen –, im klammen Keller seines Elternhauses in Queens bleiben zu können.
Doch das stand nicht zur Debatte.
Er wickelte sich fester in seine dunkelgraue Wolljacke und ließ sich dabei sanft von der U-Bahn wiegen. Der Zweiundzwanzigjährige war dünn und nicht groß. Er hatte seine Körpergröße von eins achtundsechzig schon in der Grundschule erreicht und ungefähr zwei Jahre lang all seine Klassenkameraden überragt, bis die anderen Jungen gleichgezogen oder ihn überholt hatten. Später auf der Highschool gab es unter seinen Mitschülern mehr Latinos und Südostasiaten als Schwarze oder Weiße, sodass er auch dort nicht zu den Kleinsten zählte. Was nicht hieß, dass er ungeschoren davonkam. Sein größtes Pech war, dass seine Familie aus Kaschmir stammte, jener Region, auf die sowohl Indien als auch das Nachbarland Pakistan Anspruch erhoben. Vimal war seines Wissens der einzige Junge, der wegen eines Grenzkonflikts Prügel bezogen hatte (ironischerweise von zwei schlaksigen Oberschülern, die ihren Religionen nach – der eine Moslem, der andere Hindu – eigentlich Erzfeinde hätten sein müssen).
Die Verletzungen waren aber nur geringfügig und der Streit bald darauf vergessen gewesen, hauptsächlich weil Vimal sich nie als überzeugter Kaschmiri gab (er hätte nicht mal sicher sagen können, wo genau die Grenzen dieses Landes seiner Vorfahren verliefen). Und was noch wichtiger war, er konnte auf dem Fußballplatz alle anderen schwindlig spielen. Gegen Ballkontrolle hat Geopolitik einfach keine Chance.
Die Bahn näherte sich mit kreischenden Rädern der Haltestelle an der Zweiundvierzigsten Straße. Es roch nach Abgasen und salziger Luft. Vimal richtete sich auf und schaute in die Papiertüte, die er bei sich trug. Sie enthielt ein halbes Dutzend Steine. Er nahm einen heraus, ungefähr so groß wie seine Faust, grau und dunkelgrün, durchzogen von Kristallen. Das eine Ende war flach, das andere gerundet. Jeder Stein der Welt, ob groß oder klein, konnte in etwas anderes verwandelt werden, und mit ein wenig Geduld und Überlegung würde der Künstler erkennen, was das wohl sein mochte. Doch dieser Fall war eindeutig: ein Vogel. Vimal sah sofort einen Vogel vor sich, der die Flügel an den Leib presste und den Kopf einzog, um sich vor der Kälte zu schützen. Die Rohfassung würde nicht mehr als einen Tag erfordern.
Aber nicht heute.
Heute war ein Arbeitstag. Mr. Patel besaß großes Talent. Viele hielten ihn für ein Genie, auch Vimal. Und weil Mr. Patel so brillant war, war er vermutlich auch so streng. Vimal musste den Abington-Auftrag erledigen. Vier Steine von jeweils etwa drei Karat. Das würde volle acht Stunden dauern, und der alte Mann – er war fünfundfünfzig – würde Vimals Ergebnisse immer wieder quälend lange unter der Lupe begutachten. Um dann Nachbesserungen anzuordnen. Und auch diese nachbessern zu lassen.
Und wieder und wieder und wieder …
Die Türen der U-Bahn öffneten sich, und Vimal legte den Stein zurück in die Papiertüte. Einzelner Vogel, Januar – so hätte er die Skulptur genannt, die es nie geben würde. Er trat hinaus auf den Bahnsteig und stieg zur Straße empor. Ein Gutes hatte der Samstag immerhin: Die meisten der orthodoxen Geschäfte waren geschlossen, und im Diamantenviertel ging es weit weniger hektisch zu als unter der Woche, zumal bei diesem scheußlichen Märzwetter. Die emsige Betriebsamkeit dieser Gegend ging Vimal bisweilen gehörig auf die Nerven.
Als er nun in die Siebenundvierzigste Straße einbog, nahm seine Aufmerksamkeit ganz automatisch zu – so wie bei fast allen der vielen Hundert Angestellten hier, deren Arbeitgeber eher zurückhaltend um Kundschaft warben. Ja, in den Geschäfts- und Firmennamen war oft von »Juwelieren«, »Diamanten« oder »Schmuck« die Rede, doch die hochrangigen Anbieter sowie die wenigen bedeutenden Diamantenschleifer der Stadt neigten eher zu verklausulierten Bezeichnungen wie »Elijah Findings«, »West Side Collateral« und »Specialties In Style«.
Über die Tische dieser Geschäfte und Schleifwerkstätten wanderten an jedem einzelnen Tag des Jahres Diamanten und Edelsteine im Wert von mehreren Hundert Millionen Dollar. Und jeder auch nur halbwegs fähige Einbrecher oder Räuber dieser Welt war sich dessen bewusst. Hinzu kam, dass Edelsteine, Gold, Platin und fertige Schmuckstücke zumeist weder in gepanzerten Fahrzeugen transportiert wurden (weil es täglich zu viele einzelne Lieferungen gab, als dass ein solcher Aufwand sich gerechnet hätte) noch in Aluminiumkoffern, die jemand an sein Handgelenk kettete (denn das war viel zu auffällig, und eine Hand ließ sich – wie jeder Arzt bestätigen konnte – mit einer gewöhnlichen Bügelsäge in weniger als sechzig Sekunden abtrennen, von Elektrowerkzeug ganz zu schweigen).
Nein, man beförderte Wertgegenstände am besten auf genau die gleiche Weise wie Vimal in diesem Moment – zwanglos gekleidet (Jeans, Joggingschuhe, Motto-Sweatshirt mit albernem Spruch, Wolljacke) und in der Hand eine fleckige Papiertüte.
Daher befolgte Vimal nun, was sein Vater – selbst ein ehemaliger Diamantenschleifer – ihm eingeschärft hatte, und ließ den Blick beharrlich in die Runde schweifen, ob jemand vielleicht argwöhnisch die Tüte anstarrte oder sich ihm näherte und dabei demonstrativ nicht hinsah.
Allzu große Sorgen machte er sich aber nicht, denn auch an weniger geschäftigen Tagen wie heute war Wachpersonal vor Ort, vermeintlich unbewaffnet, aber mit einem dieser kleinen Revolver oder einer kompakten Automatik im verschwitzten Hosenbund. Er nickte einer von ihnen zu, die vor einem Juweliergeschäft stand, einer Afroamerikanerin mit kurzem lilafarbenem und stark gekräuseltem Haar, das Vimal oft bestaunte; er hatte keine Ahnung, wie sie das hinbekam. In seiner eigenen Volksgruppe gab es mehr oder weniger nur eine Universalfrisur für alle (dichtes schwarzes Haar, gewellt oder glatt), und diese Frau machte großen Eindruck auf ihn. Er überlegte, wie ihr Kopf sich wohl in Stein abbilden ließe.
»He, Es«, rief er und winkte.
»Vimal. Am Samstag? Hat der Boss dir nicht freigegeben? So ein Mist aber auch.«
Er zuckte die Achseln und lächelte gequält.
Sie warf einen Blick auf die Tüte, in der sie womöglich ein halbes Dutzend von Harry Winston zertifizierte Steine im Wert von zehn Millionen vermutete.
Vimal war versucht zu behaupten, es seien bloß belegte Brote. Sie würde wahrscheinlich lachen. Doch in der Siebenundvierzigsten Straße hätte ein Witz irgendwie unangebracht gewirkt. Das Diamantenviertel war ein eher humorloser Ort. Der Wert der Steine und nicht zuletzt ihre narkotisierende Wirkung verliehen allen Geschäften hier eine gewisse Ernsthaftigkeit.
Er betrat nun Mr. Patels Gebäude. Den Zeitlupenaufzug nahm er nie – das Ding stamme aus dem magischen Fundus der Harry-Potter-Romane und lasse Sekunden zu Stunden werden, hatte er mal zu Adeela gesagt und sie damit zum Lachen gebracht. Stattdessen lief er geschmeidig die Treppe hinauf, als könne die Schwerkraft ihm nichts anhaben. Der Fußballplatz hatte seine Beine und Lunge stark werden lassen.
Als er in den Korridor einbog, fiel ihm auf, dass es hinter vier der acht Oberlichter immer noch dunkel war. Wie so oft fragte er sich, weshalb Mr. Patel, der einen riesigen Haufen Geld besitzen musste, nicht irgendwo anders einen noblen Laden eröffnete. Vielleicht aus Sentimentalität. Die Firma war nun seit dreißig Jahren hier beheimatet. Damals hatte es auf der gesamten Etage nur Diamantenschleifer gegeben. Inzwischen war dies eine der letzten Werkstätten im ganzen Gebäude. Kalt an Tagen wie heute, heiß und staubig von Juni bis September. Und es roch hier muffig. Mr. Patel hatte keinen eigentlichen Verkaufsraum, und die »Werkstatt« nahm lediglich eines der drei Zimmer ein. Da er geringe Stückzahlen von umso höherer Qualität lieferte, benötigte er nur genug Platz für zwei Polier- und zwei Schleifmaschinen. Ein Umzug wäre jederzeit möglich gewesen.
Doch Mr. Patel hatte Vimal nie den Grund für seinen Verbleib genannt, denn er sagte praktisch kaum etwas zu ihm, abgesehen von Anweisungen, wie man den Reibstab halten musste, wie man die Steine für den Grobschliff in die Maschine einspannte und wie viel Diamantenstaub man mit Olivenöl mischte, um die Polierpaste zu erhalten.
Auf halbem Weg zur Tür hielt Vimal inne. Was war das für ein Geruch? Frische Farbe. Die Wände hier im Flur brauchten zwar eindeutig einen neuen Anstrich, und das schon seit Jahren, aber er konnte keinerlei Anzeichen für irgendwelche Renovierungsbemühungen sehen.
Schon unter der Woche war es schwer genug, die Hausverwaltung auch nur zu irgendetwas zu bewegen. Und dann war jemand ausgerechnet am Freitagabend oder Samstag hergekommen, um Malerarbeiten zu erledigen?
Er ging weiter. Die Oberlichter hier waren aus Glas, aber natürlich mit Gitterstäben gesichert. Vimal konnte anhand der Schatten erkennen, dass Mr. Patel offenbar gerade Kundschaft hatte. Vielleicht das Paar, das wegen eines besonderen Verlobungsrings zu ihm gekommen war. William Sloane und Anna Markam – er erinnerte sich an die Namen, weil die beiden so ausgesprochen nett gewesen waren und sich sogar Vimal, dem kleinen Angestellten, vorgestellt hatten, als er ihnen bei ihrem letzten Besuch über den Weg gelaufen war. Nett, aber naiv. Falls sie das Geld, das sie für ihren anderthalbkarätigen Diamanten ausgaben, stattdessen irgendwo angelegt hätten, hätte es am Ende womöglich für die Studiengebühren ihres erstgeborenen Kindes gereicht. Aber auch sie waren wohl den Verlockungen des Diamantenmarketings erlegen.
Falls Vimal und Adeela je heirateten – was bisher noch kein Thema gewesen war, nicht mal annähernd –, würde er ihr zur Verlobung einen handgefertigten Schaukelstuhl schenken oder eine Skulptur für sie anfertigen. Und falls sie einen Ring wollte, würde er einen aus Lapislazuli schleifen, mit dem Kopf eines Fuchses darauf, denn das war aus irgendeinem Grund ihr Lieblingstier.
Er tippte den Code für das Türschloss ein.
Dann betrat er den Raum und erstarrte mitten in der Bewegung, keuchte unwillkürlich auf.
Schon im ersten Moment nahm er drei Dinge wahr. Erstens, ein Mann und eine Frau – William und Anna –, die seltsam verdreht am Boden lagen, als wären sie unter großen Qualen gestorben.
Zweitens, eine große, sich ausbreitende Blutlache.
Drittens, Mr. Patels Füße. Den Rest des Körpers konnte Vimal nicht sehen, nur die abgenutzten Schuhe, die reglos nach oben wiesen.
Aus der links vom vorderen Zimmer gelegenen Werkstatt kam eine Gestalt zum Vorschein. Der Mann trug eine Skimaske, zuckte vor Schreck aber sichtlich zusammen.
Weder Vimal noch er rührten sich.
Dann ließ der Eindringling den Aktenkoffer fallen, den er in der Hand hielt, und zog eine Pistole aus der Tasche. Vimal drehte sich instinktiv weg und hob beide Hände, als könne er der Kugel irgendwie ausweichen oder sie aufhalten.
Die Mündung blitzte auf, und der Knall war ohrenbetäubend. Ein stechender Schmerz fuhr durch Vimals Bauch und Seite.
Er torkelte zurück in den dunklen, staubigen Korridor und konnte plötzlich nur noch eines denken: Was für ein trauriger, erbärmlicher Ort zum Sterben.
3
Er war nicht rechtzeitig nach New York zurückgekehrt.
Zu seiner Enttäuschung.
Lincoln Rhyme steuerte seinen Rollstuhl Marke Merits Vision – grau mit roten Schutzblechen – durch die Vordertür seines Stadthauses am Central Park West. Jemand hatte mal angemerkt, der Ort lasse ihn an Sherlock Holmes denken – auf zweierlei Weise. Zunächst mal hätte der alte Sandsteinbau gut ins viktorianische England gepasst (er stammte aus jener Zeit), und außerdem war der ehemalige Salon des Hauses mit derartig vielen forensischen Instrumenten und Ausrüstungsgegenständen gefüllt, dass der britische beratende Detektiv schier vor Neid erblasst wäre.
Rhyme blieb am Eingang stehen, um auf Thom zu warten, seinen adretten, kräftigen Betreuer, der den behindertengerechten Mercedes Sprinter in der Sackgasse hinter dem Haus geparkt hatte. Als eine kalte Brise über seine Wange strich, wendete Rhyme den Rollstuhl und versetzte der Tür einen Stoß, um sie anzulehnen. Der Wind drückte sie wieder auf. Nach Jahren der Querschnittslähmung, die ihn vom Hals an abwärts beeinträchtigte, war Rhyme mittlerweile ziemlich geübt darin, all die Hightech-Hilfsmittel zu nutzen, die Leuten wie ihm zur Verfügung standen: Touchpads, Systeme zur Augen- und Sprachsteuerung, Prothesen und dergleichen. Dank operativer Eingriffe und einiger Implantate konnte er zudem den rechten Arm eingeschränkt bewegen. Doch viele altmodische mechanische Aufgaben, vom Schließen einer Tür bis – um irgendein beliebiges Beispiel zu wählen – zum Öffnen einer Flasche Single Malt Scotch, lagen buchstäblich außerhalb seiner Reichweite.
Gleich darauf traf Thom ein und machte die Tür zu. Er zog Rhyme die Jacke aus – der Kriminalist weigerte sich, eine Decke zu »tragen«, um sich zu wärmen –, und ging in die Küche.
»Mittagessen?«
»Nein.«
»Ich hab mich falsch ausgedrückt«, rief der Betreuer zurück. »Gemeint habe ich: Was möchtest du zu Mittag?«
»Nichts.«
»Falsche Antwort.«
»Ich habe keinen Hunger«, murmelte Rhyme, nahm umständlich die Fernbedienung des Fernsehgeräts und schaltete die Nachrichten ein.
»Du musst etwas essen«, rief Thom. »Suppe. Heute ist es kalt draußen. Suppe.«
Rhyme verzog das Gesicht. Ja, sein Zustand war ernst, und manche Dinge, zum Beispiel Druck auf der Haut oder fehlende Erleichterung bei gewissen Körperfunktionen, konnten gefährliche Konsequenzen haben. Hunger stellte jedoch keinen potenziellen Risikofaktor dar.
Der Betreuer war ja so eine gottverdammte Glucke.
Dann stieg Rhyme auf einmal ein verlockender Duft in die Nase. Nun ja, Thom konnte wirklich gut kochen.
Er wandte seine Aufmerksamkeit dem Fernseher zu, den er nur selten nutzte. Meistens wollte er dann eine bestimmte Nachrichtenentwicklung verfolgen, so auch diesmal: Die Geschichte hatte mit seiner Enttäuschung zu tun, entstanden als Folge der Reise nach Washington D. C., von wo er und Amelia Sachs soeben zurückgekehrt waren.
Auf dem Bildschirm war aber kein Nachrichtensender, sondern ein Dokumentarkanal eingestellt. Im Augenblick lief ein Beitrag über wahre Verbrechen, allerdings mit Spielszenen. Der Bösewicht starrte finster in die Kamera. Die Polizisten schauten nachdenklich drein. Die Musik schwoll dramatisch an. Der Beamte der Spurensicherung trug am Tatort seine Armbanduhr über dem Handschuh.
Um Gottes willen.
»Hast du dir etwa diesen Mist angesehen?«, rief er.
Thom antwortete nicht.
Rhyme schaltete auf einen der Nachrichtensender um. Leider lief gerade kein Beitrag, sondern Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente. Er hatte keine Ahnung, was das Zeug im Einzelnen bewirken sollte, aber es verwandelte die Schauspieler von trübsinnigen Greisen in fröhliche und anscheinend weniger alte Großeltern, die in der letzten Szene mit kleinen Kindern herumtollten, weil die Kann-nicht-mit-den-Enkeln-spielen-Krankheit geheilt war.
Dann übernahm ein Moderator, und nach einigen Meldungen aus der Lokalpolitik kam kurz die Geschichte zur Sprache, für die Rhyme sich interessierte: Es ging um ein Gerichtsverfahren, das derzeit im Eastern District von New York stattfand. Ein mexikanischer Drogenbaron namens Eduardo Capilla, besser bekannt als El Halcón, hatte den Fehler begangen, in die Vereinigten Staaten zu kommen, um sich hier mit einem ortsansässigen Vertreter des organisierten Verbrechens zu treffen und einen Drogen- und Geldwäschering aufzuziehen, dessen Aktivitäten sich noch um etwas Kinderprostitution und Menschenhandel erweitert hatten.
Der Mexikaner war ziemlich gerissen. Als mehrfacher Milliardär hatte er nur einen gewöhnlichen Linienflug in der Economyklasse gebucht, um legal nach Kanada einzureisen. Dort war er dann mit einer Privatmaschine bis zu einem Flugfeld kurz vor der Grenze gelangt. Von da aus hatte ein Hubschrauber ihn – illegal – zu einem verlassenen Landeplatz auf Long Island gebracht und war dabei wortwörtlich unter dem Radar geblieben. Die Stelle lag nur wenige Meilen von einem Lagerhauskomplex entfernt, den Capilla zu kaufen gedachte, um daraus, so nahm man an, die Zentrale seines US-Geschäfts zu machen.
Die Polizei und das FBI hatten jedoch von seiner Anwesenheit erfahren und ihn gemeinschaftlich dort abgefangen. Es gab einen Schusswechsel, bei dem der Lagerhausbesitzer und sein Leibwächter ums Leben kamen. Ein Polizeibeamter wurde schwer verwundet, und ein FBI-Agent trug ebenfalls Verletzungen davon.
El Halcón konnte verhaftet werden, sein amerikanischer Partner hingegen, mit dem er das Drogenimperium hatte aufbauen wollen, war zur Bestürzung der Staatsanwaltschaft nicht vor Ort gewesen und seine Identität blieb ungeklärt; der erschossene Lagerhausbesitzer erwies sich lediglich als Strohmann. Alle weiteren Nachforschungen verliefen im Sande.
Lincoln Rhyme hatte inständig gehofft, zu dem Fall hinzugezogen zu werden, um die Spuren zu analysieren und als forensischer Sachverständiger vor Gericht auszusagen. Doch er hatte zuvor bereits Termine mit einem halben Dutzend hochrangiger Beamter in Washington vereinbart, und so war ihm und Sachs nicht anderes übrig geblieben, als die ganze Woche dort zu verbringen.
Ja, er war enttäuscht. Er hätte wirklich gern geholfen, El Halcón hinter Gitter zu bringen. Aber es würde andere Fälle geben.
Zufälligerweise klingelte genau bei diesem Gedanken sein Telefon, und die Kennung des Anrufers deutete womöglich darauf hin, dass Rhymes Wunsch erfüllt werden könnte.
»Lon«, sagte er.
»Linc. Schon zurück?«
»Ja, gerade erst. Hast du was Verzwicktes für mich? Was Interessantes? Eine Herausforderung?«
Detective First Grade Lon Sellitto war damals beim NYPD Rhymes Partner gewesen, doch heutzutage unternahmen sie kaum noch etwas gemeinsam und telefonierten auch nie miteinander, um einfach nur zu plaudern. Ein Anruf von Sellitto bedeutete für gewöhnlich, dass er Hilfe bei einem Fall benötigte.
»Keine Ahnung, ob es diesen drei Kriterien genügt. Aber ich hab eine Frage.« Der Detective schien außer Atem zu sein. Vielleicht wegen eines dringenden Falls, vielleicht aber auch, weil er sich gerade einen Karton Donuts geholt hatte.
»Und die wäre?«
»Was weißt du über Diamanten?«
»Diamanten … Hm. Mal sehen. Ich weiß, dass sie Allotropien sind.«
»Sie sind was?«
»Allotropien. So nennt man ein chemisches Element, das in mehr als einer Form existiert. Kohlenstoff ist geradezu ein Musterbeispiel dafür. Ein Superstar in der Welt der Elemente, wie sogar du wissen dürftest.«
»Sogar ich«, knurrte Sellitto.
»Kohlenstoff kann als Graphen auftreten, als Fulleren, Graphit oder Diamant. Es kommt darauf an, wie die Atome angeordnet sind. Graphit hat eine hexagonale Kristallstruktur, Diamanten eine kubische. Das klingt nach nicht viel. Aber es bedeutet den Unterschied zwischen einem Bleistift und den Kronjuwelen.«
»Linc, tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ich hätte so anfangen sollen: Hast du schon jemals Ermittlungen im Diamantenviertel durchgeführt?«
Rhyme dachte an seine Zeit als Detective zurück, als Leiter der Spurensicherung des NYPD und dann als freier Berater. Manche der Fälle hatten mit der Gegend um die Siebenundvierzigste Straße in Midtown zu tun gehabt, aber bei keinem war es um Diamantengeschäfte oder – händler gegangen. Er teilte es Sellitto mit.
»Wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Ein aus dem Ruder gelaufener Raubüberfall, wie es aussieht. Mehrere Tote.« Eine Pause. »Und noch anderer Scheiß.«
Was eher kein kriminalistischer Fachbegriff war, stellte Rhyme fest. Er war neugierig.
»Bist du interessiert?«
Da der El-Halcón-Fall ihm durch die Lappen gegangen war, lautete die Antwort Ja. »Wie schnell kannst du hier sein?«, fragte Rhyme.
»Lass mich rein.«
»Was?«
Aus dem vorderen Korridor ertönte ein lautes Hämmern. »Ich bin hier draußen«, sagte Sellitto am Telefon. »Um dich notfalls zu diesem Fall zu überreden, ob du willst oder nicht. Na los, mach schon die verdammte Tür auf. Die Kälte fühlt sich an, als hätten wir Januar.«
* * *
»Möchten Sie Suppe?«, fragte Thom, nahm Lon Sellitto den graubraunen Mantel ab und hängte ihn auf.
»Nein. Halt, was denn für eine?« Sellitto hatte den Kopf gehoben, als wolle er dem Duft nachschnuppern, der aus der Küche herüberzog.
»Tomatencremesuppe mit Shrimps. Lincoln isst auch eine Portion.«
»Nein, esse ich nicht.«
»Doch, isst er.«
»Hm.« Der stämmige und zerknitterte – was seine Kleidung meinte, nicht den Mann – Lon Sellitto hatte schon immer Gewichtsprobleme gehabt, zumindest seit Rhyme ihn kannte. Vor einer Weile hatte ein Verbrecher, den er und Rhyme jagten, ihn vergiftet und beinahe getötet, wodurch er sehr stark abnahm. Ein dürrer Lon Sellitto war jedoch ein beunruhigender Anblick, und der Detective arbeitete derzeit daran, wieder zu alter Form zurückzufinden. Rhyme freute sich, als er nun sagte: »Okay.«
Außerdem würde es ein wenig von ihm selbst ablenken. Er hatte nämlich keinen Hunger.
»Wo ist Amelia?«, fragte Sellitto.
»Nicht hier.«
Amelia Sachs war in Brooklyn, wo sie in der Nähe ihrer Mutter wohnte. Rose hatte ihre Herzoperation zwar gut überstanden, doch Sachs schaute dennoch häufig bei ihr vorbei.
»Noch nicht.«
»Wie meinst du das?«, fragte Rhyme.
»Sie ist unterwegs. Müsste bald eintreffen.«
»Hier? Hast du sie angerufen?«
»Ja. Oh, das riecht aber gut. Kocht er oft Suppe?«
»Du hast also entschieden, dass wir an diesem Fall arbeiten werden?«, fragte Rhyme.
»Gewissermaßen. Rachel und ich machen uns oft nur eine Dose auf. Campbell’s oder so.«
»Lon?«
»Ja, ich habe es für euch entschieden.«
Die Suppe kam. Zwei Schalen. Rhyme bekam seine auf das kleine Tablett an seinem Rollstuhl gestellt. Sellitto setzte sich an einen der Tische. Rhyme sah genauer hin. Das roch wirklich gut. Vielleicht hatte er ja doch Hunger. Thom lag mit seiner Einschätzung meistens richtig, wenngleich Rhyme es nur selten zugab. Der Betreuer bot an, ihn zu füttern, doch Rhyme schüttelte ablehnend den Kopf und versuchte es selbst. Suppe stellte für seine zittrige rechte Hand eine schwierige Aufgabe dar, doch er schaffte es, ohne zu kleckern. Zum Glück konnte er Sushi nicht ausstehen; Essstäbchen wären dann doch zu kompliziert gewesen.
Zu Rhymes Überraschung traf nun noch jemand ein, den Lon Sellitto offenbar zu dem Diamantenfall hinzugezogen hatte: Ron Pulaski. Rhyme nannte ihn aus Gewohnheit immer noch Grünschnabel, obwohl er schon seit Jahren kein Neuling mehr war. Genau genommen gehörte der blonde uniformierte Beamte zur Streifenpolizei, aber sein Geschick bei der Tatortuntersuchung war Rhyme positiv aufgefallen, und so hatte der Kriminalist darauf bestanden, dass Sellitto ihn inoffiziell zur Abteilung für Kapitalverbrechen abkommandieren ließ, wo Sellitto und Sachs arbeiteten.
»Lincoln. Lon.« Der zweite Name kam Pulaski etwas leiser und zögerlicher über die Lippen. Sellitto hatte einen höheren Rang, weitaus mehr Dienstjahre und ein explosiveres Temperament als er selbst.
Zudem litt Pulaski unter den Folgen einer Kopfverletzung, die er seiner ersten Zusammenarbeit mit Rhyme und Sachs verdankte. Nach einer längeren Auszeit hatte er die schwere Entscheidung getroffen, in den aktiven Dienst zurückzukehren. Seitdem plagten ihn die für ein Schädeltrauma typischen Unsicherheiten und Zweifel.
Als er Rhyme gegenüber einmal angemerkt hatte, er wolle den Dienst quittieren, weil er sich der Polizeiarbeit nicht mehr gewachsen fühle, hatte der barsch erwidert: »Das spielt sich alles nur in Ihrem dämlichen Kopf ab.«
Der junge Beamte hatte ihn angestarrt und Rhyme derweil so lange wie möglich keine Miene verzogen, aber dann hatten sie beide lachen müssen. »Ron, wir alle haben auf die eine oder andere Weise einen Dachschaden. Aber jetzt müssen Sie für mich einen Tatort untersuchen. Meinen Sie, Sie kriegen das hin?«
Natürlich hatte er die Aufgabe übernommen.
Pulaski zog nun seinen Mantel aus, unter dem er die dunkelblaue Uniform des New York Police Department trug.
Thom bot auch ihm etwas zu essen an, und Rhyme hätte beinahe gesagt: »Schluss jetzt, wir sind hier keine Suppenküche« – ein schlagfertiger Einwurf, wie er fand –, aber Pulaski lehnte sowieso dankend ab.
Kurz darauf drang durch das geschlossene Fenster das tiefe Blubbern eines leistungsstarken Wagens an ihre Ohren. Amelia Sachs war eingetroffen. Sie gab kurz noch mal Gas und schaltete dann den Motor aus. Als sie eintrat, hängte sie ihre Bomberjacke an einen Haken und schob das Polymerholster der Glock an ihrer Jeans ein Stück nach hinten, weil das bequemer war. Sie trug einen blaugrünen Rollkragenpullover und darunter ein schwarzes seidenes T-Shirt, wie Rhyme am Morgen beim Anziehen gesehen hatte. Laut dem Wetterbericht im Radio sollte es nämlich ungewöhnlich kalt für Mitte März werden, wie schon die ganze letzte Woche. In Washington waren die Kirschblüten zu Tausenden erfroren.
Sachs nickte allen Anwesenden zu. Sellitto winkte zurück und löffelte geräuschvoll seine Suppenschale leer.
Da nun das Team beisammen und gesättigt war, wie Rhyme belustigt bei sich dachte, konnte Sellitto sie über die Einzelheiten in Kenntnis setzen.
»Vor ungefähr einer Stunde hat sich in Midtown North ein Raub mit mehreren Toten ereignet. Siebenundvierzigste Straße West, Nummer achtundfünfzig, zweiter Stock. Patel Designs, Eigentümer Jatin Patel, fünfundfünfzig. Er ist einer der Toten. Diamantenschleifer. Hat außerdem selbst Schmuck hergestellt und verkauft. War wohl recht berühmt, wie es heißt. Aber ich kenne mich mit Schmuck nicht aus, also mag ich mich irren. Der Fall wurde unserer Abteilung zugewiesen, mein Chef hat ihn mir auf den Tisch gelegt, und ich ziehe jetzt euch hinzu.«
Die Abteilung für Kapitalverbrechen unterstand einem Deputy Inspector des Detective Bureau an der Police Plaza Nummer eins. Gewöhnliche Morde und Raubüberfälle fielen eigentlich nicht in ihre Zuständigkeit.
Lon Sellitto war der Blick zwischen Rhyme und Sachs nicht entgangen. Er erklärte ihnen nun die besonderen Umstände.
»Unsere Freunde im Rathaus haben durchblicken lassen, dass ein Raubmord im Diamantenviertel so ziemlich das Letzte ist, was wir gebrauchen können. Vor allem, falls der Kerl sich noch weitere Läden vornehmen will. Das könnte nämlich die Kundschaft verscheuchen. Es wäre schlecht für den Tourismus und schlecht für die Wirtschaft.«
»Die Begeisterung der Opfer hält sich wahrscheinlich ebenfalls in Grenzen, meinst du nicht auch, Lon?«
»Ich habe bloß wiederholt, was mir zugetragen wurde, Linc. Okay?«
»Red nur weiter.«
»Da ist noch was, aber das bleibt strikt vertraulich. Der Täter hat Patel gefoltert. Der zuständige Captain vom Revier Midtown North meint, er habe vielleicht nicht kooperieren wollen – den Tresor öffnen oder was auch immer. Also hat der Killer ihn mit einem Teppichmesser zum Reden gebracht. Es ging wohl heftig zur Sache.«
Und noch anderer Scheiß …
»Okay«, sagte Rhyme. »Legen wir los. Sachs, zum Tatort. Ich hole Mel Cooper hinzu. Pulaski, Sie bleiben hier. Ich behalte Sie vorläufig in Reserve.«
Sachs nahm ihre Jacke vom Haken, streifte sie über und steckte sich eine Halterung mit zwei Reservemagazinen links an den Hosenbund. Dann machte sie sich auf den Weg.
Thom kam in den Salon und lächelte ihr zu. »Oh, Amelia. Ich hab dich gar nicht gehört. Hast du Hunger?«
»Und wie. Ich hatte weder Frühstück noch Mittagessen.«
»Wie wär’s mit einer Suppe? Genau das Richtige an einem kalten Tag.«
Sie schenkte ihm ein gequältes Lächeln. Den Ford Torino Cobra mit seinen 410 PS und dem von Hand geschalteten Vierganggetriebe durch Midtown Manhattan zu jagen ließ den gleichzeitigen Verzehr eines Getränks oder gar einer heißen Suppe recht problematisch werden.
Sie zog den Autoschlüssel aus der Tasche. »Vielleicht später.«
4
Der Tatort bei Patel Designs in der Siebenundvierzigsten Straße stellte Amelia Sachs vor drei Fragen.
Erstens, da der Täter Hunderte von Diamanten, die frei zugänglich im offenen Tresor lagen, einfach zurückgelassen hatte: Was war seine Absicht gewesen? Hatte er überhaupt etwas gestohlen?
Zweitens: Warum war Patel gefoltert worden?
Drittens: Wer war der anonyme Anrufer, der das Verbrechen gemeldet und eine ziemlich detaillierte Beschreibung des Täters geliefert hatte? Die Frage hatte einen Teil B: War er noch am Leben? Bei ihrem Eintreffen vor Ort hatte Sachs sofort gerochen, dass hier eine Schusswaffe abgefeuert worden war. Der Zeuge war vermutlich unerwartet in den Raubüberfall geplatzt und dabei angeschossen worden. Er hatte jedoch fliehen können und an einem Münzfernsprecher den Notruf gewählt.
Die Räumlichkeiten waren beengt, und zwischen Waffe und Opfer hatten höchstens drei oder vier Meter gelegen. Auf diese Entfernung war es schwierig, keinen tödlichen Schuss anzubringen. Und es gab keine weiteren Einschusslöcher, weder im Büro noch draußen im Korridor. Der Zeuge war nahezu mit Sicherheit getroffen worden.
Sachs, die einen weißen Overall mit Kapuze und Füßlingen trug, ging um die beachtliche Blutlache herum, deren Form an den Lake Michigan erinnerte, und legte die Nummern für die Fotografien aus – kleine Zifferntafeln, mit denen die Spuren und anderen relevanten Aspekte des Verbrechens markiert wurden. Nach Anfertigung der Aufnahmen suchte sie den Tatort Zentimeter für Zentimeter ab. Dabei hielt sie sich wie stets an das Gitternetzmuster, das Rhyme ihr beigebracht hatte: Sie durchmaß den Schauplatz von einem Ende zum anderen, machte einen Schritt zur Seite und trat auf einer unmittelbar parallelen Bahn den Rückweg an, so wie ein Gärtner einen Rasen mähte. Am Ende wiederholte sie die ganze Prozedur im rechten Winkel zur ursprünglichen Ausrichtung oder »gegen den Strich«, wie Rhyme das nannte.
Dabei nahm Sachs Partikelproben, sicherte Fußspuren, suchte nach Fingerabdrücken und fertigte Abstriche all jener Stellen an, die eventuell DNS des Täters aufwiesen. Als sie sich aufrichtete und den Blick durch die insgesamt etwa achtzig Quadratmeter umfassenden Räumlichkeiten schweifen ließ, entdeckte sie draußen vor der Eingangstür, die durch einen Gummikeil aufgehalten wurde, einen Mann, der den gleichen Overall wie sie selbst trug. »Der Computer steht da drüben im Büro«, sagte sie. »Drück uns mal die Daumen.«
Dieser Techniker der Spurensicherung war auf Überwachungskameras und Speichermedien spezialisiert und würde alle verfügbaren Daten der Festplatte in Patels Büro extrahieren. Hinter dem Tresen war nämlich eine einzelne Kamera auf den Eingang gerichtet. Sie schien zu funktionieren, jedenfalls leuchtete an ihr regelrecht aufreizend ein kleiner roter Punkt, und ein Kabel verlief von ihr zu Patels Desktop-PC, neben dem nicht nur ein großer Drucker stand, sondern seltsamerweise auch ein uraltes Faxgerät. Die Kamera war nur mit dem Computer verbunden, eine weitere Leitung gab es nicht.
Sachs ging davon aus, dass bloßes Daumendrücken nicht ausreichen würde. Der Täter hatte bestimmt daran gedacht, die Überwachungsvideos zu löschen. Wie aber jeder Cop wusste, waren derartige Löschvorgänge zumeist nicht permanent. Auf digitalen Datenträgern ließen sich massenweise Informationen zum Vorschein bringen – es sei denn, sie hatten gar nicht erst existiert. Diese Gefahr bestand natürlich auch.
Sachs füllte nun die Registrierkarten aus, die an den jeweiligen Beweismitteln oder an den Behältern, in denen diese verstaut waren, befestigt wurden, um darauf die Verwahrkette zu dokumentieren.
Dann kam der schwierigste Teil.
Sie hatte sich die Leichen bis zum Schluss aufgespart.
Denn wenn es nicht aus irgendeinem Grund nötig war, sie als Erstes zu untersuchen, zögerte man diese Pflicht oft ein wenig hinaus.
Das Bild, das sich ihr sofort beim Betreten des Raumes eingeprägt hatte und das ihr immer noch naheging, waren die Finger des Paares mit den durchschnittenen Kehlen. Man hatte beiden die Hände auf den Rücken gefesselt, und irgendwann – höchstwahrscheinlich kurz vor dem Ende – hatten sie sich aneinandergedrängt und die Finger verschränkt. Und obwohl sie sich unter den Schnitten vor Schmerzen gewunden haben mussten, hatten sie einander nicht losgelassen. In ihrem Todeskampf war diese Berührung ihnen vielleicht ein winziger Trost gewesen. Sachs hoffte es jedenfalls. Sie hatte einst als Streifenpolizistin angefangen und war nun schon seit Jahren als Detective für die Abteilung für Kapitalverbrechen tätig. Das härtete zwangsläufig ab. Dennoch konnten Einzelheiten wie diese ihr immer noch an die Nieren gehen, auch wenn ihr keine Tränen in die Augen stiegen. Manche Cops ließen nichts an sich heran. Amelia glaubte, ihr Einfühlungsvermögen mache sie zu einer besseren Beamtin.
Der Firmenbesitzer, Jatin Patel, war ebenfalls an einer durchschnittenen Kehle gestorben. Aber zuvor hatte man ihn gefoltert. Die diensthabende Gerichtsmedizinerin, eine schmale Frau asiatischer Abstammung, hatte auf die Schnitte an Händen, Ohren und Gesicht hingewiesen. Und auf die Schläge mit der Pistole. Alle Wunden waren ante mortem.
Weder Patel noch das Paar schienen bestohlen worden zu sein, wenngleich Patel kein Mobiltelefon bei sich trug und auch nirgendwo eines herumlag. Aber die üblichen Wertgegenstände waren alle noch da: Brief- und Handtaschen, Schmuck, Bargeld. Amelia fotografierte die drei Toten aus allen Winkeln, sicherte an ihnen Fasern und andere Partikel mit einem Kleberoller und nahm Kontrollproben ihrer Haare. Es folgten Abriebe der Fingernägel, auch wenn keines der Opfer gegen den Täter gekämpft zu haben schien. Als Sachs mit einer alternativen Lichtquelle die Haut rund um die Fesselungen überprüfte, fand sie dort keine Fingerabdrücke. Sie hatte auch nicht damit gerechnet. Es gab hier so viele Spuren von Stoffhandschuhen, manche davon voller Blut, dass der Täter gewiss nicht zwischendurch nachlässig geworden war.
»Tut mir leid«, erklang es aus dem Büro.
Sachs ging zur Tür.
»Hier gibt’s keine Festplatte«, sagte der Techniker, dessen Overall sich über dem Bauch merklich spannte. »Er hat sie mitgenommen. Und eine Sicherungskopie gibt es auch nicht.«
»Wie hat er das denn angestellt?«
»Er muss das nötige Werkzeug mitgebracht haben. Nun ja, da reicht schon ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher.«
Sachs bedankte sich, ging hinaus auf den Korridor und nickte der Gerichtsmedizinerin zu, die geduldig abgewartet und sich derweil mit ihrem Smartphone beschäftigt hatte.
»Sie können die Leute mitnehmen«, sagte Amelia.
Die Frau nickte und verständigte über Funk ihre Kollegen vor dem Gebäude, die nun mit Rolltragen und Leichensäcken heraufkommen und die Toten zur Autopsie abtransportieren würden.
»Detective?« Ein junger stämmiger Streifenbeamter des Reviers Midtown North näherte sich vom Aufzug und blieb in einiger Entfernung stehen.
»Schon okay, Alvarez, wir sind mit dem Tatort fertig. Was gibt’s?«
Er und seine Partnerin, eine Afroamerikanerin Ende zwanzig, hatten getrennt voneinander nach Zeugen und etwaigen Spuren des Täters gesucht, die dieser bei seiner Ankunft oder Flucht hinterlassen haben könnte. Auf Zeugen wagte Sachs gar nicht erst zu hoffen. Viele der Büros hier standen leer, und überall hingen Zu-vermieten-Schilder. Die anderen Firmen auf dieser Etage hatten am Wochenende geschlossen – zumal am Samstag, dem jüdischen Sabbat.
»Im ersten Stock sind heute drei der Büros besetzt und in der Etage über uns zwei weitere«, berichtete Alvarez. »Zwei Leute haben gegen zwölf Uhr dreißig oder zwölf Uhr fünfundvierzig einen Knall gehört, ihn aber für eine Fehlzündung oder irgendwelche Bauarbeiten gehalten. Sonst hat niemand was gehört oder gesehen.«
Das mochte zutreffen, aber Sachs blieb wie immer ein wenig skeptisch. Der Überfall hatte in der Mittagszeit stattgefunden, und auf dem Weg in die Pause konnte manch ein Angestellter durchaus einen Blick auf den Täter erhascht haben. Leider wurden solche Zeugen aus Selbstschutz oft von einer plötzlichen Taub- und Blindheit befallen.
»Und dann wäre da noch das hier.« Alvarez zeigte auf eine Stelle neben dem Aufzug; dort hing eine Überwachungskamera an der Wand. Sachs hatte sie bislang nicht bemerkt. Sie kniff die Augen zusammen und lachte kurz auf. »Ist das Sprühfarbe?«
Er nickte. »Und achten Sie auf den Verlauf der Farbspur.«
Sachs benötigte einen Moment, bis ihr klar wurde, was er meinte. Der Täter – vermutlich der Täter – hatte mit dem Sprühen schon hinter der Kamera angefangen und dann die Kameralinse direkt von unten erwischt, damit er auch ja keine einzige Sekunde lang im Bild sein würde. Schlau.
Genau wie die Mitnahme der Festplatte.
»Gibt es Kameras entlang der Straße?«
»Das könnte was sein«, sagte Alvarez. »Die Geschäfte zu beiden Seiten dieses Gebäudes überspielen gerade ihre Videodateien für uns. Ich habe sie angewiesen, die Originale aufzubewahren.«
Für die Ermittlungen reichten Kopien aus; vor Gericht würde man die Originaldatenträger benötigen.
Falls es zu einem Prozess kommt, dachte Sachs.
Sie kehrte zum Tatort zurück und rief sich die erste ihrer drei Fragen ins Gedächtnis: Was hatte er mitgenommen? Die gründliche Sicherung aller Spuren verschaffte nicht unbedingt Klarheit darüber, ob vor Ort etwas fehlte.
Amelia ließ noch einmal den Blick in die Runde schweifen. Patel Designs war kein herkömmliches Juweliergeschäft. Es gab hier keine Vitrinen, die man hätte einschlagen und leer räumen können. Die Firma bestand aus drei Räumen: dem vorderen Empfangsbereich, dem direkt angrenzenden Büro und einem Durchgang zur Linken, der zu einer Werkstatt führte, mit deren Geräten offenbar die Steine geschliffen und Schmuckstücke zusammengefügt wurden. Diese Werkstatt war das geräumigste der drei Zimmer und mit zwei Arbeitsplätzen ausgestattet, deren große Drehteller an Töpferscheiben erinnerten, auf denen Vasen und Schalen geformt wurden. Eine der abgenutzten Industriemaschinen war anscheinend ein kleiner Laser. Die Werkstatt diente zudem als Lagerraum: In den Regalen und vor der Wand stapelten sich leere Kartons, Versand- und Büromaterialien sowie Putzzeug. Nichts hier wirkte besonders wertvoll.
Der vordere Raum – und Empfangsbereich – maß drei mal viereinhalb Meter, dominiert von einem hölzernen Tresen. Er enthielt außerdem eine Couch und zwei ungleiche Sessel. Auf dem Tresen lagen mehrere quadratische Samtkissen, je dreißig mal dreißig Zentimeter groß, auf denen Schmuckstücke begutachtet werden konnten, dazu diverse Juwelierlupen und einige Stapel Papier (sämtlich unbeschriftet). Amelia nahm an, dass Patel nur Auftragsarbeiten erledigte. Er würde sich hier mit den Kunden treffen, die von ihnen bestellten Schmuckstücke aus der Werkstatt oder dem hüfthohen Tresor im Büro holen und sie ihnen zur Beurteilung vorlegen. Eine Internetsuche hatte ergeben, dass das hauptsächliche Geschäft der Firma daraus bestand, im Dienst anderer Schmuckhersteller große Diamanten zu schleifen und zu polieren.
Frage Nummer eins …
Was hast du von hier mitgenommen?
Sachs ging noch einmal ins Büro und musterte den Safe und dessen Inhalt: Hunderte von acht mal acht Zentimeter großen Umschlägen, gefaltet aus weißem Papier, wie beim japanischen Origami. Sie enthielten lose Diamanten.
Die Handschuhabdrücke des Täters – teilweise erkennbar wegen des Bluts, teilweise wegen der von den Stofffasern absorbierten Rückstände – befanden sich am Tresor und an mehreren der Papierquadrate. Doch er hatte nicht alles durchwühlt. Amelia hätte eigentlich damit gerechnet, dass er entweder den gesamten Inhalt mitnehmen oder – sofern er etwas Bestimmtes suchte – die Umschläge alle überprüfen und gegebenenfalls beiseitewerfen würde.
Vielleicht ließ es sich herausfinden. Sachs hatte alle greifbaren Geschäftsunterlagen eingesammelt. Dazu zählte hoffentlich auch ein Bestandsverzeichnis der hier gelagerten Diamanten. Die Techniker im Hauptquartier der Spurensicherung in Queens würden in den dort für so kostspielige Beweismittel vorgesehenen, eigens gesicherten Räumlichkeiten einen entsprechenden Abgleich vornehmen und am Ende feststellen, was fehlte.
Doch das konnte Monate dauern.
Zu lange. Sie mussten so schnell wie möglich Klarheit über das Diebesgut erlangen, damit die vertraulichen Informanten der Polizei auf all jene Hehler und Geldwäscher angesetzt werden konnten, die für gestohlenen Schmuck bekannt waren. Falls man bei einem Raubüberfall die Täter nicht in flagranti erwischte, würden die Ermittlungen sich notgedrungen mit den zeitraubenden und ausgedehnten Niederungen des illegalen Warenverkehrs beschäftigen müssen.
Und leider führte meistens kein Weg daran vorbei.
Es sei denn …
Hier stimmte etwas nicht. Wieso würde er diese Steine zurücklassen? Was konnte denn wichtiger sein?
Sachs ging in die Hocke – sehr vorsichtig, denn ihr arthritisches Knie machte ihr an feuchten Tagen wie diesem bisweilen zu schaffen – und nahm sich den Inhalt des Safes etwas gründlicher vor. Manche der Umschläge enthielten nur einen einzigen Diamanten, andere enthielten Dutzende. Die Steine kamen Amelia wie die perfekte Beute vor. Doch was wusste sie schon? Schmuck interessierte sie nicht, abgesehen von ihrem Verlobungsring mit dem blauen Diamanten und – am selben Finger – dem schmalen Goldring, die derzeit beide unter dem lilafarbenen Latexhandschuh versteckt waren.
Der Wert der Steine in diesem Tresor musste mehrere Hunderttausend Dollar betragen.
Man brauchte bloß zuzugreifen.
Aber das hatte er nicht getan.
Sie stand auf und spürte einen Schweißtropfen an der Schläfe. Draußen war es kalt, aber die Heizungen des alten Gebäudes liefen auf Hochtouren, und die Wärme staute sich unter dem weißen Tyvek-Overall. Früher hatte man bei Tatortuntersuchungen nur Handschuhe und allenfalls noch Füßlinge übergestreift. Die heute weltweit übliche Schutzkleidung existierte aus zwei Gründen: einerseits wegen potenziell gefährlicher Substanzen am Tatort und andererseits wegen der Strafverteidiger. Das Risiko, ohne Overall eine Spur zu verunreinigen, war zwar sehr gering, doch ein findiger Anwalt konnte eine Anklage schon dadurch vollständig zu Fall bringen, dass er bei den Geschworenen den Hauch eines entsprechenden Zweifels säte.
Okay, wenn nicht der Safe, was dann?
Während die Mitarbeiter der Gerichtsmedizin die Toten abholten – zuerst das Paar, dann Patel –, schaute Sachs sich ein weiteres Mal in allen drei Räumen um.
War dies womöglich gar kein Raubüberfall, sondern ein Mordanschlag? Hatte Patel sich Geld bei einem Kredithai geliehen und es dann nicht zurückgezahlt? Das klang wenig plausibel – er besaß eine gut laufende Firma und schien kaum darauf angewiesen zu sein, ein Darlehen bei einem der örtlichen Wucherer aufzunehmen, die dafür dreißig Prozent Zinsen verlangten, und zwar im Monat.
Vielleicht ein Beziehungsdrama? Patel war verwitwet, wusste sie. Aber der rundliche, ungepflegte Mann mittleren Alters sah so gar nicht wie der Kandidat für eine heiße, riskante Affäre aus. Und falls es bloß darum ging, ihn zu töten, wozu die Folter? Und weshalb hier im Laden? Warum hatte man ihn nicht einfach erschossen – zu Hause oder auf offener Straße?
Ihr Blick fiel auf die Werkstatt. Hatte Patel oder ein Angestellter an einem besonders kostbaren Diamanten oder Schmuckstück gearbeitet?
Sachs ging hinein. Hier schien heute niemand gearbeitet zu haben; alle Werkzeuge und Hilfsmittel waren ordentlich in ihren Regalen und Gestellen verstaut. An einem der Plätze lag allerdings einer jener gefalteten Papierumschläge für Diamanten. Er glich denen im Tresor, war aber leer. Jemand hatte darauf notiert: GC-1,GC-2,GC-3 und GC-4. Die Bezeichnungen der Diamanten, die der Umschlag enthalten hatte, vermutete Sachs, da jeweils ein Karatgewicht danebenstand (die Angaben reichten von fünf bis siebeneinhalb). Außerdem waren dort Buchstaben vermerkt. Neben drei der Steine stand D,IF und hinter dem letzten, kleineren D, F. Eventuell eine Qualitätseinstufung. Auf dem Blatt stand ferner: Grace-Cabot Mining Ltd., Kapstadt, Südafrika und dann noch die Telefonnummer der Firma.
»Hm«, machte Sachs, als ihr eine Notiz am unteren Rand auffiel. Es war der Wert der einzelnen Steine, insgesamt achtundsechzig Millionen ZAR. Sie nahm ihr Smartphone und konsultierte Google. Der Währungscode stand, wenig überraschend, für den Südafrikanischen Rand.
Durchaus überraschend war hingegen das Ergebnis der Umrechnung: Der Betrag entsprach etwa fünf Millionen US-Dollar.
Amelia Sachs hatte somit eine ziemlich wahrscheinliche Antwort auf Frage Nummer eins gefunden.
5
Um sich zu vergewissern, dass diese besonders kostspieligen Diamanten tatsächlich gestohlen worden waren, kehrte Amelia zum Safe zurück und nahm sich jeden einzelnen der vielen Hundert kleinen Umschläge vor.
Auf keinem standen die Buchstaben GC oder der Name der Firma. Ein Anruf bei Grace-Cabot würde nichts über ihren Verbleib ergeben, sondern nur, dass Patel im Besitz der Steine gewesen war, aber man durfte wohl annehmen, dass der Täter sie mitgenommen hatte.
Hatte er vorher von ihnen gewusst? Oder hatte er Patels Firma zufällig ausgewählt und ihn gezwungen, ihm die wertvollsten Diamanten zu überlassen?
Das war zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation.
Sachs fotografierte den Grace-Cabot-Umschlag samt seiner Beschriftung und tütete ihn dann ein.
Nun zu Frage Nummer zwei: die Folter.
Sachs war nicht Sellittos Ansicht, dass Patel sich geweigert haben könnte, die Kombination des Tresors oder das Versteck von wertvollen Diamanten wie den Grace-Cabot-Steinen preiszugeben. Die Diamanten waren letztlich nur eine Ware. Patel hätte im Angesicht des Todes oder auch schon bei der Androhung von Folter nicht gezögert, seinen Bestand auszuhändigen. Es würde ohnehin alles versichert sein. Und es war weder das Leben noch eine Sekunde Schmerzen wert.
Nein, es war dem Täter um etwas anderes gegangen. Worum?
Um eine Antwort zu finden, tat Amelia Sachs nun etwas, zu dem sie sich an den Schauplätzen von Verbrechen häufig gezwungen sah, so qualvoll die Prozedur auch sein mochte. Sie versetzte sich mental und emotional an die Stelle des Täters, war plötzlich kein Cop und keine Frau mehr, sondern der Mann, der dieses Blutbad angerichtet hatte.
Und fragte sich: Wieso muss ich ihm Schmerzen zufügen?
Muss ist das Zauberwort. Ich fühle einen Drang, eine Verzweiflung.
Wieso muss ich ihm Schmerzen zufügen und ihn zum Reden bringen?
Sie spürte ein Kribbeln im Gesicht und im Nacken. Das lag nicht an der Hitze und der stickigen Luft, die ihr zu schaffen gemacht hatten. Und auch nicht am Entsetzen über die Rolle, die sie hier gerade nachspielte. Nein, die Symptome stammten von der Anspannung, unter der er stand.
Etwas stimmt nicht. Ich muss es in Ordnung bringen. Was, was, was?
Geh in der Zeit zurück, denk nach, überleg, stell dir vor …
Es ist kurz nach Mittag. Ich betrete den Raum. Ja, ich gehe rein, und zwar unmittelbar hinter dem Paar, William und Anna. Die beiden Verliebten sind mein Türöffner, und sie müssen sterben, weil sie mein Gesicht gesehen haben. Beim Gedanken an ihren Tod empfinde ich Erleichterung. Ein Risiko zu eliminieren hat etwas Tröstliches.
Als sie hineingehen, folge ich ihnen.
Ich kann sie nicht beide mit dem Messer in Schach halten. Nein, ich ziehe die Pistole. Aber ich würde nur ungern schießen, wegen des Lärms.
Dennoch, falls nötig, werde ich abdrücken, und die anderen wissen das.
William und Anna und Patel rühren sich nicht.
Sie beruhigen sich ein wenig.
Auch ich werde ruhiger.
Ich kontrolliere die Situation.
Gut. Ich fühle mich gut.
Ich schlage Patel – vermutlich mit der Waffe, um ihn außer Gefecht zu setzen. Das Paar wird gefesselt. Sie weinen, alle beide. Drängen sich aneinander, um die Nähe des anderen zu spüren. Denn sie wissen, was nun kommt.
Das alles kümmert mich nicht, kein Stück.
Dieser Gedanke brachte Amelia zu sich selbst zurück. Ihr Atem beschleunigte sich, sie biss die Zähne zusammen, und der Magen tat ihr weh. Ihr Zeigefinger grub sich in die Nagelhaut des Daumens. Es schmerzte, trotz des Handschuhs. Sie schob es beiseite.
Zurück. Versetz dich wieder an seine Stelle.
Und das tat sie.
Ich gehe in die Hocke, packe den Mann bei den Haaren und schlitze ihm die Kehle auf.
Dann folgt die Frau.
Ich höre Patel wimmern. Aber ich achte nicht auf ihn, sondern schaue dabei zu, wie das Paar zuckend verblutet. Erledigt. Ein Punkt abgehakt. So sehe ich das. Als Aufgabe. Fertig? Gut. Haken dran. Mehr sind diese Tode nicht. Haken auf einer Liste.
Ich wende mich Patel zu. Er liegt am Boden, stellt keine Gefahr dar. Und er hat schreckliche Angst. Ich frage ihn nach den wertvollsten Steinen, die er hat.
Er verrät es mir. Er nennt mir die Kombination des Tresors, und ich hole mir die Grace-Cabot-Diamanten. Doch das ist noch nicht alles. O nein. Ganz im Gegenteil. Ich will noch etwas, und dieses Etwas gibt er nicht so einfach preis.
Aber was?
Ich bücke mich und schneide diesmal anders als zuvor. Ich will ihm Schmerzen zufügen, ihn bluten lassen, damit er redet. Das ist befriedigend. Und noch ein Schnitt. Noch mal. Ins Gesicht, die Ohren und die Finger.
Dann endlich erzählt er es mir.
Ich atme erleichtert tief durch. Das Messer fährt in seine Kehle. Drei schnelle Schnitte.
Es ist vorbei.
Was hat Patel mir anvertraut?
Was hat er mir gegeben?
Worauf habe ich es so sehr abgesehen? Was muss ich unbedingt finden?
Ich habe meine Beute, fünf Millionen in Diamanten. Warum gehe ich nicht einfach?
Dann begriff Amelia.
Ich will mich schützen. Ich muss unter allen Umständen für meine Sicherheit sorgen. Dafür würde ich auch jemanden foltern. Um die Identität einer Person zu erfahren, die mir gefährlich werden könnte. Ich besprühe eine Überwachungskamera mit Farbe, ich stehle die Festplatte der anderen Kamera, die ich nicht vorher unschädlich machen kann. Ich töte zwei unschuldige Zeugen, weil sie zufällig mein Gesicht gesehen haben …
Ich muss sicherstellen, dass niemand mit der Polizei redet.
Da war dieser Mann, der plötzlich hereingeplatzt ist und den ich angeschossen habe. Der dann den Notruf gewählt hat, um den Überfall zu melden. Würde ich Patel foltern, um seinen Namen herauszubekommen? Der Unbekannte hat nicht viel gesehen. Nur mich mit einer Skimaske, hat er der Polizei am Telefon gesagt. Und wahrscheinlich war Patel zu dem Zeitpunkt schon tot. Der Kerl stellt keine Bedrohung dar. Nein, ich habe den Diamantenschleifer gequält, um den Namen einer anderen Person in Erfahrung zu bringen, die mein Gesicht gesehen haben könnte.
Ja, das wäre Grund genug, ihn zu foltern.
Sachs verließ die Rolle, senkte den Kopf und lehnte sich keuchend gegen die Wand. Schweiß lief ihr über das Gesicht. Als sie sich halbwegs gefangen hatte, ging sie hinaus auf den Korridor und sah die gesicherten Spuren durch. Sie fand Patels Terminkalender und schlug ihn auf. Für den heutigen Tag war um 11.00 Uhr ein gewisser »S« eingetragen. Um 11.45 Uhr dann »W und A« – William und Anna, das ermordete Paar. Am Rand, ohne konkrete Zeitangabe, stand »VL«. VL dürfte die Antwort auf Frage Nummer drei sein – der anonyme Anrufer. Nun ja, zumindest eine Teilantwort, denn Initialen bedeuteten noch keine Identifikation.