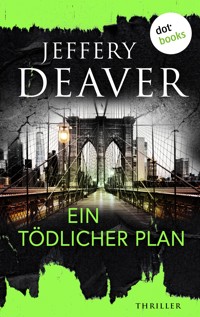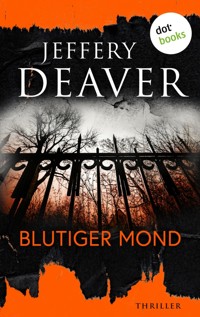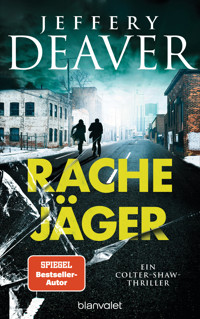10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Colter Shaw
- Sprache: Deutsch
»Du wurdest ausgesetzt. Flieh, wenn du kannst. Oder stirb mit Würde.« – Auftakt der spektakulären neuen Thriller-Reihe von SPIEGEL-Bestsellerautor Jeffery Deaver.
Colter Shaw ist hart, er ist kompromisslos und die letzte Rettung für die Menschen, denen die Polizei nicht helfen kann oder will … Er ist ein hervorragender Spurenleser und verdient seinen Lebensunterhalt damit, für Privatpersonen vermisste Personen aufzuspüren. Als er von einer verschwundenen Collegestudentin hört, bietet er dem verzweifelten Vater seine Hilfe an. Shaws Ermittlungen führen ihn in das dunkle Herz von Silicon Valley und die knallharte, milliardendollarschwere Videospielindustrie. Es gelingt ihm, die junge Frau zu finden und nach Hause zu bringen. Doch dann gibt es eine zweite Entführung und alles deutet darauf hin, dass es sich um denselben Täter handelt. Nur dieses Mal kann Shaw das Opfer nicht lebend retten. Alle Hinweise führen zu einem Videospiel, in dem der Spieler mithilfe von fünf verschiedenen Gegenständen versuchen muss zu überleben. Shaw ist überzeugt, dass der Täter versucht, das Spiel zum Leben zu erwecken. Er muss ihn stoppen, denn der Todesspieler hat gerade erst angefangen …
Alle Fälle von Colter Shaw:
Der Todesspieler (Bd. 1)
Der böse Hirte (Bd. 2)
Vatermörder (Bd. 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Colter Shaw ist hart, er ist kompromisslos und die letzte Rettung für die Menschen, denen die Polizei nicht helfen kann oder will … Er ist ein hervorragender Spurenleser und verdient seinen Lebensunterhalt damit, für Privatpersonen vermisste Personen aufzuspüren. Als er von einer verschwundenen Collegestudentin hört, bietet er dem verzweifelten Vater seine Hilfe an. Shaws Ermittlungen führen ihn in das dunkle Herz von Silicon Valley und die knallharte, milliardendollarschwere Videospielindustrie. Es gelingt ihm, die junge Frau zu finden und nach Hause zu bringen. Doch dann gibt es eine zweite Entführung, und alles deutet darauf hin, dass es sich um denselben Täter handelt. Nur dieses Mal kann Shaw das Opfer nicht lebend retten. Alle Hinweise führen zu einem Videospiel, in dem der Spieler mit Hilfe von fünf verschiedenen Gegenständen versuchen muss zu überleben. Shaw ist überzeugt, dass der Täter versucht, das Spiel zum Leben zu erwecken. Er muss ihn stoppen, denn der Todesspieler hat gerade erst angefangen …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.Weitere Informationen unter: www.jeffery-deaver.deVon Jeffery Deaver bereits erschienen Der Knochenjäger · Letzter Tanz · Der Insektensammler · Das Gesicht des Drachen · Der faule Henker · Das Teufelsspiel · Der gehetzte Uhrmacher · Der Täuscher · Opferlämmer · Todeszimmer · Der Giftzeichner · Der talentierte Mörder · Der Komponist · Der TodbringerBesuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
JEFFERY DEAVER
DER TODESSPIELER
Thriller
Deutsch von Thomas Haufschild
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Never Game« bei G. P. Putnam’s Son, an imprint of Penguin Radom House LLC, New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2019 by Jeffery Deaver and Gunner Publications, LLC
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Rainer Schöttle
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: © Paul Sheen/ Trevillion Images; www.buerosued.de
JaB · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26663-9V002www.blanvalet.de
Für M und P
Videospielsucht zeichnet sich durch ein Verhalten aus, bei dem die Kontrolle über das Spiel verloren geht und ihm immer mehr Vorrang vor anderen Aktivitäten eingeräumt wird, bis es schließlich andere Interessen und alltägliche Verrichtungen vollständig überlagert und trotz negativer Folgen fortgesetzt oder sogar noch ausgeweitet wird.
Die WeltgesundheitsorganisationVideospiele sind schlecht für dich? Das hat man von Rock ’n’ Roll auch mal behauptet.
Shigeru Miyamoto, Spieleentwickler bei Nintendo
LEVEL 3: DAS SINKENDE SCHIFF
Sonntag, 9. Juni
Colter Shaw rannte auf das Ufer zu und ließ das Boot dabei nicht aus den Augen.
Der zwölf Meter lange, heruntergekommene Fischkutter, mehrere Jahrzehnte alt, versank mit dem Heck voran und war bereits zu drei Vierteln untergetaucht.
Shaw sah keine Türen, die in die Kabine führten; es gab vermutlich nur eine, und die war nun unter Wasser. Im achtern gelegenen Teil der Aufbauten, der noch über die Oberfläche ragte, gab es ein Fenster, das in Richtung Bug wies. Es war groß genug, um hindurchzuklettern, aber es ließ sich offenbar nicht öffnen. Er würde also zu der Tür tauchen.
Er blieb stehen. War das überhaupt nötig?, fragte er sich.
Shaw hielt nach dem Seil Ausschau, mit dem das Boot am Anleger vertäut war; vielleicht konnte er mit etwas Kraftaufwand das Schlimmste verhindern.
Doch da war kein Seil; das Boot lag vor Anker, was bedeutete, dass es ungehindert die neun Meter auf den Grund des Pazifischen Ozeans hinabsinken konnte.
Und falls die Frau sich im Innern befand, würde es sie in ein kaltes, düsteres Grab mitnehmen.
Er lief auf den rutschigen Steg und mied dabei die morschesten Stellen. Dann streifte er sein blutbeflecktes Hemd, die Schuhe und die Socken ab.
Eine kräftige Dünung erfasste das Boot. Es erzitterte und versank zehn oder zwanzig weitere Zentimeter im grauen, teilnahmslosen Wasser.
»Elizabeth?«, rief er.
Keine Reaktion.
Shaw überlegte: Mit sechzig Prozent Wahrscheinlichkeit war sie an Bord. Mit fünfzig Prozent Wahrscheinlichkeit war sie nach einigen Stunden in der gefluteten Kabine noch am Leben.
Aber wie hoch oder niedrig die Wahrscheinlichkeit auch sein mochte, der nächste Schritt stand ohnehin fest. Er hielt einen Arm ins Wasser und schätzte die Temperatur auf vier oder fünf Grad. Ihm blieben etwa dreißig Minuten, bis er durch die Unterkühlung das Bewusstsein verlieren würde.
Eine halbe Stunde ab … jetzt, dachte er.
Und sprang hinein.
Ein Ozean besteht nicht aus Flüssigkeit, sondern eher aus verflüssigtem Gestein. Er kann zerschmettern.
Und ist heimtückisch.
Shaw hatte vor, die Tür zur Kabine aufzustemmen und dann mit Elizabeth Chabelle herauszuschwimmen. Das Wasser hatte eine andere Idee. Sowie er die Oberfläche durchbrochen hatte, um Luft zu holen, wurde er auf einen der Eichenpfähle des Stegs zugeschleudert, an dem irgendein filigraner Bewuchs aus zarten grünen Fasern klebte. Shaw riss eine Hand hoch, um sich zu schützen, rutschte aber von der schleimigen Schicht ab und schlug mit dem Kopf gegen das Holz. Vor seinen Augen explodierte ein gelbes Feuerwerk.
Die nächste Welle hob ihn an und schob ihn erneut auf den Steg zu. Diesmal konnte er gerade noch einem rostigen Nagel ausweichen. Anstatt gegen die Strömung anzukämpfen, um das ungefähr zweieinhalb Meter entfernte Boot zu erreichen, wartete er ab, bis der Rückstrom ihn von selbst ans Ziel tragen würde. Eine Woge packte ihn, und seine Schulter machte schmerzhafte Bekanntschaft mit dem Nagel. Autsch, das würde bluten.
Gibt es hier Haie?
Mach dich nicht verrückt …
Das Wasser strömte zurück. Shaw ließ sich mittreiben, hob den Kopf, füllte seine Lunge und tauchte mit kräftigen Schwimmstößen nach der Tür. Das salzige Wasser brannte in seinen Augen, aber er behielt sie weit offen; die Sonne stand schon tief, und es war dunkel hier. Dann erblickte er, wonach er suchte, packte den metallenen Türknauf und drehte ihn. Der Knauf bewegte sich hin und her, doch die Tür blieb geschlossen.
Zurück nach oben, mehr Luft. Dann wieder runter. Er hielt sich mit der linken Hand am Türknauf fest und tastete mit der Rechten nach weiteren Schlössern oder Sicherungsvorrichtungen.
Der anfängliche Schock und Schmerz, den das eiskalte Wasser ihm verpasst hatte, war abgeklungen, aber er zitterte stark.
Ashton Shaw hatte seinen Kindern beigebracht, wie man im kalten Wasser überlebte – am besten in einem Trockenanzug. Oder notfalls in einem Neoprenanzug. Mit zwei Mützen – am Kopf ist der Wärmeverlust am stärksten, auch wenn man so dichte blonde Locken hatte wie Shaw. Die Extremitäten kann man ignorieren; man verliert durch die Finger oder Zehen keine Wärme. Ohne Schutzkleidung besteht die einzige Lösung darin, so schnell wie irgend möglich aus dem Wasser zu kommen, bevor die Unterkühlung dich verwirrt, betäubt und tötet.
Ihm blieben noch fünfundzwanzig Minuten.
Ein weiterer Versuch, die Tür zur Kabine zu öffnen. Ein weiterer Fehlschlag.
Er dachte an die Frontscheibe oberhalb des Vorderdecks. Es war der einzige Ausweg.
Shaw schwamm auf das Ufer zu und tauchte. Er fand einen Stein, der groß genug war, um Glas zu zertrümmern, aber nicht so schwer, dass er ihn nach unten ziehen würde.
Mit kräftigen, rhythmischen Schwimmstößen im Einklang mit den Wellen kehrte er zu dem Boot zurück. Es hieß Seas the Day, sah er.
Shaw schaffte es, die fünfundvierzig Grad Steigung zu bewältigen und sich auf die nach oben weisende Vorderseite der Kabine zu setzen. Neben ihm befand sich das schmutzige, einhundertzwanzig mal neunzig Zentimeter große Fenster.
Er spähte hinein, konnte aber keine Spur von der zweiunddreißigjährigen Brünetten entdecken. Der vordere Teil der Kabine war leer. In der Mitte des Raumes gab es eine Trennwand mit einer Tür, die in Kopfhöhe ein Fenster besaß, dessen Scheibe fehlte. Falls die Frau hier war, dann auf der anderen Seite – die mittlerweile zum größten Teil mit Wasser gefüllt sein musste.
Er hob den Stein und schlug mit der scharfen Kante gegen das Glas, wieder und wieder.
Und er stellte fest, dass der Erbauer des Boots die Frontscheibe gegen Wind, Wellen und Hagel verstärkt hatte. Der Stein hinterließ nicht mal eine Schramme.
Dann stellte Colter Shaw noch etwas fest.
Elizabeth Chabelle war tatsächlich noch am Leben.
Sie hatte die Schläge gehört, und ihr blasses, hübsches Gesicht, umrahmt von strähnigem braunem Haar, erschien in dem Türfenster zwischen den beiden Hälften der Kabine.
»Helfen Sie mir!«, schrie Chabelle so laut, dass Shaw es durch das dicke Glas deutlich hören konnte.
»Elizabeth!«, rief er. »Hilfe ist unterwegs. Bleiben Sie aus dem Wasser.«
Er wusste, dass die versprochene Hilfe unmöglich hier eintreffen konnte, bevor das Boot vollständig gesunken war. Er war ihre einzige Hoffnung.
Jemand anders hätte sich vielleicht durch die Öffnung des Türfensters zwängen und in den vorderen, trockeneren Teil der Kabine klettern können.
Aber nicht Elizabeth Chabelle.
Ihr Kidnapper hatte, ob nun absichtlich oder zufällig, eine Frau entführt, die im achten Monat schwanger war; sie passte auf keinen Fall durch die Öffnung.
Chabelle verschwand, um sich einen Platz irgendwo außerhalb des eiskalten Wassers zu suchen, und Colter Shaw hob den Stein, um abermals auf die Frontscheibe einzuhämmern.
LEVEL 1: DIE VERLASSENE FABRIK
Freitag, 7. Juni Zwei Tage zuvor
1
Er bat die Frau, das noch mal zu wiederholen.
»Dieses Ding, das die werfen«, sagte sie. »Mit dem brennenden Lappen drin.«
»Das die werfen?«
»Bei Aufständen oder so. Eine Flasche. Man sieht das oft im Fernsehen.«
»Einen Molotowcocktail«, sagte Colter Shaw.
»Ja, ja«, bestätigte Carole. »Ich glaube, er hatte einen.«
»Hat er denn gebrannt? Der Lappen?«
»Nein. Aber Sie wissen schon …«
Carole hatte eine Reibeisenstimme, obwohl sie, zumindest derzeit, keine Raucherin war, soweit Shaw das sehen oder riechen konnte. Sie trug ein grünes Kleid aus weichem Stoff. Ihre Miene schien von Natur aus besorgt zu sein, heute Morgen jedoch etwas mehr als sonst üblich. »Er war da drüben.« Sie streckte den Finger aus.
Der Oak View Wohnmobilpark, einer der ungepflegteren Plätze, auf denen Shaw gewohnt hatte, war von Bäumen umgeben, hauptsächlich Busch-Eichen und Kiefern, manche tot, alle trocken. Und dicht an dicht. »Da drüben« war schwer zu erkennen.
»Haben Sie die Polizei gerufen?«
Eine Pause. »Nein, denn wenn es kein … Wie hieß das noch mal?«
»Molotowcocktail.«
»Falls er doch keinen gehabt hätte, wäre das peinlich gewesen. Und ich hole die Cops schon oft genug wegen irgendwas her.«
Shaw kannte Dutzende Eigentümer von Wohnmobilparks im ganzen Land. Meistens handelte es sich um Ehepaare mittleren Alters, die sich besonders für diese Branche zu eignen schienen. Falls es nur eine Person war, wie zum Beispiel Carole, dann für gewöhnlich eine Frau, und zwar eine verwitwete. Die neigten dazu, bei Streitereien auf dem Platz häufiger den Notruf zu wählen als ihre verstorbenen Männer, die zumeist eine Waffe getragen hatten.
»Aber andererseits, ein Feuer?«, fuhr sie fort. »Hier? Sie wissen schon.«
Kalifornien war ein Pulverfass, wie jeder wusste, der die Nachrichten verfolgte. Man dachte in erster Linie an Naturschutzgebiete, Vororte und Agrarflächen, aber auch Städte waren nicht gegen Feuersbrünste gefeit. Shaw glaubte sich zu erinnern, dass einer der schlimmsten Buschbrände in der Geschichte des Staates sich in Oakland ereignet hatte, hier ganz in der Nähe.
»Manchmal, wenn ich jemanden rauswerfen muss, dann droht er mir, er würde zurückkommen und es mir heimzahlen. Sogar wenn ich ihn vorher dabei erwischt habe, dass er vierzig Ampere abgezweigt, aber nur für zwanzig bezahlt hat.« Sie klang regelrecht erstaunt. »Manche Leute. Also wirklich!«
»Und ich soll jetzt …?«, fragte er.
»Ich weiß auch nicht, Mr. Shaw. Einfach mal nachsehen. Könnten Sie das tun? Bitte.«
Shaw kniff die Augen zusammen und nahm zwischen den Bäumen eine Bewegung wahr, die eventuell nicht von der Brise stammte. Eine langsame Person? Und falls ja, bedeutete die reduzierte Geschwindigkeit dann, dass sie sich vorsichtig näherte, weil sie etwas im Schilde führte?
Carole sah Shaw auf eine ganz bestimmte Weise an. Das geschah relativ häufig. Er war Zivilist und behauptete auch nie etwas anderes. Aber er wirkte wie ein Cop.
Shaw schlug einen Bogen zum vorderen Teil des Parks, zunächst auf dem rissigen, unebenen Gehweg, dann auf der grasbewachsenen Böschung der wenig belebten Straße in dieser wenig belebten Ecke der Stadt.
Ja, da war ein Mann mit dunkler Jacke, blauer Jeans und schwarzer Wollmütze, ungefähr zwanzig Meter vor ihm. Er trug Stiefel, die bei einem Marsch durchs Gestrüpp hilfreich sein würden – oder beim Kampf mit einem Gegner. Und ja, er war entweder mit einem Brandsatz bewaffnet oder er hielt eine Bierflasche und eine Serviette gleichzeitig in der Hand. Anderswo mochte es zu früh für ein Bier sein, aber nicht in diesem Teil von Oakland.
Shaw schlich sich von der Böschung in das Unterholz zu seiner Rechten und beschleunigte seinen Schritt, allerdings möglichst leise. Die Kiefernnadeln, die sich im Laufe der Zeit wie ein dichter Teppich über den Boden gelegt hatten, machten es ihm einfach.
Wer auch immer dies sein mochte, ob rachsüchtiger Mieter oder nicht, er befand sich weit von Caroles Hütte entfernt, also war sie im Moment nicht persönlich gefährdet. Doch das allein reichte Shaw noch nicht aus.
Irgendwas ging hier vor sich.
Der Kerl näherte sich nun dem Teil des Geländes, in dem neben vielen weiteren Wohnmobilen auch Shaws Winnebago stand.
Shaw interessierte sich mehr als nur oberflächlich für Molotowcocktails. Vor einigen Jahren hatte er nach einem Flüchtigen gesucht, der einen Ölschwindel in Oklahoma begangen hatte. Mitten in der Nacht war dann eine Benzinbombe durch die Windschutzscheibe seines Wohnmobils geflogen. Das Fahrzeug war binnen zwanzig Minuten bis auf die Felgen niedergebrannt, und nur ein paar Habseligkeiten hatten in letzter Sekunde gerettet werden können. Shaw konnte es immer noch förmlich riechen, wie die Luft rund um das metallene Gerippe gestunken hatte.
Die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass Shaw während seines Lebens, ganz zu schweigen innerhalb weniger Jahre, von zwei dieser russisch inspirierten Waffen attackiert wurde, musste ziemlich gering sein. Shaw siedelte sie bei fünf Prozent an. Noch niedriger wurde die Zahl, wenn man bedachte, dass er wegen einer Privatangelegenheit in die Gegend von Oakland und Berkeley gekommen war, und nicht, um einem flüchtigen Verbrecher das Leben zu ruinieren. Und obwohl Shaw tags zuvor gegen die Regeln verstoßen hatte, hätte ihm dafür eine Standpauke gedroht, eine Auseinandersetzung mit einem bulligen Wachmann oder schlimmstenfalls die Polizei. Kein Brandsatz.
Shaw war nun nur noch zehn Meter hinter dem Mann, der irgendetwas zu suchen schien – sein Blick schweifte nicht nur über das Gelände des Wohnmobilparks, sondern auch die Straße hinauf und hinunter und über einige verlassene Gebäude auf der anderen Straßenseite.
Der Mann war gepflegt, weiß und glatt rasiert. Etwa eins dreiundsiebzig, schätzte Shaw. Mit pockennarbigem Gesicht. Das braune Haar unter der Mütze schien kurz geschnitten zu sein. Sein Aussehen und seine Bewegungen ließen unwillkürlich an ein Nagetier denken. Und angesichts seiner Körperhaltung vermutete Shaw einen ehemaligen Soldaten. Shaw selbst war keiner, hatte aber Freunde und Bekannte mit militärischer Vorgeschichte und einen Teil seiner Jugend mit quasimilitärischem Training verbracht. Dazu hatte auch gehört, dass er regelmäßig zu Einzelheiten des Überlebenshandbuchs FM 21-76 der U. S. Army abgefragt worden war.
Der Mann hielt tatsächlich einen Molotowcocktail in der Hand. Die Serviette war in den Hals der Flasche gestopft, und Shaw konnte Benzin riechen.
Shaw wusste mit Revolvern umzugehen, mit halbautomatischen Pistolen, halbautomatischen Gewehren, Repetiergewehren, Schrotflinten, Pfeil und Bogen und Steinschleudern. Und was Klingen anging, war er auch nicht abgeneigt. Er zog nun die Waffe aus der Tasche, die er am häufigsten benutzte: sein Mobiltelefon, gegenwärtig ein iPhone. Er wählte eine Nummer, und als die Notrufzentrale von Polizei und Feuerwehr sich meldete, gab er flüsternd seinen Standort durch und beschrieb, was er vor sich sah. Dann trennte er die Verbindung. Er tippte noch einige weitere Dinge ein und schob das Telefon in die Brusttasche seines dunkel karierten Sakkos. Bekümmert dachte er an den Regelverstoß vom Vortag und fragte sich, ob der Anruf den Behörden wohl irgendwie gestatten würde, ihn zu identifizieren und festzunehmen. Er bezweifelte es.
Shaw hatte beschlossen, auf das Eintreffen der Fachleute zu warten. Bis zu dem Augenblick, in dem der Mann plötzlich ein Feuerzeug in der Hand hielt, aber keine Zigarette.
Das änderte alles.
Shaw trat aus den Büschen vor und kam näher. »Guten Morgen.«
Der Mann fuhr herum und duckte sich. Shaw bemerkte, dass er nicht an den Gürtel oder unter die Jacke griff. Vielleicht wollte er den Brandsatz nicht fallen lassen – oder er trug keine Schusswaffe. Oder er war ein Profi und wusste genau, wo seine Waffe war und wie viele Sekunden es dauern würde, zu ziehen, zu zielen und abzudrücken.
Schmale Augen in einem schmalen Gesicht suchten Shaw erst nach Waffen und dann nach anderen Bedrohungen ab. Der Fremde musterte die schwarze Jeans, die schwarzen Ecco-Schuhe, das grau gestreifte Hemd und das Sakko. Das kurze, eng anliegende blonde Haar. Mr. Nagetier hatte im ersten Moment bestimmt »Cop« gedacht, doch die Gelegenheit, eine Dienstmarke vorzuzeigen und mit amtlicher Stimme nach einem Ausweis oder Ähnlichem zu fragen, war gekommen und verstrichen. Also hatte er gefolgert, dass Shaw ein Zivilist war. Wenngleich einer, den man nicht unterschätzen durfte. Shaw wog bei einem Meter zweiundachtzig knapp über achtzig Kilo und war breitschultrig, mit sehnigen Muskeln, einer kleinen Narbe auf der Wange und einer größeren am Hals. Er ging zwar nicht joggen, aber zum Felsklettern und hatte im College zu den besten Ringern gezählt. Er war in erstklassiger Form und hielt dem Blick von Mr. Nagetier stand, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Oh, hallo.« Eine Tenorstimme, angespannt wie ein Drahtseil. Aus dem Mittleren Westen, vielleicht Minnesota.
Shaw sah hinunter auf die Flasche.
»Wissen Sie, das ist Pisse, kein Benzin.« Das Lächeln des Mannes war so straff wie seine Stimmlage. Und er log.
Würde das hier mit einem Kampf enden? Das war das Letzte, was Shaw wollte. Er hatte seit Langem nicht mehr zugeschlagen. Er mochte es nicht. Noch weniger mochte er, selbst geschlagen zu werden.
»Was soll das?«, fragte Shaw und wies auf die Flasche in der Hand des Mannes.
»Wer sind Sie?«
»Ein Tourist.«
»Tourist.« Der Mann überlegte, sein Blick hob und senkte sich. »Ich wohne die Straße hinauf. Auf einem verlassenen Nachbargrundstück gibt es Ratten. Ich wollte sie ausräuchern.«
»In Kalifornien? Im trockensten Juni seit zehn Jahren?«
Das hatte Shaw sich gerade ausgedacht, aber wer wusste das schon?
Nicht, dass es eine Rolle gespielt hätte. Es gab weder das Nachbargrundstück noch gab es die Ratten, obwohl die Tatsache, dass der Mann diese Ausrede gewählt hatte, darauf hindeutete, dass er früher mal Ratten bei lebendigem Leib verbrannt haben könnte. Nun gesellte sich Abneigung zum Argwohn.
Lass ein Tier niemals leiden …
Dann schaute Shaw über die Schulter des Mannes – zu dem Ziel, das er angesteuert hatte. Ein leeres Grundstück, ja, aber daneben lag ein altes Gewerbegebäude. Nicht die frei erfundene Nachbarparzelle neben dem frei erfundenen Haus des Mannes.
Die Augen des Kerls verengten sich noch weiter, als Reaktion auf die Sirene des sich nähernden Polizeifahrzeugs.
»Wirklich?« Mr. Nagetier verzog das Gesicht, was heißen sollte: Du hast allen Ernstes die Bullen gerufen? Er murmelte auch noch etwas anderes.
»Legen Sie das Ding hin«, sagte Shaw. »Sofort.«
Das tat der Mann nicht. Er zündete in aller Seelenruhe den benzingetränkten Lappen an, der sofort in Flammen aufging, fixierte Shaw wie ein Werfer den Schlagmann und schleuderte die Flasche auf ihn.
2
Molotowcocktails explodieren nicht – in der verschlossenen Flasche ist zu wenig Sauerstoff. Der brennende Lappen entzündet das sich ausbreitende Benzin, wenn das Glas zerbricht.
So wie in diesem Fall, wirkungsvoll und angemessen spektakulär.
Ein lautloser Feuerball erhob sich knapp anderthalb Meter in die Luft.
Shaw wich rechtzeitig aus, und Carole rannte schreiend zu ihrer Hütte. Er zog in Erwägung, den Mann zu verfolgen, aber das Gras der Böschung brannte lichterloh, und der Halbmond aus Flammen näherte sich langsam einigen hohen Sträuchern. Shaw schwang sich über den Maschendrahtzaun, lief zu seinem Wohnmobil und nahm einen der Feuerlöscher. Dann eilte er zurück, zog den Splint und hüllte die Flammen in eine weiße Chemikalienwolke, was sie erlöschen ließ.
»O mein Gott. Sind Sie in Ordnung, Mr. Shaw?« Carole trottete ebenfalls mit einem Feuerlöscher herbei, einem kleineren, einhändig zu bedienenden Exemplar. Das war eigentlich nicht mehr nötig, doch auch sie zog den Stift und legte los, weil so was natürlich immer Spaß macht. Vor allem, wenn das Feuer sowieso schon fast nicht mehr brennt.
Nach ein oder zwei Minuten bückte Shaw sich und tastete mit der Handfläche jeden Quadratzentimeter der verbrannten Stelle ab, wie er das vor vielen Jahren gelernt hatte.
Lass niemals ein erloschenes Lagerfeuer zurück, ohne die Asche abzuklopfen.
Ein zweckloser Blick in Richtung von Mr. Nagetier. Er war verschwunden.
Ein Streifenwagen hielt an. Oakland PD. Ein großer schwarzer Beamter mit schimmerndem, kahl rasiertem Kopf stieg aus und hatte auch einen Feuerlöscher in der Hand. Seiner war der kleinste der drei. Er betrachtete den Brandort und verstaute den roten Behälter wieder unter dem Beifahrersitz.
Officer L. Addison, jedenfalls laut seinem Namensschild, wandte sich an Shaw. Dieser eins fünfundneunzig große Cop erhielt bestimmt so manches Geständnis, indem er einfach nur zu dem Verdächtigen ging und sich über ihn beugte.
»Haben Sie uns verständigt?«, fragte Addison.
»Ja.« Shaw erklärte, der Mann, der den Brandsatz geworfen habe, sei gerade erst geflohen. »Da entlang.« Er deutete die Straße voller Unkraut hinunter, an der alle paar Schritte irgendwelcher Müll lag.
Der Cop fragte, was geschehen sei.
Shaw schilderte es ihm. Carole ergänzte die Aussage und fügte unaufgefordert hinzu, wie schwierig es sei, als Witwe ganz allein ein Geschäft zu betreiben. »Die Leute wollen dich ausnutzen. Ich wehre mich dagegen. Ich muss. Würden Sie auch. Manchmal drohen sie einem.« Shaw bemerkte, dass sie einen Blick auf Addisons linke Hand warf, an der kein Ring steckte.
Addison neigte den Kopf zu dem Funkgerät an seiner Schulter und fasste den Sachverhalt für die Zentrale zusammen, einschließlich der Personenbeschreibung, die Shaw ihm geliefert hatte. Sie war ziemlich detailliert ausgefallen, nur das mit dem Nagetier hatte er weggelassen, weil das ja weitgehend Ansichtssache war.
Addisons Blick richtete sich wieder auf Shaw. »Können Sie sich ausweisen?«
Shaw zögerte kurz. Jemand am Ort des gestrigen Regelverstoßes könnte sich das Nummernschild seines Motorrads gemerkt haben. Was wiederum dazu geführt haben könnte, dass sein Name nun im System war. Dann fiel ihm ein, dass die seinen Namen ohnehin schon kannten; er hatte für den Notruf sein privates Smartphone benutzt, kein Wegwerftelefon. Also reichte Shaw dem Cop seinen Führerschein.
Addison fotografierte das Dokument mit seinem Telefon und lud das Bild irgendwo hoch.
Shaw fiel auf, dass er das bei Carole nicht tat, obwohl ihr Wohnwagenpark von dem Vorfall zumindest am Rande betroffen war. Offenbar ein wenig Profiling, dachte Shaw: Er war fremd in der Stadt, sie eine Einheimische. Aber das behielt er für sich.
Addison schaute auf das Ergebnis. Dann nahm er Shaw genau in Augenschein.
Kam jetzt die Quittung für den Verstoß gestern? Shaw entschied sich, das Kind beim Namen zu nennen: Diebstahl. Es zu beschönigen, half ihm auch nicht weiter.
Anscheinend wollte der Arm des Gesetzes heute nicht nach ihm greifen. Addison gab ihm den Führerschein zurück. »Haben Sie den Mann wiedererkannt?«, fragte er Carole.
»Nein, Sir, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Es kommen sehr viele Leute her. Unsere Preise sind weit und breit die günstigsten.«
»Hat er die Flasche auf Sie geworfen, Mr. Shaw?«
»In meine Richtung. Als Ablenkungsmanöver, nicht als Angriff. Damit er fliehen konnte.«
Der Beamte hielt nachdenklich inne.
»Ich hab’s im Internet nachgesehen«, platzte es aus Carole heraus. »Molotow hat insgeheim für Putin gearbeitet.«
Beide Männer sahen sie fragend an. Dann fügte Shaw für Addison hinzu: »Und um die Beweise zu verbrennen. Fingerabdrücke und DNS auf dem Glas.«
Der Cop nickte nur. Sein Mangel an Körpersprache war dafür umso aussagekräftiger, wie bei vielen Polizisten. Er fragte sich gerade, wieso Shaw an solche forensischen Einzelheiten gedacht hatte.
»Falls er nicht hier war, um Ihnen Probleme zu bereiten, Ma’am, wohin wollte er dann Ihrer Meinung nach?«, fragte der Beamte.
»Dorthin«, sagte Shaw, bevor Carole antworten konnte. Er zeigte auf das leere Grundstück auf der anderen Straßenseite, das ihm zuvor schon aufgefallen war.
Sie gingen alle drei.
Der Wohnmobilpark lag in einem schäbigen Gewerbegebiet nahe der Route 24, wo Touristen einen Zwischenstopp einlegten, um von hier aus einen Ausflug zum steilen Grizzly Peak oder ins benachbarte Berkeley zu unternehmen. Das mit Unrat übersäte, zugewucherte Grundstück, das sie nun betraten, wurde durch einen alten, etwa zweieinhalb Meter hohen Holzzaun von der Parzelle dahinter getrennt. Einige ortsansässige Künstler hatten ihn als Leinwand für diverse ansehnliche Arbeiten benutzt: Porträts von Martin Luther King jr., Malcolm X und zwei anderen Männern, die Shaw nicht kannte. Als sie nun näher kamen, sah Shaw, dass unter den Bildern Namen standen: Bobby Seale und Huey P. Newton. Sie hatten zur Black-Panther-Bewegung gehört. Shaw erinnerte sich an kalte Abende seiner fernsehfreien Kindheit, wenn Ashton ihm und seinen Geschwistern etwas vorgelesen hatte, meistens amerikanische Geschichte. Viel davon über alternative Regierungsformen. Die Black Panthers waren dabei mehrmals aufgetaucht.
»Aha«, sagte Carole und verzog angewidert den Mund. »Ein Hassverbrechen. Schrecklich.« Sie wies auf die Gemälde. »Ich habe bei der Stadt angerufen und denen gesagt, man sollte die Bilder irgendwie erhalten. Die haben mich nie zurückgerufen.«
Addisons Funkgerät erwachte zum Leben. Shaw konnte die Meldung hören: Ein anderer Streifenwagen hatte die umliegenden Straßen überprüft und niemanden gesehen, auf den die Beschreibung des Brandstifters gepasst hätte.
»Ich hab ein Video«, sagte Shaw.
»Wirklich?«
»Nachdem ich den Notruf gewählt hatte, habe ich das Telefon in meine Tasche gesteckt.« Er berührte die Brusttasche auf der linken Seite des Sakkos. »Es hat die ganze Zeit aufgezeichnet.«
»Läuft es immer noch?«
»Ja.«
»Würden Sie das bitte abschalten?«, fragte Addison in einem Tonfall, der in Wahrheit besagte: Schalten Sie das ab. Ohne Fragezeichen.
Shaw tat es. Dann: »Ich schicke Ihnen ein Standbild des Kerls.«
»Okay.«
Shaw fertigte das Bild an, ließ sich die Nummer von Addisons Telefon geben und schickte die Datei ab. Sie standen nur einen Meter auseinander, aber die Reise der Elektronen führte womöglich um den halben Erdball, dachte Shaw.
Das Telefon des Beamten gab einen Ton von sich; der Mann warf nicht mal einen Blick auf das Bild. Er reichte erst Carole und dann Shaw seine Karte. Shaw besaß inzwischen einen ganzen Haufen Karten von Cops; er fand es lustig, dass Polizisten Visitenkarten hatten, als wären sie Werbefachleute oder Hedgefonds-Manager.
Nachdem Addison weggefahren war, fragte Carole: »Die Polizei wird nichts mehr unternehmen, oder?«
»Nein.«
»Nun ja, aber danke, dass Sie sich darum gekümmert haben, Mr. Shaw. Es wäre entsetzlich gewesen, wenn Sie Verbrennungen abbekommen hätten.«
»Keine Sorge.«
Carole kehrte zu ihrer Hütte zurück und Shaw zu seinem Winnebago. Er dachte über einen Aspekt der Begegnung nach, den er gegenüber Officer Addison nicht erwähnt hatte. Nach dem genervten »Wirklich?« als Reaktion auf die Sirene hatte Mr. Nagetier leise etwas hinzugefügt, das sich so anhörte wie: »Was soll der Scheiß?«
Es war aber auch möglich – mit mehr als fünfzig Prozent –, dass er gesagt hatte: »Was soll das, Shaw?«
Und falls das der Fall war, bedeutete es, dass Mr. Nagetier ihn kannte oder von ihm wusste.
Und das würde natürlich ein ganz neues Licht auf den Zwischenfall werfen.
3
Shaw hängte das Sakko im Winnebago an einen Haken und ging zu einem kleinen Schrank in der Küche. Er öffnete ihn und nahm zwei Dinge heraus. Zunächst mal seine kompakte Glock, Kaliber 380, die er hinter einer Reihe McCormick-Gewürze versteckt hielt. Die Waffe steckte in einem grauen Polymerholster von Blackhawk. Shaw klemmte es sich an den Hosenbund.
Der zweite Gegenstand war ein dicker Umschlag, 28 mal 36 Zentimeter groß, der in dem Fach unter dem Pistolenversteck hinter mehreren Gewürzsoßen stand. Worcestershire, Teriyaki und ein halbes Dutzend Essigsorten, von Heinz bis exotisch.
Shaw sah nach draußen.
Keine Spur von Mr. Nagetier. Wie erwartet. Trotzdem konnte es nicht schaden, hin und wieder eine Waffe zu tragen.
Er ging zum Herd, kochte Wasser und bereitete sich mit einem Ein-Tassen-Filter einen Keramikbecher Kaffee zu. Eine seiner Lieblingssorten. Daterra, aus Brasilien. Mit einem Spritzer Milch.
Er nahm auf der Sitzbank Platz und betrachtete den Umschlag, auf dem in perfekter Handschrift, sogar noch kleiner als die von Shaw, die Worte Benotete Arbeiten, 25.5. standen.
Die Klappe war nicht zugeklebt, sondern lediglich mit einer flexiblen Spreizklammer verschlossen, die er aufbog und dem Umschlag einen durch Gummibänder zusammengehaltenen Papierstoß von knapp vierhundert Seiten entnahm.
Er merkte, wie sein Herz beim Anblick des Stapels unwillkürlich einen Schlag zuzulegen schien.
Diese Seiten waren die Beute des Diebstahls, den Shaw tags zuvor begangen hatte.
Er hoffte, sie würden die Antwort auf eine Frage enthalten, die ihn schon seit anderthalb Jahrzehnten quälte.
Ein Schluck Kaffee. Er blätterte den Inhalt durch.
Es schien sich um eine unzusammenhängende Sammlung von Gedankengängen zu historischen, philosophischen, medizinischen und wissenschaftlichen Themen zu handeln, mit Landkarten, Fotos und Belegkopien. Die Schrift war die gleiche wie auf der Vorderseite des Umschlags: präzise und absolut gerade, als hätte man eine Schablone verwendet, mit einer grazilen Mischung aus Schreibschrift und Druckbuchstaben.
Ähnlich wie Colter Shaws eigene Schrift.
Er schlug wahllos eine Seite auf und fing an zu lesen.
Vierundzwanzig Kilometer nordwestlich von Macon auf der Squirrel Level Road, Kirche der Heiligen Brüder. Sollte mit Pfarrer reden. Guter Mann. Rev. Harley Combs. Klug und verschwiegen, wenn angebracht.
Shaw las weitere Abschnitte und hörte dann auf. Zwei Schlucke Kaffee, der Gedanke an Frühstück. Dann: Mach weiter, tadelte er sich selbst. Du hast diese Sache angefangen und warst bereit, das Ergebnis zu akzeptieren. Also bleib dran.
Sein Mobiltelefon summte. Er sah auf die Kennung des Anrufers und war beinahe froh darüber, sich nicht sofort wieder um die gestohlenen Unterlagen kümmern zu müssen.
»Teddy.«
»Colt. Wo bist du?« Ein Baritonbrummen.
»Noch immer in der Bay Area.«
»Schon was gefunden?«
»Ein wenig. Eventuell. Zu Hause alles in Ordnung?« Die Bruins hüteten sein Haus in Florida, dessen Grundstück an ihres grenzte.
»Picobello.« Ein Wort, das man von einem ehemaligen Berufsoffizier der Marines nicht unbedingt erwarten würde. Teddy Bruin und seine Frau Velma, ebenfalls Veteranin, gaben sich aber keine Mühe, den Vorurteilen anderer Leute zu entsprechen. Shaw sah sie nun vor sich, wie sie höchstwahrscheinlich – wie so oft – auf ihrer Veranda saßen und hinaus auf den vierzig Hektar großen See in Nordflorida schauten. Teddy war zweiundsechzig Jahre alt und hundertfünfzehn Kilo schwer. Sein rötliches Haar war in farblicher Hinsicht eine dunklere Version seiner sommersprossigen, geröteten Haut. Er hatte eine Stoffhose oder Shorts an, und zwar khakifarben, weil das die einzige Farbe war, die er besaß. Auf seinem Hemd würden Blumen sein. Velma wog nicht mal halb so viel wie er, war aber auch groß gewachsen. Sie trug eine Jeans und ein Arbeitshemd, und sie hatte die raffinierteren Tätowierungen der beiden.
Im Hintergrund bellte ein Hund. Das musste Chase sein, ihr Rottweiler. Shaw hatte mit dem massigen, gutmütigen Tier viele nachmittägliche Wanderungen unternommen.
»Wir haben einen Auftrag bei dir in der Nähe gefunden. Keine Ahnung, ob’s dich interessiert. Vel hat die Einzelheiten. Da kommt sie schon. Ah, hier.«
»Colter.« Im Gegensatz zu Teddys Stimme klang die von Velma wie sanft fließendes Wasser. Shaw hatte ihr vorgeschlagen, Hörbücher für Kinder aufzunehmen. Ihre Stimme würde wie Zolpidem wirken und sie direkt einschlafen lassen.
»Algo hat einen Treffer gelandet. Sie schnüffelt besser als ein Bluetick Coonhound. Was für eine Nase.«
Velma hatte beschlossen, dass der Computer-Bot, den sie benutzte (Algo wie in »Algorithmus«), um das Internet nach potenziellen Aufträgen für Shaw zu durchsuchen, weiblichen Geschlechts war. Und außerdem ein Hund, wie es schien.
»Ein vermisstes Mädchen im Silicon Valley«, fügte sie hinzu.
»Vom Hinweistelefon?«
Solche Nummern wurden häufig angeboten, sowohl von den Behörden als auch von privaten Organisationen wie den Crime Stoppers, damit ein Informant, zumeist ein Insider, sich anonym melden und Angaben zu etwaigen Verdächtigen machen konnte. Umgangssprachlich war oft auch von Spitzel- oder Petzernummern die Rede.
Shaw hatte im Laufe der Jahre immer mal wieder Jobs vom Hinweistelefon angenommen – sofern das Verbrechen besonders abscheulich oder die Familie des Opfers besonders stark betroffen war. Normalerweise mied er diese Aufträge aber, weil sie Formalitäten und viel Bürokratie mit sich brachten. Und sie lockten seltsame Gestalten an.
»Nein. Der Anbieter ist ihr Vater«, erklärte Velma. »Zehntausend. Nicht viel. Aber sein Aufruf … kam von Herzen. Er ist ziemlich verzweifelt.«
Teddy und Velma waren Shaw schon seit Jahren bei der Prämiensuche behilflich; Verzweiflung erkannten sie mittlerweile auf den ersten Blick.
»Wie alt ist die Tochter?«
»Neunzehn. Studentin.«
Bei dem Telefon in Florida war der Lautsprecher eingeschaltet, und Teddys kratzige Stimme sagte: »Wir haben die Nachrichten überprüft. Es gab keine Meldungen über Maßnahmen der Polizei. Ihr Name taucht nirgendwo auf, nur im Zusammenhang mit der Belohnung. Also laufen wohl noch keine Ermittlungen.«
Bei einem älteren Teenager und keinerlei Hinweis auf eine Entführung würden die Cops nicht gleich alles in Bewegung setzen – im Gegensatz zu einem eindeutigen Kidnapping. Vorläufig würden sie davon ausgehen, das Mädchen sei einfach abgehauen.
Natürlich konnte beides zutreffen: Es kam immer wieder vor, dass junge Leute sich verleiten ließen, ihr Zuhause zu verlassen, nur um dann festzustellen, dass sie auf falsche Versprechungen hereingefallen waren. Oder es hatte sich ein Unfall ereignet, und ihr Leichnam trieb nun im kalten, unberechenbaren Wasser des Pazifik oder lag am Grund einer Schlucht in einem Fahrzeugwrack, dreißig Meter unterhalb der Serpentinen des Highway 1.
Shaw überlegte. Sein Blick fiel auf die etwa vierhundert Seiten. »Ich werde mal mit dem Vater sprechen. Wie heißt sie?«
»Sophie Mulliner. Und er Frank.«
»Und die Mutter?«
»Die wird nicht erwähnt«, sagte Velma. »Ich schicke dir die Einzelheiten.«
»Ist Post gekommen?«, fragte Shaw.
»Rechnungen«, erwiderte sie. »Die ich bezahlt habe. Ein Haufen Coupons. Und ein Katalog von Victoria’s Secret.«
Shaw hatte Margot vor zwei Jahren ein Geschenk gekauft; Victoria hatte beschlossen, dass seine Adresse keines ihrer Secrets war, und sie den Handlangern ihres Werbeverteilers überlassen. Er hatte schon länger nicht mehr an Margot gedacht, bestimmt seit … einem Monat? Vielleicht seit zwei Wochen. »Wirf ihn weg«, sagte er.
»Kann ich ihn behalten?«, fragte Teddy.
Ein dumpfer Schlag und Gelächter. Dann noch ein dumpfer Schlag.
Shaw bedankte sich und trennte die Verbindung.
Er spannte die Gummibänder um den Papierstoß. Ein weiterer Blick nach draußen. Kein Mr. Nagetier.
Colter Shaw klappte seinen Laptop auf und las Velmas E-Mail. Dann öffnete er auf dem Bildschirm eine Straßenkarte, um in Erfahrung zu bringen, wie lange es dauern würde, ins Silicon Valley zu gelangen.
4
Womöglich befand Colter Shaw sich schon jetzt im Silicon Valley.
Manche Leute waren tatsächlich der Ansicht, North Oakland und Berkeley lägen innerhalb der nebulösen Grenzen dieses mythischen Orts. Für sie umfasste das Silicon Valley – oder »SV«, wie es anscheinend die Eingeweihten nannten – einen breiten Streifen zwischen Berkeley im Osten und San Francisco im Westen bis hinunter zum südlich gelegenen San Jose.
Die Definition hing offenbar davon ab, ob eine Firma oder Person zum Silicon Valley gehören wollte. Und die allermeisten wollten absolut.
Nach herkömmlichem Verständnis war allerdings nur die Region westlich der Bucht gemeint, mit Palo Alto und der dortigen Stanford University im Zentrum. Die Anschrift des Belohnungsanbieters lag nicht weit von dort in Mountain View. Shaw sicherte die Inneneinrichtung des Wohnmobils für die Fahrt, vergewisserte sich, dass sein Geländemotorrad an der Halterung am Heck verzurrt war, und trennte die Versorgungsleitungen des Stellplatzes ab.
Bei der Hütte machte er kurz Halt, um Carole Bescheid zu geben, und eine halbe Stunde später folgte er dem breiten Freeway 280. Zu seiner Linken konnte er zwischen den Bäumen erste Blicke auf die Vororte des Silicon Valley erhaschen, und im Westen erstreckten sich die üppig bewachsenen Hügel des Rancho Corral di Tierra und das beschauliche Crystal Springs Reservoir.
Diese Gegend war neu für ihn. Shaw war in Berkeley geboren – nur dreißig Kilometer von hier – konnte sich aber kaum noch daran erinnern. Als Colter vier war, hatte Ashton die Familie auf ein riesiges Stück Land umziehen lassen, hundertsechzig Kilometer östlich von Fresno, in den Ausläufern der Sierra Nevada. Er nannte es das »Anwesen«, weil das seiner Meinung nach kerniger klang als »Ranch« oder »Farm«.
Auf Anweisung des Navigationsgeräts fuhr Shaw nun vom Freeway ab und weiter zum Westwinds Wohnmobilcenter in Los Altos Hills. Er meldete sich an. Der freundliche Leiter war ungefähr sechzig, durchtrainiert und ein ehemaliger Seemann, falls die Ankertätowierung irgendwas zu bedeuten hatte. Er gab Shaw einen Lageplan und zog mit einem Druckbleistift eine saubere Linie von seinem Büro zu dem zugewiesenen Stellplatz. Der lag am Google Way, und man erreichte ihn über die Yahoo Lane und die PARC Road. Den letzten Namen begriff Shaw nicht. Aber er musste wohl auch was mit Computern zu tun haben.
Er fand den Platz, stöpselte die Anschlüsse ein und kehrte mit seiner schwarzledernen Computertasche zum Büro zurück, wo er sich ein Uber-Taxi rief und sich zu der kleinen Avis-Filiale mitten in Mountain View bringen ließ. Dort mietete er eine Stufenhecklimousine. Das Modell war ihm egal, aber es musste schwarz oder marineblau sein, seine bevorzugten Farben. In den zehn Jahren als Prämienjäger hatte er sich kein einziges Mal als Polizist ausgegeben, aber bisweilen hielten die Leute ihn dafür, und er widersprach ihnen nicht. Ein Auto, das wie das Fahrzeug eines Detectives aussah, lockerte so manche Zunge.
Während der letzten beiden Tage war Shaw mit seiner Yamaha Enduro zwischen Caroles Wohnmobilpark und Berkeley hin und her gefahren. Er nutzte so oft wie möglich das Motorrad, wenngleich nur, um private Dinge zu erledigen, oder natürlich aus Spaß. Wenn er einen Auftrag übernahm, mietete er stets eine Limousine oder, falls das Gelände es erforderte, ein SUV. Mit einem knatternden Motorrad bei Anbietern, Zeugen oder der Polizei aufzutauchen würde zu Zweifeln an seiner Professionalität führen. Und während ein neun Meter langes Wohnmobil sich gut für Highways eignete, war es für den dichten Verkehr der Ballungsräume viel zu unhandlich.
Er gab die Adresse des Anbieters in das Navi ein und machte sich auf den Weg.
Dies war also das Herz des SV, des Olymps der Hochtechnologie. Nicht ganz so glitzernd, wie man erwarten würde, jedenfalls nicht auf Shaws Route. Keine skurrilen Glasgebäude, Marmorvillen oder reihenweise geschmeidige Mercedesse, Maseratis, BMWs oder Porsches. Das hier sah wie ein Diorama der 1970er-Jahre aus: hübsche Einfamilienhäuser, meistens nach Art von Ranchgebäuden, mit winzigen Gärten, Mietshäuser, die zwar sauber und ordentlich wirkten, aber einen frischen Anstrich oder eine neue Außenverkleidung vertragen konnten, Kilometer um Kilometer mit Ladenzeilen und zwei- oder dreigeschossigen Bürobauten. Keine Hochhäuser – vielleicht aus Angst vor Erdbeben? Die San-Andreas-Spalte verlief genau hier entlang.
Das Silicon Valley hätte auch in Cary, North Carolina, oder Plano, Texas, oder Fairfax County, Virginia, liegen können – oder in einem anderen kalifornischen Tal, dem San Fernando Valley, fünfhundert Kilometer weiter südlich von hier und mit dem SV durch den praktischen Highway 101 verbunden. Das war bei der Geburt von neuen Technologien wohl immer so, vermutete Shaw: Es passierte alles in geschlossenen Räumen. Wenn man durch Hibbing, Minnesota, fuhr, sah man die anderthalb Kilometer lange karmesinrote Eisenerzgrube. Oder in Gary, Indiana, die festungsgleichen Stahlwerke. Im Silicon Valley gab es keine Narben in der Landschaft oder charakteristische Industrieanlagen.
Nach zehn Minuten erreichte er Frank Mulliners Anschrift am Alta Vista Drive. Die Ranch war nicht nach Schema F erbaut, fügte sich aber gut in diesen langen Häuserblock ein. Preisbewusst, mit Holz- oder Vinylverkleidung, drei Betonstufen vor der Haustür und schmiedeeisernem Geländer. Die schickeren Häuser hatten Erkerfenster. Auf der Fahrbahn war jeweils ein Parkstreifen markiert, dann folgten der Bürgersteig und der Vorgarten. Bei manchen war das Gras grün, bei anderen strohfarben. Einige Hauseigentümer hatten den Rasen durch Kies, Sand und niedrige Sukkulenten ersetzt.
Shaw hielt vor dem blassgrünen Haus. Ein Schild auf dem Nachbargrundstück kündigte eine Zwangsversteigerung an. Auch Mulliners Immobilie sollte verkauft werden.
Nachdem Shaw geklopft hatte, dauerte es nur einen Moment, dann öffnete ihm ein stämmiger, ungefähr fünfzigjähriger Mann mit schütterem Haar. Er trug eine graue Hose und ein blaues Anzughemd ohne Krawatte. An seinen Füßen steckten Slipper ohne Socken.
»Frank Mulliner?«
Die rot geränderten Augen des Mannes musterten flink Shaws Kleidung, das kurze blonde Haar, das ernste Auftreten – er lächelte nur selten. Der verängstigte Vater würde ihn für einen Detective halten, der schlechte Neuigkeiten brachte, also stellte Shaw sich umgehend vor.
»Oh, Sie sind … Sie haben angerufen. Wegen der Belohnung.«
»Ganz recht.«
Der Mann reichte ihm die Hand. Sie war eiskalt.
Mit einem schnellen Blick in die Runde bat er Shaw hinein.
Die Wohnräume eines Anbieters verrieten Shaw viel über die jeweilige Person – und ob die ausgelobte Belohnung realistisch und berechtigt zu sein schien. Daher traf er sich mit den Leuten möglichst zu Hause. Notfalls auch im Büro. Das verschaffte ihm einen Eindruck über die potenzielle Geschäftsbeziehung und auch darüber, wie ernst die Umstände waren, die zur Auslobung der Belohnung geführt hatten. Hier roch es nach Essensresten. Auf Tischen und anderen Möbeln lagen Rechnungen und Briefe, Werkzeuge und Werbeprospekte verstreut. Im Wohnzimmer türmten sich Kleidungsstücke. Obwohl Sophie erst seit ein paar Tagen verschwunden war, hatte der Mann sich schon nicht mehr im Griff.
Auch wirkte das Haus insgesamt heruntergekommen. Die Wände und Zierleisten waren verschrammt, mussten ausgebessert und neu gestrichen werden. Eines der Beine des Couchtisches war gebrochen; man hatte es mit Textilklebeband geflickt und dieses dann braun angemalt, damit es sich nicht so sehr vom Eichenholz abhob. An der Decke gab es Wasserflecke, und über einem Fenster gähnte ein Loch, weil die Gardinenleiste sich von der Gipskartonplatte gelöst hatte. Das hieß, die zehntausend Dollar Belohnung waren zumindest zweifelhaft.
Die beiden Männer nahmen auf durchgesessenen Polstermöbeln Platz, die mit ausgeleierten goldenen Schonbezügen versehen waren. Die Lampen passten nicht zueinander. Und der große Fernseher war nach heutigen Maßstäben gar nicht mehr so groß.
»Haben Sie mittlerweile etwas gehört?«, fragte Shaw. »Von der Polizei? Oder von Sophies Freunden?«
»Nein, nichts. Ihre Mutter auch nicht. Sie lebt nicht in Kalifornien.«
»Ist sie hierher unterwegs?«
Mulliner schluckte. »Sie kommt nicht.« Er biss die Zähne zusammen und strich sich über den Rest seines braunen Haars. »Noch nicht.« Er sah Shaw prüfend an. »Sind Sie ein Privatdetektiv oder so?«
»Nein. Ich verdiene mir Belohnungen, die von Privatpersonen oder der Polizei ausgesetzt worden sind.«
Das schien er erst mal verdauen zu müssen. »Als Lebensunterhalt.«
»Korrekt.«
»Davon hab ich noch nie gehört.«
Shaw brauchte Mulliner zwar nicht von sich zu überzeugen, wie ein Privatschnüffler dies bei einem neuen Klienten tun würde, war aber auf Informationen angewiesen. Und das bedeutete Kooperation. Also hielt er seine übliche Rede. »Ich verfüge hierbei über jahrelange Erfahrung und habe schon einige Dutzend Male geholfen, vermisste Personen aufzuspüren. Ich werde Nachforschungen anstellen, um einen Hinweis auf Sophies Aufenthaltsort zu finden. Sobald mir das gelungen ist, verständige ich Sie und die Polizei. Ich hole niemanden gewaltsam zurück und überrede auch niemanden zur Umkehr, falls er aus freien Stücken weggegangen ist.«
Der letzte Teil entsprach nicht ganz der Wahrheit, aber Shaw legte Wert auf klare Verhältnisse. Und deshalb erwähnte er auch nur die Regeln und nicht die Ausnahmen.
»Sollten meine Angaben sich als zutreffend erweisen, zahlen Sie mir die Belohnung. Vorher aber müssen wir uns ein wenig unterhalten. Falls Ihnen nicht gefällt, was Sie hören oder sehen, sagen Sie es mir, und ich werde die Angelegenheit nicht weiter verfolgen. Falls mir etwas nicht gefällt, ziehe ich mich sofort zurück.«
»Ich für meinen Teil bin einverstanden«, sagte der Mann mit erstickter Stimme. »Sie scheinen in Ordnung zu sein. Sie machen klare Ansagen und bleiben ruhig. Nicht wie, keine Ahnung, wie einer dieser Kopfgeldjäger im Fernsehen. Tun Sie, was Sie können, um Fee zu finden. Bitte.«
»Fee?«
»Ihr Spitzname. So-fee. So hat sie sich selbst genannt, als sie noch klein war.« Er schaffte es gerade noch, nicht zu weinen.
»Hat sich sonst jemand wegen der Belohnung an Sie gewandt?«
»Es gab eine Menge Anrufe und E-Mails. Vorwiegend anonym. Die Leute haben behauptet, sie hätten sie gesehen oder wüssten, was passiert ist. Aber schon nach ein paar Fragen war mir klar, dass die gar nichts wussten. Die wollten bloß das Geld. Einer hat Außerirdische und ein Raumschiff erwähnt. Ein anderer einen russischen Sexhandelsring.«
»Die meisten Leute, die Kontakt zu Ihnen aufnehmen, werden es nur auf das schnelle Geld abgesehen haben. Jeder, der Ihre Tochter kennt, wird Ihnen ohne solche Hintergedanken helfen. Dennoch besteht die geringe Chance, dass jemand sich meldet, der irgendwie mit dem Entführer zu tun hat – falls es überhaupt einen Entführer gibt – oder der wirklich glaubt, Ihre Tochter auf der Straße gesehen zu haben. Hören Sie sich daher bitte alle Anrufer an, und lesen Sie alle E-Mails. Manchmal hat man Glück. Also, sie zu finden ist unser einziges Ziel. Dafür kann es nötig sein, viele kleine Informationen zu einem größeren Bild zusammenzusetzen. Fünf Prozent hier, zehn da. Wie die Belohnung gegebenenfalls zwischen mir und meinen Hinweisgebern aufgeteilt wird, braucht Sie nicht zu interessieren. Sie zahlen nicht mehr als die zehntausend Dollar.
Und noch etwas: Ich fordere die Belohnung nur ein, sofern die betreffende Person noch am Leben ist.«
Der Mann erwiderte nichts darauf. Er knetete einen leuchtend orangefarbenen Golfball. »Diese Dinger sind dafür gedacht, dass man im Winter spielen kann«, sagte er nach einem Moment. »Jemand hat mir eine Schachtel davon geschenkt.« Er hob den Kopf und erwiderte Shaws teilnahmslosen Blick. »Es schneit hier nie. Spielen Sie Golf? Wollen Sie ein paar von den Dingern haben?«
»Mr. Mulliner, wir sollten keine Zeit verlieren.«
»Frank.«
»Je schneller, desto besser«, mahnte Shaw.
Der Mann atmete tief ein. »Bitte. Helfen Sie ihr. Finden Sie Fee für mich.«
»Zunächst mal: Sind Sie sicher, dass sie nicht weggelaufen ist?«
»Ja, hundertprozentig.«
»Und warum?«
»Wegen Luka.«
5
Shaw saß an dem versehrten Couchtisch.
Vor ihm lag ein dreizehn mal achtzehn Zentimeter großes Notizbuch mit zweiunddreißig leeren, unlinierten Seiten. In der Hand hielt er einen schwarzen Füllfederhalter, einen Delta Titanio Galassia mit drei orangefarbenen Ringen zur Spitze hin. Das trug ihm gelegentlich befremdete Blicke ein. Ganz schön prätentiös, oder? Doch Shaw schrieb viel und schnell, und das italienische Schreibgerät, das mit einem Preis von zweihundertfünfzig Dollar nicht billig, aber auch kein Luxusartikel war, strengte die Muskeln deutlich weniger an als ein Kugelschreiber oder sogar ein Tintenroller. Es war das beste Werkzeug für die Aufgabe.
Shaw und Mulliner waren nicht allein. Neben Shaw saß jemand und hechelte ihm auf den Oberschenkel, nämlich der Grund dafür, dass der Vater keinen Zweifel daran hatte, dass seine Tochter nicht weggelaufen war: Luka.
Ein wohlerzogener weißer Standardpudel.
»Fee würde Luka nicht zurücklassen. Niemals. Wäre sie aus freien Stücken weggegangen, hätte sie ihn mitgenommen. Oder wenigstens angerufen, um sich nach ihm zu erkundigen.«
Auf dem Anwesen hatte es auch Hunde gegeben, Vorstehhunde zum Vorstehen, Apportierhunde zum Apportieren – und alle gemeinsam zum Bellen wie verrückt, falls ungebetene Besucher kamen. Colter und Russell waren wie ihr Vater der Ansicht, dass es sich bei den Tieren um Angestellte handelte. Ihre jüngere Schwester Dorion hingegen brachte die Hunde durcheinander, indem sie ihnen selbst genähte Sachen anzog und sie bei sich im Bett schlafen ließ. Shaw akzeptierte nun Lukas Anwesenheit als Indiz dafür, dass die junge Frau nicht weggelaufen war. Ein Beweis war es aber nicht.
Colter Shaw fragte nach den Einzelheiten von Sophies Verschwinden, nach der Reaktion der Polizei auf Mulliners Anruf, nach Angehörigen und Freunden. Mit seiner winzigen, eleganten Handschrift, die auf dem unlinierten Papier perfekt waagerecht verlief, hielt er alles fest, was potenziell hilfreich sein konnte, und ignorierte das Unwesentliche. Nachdem er alle Fragen gestellt hatte, ließ er den Mann reden. Auf diese Weise erhielt er für gewöhnlich die wichtigsten Informationen, die sich wie Nuggets in dem Wortschwall verbargen.
Mulliner ging in die Küche und kam gleich darauf mit einigen Zetteln und Haftnotizen voller Namen, Zahlen und Adressen zurück – in zwei Handschriften. Seiner und Sophies, bestätigte er. Telefonnummern von Freunden, Termine, Schicht- und Stundenpläne. Shaw übertrug die Informationen in sein Notizbuch. Falls die Polizei doch noch tätig wurde, sollte Mulliner lieber im Besitz der Originale sein.
Sophies Vater hatte seine Sache bisher gut gemacht. Er hatte haufenweise VERMISST-Aushänge unter die Leute gebracht. Er hatte sowohl bei Sophies Chef nachgefragt, in dessen Softwarefirma sie Teilzeit arbeitete, als auch bei einem halben Dutzend ihrer Collegeprofessoren und bei ihrem Sporttrainer. Außerdem hatte er mit einer Handvoll ihrer Freunde gesprochen, aber die Liste war kurz.
»Ich wäre gern ein besserer Vater gewesen«, räumte Mulliner ein und senkte betreten den Blick. »Wie gesagt, Sophies Mutter lebt weit weg. Ich habe zwei Jobs. Es hängt alles an mir. Ich schaffe es nicht so oft zu ihren Veranstaltungen oder Turnieren – sie spielt Lacrosse –, wie ich das möchte.« Er wies mit ausholender Geste auf das unordentliche Haus. »Sie veranstaltet hier keine Partys. Sie sehen ja selbst, warum. Zum Saubermachen bleibt mir keine Zeit. Und eine Putzfrau bezahlen? Vergessen Sie’s.«
Shaw notierte sich das Lacrosse. Die junge Frau konnte rennen und war vermutlich muskulös. Und sie kannte sich mit Konkurrenzdruck aus.
Sophie würde kämpfen – falls sie dazu die Gelegenheit bekam.
»Übernachtet sie oft bei Freunden?«
»Kaum noch. Während der Highschool kam das durchaus vor. Manchmal. Aber sie gibt immer Bescheid.« Mulliner stutzte. »Ich habe Ihnen ja gar nichts angeboten. Bitte verzeihen Sie. Möchten Sie einen Kaffee? Oder ein Wasser?«
»Nein, vielen Dank.«
Wie die meisten Leute konnte auch Mulliner seinen Blick nicht von Shaws flinker, präziser Handschrift in dunkelblauer Tinte abwenden.
»Haben Sie das in der Schule gelernt?«
»Ja.«
Gewissermaßen.
Eine Durchsuchung von Sophies Zimmer erbrachte nichts Aufschlussreiches. Es gab hier zahlreiche Computerbücher, Platinen, Schränke voller Kleidung, Schminksachen, Konzertplakate und einen kleinen Plastikbaum als Schmuckständer. Shaw fiel auf, dass sie eine Künstlerin war, und zwar eine gute. Auf der Kommode lag ein Stapel Landschaftsaquarelle, kühn und farbenfroh. Die Ränder der Blätter hatten sich beim Trocknen eingerollt.
Mulliner hatte gesagt, sie habe ihren Laptop und ihr Telefon mitgenommen, womit Shaw gerechnet hatte, aber er war enttäuscht, dass sie keinen zweiten Computer besaß, den er sich vornehmen könnte, auch wenn das häufig nicht besonders hilfreich war. Man stieß nur selten auf Einträge wie: Am Sonntag zum Brunch; danach werde ich weglaufen, weil ich meine blöden Eltern hasse.
Und Abschiedsbriefe etwaiger Selbstmordkandidaten musste man nie großartig suchen, denn die sollten ja gefunden werden.
Shaw bat um einige Fotos der jungen Frau, in unterschiedlicher Kleidung und aus verschiedenen Winkeln aufgenommen. Ihr Vater konnte mit zehn guten Bildern aufwarten.
Mulliner setzte sich wieder ins Wohnzimmer, aber Shaw blieb stehen. »Sie ist am Mittwoch, also vorgestern, um sechzehn Uhr aus der Uni nach Hause gekommen«, sagte er, ohne seine Notizen zurate zu ziehen. »Um siebzehn Uhr dreißig ist sie mit ihrem Rad von hier losgefahren und nicht mehr zurückgekehrt. Am frühen Donnerstagmorgen haben Sie dann die Belohnung ausgesetzt.«
Mulliner nickte nur.
»Das ist nach so kurzer Zeit ziemlich außergewöhnlich – falls alles mit rechten Dingen zugegangen ist.«
»Ich war nur … Sie wissen schon. Es war so schrecklich. Ich habe mir solche Sorgen gemacht.«
»Frank, ich muss alles wissen.« Shaws blaue Augen blieben unverwandt auf den Anbieter gerichtet.
Mulliner knetete erneut den orangefarbenen Golfball zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand. Sein Blick war auf den Couchtisch mit den Haftnotizen gerichtet. Er sammelte die Zettel ein, ordnete sie und hielt dann inne. »Wir haben uns gestritten, Fee und ich. Am Mittwoch. Als sie nach Hause gekommen ist. Es war ein heftiger Streit.«
»Erzählen Sie mir davon.« Shaws Stimme klang sanfter als noch kurz zuvor. Er setzte sich ebenfalls.
»Ich habe eine Dummheit begangen. Ich habe das Haus am Mittwoch zum Verkauf freigegeben, den Makler aber gebeten, noch kein Schild in unseren Rasen zu stecken. Ich wollte zuerst Fee davon erzählen. Er hat es aber trotzdem gemacht, und ein Freund aus der Nachbarschaft hat es gesehen und sie angerufen. Scheiße. Das hätte ich mir denken können.« Seine feuchten Augen blickten auf. »Ich habe alles versucht, um nicht umziehen zu müssen. Ich habe diese zwei Jobs. Ich habe mir Geld vom neuen Ehemann meiner Exfrau geliehen, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe alles getan, was mir möglich war, aber ich kann es mir einfach nicht mehr leisten zu bleiben. Dies war unser Zuhause! Fee ist hier aufgewachsen, und ich werde es nun verlieren. Die Abgaben hier im Bezirk sind erdrückend. Ich habe etwas Neues in Gilroy gefunden, südlich von hier. Ein ganzes Stück weiter südlich. Mehr ist nicht drin. Sophie wird zum College und zur Arbeit pendeln müssen – zwei Stunden pro Strecke. Sie wird ihre Freunde kaum noch zu Gesicht bekommen.«
Er lachte verbittert auf. »Sie hat gesagt: ›Super, wir ziehen in die Knoblauch-Hauptstadt der Welt.‹ Was stimmt. ›Und du hast mich nicht mal vorgewarnt.‹ Da ist mir die Sicherung durchgebrannt. Ich hab sie angeschrien. Wie sie einfach ignorieren könne, wie sehr ich mich bemüht habe. Dass mein Weg zur Arbeit sogar noch länger sein wird. Sie hat sich ihren Rucksack geschnappt und ist rausgestürmt.«
Mulliner wich Shaws Blick aus. »Ich habe befürchtet, wenn ich es Ihnen erzähle, würden Sie sicher sein, dass sie weggerannt ist, und mir nicht helfen.«
Das beantwortete eine wichtige Frage: Warum so schnell eine Belohnung? Es hatte Shaw wirklich zu denken gegeben. Ja, Mulliner schien aufrichtig verzweifelt zu sein. Er hatte das Haus vor die Hunde gehen lassen. Das sprach dafür, dass er sich große Sorgen um seine Tochter machte. Doch Ehe- oder Geschäftspartner, Geschwister und, jawohl, auch Eltern, die einen Mord begangen haben, setzen manchmal eine Belohnung aus, um selbst unschuldig zu erscheinen. Und das meistens zügig, genau wie Mulliner dies getan hatte.
Nein, er war noch nicht ganz vom Haken. Doch sein Eingeständnis des Streits sowie die weiteren Schlussfolgerungen, die Shaw über den Mann gezogen hatte, deuteten darauf hin, dass er unschuldig am Verschwinden seiner Tochter war.
Der Grund für die frühzeitig angebotene Belohnung war nachvollziehbar: Es war für ihn unerträglich, befürchten zu müssen, dass er seine Tochter aus dem Haus vertrieben hatte und sie direkt einem Mörder, Vergewaltiger oder Entführer in die Arme gelaufen war.
»Falls ihr etwas zustößt …«, sagte Mulliner nun tonlos, fast unhörbar. »Ich könnte mir …« Seine Stimme erstarb, und er schluckte schwer.
»Ich werde Ihnen helfen«, sagte Shaw.
»Danke!« Ein Flüstern. Und dann brach er wirklich in Tränen aus. »Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid …«, schluchzte er.
»Schon gut.«
Mulliner sah auf die Uhr. »Verdammt, ich muss zur Arbeit. Das Letzte, was ich jetzt will. Aber ich darf diesen Job nicht verlieren. Bitte rufen Sie mich an. Was auch immer Sie herausfinden, bitte rufen Sie mich sofort an.«
Shaw schraubte die Kappe auf seinen Füllfederhalter, steckte ihn in die Innentasche seines Sakkos, stand auf und klappte das Notizbuch zu. Er fand selbst hinaus.
6
Bei der Einschätzung, wie er einen Fall am besten angehen würde – und, nebenbei bemerkt, bei den meisten Entscheidungen im Leben –, folgte Colter Shaw dem Rat seines Vaters.
»Ob du nun einer Gefahr entgegentrittst oder eine Aufgabe in Angriff nimmst, du bewertest jede einzelne Wahrscheinlichkeit, wählst dann die mit der höchsten Prozentzahl und legst dir eine passende Strategie zurecht.«
Die Wahrscheinlichkeit, dass du an einem windigen Tag und hangaufwärts schneller rennen kannst als ein Waldbrand: zehn Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass du überleben kannst, indem du eine Feuerschneise anlegst und dich in der Asche eingräbst, während die Flammen über dich hinwegziehen: achtzig Prozent.
Ashton Shaw: »Die Wahrscheinlichkeit, oben in den Bergen einen Blizzard zu überleben. Wenn du weiterläufst: dreißig Prozent. Wenn du in einer Höhle Schutz suchst: achtzig Prozent.«
»Es sei denn«, hatte die achtjährige und stets praktisch veranlagte Dorion angemerkt, »in der Höhle wohnt eine Grizzlymutter mit ihren Jungen.«
»Das stimmt, Purzel. Dann ist deine Chance auf einmal nur noch ganz, ganz winzig. Obwohl es hier ein Schwarzbär wäre. Grizzlys sind in Kalifornien ausgestorben.«
Shaw saß nun vor Mulliners Haus in seinem Chevy, hatte das Notizbuch auf dem Schoß und den Laptop aufgeklappt neben sich. Er jonglierte mit den Prozentsätzen von Sophies Schicksal.
Was er Mulliner nicht gesagt hatte: Der Tod des Mädchens war wahrscheinlicher als alles andere.
Shaw stufte ihn bei sechzig Prozent ein. Höchstwahrscheinlich ermordet von einem Serientäter, Vergewaltiger oder einem neuen Bandenmitglied, das sich beweisen musste (die Gangs der Bay Area zählten zu den brutalsten des ganzen Landes). Eine etwas weniger wahrscheinliche Todesursache war ein Unfall mit Fahrerflucht, bei dem ihr Fahrrad von einem Betrunkenen oder SMS-Schreiber von der Straße gestoßen worden war.
Natürlich stand auch eine beachtliche Prozentzahl für ihr Überleben – entführt für Lösegeld oder Sex oder einfach nur stinksauer auf Dad wegen des Umzugs, weshalb sie nun – Pudel Luka hin oder her – erst mal ein paar Tage auf der Couch einer Freundin übernachtete, um ihn schwitzen zu lassen.
Shaw nahm seinen Computer – wenn er an einem Fall arbeitete, abonnierte er die örtlichen Newsfeeds und hielt nach Meldungen Ausschau, die sich als hilfreich erweisen könnten. Nun überprüfte er, ob unidentifizierte weibliche Leichen gefunden worden waren (keine) oder ob sich in den letzten Wochen Zwischenfälle mit Serienentführern oder -mördern ereignet hatten (mehrere, aber der Täter hatte es auf afroamerikanische Prostituierte im Stadtteil Tenderloin von San Francisco abgesehen). Shaw erweiterte die Suche auf ganz Nordkalifornien und stieß auf nichts Relevantes.
Er überflog seine Notizen. Frank Mulliner hatte ihm erzählt, er habe am Mittwochabend und gestern nach dem Mädchen gesucht. Dann habe er so viele Freunde, Kommilitonen und Arbeitskollegen angerufen, wie er Namen finden konnte. Diese Leute hätten ausgesagt, soweit sie wüssten, sei Sophie nicht von einem Stalker belästigt worden.
»Doch da gibt es jemanden, von dem Sie wissen sollten.«
Dieser Jemand war Sophies Exfreund. Kyle Butler war zwanzig und ebenfalls Student, aber an einem anderen College. Sophie und Kyle hatten sich vor ungefähr einem Monat getrennt, schätzte Mulliner. Nachdem sie ein Jahr lang immer mal wieder Zeit miteinander verbracht hatten, war erst letzten Frühling etwas Ernsteres daraus geworden. Der Vater kannte den Trennungsgrund nicht, war aber froh darüber.
Shaws Notiz: Mulliner: KB hat Sophie nicht so behandelt, wie es sich gehört hätte. Er war respektlos und gemein. Nicht gewalttätig. KB war aufbrausend und impulsiv. Und er nahm Drogen. Hauptsächlich Pot.
Mulliner besaß kein Foto des Jungen – und Sophie hatte seine Bilder anscheinend aus ihrem Zimmer verbannt –, aber Shaw wurde bei Facebook fündig. Kyle war ein kräftig gebauter, sonnengebräunter junger Mann mit blondem Lockenschopf auf dem Kopf eines griechischen Gottes. Laut seinen Profilangaben interessierte er sich für Heavy Metal, Surfen und die Legalisierung von Drogen. Mulliner glaubte, er verdiene sich Geld hinzu, indem er Musikanlagen in Autos einbaute.
Mulliner: Keine Ahnung, was Sophie in ihm gesehen hat. Vielleicht hat sie sich für unattraktiv gehalten, für einen »Computerfreak«, und er war ein gut aussehender, cooler Surfer-Typ.
Der Vater berichtete, der Junge habe die Trennung nicht gut verkraftet und sich unangemessen verhalten. An einem Tag habe er zweiunddreißigmal angerufen. Nachdem sie seine Nummer blockiert hatte, fand Sophie ihn vor ihrer Haustür wieder, wo er sie schluchzend anflehte, ihn zurückzunehmen. Am Ende fing er sich, und die beiden schlossen einen Waffenstillstand. Sie würden sich gelegentlich auf einen Kaffee treffen. Sie sahen sich gemeinsam »als Freunde« ein Theaterstück an. Kyle drängte sie nicht, aber Sophie hatte ihrem Vater erzählt, dass er unbedingt wieder mit ihr zusammen sein wollte.
Entführungen im häuslichen Rahmen wurden fast immer von Eltern verübt. (Die Aufklärung eines solchen Falles – genau genommen nur aus einer Eingebung heraus – hatte Shaw ursprünglich auf die Idee gebracht, eine Laufbahn als Prämienjäger einzuschlagen.) Hin und wieder jedoch ließ auch ein ehemaliger Partner das Objekt seiner Begierde verschwinden.
Colter Shaw hatte gelernt, dass Liebe ein unerschöpflicher Quell des Wahnsinns sein konnte.
Er setzte die Wahrscheinlichkeit von Kyles Schuld bei zehn Prozent an. Der Junge mochte von Sophie besessen gewesen sein, aber er wirkte auch zu normal und rührselig, um so durchzudrehen. Sein Drogenkonsum konnte aber eine Rolle spielen. Hatte Kyle versehentlich ihr Leben in Gefahr gebracht, indem er sie einem Dealer vorstellte, der nicht wiedererkannt werden wollte? War sie zur Zeugin eines Mordes oder anderen Verbrechens geworden, womöglich ohne es überhaupt zu bemerken?
Er gab dieser Hypothese zwanzig Prozent.