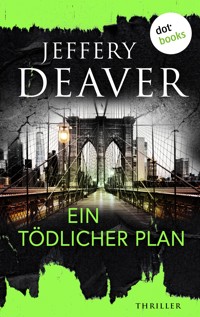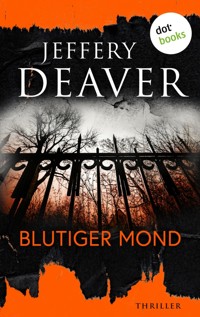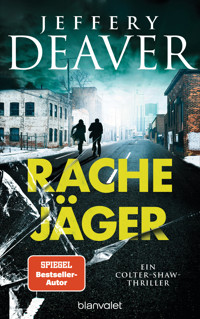10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Colter Shaw
- Sprache: Deutsch
Ihm bleiben nur 48 Stunden, um das Leben einer ganzen Familie zu retten – der hochspannende dritte Band der packenden Thrillerreihe von SPIEGEL-Bestsellerautor Jeffery Deaver!
In San Francisco ist Colter Shaw in einer ganz persönlichen Mission unterwegs. Er setzt die letzte Ermittlung seines ermordeten Vaters fort. Dieser sammelte Beweise gegen die mysteriöse Firma BlackBridge, die als »Problemlöser« ihrer Kunden agiert und für Hunderte von Drogentoten verantwortlich ist. Den rätselhaften Hinweisen folgend, die sein Vater hinterlassen hat, findet sich Shaw in einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel wieder. Das Unternehmen hat Killer auf ihn angesetzt und ihm läuft die Zeit davon. Denn nur wenn er die Machenschaften der Firma auffliegen lassen kann, wird er auch den Mord an einer ganzen Familie verhindern können, die in achtundvierzig Stunden sterben soll. Unerwartete Hilfe bekommt er dabei von jemandem aus seiner Vergangenheit ...
Verpassen Sie nicht die anderen eigenständig lesbaren Colter-Shaw-Fälle wie zum Beispiel »Der böse Hirte«.
Kennen Sie auch schon die Lincoln-Rhyme-Thriller? Ein Muss für alle Deaver-Fans!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
In San Francisco ist Colter Shaw in einer ganz persönlichen Mission unterwegs. Er setzt die letzte Ermittlung seines ermordeten Vaters fort. Dieser sammelte Beweise gegen die mysteriöse Firma BlackBridge, die als »Problemlöser« ihrer Kunden agiert und für Hunderte von Drogentoten verantwortlich ist. Den rätselhaften Hinweisen folgend, die sein Vater hinterlassen hat, findet sich Shaw in einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel wieder. Das Unternehmen hat Killer auf ihn angesetzt, und ihm läuft die Zeit davon. Denn nur wenn er die Machenschaften der Firma auffliegen lassen kann, wird er auch den Mord an einer ganzen Familie verhindern können, die in achtundvierzig Stunden sterben soll. Unerwartete Hilfe bekommt er dabei von jemandem aus seiner Vergangenheit …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.Weitere Informationen unter: www.jeffery-deaver.de
Von Jeffery Deaver bereits erschienen
Der Knochenjäger · Letzter Tanz · Der Insektensammler · Das Gesicht des Drachen · Der faule Henker · Das Teufelsspiel · Der gehetzte Uhrmacher · Der Täuscher · Opferlämmer · Todeszimmer · Der Giftzeichner · Der talentierte Mörder · Der Komponist · Der Todbringer · Der Todesspieler · Der böse Hirte
JEFFERY DEAVER
VATERMÖRDER
Thriller
Deutsch von Thomas Haufschild
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »The Final Twist« bei G. P. Putnam’s Son, an imprint of Penguin Random House LLC, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2021 by Gunner Publications, LLC
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Rainer Schöttle
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
JaB · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30652-6V001
www.blanvalet.de
Für die Sonntagnachmittagstruppe:Joan, Cleve, Kay, Ralph, Gail
Für die Mächtigen sind Verbrechen das, was andere begehen.
Noam Chomsky
DAS STAHLWERK
Colter Shaw zieht seine Waffe und steigt leise die Stufen hinab. In dem weitläufigen Untergeschoss des alten Gebäudes riecht es stechend nach Schimmel und Heizöl.
Ein Keller, erinnert Shaw sich unwillkürlich an das letzte Mal. Und daran, was er dort erlebt hat.
Über ihm hämmert Musik, tanzen Leute. Der Bass ist schnell wie der Herzschlag eines Sprinters. Aber da oben und hier unten sind getrennte Universen.
Am Fuß der Treppe sieht Shaw sich um. Orientiert sich … wie immer, ganz automatisch. Der Keller ist halb ausgebaut. Rechts der Stufen befindet sich eine große leere Fläche. Links zweigen Räume von einem etwa fünfzehn Meter langen Korridor ab.
Auf der Freifläche scheint es nichts zu geben, das ihm gefährlich werden oder weiterhelfen könnte. Er wendet sich nach links und steuert den Gang an, vorbei an den Boilern und an Vorräten: großen Packungen Toilettenpapier, Chili-Konserven, Wasser in PET-Flaschen, Papierhandtüchern, Papptellern, Plastikbesteck. Einer Großpackung Neun-Millimeter-Munition.
Shaw dringt langsam in den Korridor vor. Beim ersten Raum rechts steht die Tür offen. Kaltes Deckenlicht fällt heraus, aber auch ein wärmeres Flackern. Er wagt einen kurzen Blick um die Ecke. Ein Büro. Aktenschränke, Computer, ein Drucker.
An einem Tisch sitzen zwei stämmige Kerle und schauen sich auf einem Monitor ein Baseballspiel an. Einer der beiden lehnt sich soeben zurück und nimmt die letzte Flasche Bier aus dem Sechserträger auf einem dritten Stuhl. Shaw weiß, dass sie bewaffnet sind, denn er kennt ihre Branche. Solche Männer sind immer bewaffnet.
Shaw ist nicht unsichtbar, aber der Gang ist dunkel, ohne Deckenleuchten, und Shaw trägt eine schwarze Jacke, schwarze Jeans sowie – da er mit dem Motorrad hier ist – schwarze Stiefel. Die sind zwar nicht so leise wie die Ecco-Schuhe, die er normalerweise bevorzugt, aber der Lärm von der Tanzfläche im Erdgeschoss übertönt Shaws Schritte. Vermutlich könnte man hier sogar unbemerkt einen Schuss abfeuern.
Die Männer sehen sich das Spiel an und plaudern und reißen Witze. Es gibt fünf leere Bierflaschen. Das könnte sich als hilfreich erweisen: der getrunkene Alkohol. Sein Einfluss auf die Reaktionszeit. Und auf die Zielsicherheit.
Falls es so weit kommt.
Shaw überlegt: Soll ich sie jetzt entwaffnen?
Nein. Das könnte in die Hose gehen. Die Erfolgschance liegt bei höchstens fünfundsiebzig Prozent.
Er hört die Stimme seines Vaters: Sei niemals brachial, wenn es auch dezent geht.
Außerdem ist er sich nicht sicher, was ihn hier erwartet. Falls gar nichts, schleicht er sich einfach auf demselben Weg wieder hinaus, ohne dass die Männer etwas mitbekommen.
Er huscht ungesehen an der Türöffnung vorbei und hält inne, bis seine Augen sich nach dem hell erleuchteten Büro erneut an die Dunkelheit gewöhnt haben.
Dann geht er weiter und überprüft den Rest. Die meisten Türen stehen offen, in fast allen Räumen ist es finster.
Die Musik und das Stampfen der Tänzer sind ein zweischneidiges Schwert. Niemand kann Shaw kommen hören, aber er selbst ist ebenso taub. Womöglich hat jemand ihn bereits entdeckt und lauert ihm nun mit gezogener Waffe in einem der leeren Räume auf.
Zehn Meter den Flur entlang, dann zwölf.
Leerer Raum, leerer Raum. Shaw nähert sich dem Ende des Korridors, wo ein zweiter Gang nach rechts abzweigt. Es gibt also weitere Bereiche zu kontrollieren. Wie viele wohl?
Der letzte Raum. Die Tür steht nicht offen. Ist sogar abgeschlossen.
Shaw nimmt sein Taschenmesser und drückt mit der Spitze der Klinge den Riegel ein kleines Stück aus der Öffnung im Schließblech zurück in Richtung Schloss. Dann zieht er sehr fest am Knauf, damit der Riegel nicht wieder zurückschnellt, und setzt mit der Messerspitze nach. Nach einem Dutzend Wiederholungen ist die Tür offen. Shaw steckt das Messer ein, zieht die Pistole und hebt sie schussbereit, den Abzugsfinger seitlich am Schlitten.
Vorwärts.
Die Frau ist Anfang zwanzig und hat ihr Haar zu einem komplizierten Zopf geflochten. Sie trägt Jeans und ein hellgraues Sweatshirt. Sie sieht die Waffe und atmet tief ein, um zu schreien. Shaw hebt eine Hand und steckt sofort die Pistole ins Holster. »Keine Sorge. Es wird alles gut. Ich hole Sie hier raus. Wie heißen Sie?«
Einen Moment lang bleibt sie stumm. Dann: »Nita.«
»Ich bin Colter. Haben Sie keine Angst.«
Es ist dreckig hier. Ungegessenes Chili auf einem Pappteller. Eine halb ausgetrunkene Flasche Wasser. Ein Eimer als Toilette. Die Frau ist nicht gefesselt, aber angeleint. Um ein Wasser- oder Abflussrohr liegt ein Fahrradschloss, an dem wiederum ein Knöchel der Frau mit einem Kabelbinder befestigt wurde. Shaw schaltet die Deckenlampe aus. Es ist auch so hell genug.
Er schaut zurück in den Korridor. Das Flackern des Bildschirms dauert an, das Baseballspiel läuft weiter. Wie lange noch? Wäre wichtig zu wissen.
»Sind Sie verletzt?«
Sie schüttelt den Kopf.
Er nimmt sein Messer und klappt es mit einem Klicken auf. Dann sägt er sich durch die Plastikfessel und hilft der Frau beim Aufstehen. Sie ist wacklig auf den Beinen.
»Können Sie gehen?«
Ein Nicken. Sie zittert und weint. »Ich will nach Hause.«
Shaw muss erneut an das Spiel Stein, Schere, Papier denken, wie gerade mal zehn Minuten zuvor. Er wünscht, er hätte sich mehr angestrengt, viel mehr.
Sie treten hinaus auf den Korridor. In dem Moment denkt Shaw: der dritte Stuhl.
Oh, verdammt.
Der Sechserträger braucht keinen eigenen Sitzplatz. Es gibt bei dem Spiel noch einen weiteren Zuschauer.
Und da kommt der dritte Mann auch schon die Treppe herunter und bringt eine neue Packung Budweiser. Als er den Betonboden erreicht, blickt er auf und entdeckt Shaw und Nita. Er lässt das Bier fallen. Mindestens eine der Flaschen zerbricht. »He!«, ruft er. Und greift an die Hüfte.
Das Flackern im Baseballzimmer hört auf.
ERSTER TEIL 24. Juni DIE MISSION
Zeit bis zum Tod der Familie:52 Stunden
1
Das Versteck.
Endlich.
Colter Shaws Reise zu diesem kornblumenblauen Haus im viktorianischen Stil an der schmucklosen Alvarez Street im Mission District von San Francisco hatte Wochen gedauert. Vom Silicon Valley über die ostkalifornische Sierra Nevada nach Washington State. Genau genommen dauert sie schon fast mein ganzes Leben, dachte Shaw nun, als er von der Sitzbank seiner Yamaha aus an dem Gebäude emporblickte.
Wie so oft, wenn man ein lange ersehntes Ziel erreicht, macht es einen schlichten ersten Eindruck, ganz gewöhnlich, unscheinbar. Doch falls es enthielt, was Shaw sich erhoffte, würde es das genaue Gegenteil sein: eine Fundgrube an Informationen, die Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Leben zu retten vermochten.
Als Sohn eines Überlebensfachmanns stellte Shaw sich zudem eine weitere Frage: Wie sicher war dieses Versteck denn nun genau?
Von hier unten wirkte es verlassen und dunkel. Shaw ließ die Kupplung kommen und fuhr in die Gasse hinter dem Haus, wo er abermals innehielt. Ein gotischer schmiedeeiserner Zaun umschloss einen zugewucherten Garten. Auch von hier aus sah man kein Licht, keinen Hinweis auf einen Bewohner, keine Bewegung. Shaw gab Gas und kehrte zur Vorderseite zurück. Er bremste und schob die Maschine im Leerlauf auf den Bürgersteig.
Dann nahm er seinen schweren Rucksack, kettete das Motorrad samt Helm an und stiefelte durch den einen Meter breiten Grünstreifen vor dem Gebäude. Hinter einem Buchsbaumstrauch fand er die Schutzschalter des Stromkreises. Falls es im Haus eine Bombe gab, was unwahrscheinlich war, würde sie vermutlich fest verdrahtet sein; ob nun bei Telefonen, Computern oder improvisierten Sprengvorrichtungen, es war stets heikel, sich auf Batterien zu verlassen.
Mit Hilfe der Schlüssel, die sein Vater ihm vermacht hatte, entriegelte Shaw nun die Tür und stieß sie auf, die andere Hand in der Nähe seiner Waffe. Ihn erwarteten aber nur Stille und der Lavendelduft eines Lufterfrischers.
Bevor er nach den Dokumenten suchte, die sein Vater hier hoffentlich hinterlassen hatte, musste er das Haus einmal komplett kontrollieren.
Kein Hinweis auf eine Bedrohung ist nicht dasselbe wie keine Gefahr.
Mit dem Erdgeschoss fing Shaw an. Auf das Wohnzimmer folgte ein Salon, von dem aus eine Treppe nach oben führte. Dahinter lagen ein Esszimmer und schließlich die Küche mit einer verstärkten, fensterlosen Tür zur Gasse. Eine zweite Tür in der Küche führte in einen Keller – der in weiten Teilen Kaliforniens eigentlich eher unüblich war. Die wenigen Einrichtungsgegenstände waren funktional und nicht zusammenpassend. Die Farbe der Wände erinnerte an alte Knochen, und die Vorhänge waren in der Sonne stellenweise ausgebleicht, sodass sie nun unbeabsichtigte Batikmuster trugen.
Shaw ließ sich Zeit und inspizierte jeden Raum auf dieser Etage und in den beiden Obergeschossen. Nichts deutete auf aktuelle Bewohner hin, aber auf einer Matratze im ersten Stock lag ordentlich gefaltetes Bettzeug.
Als Letztes nahm er sich den Keller vor.
Shaw schaltete seine Taschenlampe mit dem blendend hellen Halogenstrahl ein, stieg die Stufen hinab und stellte fest, dass der Raum weitgehend leer war. Ein paar alte Farbdosen, ein zerbrochener Tisch. Am hinteren Ende gab es einen Kohlenverschlag mit einem kleinen Haufen schwarz glitzernder Brocken darin. Shaw musste unwillkürlich lächeln.
Stets auf alles vorbereitet, nicht wahr, Ashton?
Da entdeckte er im Halbdunkel drei Kabel, die von der Decke baumelten. Eines, neben der Treppe, endete in einer Fassung mit einer kleinen Glühlampe. An den beiden Leitungen in der Mitte und am Ende des Kellers gab es keine Lichtquellen mehr. Die blanken Kabelenden waren mit Isolierband umwickelt.
Shaw kannte den Grund für diese Maßnahme: Man sollte den hinteren Teil des Raumes nicht gut einsehen können.
Er richtete seine Taschenlampe auf die Rückwand und kam näher.
Alles klar, Ash.
Der gesamte Keller war vom Boden bis zur Decke mit großen, mattschwarz gestrichenen Sperrholzplatten ausgekleidet. Doch bei genauerem Hinsehen unterschieden die Fugen um eine der Platten sich von den anderen. Es handelte sich um eine Geheimtür vor einem versteckten Raum. Shaw zog sein Taschenmesser und klappte es auf. Nachdem er die Wand noch etwas länger in Augenschein genommen hatte, entdeckte er in Bodennähe einen Schlitz. Er schob die Klinge hinein und hörte ein Klicken. Die Tür sprang ein kleines Stück auf. Shaw verstaute das Messer, zog seine Pistole und leuchtete geduckt ins Innere. Dabei reckte er die Taschenlampe hoch und nach links, um das Feuer eines etwaigen bewaffneten Gegners auf sie zu ziehen.
Er tastete nach Stolperdrähten. Negativ.
Mit einem Fuß zog er die Tür langsam auf.
Sie hatte sich höchstens einen halben Meter bewegt, als mit gleißendem Blitz und ohrenbetäubendem Knall ein Sprengsatz explodierte. Ein Splitter traf Shaw mitten in die Brust.
2
Die größte Gefahr bei Detonationen ist üblicherweise nicht der Tod.
Die meisten Bombenopfer sind vielmehr blind, taub und/oder verstümmelt. Moderne Sprengstoffe dehnen sich mit mehr als neuntausend Metern pro Sekunde aus, das heißt, die Schockwelle legt die Strecke vom Meeresspiegel bis zum Gipfel des Mount Everest in der Dauer eines Räusperns zurück.
Shaw lag auf dem Boden, konnte nichts sehen, konnte nichts hören, hustete und hatte Schmerzen. Er berührte die Stelle, an der der Splitter ihn erwischt hatte. Autsch. Aber die Wunde blutete nicht. Aus irgendeinem Grund war die Haut nicht durchdrungen worden. Shaw unterzog auch den restlichen Körper einer schnellen Untersuchung. Seine Arme, Hände und Beine funktionierten noch.
Als Nächstes musste er seine Waffe wiederfinden. Eine Bombe bedeutet häufig nur die Einleitung eines Angriffs.
Shaw tastete den feuchten Beton auf Knien in einem Kreismuster ab, bis er auf die Pistole stieß.
Er kniff die Augen zusammen, konnte aber weiterhin nichts erkennen. Man kann sein Sehvermögen nicht erzwingen.
Es blieb keine Zeit für Panik, keine Zeit für Gedanken an die Konsequenzen, die es für sein Leben haben würde, falls er dauerhaft blind oder taub blieb. Felsklettern, Motorrad fahren, Reisen durch das Land – alles wäre infrage gestellt, aber jetzt war nicht der richtige Moment für solche Sorgen.
Wie aber sollte er bemerken, aus welcher Richtung der Angriff erfolgte? Geduckt begab er sich zu dem Kohlenverschlag, der zumindest etwas Deckung bot. Shaw versuchte zu lauschen, konnte aber nur ein tinnitusähnliches Klingeln hören.
Nach fünf verzweifelten Minuten schälte sich am anderen Ende des Kellers ein schwaches Schimmern aus der Finsternis. Tageslicht aus der Küche im Erdgeschoss.
Demnach war er nicht komplett erblindet, sondern durch den Blitz der Explosion nur vorübergehend geblendet worden. Schließlich konnte er den Lichtstrahl seiner Taschenlampe erkennen. Sie lag in drei Metern Entfernung. Shaw hob sie auf und leuchtete den Keller und dann den Raum hinter der Geheimtür ab.
Keine Angreifer.
Er steckte die Waffe ein und schnippte neben jedem Ohr einmal mit den Fingern. Auch sein Gehör kehrte zurück.
Dann bewertete er die Lage.
Was war gerade passiert?
Falls der Bombenleger den Tod des Eindringlings gewollt hätte, wäre das leicht zu bewerkstelligen gewesen. Shaw richtete die Lampe auf die Türöffnung und fand die qualmenden Reste aus grauem Metall. Es handelte sich um eine große Blendgranate – die zwar sehr laut und strahlend hell detonierte, aber keine tödlichen Fragmente verschleuderte; sie sollte als Warnung dienen.
Shaw versuchte zu begreifen, wieso er die Granate übersehen hatte. Ah, interessant. Sie war als Projektil von einem Regal in der Nähe der Geheimtür gestartet worden, um nach etwa einer halben Sekunde zu explodieren. Ein Teil des Gehäuses hatte ihn an der Brust getroffen. Als Auslöser der Abschussvorrichtung musste ein Bewegungssensor oder Näherungsschalter gedient haben. Shaw hatte noch nie von einem solchen Mechanismus gehört.
Dann suchte er den Raum gründlich nach weiteren Fallen ab, fand aber keine.
Wer war dafür verantwortlich? Sein Vater und dessen Kollegen hatten wahrscheinlich den versteckten Raum geschaffen, würden aber schwerlich die Granate installiert haben. Ashton Shaw hatte nie mit Sprengstoff gearbeitet. Ohne entsprechende Lizenz war der Besitz illegal, und Shaws Vater hatte nicht gegen Gesetze verstoßen, ungeachtet aller Survival-Begeisterung und seiner Skepsis gegenüber der Obrigkeit.
Räume den Behörden niemals eine so umfassende Kontrolle über dich ein.
Dann fand Shaw die Bestätigung, dass sein Vater nichts mit der Falle zu tun hatte. Als er die Vorrichtung im grellen Licht der Taschenlampe genauer inspizierte, erkannte er, dass sie aus Militärbeständen stammte, mit einem Herstellungsdatum aus dem letzten Jahr.
Shaw schaltete eine Deckenleuchte ein und steckte die Taschenlampe weg. In der Mitte des sechs mal sechs Meter messenden Raumes stand ein verschrammter Arbeitstisch, daneben ein alter hölzerner Stuhl. Die Regale waren überwiegend leer, abgesehen von einigen Unterlagen und Kleidungsstücken. An der Wand lehnten mehrere Dokumentenstapel. In der Ecke lag eine große olivfarbene Reisetasche.
Auch auf dem Tisch häuften sich Papiere.
War er das? Der versteckte Schatz, der mehrere Leben gekostet hatte – auch das seines Vaters?
Shaw ging auf die andere Seite des Tisches, um die Tür im Blick zu behalten. Dann beugte er sich vor und suchte nach einer Antwort auf seine Frage.
3
Colter Shaw war überhaupt nur hier, weil er auf dem Anwesen seiner Familie in den Gebirgsausläufern des östlichen Kaliforniens eine Entdeckung gemacht hatte.
Sein Vater war dort auf dem hohen, abgelegenen Echo Ridge ums Leben gekommen und hatte Jahre zuvor ganz in der Nähe einen Brief deponiert.
Einen Brief, der Shaws Leben verändern würde.
Darin führte Ashton aus, er habe während seiner Jahre als Professor und Amateurhistoriker immer mehr Misstrauen gegenüber der Macht großer Konzerne, Institutionen, Politiker und wohlhabender Personen entwickelt, »die in der Grauzone zwischen Legalität und Illegalität, zwischen Demokratie und Diktatur gedeihen«. Er schloss sich mit einigen Freunden und Kollegen zusammen, um gegen diese Art der Korruption anzugehen und sie publik zu machen.
Nach einer Weile stieß die Gruppe auf BlackBridge Corporate Solutions, eine Firma aus der Schattenwelt der Wirtschaftsspionage. Sie steckte hinter zahlreichen fragwürdigen Machenschaften, aber am verwerflichsten fanden Ashton und seine Kollegen den »urbanen Image-Plan«, kurz »UIP«. Auf den ersten Blick schienen Bauunternehmen mit Hilfe dieses Plans lediglich nach geeigneten Grundstücken zu suchen. Aber BlackBridge ging noch einen Schritt weiter. Gemeinsam mit einheimischen Kriminellen überschwemmte die Firma die betreffenden Stadtviertel mit nahezu kostenlosen Opioiden, Fentanyl und Meth. Die Zahl der Süchtigen explodierte, ebenso die Kriminalitätsrate. In der Folge sank der Wert der dortigen Immobilien immer weiter. Am Ende konnten die Bauunternehmen die Objekte in großem Stil und zu Spottpreisen aufkaufen.
Mit der gleichen Taktik wurde BlackBridge auch für Klienten aus der Politik tätig, für Unterstützungskomitees, Lobbyisten oder direkt für die Kandidaten. Eine Rauschgiftschwemme führte zum Wegzug vieler Anwohner und damit zu einem neuen Zuschnitt der Wahlbezirke, basierend auf der Bevölkerungszahl. Der UIP etablierte gewissermaßen das Drogenbriefchen als inoffiziellen Wahlzettel.
Die Angelegenheit erhielt eine persönliche Dimension, als Todd Zaleski, ein Freund und ehemaliger Student von Ashton Shaw und mittlerweile im Stadtrat von San Francisco tätig, sich für den UIP zu interessieren begann. Wenig später wurden er und seine Frau ermordet aufgefunden. Beide waren aus nächster Nähe erschossen worden, vermeintlich bei einem Raubüberfall, aber Ashton wusste es besser.
Er und seine Kollegen suchten nach Beweisen gegen BlackBridge, um diese dann den Strafverfolgungsbehörden vorlegen zu können. Fast alle Angestellten der Firma weigerten sich, mit ihnen zu reden, doch Ashton hörte von einem früheren Mitarbeiter, dem der UIP zu weit gegangen war. Der Mann hieß Amos Gahl, hatte für BlackBridge als Rechercheur gearbeitet, interne Dokumente entwendet und diese angeblich in oder bei San Francisco versteckt. Kurz darauf war auch Gahl unter dubiosen Umständen ums Leben gekommen – bei einem Autounfall.
Ashton hatte in seinem Brief geschrieben: Ich nahm mir vor, das von Gahl versteckte Material zu finden.
Dann erfuhr BlackBridge von Ashton und seinen Mitstreitern. Zwei von ihnen starben durch rätselhafte Zufälle, und die anderen zogen sich aus Angst um ihr Leben zurück. Schon bald war nur noch Ashton damit beschäftigt, die Firma zu Fall zu bringen, die seinen Studenten und so viele andere getötet hatte – in San Francisco und mutmaßlich zahllosen weiteren Städten.
Am Ende fand der sechzehnjährige Colter Shaw in einer kalten Oktobernacht den Leichnam seines Vaters beim trostlosen Echo Ridge.
Seit damals hatte er einige seiner Gegenspieler identifizieren können:
Ian Helms, Gründer und Chef von BlackBridge. Der heutige Mittfünfziger mit dem guten Aussehen eines Filmstars hatte in der Vergangenheit für das Militär und den Geheimdienst gearbeitet und sich dann als Lobbyist auf das politische Parkett gewagt.
Ebbitt Droon, Handlanger der Firma. Ein Mann fürs Grobe, mit drahtiger Statur und Rattengesicht. Nach einigen persönlichen Begegnungen, bei denen unter anderem ein Molotowcocktail in Shaws Richtung geflogen war, hielt er Droon für einen geistesgestörten Sadisten.
Irena Braxton, die im Auftrag von BlackBridge damals Ashton aufhalten sollte – und nun seinen Sohn. Über sie hatte Ashton geschrieben:
Sie mag wie eine gütige Großmutter aussehen, ist aber absolut skrupellos und schreckt nicht davor zurück, zur Erreichung ihrer Ziele Gewalttaten anzuordnen.
Offiziell war sie eine Bereichsleiterin für Außenbeziehungen der Firma, was so ungefähr der schönfärberischste Blödsinn sein durfte, den Colter je gehört hatte.
Ashton hatte seinen Brief mit den folgenden Ausführungen beendet:
Kommen wir nun auf Sie zu sprechen.
Sie sind offensichtlich den von mir hinterlassenen Brotkrumen zum Echo Ridge gefolgt und kennen nun die ganze Geschichte.
Ich kann Sie nicht guten Gewissens darum bitten, diese gefährliche Aufgabe zu übernehmen. Kein vernünftig denkender Mensch würde das tun. Doch falls Sie mit dem Gedanken spielen, möchte ich anmerken, dass die Fortführung meiner Suche all jenen Gerechtigkeit verschaffen würde, die gestorben sind oder deren Leben durch BlackBridge und ihre Kunden auf den Kopf gestellt wurde. Und Sie würden Tausenden zukünftiger Opfer ein vergleichbares Schicksal ersparen.
Auf der beiliegenden Karte sind die Orte markiert, die als Versteck für Gahls Dokumente in Betracht kommen oder zumindest darauf verweisen könnten. Sobald ich dieses Schreiben samt den zugehörigen Anlagen deponiert habe, werde ich nach San Francisco zurückkehren und hoffentlich weitere Anhaltspunkte in Erfahrung bringen. Näheres findet sich in der Alvarez Street 618 in San Francisco.
Lassen Sie mich mit einer Warnung schließen:Wiegen Sie sich niemals in Sicherheit.
A. S.
4
Colter Shaw hatte sich vorgenommen, die auf der Karte seines Vaters markierten Orte – insgesamt achtzehn an der Zahl – zu überprüfen und das von Amos Gahl versteckte Material zu finden.
Wie er nun feststellte, hatten die Dokumente hier in dem versteckten Kellerraum allerdings nichts mit BlackBridge zu tun, sondern mit technischen Konstruktionen und Transportfragen. Einige waren in Englisch abgefasst, andere in Russisch oder eventuell auch einer anderen Sprache mit kyrillischen Buchstaben. Darüber hinaus fanden sich Texte in Spanisch, das Shaw beherrschte, und auch in ihnen ging es um Fracht und Transport. Ein paar der Seiten waren chinesisch beschriftet.
Irgendwer nutzte diesen Geheimraum als Operationsbasis. Einer der ursprünglichen Mitstreiter seines Vaters? Oder jemand aus der nachfolgenden Generation, so wie Shaw? Ein Mann oder eine Frau? Jung? Schon älter? Die Daten auf manchen der Schriftstücke lagen noch nicht weit zurück. Shaw ging zu der Reisetasche, untersuchte sie auf etwaige Fallen und öffnete den Reißverschluss. Der Inhalt beantwortete die Frage nach dem Geschlecht. Die Kleidungsstücke waren die eines Mannes von überdurchschnittlicher Statur. T-Shirts, Arbeitshemden, Cargohosen, Jeans, Pullover, Wollsocken, Baseballmützen, Handschuhe, Freizeitjacken. Allesamt schwarz, dunkelgrau oder dunkelgrün.
Dann sah Shaw im Schatten der hinteren Wand einen weiteren Stapel Papiere. Ah, die stammten von seinem Vater. Ashton hatte Shaw die Kunst der Kalligrafie gelehrt, und die Handschrift des Vaters war sogar noch eleganter – und kleiner – als die des Sohnes.
Der Anblick ließ Shaws Herz ein wenig schneller schlagen.
Er trug den Stapel nach oben und legte ihn auf dem klapprigen Küchentisch ab. Dann nahm er auf einem ebenfalls altersschwachen Stuhl Platz und fing an zu lesen. Er stieß auf weitere Ausführungen über den UIP und Verweise auf andere Machenschaften der Firma: windige Gutachten zur Erdbebensicherheit von Hochhäusern (von denen einige wirklich direkt auf der San-Andreas-Verwerfung standen), Schmiergeldzahlungen für öffentliche Aufträge, fingierte Baubestimmungen und Flächennutzungspläne, Börsenmanipulationen und Geldwäsche.
In einem Zeitungsartikel über den Tod eines kalifornischen Abgeordneten standen zwei Fragezeichen neben dem Foto des Opfers. Der Mann war auf dem Weg zu einem Treffen mit dem Generalbundesanwalt durch einen Autounfall gestorben. Bei dem Fahrzeugbrand waren auch alle von ihm mitgeführten Dokumente vernichtet worden. Trotz einiger Zweifel am Hergang des Geschehens wurde letztlich keine polizeiliche Untersuchung eingeleitet.
Shaw fand auch einige Artikel über Todd Zaleski, den ehemaligen Studenten seines Vaters und späteren Stadtrat, der nach Ashtons Auffassung von BlackBridge ermordet worden war.
Alles hier deutete auf die Schuld der Firma hin. Doch es waren keine hinreichenden Beweise – jedenfalls nicht aus Sicht eines Staatsanwalts. Shaw kannte sich im Strafrecht ganz gut aus. Nach dem College hatte er in einer Anwaltskanzlei hospitiert und in Erwägung gezogen, ein Jurastudium zu beginnen, vor allem inspiriert durch einen Professor namens Sharphorn, der an der Universität von Michigan lehrte. Letzten Endes hatte der ewig rastlose Shaw sich dann doch gegen einen Bürojob entschieden, wenngleich er an juristischen Fragen interessiert blieb und entsprechende Fachliteratur las, was sich oft auch als hilfreich bei seiner Prämienjagd erwies.
Nein, keiner der Funde seines Vaters hätte einen Ankläger überzeugt.
Dann stieß Shaw auf eine an Ashton gerichtete Notiz, mutmaßlich verfasst von einem Kollegen von Amos Gahl. Es handelte sich um ein kleines, vielfach gefaltetes Stück Papier. Wahrscheinlich war es in einem toten Briefkasten hinterlegt worden, zum Beispiel unter einer Parkbank oder in einem Mauerspalt. So wurden in Spionagekreisen seit jeher Nachrichten ausgetauscht, auch heutzutage noch, weil eine elektronische Kommunikation jederzeit abgefangen werden konnte.
Amos ist tot. Es geht um eine BlackBridge-Kuriertasche. Keine Ahnung, wo er sie gelassen hat. Dies ist meine letzte Nachricht. Es ist zu riskant. Viel Glück.
Das fragliche Beweismaterial befand sich demnach in einer Tasche der Firma und war an einem der achtzehn Orte versteckt, die Ashton entsprechend markiert hatte. Die Aufgabe war mühselig, aber es führte kein Weg daran vorbei. Shaw würde die Punkte nacheinander abklappern müssen, bis er die Kuriertasche fand – oder er am Ende nirgendwo fündig geworden war.
Kurz darauf erfuhr er jedoch, dass die achtzehn Ausflüge ihm wohl erspart bleiben würden. Er brauchte sogar keinen einzigen der Orte aufzusuchen.
Im Stapel vor ihm tauchte nämlich eine Straßenkarte auf, die jener entsprach, die Shaw am Echo Ridge gefunden hatte – mit einem Unterschied: Alle achtzehn Orte waren jeweils mit einem großen roten X ausgestrichen.
Nachdem Ashton seinen Umschlag auf dem Gelände des Anwesens deponiert hatte, war er also hierher zurückgekehrt, um die Ankündigung aus seinem Brief umzusetzen: die Orte selbst zu überprüfen, offenbar vollständig und ohne Erfolg.
Shaw seufzte. Dies bedeutete, dass die für BlackBridge potenziell vernichtenden Beweise irgendwo in der gesamten San Francisco Bay Area liegen konnten, die viele Tausend Quadratkilometer umfasste.
Vielleicht hatte Ashton ja andere mögliche Verstecke ermittelt. Shaw wollte die Unterlagen daraufhin durchgehen, doch er wurde jäh unterbrochen.
Auf der Alvarez Street, in unmittelbarer Nähe des Hauses, rief eine Frau: »Hilfe! Bitte! So hilf mir doch jemand!«
5
Vom Erkerfenster aus sah Shaw zwei Leute aneinander zerren, genau vor dem Tor des Maschendrahtzauns eines verwahrlosten Nachbargrundstücks. Das Haus dort war vor Jahren teilweise niedergebrannt.
Er schätzte die dunkelhaarige Frau auf Mitte dreißig. Sie trug eine ausgeblichene Jeans, ein T-Shirt, eine abgewetzte dunkelblaue Lederjacke und Laufschuhe. Ihr weißer Ohrhörer baumelte an seinem Kabel. Die Frau wandte sich panisch um, während ein untersetzter Mann in abgetragener sandfarbener Tarnjacke und Cargohose ihren Unterarm gepackt hielt. Der Kerl war ein Weißer und starrte vor Dreck. Ein Obdachloser, vermutete Shaw, womöglich schizophren oder mit Borderline-Störung, wie so viele seiner Leidensgenossen. In seiner anderen Hand hielt der Mann ein Teppichmesser, und er zog die Frau auf das Tor zu, anscheinend mit beträchtlicher Kraft. Das war nicht ungewöhnlich, denn das Leben auf der Straße erforderte hohe Belastbarkeit und eine ganz eigene Art von Überlebenstechnik. Sogar aus dieser Entfernung konnte Shaw die dicken Venen erkennen, die sich auf Händen und Stirn des Mannes abzeichneten.
Er eilte zur Vordertür hinaus, die Betonstufen hinunter und auf die beiden Personen zu. Mit verzweifelter Miene und weit aufgerissenen Augen sah die Frau ihm entgegen. »Bitte! Er tut mir weh!«
Der Blick des Angreifers richtete sich auf Shaw, trotzig und starrköpfig. Mit seiner gedrungenen und breiten Statur hätte er ein Geschöpf in einem Fantasy- oder Märchenfilm spielen können. Und seine Hände wirkten tatsächlich sehr kräftig.
»Na, du dürres Hemd, willst du den Helden spielen? Verpiss dich.«
Shaw kam näher.
Der Mann fuchtelte theatralisch mit dem Messer. »Glaubst du, ich mache Witze?«
Shaw kam näher.
Man sollte meinen, dem Kerl würden angesichts des Störers sämtliche fleischlichen Gelüste vergehen, doch er hielt die Frau unverwandt so fest gepackt, als wäre sie ein Homerun-Ball, den er im Baseballstadion gefangen hatte und nun keinesfalls einem anderen Fan zu überlassen gedachte. Ohne seinen Griff zu lockern, trat er Shaw entgegen.
Der noch näher kam.
»Herrje! Bist du taub, du Arsch?«
Auf dem Anwesen der Familie Shaw in der Sierra Nevada hatte Ashton bei der Ausbildung seiner Kinder in allgemeinen Überlebenstechniken viel Zeit auf Schusswaffen verwendet, jene zwiespältigen Erfindungen, die sowohl Segen als auch Fluch sein konnten. Dabei hatte er sich als eine seiner Grundregeln einen Gemeinplatz geborgt:
Ziehe niemals eine Waffe, wenn du sie nicht benutzen willst.
Shaw zog die Glock und richtete sie auf den Kopf des Angreifers.
Der Mann erstarrte.
Shaw nahm sich die Regel seines Vaters zu Herzen, so wie auch die meisten anderen der vielen Niemals-Leitsätze. Er war jedoch der Ansicht, dass das Wort benutzen einigen Spielraum für Interpretationen ließ. Und sein Ansatz war da weniger strikt als der von Ashton. In diesem Fall wollte er also nicht den Abzug betätigen, sondern seinem Gegenüber lediglich eine Heidenangst einjagen.
Es funktionierte.
»Oh … Nein, Mann … tu das nicht! Bitte! Ich wollte doch nicht … Ich stand hier bloß rum und hab sie um etwas Kleingeld gebeten. Weil ich seit einer Woche nichts gegessen hab. Da geht sie plötzlich auf mich los.«
Shaw sagte nichts. Er würde weder verhandeln noch sich auf Diskussionen einlassen. Stattdessen zielte er ungerührt weiter mit der Waffe auf das Gesicht des Kobolds, dessen fettige Langhaartracht nach Shaws Einschätzung so ungefähr 1975 aus der Mode gekommen sein durfte. Zum Glück.
Nach kurzem Überlegen ließ der Angreifer die Frau los. Sie entfernte sich ein Stück und lehnte sich schwer atmend gegen den Maschendrahtzaun. Man sah ihr den panischen Schrecken weiterhin an.
Das Feuer musste bestimmt fünf Jahre zurückliegen, doch in der schweren, feuchten Luft roch es auch jetzt noch nach verbranntem Holz.
Der Mann zog die Klinge des Teppichmessers ein und wollte es in die Tasche stecken.
»Nein. Fallen lassen.«
»Aber …«
»Fallen. Lassen.«
Das graue Werkzeug fiel klappernd auf den Kies des Bürgersteigs.
»Und nun verschwinde von hier.«
Der Mann hob beide Hände und wich zurück. Dann hielt er inne. Er neigte den Kopf, kniff die Augen zusammen und fragte mit einem Anflug von Hoffnung: »Hast du vielleicht einen Zwanziger für mich?«
Shaw verzog das Gesicht. Der Mann trollte sich.
Shaw steckte die Pistole ein und warf einen Blick in die Runde. Auf der Straße befand sich nur eine weitere Person – ein bärtiger Mann mit schenkellanger schwarzer Jacke, dunkler Hose und Wollmütze. Sein Rucksack trug das Logo der Oakland Athletics. Der Unbekannte war ein ganzes Stück entfernt und schaute in die andere Richtung. Falls er den Zwischenfall überhaupt bemerkt hatte, wollte er offenbar nichts damit zu tun haben. Er betrat nun ein Café, wie es sie hier in San Francisco mit seiner großen italienischstämmigen Gemeinde häufig gab.
»Mein Gott«, flüsterte die Frau. »Vielen Dank!« Sie war etwas kleiner als Shaws eins zweiundachtzig, aber nicht viel, mit athletischer Statur und straffen Schenkeln unter ihrer engen, auf alt getrimmten Jeans. Ihre Hüften waren schmal, die Arme lang. Auch auf ihren Handrücken zeichneten sich deutlich die Venen ab, genau wie bei ihrem Angreifer. Das braune Haar trug sie offen, und sie war ungeschminkt. Ihr Gesicht wirkte wettergegerbt, und eine Narbe verlief von ihrer Schläfe bis unter den Haaransatz.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sind Sie, äh, von der Polizei?« Dabei streifte ihr Blick die Waffe an seiner rechten Hüfte und richtete sich dann prüfend auf ihn. Sie war vorsichtig.
Mit seinem kurzen blonden Haar, dem muskulösen Körperbau und der wortkargen Art hätte man Colter Shaw leicht für einen Gesetzeshüter halten können, einen Bundesagenten oder Detective, der in komplexen Mordfällen ermittelte – oder gegen Terroristen. Die Frau würde vermutlich annehmen, dass er verdeckt arbeitete, denn immerhin war er auf seiner Yamaha und in Motorradkluft hier aufgetaucht: Lederjacke, dunkelblaues Hemd unter einem schwarzen Pullover, der die Waffe verbarg, Jeans und schwarze Stiefel.
»So eine Art Privatdetektiv.«
»Ich bin Tricia«, sagte sie.
Er nannte keinen Namen, weder echt noch falsch.
Sie schüttelte den Kopf, anscheinend über ihr eigenes Verhalten. »So was Blödes …«
»Suchen Sie sich einen besseren Dealer«, sagte Shaw. »Oder nehmen Sie am besten gar keine Drogen.« Dann zuckte er die Achseln. »Ich hab leicht reden.«
Ihre Lippen wurden schmal; sie senkte den Kopf. »Ich weiß. Ich versuch’s. Hab schon alle möglichen Maßnahmen hinter mir. Vielleicht ist das hier ja ein heilsamer Schock.« Sie lächelte matt. »Vielen Dank, wirklich.«
Und dann ging sie davon, in entgegengesetzter Richtung der Kreatur aus Mittelerde.
6
Shaw kehrte zum Haus zurück, wollte wieder in die Küche und zu den Unterlagen, kam aber nur bis zum Wohnzimmer.
Dort hielt er abrupt inne und starrte auf ein Regal, in dem die fünfzehn Zentimeter große Bronzestatuette eines Weißkopfseeadlers stand, die Schwingen ausgebreitet, die Fänge vorgereckt, die Raubvogelaugen nach unten gerichtet.
Shaw nahm sie, betrachtete sie von allen Seiten, hielt sie wieder aufrecht.
Auf den ersten Blick schien es sich um ein gefällig modelliertes Mitbringsel aus dem Andenkenladen eines Tierparks zu handeln, ein Vitrinenobjekt der gehobenen Preisklasse.
Doch für Colter Shaw verband sich wesentlich mehr damit.
Die Figur hatte vor vielen Jahren in seinem Zimmer des Anwesens gestanden, dann war sie plötzlich verschwunden. Er hatte sich hin und wieder gefragt, was wohl aus ihr geworden sein mochte. Hatte er sie womöglich selbst irgendwann weggeräumt, um Platz für handgefertigte Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu schaffen – oder für irgendein Fundstück seiner endlosen Wanderungen durch die umliegende Berglandschaft: Steine, Kiefernzapfen, Pfeilspitzen, Knochen?
Die Statuette nun hier wiederzufinden, machte ihn froh, denn endlich begriff er, was geschehen war. Sein Vater musste sie als Erinnerung an sein mittleres Kind hergebracht haben. Shaw war zudem erfreut, dass die Figur überhaupt noch existierte, denn wie er in ihren Besitz gelangt war, stellte einen wichtigen Aspekt seiner Kindheit dar. Das entsprechende Ereignis hatte letztlich sogar Auswirkungen auf sein heutiges Leben und seine Berufswahl gehabt.
Der Rastlose …
Doch diese Nachbildung eines Vogels in kraftvollem Flug rief auch traurige Jugenderinnerungen wach, vor allem an seinen älteren Bruder, Russell.
Vor vielen Jahren hatte Ashton Shaw aus einer Laune heraus beschlossen, dass die damals dreizehnjährige Dorion mitten in der Nacht und ungesichert eine fast fünfzig Meter hohe Felswand hinaufklettern sollte. Er nannte das eine Abschlussprüfung, und alle seine Kinder mussten sie absolvieren, wenn sie Teenager wurden.
Russell und Colter hatten die Tour bereits hinter sich, hielten diesen Initiationsritus aber mittlerweile für überflüssig, erst recht im Hinblick auf ihre Schwester. Dabei war Dorie mit Talkum und Seil genauso begabt und athletisch wie ihre Brüder und übertraf sogar Ashton selbst. Sie hatte das bereits mehrfach unter Beweis gestellt, auch bei Nacht.
Mit ihrem schon damals ausgeprägten Eigensinn beschloss Dorie, sie habe diese Prüfung nicht nötig … oder keine Lust darauf. »Nein, Ash«, verkündete sie unumwunden.
Doch ihr Vater gab nicht nach, ereiferte sich immer mehr und geriet regelrecht in Rage.
Dann griff der ältere Bruder Russell ein und stellte sich auf Dories Seite.
Die Situation eskalierte. Ein Messer kam ins Spiel – durch Ashton. Und Russell, der von seinem Vater entsprechend ausgebildet worden war, wollte seine Schwester beschützen und den aufgebrachten Mann entwaffnen.
Mary Dove, die auch als Psychiaterin ihres Mannes fungierte und seine Medikation überwachte, war zu der Zeit wegen eines familiären Notfalls nicht vor Ort, sodass kein anderer Erwachsener die Gemüter hätte beschwichtigen können.
Nach einem bis zum Zerreißen angespannten Moment gab der Vater letztlich doch klein bei und zog sich unter leisem Protestgemurmel in sein Schlafzimmer zurück.
Wenig später war Ashton dann bei dem Sturz am Echo Ridge gestorben.
Dies geschah unter fragwürdigen Umständen, und zu allem Überfluss erfuhr Shaw, dass sein Bruder im Hinblick auf seinen Verbleib am Todestag des Vaters gelogen hatte und in Wahrheit unweit des Echo Ridge gewesen war. Daher nahm Shaw an, dass Russell den Mann ermordet hatte, wenn auch bestimmt unter großen Gewissensbissen und alles andere als leichtfertig. Doch Russell musste wohl zu der Überzeugung gelangt sein, Dories Leben sei durch Ashton gefährdet, und so traf er seine Entscheidung. Der Vater war damals längst nicht mehr der sanftmütige, humorvolle Mann und Lehrer gewesen, als den seine Kinder ihn einst kennengelernt hatten.
Shaw fand sich mit der bitteren Erkenntnis ab, dass sein Bruder zum Vatermörder geworden war, was ihm jahrelang zu schaffen machte und ihn und Russell entzweite.
Dann, erst vor wenigen Wochen, stieß er auf die Wahrheit: Russell hatte mit Ashtons Tod nichts zu tun. Der Täter war ein Abgesandter von BlackBridge gewesen und hatte ihren Vater in jener eiskalten, dunklen Oktobernacht zum Echo Ridge verfolgt.
Ebbitt Droon höchstpersönlich hatte Shaw die Geschichte erzählt: »Ihr Vater … Braxton wollte ihn tot – aber noch nicht gleich, vorher brauchte sie noch etwas von ihm. Sie hat jemanden geschickt, der mit ihm über die Dokumente … äh … reden sollte.«
»Reden« bedeutete, Ashton zu foltern, bis er preisgab, was er über die von Amos Gahl entwendeten Firmengeheimnisse und -unterlagen wusste.
Droon hatte erklärt: »Soweit wir das im Nachhinein sagen können, hat Ihr Vater gewusst, dass Braxtons Mann zu Ihrem Haus unterwegs war. Ashton ist ihm zuvorgekommen und hat ihn weggelockt, um ihn irgendwo im Wald zu töten. Das hat nicht geklappt. Es kam zu einem Kampf, und Ihr Vater ist abgestürzt.«
Bis zu jenem Zeitpunkt hatte Shaw wirklich felsenfest geglaubt, Russell habe den Vater ermordet. Den älteren Bruder hatte der, wenngleich unausgesprochene, Vorwurf so tief getroffen, dass er aus dem Leben der Familie verschwunden war. Seit Ashtons Beisetzung vor mehr als zehn Jahren hatte niemand mehr etwas von ihm gehört.
Colter Shaw verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem Aufspüren von Personen – Guten wie Bösen –, ob sie nun von schicksalhaften Umständen heimgesucht worden oder aus freien Stücken von der Bildfläche verschwunden waren. Er hatte viel Zeit, Geld und Aufwand investiert, um seinen Bruder wiederzufinden. Was Russell sagen würde, wenn sie sich gegenüberstanden, wusste Shaw nicht. Er selbst hatte sich eine Art Rede zurechtgelegt, als Erklärung, als Bitte um Verzeihung, als eine Möglichkeit, sich wieder anzunähern.
Doch bislang hatten seine Bemühungen zu nichts geführt. Russell Shaw blieb verschwunden, und er hatte seine Spuren sehr, sehr gut verwischt.
Shaw musste daran denken, wie er erst vor wenigen Tagen mit jemandem darüber gesprochen und die Auswirkungen beschrieben hatte.
Der Mann hatte ihn gefragt: »Was ist Ihrer Ansicht nach der größte Minuspunkt im Hinblick auf Ihren Bruder? Was tut am meisten weh?«
Shaw hatte erwidert: »Er war immer mein Freund gewesen. Und ich seiner. Und dann habe ich alles zerstört.«
Der Anblick des Adlers ließ ihn nun Russells Abwesenheit umso schmerzlicher spüren.
Er stellte die Statuette auf den Küchentisch und widmete sich wieder den Unterlagen seines Vaters. Im Laufe der nächsten Stunde stieß er auf zwei Notizen in Ashtons eleganter Handschrift. Sie bezogen sich nicht auf die achtzehn Markierungen, was wohl bedeutete, dass Ashton erst nach der Abarbeitung der Karte auf diese beiden Orte gestoßen war.
Einer der Hinweise benannte ein Gewerbegebäude im Embarcadero, dem östlichen Küstenstreifen von San Francisco: das Hayward Brothers Warehouse.
Die andere Anschrift lag in Burlingame, einem Vorort südlich der Stadt, Camino 3884.
Shaw schickte seiner Privatdetektivin eine SMS mit beiden Adressen und bat um nähere Informationen. Mack McKenzie antwortete kurz darauf, sie könne über das Lagerhaus nur wenig herausfinden: Es handele sich um ein historisches Gebäude aus dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts, das nicht ohne Weiteres zugänglich sei und derzeit zum Verkauf stünde. Die Anschrift in Burlingame sei die Privatadresse eines Mannes namens Morton T. Nadler.
Shaw fand außerdem eine Visitenkarte, die auf einen dritten möglichen Ort verwies: die Fachbibliothek für Wirtschaft und Handel der Universität Stanford, die sich nicht etwa auf dem Campus in Palo Alto, sondern im Stadtteil South of Market befand.
Vielleicht hatte die Bibliothek auch gar nichts mit Gahls gestohlenen Beweisen zu tun; sie wäre ein merkwürdiges Versteck für eine Kuriertasche. Womöglich hatte Ashton Shaw dort lediglich Nachforschungen angestellt. Er hatte nie einen eigenen Computer besessen und natürlich auch niemals einen unter seinem Dach geduldet, also könnte er eines der öffentlichen Bibliotheksterminals genutzt haben.
Shaw entschied, mit der Bibliothek anzufangen. Sie lag dem Versteck am nächsten. Falls er dort keinen Erfolg hatte, würde er es erst mit der Adresse in Burlingame versuchen und dann mit dem Lagerhaus.
Vorab aber galt es, einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
San Francisco war das Revier von BlackBridge. Mit neunzig Prozent Wahrscheinlichkeit wussten die Leute in der Firma nicht, dass er hier war. Aber die finsteren zehn Prozent erforderten gebührende Sorgfalt.
Er öffnete eine App auf seinem Smartphone.
Sie zeigte ihm den aktuellen Aufenthaltsort von Irena Braxton und Ebbitt Droon an.
Braxton hatte kürzlich unter falscher Identität Zugang zu Shaws Wohnmobil erlangt und vermeintlich Ashtons Karte gestohlen, auf der die möglichen Verstecke von Gahls Beweismaterial markiert waren.
Shaw hatte zuvor jedoch durchschaut, wer die Frau in Wirklichkeit war. Und so hatte er für sie eine Landkarte mit achtzehn willkürlich gewählten Orten vorbereitet, dazu ein Exemplar von Henry David Thoreaus Walden mit Randnotizen voller codeähnlichem Kauderwelsch. Und einem versteckten GPS-Peilsender im Buchrücken.
Während der letzten beiden Tage hatte das Peilsignal mehrere der von Shaw markierten Orte angesteuert und zwischendurch immer wieder Zeit in einem Gewerbehochhaus an der Sutter Street mitten in San Francisco zugebracht, wahrscheinlich der Sitz von BlackBridges lokaler Zweigstelle. Dort befand es sich auch in diesem Moment.
Shaw wechselte auf Google Maps und inspizierte die Umgebung der Stanford-Bibliothek. Er rechnete zwar nicht konkret mit Schwierigkeiten, hielt sich bei der Arbeit jedoch stets an diese Prozedur, weil Informationen nun mal die wirksamste Waffe waren, um das eigene Überleben zu sichern.
Plus natürlich das nötige Werkzeug.
Shaw überprüfte ein weiteres Mal seine Pistole.
Gehe niemals davon aus, dass deine Waffe immer noch geladen ist und seit der letzten Benutzung auch weder beschädigt noch manipuliert wurde.
Shaws 380er Glock war allerdings vollständig geladen, mit sechs Schuss im Magazin und einem in der Kammer. Es handelte sich um eine gute und zuverlässige Automatik – solange man sie beim Abfeuern fest umklammert hielt. Das Modell war berüchtigt dafür, dass der Schlitten ansonsten nicht vollständig zurückglitt und die leere Patronenhülse im Verschluss hängen blieb. Colter Shaw war das aber noch nie passiert.
Er steckte die Pistole zurück in das graue Polymerholster an der Innenseite des Hosenbunds und zog als Sichtschutz den Pullover darüber. Wenn man eine verdeckte Waffe trug, sollte möglichst niemand einen Blick darauf erhaschen und aus lauter Panik die Polizei rufen.
Und es gab noch einen Grund.
Lass den Gegner niemals wissen, über welche Mittel du verfügst …
7
Eine neue Bedrohung.
Shaw stand neben seinem Motorrad und bemerkte, dass jemand ihn beobachtete.
Eine schmale Gestalt mit Lederjacke und Baseballmütze.
Die Sonnenbrille verriet den Unbekannten. Sie war an einem solchen Tag einfach überflüssig, denn der typische Morgendunst hatte sich nicht aufgelöst, sondern war schwerfällig und trübe wie ein penetranter Hausgast an Ort und Stelle geblieben. Die dichten Schwaden rochen nach feuchtem Asphalt, Auspuffgasen, einem Anflug von Müll und dem Meer. In San Francisco war man nie weit vom Wasser entfernt.
Shaw hatte sich beim Verlassen des Hauses und Abschließen der Tür unauffällig umgesehen und zunächst nur den Bärtigen mit der schenkellangen schwarzen Jacke und der Wollmütze registriert, zu dessen Füßen der Rucksack mit dem Logo der Oakland Athletics stand und der ihm zuvor schon aufgefallen war. Er saß an einem Tisch vor dem Café, trank gerade einen Schluck und tippte auf seinem Smartphone herum. Dann schaute Shaw in den Rückspiegel der Yamaha und entdeckte den Spion anderthalb Blocks hinter sich.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich irrte? Fünfzig Prozent.
Shaw drehte sich beiläufig um, überprüfte das Hinterrad der Yamaha und schaute dabei auch wie zufällig zu dem Unbekannten.
Der Mann verschwand sofort hinter der Hausecke, an der er gestanden hatte.
Was die Wahrscheinlichkeit einer Beschattung auf nahezu hundert Prozent erhöhte.
Wer mochte das sein?
Seine Statur entsprach der von Droon – doch falls es jemand von BlackBridge war, woher wussten sie von diesem Versteck? Außerdem hätten sie sich in dem Fall sofort auf Shaw gestürzt. Das Team hätte ihn zurück ins Haus gedrängt, um ihn dort danach zu »fragen«, was er hier in der Stadt verloren hatte und wo seiner Ansicht nach Gahls Beweise versteckt waren.
Nein, Shaw tippte zu sechzig Prozent auf den russisch und chinesisch sprechenden Bewohner des Hauses, der sich so gut auf Hinterhalte mit Blendgranaten verstand.
Und zu mindestens neunundneunzig Prozent war der Mann alles andere als begeistert darüber, dass Shaw plötzlich hier aufgetaucht war und all die Unterlagen zu Gesicht bekommen hatte, die der Fremde so sorgfältig geheim halten wollte.
Handelte es sich um einen der Kollegen seines Vaters? Oder um einen Nachfolger, so wie Shaw selbst?
Gut möglich. Aber ohne weitere Informationen ließ die Wahrscheinlichkeit sich nicht näher beziffern.
Dalton Crowe? Im Laufe der Jahre hatten Shaw und der einfältige Kopfgeldjäger mehrmals und teils handfest miteinander zu tun bekommen. Crowe war zurzeit der irrigen Überzeugung, Shaw habe ihn um eine hohe fünfstellige Belohnung betrogen. Er wohnte zwar weit weg von hier, aber seine brutale, annähernd psychopathische Natur ließ es denkbar erscheinen, dass er sich ins Auto setzen und anderthalbtausend Kilometer weit fahren würde, um sein Geld einzufordern, ob berechtigt oder nicht.
Ja, Crowe war massig wie ein Kühlschrank, mindestens doppelt so breit wie der Spion. Doch er könnte ja jemanden angeheuert haben. Wenn du dir sicher bist, dass ein anderer dir fünfzigtausend Dollar schuldet, investierst du vielleicht ein paar Scheine, um an das Geld zu kommen.
Oder wollte jemand sich wegen eines früheren Auftrags an Shaw rächen? Durchaus möglich. Erst vor wenigen Wochen hatte Shaw sich im Silicon Valley bei mehreren Leuten unbeliebt gemacht, als eine einfache Prämienjagd zu etwas deutlich Gravierenderem eskaliert war. Seine neuen Feinde in der Videospielindustrie verfügten über beträchtlichen Einfallsreichtum, womöglich gepaart mit Rachsucht.
Er dachte an den gedrungenen, breiten Kerl von vorhin, der Tricia angegriffen hatte. Es war zwar nicht wahrscheinlich, dass er zurückkehren würde, aber schon manch ein Unterlegener hatte sich im Nachhinein eine Schusswaffe besorgt, um Vergeltung zu üben. Es wäre zwar eine dumme und sinnlose Aktion, doch das allein war längst kein Hinderungsgrund. Shaw verwarf den Gedanken wieder; der Körperbau passte einfach nicht.
Er wandte sich erneut zum Vorderrad der Maschine um, machte sie von dem Laternenmast los und verstaute das massive Kettenschloss. Ein weiterer Blick in den Rückspiegel verriet ihm, dass sein Schatten wieder an Ort und Stelle stand.
Shaw setzte den Helm auf und streifte die schwarzen Lederhandschuhe über.
Er öffnete den Reißverschluss seiner Jacke und zog den Pullover ein Stück hoch, um schnell an seine Waffe gelangen zu können. Gleich darauf erwachte der Motor knatternd zum Leben. Shaw legte mit der Stiefelspitze den ersten Gang ein und drehte den Gashebel weit zurück. Das Hinterrad drehte qualmend durch. Shaw ließ die Maschine um hundertachtzig Grad herumschleudern und raste los.
Die Gestalt verschwand.
Shaw beschleunigte auf siebzig Kilometer pro Stunde. Kurz vor der Kreuzung, an der er rechts abbiegen musste, um den Spion zu stellen, schaltete er herunter, ging vom Gas und kam schlitternd zum Stehen. Er musste davon ausgehen, dass der Beobachter bewaffnet war und auf die Stelle angelegt hatte, an der Shaw um die Ecke biegen würde. Um also kein Ziel zu bieten, neigte er die Yamaha mit eingeschlagenem Lenker nach rechts und nutzte den Rückspiegel, um die Querstraße einzusehen.
Es gab keine Bedrohung, aber, verdammt noch mal, ein Auto raste soeben davon.
Shaw gab wieder Gas und nahm die Verfolgung auf.
Etwa zehn Meter weit.
Oh, Mist …
Er trat mit voller Wucht auf die Hinterradbremse und zog dann erst den Bremshebel des Vorderrads, die heiklere der beiden Bremsen, die dich über den Lenker katapultieren konnte. Es gelang Shaw, die Maschine nicht ausbrechen zu lassen und gerade noch rechtzeitig vor den zahlreichen Nägeln zum Stehen zu kommen, die der Spion anscheinend auf das Kopfsteinpflaster geworfen hatte, bevor er in seinen Wagen gestiegen und weggefahren war. Es handelte sich um keinen schlechten Trick, das improvisierte Äquivalent einer Nagelkette, wie die Polizei sie benutzte, um Verfolgungsjagden zu beenden. Falls der Unbekannte ihm ans Leder wollte, würde er Shaw angreifen, sobald dieser die Yamaha abstellte.
Aber der Wagen bog in diesem Moment nach links zur Auffahrt des Freeway ab – ein dunkelgrüner Honda Accord mit kalifornischen Kennzeichen, die Shaw nicht mehr näher entziffern konnte.
Da der Spion aufgeflogen war, würde er nun von seinem Vorhaben ablassen?
Nein, zu neunundneunzig Komma fünf Prozent nicht, dachte Shaw. Aber diese Überzeugung basierte nicht auf Fakten, sondern allein auf seiner Intuition.
Er stieg ab, hob ein Stück Pappe vom Boden auf und fegte die Nägel in den nächstbesten Gully – einerseits, um andere Motorradfahrer zu schützen, und andererseits, weil er nicht wollte, dass nach einem eventuellen Unfall diverse Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Sirene hier auftauchten, jede Menge Aufmerksamkeit erregten, und dann die Polizei auch noch an jede Tür klopfte, um nach Augenzeugen zu suchen.
Shaw konnte jetzt nicht einfach zu der Bibliothek fahren. Jemand – eindeutig ein Gegner – wusste nun von dem Versteck. Er stieg auf die Yamaha und kehrte zum Haus zurück. Dort fotografierte er jedes einzelne Dokument seines Vaters, verschlüsselte die Bilddateien und lud sie in seinen sicheren Cloud-Speicher hoch. Mack erhielt Kopien.
Dann stieg er abermals auf sein Motorrad, ließ den Motor an und raste davon zu der Hauptstraße, über die er zu der Stanford-Bibliothek gelangen würde.
Alle Gedanken an die Identität und Absichten des Spions waren schlagartig wie weggeblasen. Nach nur wenigen Metern herrschte nur noch Hochgefühl. Das Felsklettern war eine komplexe, intellektuelle Freude. In niedrigen Gängen mit hoher Drehzahl auf rutschigen Reifen um Kurven zu driften, Steigungen hinaufzuschießen und über Hügelkuppen zu fliegen … tja, das war der reinste, ungefilterte Rausch.
Shaw kannte den Polizeithriller Bullitt aus den 1960ern, in dem der Schauspieler Steve McQueen – dem Shaw mehr als nur ein wenig ähnelte, wie ihm immer wieder versichert wurde – seinen Ford Mustang durch die gewundenen und steilen Straßen San Franciscos jagte, um zwei Killern in einem Dodge Charger zu folgen – die beste Autoverfolgungsjagd der Filmgeschichte. Wenn Shaw mit seinem Motorrad in der Stadt war, nutzte er stets die Gelegenheit, es Detective Frank Bullitt gleichzutun und die riskante und aufregende Beschaffenheit des Geländes mit vereinzelten Sprüngen und ausgiebigen Drifts gründlich auszukosten.
Diesmal begann seine Fahrt in dem Viertel, in dem das geheime Haus seines Vaters stand: im Mission District, kurz The Mission.
Shaw kannte die Gegend seit einer wochenlangen Prämienjagd vor einigen Jahren und fühlte sich ganz wohl hier. Der Bezirk war einst nur dünn besiedelt gewesen, bis im Jahr 1906 das berüchtigte Erdbeben den größten Teil von San Francisco zerstörte. Da es in The Mission mehr Freiflächen und somit weniger Beben- und Feuerschäden gab, zogen viele Einwohner hierher, um einen Neuanfang zu versuchen. Die Leute waren sowohl europäischer Abstammung – vorwiegend polnisch und deutsch – als auch mexikanischer und sonstiger lateinamerikanischer Herkunft. In den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts galt das Viertel als schäbig und gefährlich, regelrecht gesetzlos. So blieb es, bis mit den Siebzigerjahren die Stunde der Gegenkultur schlug.
The Mission wurde zum Mittelpunkt der hiesigen Punkrockszene und Tummelplatz der Schwulen-, Lesben- und Transgender-Bewegung.
Shaw hatte bei seiner Suche nach den Benson-Zwillingen zudem den interessanten Umstand erfahren, dass erstaunlich viele der ortsansässigen Familien ursprünglich von der Halbinsel Yukatan stammten. In dem Teil von The Mission, den er soeben durchquerte, beherrschten viele der Anwohner die ausdrucksstarke, komplexe Sprache der Maya. Er fuhr gerade am grünen In Chan Kaajal Park vorbei, was auf Mayathan »Meine kleine Stadt« heißt.
Auf dem Weg nach Norden ließ er The Mission hinter sich und gelangte nach SoMa, was die alberne Kurzform der Städter für »South of Market« war. Manch älterer Zeitgenosse bevorzugte die interessantere Bezeichnung »South of the Slot«, was sich auf eine heute nicht mehr existierende Kabelbahn entlang der Market Street bezog. Genau wie The Mission konnte auch SoMa eine schillernde Vergangenheit vorweisen, wenngleich die Farbenpracht allmählich den profanen Geschäftsinteressen wich. Es gab hier zahllose Firmensitze, Museen, Galerien und diverse spießige Veranstaltungsorte. Was hätten die Punks wohl dazu gesagt?
Wenig später erreichte Shaw sein Ziel, das am nördlichen Rand von SoMa lag, dem wohlhabenderen Teil des Viertels. Nicht weit von hier begann der Finanzdistrikt mit all den Großkanzleien und Fachbüros, die eine Universitätsbibliothek für Wirtschaft und Handel zu schätzen und zu nutzen wussten.
Shaw hielt auf der gegenüberliegenden Straßenseite und betrachtete das zweigeschossige Gebäude, das mit seiner Glas- und Aluminiumfassade eher zweckmäßig wirkte als architektonisch bemerkenswert. Er ließ sich Zeit. Leute kamen und gingen, zumeist konservativ gekleidet. Ein paar Boten, ein paar Lieferanten.
Shaw tat so, als würde er telefonieren, und konzentrierte sich auf den einzigen Eingang.
Hinter der Tür folgte eine geräumige Lobby mit zwei Durchgängen. Der rechte war offenbar ausschließlich für Mitarbeiter gedacht, der linke für Besucher. Es gab dort eine Sicherheitsschleuse wie am Flughafen, mit Metalldetektor und Kontrolle des Tascheninhalts. Ferner musste man sich ausweisen, woraufhin der Name in einer Liste notiert wurde, allerdings ohne weitere Überprüfung der Identität.
Shaw legte den Gang ein und fuhr den Block hinauf zu einer für Krafträder reservierten Stellfläche. Dort kettete er die Yamaha an einen Pfahl und schloss auch den Helm mit an. Nach einem kurzen Blick in die Runde verstaute er sein Klappmesser und das Holster mit der Pistole in einem Schließfach unter der Sitzbank, das er speziell für diesen Zweck angefertigt hatte. Dann vergewisserte er sich, dass der versteckte Peilsender der Diebstahlsicherung eingeschaltet war. Keine noch so dicke Kette war einem entschlossenen Langfinger gewachsen.
Colter Shaw ließ die Waffe nur ungern zurück, aber ihm blieb nichts anderes übrig. Dann ermahnte er sich, nicht so paranoid zu werden wie sein Vater. Was sollte ihm in einer Bibliothek denn schon groß passieren können?
8
Er hatte eine Geschichte parat.
Rechtsreferent Carter Skye, Mitarbeiter der Kanzlei Dorion & Dove, war von seinem Vorgesetzten hergeschickt worden, um einen Sachverhalt im Versicherungsrecht zu recherchieren. Diese Tarnung war nicht vollständig aus der Luft gegriffen. Im Zuge seines juristischen Praktikums nach dem College hatte Shaw für einen der dortigen Anwälte tatsächlich derartige Nachforschungen anstellen müssen. Es war dabei um einen komplizierten Übergang von Forderungen gegangen – wenn eine Versicherung in Anspruch genommen wird und im Gegenzug das Recht erhält, anstatt des Versicherten Klage einzureichen.
Der freundliche Latino-Wachmann interessierte sich jedoch kein bisschen für Skyes/Shaws Absichten, und Shaw war erfahren genug, den Mund zu halten. Wer eine zunächst glaubwürdige Geschichte immer weiter ausschmückte, machte sich verdächtig.
»Muss ich Gebühren zahlen?«, fragte er.
Der Mann erklärte, wer nicht Student oder Mitarbeiter der Universität sei, müsse zehn Dollar Eintritt entrichten. Shaw zahlte in bar. Dann legte er auf Nachfrage einen Ausweis vor, auf dem das Foto und die Angaben zu Größe, Gewicht und Augenfarbe stimmten, nur nicht der Name Skye, der ihm bei seinem letzten Auftrag als Tarnung gedient hatte. Mack war Expertin darin, falsche Identitäten zu erschaffen (was sogar völlig legal war, solange man nicht versuchte, die Behörden zu täuschen oder einen Betrug zu begehen).
Eine summende Maschine fabrizierte einen Aufkleber mit Shaws Abbild darauf. Er heftete ihn sich an die Brust.
Dann zog er kurz in Erwägung, das Foto von Amos Gahl vorzuzeigen, das er mit seinem Smartphone von dem Artikel über den Tod des Mannes geschossen hatte, und sich nach ihm zu erkundigen. Aber der Wachmann war noch jung, und Gahls Besuch, sofern es überhaupt einen gegeben hatte, würde Jahre zurückliegen.
»Was ist denn da drüben?«, fragte Shaw und wies auf die Doppeltür zur Rechten.
NURFÜRFAKULTÄTSANGEHÖRIGE
»Hauptsächlich historische Dokumente.«
»Auch juristische?«
»Zum Teil. Aber auch zur Stadtplanung und Flächennutzung, Liegenschaften und Verwaltungsvorgängen.«
»Ach, wirklich? Meine Kollegen bearbeiten einen Fall, der teils dreißig oder vierzig Jahre zurückreicht. Ich suche nach einigen alten Bebauungsentscheidungen, die im Rathaus nicht mehr vorliegen. Könnte ich mich da mal umschauen?«
Er hoffte, dass nicht plötzlich irgendeine leitende Bibliothekarin zum Vorschein kam und sich nach den konkreten Details seiner Anfrage erkundigte.
»Dazu müssen Sie einen Termin vereinbaren. Unter dieser Nummer.« Der Mann reichte Shaw eine Karte. Er schob sie sich in die Hosentasche. Es war wahrscheinlicher, dass sein Vater oder Gahl die öffentlich zugängliche Seite gewählt hatten. Falls Shaw dort nicht fündig wurde, konnte er sich immer noch in altes kalifornisches Baurecht vertiefen und versuchen, Zugang zum anderen Teil der Bibliothek zu erlangen.
Er bedankte sich bei dem Wachmann, passierte ohne Zwischenfall den Metalldetektor und betrat den ausgedehnten und hell erleuchteten Bereich, der für die Allgemeinheit gedacht war.
So, und nun?
Es war eine ziemlich noble Einrichtung, was nicht überraschend war, wenn man zu einer der reichsten Universitäten des Landes gehörte. In der Mitte stand ein kreisrunder Tresen für die Bibliothekare. Dort saß ein etwa fünfunddreißigjähriger Afroamerikaner in einem beigefarbenen Anzug und schaute auf einen Bildschirm.
Vom Zentrum aus erstreckten sich Tischreihen und geräumige Computerarbeitsplätze mit großen Monitoren, auf denen als Bildschirmschoner ein Kasten mit dem Namen der Bibliothek träge umherwanderte. Die Tische und Arbeitsnischen waren mit Hilfsmitteln ausgestattet; es gab Stifte, Schreibblöcke, Haftnotizzettel und Büroklammern. Rund um die offenen Flächen standen Regale mit Büchern und Fachzeitschriften. Vorder- und Seitenwand des Saals besaßen raumhohe Fenster. Hinten schien es etwa ein Dutzend Büros oder Besprechungszimmer zu geben. Die umlaufende Galerie im ersten Stock war mit ihren Regalen und Räumen ebenso gestaltet wie das Erdgeschoss.
Hier unten herrschte derzeit wenig Betrieb. Zwei ältere Geschäftsmänner hatten ihre Jacketts abgelegt und waren in alte Bücher vertieft. Eine junge Frau im Karokleid und ein schmaler Mann mit weißem Hemd und dunklem Anzug – beide ungefähr Mitte dreißig – saßen an Computern.
Shaw hielt unwillkürlich nach möglichen Fluchtwegen Ausschau. Es gab zwar keinen aktuellen Anlass, doch ein derartiges Verhalten zählte zu den grundlegenden Überlebenstechniken. Shaw tat das immer und überall, ganz automatisch.
Verliere niemals die Orientierung …
Zunächst also gab es den Eingang und eine Treppe in den ersten Stock. Sowie einen Aufzug. Eine Glastür hinter den Regalen führte zur anderen Seite der Bibliothek, die den Mitarbeitern und Studenten vorbehalten war. Es gab dort ferner einen Konferenzraum, von dem aus womöglich weitere Türen in den hinteren Teil des Gebäudes führten. Der Raum war zurzeit in Benutzung; eine Frau mittleren Alters in einem Geschäftskostüm und ein schlanker Mann mit dunkler Freizeitjacke saßen mit dem Rücken zur Glastür. Ihnen gegenüber saß ein ernst dreinblickender Mann mit hellblondem Haar. Die Tür war geschlossen; ob sie außerdem verriegelt war, konnte Shaw nicht erkennen.
Zwischen den hohen Fenstern auf der linken Seite gab es einen alarmgesicherten Notausgang zur Nebenstraße. Shaw sah Herren- und Damentoiletten und eine Tür mit der Aufschrift LAGER.
Er merkte sich all diese Einzelheiten und machte sich ans Werk. Angenommen, sein Vater hatte tatsächlich vermutet, das Beweismaterial könne hier in der Bibliothek deponiert worden sein, wo würde Gahl es versteckt haben?