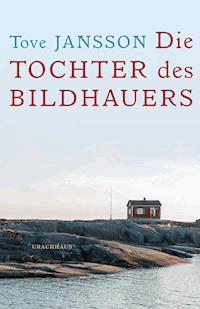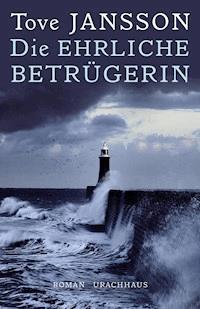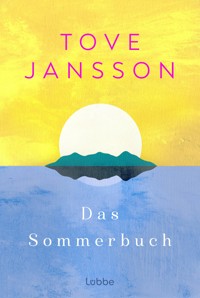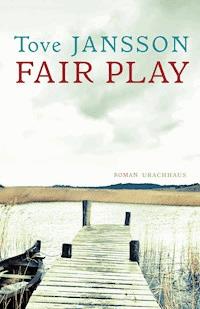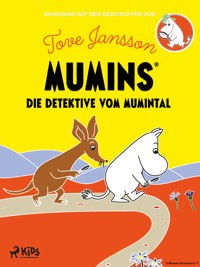Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
So wunderbar wie ein Frühling in Paris... Ein klarer, neugieriger Blick auf Orte in ganz Europa, auf Protagonisten in jedem Lebensalter und in unterschiedlichsten Situationen durchzieht die fünfzehn Erzählungen dieses Bandes. Ob in Paris, Dresden, Helsinki, auf Capri oder in den Schären: Janssons feiner Humor zeichnet so eigenwillige wie liebenswerte Charaktere - einsame Flaneure, frisch Verliebte, junge Künstler, alternde Autoren - und ja, sogar Hemule und Filifjonken, die wir aus den Mumin-Geschichten kennen. Es ist ein einzigartiger Band, der hier von der Jansson-Forscherin Sirke Happonen zusammengestellt wurde. Die Texte waren bisher nur in finnischen Zeitschriften erschienen, der erste, titelgebende, bereits 1934, der letzte 1997. Das ergibt einen reizvollen Querschnitt durch das Gesamtwerk Tove Janssons, der einmal mehr ihre Meisterschaft im Genre der Kurzgeschichte und der Erzählung belegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tove Jansson
Der BOULEVARD
ERZÄHLUNGEN
Aus dem Schwedischen von Birgitta Kicherer
INHALT
Vorwort des Verlags zur deutschsprachigen Ausgabe
Der Boulevard
Klischee
Stadtkinder
Der Brief
Auf dem Dampfersteg
Quat’z’Arts
Der Bart
Zimmersuche
Nie wieder Capri
Die Geige
San Zeno Maggiore, 1 Stern
Die Insel
Der hinterhältige Kinderbuchautor
Eine etwas unordentliche Geschichte
Das Muminhaus im Mumintal
Post scriptum
Einmal in einem Park
Quellen
VORWORT DES VERLAGS ZUR DEUTSCHSPRACHIGEN AUSGABE
Die Sammlung von Erzählungen, Kurzgeschichten und Essays unter dem Titel Der Boulevard stellt für alle, die die Prosa Tove Janssons lieben, einen besonderen Schatz dar. Sie ist der finnischen Jansson-Forscherin Sirke Happonen zu verdanken, die diese Texte – zu Lebzeiten der Autorin ausschließlich in Zeitschriften erschienen und deshalb nur noch in Archiven zugänglich – zusammengestellt und im Original 2017 veröffentlicht hat. Der überwiegende Teil, nämlich gut zwei Drittel der Texte, stammen aus den Jahren 1934 bis 1940, einer Zeit, in der Tove Jansson ihr Kunststudium in Helsinki absolvierte, ihre ersten Reisen nach Europa machte, für einige Monate in Paris studierte und sich finanziell durch das Zeichnen von Karikaturen, Postkarten, Buchumschlägen und Illustrationen über Wasser hielt.
1934, als ihre Debut-Erzählung »Der Boulevard« erschien, war Tove Jansson gerade einmal zwanzig – die dreijährige Ausbildung an der »Konstfack« in Stockholm, das erste Studienjahr Malerei und die erste Reise nach Deutschland und Frankreich lagen schon hinter ihr.
In den darauffolgenden Jahren bis 1940, als der Krieg die Welt erschütterte, publizierte die junge Künstlerin elf Erzählungen in schwedischsprachigen Zeitschriften, die hier chronologisch geordnet wiedergegeben werden. Sie zeugen bereits von einer exzellenten Beobachtungsgabe, einem frischen, scharfen Blick, feinem Humor, sowie von dem Mut, auf gesellschaftliche Verwerfungen hinzuweisen. Die Kurzprosa – das wird durch diese Texte offensichtlich – war von Anfang an ein Genre, in dem Tove Jansson brillierte, selbst wenn sie sich den Zwängen der »Gelegenheitsprosa« beugen musste.
Nach dieser ersten Schaffensphase sollte Jansson allerdings für viele Jahre kaum mehr in diesem Genre tätig sein. In der Not des Krieges schrieb sie zunächst – als Überlebenstexte für die eigene Seele – die Muminbücher, mit denen sie Weltruhm erlangte. Später, in den 1950er-Jahren zeichnete sie – für den ebenso notwendigen Broterwerb – die Mumin-Comics für die britischen The Evening News. Doch hauptsächlich lebte Tove Jansson für die Malerei. In den 1940er-Jahren entstanden viele Porträts und Selbstporträts, aber auch großflächige Wandgemälde in privaten und öffentlichen Räumen.
Die meisten Erzählungen aus der frühen Schaffensphase, so scheint es, hat die junge Künstlerin von ihren Reisen »mitgebracht«. Sie spielen in Verona, Capri oder Dresden – und immer wieder in Paris. Auffallend ist, dass bereits in diesen frühen Texten Janssons Protagonisten Außenseiter sind: Einsame, Arme, Künstler, Sonderlinge, Figuren vom Rande der Gesellschaft, die das Leben meistern, so gut es eben geht.
Gleich in der ersten Erzählung, »Der Boulevard«, begegnet man einem Einsamen, der sich abends in das lebendige Treiben auf den Boulevards begibt, einem frisch verliebten Paar folgt und sich der Illusion hingibt, er könnte so an ihrem Leben teilhaben, bis sie vor seinen Augen in einem Wagen verschwinden und er wieder auf sich allein zurückgeworfen ist. Ähnlich einsam ist auch Herr Völpel in »Der Brief« oder Jolanda in »San Zeno Maggiore«. Bei Herrn Völpel und Jolanda spielt dazu das Motiv der Armut mit herein, dem man wiederum in den Erzählungen »Zimmersuche«, »Die Geige« oder »Der Bart« in einer humorvoll geschilderten Version wiederbegegnet – dort auch mit dem Motiv des Künstlerdaseins verbunden.
In der Erzählung »Nie wieder Capri!« von 1939, in der sie die Faszination für das Exotische oder Authentizitätsträume thematisiert, stechen Tove Janssons Menschenkenntnis und unterhaltsame Ironie hervor.
Die letzten fünf Texte dieser Sammlung, zwischen 1961 und 1997 entstanden, ergeben eine weniger heterogene Reihe. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit haben alle eine sehr persönliche Note und vermögen dem Leser in konzentrierter Form zu vergegenwärtigen, wer die Künstlerin und der Mensch Tove Jansson war. Die Erzählung »Die Insel« von 1961 ist ein autobiografisch geprägter Text, in dem die inzwischen 47-jährige Autorin ihre Lebenserfahrung aphoristisch knapp einfließen lässt.
Der aus dem gleichen Jahr stammende Essay über den hinterhältigen Kinderbuchautor birgt eine Fülle präzise formulierter Behauptungen über die Kunst, für Kinder zu schreiben, und stellt Janssons Fähigkeit unter Beweis, sich mit feiner Ironie selber auseinanderzunehmen.
»Eine aus der Ordnung fallende Geschichte« (1966) verdankt ihre Entstehung dem Auftrag des schwedischen Schriftstellerverbands an verschiedene Autoren, eine eigene Variante von H. C. Andersens »Galoschen des Glücks« zu schreiben. Tove Jansson lässt sie im Haus eines Hemuls spielen, nach einem Fest, zu dem Filifjonken und andere Bewohner der Muminwelt geladen waren. Ihre originelle Lösung der Geschichte um die verzauberten Galoschen ist, dass zwei Figuren je eine Galosche behalten und damit genau das richtige Maß an Glück für sich finden.
In einem weiteren kurzen Text beschreibt Tove Jansson 1979 für eine Ausstellung das Mumin(Puppen)-Haus, das sie mit ihrer Lebensgefährtin Tuulikki Pietilä und Pentti Eistola gebaut hatte. Sie sprengt den an sich sachlichen Charakter eines solchen Textes mit einem Plädoyer für Fantasie und Freiheit: Gegen die hässlichen viereckigen Kästen, in denen der moderne Mensch zu wohnen gezwungen ist, protestiert das Muminhaus mit seinen Rundungen, Erkern und Winkeln in origineller Stilmischung. Ein beglückendes Merkmal seiner Konstruktion ist übrigens, dass es eine unbegrenzte Anzahl an Gästen beherbergen kann.
Eine ganz besondere Perle stellt schließlich die sehr späte Kurzgeschichte »Einmal in einem Park« dar, die 1997 nur wenige Jahre vor Tove Janssons Tod entstand – eine kritisch-charmante Auseinandersetzung mit dem Prozess des Schreibens. Sie spielt übrigens – wie Janssons allererste Erzählung – in Paris …
DER BOULEVARD
Der Boulevard ist in Paris auf die Welt gekommen, so viel ist sicher. Und die Nachkommen dieser Prachtstraße werden den Vergleich mit ihrer Urahnin nie bestehen, mit ihr, die ständig wächst, hell erstrahlt, ihre nächtliche Fassade mit einer Tiara aus flammender Reklame krönt und ihren Asphalt mit den Lichtern des kompakten Fahrzeugstroms schmückt.
Aus schattigem Halbdunkel münden die engen Nebenstraßen in den Boulevard, ob ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit fast verlegen.
Sie sind leer – alles wird in den großen Mahlstrom gezogen, dessen Zuflüsse im Sog der heiligen Stunde des Aperitifs zunehmen und gegen Mitternacht immer stärker angerauscht kommen.
Monsieur Chatain wohnt allein in der Nähe der Madeleine, der Kirche, benannt nach der großen biblischen Sünderin, die sich bekehrte, bereute und zur Heiligen erhoben wurde.
Monsieur Chatain, dessen Jugend heiter und verantwortungslos verlaufen ist, hegt für diese Kirche eine gewisse Vorliebe.
Er will in der Nähe der Kirche leben, weil er es einfach so gewohnt ist und auch weil er keine plötzlichen Veränderungen liebt. – Es ist gut so, wie es ist.
Und vor allem: Hier beginnt der Boulevard Madeleine. Die Vorstellung, diesen Boulevard zu verlassen, ist Monsieur Chatain genauso unmöglich wie der unfassbare Gedanke, Paris zu verlassen.
Er selbst sagt, er habe die ruhige Balance erreicht, das endgültige Ziel eines Lebens – daher kann er auch darüber hinwegsehen, dass gewisse übelgesinnte Personen ihn der Bequemlichkeit bezichtigen sowie eines ziellosen Daseins.
Wie dem auch sei – er ist allein, er kann tun und lassen, was er will.
Als das »Paarris Soirr!« der Zeitungsjungen unter seinem Fenster ertönt, hat er keine Ruhe mehr – er muss hinaus. Es ist Frühling, und der Frühling war für ihn schon immer mit unbestimmter Erwartung erfüllt, mit der Überzeugung, dass ihm etwas Großes einfach zustoßen müsse, etwas, das den ganzen Winter darauf gewartet hat, zu geschehen, und zwar jetzt.
Er weiß, solche Gefühle, die zur Jugend gehören, sind seiner unwürdig – darum sagt er: »Wir betrügen uns selbst, wenn wir uns nach den vergänglichen äußeren Phänomenen sehnen, die wir ›Ereignisse‹ nennen. Alles geschieht in unserem eigenen Inneren. Im Übrigen, mit der Beobachtungsgabe, die ich mir angeeignet habe, fällt es nicht schwer, überall ringsum große Ereignisse zu entdecken. Man muss nur einen Abend lang den Boulevard entlangschlendern … «
Das von Monsieur Chatain bevorzugte Bistro liegt am Boulevard des Italiens. Hier trifft er den richtigen Barkeeper, mit dem er über die neuesten Nachrichten diskutieren und über die Seltsamkeiten des Lebens philosophieren kann. Des Lebens aus Pariser Sicht natürlich – alles, was sich außerhalb dessen befindet, interessiert sie nicht. Beide kreisen um die große Schlagader, die bei der Madeleine ihren Anfang nimmt und an der Place de la Republique endet.
»Auf dieser Strecke kann man sämtliche Phasen des Lebens sehen – mehr braucht es nicht«, sagt Monsieur Chatain tiefsinnig. »Sie wechselt ihr Gesicht mindestens so oft, wie sie ihren Namen wechselt. Wo die Strecke in Richtung Boulevard St. Denis dunkler wird, sind das Publikum und die Lokale schon anders. Den Anfang zerstören die Touristen gerade, indem sie ihn zu ihrer versnobten Rennstrecke erkoren haben – diable.«
»Die Touristen sind gut«, sagt Monsieur Gilbert, der als aktiver Geschäftsmann einen extremeren Blick auf die Dinge vertritt.
Monsieur Chatain besteht erregt auf seiner Meinung über die Touristen: Lauter stupide Typen ohne Daseinsberechtigung. Dass sie Paris sehen wollen, hélas – das ist ganz natürlich –, aber ein bescheideneres Auftreten wäre auf jeden Fall angebracht! Sie führen sich auf, als hätten sie nicht nur ihr Hotelzimmer, ihre idiotischen Souvenirs, ihre Eintrittskarten fürs Moulin Rouge und das unvermeidliche Folies Bergère gekauft, sondern als hätten sie für ihr Geld die ganze Stadt erworben!
Sie belächeln alles, was sie bisher nie gesehen haben – o ja – da gibt es hier in Paris viel zu belächeln … !
Monsieur Chatain ist aufgebracht, er nimmt seinen Hut und geht. Sein Gesichtsausdruck lässt ahnen, dass er in Zukunft ein anderes Bistro mit seiner Anwesenheit beglücken wird.
Aber eigentlich fühlt er sich belebt und ist bester Laune. Der Disput plus zwei Pernods haben seine Lebensgeister stimuliert – jetzt streicht der frühlingshafte Wind erfrischend über seine erhitzten Schläfen.
Inzwischen gehen die Lichter an, die Leuchtreklamen flammen auf. Er wendet ihnen das Gesicht in fast heidnischer Anbetung zu. Wie er sie liebt, diese Surrogate für das Sonnenlicht, das ihm jetzt blass und uninteressant erscheint.
Die dunklen Mündungen der Nebenstraßen verachtet er, langsam wird er in den anschwellenden Hauptstrom gezogen.
Vor einem verlockend funkelnden und blitzenden Eingang bleibt er stehen, um sich in dessen Glanz zu sonnen und eine Zigarette anzustecken. Er denkt: »Ich gehöre nicht zu den Leuten, die behaupten, Paris sei jetzt trivialer als früher. Die Touristen bemühen sich zwar nach Kräften, meine Stadt zu zerstören – aber damit kommen sie nicht weit. Das gelingt keinem. Die Stadt bleibt immer gleich. Und so muss es sein. Auch die Frau bleibt immer gleich. Obwohl ich gestehen muss, diese Sandaletten zu goldlackierten Nägeln sind nicht nach meinem Geschmack. Aber sie bleibt genauso schön, genauso schön … « Vor ihm gehen ein paar junge Männer, bewusst nachlässig gekleidet, er mustert sie nachdenklich.
»Auch die jungen Möchtegernkünstler sind noch gleich, mit den gleichen weit ausholenden Gesten wie damals. Die kleinen anliegenden Mützen kenne ich allerdings noch nicht. Damals war der Schlapphut obligatorisch. Aber diese flaumigen Bärtchen, die sie sich wachsen lassen, die gefallen mir. Hoffentlich werden die bald wieder modern.« Und mit einem ironischen Lächeln: »Womöglich glauben sie, dadurch alle zu Christusgestalten zu werden.«
Monsieur Chatain zuckt die Schultern mit einem glücklichen Seufzer. Ah, wie angenehm das ist, so ungestört herumspazieren und die Mitmenschen ab und zu ein bisschen anpieksen zu können. Das bereitet ihm großes Vergnügen. Es ist gut, allein zu sein, allein und unabhängig. Er sehnt sich nicht nach Vergangenem, er – Monsieur Chatain – fürchtet nicht, was da kommen mag. Er lebt im Jetzt, und auch wenn seine Menschenkenntnis und seine satirische Gabe so unbekannt bleiben sollten wie er selbst, ist das gleichgültig. Wirklich große Männer bleiben unbekannt. Früher hat er gemalt – wie die da vorne.
Aber wozu noch länger Perlen vor das Volk werfen, das nichts zu schätzen wusste und nichts begriff. »Sollen sie doch in den Louvre gehen, wo die allgemein anerkannte Kunst hängt. Übrigens gebe ich zu, dass vieles dort selbst die Erzeugnisse meiner Glanzperiode übertreffen«, sagt Monsieur Chatain, der ein anspruchsloser Mann ist. »Alle halben Sachen sind mir zuwider. Das Beste – oder gar nichts.« Inzwischen ist es Zeit fürs Dîner.
Da er die Prix-fixe-Restaurants verächtlich meidet, findet Monsieur Chatain erst nach einiger Zeit ein Lokal, das ihm attraktiv genug erscheint. Dort wählt er einen Tisch im Freien, von wo aus er den vorbeifließenden Menschenstrom betrachten kann, und bestellt seine Suppe. Der zinnoberrote Farbton der Tischdecken entspricht ganz seinem Geschmack, das warme, weiche Licht, das davon reflektiert wird, verschönert die Gesichter der Menschen.
Am Nebentisch sitzen ein junger Mann und ein Mädchen, das einen großen hellen Hut aufhat. Monsieur Chatain beobachtet amüsiert, wie das Mädchen durch das Licht rosa wird: Kostüm, Gesicht und Haare, alles rosa. Sie lacht viel, vermutlich erzählt der junge Mann etwas Lustiges.
Sie hat Oliven bestellt, die sie sich nach und nach in den Mund steckt. Als sie die Kerne ausspuckt, sieht sie unglaublich kindlich aus. Monsieur Chatain konzentriert sein Interesse auf dieses junge Paar. Zu gern wüsste er, was der junge Mann erzählt – sind sie eventuell verlobt? Nein, unmöglich. Sie haben sich heute Abend zum ersten Mal getroffen, das ist ihm klar.
Er sieht, dass ihr die Beleuchtung gefällt, sie ordnet sich die Haare mit kurzen, raschen Bewegungen, dann zieht sie einen ihrer Handschuhe an und gleich wieder aus. Offenbar sucht sie nach irgendeiner geistreichen Bemerkung, begnügt sich aber schließlich damit, nur zu lachen. »Vermutlich das Vernünftigste«, denkt Monsieur Chatain philosophisch.
Jetzt pickt sie mit der Gabel ihre Pommes frites auf, errötet, lässt etwas fallen – ein kleiner Spiegel rollt bis an seinen Tisch hin. Der junge Mann dreht sich um, und als Monsieur Chatain ihm das Dingelchen reicht, betrachtet er das helle, selbstsichere Gesicht eingehend. »Genau wie ich«, denkt er. »Die gleiche Miene. Sogar die Krawatte hatte ich auf die gleiche alberne Art gebunden.«
Sein Interesse an dem jungen Paar nimmt zu, und er versucht sich auszudenken, wie sie sich kennengelernt haben, was für Berufe sie haben, was der junge Mann ihr nach dem Essen offerieren wird und ob sie womöglich bereits ineinander verliebt sind. »Dies ist der Beginn des Romans«, sagt er sich. »Ich möchte wissen, wie sie ihren Abend beenden werden. Es ist meine Pflicht, meine Beobachtungsgabe zu verfeinern, indem ich die Entwicklung von dergleichen Episoden verfolge.«
Er lächelt ein weises Beschützerlächeln, senkt das Kinn auf die Brust, wartet.
Unterdessen hat der Himmel mit dem roten Widerschein der Stadt seine charakteristische nächtliche Färbung angenommen. Monsieur Chatain folgt den beiden auf die Straße hinaus. Er sieht, wie der junge Mann ihr Veilchen kauft, und nickt anerkennend.
Das Mädchen macht nur ganz kurze Schritte und bleibt immer wieder in stummer Verzückung vor den Schaufenstern stehen. Aus einem Lokal dringt Musik. Als sie daran vorbeigeht, wird sie langsamer – jedoch hat sie offenbar keine Lust zu tanzen. Monsieur Chatain folgt ihnen über die Boulevards Montmartre, Poissonière, de Bonne-Nouvelle.
Es werden allmählich weniger Fußgänger. Das Mädchen schaut nicht mehr in die Schaufenster. Ab Boulevard St. Martin gehen die beiden Arm in Arm. Monsieur Chatain nickt.
»Ah, das ist nichts mehr für mich – und doch, ich kenne es. Aber gebunden habe ich mich nie.«
Jetzt gehen sie sehr langsam, biegen plötzlich in eine Nebenstraße ein. Monsieur Chatains Eifer, die Fortsetzung zu sehen, ist so groß, dass er ihnen ohne zu zögern in die dämmrige Gasse folgt. Er will bis zum Ende dabei sein.
Aber seltsam, es gelingt ihm nicht mehr, sie wie bisher zu beobachten. Er steht zu weit weg, hört nicht, worüber sie reden, und bis ans Ende der Gasse gehen sie in einem uninteressanten, gleichmäßigen Takt nebeneinanderher. Ein schrecklicher Verdacht – sind sie etwa Geschwister? Doch nicht. Voller Befriedigung sieht Monsieur Chatain, wie sie sich einander zuwenden.
Da durchschneidet Scheinwerferlicht die Dunkelheit. Der junge Mann hebt den Kopf, hält das Auto an. Er öffnet die Wagentür: Für einen Augenblick sieht Monsieur Chatain den Hut des Mädchens wie einen hellen Fleck – dann gleitet das Licht der Scheinwerfer weiter über den Asphalt – die Straße ist leer.
Eine große, bisher unbekannte Traurigkeit senkt sich über Monsieur Chatain. Das war die Jugend – sie fuhr einfach in einem Auto davon und gestattete ihm nicht einmal, danebenzustehen und seine Reflexionen zu machen.
Plötzlich fühlt er sich auf unheimliche Weise einsam, alt und ausgeschlossen. Aus dem dämmrigen Dunkel der Gasse kommen neue unangenehme Gedanken und Fragen auf ihn zugekrochen. Er macht eine abwehrende, wegwischende Handbewegung, so wie er seine Skizzen früher mit dem Sämischleder weggewischt hat.
Aber dieses Neue lässt sich nicht wegwischen. Es kommt heran bis an seine Füße und droht seinen ganzen Körper in Besitz zu nehmen. Da hört er das ferne Rauschen des Boulevards, er dreht sich um, rennt zurück.
Wie aus einem schlimmen Traum taucht er erneut in das Licht ein, bleibt zitternd stehen, holt tief Luft und wandert langsam zurück zur Madeleine.
KLISCHEE
Er lachte leise und schien sich dabei aufmerksam und kritisch selbst zuzuhören. Die Ironie, die in diesem Lachen lag, fand er wohl zufriedenstellend, denn jetzt wandte er sich mit einem schmerzerfüllten kleinen Lächeln zu mir um. Seine Haare standen ihm wie ein Strahlenkranz aus schwarzen Daunenfedern um den Kopf, seine schmalen Augenbrauen waren gewölbt wie bei einer Frau.
Ich zündete mir eine Zigarette an, während ich darauf wartete, dass er anfangen würde, über sich selbst zu reden. Sein ungewöhnliches Schweigen hatte zweifelsohne den Grund, dass er den richtigen, besonders wirkungsvollen Moment abwarten wollte.
Und der kam. Die Stimmen im Saal verstummten plötzlich, jemand trat vor und schlug mit feierlicher Miene zwölf Mal vibrierend auf einen Gong. Gleichzeitig wurde das Licht gedämpft, alle umarmten einander, weinten und klopften mit den Händen auf die Tische. Ich drehte mich zu meinem Freund um und wünschte ihm erleichtert ein gutes neues Jahr.
»Das Leben ist eine unheilbare Krankheit, die mit dem Tod endet«, antwortete er und verweilte genüsslich bei jedem Wort. Verärgert sah ich ihn mit einem Blick an, in dem er hoffentlich »Zitat« lesen konnte. »Das eben hättest du vor ein paar Minuten sagen können, da hätte es besser gepasst.«
»Der letzte Tag des alten Jahres«, sagte er leise. »Der war so schon schwer genug, müde und alt. Hast du nicht auch gespürt, wie die letzten Tage im Dezember Unbehagen ausstrahlen und wie die Luft dich mit atmosphärischem Druck niederpresst? Sag – hast du das nicht gespürt?« Auffordernd starrte er mich mit seinen hellen, weit aufgerissenen Augen an und fuhr dann fort: »Einer dieser verfluchten Tage, an denen man sogenannte gute Vorsätze und Beschlüsse fasst. So war es letztes Silvester – ein drückender Abend mit einem bedrohlich fernen, blinden Himmel. Mir kam es vor, als würde er summen wie ein Telegrafenmast.« Seine Augen wurden zu schmalen Schlitzen, er sah entzückt aus. Ich war sein Auditorium, ein Auditorium, das die schwierige Kunst des Zuhörens beherrschte.
»Und während ich dastand und darauf wartete, dass das alte Jahr verschwinden würde, blickte ich in mich selbst hinein, ja, ich sah so weit zurück wie möglich – bis zurück in den März.
Überall sah ich dasselbe ekelhafte kleine Geschöpf vor und zurück krabbeln – vor allem zurück oder in einem Bogen um sich selbst herum. Und ich sah, dass ich ein Tor war, ein widerwärtiges Phänomen. Ich war das, was die Menschen einen Sünder nennen – ein Sünder, schwarz wie die Nacht, wie der Schlamm, wie das dunkelste Wasser.«
Er verstummte und starrte meine Krawatte vorwurfsvoll an. Sie glauben, sie seien entweder schwarz oder weiß, dachte ich gelangweilt. Sie pendeln zwischen allerlei Übertreibungen hin und her und trauen sich nicht, Farbe zu bekennen. Weil sie nämlich grau sind, ganz einfach grau.
Ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der seine Haltungslosigkeit, seine Gleichgültigkeit und seine laue Feigheit lauthals verkündet hätte!
»Was ich dir jetzt erzählen will«, fuhr er fort und sah mir dabei ins Gesicht, »ist, wie ich drei wahnsinnige Monate lang den Spiegel der Selbstzucht vor mir hochhielt, bis ich ihn wutentbrannt zerschmetterte und wieder ich selbst wurde. Na, verstehst du, was ich meine?«
»Nun ja, schon … «, antwortete ich unangenehm berührt und schämte mich irgendwie ganz grundlos. Warum, um Himmels willen, machte er immer so ein Getue um sein »Seelenleben«? Das konnte durchaus Schaden nehmen, wenn man sich zu viel damit befasste.
»Hast du Millan Carlberg gekannt?«
Die Frage kam schnell und überraschend, dabei sah er fast verängstigt aus und sprach ihren Namen auf die gleiche schwebende, verlegene Art aus, wie man den eigenen Namen ausspricht.
»Ja, natürlich«, antwortete ich erstaunt.
»Und wie hast du sie gefunden …?«
»Ich – nun, ganz nett, ich habe sie kaum gekannt. Vielleicht etwas überspannt. Sie hat sich dann ja das Leben genommen, die Ärmste.«
»Ja, das war doch wirklich eigenartig«, bemerkte er munter. »Sie verlässt die Wohnung, so wie immer, nickt, sagt: Nein, ich komme nicht zum Tee zurück. Ich mache einen Spaziergang. Dann geht sie und kommt nicht wieder zurück. Sie kommt nie zurück. Irgendwann treibt sie dann im Hafen nach oben.«
Ich betrachtete ihn mit Widerwillen. Er lächelte mich an, wie ein Mäzen, wie ein Wohltäter. »Jetzt werde ich es dir erzählen. Bisher habe ich noch mit keinem Menschen darüber gesprochen.
Also. Hast du bemerkt, dass manche Menschen unser böser Geist sein können, die Inkarnation alles Bösen, was in uns steckt?
Na, hast du das noch nie bemerkt? Ein Mr. Hyde, den wir hassen und fürchten, der uns jedoch fasziniert.
Also, Millan Carlberg war so etwas. Als ich sie zum ersten Mal sah, begriff ich, dass wir aus demselben Holz geschnitzt waren. Diese schreckliche Person, sie verwendete meine Worte, meine Gesten, meine Gedanken! Es war, als würde man in einen konkaven Spiegel blicken, der alles verzerrt, aber in dem man sich selbst dennoch wiedererkennt.
Und das hast du nicht bemerkt? Hast es wirklich nicht wahrgenommen?