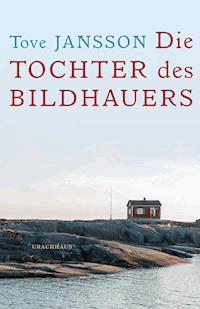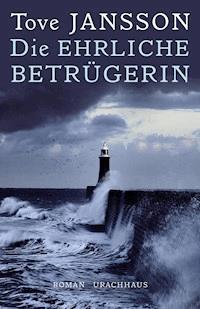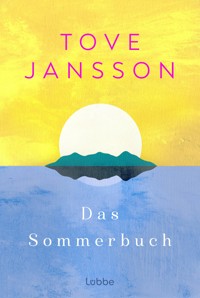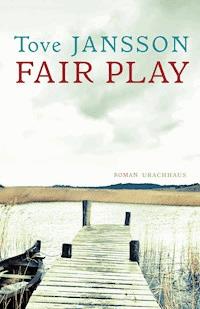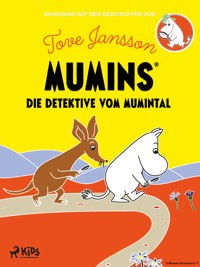Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Gästehaus in Florida, eine Handvoll Rentner am Ziel ihres Lebens und in Erwartung des Unausweichlichen, demgegenüber zwei junge, schöne Liebende. Ein Fundus an kräftig skizzierten Charakteren, überzeugend, skurril, lebensnah, jeder ein faszinierendes Original. Treffsicher und humorvoll, mit der ihr eigenen feinen Beobachtungsgabe erforscht Tove Jansson das Phänomen des Alterns. Das Resultat ist ein literarisches Juwel zu einem zeitlos aktuellen Thema, dessen Wert kaum überschätzt werden kann. St. Petersburg ist eine jener Sun Cities in Florida, in denen Rentner den Traum ihrer letzten Lebensjahre realisieren. Ein unwirklicher Ort, an dem wie in einem Wartezimmer Fremde auf Fremde treffen, unterschiedliche Gewohnheiten aufeinanderprallen, Irritation und Gelassenheit einander ablösen, und Lebensläufe, die sich niemals überschnitten haben, stetig und nebeneinanderher ihrem Ende entgegengleiten. Schonungslos – nichts beschönigend, nichts verschweigend – taucht Tove Jansson in die Gedankenwelt ihrer Figuren ein. Aber ihr liebevolles Verständnis für ihre schrulligen Helden ist so verlässlich wie die Sonne in Florida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tove Jansson
STADT der SONNE
Aus dem Schwedischen von Birgitta Kicherer
»SUN CITIES«,
diese wunderbaren friedlichen
Städte, wo wir ewigen Sonnenschein
garantieren, das Paradies auf Erden,
belebend wie alter Wein …
Zitat aus einem amerikanischen Prospekt
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
1
In St. Petersburg, Florida, ist es immer warm. Palmenpromenaden säumen das blaue Meer, die Straßen sind gerade und breit und die Häuser von lauschigen Büschen und Bäumen umgeben. Im vornehmen, passiven Teil der Stadt sind die meisten Häuser aus Holz und oft weiß gestrichen, mit offenen Veranden, wo die Schaukelstühle das ganze Jahr über in langen Reihen dicht nebeneinander stehen. Morgens ist es sehr still, und die Straßen liegen im ewigen Sonnenschein leer da. Nach und nach kommen die Gäste auf die Veranden heraus, steigen die Treppen herunter und begeben sich langsam zu The Garden oder einem anderen der besseren Lokale mit Selbstbedienung. Sie bewegen sich oft in Grüppchen oder paarweise. Etwas später setzen sie sich in ihre Schaukelstühle oder machen einen kleinen Spaziergang.
In St. Petersburg gibt es mehr Frisöre als anderswo, alle spezialisiert darauf, dünnes weißes Haar in kleine, luftige Löckchen zu legen. Hunderte von alten Damen wandern mit weiß gelockten Köpfen unter den Palmen, die Herren dagegen sind weniger zahlreich. In den Gästehäusern hat jeder sein eigenes Zimmer, oder man bewohnt es zu zweit, manche nur vorübergehend, um das gleichmäßige, warme Klima zu genießen, die meisten jedoch für die gesamte Zeit, die ihnen noch verbleibt. Krank ist hier niemand, also genau genommen bettlägerig, so etwas wird unglaublich flink von Krankenwagen erledigt, die jedes Mal ohne Martinshorn unterwegs sind. Zwischen und auf den Bäumen hausen viele Eichhörnchen und noch mehr Vögel, alle so zahm, dass ihr Benehmen fast an Frechheit grenzt. Viele Läden führen Hörgeräte und andere Hilfsmittel, in jedem Viertel wird mit leuchtenden, fröhlichen Farben für schnelle Blutdruckmessung geworben, außerdem werden umfangreiche Informationen in Sachen Rente, Einäscherung oder juristische Beratung offeriert. Auch gibt man sich viel Mühe damit, ein vielseitiges Angebot von Strickmustern und Garnen, Gesellschaftsspielen, Material für selbst gebastelte Broschen und Ähnliches vorrätig zu haben. In allen Läden kann der Kunde damit rechnen, immer freundlich und zuvorkommend bedient zu werden.
Wer den Palmenpromenaden bis hinunter ans Meer folgt oder hinauf zum Stadtpark und zur Kirche, begegnet weder Kindern noch Hippies oder Hunden. Nur an den Wochenenden sind Pier und Strandpromenaden voller Leute, die in das schöne St. Petersburg geströmt sind, um das Filmschiff Bounty zu besichtigen. Dann ist das Strandleben fröhlich und bunt, und die letzten Autos fahren erst in der Abenddämmerung weg.
Das Gästehaus Butler Arms liegt drei Blocks aufwärts in der Zweiten Avenue, es hat zwei Stockwerke, und vom Eckzimmer im Obergeschoss kann man ein Stück Meer sehen und die Takelage der Bounty, die abends beleuchtet ist. Die Veranda des Gästehauses Butler Arms ist schöner als die meisten anderen, sie hat ein geschnitztes Geländer und macht einen intimen, freundlichen Eindruck, weil nicht mehr als acht Schaukelstühle dort stehen. Im Übrigen sei erwähnt, dass das Haus sehr alt ist, fast fünfundsiebzig Jahre.
Zwei Mal täglich fährt Bounty-Joe auf seinem Motorrad durch die Straße, kurz vor elf, wenn die Kasse öffnet, und in der abendlichen Dunkelheit, wenn die Beleuchtung der Takelage angegangen ist. Er fährt mit Karacho, rasend schnell. Wenn er die Kurve bei Palmers Ecke nimmt, streckt er das eine Bein aus und lässt die Stiefelsohle über den Asphalt schlittern, danach ist alles wieder still. Bounty-Joe liebt Linda, das Zimmermädchen von Butler Arms.
Mrs. Elizabeth Morris, Nebraska, 77, hatte ihren Platz im zweiten Schaukelstuhl vom Geländer aus, bei der großen Magnolie. Direkt neben der Magnolie saß Mr. Thompson, der vorgab, taub zu sein, und an ihrer anderen Seite Miss Peabody, die sehr scheu war, somit konnte Mrs. Morris ungestört denken. Sie war erst vor Kurzem in St. Petersburg angekommen, ohne Begleitung und mit Halsschmerzen. Bei der Ankunft in Butler Arms hatte ihre Stimme endgültig versagt. Auf einer Seite in ihrem Notizbuch hatte Mrs. Morris ihren Namen und ihre momentane Verfassung notiert sowie die Tatsache, dass ein paar antike Möbelteile später ankommen würden. Das Schweigen hatte sie davor bewahrt, sich in voreiligem Eifer jemandem anzuvertrauen, eine Gefahr, die sonst durchaus bestand, wenn man nach einer langen, einsamen Reise irgendwo ankam. Als ihre Stimme wiederkehrte, war der heikle Zeitpunkt für vertrauliche Mitteilungen verstrichen, die anderen hatten sich daran gewöhnt, dass sie schwieg, und fragten nichts.
Elizabeth Morris war von kräftiger Statur und hielt sich ungewöhnlich aufrecht. Als einziges Zugeständnis an Make-up hatte sie die Augenbrauen mit einer schwungvollen Linie nachgezogen. Unter dem grauen Haar verliefen diese majestätischen Augenbrauen in einem dunklen Blau und verliehen ihrem Blick einen klaren, prüfenden Ausdruck. Allerdings kam es nur selten vor, dass jemand ihre Augen zu sehen bekam.
Miss Peabody beugte sich vor und sagte: »Sie haben so viele verschiedene Sonnenbrillen?«
»Drei«, antwortete Mrs. Morris. »Damit mache ich die Straße blau, braun oder rosa. Die blaue Straße ist die beste.«
Bounty-Joe fuhr auf seinem Motorrad vorbei, nach der Kurve heulte die Maschine auf und schoss in gerader Linie aufs Meer zu. Das hintere Schutzblech war mit einem großen weißen Kreuz bemalt.
»Der furzt noch lauter als ich«, bemerkte Thompson.
Sie warteten auf die Post. Miss Frey kam jeden Morgen mit der Post auf die Veranda, mal trug sie grüne Hosen, mal waren sie rosa, eine dürre alte Echse von fünfundsechzig Jahren in rosa Hosen.
»Weiber!«, grummelte Thompson, machte sich in seinem Stuhl steif wie ein Stock und stieß aus dem einen Mundwinkel einen langen, stöhnenden Heulton aus.
Peabody klammerte sich an Mrs. Morris und schrie: »Ein Anfall! Er hat einen Anfall, tun Sie was!« Elizabeth Morris zog ihren Arm heftig an sich, wie vor einem Biss. Weiter hinten auf der Veranda bemerkte Mrs. Rubinstein, Thompsons Darbietung sei, selbst als Generalprobe betrachtet, misslungen. Miss Peabody sah auf und flüsterte eine Entschuldigung, sie hatte kleine, schmale Schneidezähne und erinnerte stark an eine Spitzmaus. Mrs. Morris müsse verstehen, so sei es immer mit ihr, sie sei viel zu impulsiv, lasse sich viel zu leicht täuschen, dafür könne sie nichts …
Der Morgen war kühl und frisch und roch nach Gras. Der Geruch nach Gras ist überall gleich, wo man einen Rasen mäht, egal wo, dachte Elizabeth Morris. Ich hätte meinen Arm nicht zurückziehen sollen! Jedes Mal, wenn jemand mich anfasst, ist es dasselbe, und jetzt habe ich eine Maus gekränkt. Die Schaukelstühle standen zu eng nebeneinander. Hannah Higgins war die Einzige, die schaukelte, sie schaukelte immer, vor und zurück, friedlich und langsam. Sie hatte ihre Eierschachtel aus Styropor hervorgeholt, dazu Schere und Stift. Mit großem Geschick schnitt sie Lilien mit tiefem Kelch und vier nach außen geöffneten Blütenblättern aus, eine nach der anderen. Diese Lilien standen immer an Ostern auf dem Klavier; zu Weihnachten schnitt Mrs. Higgins Schneeflocken und Ähnliches aus, erstaunlich, was man alles aus Eierschachteln fabrizieren kann. Hinter den starken Brillengläsern folgten ihre kurzsichtigen Augen aufmerksam dem Weg der Schere, das breite Gesicht war von unzähligen mikroskopischen Runzeln überzogen, fein verteilt wie bei Krepp-Papier. Im Juni wurde sie achtundsiebzig.
Mrs. Morris hatte festgestellt, dass einiges an Aufmerksamkeit nötig war, um einen Schaukelstuhl am Schaukeln zu hindern, die kleinste Bewegung setzte ihn in Gang. Sie lernte es schnell, aber immer wenn sie sich aus dem verflixten Möbelstück erhob, waren ihr die Beine von aufgestauter Anspannung steif geworden. Manchmal fragte sie sich, ob es wohl allen so erging. Als Miss Frey aus dem Vestibül trat, sagte sie: »Hallo, alle miteinander! Und wieder ein Tag mit Sonnenschein!« Das sagte sie jeden Morgen, aber heute war sie müde und sagte es mit schärferer Stimme als sonst. Sehr unvorsichtig, wie von Dämonen gesteuert, nahm sie ausgerechnet Mrs. Rubinstein aufs Korn, hielt direkt auf sie zu und äußerte in einem Tonfall, mit dem man sonst sehr kleine Hunde oder die Kinder anderer Leute anspricht: »Ein Brieflein! Die Post hat ein Brieflein gebracht!« Die voluminöse schwarzäugige Frau machte langsam eine halbe Umdrehung und durchbohrte Miss Frey mit dem Blick, sah ihr in das geschminkte, verbrauchte Gesicht unter der Perücke, dann senkte sie genauso langsam die Augen und musterte den Brief, ohne ihn entgegenzunehmen. Jetzt wird sie wieder unanständig, das wussten alle. Miss Freys Hand hatte zu zittern begonnen. Endlich sprach Mrs. Rubinstein, mit vernichtender Liebenswürdigkeit sagte sie: »Meine liebe Miss Frey. Ein ganz eigenes Brieflein mit einem ganz eigenen kleinen Werbeprospekt. Für Plastikartikel. Mein Feingefühl, Miss Frey, einzig und allein mein Feingefühl verbietet mir, Ihnen zu sagen, was Sie mit diesem Brief machen können.« Und mit einem kurzen, heiseren Lachen machte sie deutlich, wohin sich Miss Frey den Brief stecken könne. Thompson setzte sich auf und fragte: »Was hat sie gesagt? Wieder etwas Unanständiges?«
»Nichts von Bedeutung«, antwortete Mrs. Morris.
Miss Frey wurde rot, gab Mrs. Rubinstein einen neckischen Klaps auf die Schulter und rief: »Wer ist denn da so unartig«, ließ die Post auf den Boden fallen und ging.
»Was hat sie gesagt?«, wiederholte Thompson.
Durch Elizabeth Morris’ Sonnenbrille wurde der Rasen blau, die leere Straße fern wie auf dem Mond, und der blaue Thompson sah ungewöhnlich krank aus. Sie sagte beruhigend: »Nichts Wichtiges. Mrs. Rubinstein hat versucht, einen Scherz zu machen.«
»Aber was hat sie denn gesagt, was hat sie gesagt!«, beharrte Thompson. Er hievte sich aus dem Stuhl, schob sein schiefes, kleines Gesicht dicht heran und schrie: »So ist es immer mit euch Weibern, nie darf man wissen, wenn es was zum Lachen gibt! Genauso gut könnte man tot sein! Total mausetot, und das könnten Sie auch sein, wie auch immer Sie heißen!«
Mit der Hand hinterm Ohr blieb er stehen und wartete, während sich auf der ganzen Veranda bleierne Stille ausbreitete. Mrs. Morris nahm ihre Sonnenbrille ab. Jetzt, da der Kerl nicht mehr blau war, sah er einigermaßen normal aus. Mit kühler Stimme erwiderte sie, Mrs. Rubinstein habe vermutlich darauf angespielt, dass Miss Frey sich mit dem betreffenden Brief den Hintern wischen könne. Thompson hörte aufmerksam zu und setzte sich dann wieder in den Schaukelstuhl. »Sehr komisch«, sagte er und richtete den Blick auf die Straße. »Meine Damen, Sie sind umwerfend witzig.«
Kann ja sein, dass die frontale Platzierung der Schaukelstühle, mit Blickrichtung geradeaus, die einzige praktische Möglichkeit ist. Vermutlich, dachte Mrs. Morris, ist es schwierig, Schaukelstühle in Gruppen zu arrangieren, also aufeinander zuschaukelnd, das erfordert viel Platz und kann auf die Dauer ermüdend sein. Eigentlich besteht die ursprüngliche Idee des Schaukelstuhls aus einem einzigen Möbelstück, das sich in einem ansonsten statischen Raum in Bewegung befindet.
»Ich muss gehen«, erklärte Miss Peabody. »In meinem Zimmer wartet Handwäsche.« Sie begann zu schluchzen und verließ schnell die Veranda. Mrs. Higgins bemerkte: »Die arme Kleine, jetzt ist sie wieder außer sich.« Mrs. Rubinstein steckte sich eine neue Zigarette an und erwiderte: »Alle Peabodys sind zu allen Zeiten auf ihr Zimmer gerannt, wenn sie außer sich geraten. Sie sind so schrecklich mitfühlend und müssen immerzu getröstet werden.« Dann schlug sie die Zeitung auf und las verächtlich und gut informiert über den Lauf der Welt. Es war die vierte Zigarette vor dem Lunch. Rebecca Rubinstein war einundachtzig. Ihr Haar bildete eine weiße Tiara, unterhalb der gesenkten Augenlider hatten die glatten, schweren Wangen noch die Farbe einer etwas zu reifen Frucht.
Mausetot, dachte Elizabeth Morris und schloss hinter ihrer Sonnenbrille die Augen, als würde sie schlafen, damit hat er seinen großen Hit gelandet. Das war nicht fair, aber irgendeine Freude muss man dem alten Furzer schließlich gönnen. Ich glaube nicht, überlegte sie, ich glaube nicht, dass es noch besonders viele Dinge gibt, die mir richtig Angst machen. Vielleicht Nebraska und Vertrauensseligkeit, auch gewisse Formen von Musik, aber der Tod gehört nicht dazu. Nicht der Versuch, andere zu beeindrucken, und nicht der Tod. Sie vergaß, die Angst vor dem Zimmer zu erwähnen – das Zimmer, das man offen hinter sich zurücklässt, kann zu einer kläglichen Bloßstellung werden, man muss die verräterischen Spuren und Anzeichen des Alters verstecken, kleine unästhetische Zeichen der Vergesslichkeit, all jene Konstruktionen der Hilflosigkeit, die sich so unbemerkt und so offensichtlich einschleichen. Mrs. Morris versteckte das alles, sie versuchte, die Würde der Dinge wiederherzustellen, und strengte sich bis zum Äußersten an, um Linda täglich ein leeres, unpersönliches Zimmer übergeben zu können. Nachdem sie sich angezogen und das Zimmer versteckt hatte, war sie meistens erschöpft, traute sich jedoch nie, auf der Veranda einzuschlafen. Man könnte schnarchen, der Mund könnte aufklappen. Lindas Staubsauger dröhnte hin und her durch den Flur, manchmal schlug er an die Wände und fuhr dann weiter. Mrs. Morris schlief ruhig ein, ihr Kopf sank auf die Seite, sie schlief ganz geräuschlos, mit geschlossenen Zähnen.
Am anderen Ende der Veranda erhoben sich die Schwestern Pihalga beide gleichzeitig, sie nahmen ihre Bücher mit und wanderten langsam zum Meer hinunter. Während sie lasen, waren die Schwestern Pihalga von allem, was ringsum geschah, vollkommen abgeschottet. Und sie lasen fast immer.
Als Evelyn Peabody die Treppe nach oben stieg, eine Stufe nach der anderen, schleppte sie ihr großes Mitgefühl mit, das immer dann, wenn sie ihre eigene Meinung nicht zu verteidigen wagte, anschwoll und schwer und unhantierbar wurde. Wort für Wort und Stufe für Stufe ging sie das würdelose und unnötige Gespräch auf der Veranda durch. Oh, diese Menschen, die mit Worten um sich warfen, als würden sie Steine werfen oder Abfall wegschmeißen, und der arme alte Mr. Thompson, der von allem ausgeschlossen war! Er fand, dass er genauso gut tot sein könnte. Und sie war davongelaufen und hatte wieder mal geflunkert! In ihrem Zimmer wartete keine Handwäsche. Wie kam es nur, dass jemand, der die Wahrheit liebte, so oft flunkern musste, und dass es jemandem, der die Gerechtigkeit liebte, so schwer fiel, zu kämpfen! Er könnte genauso gut tot sein! Entsetzlich! Aber er hatte völlig recht, ein Herr von achtzig Jahren hat sich sehr viel länger durchgeschlagen, als ihm zusteht. Sie selbst war vierundsiebzig, für eine Dame war das gar nichts. Arm war er zudem noch, bekam hier das Gnadenbrot und hatte allem Anschein nach ein langes, liederliches Leben hinter sich. So kann’s gehen, wenn man nicht aufpasst!
Miss Peabody beschloss, freundlich zu ihm zu sein und ihm so viel Sympathie wie möglich entgegenzubringen. Ja, das würde sie tun, obwohl er ein wirklich abscheulicher und übellauniger alter Mann war. Sie nahm einen Schal und wusch ihn kurz durch, um der Wahrheit willen. Dann holte sie ihr langes Graues hervor und begann, die Knöpfe am Rücken zu versetzen. Man schrumpft im Laufe der Zeit. Und Nähen beruhigt die Gedanken. Ihr Leben lang hatte Evelyn Peabody Kleider genäht, alte Kleider geändert, gewendet, enger und weiter gemacht. Man braucht Geschicklichkeit und Ausdauer, um das Abgetragene und schief Geratene zu verbergen und das Schöne zu betonen. Später, im Modesalon, waren die Stoffe zwar neu, aber die Kunst, etwas zu verbergen oder zu betonen, blieb immer noch gefragt. Sie nähte flink und sicher. Inzwischen hielten ihre Augen nur jeweils für eine halbe Stunde. Miss Peabody nähte ausschließlich für sich selbst, für sonst niemanden mehr. Während sie die Nadel in fliegender Hast durch den Stoff stach, lange Reihen gleichmäßiger kleiner Bisse, wanderten ihre Gedanken wie immer zu den Damen zurück, die Schweißlappen unter den Armen haben wollten, zu diesen Damen, die sie nie wiedererkannt hatten, weil sie nur in den Spiegel schauten, und nachdem sie die Damen fertig gedacht hatte, kam sie zu dem traumhaften Morgen, als Evelyn Peabody in der Staatlichen Lotterie den Hauptgewinn bekam. An jenem Morgen hatte niemand gearbeitet. Miss Arundell schrie: »Herrje, ausgerechnet sie! Schaut sie euch an, sie ist ganz weiß im Gesicht vor Freude …« Die Kolleginnen fragten: »Was wirst du dir jetzt kaufen?«, und sie rief: »Sonne! Sonne! Ein eigenes Zimmer für mich allein!« So hatte sie geantwortet, ohne einen Augenblick zu überlegen. Sie, diese kleine Person, der es immer kalt war, hatte auf eigene Faust gewonnen, mit ihrer ganz eigenen Losnummer, und endlich war der Gerechtigkeit Genüge getan.
Als Linda mit frischen Handtüchern hereinkam, stand Miss Peabody auf, das tat sie immer, wenn Linda ihr Zimmer betrat. Das war ein Ritual. Jedes Mal wurde sie von diesem ruhigen, blendenden Lächeln überwältigt, das so unglaublich schön war, und erwiderte es mit der Hand vor dem Mund. Linda ging ohne Eile ins Badezimmer. Sie trug immer Schwarz, und ihr schwarzes Haar fiel ihr als funkelnde Masse über den Rücken. Ihr makelloses blasses Gesicht war von einer Art leichter Trauer überschattet, die total in sich selbst ruhte. Linda ist ein mexikanischer Name und bedeutet lieblich, anmutig.
Auf der Veranda fuhr Hannah Higgins, die Eierschachtel immer dicht vor der Nase, damit fort, Lilien auszuschneiden, eine Lilie nach der anderen wurde auf ihrem Schoß aufgereiht. Sie teilte mit, dieses Jahr gebe es keine gelben Pfeifenreiniger, darum müssten die Blütenstempel eben grün werden.
Aus alter Gewohnheit überlegte Mrs. Rubinstein, ob sie irgendeine unanständige Bemerkung über Blütenstempel machen sollte, doch dann verging ihr die Lust dazu und sie ließ ihre schweren Lider über die große Verachtung sinken, sie verachtete Osterschmuck, Veranden, angenehmes Klima und eigentlich alles, was sich an einem schönen, leeren Tag in St. Petersburg, Florida, so verachten lässt.
Thompson schlief. Und jetzt, sagte Mrs. Higgins, jetzt komme ja bald der Frühlingsball, und sie für ihren Teil habe vor, dabei Schwarz zu tragen, für alte Frauen sei das eine gute Farbe, zumindest dort, wo sie herkomme, und auch wenn man zu dick sei. Plötzlich ließ sie los, was sie gerade in den Händen hielt, legte den Kopf zurück und lachte, erstaunlich hell, ein fast unschuldiges Lachen. Thompson könne ein passender Kavalier sein – die eine sehe nichts und der andere höre nichts! Das sei doch komisch, oder? Mrs. Rubinstein hörte zerstreut zu, während sie ihre schönen alten Hände musterte und die Ringe, die ihre Finger schmückten. Abraschas Ring war der größte, sie trug ihn ständig, obwohl er so vulgär war. Abraschas monatlicher Brief hatte sich um vier Tage verspätet. Eierschachteln. Osterglocken. Eine alte Frau vom Lande in Schwarz. Sie wandte ihr großes Gesicht mit der markanten Nase der Straße und Friendship’s Rest zu, das genau gegenüber lag. Dort waren alle vom Frühstück zurückgekehrt, sämtliche Schaukelstühle waren besetzt. Ein Dutzend weißer Gesichter, die geradeaus starrten, ein Dutzend alter Ärsche in je einem Schaukelstuhl, dachte Mrs. Rubinstein. Und bald werden sie ihre Ärsche auf dem Frühlingsball im Senior’s Club schwingen. Unhörbar und verächtlich fügte sie hinzu: »Gojim naches«, was übersetzt bedeutet »die Narreteien der Christen«.
Miss Peabody stand hinter einer Palme und wartete. Kurz vor zwölf pflegte Mr. Thompson Palmers unten an der Ecke aufzusuchen, um sich ein Bier zu genehmigen. Es hieß, damit wolle er allen, die zum Lunch gingen, seine Geringschätzung zeigen, aber es konnte auch damit zu tun haben, dass er sich nicht gleichzeitig Lunch und Bier leisten konnte und daher das wählte, was ihm am liebsten war. Jetzt hörte sie seinen Stock auf die Straße klopfen, das Klopfen kam näher und näher, bis Peabody plötzlich hinter ihrer Palme hervorschoss und ziemlich laut sagte: »Ein Glas Bier wäre jetzt vielleicht ganz nett?«
»Bier?«, entgegnete Thompson, während er an ihr vorbeischlurfte. »Und was hindert Sie daran, Bier zu trinken?« So aus der Nähe merkte sie, dass er sich nicht so oft wusch, wie er eigentlich sollte, und dass er sauer war. Hintereinander gingen sie schweigend in Richtung Palmers, er voraus und sie hinterher. An der Ecke kam ihnen Mrs. Morris entgegen, eingekapselt in ihre distanzierte Privatheit. Peabody zupfte sie am Mantel und flüsterte erregt: »Darf ich Sie zu einem Glas Bier einladen?«
»Das glaube ich kaum«, erwiderte Mrs. Morris, doch Peabody, diese verwirrte Person, blieb stehen und begann zu erklären, Thompson sei zwar ein unangenehmer alter Herr, aber trotzdem sei es wichtig, ihn jetzt zu trösten, schließlich müsse man sich immer bemühen, das Beste zu tun, und in jedem Menschen stecke etwas Gutes …
»Beruhigen Sie sich«, sagte Mrs. Morris. »Lieber nicht zu viel erklären.« Sie betraten das Lokal, während ihr der flüchtige Gedanke durch den Kopf ging, dass Mitleid oft aus Schuldgefühlen entspringt und Verachtung erzeugt. Tugenden, die aus Klischees entsprangen, waren in ihren Augen banal, und ohnehin konnte sie Miss Peabody nicht leiden. Die Bar war leer. Sie setzten sich an die Theke, Thompson ans hintere Ende, wo er drei Bier und ein Sandwich bestellte. Der enge Raum war schummrig und langgestreckt, am hinteren Ende die Tür, eine normale Bar mit Regalen voller Flaschen und jenem nutzlosen Schnickschnack, der jedes Regal in jeder Bar zu füllen pflegt, dahinter die Spiegelwand und die halb verdeckten Gesichter der Gäste, genauso zufällig und anonym wie alles Übrige hier. Der Barkeeper schwieg und wandte ihnen den Rücken zu.
»Nett ist es hier«, flüsterte Peabody. »Sie werden es nicht glauben, Mrs. Morris, aber ich bin noch nie in einer richtigen Bar gewesen.« Das Bier schmeckte bitter. Peabody legte die Arme auf die Bartheke und spürte, wie gut das dem Rücken tat. So hohe Tische sollte es überall geben, das wäre äußerst erholsam und angenehm. Die farbenfrohen Regale vor dem Spiegel weckten das Gefühl, in einer fremden Welt zu sein, fern von St. Petersburg. Thompson kaute wortlos an seinem Sandwich. Unauffällig holte Peabody einen Fünfdollarschein heraus und behielt ihn zerknüllt in der geschlossenen Hand, vielleicht war es noch zu früh und würde Thompson nur reizen. Jetzt stehe ja der Frühlingsball vor der Tür, ob Mrs. Morris sich schon im Senior’s Club eingetragen habe? Das solle sie tun, dort gebe es so viele Möglichkeiten zum Zeitvertreib, Hobbyräume, Bridge, Gymnastik und Chorgesang, man müsse nur über sechzig sein, mehr nicht.
»Tatsächlich?«, sagte Mrs. Morris.
»Ja. Hier wird so viel für die Senioren getan. Glauben Sie mir, nirgends auf der Welt tut man so viel für uns. Ewiger Sommer und ringsum dieses Meer!« Mrs. Morris bemerkte, diese letzteren Dinge seien eventuell natürlichen Ursprungs. Thompson sagte: »Noch eins. Aber ein bisschen fix.«
»Mrs. Morris«, sagte Peabody, »stellen Sie sich mal vor, ich bin bisher noch nie in einer richtigen Bar gewesen!«
»Ja, das haben Sie erwähnt.«
»Hab ich das?«, sagte Peabody vage. »Ja, kann sein.« Sie schwieg eine Zeit lang und bemerkte dann, der Frühlingsball sei genauso wichtig wie der Herbstball. Jeder tanze auf eigene Verantwortung, bei Tango und Walzer würden die Scheinwerfer rotieren. Im Ballsaal sei Rauchen oder Trinken verboten. Die Kleider seien fantastisch. Viele Damen nähmen an der großen Hutparade teil, das sei ein Wettbewerb um den schönsten Hut in St. Petersburg. Und regelmäßig trage Mrs. Rubinstein den Preis davon!
»Chips«, verlangte Thompson. »Und Musik. Der erste Walzer geht auf Palmers.« Der Barkeeper machte die Jukebox an, worauf ein lang gezogener, halb geheulter Cowboy-Blues die Bar in voller Lautstärke erfüllte. Elizabeth Morris erschauerte, sagte aber nichts, sie musste sich daran gewöhnen, das musste sie, überall war Musik, da gab es kein Entrinnen. Jetzt knatterte das Motorrad um die Ecke, der schöne Junge von der Bounty stürmte zur Tür herein und an die Theke. »Hi«, sagte er, »nichts für mich gekommen?«
»Nein«, antwortete der Barkeeper.
»Kein Brief, gar nichts? Nichts aus Miami?«
Der Barkeeper sagte: »Gar nichts.«
Joe stürmte wieder hinaus, ohne die anderen auch nur anzusehen, dann röhrte das Motorrad weiter die Straße hinunter.
»Also, wenn man tanzen möchte«, sagte Peabody, »habe ich schon erwähnt, dass man sich am besten auf eine der vordersten Bänke setzt, wenn man tanzen möchte? Dann wissen sie, was man will.«
»Wer?«
»Die Herren.«
»Und wo gibt es diese Herren?«, fragte Mrs. Morris.
»Die zirkulieren, allzu viele sind es nicht …«
»Sind gestorben«, erklärte Thompson. Er hatte alles gehört. Peabody drehte sich heftig zu ihm um und legte ihm die Hand auf den Arm, aber als Mrs. Morris »Na, na« machte, zog sie die Hand zurück. Die Jukebox kratzte im Leerlauf und ließ dann eine neue Platte herab, diesmal war es Rock. Vielleicht fand Thompson Rock gut, er ließ den Kopf in die Hände sinken. Möglicherweise versuchte er auch nur, seine Ohren zu schützen, oder er war ganz einfach müde. So unauffällig wie möglich schob Peabody ihm ihren Dollarschein unter den Ellbogen. Sofort senkte er den Arm, um das Geld zu sichern. »Noch drei«, bestellte er.
»Zwei«, sagte Mrs. Morris. Ob Miss Peabody denn gern Bier trinke?
Eigentlich nicht so sehr gern, ehrlich gesagt gar nicht, aber die Bar gefalle ihr. Peabodys Gedanken waren leicht und unbekümmert und flatterten immer wieder davon. Vielleicht wolle Mrs. Morris wissen, was sie früher, bevor sie nach St. Petersburg kam, gemacht habe? Aber Mrs. Morris sagte nichts, lächelte nur schwach hinter ihrer Sonnenbrille. Da wandte sich Peabody dem Barspiegel zu und dachte: Und wenn schon! Sie wird nie verstehen können, wie es war. Schneiderin?, wird sie sagen. Ach? Tatsächlich? In der Lotterie? Wie schön! Dann erzähle ich, dass wir eine große Familie waren, und jetzt bin ich als Einzige übrig. Wie traurig, wird sie antworten, und dann sitzen wir da, und nichts ist gesagt worden. Blaue Augenbrauen, aber keine Augen!
Thompson begann wieder zu stöhnen und den Kopf hin und her zu rollen. Von mir aus, dachte Peabody ärgerlich, kannst dich ruhig aufführen, wie du willst, ich muss schließlich nicht als Einzige nett sein.
»Gute Musik!«, sagte Thompson plötzlich. »Wenn schon Lärm, dann aber ordentlich, und ausnahmsweise schaffen sie es sogar, den Takt zu halten. Peabody, steck noch was in die Box, ich hab gerade kein Kleingeld.«
Mrs. Morris machte eine plötzliche Bewegung, ließ es dann aber gut sein. Wenn sie Lärm brauchen, dann bitte, sollen sie doch. Im Übrigen machten sich die Kopfschmerzen bereits bemerkbar, ganz unten im Nacken. Sie biss die Zähne zusammen und wartete, bis die anderen ihr Bier ausgetrunken hatten.
Als sie zu Butler Arms zurückkamen, hielt Thompson ihnen die Tür auf und sagte mit höflichem Spott: »Bitte sehr, die Damen.« Peabody, aha, sie hieß also Peabody. Eine ängstliche, egozentrische Mäuseperson, kinnlos und mit weißen Haarflusen auf dem Kopf. Aber sie hätte, natürlich, noch schlimmer sein können.
Am Abend, als die Touristenbusse eine Pause einlegten, fuhr Joe wieder zu Palmers, um nachzufragen, doch da war immer noch keine Post. Er erklärte, vielleicht handle es sich nicht einmal um einen Brief, nur um eine Karte mit einem Kreuz und einer Adresse. Schon bei einem an ihn adressierten Zettel mit einem Kreuz darauf wisse er, was er zu tun habe.
»Was heißt da schon Kreuz«, sagte der Barkeeper und breitete bezahlte Rechnungen auf der Theke aus, alle mit einem Kreuz durchgestrichen. »Hinter was bist du eigentlich her?« Joe antwortete, er warte auf ein Zeichen, um aufzubrechen, nach Miami oder sonstwohin, es sei sehr wichtig. Der Fahrer aus dem Gästehaus Las Olas teilte mit, seiner Meinung nach gehe es hier um Schmuggel, und gewisse Leute sollten lieber mal zur Abwechslung nach ihrer alten Großmutter in Tampa schauen.
»Ihr ekelt mich an«, sagte Joe. Der Barkeeper konterte: »Jesus, heutzutage ist keiner von euch noch normal, egal, ob ihr uralt seid oder neugeborene Babys.« Da beugte sich der Junge weit über die Theke und schrie: »Hey, du! Du hast ja keine Ahnung von Jesus!«, dann stürmte er zur Tür hinaus und fuhr mit aufheulendem Motor davon. Einer der Kunden grinste und sagte: »Das sind doch diese Jesuskinder, die auf den Straßen herumhängen und sich vom Staat versorgen lassen, in Miami haben sie so eine Art Lager. Die fahren voll auf Jesus ab, haben sich irgendwo im Norden angesteckt.«
»Hippies?«, fragte der Barkeeper.
»Nein, keine Hippies mehr. Das hier ist was anderes.«
»Krawall und Randale«, sagte der Barkeeper. »Der gleiche Krawall, nur auf andere Art.«
2
Über Mittag hatte Linda zwei Stunden für sich allein, die verbrachte sie meistens in ihrem Zimmer. Es war ein kleines, schönes Zimmer, weiß getüncht und durch das dichte Grün des Hinterhofes vor der Hitze geschützt. Über dem Bett hatte Joe den Altar angebracht und das Regal ordentlich festgedübelt, damit es gerade hing. Die Gottesmutter stand inmitten ihrer Plastikblumen und der kleinen Zucker-Totenköpfe aus Guadalajara, direkt darüber hatte er die Lampe angeschlossen. Joe respektierte die Madonna, interessierte sich aber mehr für Jesus, sie sprachen nicht oft über diese beiden, denn warum sollte man sich über Dinge unterhalten, die so selbstverständlich waren wie die Sonne und der Mond? Die Madonna lächelte ständig. Unter ihr war Miss Freys Klingel, daneben hingen die Schlüssel des Hauses.
Linda zog sich aus und legte sich nackt aufs Bett, in vollkommenem Frieden, die Hand unter der Wange. Es war ein gutes Bett mit robuster Federung. Schöne Bilder begannen vorbeizugleiten, eines angenehmer als das andere. Zuerst kam die Mama, dann Joe. Mama war groß und ruhig und arbeitete viel; um ihre Tochter, die es gut getroffen hatte, brauchte sie sich keine Sorgen zu machen. In ihrem schwarzen Kleid, den Korb auf dem Kopf, wanderte die Mama in Guadalajara hin und her, in den Marktschatten hinein und wieder in die Sonne hinaus. Sie sorgte für ihre Familie. Joe ging es gut, er hatte eine feste, anständig bezahlte Anstellung. Nachdem Linda an die beiden gedacht hatte, ließ sie Silver Springs näher kommen. Sie hatte Silver Springs noch nie gesehen. Dort gab es einen Dschungelfluss mit kristallklarem Wasser, und am Ufer hüpften Äffchen umher. Für einen Dollar konnte man an Bord eines Flussboots mit gläsernem Boden Fische beobachten, die über weißem Sand vorbeischwammen. Der Dschungel neigte sich zu beiden Seiten tief über den Fluss, ein weiches grünes Dach, das sich Hunderte von geschützten Meilen weit ins Innere Amerikas erstreckte, alles war vom Staat unter Naturschutz gestellt, dort gab es weder Schlangen noch Skorpione.
»Liebe Madonna«, flüsterte Linda, »lass mich Joe am Ufer des Dschungelflusses lieben. Danach, in deiner Gnade, waten wir hinaus ins Wasser und schwimmen langsam nebeneinander immer weiter weg.« Sie streckte den Arm hoch und knipste die Lampe der Madonna an, nicht um zu leuchten, sondern um die Madonna zu ehren. Dann legte sie sich die Hände auf den schönen Bauch und schlief ein.
Bounty-Joe weckte sie, er stand im Hof vor dem Fenster und rief: »Hi! Die haben mich vergessen, die haben es nicht ernst gemeint.«
Linda blieb still liegen und sah ihn an, sie sagte, man müsse Geduld haben. Ein Haus zu finden, das nichts kostet, könne lang dauern, und nicht in allen Häusern, die abgerissen werden sollten, dürfe man wohnen. Die Polizei in Miami sei gefährlich. Er kam herein und setzte sich, von ihr abgewandt, aufs Bett. »Ich kann nicht mehr warten, und ich weiß nicht, wo sie sind. Die können überall sein, hierher kommen sie nie, hierher kommt überhaupt nichts. Vielleicht haben sie einen Platz gefunden, ein Lager, eine Höhle, einen Schuppen, was weiß ich! Sie haben es schon längst gefunden und vergessen, mir zu schreiben. Und du weißt«, fuhr er streng fort, »du weißt, sofort, wenn ich etwas von ihnen höre, fahre ich los, die Zeit wird knapp, ich verschwinde, egal, ob du mitkommst oder nicht!«
»Ich weiß«, sagte Linda.
»Und du bleibst.«
»Ich habe einen guten Job«, sagte sie. »Und Papiere, die gelten bis Weihnachten.«