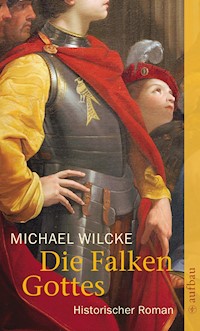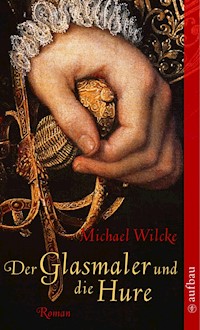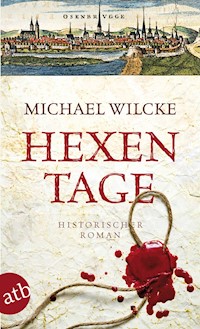8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Salzburg im Jahr 1658: In einer eisigen Nacht wird die schwangere Sybilla von ihrer Mutter in eine Kutsche gesteckt, die sie nach Rosenheim bringen soll. Bevor die Kutsche abfährt, raunt die Mutter ihr noch zu, dass ihr Kind des Teufels ist. Sybilla hingegen hat sich längst entschieden, für ihr Kind zu sorgen.
Zwanzig Jahre später beschließt dieses Kind nach Salzburg zurückzukehren, um seine Mutter zu rächen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Michael Wilcke
Der Bund der Hexenkinder
Historischer Roman
Impressum
ISBN E-Pub 978-3-8412-0190-4
ISBN PDF 978-3-8412-2190-2
ISBN Printausgabe 978-3-7466-2656-7
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2011
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Orginalausgabe erschien 2010 bei Aufbau Taschenbuch,
einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlin
unter Verwendung zweier Motive von Bridgeman Art Library
und eines Motivs von © Soubrette/iStockphoto
Kartenillustration: Jessica Krienke
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Prolog
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Zweiter Teil
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Dritter Teil
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Nachwort
Prolog
Sybilla keuchte. Ihre Mutter Josefa hielt ihre Hand in einem festen Griff und zerrte sie so hastig durch die engen Gassen Salzburgs, als wäre sie eine Aussätzige, die den Menschen in der Stadt den Tod bringen würde. Mehrere Male stolperte Sybilla, doch die Mutter riss dann sofort heftiger an ihrem Arm, damit sie weiterlief. Die klirrende Kälte an diesem Januarmorgen des Jahres 1658 kniff wie eine Zange in Sybillas Wangen, und bei jedem Schritt über den vereisten Boden glaubte sie, auszurutschen und zu stürzen.
Die Domuhr schlug zur sechsten Morgenstunde. Aus einigen Häusern waren Stimmen zu hören und hier und da das Klappern von Türen. Die Bürger Salzburgs bereiteten sich auf den neuen Tag vor, doch noch blieben die dunklen Straßen verlassen. Nur einige magere Hunde strichen umher. Sybilla strauchelte erneut und sackte schmerzhaft auf die Knie. Dieses Ungeschick brachte ihr zwei klatschende Maulschellen ein, die ihr Josefa mit zornigem Gesicht verpasste. Sybilla hob abwehrend die Hände, um sich zu schützen, und wimmerte. In den sechzehn Jahren ihres Lebens war sie häufig von ihrer Mutter mit wütenden Worten gescholten worden, doch nie zuvor hatte sie sich so erniedrigt gefühlt wie in diesem Moment, als sie hier in der Kälte auf den Knien geohrfeigt wurde.
Josefa griff in Sybillas Haare und zog sie grob zurück auf die Beine.
»Eil dich!«, schimpfte ihre Mutter. »Wenn die Kutsche ohne dich abfährt, treibe ich dich auf deinen Füßen aus der Stadt.«
Sybilla schwieg nur und versuchte, mit Josefa Schritt zu halten. Sie konnte verstehen, dass ihre Mutter so hartherzig mit ihr umging. Die Sünde, die sie auf sich geladen hatte, rechtfertigte diesen Zorn. Und doch wünschte sie sich einige tröstende Worte, denn sie war im Begriff, Salzburg für lange Zeit, vielleicht sogar für immer, zu verlassen und damit auch alle Menschen, die ihr lieb und teuer waren.
Vor allem quälte sie der Gedanke, dass sie sich nicht mehr von Sebastian hatte verabschieden können. Die Trennung trieb ihr die Tränen in die Augen.
Sie erreichten die Bürgerstadt und kamen bald am Waagplatz an. In den vergangenen Jahren hatte Sybilla hier zu mehreren Gelegenheiten inmitten einer dichtgedrängten Menschenmasse verfolgt, wie die sechsunddreißig Mitglieder des Rates unter freiem Himmel auf hufeisenförmig angeordneten Bänken Platz genommen hatten, um auf der Schranne das Gericht abzuhalten. An diesem Morgen war der Platz verlassen, und doch fühlte sich Sybilla, als hätte man auch über sie ein Urteil gesprochen und eine schreckliche Strafe verhängt.
Am Rande des Waagplatzes trafen sie auf eine vierspännige Kutsche, vor der zwei Männer und eine Frau standen, die sich frierend die Arme rieben. Ein schlaksiger Kerl, wahrscheinlich der Kutscher, verstaute derweil Gepäckstücke auf dem Dach des Wagens und schwenkte dabei eine Laterne.
Josefa ließ Sybillas Hand los und trat auf den Mann mit der Laterne zu. Während die beiden miteinander sprachen und die Mutter ihm einige Münzen reichte, legte Sybilla eine Hand auf ihren Bauch, der sich bereits ein wenig wölbte. Der Gedanke an das Kind, das sie erwartete, machte ihr das Herz schwer. Nachdem das Geheimnis um ihre Schwangerschaft verraten worden war, hatte man Sebastian gezwungen, sich von ihr abzuwenden. In der vergangenen Woche war er ihr ausgewichen, und sie hatten nicht mehr miteinander sprechen können. Hatte er sich so schnell damit abgefunden, dass sie Salzburg verlassen und er sein Kind womöglich niemals zu Gesicht bekommen würde? Sie wollte das nicht glauben.
Eine Hand legte sich auf ihre Schulter und zog sie rüde herum. »Verflucht sei er, der Bankert!«, zischte die Mutter mit einem giftigen Blick auf Sybillas Bauch. Josefa schüttelte verständnislos den Kopf. »Warum nur straft mich Gott mit dieser Schande.« Die Mutter schob sie zur Kutschentür. »Du hast hoffentlich nicht vergessen, was du tun wirst, wenn du in Rosenheim angekommen bist.«
»Ich suche eine Frau namens Maria Rogan auf und übergebe ihr den Brief, den du mir in mein Bündel gesteckt hast«, erwiderte Sybilla fügsam und senkte dabei den Blick.
»Sie wird dir bei der Geburt zur Seite stehen.« Josefa beugte sich an ihr Ohr und raunte: »Du wirst mindestens ein Jahr in Rosenheim bleiben und auch nur ohne das Kind zurückkehren. Sollte Gott dir vergeben, wird er den Bastard nicht am Leben lassen. Ich bete dafür, dass dir der Herr diese Gnade erweist.«
Ohne etwas darauf zu erwidern, wandte Sybilla sich um und setzte sich in die Kutsche. Nach ihr stieg ein Kerl ein, den ein widerlicher Geruch nach ranzigem Öl umgab. Ihm folgten ein kahlköpfiger alter Mann und eine fette Frau, die sich schnaufend neben ihr niederließ und sie dabei gegen den Holzrahmen drückte. Als sich die Kutsche ruckelnd in Bewegung setzte, schaute Sybilla aus dem Fenster, doch ihre Mutter hatte bereits den Rückweg angetreten und stapfte davon, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Während die Kutsche die Bürgerstadt passierte und in die Gstättengasse einbog, zog sie aus ihrem Rockschurz ein kleines silbernes Kruzifix hervor. Sie hatte es gestern Abend auf ihrer Bettstatt gefunden, und sie hatte geweint, als ihr klar geworden war, dass dies die letzte Aufmerksamkeit sein würde, die Sebastian ihr zuteil werden ließ.
Sybilla streckte den Kopf aus dem Fenster. Der eisige Fahrtwind schnitt in ihr Gesicht. Aus zusammengekniffenen Augen machte sie in der Dämmerung die steilen Hänge des Mönchbergs aus. Im vergangenen Jahr hatte sie sich dort häufig mit Sebastian zu ihren verbotenen Treffen zurückgezogen. Zwischen Holundersträuchern und wildem Hopfen hatten sie sich geküsst und schon bald im Rausch ihrer Leidenschaft jedes Verbot missachtet. Nun hatte Sybilla die Konsequenzen dafür zu tragen.
Die Kutsche durchquerte das Klausentor und ließ damit die Stadt Salzburg hinter sich. Wehmütig strich Sybilla mit der Hand über ihren Bauch. Ihre Mutter hatte behauptet, das Kind sei verdammt, weil es der Saat des Teufels entsprungen war, doch insgeheim hoffte Sybilla, dass ihrem Sohn oder ihrer Tochter Gnade widerfuhr. Sie wollte nicht, dass dieses Kind starb. Und wenn diese Hoffnung zur Folge hatte, dass sie sich von Salzburg fernhalten musste, dann würde sie auch die Bürde auf sich nehmen, für immer in Rosenheim oder an einem anderen entfernten Ort zu leben.
Erster Teil
Kapitel 1
Es bereitete Robert Bernau keine Mühe, seinen Gegner einzuschätzen. Er kannte Caspar Stössel seit seiner Kindheit, denn sie waren im selben Jahr geboren worden. Doch damit fanden die Gemeinsamkeiten der beiden Zwanzigjährigen auch schon ein Ende. Im Gegensatz zu Caspar, dem Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns, stammte Robert aus ärmlichen Verhältnissen. Er schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durchs Leben, ging beizeiten dem Gerbermeister zur Hand, unter dessen Dach seine Mutter und er vor einigen Jahren untergekommen waren, oder verbrachte seine Zeit damit, begüterten Taugenichtsen wie Caspar Stössel das allzu locker sitzende Geld an den Spieltischen in den Tavernen abzunehmen.
In Caspar glaubte er nun genau das richtige Opfer vor sich zu haben. Dessen Vater hatte einige Jahre nach dem Ende des großen Krieges die Schweizer Eidgenossenschaft verlassen und war nach Rosenheim gekommen, wo er mit dem Handel von Kalk, Seide, Holz und Salz über die Innschifffahrt rasch ein ansehnliches Vermögen angehäuft hatte. Und diesen Wohlstand trug nun vor allem Caspar zur Schau, obwohl jedermann wusste, dass er seinem geschäftstüchtigen Vater nicht das Wasser reichen konnte. Dem behäbigen und launischen Caspar schien es zu gefallen, als galanter Kavalier aufzutreten. Er trug stets einen knielangen, taillierten Schoßrock, den er mit allerlei Bandschmuck, Rosetten und Schluppen hatte verzieren lassen. Sogar seine Schuhe waren mit bunten Schleifen geschmückt. Zudem frönte er seit einigen Wochen einer neuartigen Mode, indem er eine bauschige Perücke trug, deren Lockenpracht so fein gekräuselt war, dass er wie ein Pudel ausschaute, und sein feistes Gesicht, aus dem zwei bösartig funkelnde Schweinsaugen hervorstachen, schminkte er mit hellem Puder.
Die beiden saßen sich im Gasthaus Bruckladner wie zwei kampflustige Hunde gegenüber, die sich mit lauerndem Blick abschätzten. Zwar fletschten sie noch nicht die Zähne, doch die zahlreichen neugierigen Zuschauer, die sich um ihren Tisch versammelt hatten, ließen keinen Zweifel daran aufkommen, dass sich hier ein besonderes Duell abspielte. Sogar der Schankwirt Humbert hatte sich eingefunden, obwohl er nur selten die Zeit fand, das Geschehen an den Spieltischen zu verfolgen. Und wenn, dann hielt er sich zumeist nur an den Würfel- und Kartentischen auf, die in einem Nebenraum untergebracht waren.
Robert und Caspar indes hatten mitten im Schankraum Platz genommen. Hier befand sich ein Tisch, in dessen Holzplatte drei ineinanderliegende, mit Linien verbundene Quadrate geritzt worden waren. Die Linien waren bereits ausgeblichen, die Oberfläche des Holzes war mit zahlreichen Kerben übersät. Wahrscheinlich hatten sich schon lange vor Roberts Geburt die Gäste der Bruckladner-Taverne an diesem Tisch die Zeit mit dem Mühlespiel vertrieben.
Caspar rümpfte die Nase. Die Luft war stickig vom Tabakqualm und von dem Rauch, der von dem großen Herd aufstieg, wo über dem Feuer fetttriefendes Fleisch gebraten wurde. Die schrillen Klänge einer Fidel und einer Querflöte untermalten die johlenden Stimmen der Betrunkenen. Schankbuben rannten mit Bier- und Weinkrügen zwischen den Tischen umher. Obwohl es noch früh am Abend war, hatte Robert bereits zahlreiche Männer gesehen, die mit den Köpfen auf die Tische gesunken waren und ihren Rausch ausschliefen. Er selbst hatte bislang nur einige Becher verdünnten Wein zu sich genommen. Für ihn stand bei dieser Partie gegen Caspar Stössel viel Geld auf dem Spiel. Darum würde er sich erst später betrinken.
»Wird dir die Luft knapp?«, fragte Robert belustigt. Er hatte Caspar in den vergangenen Monaten nur selten in der verrauchten Taverne zu Gesicht bekommen, der eitle Pfau schien in diesem Dunst regelrecht nach Atem zu ringen. »Vielleicht möchtest du vor dem Spiel noch einen Augenblick auf die Straße treten.«
Ein pockennarbiger Bursche, der hinter Caspar stand, richtete drohend einen Finger auf Robert und warnte ihn: »Werde nur nicht frech!« Robert kannte seinen Namen nicht, aber ihm war aufgefallen, dass der Kerl Caspar nicht von der Seite wich und sich wohl berufen fühlte, seinen Kumpan zu verteidigen.
»Er ist den Gestank gewiss gewohnt«, erwiderte Caspar mit einem hämischen Grienen. Er schob die Hand unter seinen Schoßrock, holte eine Silbermünze hervor und legte sie auf den Tisch. »Was ist? Kann ich deinen Einsatz sehen?«
Robert schüttelte einige Kupfermünzen aus einem Lederbeutel auf seine Hand und zählte sechzig Kreuzer ab, was dem Gegenwert des silbernen Guldens entsprach, den Caspar als Einsatz gebracht hatte. Für dieses Geld hatte er zwei Wochen lang für die Fasszieher am Innlände geschuftet, faulende Tierkadaver für den Abdecker geschleppt und einige stinkende Aborte gereinigt. Wenn er dieses Spiel und damit den Einsatz verlor, wäre die gesamte Anstrengung umsonst gewesen. Ihm würden dann nur wenige Kreuzer bleiben, mit denen er nicht mal mehr einen Krug Dünnbier in dieser Taverne bezahlen konnte.
Also durfte er nicht verlieren.
Üblicherweise wurden im Gasthaus Bruckladner fünf Gewinnpartien ausgetragen, um einen Einsatz zu erringen. Caspar und Robert hatten sich jedoch darauf geeinigt, dass nur eine einzige Partie – sofern sie nicht unentschieden endete – über Sieg oder Niederlage entscheiden sollte.
Unter den Schaulustigen machte Robert nun auch zwei ihm bekannte Frauengesichter aus. Ihm gegenüber hatte die Hure Apollonia einen vorderen Platz in der Menge ergattert. Sie war ohne Zweifel die hübscheste der drei Dirnen, die in den oberen Räumen für Humbert arbeiteten. Robert nahm an, dass Apollonia ihm den Sieg wünschte, denn er hatte ihr versprochen, noch am Abend ihre Dienste in Anspruch zu nehmen, wenn er Caspar Stössel den Gulden aus der Tasche zog.
Die andere Frau hatte ihn zur Bruckladner-Taverne begleitet. Helene Holt war entsetzt darüber gewesen, wieviel Geld Robert aufs Spiel setzte, um gegen Caspar anzutreten.
»Der Einsatz ist viel zu hoch«, hatte sie geklagt, als wäre sie seine Ehefrau, die ihn maßregeln wollte. Robert schlug ihre Warnung in den Wind. Er verstand auch nicht, warum sie sich überhaupt um ihn sorgte. Sie waren weder verheiratet, noch teilten sie das Bett miteinander. Helene wohnte mit ihrem Sohn zwar im selben Haus, in dem auch Robert und seine Mutter untergekommen waren, aber das gab ihr nicht das Recht, ihm vorzuschreiben, was er zu tun und zu lassen hatte. Sie hielt ihn für einen Hasardeur und hatte nicht begriffen, dass er sein Geld schon lange nicht mehr für Glücksspiele einsetzte.
Früher hatte er so manchen Abend bis in die tiefe Nacht hinein an den Karten- und Würfelspielen teilgenommen, die Humbert regelmäßig in einem kleinen Nebenraum betrieb. Beim Faro, Wurfzabel oder auch beim Gänsespiel hatte er immer wieder Geld verloren, bis er es leid war, sich einzig auf die Launen Fortunas zu verlassen. Glück spielte hingegen beim Setzen der Steine auf dem Mühlefeld keine Rolle. Es gab keine Spielkarten, die dem Gegner Vorteile verschafften, und keine Würfel, die unglücklich fielen. Allein das taktische Geschick war von Bedeutung – und Robert war überzeugt, davon in einem Übermaß gesegnet worden zu sein.
Schon als Kind hatte er das Mühlespiel hervorragend beherrscht. Seine Mutter Sybilla hatte es ihm beigebracht, indem sie die Quadrate mit einem Holzstab in die Erde gezeichnet und Bohnen als Spielsteine benutzt hatte. Bald darauf hatte sie kaum mehr eine Partie gegen ihn gewinnen können, und ihr war die Lust vergangen, sich mit ihrem Sohn bei diesem Spiel zu messen. Robert hingegen hatte seine Fertigkeiten in zahlreichen Auseinandersetzungen mit geschickten Gegnern verbessert, und von den weniger guten Spielern waren immer wieder Münzen in seine Tasche gewandert. Für dieses Geld hatte er vor einigen Monaten dann ein kunstvoll bedrucktes Kartenspiel erstanden, das mit den Farben und Figuren des französischen Pikettblattes bedruckt war. Der fahrende Händler, von dem er diese Karten erworben hatte, brachte ihm zudem noch einige Kunststücke bei, die geschickte Finger erforderten, doch nach beharrlichem Üben gelang es ihm schon bald, andere Menschen in Erstaunen zu versetzen, wenn er eine der Karten plötzlich in seiner Hand verschwinden ließ oder scheinbar mühelos erriet, welche Karte die Person zuvor aus dem Stapel gezogen hatte. Seine Mutter betrachtete seine Leidenschaft für das Spiel um Geld mit Argwohn und hatte des Öfteren ihr Missfallen darüber geäußert, dass er versuchte, auf diese unredliche Weise anderen Männern die Münzen aus den Taschen zu locken. Um sie nicht weiter zu beunruhigen, verschwieg er ihr darum zumeist, dass er regelmäßig an die Spieltische zurückkehrte und seine Einsätze immer höher wurden.
Auch Helenes fünfjähriger Sohn Adam war an den Tisch getreten und streckte sich, um das Spielfeld zu betrachten, doch sofort langte dessen Mutter nach seinem dünnen Arm und zog ihn zurück. Mit mürrischer Miene verfolgte sie, wie Robert und Caspar die Spielsteine bereitlegten. In Gedanken malte sich Robert bereits aus, dass er ihr von seinem Gewinn ein seidenes Haarband und Adam eine Handvoll Zuckerwerk kaufen würde. Seine Großzügigkeit würde sie beschämen, und vielleicht verstand sie dann endlich, dass ein guter und geschickter Spieler in einer Stunde mehr Münzen in seine Taschen bekommen konnte als manch fleißiger Handwerker in der ganzen Woche.
Die Partie begann. Robert blieb nicht verborgen, dass unter den Gaffern Nebenwetten über den Spielausgang abgeschlossen wurden und dass er dabei als Favorit gehandelt wurde. Sogleich lenkte er seine Aufmerksamkeit aber wieder voll und ganz auf das Spielfeld. Eine Partie Mühle konnte in drei Phasen unterteilt werden. Zunächst die Eröffnung, in der jeder Spieler abwechselnd seine neun Steine auf die Schnittpunkte der Linien verteilte. In der mittleren Phase durften die Steine von einem Punkt zum nächsten gezogen werden, mit dem Ziel, drei Steine waagerecht oder senkrecht nebeneinander zu platzieren, um eine Mühle zu bilden und so einen Stein des Gegners aus dem Spiel zu nehmen. Konnte man sieben Steine des Gegners entfernen oder blockierte man dessen Steine so, dass es ihm nicht mehr möglich war, einen Zug auszuführen, hatte man das Spiel gewonnen. Besaß ein Spieler allerdings nur noch drei Steine, dann durfte er springen, also seine Steine auf einen beliebigen freien Platz setzen – ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen war.
Robert bot Caspar an, das Spiel mit den weißen Steinen zu beginnen. Der ging auch, ohne zu zögern, darauf ein und stapelte die kleinen Plättchen auf seiner Seite. Viele Spieler bevorzugten es, die Eröffnung auszuführen, so dass sie beim Setzen immer einen Stein voraus waren. Robert wusste aus Erfahrung, dass es aber ebenso ein Vorteil sein konnte, den letzten Stein auf das Feld zu bringen. Er hütete sich davor, allzu schnell eine Mühle zu bilden, denn besonders an den inneren und an den äußeren Quadraten konnten seine Steine rasch blockiert werden. Für eine möglichst große Bewegungsfreiheit war es unumgänglich, zuerst die mittlere Kreuzung zu besetzen.
Caspar grübelte deutlich länger über jeden Stein, den er auf das Spielfeld legte. Er kratzte sich die Stirn, rieb an seinem Kinn und atmete jedes Mal schnaufend aus, wenn er dann endlich seinen Zug ausführte. Robert befand, dass Caspar nicht so ungeschickt spielte, wie er es erwartet hatte, aber die Mühe, die seinem Gegenüber diese Entscheidungen bereiteten, bewies ihm, dass er Caspar richtig eingeschätzt hatte. Der Sohn des Kaufmanns war der unerfahrenere und damit auch schwächere Spieler von ihnen.
Robert konnte mit seinem Spiel zunächst zufrieden sein. Er hatte eine symmetrische Stellung der Spielsteine verhindert, die den weißen Spieler in eine vorteilhafte Position gebracht hätte, und als er seinen letzten Stein platzierte, war er davon überzeugt, dass er nur noch auf einen Fehler seines Gegners warten musste, um diese Partie und damit den Silbergulden zu gewinnen.
Die umstehenden Gaffer hielten sich inzwischen mit ihren Kommentaren zurück und verfolgten das Spiel größtenteils schweigend. Robert wechselte erneut einen kurzen Blick mit Helene und zwinkerte ihr zu. Sie jedoch verzog keine Miene.
Inzwischen war es Robert gelungen, den ersten von Caspars Steinen vom Spielfeld zu entfernen. Der fluchte nur leise und stützte den Kopf auf seine Hände, während er überlegte. »Du spielst recht geschickt«, sagte Caspar nach einer Weile. »Wie kann es sein, dass ein einfacher Tagelöhner – ein Bursche von schlichtem Verstand – dieses schwierige Spiel so gut beherrscht?«
Robert wusste nicht, ob er Caspars Bemerkung als Kompliment oder als Beleidigung auffassen sollte. Er schnaufte nur abfällig, dann erwiderte er: »Seidene Bänder und falsche Locken zeugen nicht unbedingt von der Klugheit eines Mannes.«
»Wohl wahr.« Caspar griente. »Vielleicht war ja aber dein Vater ein kluger Mann. Damit würde sich vieles erklären lassen. Zu schade, dass du nicht weißt, ob deine Mutter dereinst von einem Gelehrten oder einem tumben Idioten besprungen wurde.«
Dies war nun ohne jeden Zweifel eine Beleidigung. Robert spürte, wie ihm das Blut in den Kopf schoss. Er konnte damit umgehen, wenn man ihn wegen seines niederen Standes schmähte, aber er würde es nicht hinnehmen, dass Caspar seine Mutter in den Dreck zog. Robert sprang auf und krallte seine Hände am Spieltisch fest. Als hätte sie geahnt, was geschehen würde, war Helene hinter ihn geeilt und legte ihre Hände auf seine Schultern, um ihn zurück auf den Stuhl zu drücken, was ihr aber nicht gelang.
»Noch ein weiteres Wort, Caspar, und du wirst mit einer gebrochenen Nase den Heimweg antreten!«, rief Robert.
Caspar gab sich von dieser Drohung unbeeindruckt. »Wenn du den Tisch umwirfst, gilt das Spiel für dich als verloren.«
»Bring es zu Ende!«, zischte Helene in sein Ohr. Robert setzte sich wieder und führte den nächsten Zug aus. Es fiel ihm nun schwerer, sich zu konzentrieren. Immer wieder schaute er in die Gesichter der Umstehenden, denen der Streit wohl gefallen hatte, denn die meisten von ihnen feixten und lachten verhalten. Caspar gab sich völlig unbeteiligt, und es schien ihn auch nicht zu stören, dass Robert ihn mit finsterer Miene anstarrte.
Roberts Herz pochte wild, und seine Hände zitterten noch immer vor Wut. Sein verdammtes Temperament hätte ihn fast dazu gebracht, den Tisch umzuwerfen und Caspar den Sieg zu schenken. Es ärgerte ihn, dass er sich wieder einmal nicht zu beherrschen gewusst hatte.
Nachdem Caspar seinen Zug ausgeführt hatte, verschob Robert, ohne lang zuüberlegen, den nächsten Stein. Sein Gegenüber lachte leise, und sofort begriff Robert, dass ihn seine Unaufmerksamkeit zu einem dummen Spielzug verleitet hatte. Caspar nutzte dies aus, indem er zwei offene Mühlen bilden und diese nach Belieben öffnen und schließen konnte, so dass Robert nun einen Stein nach dem anderen verlor. Robert zwang sich zur Ruhe. Er besaß noch vier Steine. Wenn Caspar einen weiteren Stein aus dem Spiel nahm, würde er springen können, und mit einigen geschickten Spielzügen war es dann immer noch möglich, das Spiel zu gewinnen. Er atmete tief durch und unterdrückte seinen Ärger.
Caspar schien zu spüren, dass die entscheidende Phase der Partie bevorstand, denn er unternahm einen weiteren Angriff auf Roberts Konzentration.
»Nein, ich glaube nicht, dass dein Vater ein Idiot war«, sagte Caspar. Sein Tonfall klang vorsichtig, als wolle er abschätzen, wie weit er gehen konnte, bevor er Roberts Temperament erneut zum Ausbruch brachte. Und jedes seiner Worte fachte das Feuer an, das Robert nur noch mühsam unter Kontrolle hielt.
»Deine Mutter scheint auf kluge Männer durchaus anziehend zu wirken. Es heißt, sogar der Schiffmeister Stollberg kann nicht die Augen von ihr lassen, wenn sie Aufgaben in seinem Haushalt erledigt. Um welche Dienste mag es sich dabei wohl handeln?«
Er will mich nur aus dem Spiel bringen, dachte Robert und zwang sich, ruhig zu bleiben. Ohne Caspar eines Blickes zu würdigen, führte er seinen Zug aus.
»Man sagt, Weiber aus den unteren Schichten üben eine starke Anziehung auf die Herren des höheren Standes aus.« Während einige der Umstehenden über die Bemerkung kicherten, verschob Caspar nach kurzem Nachdenken seinen Stein. »Wahrscheinlich liegt es daran, dass solche Frauen eher bereit sind, ihnen im Bett die sündhaftesten Wünsche zu erfüllen.«
Robert stutzte. Caspars Worte schwirrten in seinem Kopf herum, doch die Beleidigungen waren in diesem Moment zweitrangig. Er betrachtete die Konstellation der Spielsteine, und als er begriff, was geschehen war, sprach Caspar das mit deutlicher Genugtuung aus.
»Du bist blockiert und hast damit verloren.«
Er hatte recht. Es war Robert nicht möglich, einen seiner verbliebenen Steine zu verschieben. Caspars Provokationen hatten ihn unaufmerksam werden lassen und zu einem weiteren Fehler verleitet. Neben ihm seufzte Helene vernehmlich.
Caspars Kumpan lachte laut auf und klang dabei wie ein schreiender Esel. Er klopfte Caspar auf die Schultern und reichte ihm einen Krug Bier.
Einen Augenblick lang fühlte sich Robert wie zu Stein erstarrt. Ein Grollen bahnte sich den Weg von seinem Bauch bis zur Kehle. Dann machte er seiner Wut Luft, indem er den Tisch umwarf und auf Caspar losgehen wollte. Da er das Spiel verloren hatte, konnte er seinem Kontrahenten nun auch die blutige Nase schlagen, die er ihm angedroht hatte.
Mit erhobener Faust machte er einen Schritt auf den Sohn des Kaufmanns zu, doch sofort war Humbert bei ihm und stieß ihn zurück. »Keinen Streit hier!«, grollte der Wirt, und auf sein Zeichen hin wurde Robert von zwei kräftigen Männern gepackt und festgehalten. Er fluchte laut und wand sich in dem festen Griff, während Caspar sich rasch bückte und die Münzen einsammelte, die auf dem Boden verstreut lagen.
Helene baute sich mit verschränkten Armen vor Robert auf und schüttelte den Kopf. »Beruhige dich! Du Dummkopf hast dir schon genügend Schwierigkeiten eingehandelt.«
»Beruhigen soll ich mich?«, keifte er ihr entgegen. »Der Hundsfott hat meine Mutter beleidigt.«
»Trotzdem hat er das Spiel gewonnen«, erwiderte Helene kühl.
Caspar hatte inzwischen seinen Gewinn zusammengerafft und zog sich feixend mit seinem Kumpan in eines der Hinterzimmer zurück. Erst jetzt wurde Robert losgelassen. Er schnaufte noch immer aufgebracht. Einen Moment lang spielte er mit dem Gedanken, Caspar zu folgen, doch dann gewann die Vernunft Oberhand, denn Humbert machte ihm mit einem finsteren Blick klar, dass er ihn bei dem geringsten Ärger auf die Straße werfen lassen würde.
Helene zog an seinem Arm. »Lass uns gehen. Es war kein guter Tag für dich.«
Sollte er sich wie ein geprügelter Hund nach Hause schleichen? Die aufgestaute Wut kochte noch immer in ihm. Vielleicht war es das Beste, er würde sich daheim eine Axt zur Hand nehmen und seinem Ärger Luft machen, indem er einen Klafter Holz in Stücke hackte.
Bevor er Helene jedoch eine Antwort geben konnte, tauchte die Hure Apollonia neben ihm auf und zeigte ihm mehrere Kreuzer in ihrer Hand.
»Die hat Caspar in der Eile wohl übersehen«, meinte sie und zwinkerte Robert aufreizend zu. »Was meinst du? Willst du dich auf seine Kosten ein wenig amüsieren?«
Robert berührte ihr schwarz glänzendes Haar und vergaß die Axt. Er drehte er sich zu Helene um und raunte ihr zu: »Geh allein zurück. Und bitte sag Sybilla nicht, dass ich mein Geld verloren habe.«
Helene beäugte skeptisch die Dirne und verzog das Gesicht. »Caspar wird seinen Triumph morgen zum Stadtgespräch machen. Und auch Sybilla wird dann erfahren, was ihr Sohn für ein Tölpel ist.« Aufgebracht zog sie an seiner Hand, als wolle sie ihn so aus der Gewalt der Hure befreien, doch Robert hatte schon einen Arm um Apollonias Hüfte gelegt und rührte sich nicht vom Fleck.
»Schweig heute einfach über meine Dummheit«, bat er Helene noch einmal, dann ließ er sie im Schankraum stehen und folgte Apollonia in eine Dachkammer, in der sich nur eine schmale Bettstatt befand.
Robert schloss die Tür hinter sich und machte sich Luft, indem er dreimal kräftig gegen die Wand schlug – so fest, dass seine Hand schmerzte.
»Spar dir die Kraft für mich auf.« Apollonia zog neben dem Bett einen Eimer hervor. »Es war gewiss nicht schmeichelhaft, was Caspar über deine Mutter gesagt hat, aber du solltest lernen, dein Temperament zu zügeln.«
Robert setzte sich auf das Bett, in dem er schon so manch lustvolle Nacht mit Apollonia verbracht hatte, und seufzte: »Wenn mein Blut in Wallung gerät, setzt mein Verstand aus. So war es schon immer.«
»Besonnenheit ist also nicht deine Stärke«, sagte sie.
»Besonnenheit?« Robert schnaubte. »Wie kann ich besonnen sein, wenn dieser Ochse meine Mutter beleidigt? Er hat angedeutet, sie hätte ein Verhältnis mit dem Schiffmeister Stollberg. Welch ein Unsinn!« Schon oft hatte Sybilla darüber geklagt, dass Rudwin Stollberg ihr nachstellte und sie mit zweideutigen Bemerkungen in Verlegenheit brachte, obwohl er ein verheirateter Mann war. Sie hatte vor Robert keinen Hehl daraus gemacht, dass sie in dem Schiffmeister nur einen Widerling sah und sein Haus nur aufsuchte, um sich ihren Lohn zu verdienen, indem sie dessen Gesinde ab und an bei der großen Wäsche unterstützte oder für Rudwin auf die sumpfigen Weiden ging, um das Moos zu sammeln, mit dem die Fugen der Schiffsbretter auf den Schopperplätzen abgedichtet wurden.
»Rudwin ist ein Schwein«, fügte er an.
»Ich weiß«, meinte Apollonia und raffte ihre Röcke hoch. »Er sucht mich an jedem Freitagabend auf, lässt sich von mir im Zuber waschen und mag es besonders, wenn ich ihm dabei kräftig den Anus reibe. Aber er bezahlt mich anständig für diese Dienste.« Sie hockte sich über den Eimer, bemerkte aber, dass Robert sie nicht aus den Augen ließ.
»Dreh dich um!«, verlangte sie.
Er lachte. »Warum? Ich kenne deinen Körper fast besser als meinen eigenen.«
»Deshalb musst du mir aber nicht beim Pissen zuschauen.«
»Glaubst du etwa, das würde mich erregen?«
Sie rollte mit den Augen. »Mir sind schon Männer mit weit seltsameren Vorlieben untergekommen.«
Robert erhob sich, trat zum Fenster, das zur Straßenseite lag und drehte Apollonia den Rücken zu. Während sie sich erleichterte, öffnete er das Fenster und sog die kühle Abendluft ein. Unten hörte er Stimmen und ein heiseres Lachen. Es dämmerte bereits, aber das letzte Tageslicht war noch hell genug, um die beiden Männer zu erkennen, die dort auf die Straße traten.
Er wandte sich um. Apollonia hatte sich aufgerichtet und wollte den Eimer unter das Bett schieben.
»Gib mir den Eimer! Schnell!«, rief er und winkte sie eilig zu sich.
Apollonia rührte sich nicht. Ihre Augen verrieten Skepsis.
»Schau mich nicht an, als wollte ich daraus trinken«, sagte Robert. »Gib ihn mir einfach.«
Sie reichte ihm den Eimer. Robert lehnte sich aus dem Fenster, steckte zwei Finger in den Mund und pfiff laut. Im nächsten Moment reckten sich auch schon Caspar Stössels Gesicht und das seines Begleiters nach oben. Caspar runzelte die Stirn. Robert zögerte nicht und schüttete den Inhalt des Eimers auf sie. Caspar kreischte und schimpfte, als der üble Schauer auf ihn niederging. Sein Kumpan sprang zur Seite, doch auch ihm gelang es nicht mehr, dem Unrat auszuweichen. Rasch schloss Robert das Fenster. Caspars Flüche und Verwünschungen waren nun nur noch gedämpft zu hören.
Er stellte den Eimer zur Seite, wischte die Hände an seiner Hose ab und zog Apollonia an sich, die bereits die Bänder ihres Kleides geöffnet hatte.
»Nun fühle ich mich besser«, sagte er und ließ sich mit der Dirne auf das Bett fallen.
Kapitel 2
Mit eiligen Schritten trat Helene auf das Färbertor zu und wich dabei den Dreckpfützen aus, die die heftigen Regenfälle der letzten Tage hinterlassen hatten. Wie so häufig bedeckte am Beginn des Frühlings eine tiefe Schlammschicht die Straßen Rosenheims.
Fluchend zog sie Adam am Arm, um ihn voranzutreiben. Bei jedem kräftigen Ruck jaulte er auf, gab sich aber weiterhin störrisch wie ein Esel. Wahrscheinlich ließ ihn die Müdigkeit so trotzig werden. Helene stoppte kurz und drohte ihrem Sohn Schläge auf den Hinterkopf an, woraufhin er sofort losheulte. Sie seufzte und stieß ihn unter das Tor, das den Abschluss des Äußeren Marktes zur Färbergasse bildete. Ein Mann taumelte auf sie zu, stolperte in Helenes Arme und säuselte ihr lallend ins Ohr, ob er sie nach Hause begleiten dürfe. Helene versteifte sich, dann warf sie den Betrunkenen zu Boden. Sie stellte sich vor, dass Robert dort vor ihr kauerte, und versetzte dem Kerl einen harten Tritt vor das Hinterteil. Der schrie auf, ballte drohend die Faust und wünschte sie lautstark zum Teufel. Doch er war zu betrunken, um auf die Beine zu kommen. Helene drängte Adam schnell mit sich und durchquerte das Tor.
»Warum hast du den Mann getreten?«, wollte Adam wissen.
»Das Gleiche wird auch dir passieren, wenn du jetzt nicht mit mir kommst«, fauchte sie ihn an.
Von dieser überzeugenden Drohung durchaus beeindruckt, löste Adam den Blick von dem Betrunkenen und hielt nun endlich mit ihr Schritt. Helene bedauerte es bereits, dass sie so rüde mit Adam umging. Im Grunde ließ sie an ihm nur ihre Enttäuschung über Robert aus, weil es sie ärgerte, dass er so dumm gewesen war, sein mühsam verdientes Geld in der Bruckladner-Taverne zu verspielen.
War das wirklich der Grund für ihre schlechte Laune? Nein, Helene gestand sich ein, dass sie sich selbst belog. Es scherte sie doch eigentlich gar nicht, dass Robert sein Geld aufs Spiel setzte. Eigentlich hatte sie sich nur deshalb kaum noch unter Kontrolle, weil er sich lieber mit der Hure Apollonia abgab als mit ihr. Ihn in den Armen dieser Metze zu wissen, zwischen deren Beinen gewiss schon die Hälfte aller Männer aus Rosenheim gelegen hatte, machte Helene rasend.
Ihr Kopf schmerzte. Sie lehnte sich an eine Hauswand und rieb ihre Stirn. »Verfluchter Kerl«, raunte sie, und plötzlich hätte sie über ihre Vernarrtheit heulen können. War es ihr Schicksal, handelte es sich nur um eine Laune der Natur oder mochte gar Zauberei im Spiel sein, dass sie Robert nicht aus ihrem Kopf bekam und ihn stärker begehrte als irgendeinen Mann zuvor in ihrem Leben?
Fünf Jahre lang hatte sie an der Seite ihres Ehemannes Kilian gelebt. Und in all diesen Jahren war sie an keinem einzigen Tag von einem solch unerträglichen Verlangen geplagt worden, wie sie es nun in Roberts Nähe ständig verspürte. Kilian Holt war ihr ein guter Mann gewesen. Er hatte niemals die Hand gegen sie erhoben und ihr sogar dann und wann kleine liebevolle Aufmerksamkeiten zukommen lassen, selbst wenn es sich nur um Blumen handelte, die er auf den Feldern für sie gepflückt hatte. Und er hatte sich stets bemüht, sie zum Lachen zu bringen, auch wenn ihr Tag zumeist nur aus harter Arbeit bestanden hatte. Bei Adams Geburt war er ihr nicht von der Seite gewichen, obwohl die Hebamme damals vehement auf ihn eingeredet hatte, um ihn vom Wochenbett fernzuhalten. Helene war davon überzeugt, dass Kilian niemals eine andere Frau als sie begehrt hatte.
Sie hatten als Landweber auf einem gepachteten Acker in der Nähe Rosenheims Flachs angebaut und diesen in ihrer Kate verarbeitet. Helene hatte die meiste Zeit mit dem Riffeln und Rösten, Brechen und Klopfen des langfaserigen Flachses verbracht, den Kilian auf dem Markt verkauft oder zu Stoffen verarbeitet hatte.
Er war vor fast genau einem Jahr gestorben. Beim Heben schwerer Fässer hatte er sich einen Bruch an der Leiste zugezogen. Nachdem ein Bader ohne Erfolg versucht hatte, den Bruch mit der Hand in die Bauchhöhle zurückzuzwängen und auch eine eiserne Bandage keine Wirkung gezeigt hatte, hatte sich der schmerzgeplagte Kilian an einen Chirurgen gewandt, der einen Bruchschnitt durchgeführt hatte, von dem sich ihr Ehemann nicht mehr erholt hatte. Nach dem Eingriff hatte er fünf Tage an einem heftigen Fieber gelitten, eine Vergiftung seines Blutes hatte ihn schließlich getötet. Helene hatte um ihn geweint, doch vor allem deshalb Tränen vergossen, weil sie wusste, dass sie nun die Pacht für das Land nicht mehr aufbringen konnte und mit ihrem Sohn ein Leben in Armut führen würde. Glücklicherweise unterbreitete ihr der Bruder ihrer Mutter, der Gerber Ludolf Dickart, das Angebot, in seinem Haus zu wohnen. Dort teilte sie sich seit nunmehr elf Monaten eine Dachkammer mit Robert Bernau und dessen Mutter Sybilla und verdiente sich ihr Brot, indem sie ihrer Tante Donata dabei half, den Haushalt zu führen, oder beizeiten als Lohnwäscherin arbeitete.
Es hatte sie verwundert, wie schnell die Trauer um Kilian ihrem Interesse für Robert gewichen war. Robert Bernau und seine Mutter waren wie sie aus wirtschaftlicher Not im Haus des Gerbers untergekommen. Beide leisteten ihre Arbeit im Haus und schlugen sich mit Gelegenheitsdiensten durch. Helene war mit den beiden vom ersten Tag an gut ausgekommen, und das war im Grunde auch eine Notwendigkeit, denn sie lebten in der Dachkammer auf engstem Raum. Ihre Schlaflager waren nur durch ein an einer Stange aufgehängtes Sacktuch voneinander getrennt, so dass kein Geräusch und kein Wort voreinander verborgen blieben.
Die unvermeidliche Nähe in dieser Kammer war ihr aber alles andere als unangenehm, denn da war etwas an Robert, was sie ganz einfach faszinierte. Sie konnte nicht genau bestimmen, womit er ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. War es seine Art oder sein Äußeres? Oftmals betrachtete sie Robert verstohlen, wenn er beim Waschen sein Hemd ablegte. Und sie verspürte einen gewissen Reiz dabei, sich selbst zu entblößen, wenn Robert sich in der Kammer aufhielt. Helene gefiel es, seine Blicke auf ihrem Körper zu wissen, auch wenn ihre Brüste nicht mehr so fest waren wie vor Adams Geburt. In vielen Nächten malte sie sich in ihrer Phantasie aus, wie es sein könnte, wenn er sich neben sie legen und sie in seinen Armen halten würde. So manches Mal stiegen ihr dann recht lüsterne Bilder in den Kopf, und wenn sie in der Dunkelheit heimlich mit der Decke zwischen ihren Beinen rieb, stellte sie sich vor, es wären seine Finger, die sie dort berührten. Häufig reichte aber schon der Gedanke an seine blauen Augen, an den Klang seiner Stimme oder aber ganz einfach die Erinnerung an den Geruch seiner Haut aus, um sie in Erregung zu versetzen.
Helene fragte sich, ob Roberts Mutter ahnte, wie sehr sie ihren Sohn begehrte. In all den Monaten hatte sie nie mit ihr darüber gesprochen. Im Grunde gab sich Sybilla ohnehin sehr verschlossen. Helene war zu Ohren gekommen, dass Roberts Mutter vor zwanzig Jahren schwanger in Rosenheim eingetroffen war und seitdem nie mehr einen Mann an ihrer Seite gehabt hatte. Mit ihren sechsunddreißig Jahren war Sybilla noch immer eine hübsche Frau, und darum war es verwunderlich, dass sie es offenbar vorgezogen hatte, ihr Leben wie eine Nonne zu verbringen.
Im Gegensatz zu Sybilla wollte Helene aber nicht allein bleiben. Das Trauerjahr war inzwischen abgelaufen, und es hatte vor einigen Wochen sogar ein Angebot für eine Heirat gegeben, als ein verwitweter Drechsler um sie geworben hatte. Nach reiflicher Überlegung hatte Helene jedoch abgelehnt. Es hatte sie gestört, dass der Werber fast dreißig Jahre älter war als sie. Doch vor allem hoffte sie noch immer darauf, Robert für sich zu gewinnen und sein Verlangen zu wecken. Ihn wollte sie heiraten, und nur mit ihm konnte sie es sich vorstellen, eine neue Familie zu gründen, wenngleich er sich mehr schlecht als recht als Tagelöhner durchs Leben schlug und zudem ein lasterhafter Spieler war. Sein Naturell machte ihn wohl kaum zum geeigneten Kandidaten für einen verlässlichen Vater und Ehemann – und doch reizte Helene genau das an Robert.
Für sie nahm diese Zukunft bereits klare Formen an. Mit dem Wissen, das Kilian ihr vermittelt hatte, könnten Robert und sie als Landweber arbeiten und eine neue Hütte mieten. Adam würde bald alt genug sein, um sie bei der Arbeit auf dem Feld zu unterstützen, und auch Sybilla konnte dann in ihrer Kate leben, wenn sie das denn wollte. Bislang hatte Helene nur noch nicht den Mut gefunden, mit Robert über ihre Gefühle und diese Pläne zu sprechen. Sie ahnte, dass er nur darüber lachen würde, denn leider zeigte er kein ernsthaftes Interesse an ihr, sondern zog es vor, sein Geld an den Spieltischen zu verprassen und sich im Bett einer billigen Dirne zu vergnügen.
Sie erreichten den Häuserblock am Mühlbach, der ringförmig von der Färbergasse umschlossen wurde. Hier war das Handwerk angesiedelt, das auf fließendes Wasser angewiesen war: die Müller, Gerber, Färber und Metzger. Helene und Adam liefen über einen Schotterweg, bis sie den Hof des Gerberhauses ihres Onkels Ludolf betraten. Schon aus der Entfernung nahm man hier den Gestank wahr, der aus den Bottichen stieg, in die Ludolf Schaf- und Ziegenfelle über mehrere Wochen in eine Lauge aus Branntkalk und Wasser tauchte, bevor sie mit einem Eisenschaber enthaart und von Fett- und Hautresten befreit wurden. In dieser Lauge bildete sich ein beißender Geruch, der für Helene in der ersten Zeit kaum zu ertragen gewesen war. Nach und nach hatte sie sich allerdings an den Gestank gewöhnt, der vor allem dann besonders penetrant in der Luft hing, wenn ihr Onkel Ludolf oder Robert mit einem Stecken in den Bottichen rührten. Nicht ohne Grund waren die Weißgerber vor den Toren des Marktes Rosenheim angesiedelt worden.
Als sie nun den Hof betrat, war ihr Onkel damit beschäftigt, seine Haareisen zu schärfen. Er bewegte mit einem Fußbrett den rundlaufenden Sandstein und schaute nur kurz auf, als er Helene und Adam bemerkte. Ludolf war ein schweigsamer Kerl, der im Grunde nur dann den Mund aufmachte, wenn man ihm eine Frage stellte. Ansonsten vernahm man von ihm nur ab und an ein Brummen oder ein Seufzen. Ihre Tante Donata war von einem anderen Schlag. Häufig hörte man ihre kräftige Stimme bereits auf der Straße, und auch jetzt empfing sie Helene mit einem lauten Rufen.
»Heda! Wir haben auf dich gewartet. Wo treibst du dich nur den ganzen Abend herum mit dem Buben? Ich habe zwei Hühner geschlachtet, die nicht von allein ihre Federn verlieren werden.« Donata wischte ihre Finger an einer fleckigen Schürze ab, an der noch einige frische Blutspritzer aus den Hühnerhälsen klebten.
»Warum ist Sybilla dir nicht zur Hand gegangen?«, meinte Helene. Sie schöpfte mit einer Kelle aus einem Eimer Wasser und ließ Adam davon trinken.
»Sybilla?« Donata runzelte die Stirn. »Die ist auch noch nicht zurückgekehrt. Wahrscheinlich hat sie sich bei der Wäsche in Rudwins Haus mit den anderen Frauen verschwatzt.« Ludolf pflichtete seiner Frau mit einem Brummen bei, doch Helene wusste, dass es nicht Sybillas Art war, lange Gespräche mit den anderen Weibern zu führen. Roberts Mutter, die stets einen etwas traurigen Eindruck vermittelte, pflegte nur wenig Kontakt zu den Menschen aus Rosenheim. Zumeist hielt sie sich bei Donata oder auf dem Gerberhof auf, ganz im Gegensatz zu ihrem Sohn, der hier nur die ihm aufgetragenen Arbeiten erledigte und ansonsten durch den Ort streifte oder in einer der Tavernen hockte.
Donata strich über Adams Haar. »Der Bub ist so müde, dass ihm fast die Augen zufallen. Bring ihn ins Bett, sonst schläft er morgen während der Frühmesse ein.«
Helene nickte. »Ich werde dir gleich zur Hand gehen, Tante.« Sie schob Adam ins Haus und stieg mit ihm die steile Treppe ins Dachgeschoss hinauf, wo sie zunächst einen Raum durchquerten, in dem auf Stangengerüsten zahlreiche Lederhäute getrocknet wurden. Am hinteren Ende des Dachbodens befand sich die Kammer, die sie mit Robert und Sybilla bewohnte. Ihre Einrichtung bestand nur aus einer Strohmatratze, dem Sacktuch, das die Schlaflager abtrennte, und einer Bank, auf der eine Waschschüssel und ein Krug mit Wasser standen. Nicht mal einen Ofen oder eine Feuerstelle gab es hier oben, so dass es in den zurückliegenden Wintermonaten oft so kalt gewesen war, dass sie sich eng an Adams warmen Körper gedrängt hatte, um in der eisigen Luft in den Schlaf zu finden.
Adam ließ sich auf die Matratze fallen. Helene deckte ihn zu und versprach ihrem Sohn, dass Ludolf mit ihm nach der morgigen Frühmesse an die Innlände gehen würde, um dort am Fluss zu angeln. Dann küsste sie Adams Stirn und trat hinter das Tuch in Roberts Teil der Kammer. Ihr Blick fiel auf ein Hemd, das er dort achtlos zu Boden geworfen hatte. Sie hob es auf und roch an dem Wollstoff. Vielleicht bildete sie es sich nur ein, aber sie glaubte, dass Roberts Geruch sein Bild in ihrem Kopf klarer hervortreten ließ. Sie sah ihn entblößt vor sich und presste das Hemd noch dichter an ihre Nase.
»Wird Robert morgen mit zum Fluss kommen?«
Helene erschrak, als sie Adams Stimme vernahm. Sein Kopf lugte hinter dem Tuch hervor. Rasch warf sie das Hemd fort und drängte Adam zurück auf das Lager.
»Ich weiß es nicht. Schlaf jetzt!«, sagte sie hastig und grämte sich darüber, wie offensichtlich sie diese Situation vor ihrem Sohn zu überspielen versuchte.
Nachdem sie Adam wieder zugedeckt hatte, begab sie sich zu ihrer Tante in die Küche. Donata hatte dort einen großen Topf mit Wasser auf den Herd gestellt und das Feuer angeheizt. Sie holte die beiden toten Hühner herbei, um sie in das Wasser zu tauchen, wenn es denn endlich kochte. Danach würden sich die Federn leichter rupfen lassen.
Mit einem Seufzen setzte sich Helene an den Tisch und stützte den Kopf auf die Hände.
»Du schaust so traurig aus, als wolltest du jeden Moment heulen«, meinte Donata. »Was macht dir zu schaffen?«
»Es war ein langer Tag. Ich bin müde.« Helene täuschte ein Gähnen vor, das Donata aber nicht zu überzeugen wusste.
»Müde?« Die Tante schüttelte den Kopf. »Nein, nein, dich bedrückt gewiss etwas anderes.« Donata ließ sich ebenfalls am Tisch nieder und schnitt dort eine Rübe in Stücke. »Du kennst meine Meinung. Es ist nicht gut für eine junge Frau wie dich, wenn sie zu lange alleine ist. Such dir einen Mann, der dich wieder aufblühen lässt.«
»So einen wie den Drechsler, mit dem du mich verkuppeln wolltest?«
»Albrecht Keßler ist ein guter Mann.«
»Er könnte mein Großvater sein.«
»Ein lahmer Gaul, na und? Nicht jeder feurige Hengst lässt sich zähmen.« Donatas Blick wanderte kurz zur Dachstube. Helene begriff die Anspielung, doch bevor sie sich rechtfertigen konnte, wurden sie von Ludolfs lautem Rufen unterbrochen.
»Donata! Helene!« Die Aufregung in der Stimme des Gerbers ließ Helene sofort aufspringen. Wenn der wortkarge Ludolf derart die Stimme erhob, musste etwas Schlimmes geschehen sein.
Sie liefen auf den Hof und sahen im Halbdunkel, dass Ludolf und eine Frau aus dem Nachbarhaus jemanden stützten, der wie leblos in ihrem Griff hing.
»Oh, Himmel, Sybilla!«, keuchte Donata und stürzte auf Roberts Mutter zu, deren Kleidung so schlammverschmiert war, als wäre sie in eine Pfütze gestürzt. Doch das alles konnte nicht der Grund für ihren Zustand sein.
Sie trugen sie in die Küche. Donata holte eine Schüssel Wasser herbei und tupfte Sybillas schmutziges Gesicht mit einem Tuch ab, dann löste sie die Bänder des Wamses, das Roberts Mutter trug, und streifte es ab. Auf Sybillas Hemd war nun auf der linken Körperseite ein großer Blutfleck zu erkennen. Helene legte erschrocken eine Hand vor den Mund. Jemand musste mit einem Messer auf sie eingestochen und ihr eine Verletzung zugefügt haben, die sie das Leben kosten konnte.
»Ich habe sie auf der Straße gefunden, als ich die Schweine zurück zum Haus trieb«, erklärte die Nachbarsfrau hastig. »Heilige Maria, zunächst glaubte ich, sie wäre tot, wie sie dort im Schlamm lag. Aber dann bewegte sie sich und stöhnte. Wahrscheinlich wurde sie von herumlungerndem Gesindel überfallen.«
»Wie auch immer«, unterbrach Helene sie. »Sie braucht einen Arzt und zwar schnell, sonst stirbt sie.«
»Ich werde Ullrich, den Bader, herbeischaffen«, sagte Ludolf und machte sich sogleich auf den Weg.
Sybilla stöhnte laut. Ihre Augen irrten suchend in der Küche umher.
»Robert?«, brachte sie krächzend hervor. »Wo ist Robert?«
»Er wird bald hier sein«, erwiderte Helene. Sie drehte sich zu Donata um. Ihre Tante nickte, und so lief sie eilig aus dem Haus auf das Färbertor zu, um Robert herbeizuschaffen. Er musste erfahren, dass seine Mutter mit dem Tod rang.
Kapitel 3
Robert wusste, dass Apollonia von Humbert dazu angehalten wurde, ihre Freier rasch aus dem Zimmer zu schicken, wenn diese ihre Befriedigung erlangt hatten, damit die Dirne sich umgehend dem nächsten Kunden zuwenden konnte. Für ihn machte Apollonia jedoch eine Ausnahme und blieb noch eine Weile in seinen Armen liegen, nachdem Roberts Lust gestillt war, so dass er die Nähe ihres warmen Körpers genießen konnte.
Er streichelte ihre Schulter und verlor sich in seinen Gedanken. Apollonia konnte wohl ahnen, was ihm im Kopf herumging, denn sie ließ einen Finger auf seinem Gesicht von einem Mundwinkel zum anderen wandern und zeichnete sein Lächeln nach.
»Erkenne ich da etwa Häme?«, wollte sie wissen.
Er lachte. »Ich stelle mir vor, dass Caspar schimpfend wie ein Rohrspatz in einem Badezuber hockt und sich so lange angewidert mit einem Tuch abreibt, bis seine Haut so rot ist, als hätte man sie mit Brennnesseln bestrichen.«
»In der nächsten Zeit solltest du ihm wohl besser aus dem Weg gehen.«
»Warum? Caspar ist nur mutig mit seiner bösen Zunge.« Robert ballte die Hand zur Faust. »Und sein nichtsnutziger Kumpan ist ebenfalls ein Idiot. Wenn es sein muss, nehme ich es mit beiden gleichzeitig auf.«
»Das habe ich gesehen, als du vorhin mit erhobener Faust auf sie losgehen wolltest.«
»Und wenn ich nicht zurückgedrängt worden wäre, hätte ich Caspar auch eine kräftige Abreibung verpasst. Eine Tracht Prügel, die er sich mit seinem Schandmaul redlich verdient hat.«
Apollonia richtete sich ein Stück auf. Ihre üppigen Brüste drückten sich dabei gegen seinen Oberkörper. »Du solltest lernen, deinen Jähzorn zu zügeln, Robert. Wenn du dich weiterhin so unbedacht verhältst, wirst du eines Tages in arge Schwierigkeiten geraten.«
»Ich dachte, du magst mein Temperament.« Er zog sie weiter zu sich heran und küsste ihren Mund.
»So meine ich das nicht«, sagte sie.
»Ich weiß, aber es wird immer Situationen geben, in denen die Wut über meinen gelassenen Kopf siegt. Vor allem dann, wenn jemand so beleidigend über meine Mutter spricht und mich einen Bastard schimpft.«
»Nimm es mir nicht übel, doch soviel ich weiß, war deine Mutter niemals verheiratet. Du … du bist also tatsächlich ein Bankert.« Sie schien ihre Worte so vorsichtig zu wählen, als befürchte sie, dass auch sie ihn in Rage versetzen würde. Apollonia schwieg kurz, dann fragte sie. »Bist du deinem Vater jemals begegnet?«
Er schüttelte den Kopf. »Meine Mutter konnte mir nicht viel über ihn berichten. Er soll ein fahrender Händler gewesen sein, mit dem sie in Salzburg eine kurze Affäre gehabt hat. Sie sagt, sie kennt nicht einmal seinen vollständigen Namen, da er bereits nach wenigen Tagen weitergezogen ist, ohne zu wissen, dass sie von ihm schwanger geworden war.«
»Und Sybillas Familie? Deine Familie?«
»Sie ist ein Waisenkind. Vor zwanzig Jahren, als sie diesem Mann über den Weg lief, hat sie im Haushalt einer begüterten Familie als Dienstmagd gearbeitet. Nachdem ihre Schwangerschaft bekannt wurde, hat man sie auf die Straße gesetzt. Sie wollte nicht in Salzburg bleiben und ist hier nach Rosenheim gekommen, wo sie mich dann zur Welt gebracht hat.«
»Glaubst du, sie könnte dir etwas verschweigen?«
Er zuckte unschlüssig mit den Schultern. Es gab tatsächlich einen Vorfall, der ihn stutzig gemacht hatte, doch diese Erinnerung aus seiner Kindheit lag bereits an die fünfzehn Jahre zurück. Seine Mutter und er hatten damals noch nicht im Haus des Gerbers, sondern außerhalb des Marktes Rosenheim bei einem Bauern in der Gemeinde Roßacker gelebt. An einem Tag im Herbst war dort auf dem Hof ein Fremder eingetroffen, der Sybilla in eine tiefe Verwirrung gestürzt hatte. Auch nach all den Jahren tauchten diese Bilder recht klar in seinem Kopf auf. Er glaubte sich an einen großgewachsenen Mann zu erinnern, der mit einem schmutzigen Mantel bekleidet gewesen war. Wahrscheinlich hatte er einen tagelangen Ritt hinter sich gebracht. Als Sybilla das Gesicht des Mannes erblickt hatte, war sie zusammengezuckt, und sie hatte ein seltsames Geräusch von sich gegeben. Bis heute war Robert nicht klar, ob es sich dabei um überraschte Freude oder um einen Ausdruck des Erschreckens gehandelt hatte.
Der Mann war von seinem Pferd gestiegen und wortlos auf ihn zugetreten. Er hatte auf Robert so furchteinflößend gewirkt, dass ihm das Bild dieses Besuchers und die Reaktion seiner Mutter bis heute im Gedächtnis geblieben waren. Trotz der schmutzigen Kleidung hatte Robert damals sofort begriffen, dass dies nur ein Herr von hohem Stand sein konnte. Der Herr hatte ihn mit so strengem Blick gemustert, als hätte Robert sich eines schlimmen Vergehens schuldig gemacht. Dann hatte seine Mutter die Hand des Mannes geküsst. Sie hatte geweint, daran erinnerte er sich genau. Robert war von ihr zum Rosenheimer Markt geschickt und eindringlich angewiesen worden, nicht vor dem Abend zurückzukehren.
Obwohl der Fremde seine Neugier geweckt hatte, hatte Robert die Bitte seiner Mutter befolgt und war erst in der Dämmerung heimgekommen. Der fremde Herr war da bereits fortgewesen. Sybilla hatte mit verweinten Augen, nur mit ihrem Hemd bekleidet, auf einer Bank gehockt und so verzweifelt geschluchzt, dass Robert Angst bekommen hatte. Er hatte sie vorsichtig gefragt, wer der Herr gewesen sei, und daraufhin hatte Sybilla nur noch heftiger angefangen zu weinen, und in diesem Zustand war sie die nächsten fünf Tage verblieben. Sie hatte geheult und geschrien, sich auf ihrem Lager zusammengekrampft und Gott um Vergebung angefleht. Auf seine Frage hatte sie ihm aber nie eine Antwort gegeben – auch nicht, als sie sich wieder beruhigt hatte. Der Fremde kehrte niemals zurück, doch bis zum heutigen Tag glaubte Robert, dass er damals seinem Vater begegnet war.
»Wie auch immer«, sagte Apollonia und drehte eine schwarze Locke um ihren Finger. »Du solltest lernen, dein Temperament zu beherrschen. Vor allem, wenn du um größere Summen spielst.«
Er winkte ab. »Erspare mir die Vorwürfe. Du klingst wie Helene.«
»Helene Holt? Die mir vorhin in der Taverne wohl gerne Feuerbälle aus ihren Augen entgegengeschleudert hätte, als wir uns hier in die Kammer zurückgezogen haben?«
Robert stutzte. »Das ist mir nicht aufgefallen.«
»Stell dich nicht dumm, Robert. Die Frau giert nach dir wie eine rollige Katze, die über den Boden kriecht und jaulend ihr Hinterteil in die Luft streckt.«
Er schmunzelte über diesen Vergleich und musste sich eingestehen, dass Apollonia wohl recht hatte. Das musste der Grund dafür sein, dass Helene ihn so oft verstohlen im Blick behielt. Und sie konnte es auch nur schlecht vor ihm verbergen, wie sehr es ihr die Laune verdarb, wenn er seine Aufmerksamkeit anderen Frauen schenkte. Er hatte ihr niemals Hoffnung gemacht, dennoch suchte sie seine Nähe und folgte ihm oft in die Taverne oder gesellte sich zu ihm, wenn er Aufgaben auf dem Hof des Gerberhauses erledigte. So manches Mal schon hatte er sich heimlich davongestohlen, um Helene einfach loszuwerden.
Apollonia schaute ihn an und runzelte die Stirn. »Ihr wohnt seit Monaten zusammen in einem Haus, und sie würde dir mit Freude jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Warum in Herrgotts Namen nimmst du also noch meine Dienste in Anspruch?«
Er zögerte kurz, dann sagte er: »Ich mag Helene. Aber sie sucht nach einem Ehemann und nach einem Vater für ihren Sohn. Daran habe ich kein Interesse. Ich bin noch nicht dazu bereit, eine Familie zu versorgen. Und wenn es mich zwischen den Beinen juckt, dann habe ich ja immer noch dich.« Er warf abrupt die Decke zurück, packte Apollonia und zog sie auf sich. Sie juchzte und kreischte, als er seine Finger in ihre Hinterbacken krallte, doch schon im nächsten Moment wurde ihr lustvolles Treiben von einem lauten Pochen an der Tür und einem Rufen unterbrochen.
»Robert! Öffne die Tür!« Es war Helenes Stimme.
»Wenn man vom Teufel spricht«, meinte Apollonia und seufzte vernehmlich.
Robert richtete sich auf. Wieder hämmerte Helenes Faust gegen die Tür. Er hatte angenommen, sie wäre längst zurück zum Gerberhaus gelaufen, doch anscheinend hatte sie die ganze Zeit unten in der Taverne gehockt und sich darüber geärgert, dass er ihr die Dirne vorgezogen hatte. Wenn es nur Eifersucht war, die sie so aufgebracht vor diese Tür getrieben hatte, dann würde er sie mit deutlichen Worten zurechtweisen müssen.
»Verschwinde!«, rief er laut.
»Um Himmels willen, lass mich ein!«
»Sie ist hartnäckig«, meinte Apollonia kichernd.
»Verdammt, was willst du von mir?«, brüllte er.
»Deine Mutter … man hat sie blutend auf der Straße gefunden. Jemand hat sie niedergestochen.«
Sofort sprang Robert aus dem Bett. Nackt wie er war schloss er die Tür auf und ließ Helene eintreten. Sie kam näher, musterte seine Blöße mit skeptischem Auge und bedachte auch die nackte Apollonia auf dem Bett mit einem verächtlichen Blick.
»Was ist mit Sybilla passiert?«, wollte Robert wissen. Er langte nach seinen Beinkleidern.
»Die Nachbarsfrau hat sie auf der Straße gefunden«, brachte Helene hastig hervor. »Sybilla war bewusstlos, sie hat viel Blut verloren. Wahrscheinlich ist sie überfallen worden. Donata kümmert sich um sie, aber Sybilla ist kaum bei Besinnung.«
»Habt ihr nach einem Arzt gerufen?«
»Ludolf hat sich sofort auf den Weg zum Bader Ullrich Eckertz gemacht.«
Robert streifte sein Hemd und das Wams über, schlüpfte in seine Schuhe und zog Helene mit sich aus der Kammer, ohne Apollonia noch Beachtung zu schenken. Sie würde es verstehen.
Er rannte die Straße entlang und nahm keine Rücksicht darauf, ob Helene mit ihm Schritt halten konnte. Binnen weniger Minuten hatte er das Gerberhaus erreicht, wo zur selben Zeit auch Ludolf und der Bader eintrafen. Robert rang nach Atem, als er das Haus betrat und den Bader in die Schlafkammer der Gerberleute führte, wo Donata Sybilla auf der Bettstatt niedergelegt hatte. Dort sah Robert seine Mutter, die sich stöhnend auf einem blutbefleckten Laken zusammenkrümmte.
Er trat auf sie zu und nahm ihre Hand. Sybillas Augenlider flackerten, aber sie erkannte ihn wohl, denn ihr bleiches Gesicht entspannte sich ein wenig.
»Schafft einen Krug Wasser heran«, sagte Eckertz. Der Bader stellte seine Ledertasche ab, öffnete sie und holte einige medizinische Gerätschaften und Verbandsstoff hervor. »Verlass die Kammer, Robert. Ich muss sie in Ruhe behandeln können. In der nächsten Stunde wird mir nur Donata zur Hand gehen.«
Robert wollte nicht gehen, doch die Entschlossenheit in Ullrich Eckertz’ Stimme brachte ihn dazu, sich von Sybillas Hand zu lösen und zurückzutreten.
»Wird sie es überleben?«, wollte er wissen.
»Das liegt wohl mehr in Gottes Hand als in meiner«, sagte der Bader. Er drängte Robert aus der Kammer und zog die Tür zu.
In der Küche schloss Helene Robert in den Arm. Er fühlte sich verzweifelt und hilflos, als er zur Tür starrte. Ullrich Eckertz übte sein Handwerk schon seit mehr als zwei Jahrzehnten im Markt Rosenheim aus, doch er war kein ausgebildeter Chirurg – nur ein Barbier, der Kenntnisse in der Heilkunde erworben hatte und sein Geld mit Zahnziehen und der Behandlung von Wunden und Frakturen verdiente. Sybillas Verletzung erforderte hingegen chirurgische Fähigkeiten, die Ullrich Eckertz wohl kaum besaß.
Hilf ihr, gütiger Vater, betete er in Gedanken und drückte Helene fester an sich. Nun, in der Stunde der Not, war er plötzlich froh, sie in seiner Nähe zu wissen.
Aus der Kammer erklangen Schreie und die hektische Stimme des Baders. Robert drängte es, nach seiner Mutter zu schauen, doch als er sich zur Tür wandte, legte Helene ihre Hände auf seine Brust und schüttelte nur den Kopf. Er seufzte und ließ sich auf der Bank am Küchentisch nieder. Das Brot und das Schmalz, das Helene vor ihm abstellte, verschmähte er. Alles, was er zu sich nehmen konnte, war ein Becher Dünnbier, den er mit zitternder Hand an den Mund führte, während hinter der Tür zur Schlafkammer die Schreie in ein elendes Stöhnen übergingen.
»Wer hat das getan?«, fragte er Helene. Sie hatte ihre Hände zum Gebet gefaltet und antwortete mit geschlossenen Augen: »Ich kann es dir nicht sagen. Die Nachbarsfrau hat Sybilla in diesem Zustand auf der Straße gefunden und mit Ludolfs Hilfe zu uns geschafft.«
»Das ist also alles, was wir wissen«, brummte Robert. Helene nickte nur, und so blieb er weiterhin im Ungewissen, bis Donata nach einer scheinbaren Ewigkeit endlich aus der Kammer in die Küche trat.
Robert erhob sich. »Wie ist ihr Zustand?«
Donata langte nach einem Tuch und wischte ihre blutbefleckten Hände ab. Sie wirkte erschöpft. »Ullrich hat die Wunde gereinigt und einen Verband angelegt, um die Blutung zu stoppen. Wir haben ihr Laudanum verabreicht. Sie schläft nun.«
»Glaubt Ullrich, dass sie es überstehen wird?«, fragte Helene.
»Er weiß es nicht. Der Einstich an ihrer Seite hat die linke Niere verletzt. Ullrich musste sie nähen. Er hofft, dass er damit die innere Blutung verhindern kann, aber er ist sich dessen nicht gewiss. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Wunde entzündet. Ein solches Fieber würde sie in ihrem Zustand wohl kaum überstehen.«
»Gütiger Himmel«, stöhnte Robert, der gehofft hatte, dass es nicht so schlimm um seine Mutter stehen würde. Er atmete gespannt ein, dann schlug er mit der Faust so wütend auf die Tischplatte, dass ein Becher umfiel. »Ich will endlich erfahren, wer für diese Tat verantwortlich ist.«
Donata schwieg, doch Robert sah es ihrem Gesicht mit den zusammengekniffenen schmalen Lippen an, dass sie etwas vor ihm verbarg.
»Du weißt es«, rief er, doch sie schüttelte den Kopf.
»Verkauf mich nicht für dumm, Donata. Ich sehe dir an, dass du etwas vor mir verbirgst.«
»Weil es besser für dich ist, wenn du es nicht erfährst.«
»Es ist besser für mich?« Robert schnaufte aufgebracht und trat an Donata vorbei zur Kammertür.
Sie drängte ihn zurück. »Was hast du vor?«
»Ich werde meine Mutter danach fragen.«
»Sie braucht Ruhe.«
»Dann sag du es mir! Wer hat Sybilla das angetan?«
Donata zögerte kurz. Sie schnaufte unwirsch, dann fügte sie sich jedoch und sagte leise: »Als wir auf den Bader gewartet haben, brachte Sybilla einige Sätze hervor. Sie sprach davon, dass Rudwin sie bedrängt habe, als sie sich nach Erledigung der Wäsche auf den Heimweg machen wollte.«
»Rudwin? Der Schiffmeister?«
Donata nickte. »Der Hundsfott hat sie an die Wand gedrückt und unter ihre Röcke gegriffen. Sie hat sich gegen ihn zur Wehr gesetzt und ihm den Hals zerkratzt. Er stieß sie von sich, zog ein Messer aus seinem Gürtel und stach in seiner Wut auf sie ein. Dann schaffte man sie aus dem Haus. Ich nehme an, Rudwin hat sie im Schutz der Dunkelheit auf eine Seitenstraße geworfen, um sie dort verbluten zu lassen. Es sollte wohl so aussehen, als wäre sie von Diebesgesindel überfallen worden. Doch glücklicherweise wurde sie von der Nachbarsfrau gefunden, als die ihre Schweine zurück zur Färbergasse trieb.«
Robert ballte die Hand zur Faust. »Dafür wird Rudwin bezahlen.«
Helene berührte seine Schulter. Ihr Blick wirkte besorgt. Wahrscheinlich ahnte sie, welche Gedanken in seinem Kopf kreisten.