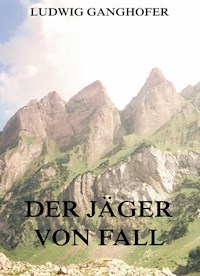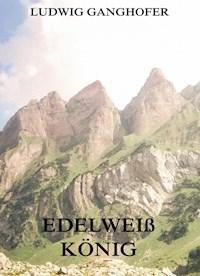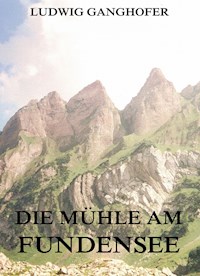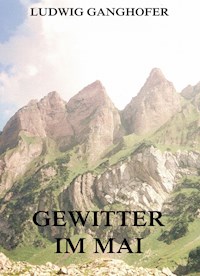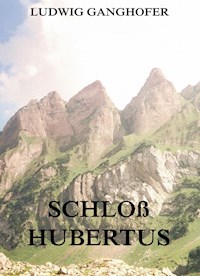Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine von Ganghofers berühmten Hochlandgeschichten um einen armen Knecht, der müßig versucht ein Dorf zu bekehren ... Ludwig Ganghofer war ein bayerischer Schriftsteller, der durch seine Heimatromane bekannt geworden ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Dorfapostel
Ludwig Ganghofer
Inhalt:
Ludwig Ganghofer – Biografie und Bibliografie
Der Dorfapostel
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Der Dorfapostel, Ludwig Ganghofer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN:9783849614713
www.jazzybee-verlag.de
Ludwig Ganghofer – Biografie und Bibliografie
Dichter und Schriftsteller, Sohn des August Ganghofer, geb. 7. Juli 1855 in Kaufbeuren, wandte sich erst der Maschinentechnik zu, betrieb dann in Würzburg, München und Berlin philosophische, naturwissenschaftliche und philologische Studien und widmete sich, nachdem er 1879 in Leipzig promoviert worden war, ausschließlich literarischer Tätigkeit. Er lebt in München. G. errang seine ersten Erfolge als Dramatiker durch die für die Wandertruppe der Münchener Dialektschauspieler gemeinsam mit Hans Neuert geschriebenen Volksstücke: »Der Herrgottschnitzer von Ammergau« (Augsb. 1880; 10. Aufl., Stuttg. 1901), »Der Prozeßhansl« (Stuttg. 1881, 4. Aufl. 1884) und »Der Geigenmacher von Mittenwald« (das. 1884, neue Bearbeitung 1900). Später folgten das gemeinsam mit Marco Brociner geschriebene Trauerspiel: »Die Hochzeit von Valeni« (Stuttg. 1889,.3. Aufl. 1903), die Schauspiele »Die Falle« (das. 1891), »Auf der Höhe« (das. 1892) und das ländliche Drama »Der heilige Rat« (das. 1901). Einen großen Leserkreis erwarb sich G. durch sein frisches Erzählertalent, insbes. mit seinen Hochlandsgeschichten. Wir nennen davon die meist in einer Reihe von Auflagen erschienenen Werke: »Der Jäger von Fall« (Stuttg. 1882), »Almer und Jägerleut« (das. 1885), »Edelweißkönig« (das. 1886, 2 Bde.), »Oberland« (das. 1887), »Der Unfried« (das. 1888), »Die Fackeljungfrau« (das. 1893), »Doppelte Wahrheit« (das. 1893), »Rachele Scarpa« (das. 1898), »Tarantella« (das. 1898), »Das Kaser-Mandl« (Berl. 1900) sowie die Romane: »Der Klosterjäger« (Stuttg. 1893), »Die Martinsklause« (das. 1894), »Schloß Hubertus« (das. 1895), »Die Bacchantin« (das. 1896), »Der laufende Berg« (das. 1897), »Das Gotteslehen« (das. 1899), »Das Schweigen im Walde« (Berl. 1899), »Der Dorfapostel« (Stuttg. 1900), »Das neue Wesen« (das. 1902). Daneben veröffentlichte er noch: »Vom Stamme Asra«, Gedichte (Brem. 1879; 2. vermehrte Aufl. u. d. T.: »Bunte Zeit«, Stuttg. 1883), »Heimkehr«, neue Gedichte (das. 1884), »Es war einmal«, moderne Märchen (das. 1891), »Fliegender Sommer«, kleine Erzählungen (Berl. 1893) u. a. Im Roman »Die Sünden der Väter« (Stuttg. 1886, 7. Aufl. 1902) versuchte sich G. ohne rechtes Glück als Sittenmaler; er hat darin den Dichter Heinrich Leuthold geschildert. G. gab auch eine Übersetzung von A. de Mussets »Rolla« (Wien 1880) und mit Chiavacci die »Gesammelten Werke Johann Nestroys« heraus.
Der Dorfapostel
Erstes Kapitel
Helle Mittagssonne überflimmerte die beschneiten Berge und das weiße Tal. Kaum ein Schatten in der Landschaft; alles in stille, leuchtende Sonne getaucht. Und alles weiß. Man sah von den Dächern keines; sie unterschieden sich im Schnee nicht mehr von den getünchten Mauern der Häuser und von der weißen Erde. Man sah den Kirchturm nicht; er war im Weiß verschwunden; nur die runden Luken seiner Glockenstube hingen wie große dunkle Augen in der Luft, und sein grünes, spitz aufgezogenes Dach, auf dessen steilen Kupferplatten der Schnee nicht haften konnte, schien unter dem Himmel zu schweben, als wär's die sichtbare Haube eines Riesen, der unsichtbar inmitten des weißen Tales stand.
Wie kalt die Nächte noch immer waren, das sah man an den großgeblätterten Kristallen, die überall im Nachtfrost aus der Schneedecke hervorgeblüht waren, als hätte auch der eisige Winter seine Blumen. Die glitzerten mit kaltem Schimmer über allem Grund; doch in den reinen, stillen Lüften, deren blaue Wunderglocke sich wolkenlos über die weißen Berge spannte, und in der linden Sonne der Mittagsstunden spürte man schon eine leise Ahnung des Frühlings, welcher kommen wollte.
Manchmal fielen kleine Schneeklumpen von den Bäumen nieder, immer wieder klang das den Bach bedeckende Eis, und an den verschneiten Hecken flogen die winzigen Schopfmeisen aus und ein.
»Die merken halt auch schon, daß die gute Zeit nimmer weit is!«
So schien der Waldhofer-Roman zu denken, als er auf der Straße stehenblieb, um lächelnd eine Weile das Spiel der kleinen Vögel zu betrachten, die sich der Sonne freuten und dabei im Schnee der Straße ihre Flügel badeten.
Ein junger Bursch, kräftig und schlank gewachsen. Und mit heißem Blut in den Adern. Trotz der Winterkälte trug er die Joppe an der Brust weit offen, als gäb es für ihn kein Frieren. Ein männlich hübsches Gesicht, noch gebräunt vom Sommer her, Kinn und Wangen mit Sorgfalt rasiert, ein braunes Bärtchen über den Lippen aufgezwirbelt, und ruhige, dunkelglänzende Augen. Ein wenig aus der Stirn geschoben saß ein leichtes Hütl mit weißen Adlerflaumen über dem kurz geschnittenen Braunhaar. An Romans ganzem Wesen war etwas von städtischem Schliff. Das hatte er von seiner Soldatenzeit mit heimgebracht, und wenn er auch das doppelfärbige Tuch der ›Schweren Reiterei‹ gegen die Joppe vertauscht hatte, so war ihm doch die militärische Haltung geblieben und jene Fürsorge für den äußeren Menschen, bei der man etwas aus sich zu machen liebt, ohne eitel zu sein.
Als er so mitten in der Straße stand, auf die Axt gestützt, die er wie einen Spazierstock in der Hand führte, war er anzusehen wie der Typus eines glücklich geratenen Volkskindes, ein Bild gesunder Jugend und sorgloser Lebensfreude. Und wie gut seinem Gesichte dieses ruhige, sinnende Lächeln stand, mit dem er das Spiel der Meisen belauschte!
Da flatterten die Vögel plötzlich auf und waren verschwunden.
Ein kleines, behäbiges Männlein mit rundem Faltengesicht kam auf der Straße daher, in einer schwarzen Pudelmütze, unter der die grauen Haare hervorlugten. Um den Hals war viermal ein schwarzer Schlips gewunden, und unter dem langen schwarzen Winterrock, der über dem strebsamen Bäuchlein schon so eng geworden, daß von den Knöpfen weg die Falten straff nach allen Seiten liefen, guckten zwei sacht schreitende Stiefel hervor, groß und schwer wie lederne Flöße. Die Augen gesenkt, ein offenes Buch in den Händen, und diese Hände versteckt in wollenen Fäustlingen, die an einer Schnur um die Schultern hingen, so kam der hochwürdige Herr Felician Horadam, der alte Seelsorger des Dorfes, auf den jungen Waldhofer zugegangen.
»Grüß Gott, Herr Pfarr!«
Der alte Herr schloß das Brevier und machte noch ein paar Schritte, als wäre das keine leichte Sache, diese gewichtigen Stiefel zum Stillhalten zu veranlassen. Nun stand er fest, und die Hände mit dem Brevier hinter den Rücken legend, nickte er freundlich. »Grüß dich Gott, lieber Roman! Was treibst du denn da?«
»So zugschaut hab ich a bißl, wie's d' Vogerln machen. Ich sag Ihnen, Herr Pfarr, von denen kunnt der Mensch was lernen.«
»Freilich, ja, der Mensch könnt immer was lernen! Wenn er nur möcht!« Gutmütig lächelte der alte Herr. »Aber sag, was willst du denn lernen von den Vögerln?«
»Wie s' voller Lustigkeit im Schnee umanand hupfen und d' Federn aufbludern in der Sonn! So müßt's jeder machen: sei' Freud an allem haben, am kalten Winter, wie an der warmen Sonn. Da tät man grad so leicht über harte Zeiten nüberkommen, wie über die guten.«
»Ja, Roman, das lern du nur!« Aus dem Blick, mit dem Herr Felician den jungen Waldhofer betrachtete, sprach es wie Sorge. »Vielleicht kannst du solche Lehr im Leben einmal brauchen. Wer weiß, wie bald?«
Roman lächelte so zufrieden vor sich hin, als wäre er ein wenig stolz auf den klugen Gedanken, den ihm die kleinen Schopfmeisen eingegeben hatten.
»Ja, Roman, lerne das nur!«
Der junge Waldhofer schmunzelte. »Schier mein' ich, Herr Pfarr, ich kann's a bißl!«
»Die harten Zeiten grad so leicht wie die guten nehmen? Wieviel harte Zeiten hast denn du im Leben schon gesehen? Soviel, wie der Blinde auf'm Guglhupf Zwibeben sieht.«
Da lachte Roman. »Haben S' recht, Herr Pfarr! Von dieselbigen, die sich übers irdische Jammertal beklagen müssen, bin ich keiner. Gott sei Dank! Aber jetzt muß ich schauen, daß ich d' Welt hinter d' Füß bring!«
»Wohin denn heut noch?«
»Auf'm Grünberg nachschauen, was unsere Holzknecht schaffen. Der Weg da auffi, der zieht sich.«
»Und geht am Staudamer-Hof vorbei? Gelt ja?«
»Gut troffen, Herr Pfarr! Und gar so gschwind, mein' ich, laßt mich 's Julei net weiter.« Roman lachte, wie die Glücklichen lachen. »Und schauen S', da kommt jetzt gleich von meiner harten Zeit a Stündl: wann ich bei der Julei sitz, und es steht ihr Mutter dabei. Dös is noch eine von die strengen Jahrgäng, wo jedes ledige Bußl als Todsünd gwogen hat. No, muß ich dös harte Stündl halt mit Geduld übertauchen und auf die guten warten, wo d' Mutter net dabei is.«
»Ein netter Diskurs das, für an Pfarrer!« Herr Felician Horadam zog die Brauen auf. »Schenierst du dich denn gar nicht?«
»Warum denn schenieren? Sie geben ja eh bald Ihren Segen dazu.« Lustig zwinkerte der junge Waldhofer. »Muß ich mir halt denken, ich hab a bißl an Fürschuß drauf.« Lachend rückte er das Hütl und ging davon.
Der alte Herr schob erschrocken das Brevier in die Tasche, streckte die Hände aus, so weit es die kurze Schnur der wollenen Fäustlinge zuließ, und vor Schreck der hochdeutschen Rede vergessend, die seiner Würde entsprach, rief er im Dialekt: »Nix da! He, du! Mit'm Fürschuß auf mein' Segen is's nix! Dös bitt ich mir aus!«
Roman blieb stehen und sagte mit Lachen: »Ohne Sorg, Herr Pfarr! Es war net so gfahrlich gmeint. Ich weiß schon, wie ich mich halten muß, daß mir mein Glück net aus der Hand fallt.«
Die heitere Antwort schien den alten Herrn zu beruhigen. Doch während er mit Wohlgefallen den jungen Burschen ansah, fragte er etwas unsicher: »Kommst du denn allweil gut aus mit der Julei?«
»Zwei junge Leut, die sich gern haben, warum sollten denn die net gut auskommen mitanand?«
»Freilich, freilich.«
»No ja, a bißl trutzen, a bißl tratzen. Dös muß sein! Dös is wie der Zucker im Kaffee.«
»So? Meinst?«
Betroffen sah Roman dem Pfarrer ins Gesicht. Er schien zu fühlen, daß aus diesen alten, guten Augen eine Sorge redete. »Herr Pfarrer? So haben doch nix gegen d' Julei, gelt?«
»Ich?« Der alte Herr wurde verlegen. »Nein, nein! Gott bewahre! Ich hab doch ganz was anderes sagen wollen! Ja, der böhmische Peter, gelt, der ist jetzt euer Holzknecht?«
»An bessern Holzknecht kunnt sich der Vater net wünschen. Der schafft wie drei.«
»Aber mir«, der Pfarrer seufzte, »mir macht er eine Sorg um die ander! Triffst du ihn heut noch? Dann mußt du ihm eine Botschaft sagen.«
»Schier kann ich mir denken, was für eine.« Roman lächelte. »Haben S' vielleicht ghört, was am letzten Sonntag passiert is?«
»Ja! Meine Kathrin hat mir's erzählt. Sag mir doch, Roman, was ist denn nur in den Menschen hineingefahren?«
»Der möcht halt d' Leut a bißl besser machen, als wie s' sind.«
»Das hätt schon mancher mögen!« Wieder seufzte Herr Felician Horadam, als hätte er selbst mit solchen Versuchen schon böse Erfahrungen gemacht. »Wenn ich auf der Kanzel stehe, ich, der Pfarrer, und rede meinen Bauern ins Gewissen, du mein Gott, helfen tut's leider auch nicht viel, aber es hat doch sein Ansehen, und die nicht grad schlafen im Betstuhl, passen ja auch ein bisserl auf. Aber wenn so ein Holzknecht kommt, der seine drei Zentner wiegt, und will den Bauern die christliche Nächstenlieb im Wirtshaus predigen, wenn sie ihren Schnaps ausspielen? Schau, da müssen ihn die Leut doch auslachen. Und wie mir die Kathrin erzählt hat, haben sie neulich den armen Kerl auch noch gehörig durchgewichst. Und nicht einmal gewehrt hat sich der gute Lapp!«
»Wehren darf er sich net, mit söllene Fäust! Tät er losdreschen, der Hanspeter, da wären a paar erschlagen, er wüßt net wie!« Der junge Waldhofer lachte, aber es klang doch wie Ernst aus seinen heiteren Worten. »Der Hanspeter meint halt, wann einer d' Nächstenlieb predigen will, so muß er mit gutem Beispiel vorausmarschieren.«
»Ja, ja, ja, und es wär ja auch alles schön und recht. Er ist ein braver Mensch und meint's ja auch heilig ernst. Aber wenn sich ein Pfarrer aufs Butterfasserl setzt, so ist er noch lang keine Sennerin, er macht sich nur die Hosen fett. Und steigt ein Holzknecht auf 's Kirchendach, so wird er deswegen kein Glöckl, das zum Gottesdienst ruft. Ich bin dem braven Menschen doch selber gut. Aber er wird mit seiner Volksverbesserung für das ganze Dorf zum Gespött. Sie schimpfen ihn einen buckligen Apostel hin und her. Und Apostel, das ist doch wirklich kein Wörtl, mit dem man schimpfen soll.« Der alte Herr hatte so lebhaft mit den Armen gefuchtelt, daß ihm die wollenen Fäustlinge heruntergerutscht waren und an ihren Schnüren baumelten. »Geh, sag ihm, er soll am Sonntag zu mir kommen, daß ich ihm ein bisserl Vernunft predigen kann. Und red du auch mit ihm. Von dir läßt er sich was sagen, dich mag er gern.«
»Ja, dös is wahr, für mich tät er durch Feuer und Wasser laufen! Aber beim Hanspeter, lieber Herr Pfarr, is alles Reden umsonst. Was er amal drin hat in seinem Kindergmüt, dös sitzt, als wär's eingossen mit Blei. Aber sagen will ich's ihm.« Roman schmunzelte, als er zum Gruß das Hütl abnahm. »Und gelten S', Herr Pfarr, wann ich vorhin a Spassettl gmacht hab, dös für an geistlichen Herrn net paßt, Sie verübeln mir's net?«
»No ja, was will ich denn machen? ›Und der Himmel voller Huld, hört auch dieses mit Geduld‹, wie es im Liedl heißt! Na also, gfüet dich Gott, lieber Roman! Ich wünsch dir alles Gute von Herzen. Soll dir dein Glück treu bleiben!«
»Vergeltsgott, ja!«
Nachdenklich sah der Hochwürdige hinter dem jungen Burschen her, zog das Brevier aus der Tasche und behandelte das schwarze Buch, als wär's eine Schnupftabaksdose. Der Deckel ließ sich auch richtig aufklappen. Doch als Herr Horadam die Prise nehmen wollte, merkte er den Irrtum. »Ja, ja, ja! Greif nur du nicht fehl, mein lieber Roman! Und wenn die Narretei im Hanspeter nicht fester sitzt, als wie das Glück in dir, so will ich sie bald heraußen haben aus seinem Kindergemüt.« Unter solchem Selbstgespräche setzte der alte Herr die schweren Stiefel in Schwung, während ihm die klare Wintersonne auf den schwarzen Rücken schien.
Nach der anderen Seite eilte der junge Waldhofer über die beschneiten Wiesen hinauf. Von dem Gespräche mit dem Pfarrer schienen nur die heiteren Worte in ihm nachzuklingen. Das allein war nicht die Ursach, daß er mit so seelenvergnügten Augen hinausblickte in den weißen Schimmer. Er konnte nicht anders schauen, als mit hellem Blick, nicht anders denken, als mit Lachen. Der Waldhofer-Roman war von den Menschenkindern eines, denen alles zum Guten ausschlägt und denen aus jedem kleinen Übel, das manchmal ihre Wege kreuzt wie eine springende Grille, gleich wieder eine Freude wächst. Der liebe Herrgott hatte es von Anfang an mit dem Roman gut gemeint, da er ihn vor dreiundzwanzig Jahren dem reichen Waldhofer als einzigen Erben in die schön gemalte Wiege legte. Das kleine ›Mandi‹ war der Stolz des Vaters, die Freude der Mutter, und das gab eine Kindheit, deren einziger Schmerz das Zahnen war. Wie ein langer lachender Sonnentag vergingen dem Roman die Schuljahre. Aus der Lehrerstube brachte er Jahr für Jahr unter den dreißig Buben immer das beste Zeugnis mit heim, nicht nur deshalb, weil unter allen Müttern die Waldhoferin jährlich dem Lehrer die größten Mettenwürste schickte. Und nicht nur in der Schule, auch auf der Gasse war Roman unter allen der flinkste und der stärkste. Wenn es beim Spiel der Buben ernstliche Händel setzte, waren es immer die anderen, welche die Prügel bekamen. Noch stärker als der Roman war nur der ›böhmische Peterl‹. Der aber hing am Roman wie der Schatten am Licht. Dem heimatslosen Waisenjungen, der von der Gemeinde aus halbem Mitleid gefüttert und mit halber Grausamkeit von einer Tür zur anderen gepufft wurde, erschien der mit allen Gütern des dörflichen Lebens gesegnete Erbsohn aus dem Waldhof wie ein vom Glück erzeugtes Wunderding, das man ehrfürchtig bestaunen mußte. Die anderen Buben, deren Väter Haus und Hof besaßen, dachten wohl etwas weniger heilig über den Roman; aber wenn sie in Neid und Eifersucht auch alle zusammenstanden gegen den einen, es half ihnen nichts; der Roman mit dem ›böhmischen Peterl‹, der schon als zwölfjähriger Bub zwei Fäuste hatte wie ein ausgewachsenes Mannsbild, die beiden miteinander waren stärker als die anderen im Dutzend.
Und als für den Roman die ›gspassigen‹ Jahre kamen, begann sich auch das Glück seines Herzens so gemütlich und sicher auszubilden, wie ein gesundes Bäuml wächst, dessen Samenkorn in fruchtbaren Boden fiel. Eines Feiertags im Sommer stand Roman im Garten bei seiner Mutter, die ihrem Buben die schönsten Nelken für sein Hütl aussuchte. Da ging auf der Straße still und mit rosigem Gesichtl eine junge Dirn vorüber und grüßte schüchtern. Und es ereignete sich die merkwürdige Sache, daß Roman, der doch mit der Staudamer-Julei sechs Jahre Tag für Tag in die Schule gegangen war, das schmächtig aufgeschossene Mädel mit so großen Augen ansah, als wär' es heute zum erstenmal für ihn auf der Welt. Und während er so verwundert dastand, fuhr ihm die Mutter lachend mit der Hand durchs Haar: »Ja, schau dir s' nur an! Die wachst sich amal aus für dich!« Der Waldhof und das Staudamergut, das waren die herrschenden Adelshäuser des Dorfes, die ebenbürtigen Bürgermeisterdynastien; und bevor noch die zwei jungen Leute recht ›daran‹ dachten, war zwischen den Alten schon alles abgeredet.
Doch alles rechte Glück will langsam gebaut sein wie ein gutes Haus. Roman brauchte ein Jahr, bis er eines Abends der Julei über den Gartenzaun ins Ohr wisperte: »Du und ich, wir zwei täten zammpassen!«
Ganz ernst, ohne auch nur ein bißchen rot zu werden, sagte die Julei: »Dös hat der Vater und d' Mutter auch schon gmeint.«
»Aber selber meinst es schon auch a bißl?« Heiß war dem Roman diese Frage aus verliebtem Herzen gesprungen. Für eine Antwort reichte die Zeit nicht mehr; denn plötzlich stand die Staudamerin neben den beiden, und Julei wurde von der Mutter ins Haus geschickt, aus Furcht, es könnte ihr ›eine Fledermaus ins Haar fliegen‹. Und seit diesem Abend paßte die Staudamerin auf ihr Mädel auf, wie der sparsame Haftelmacher auf ein Drahtschnitzel.
Merkwürdig, wie häufig Roman in der nächsten Zeit der Staudamerin begegnete! Die war überall, wo Roman meinte, daß die Julei wäre. Und das Jahr darauf, im Herbste, mußte er mit lachendem Verdruß die Entdeckung machen, daß die Staudamerin ihre Augen offen hielt, wenn sie von Rechts wegen schlafen sollte. Da trug er das bunte Rekrutensträußl auf dem Hut und war mit den anderen, die man ›behalten‹ hatte, vom Morgen bis zum Abend unter Singen und Jodeln zwischen den beiden Wirtshäusern des Dorfes hin und her gezogen. Aber während die anderen ›Sträußlbuben‹ von der Soldatenfreude schon wacklige Knie und heisere Kehlen hatten, jodelte er allein noch hinauf bis in den höchsten Diskant und hatte den Kopf so hell behalten, wie am Morgen die Sonne war. Mußte er doch, wenn die Sterne kamen, seiner Julei ein Wörtl sagen, treu und fest, daß es ausreichte für die lange Kasernenzeit. Doch als sich das kleine Fenster nach leisem Pochen lautlos geöffnet hatte, und als sich das junge Paar unter heißem Liebesgeflüster zwischen den engen Gitterstäben mit etwas unbequemer Mühsal umschlungen hielt, stand plötzlich die Staudamerin wie ein aus dem Boden gestiegener Geist in der finsteren Kammer und hub ein Schelten an, daß Roman mit ein paar Sätzen beim Zaun und draußen über den Staketen war. Doch das ›feste Wörtl‹ war gesagt, und als der erste Schreck sich gelegt hatte, kam den Roman ein glückseliges Lachen an; er schrie einen Jauchzer in die Nacht hinaus, daß die Berge widerhallten.
Am anderen Morgen wanderte er mit den Kameraden singend zum Dorf hinaus, auf dem Rücken das schwer angepackte Köfferchen, und im Herzen das selige Gedenken an ein rosiges Gesichtl, dessen Augen so sanft und unschuldig dreinschauten wie Taubenaugen, aber manchmal doch so seltsam aufglommen wie versteckte Kohlenglut, wenn der Wind die hüllende Asche davonbläst.
Drei Jahre! Dem Roman vergingen sie, er wußte nicht wie. Daheim freilich, da waren inzwischen harte Dinge geschehen: den Staudamer hatte beim Abladen eines Heuwagens der niederstürzende Wiesbaum erschlagen, und im Waldhof hatte die Bäuerin, von einer jähen und schmerzvollen Krankheit befallen, die guten Augen geschlossen. Aber da hatte es doch bei allem Kummer das Glück wieder gut mit dem Roman gemeint: er mußte das abgezehrte Weibl nicht auf der Bahre liegen sehen, und so behielt er die Mutter in Erinnerung als ein Bild des freundlichen Lebens, mit dem lachenden Gesicht, das die Waldhoferin bei Lebzeiten ihrem Buben immer gezeigt hatte.
Am Tage der Heimkehr führte ihn sein erster Gang zum Friedhof. Und da wollte es wieder sein Glück, daß er auf diesem Weg einem lieblichen Schmerzentrost begegnete – der Julei! Was für selig erstaunte Augen er da machte! Und wenn er eine Minute lang seiner Trauer vergaß, so war ihm das nicht zu verdenken. Hinter dem Tode hat immer das Leben sein Recht. Und die Julei hatte sich in den drei Jahren ausgewachsen, rund und farbig wie ein Apfel in der Reife, recht zum Anbeißen! Freilich gab es bei dieser Begegnung kein anderes Gespräch, als vom seligen Vater Staudamer und von der gottseligen Mutter Waldhoferin. Denn es war die Staudamerin dabei, wieder einmal! Und die Julei, als wäre sie in den drei Jahren noch um ein Erkleckliches sanfter und sittsamer geworden, wagte kaum die Augen aufzuschlagen. Sie tat es nur für einen kurzen Blick. Das war ein Blick, so still und fromm wie die Luft in einer Kirche. Dennoch meinte Roman aus diesem sanften Blick herauszulesen, was er in seinem eigenen Herzen fühlte. Liebe überredet leicht, am leichtesten sich selbst.
Er mußte erst das Gitter des Friedhofs klirren hören, um aus der Freude seines Glückes wieder hinüberzutaumeln in seine Trauer. Und da fand er ein Grab, auf dem schon die Blumen standen. Er tauchte die zitternde Hand in den Weihbrunnkessel, um den Hügel zu besprengen. Aber so recht bitter weh ums Herz wurde ihm erst, als er wieder daheim war und herumschaute in der Stube, die ganz anders aussah als zu Lebzeiten der Mutter. »Ich weiß net, Vater«, sagte er beklommen, »so viel Sach liegt umanand, und trutzwegen is d' Stuben so viel leer. Als hätt einer den Ofen davontragen.«
»Ja, Bub, man merkt halt, daß d' Mutter nimmer da is!« Der Waldhofer strich sich mit der groben Hand über die grauen Haare. »Mußt bald schauen, daß a richtiges Weib ins Haus kommt. Meinetwegen kannst Hochzet halten nach die Ostertäg.«
Habt ihr schon gesehen, wie ein dunkler Wolkenschatten über die Felder schleicht und hinter ihm her die lachende Sonne läuft?
Ein paar Tage später, am Sonntag nach dem Rosenkranz, wanderten der alte und der junge Waldhofer zum Staudamergut hinaus, der Vater im langen Rock, der Bub in der Joppe, auf dem Hut die Nelken, die er in seiner Mutter Garten noch gefunden hatte. Roman war dem Vater immer um ein paar Schritte voraus, obwohl er sich bemühte, jene ›verstandsame‹ Miene aufzusetzen, wie sie einem Burschen geziemt, der ›nach die Ostertäg‹ schon Bauer werden will. Und Bauer im Waldhof! So was verpflichtet!
Die Staudamerin, als sie die beiden so feierlich kommen sah, schmunzelte über das ganze braungerunzelte Gesicht. Die Julei wollte sich verstecken, aber Roman haschte sie mit flinkem Griff. In der Stube schwatzte man zuerst vom Wetter, vom Vieh und von den faulen Dienstboten, dann wurde ›Kaffee‹ getrunken, und als nach dem letzten Tröpfl der ›Antrag‹ in wohlgesetzten Worten vorgebracht war, gab's zwischen dem Waldhofer und der Staudamerin einen zähen Handel um das Heiratsgut. Während die Alten schacherten, saßen die Jungen still dabei: die Julei mit niedergeschlagenen Augen und mit den Händen im Schoß, der Roman mit ernstem Gesicht, nur manchmal ein stilles Schmunzeln um den Mund, ein ungeduldiges Zwinkern um die Augen.
So lang auch der Tag im Herbste noch immer war – es wurde doch Abend, bis die Alten mit ihrem Handel ins reine kamen. Wenn auch das Staudamergut an den Bruder der Julei fallen mußte, der seit einem Jahr beim Leibregiment in München diente, so war's an sicheren Staatspapieren doch ein stattliches Brautgeleit, das man der Julei ›hinauszahlte‹. Der Waldhofer schien mit dem Handel zufrieden. Und die Staudamerin, als der Schacher zu Ende ging, war sehr gerührt. Dicke Trauen kugelten ihr über die runzligen Backen, während sie die Hände des jungen Paares ineinander legte. »No also, in Gottsnamen halt!«
Roman, dem heiligen Ernst des Augenblicks zuliebe, bezähmte die Freude seines Herzens und sagte feierlich: »Müssen wir halt zammhalten wie christliche Brautleut, fest und treu!«
»Fest und treu.« Ganz leise tröpfelten die drei Wortlein von Juleis Lippen. Dabei wurde sie bis unter das Blondhaar so dunkelrot, wie Roman sie noch nie gesehen hatte. Und sie gefiel ihm so gut, daß er sie mit einem Jauchzer in die Arme schließen wollte, um ihr den Brautkuß auf den roten Mund zu drücken. Aber die Staudamerin fuhr dazwischen: »Söllene Sachen mag ich net. Wirst wohl noch warten können bis zum Ehrentag? Mit eim unschuldigen Bußl fangt man an, und mit was man aufhört, weiß man nimmer.
Da lachte der alte Waldhofer. »No, no, no, gar so gfahrlich wär's nimmer. Steht ja der Stadel schon offen, daß der Heuwagen unter Dach kommt.«
»Kunnt allweil noch draufregnen!« meinte die Staudamerin in ihrer mütterlichen Vorsicht.
Und nun kamen für den Roman schwierige Zeiten. Denn der Staudamerin schien ein Teil jener Eigenschaft angeboren zu sein, die der Teufel mit Gott gemein hat: die Allgegenwart. Da half keine List, kein Trotz und Ärger. Dazu kam noch, daß die Julei in ihrer stillen Unschuld die strengen Worte der Mutter nachzureden begann: ›dös därf net sein‹ und ›dös is net verlaubt!‹ Den Roman verdroß es manchmal, daß die Julei ihre Liebe so stachlig zu umzäunen verstand. Denn daß sie ihn liebhatte, daran gab's keinen Zweifel für ihn. Sie war eben von den ›Allerbrävsten‹ eine, und er tröstete sich mit dem Gedanken: »So a bravs Weiberl, wie ich eins krieg, hat noch nie keiner net ghabt.« Und die Zeit, in der er mit herzlicher Liebe wecken durfte, was in der unschuldsvollen Seele seiner Julei schlummerte und nur manchmal heimlich aus diesen Taubenaugen hervorglitzerte wie Kerzenschein aus den Fenstern einer Kirche, diese selige Zeit wird wohl noch zu erwarten sein. Aber je mehr er in seiner Liebe geneigt war, der Julei alles zum guten auszulegen, um so gereizter wurde er gegen die Staudamerin. Und wenn der Teufel die Alte mit ihren ›aufpasserischen Luchsaugen‹ manchmal für ein Viertelstündl durch die Luft entführt hätte, wär' es ihm recht gelegen gekommen.
Bei solchem Stand der Dinge war es begreiflich, wenn Roman an jenem schönen Wintertage, als er in die Nähe des Staudamerhofes kam und die ›Allgegenwärtige‹ durch den Schnee hinüberwaten sah zum Nachbarhaus, einen glückseligen Jauchzer nur mühsam unterdrücken konnte. Hastig duckte er sich hinter eine der weißen Hecken und gewann mit flinken Sprüngen das Gehöft. Lauschend blieb er vor dem Hause stehen, so verdutzt wie einer, dem eine liebe, schon halb erfüllte Hoffnung wieder zu Wasser wurde. Seine Julei war daheim, er hörte ihr lustiges Lachen aus der Stube heraus. Aber noch eine andere Stimme lachte mit. Eine Männerstimme. Roman zog die Brauen auf. Doch ehe sich noch der Ärger richtig in ihm festsetzte, erkannte er diese Stimme. Das war nur der Mickei, der Knecht im Staudamerhof. Einen Knecht schickt man aus der Stube, und fertig!
Über den dummen Gedanken lachend, den ihm der erste Ärger eingegeben, ging Roman rasch auf die Haustür zu. Da schwiegen in der Stube plötzlich die beiden Stimmen. Und im Flur begegnete dem Roman der Knecht, ein hagerer Bursch mit spöttischen Augen, die weiße Arbeitsschürze um die Hüften gewickelt, die Tabakspfeife in der Brusttasche des grün und rot gewürfelten Jankers. Er nickte dem Roman zu und flüsterte in wohlmeinender Freundschaft: »Heut hast es gut erraten. Die Alte is net daheim.«
Der junge Waldhofer schien sich in keine Vertraulichkeiten einlassen zu wollen. »Dös weiß ich schon selber.« Während der Knecht auf der Hausschwelle stehenblieb und lächelnd über die Schulter blickte, trat Roman in die Stube. »Schatzl! Mein liebs!« Er streckte die Arme, stand aber wie angewurzelt, als müßten erst seine Augen satt werden von dem lieblichen Sonnenbild, das er in der Stube fand.
Julei saß in der Herrgottsecke am Tisch, umflimmert von der Sonne, die durch die beiden Fenster fiel. Das wirrgezauste Blondhaar schien zu brennen, und flaumiger Schein umzitterte den weichen, schlanken Hals. Die weißen Puffärmel, die sich unter den schwarzen Miederbändern hervorbauschten, waren vom Lichte wie gesäumt mit glitzernden Borten, und eine rosige Schimmerlinie zog sich um die runden Arme und um das Schattenprofil des sanften Grübchengesichtes, das ein wenig verlegen über die Näharbeit gebeugt war. Ohne aufzublicken, ganz leis und schüchtern, erwiderte Julei den Gruß ihres Verlobten und ritzte mit der Nadel einen Saum in das Leintuch, dessen Zipfel am Polster des Nähsteines angehäkelt war.
Roman, unter leisem Lachen, griff mit beiden Händen in die Luft und machte zwei Fäuste, als hätte er jetzt sein Glück gefaßt, um es festzuhalten. »Heut, Schatzl, heut hab ich's troffen! Und ausschauen tust, als ob aus lauter Sonnschein und Licht wärst!« Und da saß er schon neben Julei, hatte sie mit den Armen umschlungen und bedeckte ihre Wange mit Küssen.
Ein wenig überließ sie sich dieser stürmischen Zärtlichkeit, und ein wenig begann sie sich zu sträuben. »Wann d' Mutter kommt!«
»Die kommt net.« Er küßte wieder. »Heut muß ich mich speisen für hungrige Zeiten.«
»Aber d' Mutter will's net haben. Hör auf, oder –«
»Oder was?«
Sie entzog sich ihm und hob zur Antwort die spitze Nadel.
»Geh, du!« Er wollte den schimmernden Blondkopf zwischen die Hände nehmen. »Dös glaub ich doch net, daß dich trauen tätst?«
Kichernd beugte Julei sich zurück, und während ihre sanften Taubenaugen einen ganz anderen Blick bekamen, stieß sie blitzschnell mit der Nadel zu.
»Au! Aber hörst, Julei!« Roman machte ein halb verdutztes, halb verdrossenes Gesicht.
Sie sah ihn an wie ein vergnügtes Kind. »Gelt, daß ich mich trau!«
»Dös hätt ich mir gar net denkt, daß ich an dir so a wehrhafts Weiberl krieg!« Nun lachte er, saugte von seiner Hand den kleinen Blutstropfen fort, der aus dem Nadelstich geflossen war, und meinte: »Dös is mir auch was Neus, daß mein Blut so süß is. Wird halt so sein, weil ich's für dich vergossen hab.« Scherzend legte er den Arm um ihre Hüfte.
»Duuu!« Sie drohte mit den Augen.
»Aber hörst!« Er zog das Mädel an sich. »Bist denn mein Schatzl net? Und mein Bräutl, mein liebs?«
»No ja, meintwegen!« Das sagte sie flink, als wäre sie in Sorge, daß er ernstlich böse würde. »Aber nähen mußt mich lassen. Und brav mußt sein.« Dabei sah sie mit Augen zu ihm auf, die wieder ganz Unschuld waren.
Die Sehnsucht, sie zu herzen, brannte in ihm; aber dieser fromme Blick band ihm die Hände. Eine Weile saß er ›brav‹ an ihrer Seite. Dann sagte er verdrießlich: »Grad mit mir bist allweil so ernsthaft! Und z'erst hast lachen können, bis in Hof aussi hab ich's ghört.«
»No mein, der Mickei halt!« Sie stichelte eifrig am Saum des Leintuches. »Allweil verzählt er söllene Sachen, daß man 's Lachen nimmer heben kann.«
»Was hat er denn verzählt?«
Julei kicherte. »Von der Häuslschusterin. Und was ihr die Buben angstellt haben in der heiligen Lichtmeßnacht! Aufs Dach auffi sind s' ihr gstiegen und haben 's Kaminloch zugstopft, daß die Hex, die alte, nimmer ausfahren kann.«
Der junge Waldhofer runzelte die Stirn. »So a bresthafts Weibl plagen, die sich mit ihrem Madl schinden muß um ihr bißl Leben? Dös is nix Lustigs net. Da kunnt ich net lachen drüber. Dös is die richtige Lausbüberei.«
Julei sah ihn mit ihren sanften Taubenaugen an wie ein Kind, das nicht versteht. Und dann erklärte sie entschieden: »Recht is ihr gschehen! Gegen Hexen is alles verlaubt. Und d' Häuslschusterin is eine.«
»Aber Julei!«
»Dös glaub ich, steif und fest! Und ihr Madl, ihr zausets, dö wachst sich auch schon aus dazu. Dös Wetter im letzten Sommer, dös unsern ganzen Haber in Grund und Boden gschlagen hat, dös Wetter hat niemand andrer gmacht, als der Häuslschusterin ihr Madl. Der Mickei hat's gsehen, wie 's Madl am Abend vor der Wetternacht ihren Hexenspruch hingredt hat übern Haber. So!« Julei streckte die Hände wie der Pfarrer, wenn er den Segen spricht.
»Aber Julei!« Zärtlich rüttelte Roman sie mit dem Arm, den er um ihre Hüfte geschlungen hielt. »Was redst denn jetzt da für Sachen! So was mußt net einlassen in dein Köpfl! Dös tat ja passen zu dir, wie der Nachtschatten zur Sonn.«
»Wann's aber wahr is! Und wann's der Mickei sagt!«
»Der Mickei! A guter Knecht, ja! Aber wann er eim Menschen was anhängen kann, so tut er's.« Zärtlich preßte Roman das Mädel an sich. »Geh, Julerl, sei gscheid! Hexen gibt's keine auf der Welt.« Aus dem jungen Waldhofer sprach gesunder Verstand, ein Herz, das von den Menschen gerne das Gute glaubte, und die Aufklärung, die er von seiner Militärzeit aus der Stadt mit heimgebracht hatte. »Dös haben halt so die dummen Leut von eh amal glaubt. Aber es is nix dran. Und a Wetter, dös kommt halt und schlagt hin, wo's hinschlagt. Wenn du's mir net glaubst, so frag den Herrn Pfarr!«
Julei fuhr auf: »Der Herr Pfarr –« Aber da verstummte sie wieder, als behielte sie lieber für sich, was sie sagen wollte.
Nun saßen sie schweigend nebeneinander. Julei stichelte am Leintuch, und Roman blickte nachdenklich in der Stube umher. Und da sah er plötzlich, was ihm früher niemals aufgefallen war: daß es in der Stube aussah, als hätten die Schweden hier gehaust. »So schaut's ja net amal bei uns daheim aus! Und bei enk is doch d' Mutter da. Und du! Geh, Julerl, dös paßt auch net zu dir: wie d' Stuben da ausschaut!«
»No mein«, Julei seufzte, »d' Mutter raffelt halt so umanander. Und ich muß allweil an so viel andere Sachen denken.«
»An was denn?«
In stiller Unschuld lächelnd, hob sie die flimmernden Taubenaugen. Das war ein Blick, der in Roman alles auslöschte und nur sein Glück noch brennen ließ. Er streckte die Arme. »Julerl!«
Kichernd entzog sie sich ihm. »Brav mußt sein und nähen mußt mich lassen. Dös hast versprochen.«
Roman lachte. »Wann ich's versprochen hab, so muß ich's halten. Aber hast es denn gar so nötig mit der Nahterei?« Schmunzelnd strich er mit der Hand über den Saum des Leintuches. »Was machst denn da?«
»Für uns was.«
Da war sein Versprechen gründlich vergessen. »Schatzl! Mein Schatzerl du!« Wie einer, dem das Herz vor Seligkeit überläuft, umschlang er sein taubensanftes Bräutl, drückte mit der Hand ihre Wangen zusammen, daß die roten Lippen spitzig wurden, und diesmal sträubte sich die kleine Heilige nicht. Roman aber sagte lachend: »Du? Dein Goscherl schmeckt ja, als hättst a Zigarrl graucht!«
»Ich? Und rauchen? Geh, du!« Erst schien es, als möchte sie schmollen. Doch sie kicherte wieder. »Dös hat mir der Postbot anghängt. Allweil raucht er so an schlechten, und allweil blast er eim den Dampf ins Gsicht.« Lachend eilte sie zum Anrichtkasten, tauchte den Zipfel eines Handtuches in den Wasserkrug und scheuerte mit dem nassen Tuch energisch den Mund und das Gesicht. Kichernd, mit glühenden Wangen, kam sie zurück und spitzte die Lippen. »Jetzt probier!«
Das ließ sich Roman nicht zweimal sagen. Und bei dem Eifer, mit dem die beiden ›probierten‹, sahen sie nicht, daß im sonnigen Fenster ein kleiner Schatten verschwand. Es war der Schatten einer spionierenden Nase gewesen. Und diese Nase gehörte dem Mickei, der an Hexen glaubte. Lautlos hatte er sich draußen von seinem Lauerposten zurückgezogen. Als er außer Hörweite der Stube war, begann er mit langen Sätzen zu springen, durch den verschneiten Garten zum Nachbarhaus. Dort trommelte er an das Fenster. »Bäuerin! Bäuerin!«
Ein wenig zerstreut, mit den Gedanken noch halb bei dem wichtigen Klatsch, den sie gehalten, kam die Staudamerin aus der Haustür gelaufen. »Was is denn?«
Mickei machte spöttische Augen. »Schier mein' ich, 's Aufpassen wär a bißl nötig. Aber verraten därfts mich net! Sonst hilf ich Enk nimmer.«
Flink erfaßte die Staudamerin den Tiefsinn dieser Worte. »Aber allweil hab ich mir's denkt: heut gschieht noch ebbes!« Lärmvoll rannte sie davon.
Wie der Sturmwind kam sie in die Stube geraffelt. Beim Anblick des jungen Paares, das still im Herrgottswinkel saß, beruhigte sich ihr ärgster Schreck. Ohne zu grüßen, ging sie zur Ofenbank und brummte: »Allweil muß dich der Teufel da haben, wann man dich net brauchen kann!«
Der junge Waldhofer lachte; denn die Staudamerin hatte genau die Worte gesprochen, die Roman sich gedacht hatte.
Durch diesen Stoßseufzer einigermaßen besänftigt, kam die Bäuerin zum Tisch und fragte: »Was willst denn? Magst an Kaffee?«
»Na, ich dank schön!« Schmunzelnd erhob sich Roman und griff nach seinem Hut. »Ich hab schon 's Meinige. Und weiter hungert mich nimmer.« Strahlendes Glück in den Augen, bot er seiner Julei die Hand: »Pfüet dich Gott, Schatzl!«
Leis erwiderte sie seinen Gruß und legte schüchtern ihre Hand in die seine.
Er trank sich das Herz noch voll mit einem langen Blick; dann nickte er der Alten lachend zu und ging.
Während er hinauswanderte über den Hof, hörte er von der Stube her noch die Raffelstimme der scheltenden Mutter, doch keinen Laut seiner Julei.
»Daß sich 's Madl gar net wehrt?« Er seufzte. Und als er zwischen hohen Zäunen um die Ecke bog, sprachen seine Gedanken: »Sei z'frieden, Schatzl! Nach die Ostertäg hast dei' Ruh. Und ich mein Glück.«
Da tauchte die Sonne hinter die weißen Berge hinunter, und der goldene Glanz, der den Roman umgeben hatte, erlosch zu blaukühlem Schatten.
Zweites Kapitel
Einem ausgetretenen Schneeweg folgend, erreichte Roman den Waldsaum des Berges.
Das ist so Bauernart: bevor sie in den Wald treten, sich umzusehen. Und Roman machte es ebenso – nicht, weil er bald ein Bauer werden sollte, sondern weil es ihm die Augen hinzog, wo seine Julei wohnte. Doch ein hoher Schneedamm verdeckte ihm die Aussicht nach dem Staudamerhof. Dafür sah er das Dach des eigenen Hauses groß und stattlich hervorragen über die anderen weißen Dächer des Dorfes. Mit zufriedenem Lächeln ließ er den Blick vom hohen Giebel des Waldhofes über die hundert anderen Dächer gleiten, als möchte er unter ihnen zum Vergleich das kleinste suchen. Ganz draußen am Ende des Dorfes lag es im Schnee, winzig, wie ein weißer Maulwurfshaufen: das Dach der Häuslschusterin, von der die sanfte Julei so fest und heilig glaubte, daß sie eine Hexe wäre.
Aus dem Schornstein, der sich inmitten des weißen Daches ausnahm wie ein schwarzer Punkt, kräuselte sich ein blauer Rauchfaden in die klare Abendluft. Das sah der junge Waldhofer. Und er lachte. »Der Rauchfang, scheint mir, hat schon wieder sein richtigen Zug.« Eine Furche grub sich in seine Stirn, als wäre in ihm von neuem der Unmut über den grausamen Streich erwacht, den die Burschen in der Lichtmeßnacht dem armen Weibl gespielt hatten. Und dann machten seine Gedanken einen Sprung: »Dös muß ich noch aussireden aus ihrem lieben Köpfl: an söllene Sachen glauben! Und über so was lachen können!« Aufatmend wandte er sich, um in den Wald zu treten. Da hörte er ein Geräusch wie von brechenden Ästen. Ein Stück Wild, das der Hunger schon vor Abend in die Nähe der Häuser trieb? Aber nein. Das war ein Laut, als würden frierende Hände gegeneinander geschlagen. Und bald darauf, etwa hundert Schritte entfernt, trat ein junges Mädel aus dem Wald, bis an die Knie im Schnee, auf dem Kopf ein großes Reisigbündel, das zu schwer für ihre Kräfte schien.
Roman lächelte. »Schau nur! An die Alte denk ich grad, und da kommt die Junge daher!«
Sie wollte den Pfad gewinnen. Doch als sie den Burschen stehen sah, wandte sie sich nach der anderen Seite, als wäre ihr von allen Wegen ein einsamer der liebste.
Es war ein schmächtiges Ding, ärmlich gekleidet. Unter dem Reisigbündel hatte sich ihr Haar gelöst und lag wie eine schwarze Welle auf ihrem schmalen Rücken.
Ein Schneedamm versperrte ihr den Weg. Sie wollte ihn übersteigen und versank bis an die Brust.
»He? Madl? Soll ich dir a bißl helfen?«
Wegen des Reisigbündels konnte sie wohl das Gesicht nicht wenden; sie machte nur mit der Hand eine ablehnende Bewegung. Als hätte das Angebot seiner Hilfe ihre Kräfte verdoppelt, so arbeitete sie sich aus dem Schnee heraus, überstieg den Damm und sprang in einen Hohlweg hinunter, in dem sie völlig verschwand.
»Die? Und a Hex? Wann s' hexen könnt, die tät sich a Klafter Holz hinhexen vor ihr Häusl. Und tät net im Schnee umanandfrieren und Armeleutholz klauben!« Roman trat in den Wald. Eine Weile schritt er unter den stillen, weiß behangenen Bäumen hin. Dabei kreuzte er die ›Hexenspur‹. »A Füßerl hat s' wie a Kindl!« Dann kam auch er zu dem Hohlweg. Bevor er hinuntersprang, blieb er lange stehen und lauschte bergaufwärts. Im höheren Walde war alles still. Nun ließ er sich hinabgleiten in die Gasse, die zwischen mannshohen Schneewällen von den schweren Holzschlitten eisglatt ausgefahren war. Während des Aufstieges lauschte er immer wieder. Er mochte sich denken, daß es eine unbehagliche Begegnung wäre, wenn jetzt von den Hornschlitten einer daherkäme, schwer mit Scheiten beladen, in sausender Fahrt, bei der es kein Parieren gibt. Und links und rechts die vereisten Schneedämme – kaum ein Ausweichen möglich!
Aber es fing schon zu dämmern an; da kam wohl von den Schlitten keiner mehr zu Tal gefahren.
Noch eine Stunde mußte Roman steigen, bis er den Holzschlag erreichte, auf dem die Knechte seines Vaters in Arbeit standen. Und da war es schon dunkle, stille Nacht geworden. Kein Laut im Wald und auf der weiten Rodung. Nur manchmal das leise Klatschen eines fallenden Schneeklumpens. Dunkelheit, doch keine Finsternis. Alles übergraut vom Zwielicht des Schnees. Nur der Himmel schwarz, und seine Sterne groß und funkelnd.
Bei langsamem Schreiten auf ebenem Pfade blickte Roman immer hinauf zu diesen flimmernden Lichtern; doch er sah nichts anderes als sein Glück, das runde Unschuldsgesichtchen seiner Julei und ein spitzes, rosig gekräuseltes Mäulchen.
Gedämpfte Stimmen, die zu einem Jodler leidlich zusammenklangen, weckten ihn aus seinen Gedanken. Ein paar hundert Gänge vor ihm lag die große Holzerhütte; sie stand im Zwielicht wie ein mächtiger schwarzer Klotz, umzittert von dem Feuerschein, der aus den Lücken des Schindeldaches und aus der offenen Tür quoll. Auf hundert Schritte spurte Roman den Schmalzgeruch, der von den Kochstätten der Holzknechte kam.
Neben der Tür, auf niederer Holzbank, saß einer, still und ruhig, von der dunklen Balkenmauer mit schwarzem Umriß abgehoben, groß und breit und ungeschlacht, wie Menschen aussehen, die man durch eine Glaskugel betrachtet.
»Guten Abend, Hanspeter!«
»Gottslieben Gruß!«
Dieser Riese von einem Menschen hatte eine Stimme, so klein und weich wie die Stimme eines halbwüchsigen Knaben. Und langsam sprach er und machte es mit den Worten auf seiner Zunge, wie's der Bauer auf dem Zahltisch mit den Goldstücken macht, bevor er sie hinlegt.
»Warum bist net drin in der Holzerstub?« fragte Roman.
»Die reden allweil so. Weißt es ja! Und dös gfallt mir net.«
»Aber was treibst denn da heraußen?«
»A bisserl lesen halt, im Himmelsbuch. Ja. Und da hab ich mir denkt, was d' Stern eigentlich sein kunnten?«
Roman lachte. »Dös mußt doch wissen von der Schul her. Weltkörper sind s' halt, wie unser Erdball.«
Der dunkle Klumpen schüttelte den Kopf. »So sagen d' Leut. Aber ich glaub's net. Laßt der Herrgott 's kleinste Steinl fallen, so tät er so schwere Körpeder auch net droben lassen. Der bleibt sich allweil gleich. D' Stern müssen ebbes anders sein.«
»Und was denn?«
»Schau, Mandi«, Hanspeter hob langsam den Arm mit weisendem Finger, »viel Leut sind gut, aber diemal einer is schlecht. Da muß sich der liebe Herrgott in seiner Güt der sündigen Seel erbarmen und muß ihr in der Nacht, wann 's Gwissen net schlaft, a bisserl zeigen, wie's ausschaut im Himmel. Drum denk ich mir allweil, d' Stern sind kleine Luckerln im Himmelsboden. Und da laßt er den himmlischen Glanz a wengerl aussispitzen! Darfst es bloß anschauen, d' Sterndln, und da mußt ja glauben!«
Roman blickte zu den funkelnden Lichtern auf, und als hätte ihn der Ernst dieser linden Stimme gefangen genommen, sagte er verträumt: »Wenn man s' anschaut, wie lieb als s' glanzen, hast recht, da kunnt man schier so ebbes denken.«
Sie schwiegen, und ihre Blicke hingen dort oben in der grenzenlosen Nacht.
Unter dem Dach der Hütte schwatzten die Knechte lärmend durcheinander; dazu hörte man das Krachen der brennenden Scheite und das Geklapper der eisernen Pfannen.
Roman begann die Kälte der Nacht zu spüren. »Geh, komm in d' Stuben, heut macht's frisch!«
»Mich tut net frieren. Wann ich ebbes denken muß, dös macht mir allweil so viel warm.«
Jetzt lachte Roman. »Dös wär was für die armen Leut. Die müssen gwiß viel sinnieren, wie s' ihr bißl Leben fortbringen. Und tät ihnen 's Denken warm machen, so kunnten sie 's Holz für'n Ofen sparen.« Er trat in die Hütte.
Neben der großen Holzerstube lag eine kleine, mit Brettern verschalte Kammer; hier pflegte der Waldhofer, oder sein Sohn, wenn sie Nachschau hielten, zu nächtigen; ein enges Gelaß, wenig über mannshoch, mit einem kleinen Kochherd, einem Pritschenbett, einem Tisch und zwei Stühlen. Roman zündete die Petroleumlampe an und heizte den Ofen, um sein Nachtmahl zu kochen. Da fiel ihm der Auftrag des Pfarrers ein.
»Hanspeter!«
Schwere Schritte, die alles Gerät der Stube zittern machten. Hanspeter trat in die Türe. Dabei mußte er sich bücken, tief. Und auch in der Stube konnte er nicht völlig aufrecht stehen, wenn er mit dem Scheitel nicht an die Decke stoßen wollte. Gut um einen Kopf war er größer als Roman, der doch auch von den hochgewachsenen Burschen einer war. Und diese Brust, wie eine Tonne, diese mächtigen Schultern, diese klobigen Arme, die an den Fäusten zu tragen schienen wie an schweren Gewichten! Alles übermenschlich, doch alles auch unförmig und ungeschlacht, im Übermaß ein bißchen komisch. Und wie die Gestalt, so das Gesicht: breit und hartknochig, völlig bartlos, mit grobgebauter, niedriger Stirne, die Nase aufgestülpt und flachgedrückt, die Ohren abstehend und das struppige Haar von schmalzigem Braun. Dazu noch – obwohl der Hanspeter nur um ein Jahr älter war als der junge Waldhofer – etwas Greisenhaftes in allen Zügen. Den abstoßenden Eindruck dieses Gesichtes konnten die blau versunkenen Augen mit ihrem ruhig strahlenden Feuer und der stille, lind gezeichnete Mund nur wenig abschwächen. Es war von den unglückseligen Mannsgesichtern eines, die geschaffen sind, um die Weiber lachen zu machen. Auch die Häßlichste ist noch zu unbescheiden, um mit solch einem Gesicht vorlieb zu nehmen.
Und sonderlich viel auf seinen äußeren Menschen schien der Hanspeter auch nicht zu halten. Freilich, er war in seinem Arbeitskleid. Aber er hatte doch einen schönen Lohn und hätte sich ein besseres Zeug schaffen können, als diesen verwaschenen Zwilchkittel, der einmal blau gewesen, dieses grobe Rupfenhemd und diese ungeheuerliche, aus einer grauen Pferdedecke geschnittene Hose, die ihm rückwärts hinunterhing wie ein Aschensack. Ihre Schäfte reichten ihm nur bis zu den Knöcheln, und die Füße staken in klotzigen, schwer mit Eisen beschlagenen Holzschuhen – Schuhe, von denen ein Volkswort sagt: sie lassen den Menschen nicht umfallen.
»Was willst denn, Mandi?« fragte er mit seiner linden, langsamen Stimme. Und weil er in der Stube nicht aufrecht stehen konnte, ging er auf einen Sessel zu und ließ sich nieder.
»Den Herrn Pfarr hab ich troffen.« Roman unterbrach sich; jetzt beim Lichtschein sah er, daß dem Hanspeter eine blutige Schramme über die Wange lief. »Was is dir denn gschehen?«
»Mir? Nix.«
»Aber bist doch voller Blut im Gsicht!«
»Mein, dös bisserl!« Hanspeter griff nach seiner Wange. Um die Hand zu bewegen, hob er zuerst den Ellbogen, als hätte er für das Gewicht seiner Faust einen Hebel nötig. »Weißt, a wengerl gstritten haben s' halt wieder, die narrischen Buben. Ich hab ihnen zugredt, ja, sie sollten gut sein mitanander. So viel schön war 's Leben, wann d' Menschen in Fried anand gern haben täten. No ja, und da is mir halt einer a wengerl ins Gsicht einigfahren. Hab's gar net gspürt. Aber hast mir net vom Herrn Pfarr ebbes sagen wollen?«
»Ghört hat er, was am letzten Sonntag im Wirtshaus gschehen is.«
»So so?« Hanspeter lächelte. »Da hat's halt a bißl Zureden braucht, 's hat sein müssen!«
»No, und da laßt dir der Herr Pfarr sagen, übermorgen am Sonntag sollst zu ihm in Pfarrhof kommen!«
»So so? No ja! Zu dem geh ich allweil gern. Von dem hab ich noch allweil ebbes glernt. Und so viel Geduld tut er haben mit mir, im Beichtstuhl. Da brauch ich so viel lang, bis ich mich bsunnen hab auf alls.«
»Geh, du!« Roman lachte. » Deine Sünden, die trag ich am Nasenspitzl davon.«
»Sag so was net!« Hanspeter sah ernst zu Roman auf. »A jeder kunnt besser sein, als er is! Bloß an einziger is ganz gut gwesen: unser lieber Herr Jesus. Dem müssen wir's nachmachen. Liebet einander, hat er gsagt. Und solang d' Lieb net in die Leut drin is, wie 's Blut in der Herzkammer, solang darf keiner von ihm selber sagen: ich bin gut und sündenfrei.«
Roman schwieg; er wußte aus Erfahrung, daß jede Widerrede gefährlich war; da fand der Hanspeter mit seinem Evangelium kein Ende mehr.
So blieb es ein Weilchen still in der Kammer. Roman setzte Wasser zum Feuer und legte das Rauchfleisch ein, das er sich zum Nachtmahl mitgebracht hatte. Plötzlich fragte er: »Hast von dem Bubenstreich schon ghört, den s' der Häuslschusterin gspielt haben?«
Hanspeter antwortete nicht gleich. »Ja, ja, hab ghört davon. Hab ja dem armen Weibl den Rauchfang wieder in Ordnung bracht. Und schau«, seine Stimme zitterte, »da hast jetzt gleich an Exemplibeispiel, daß ich noch lang von die Guten keiner bin. Wer richtig gut is, soll die gleiche Lieb haben für Feind und Freund.«
»Dös is a bißl viel verlangt.«
»Freilich, ja, ich merk's an mir. Auf die Buben, die dem lieben Weibl so mitgespielt haben, bin ich so viel harb. Die kunnt ich schiergar a bißl verdreschen!« Er streckte die Fäuste vor sich hin.
»Wann ich wüßt, wer's gwesen is, den tat ich mir selber kaufen. So was gfallt mir net.«
»Gelt, ja!« Aus diesen Worten klang ein Eifer, der dem Hanspeter ganz aus der ruhigen Art schlug. »Söllene Boshäftigkeiten sollt man keim Menschen net antun. Und gar der Nannimai!« Er meinte die Häuslschusterin, die Annamaria hieß. »Denn die Nannimai, die kenn ich, weißt! Die mag ich leiden, ja!«
»Dös brauchst mir nimmer sagen, Peterl!« Roman hatte sein Pfeifl angezündet, setzte sich auf das Pritschenbett und ließ die Füße baumeln. »Hockst ja die ganzen Feiertäg drunten bei ihr, tust ihr die grobe Arbeit im Haus, und diemal a Markstückl wird wohl auch in ihr Schubladl schlupfen, gelt?«
»Na, du! Na! Dös is net wahr. Aber gwiß net!« Hanspeter wurde verlegen. Das sah drollig aus: dieser Riese, und schamrot wie ein Kind! »Die Nannimai nehmet kein' Pfennig net an. Dös därfst mir glauben! Aber daß ich dir's ehrlich sag: diemal laß ich ihr a bißl ebbes verdienen, ja! Denn d' Nannimai, sag ich dir, wird wohl 's bravste Weibl sein auf der ganzen Welt. Und ihr Ilsabeth 's liebste Kindl. Ja, du, dös därfst mir glauben!«
»Geh, tu s' nur net gar so loben, die zwei!« Roman paffte eine Wolke vor sich hin. »Dir gelten d' Menschen allweil um d' Halbscheid mehr, als wie s' wert sind.«
»Na, Mandi! Na! Von der Ilsabeth sag ich halt so: die liebst, weil ich kein bessers Wörtl net weiß.« Hanspeter stemmte die Fäuste auf seine Knie, ließ den schweren Kopf ein wenig sinken, und langsam klang seine leise, linde Stimme: »Einer, der d' Ilsabeth kriegt amal, dem hat's der liebe Herrgott gut vermeint.«
Roman stand auf und schob dem Hanspeter mit der Faust den Kopf in die Höhe. »Peterl, Peterl! Gut meinst es ja! Aber Augen hast im Kopf, die richtigen Muckenaugen, die 's Bröserl finden, aber am Zuckerhut nimmer in d' Höh schauen. Mußt dir d' Leut schon a bißl anders betrachten, daß den Unterschied merkst auf der Welt!« Er ging zum Herd. »Am Sonntag schau dir mei' Julerl an! Die is der Zuckerhut. Der wiegt alle Bröserln auf.«
Jetzt schien der Hanspeter zu merken, daß er dem Roman mit dem Lob einer anderen ans Herz und an den Stolz gegriffen hatte. Darüber erschrak er und stotterte: »Die Julei? Ja, ja, hast recht! Tu mir's halt net verübeln, gelt! Die Julei, ja! Gegen die steht gar nix auf. Müßt sonst die deinig net sein. Allweil 's beste, dös muß dir ghören! Und die Julei, Ja! Is so viel lieb! Und so viel gern haben tust es, gelt? Gegen d' Julei kann man gar nix sagen. Aber –« Er fuhr sich mit der schweren Hand über die Stirne. Drüben in der Holzerstube war's ruhiger geworden. Nur ein paar von den Knechten schwatzten noch; die anderen lagen schon im Heu. Hanspeter stand auf. »Muß ich mir halt a bißl ebbes kochen jetzt!«
»Noch gar net gessen hast?«
»Mein, die andern, die brauchen so viel Platz am Herd. Wann die andern ihr Sach haben, is allweil noch Zeit für mich.« Er war schon bei der Türe. Nun kam er zurück und sah dem Roman in die Augen. »Gelt, Mandi? Net daß dir denkst, ich hätt gegen d' Julei ebbes sagen mögen?«
»Na na! Und gut Nacht, Peterl!«
»Gottsliebe Nacht!«
Alles Gerät in der Stube zitterte wieder, als Hanspeter zur Tür hinausging.
Roman ließ sich sein Nachtmahl schmecken. Dann blieb er mit der Pfeife noch ein halbes Stündl neben dem schwelenden Ofen sitzen. Wovon er träumte, das verriet der Glanz seiner Augen. Ein Liedchen summend, löschte er die Lampe und streckte sich zum Schlaf des Glücklichen nieder, der noch fester und süßer ist als der Schlaf des Gerechten.
Am Morgen fing der Spektakel in der Herdstube wieder an. Erst wurde der Magen gepflastert, und dann ging's hinaus zur Arbeit. Die Beilschläge widerhallten im Wald, die Sägen knirschten, und das Krachen der stürzenden Bäume dröhnte über den verschneiten Berghang.
Roman ging mit dem Notizbuch und mit dem Stempelhammer von Block zu Block, von einer Klafter zur anderen. In dem Wust von Ästen, der die Rodung bedeckte, hätte er üblen Weg gehabt. Aber Hanspeter, der mit der Meterlatte die Arbeit als ›Meßmann‹ tat, ging vor ihm her, und wo er hintrat, brachen die Äste glatt in den Schnee. So hatte Roman hinter ihm den besten Pfad.
Weil es Samstag war, bekamen die Holzknechte schon um drei Uhr Feierabend. Da gab's nach der Arbeit eine lustige Talfahrt. Immer zwei von den Knechten luden eine Klafter Scheitholz auf ihren Hornschlitten. Der eine nahm als Schlittenlenker seinen Platz zwischen den aufgebogenen Kufen, der andere setzte sich als Passagier auf die Ladung. Und so jagte ein Schlitten um den anderen durch die ausgefahrene Schneegasse ins Tal hinunter. Jede solche Fahrt, wenn auch ein paar schwere Scheite als Bremshölzer hinter den Schlitten gehängt wurden, war ein übermütiges Spiel mit dem Leben der beiden Menschen, die auf dem Schlitten saßen. Ein Glück, daß Unkraut nicht leicht verdirbt, wie das Sprichwort sagt. Sonst müßte an solchem Schlittenweg ein Martertäfelchen neben dem andern stehen.
Nachdem der letzte Schlitten der Knechte davongefahren, hatten Roman und Hanspeter noch eine Stunde zu schaffen, bis sie mit dem Aufschreiben und Messen der Wochenarbeit fertig wurden. Dann beluden, als es schon leicht zu dämmern anfing, auch die beiden ihren Schlitten. Roman richtete sich mit dem Wettermantel einen bequemen Sitz auf den Scheiten, und Hanspeter übernahm die Führung des Schlittens. Damit die Fahrt, wie Roman wollte, ›ein bißl Schneid‹ bekäme, banden sie kein Bremsholz an den Schlitten. Hanspeter schüttelte wohl den Kopf dazu; aber wenn Roman etwas wollte, hatte der Hanspeter keine Widerrede.
Erst war es auf sacht geneigtem Weg nur ein langsames Gleiten, bei dem sie gemütlich miteinander plaudern konnten. Doch als das steilere Gefäll begann, geriet der Schlitten in so rasende Fahrt, daß es mit dem Schwatzen ein Ende hatte. Bei dem sausenden Luftzug, der ihnen fast die Hüte von den Köpfen riß, hätte keiner mehr das Plauderwort des andern verstanden. Dazu schrillten auf dem vereisten Schnee die Kufen des Schlittens. Und ging es um eine Wendung der Gasse herum, dann spritzten die Schneeklumpen und Eissplitter auf, daß es wie Hagelwetter über den Schlitten wehte. Bei solcher Wendung mußte Hanspeter alle Kraft zusammennehmen, um durch festes Einstemmen der Ferse die Lenkung des Schlittens zu erzwingen; ein Anfahren an den Eiswall der Gasse hätte sie beide mitsamt der Ladung des Schlittens über den Damm hinausgeschleudert in den steilen Wald.
Immer abschüssiger wurde der Weg, immer jagender die Fahrt. Roman, der die Gefahr wie eine Freude empfand, die ihm das Blut in Feuer brachte, fing zu jauchzen an. Doch plötzlich erstickte ihm die Stimme – obwohl er sich rechtzeitig geduckt hatte, war er mit dem Nacken gegen einen großen, den Weg überspannenden Ast gestoßen, und der dicke Schnee, der auf ihn niederklatschte, hatte ihn fast begraben. Aber das erhöhte für ihn nur die Freude dieser Fahrt; lachend schüttelte er die Schneeklumpen von sich ab. Auch Hanspeter lachte mit; doch im nächsten Augenblick, als er glücklich den Schlitten in sausendem Schuß um eine Biegung der Gasse gesteuert hatte, schrie er auf, mit einer von Angst erwürgten Stimme: »Jesus Maria!«
Ein paar hundert Schritte tiefer, mitten im steilsten Gefäll des Hohlweges, stand ein ärmlich gekleidetes Mädel, auf dem Kopf ein schweres Reisigbündel.
»Ilsabeth! Ilsabeth!« schrie Hanspeter wie von Sinnen und machte einen verzweifelten Versuch, mit den vorgestemmten Beinen den Schlitten zu bremsen. Kaum merklich verminderte sich die jagende Fahrt. Und ein Wunder war's, daß dem Hanspeter die Knochen nicht wie Glas zersplitterten.