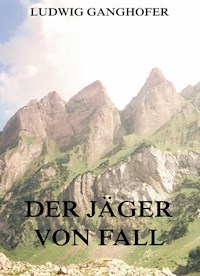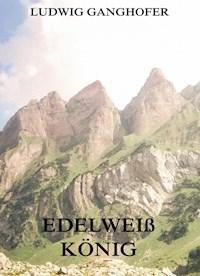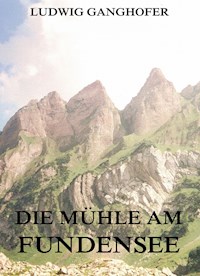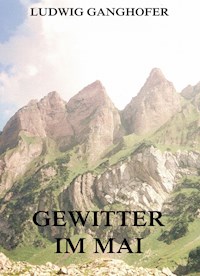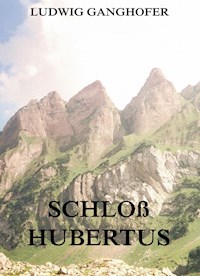2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Klassiker des historischen Heimatromans – überarbeitet und ins heutige Deutsch übertragen von Ludwig Ganghofers Enkel Stefan Murr. Deutschland, 17. Jahrhundert, eine bayerische Idylle: Ein grausiger Fund im Salzbergwerk lässt den Dorfbewohnern den Atem stocken. Was hat es mit dem behaarten Urmenschen auf sich? Die abergläubische Bevölkerung hat Angst, dass ein Fluch auf dem Dorf lastet. Schnell gehen Gerüchte um, dass der „Mann im Salz“ der Teufel ist. Und obwohl der Wahn der Hexenverfolgungen längst gebrochen schien, flackert der religiöse Fanatismus nun wieder auf, die Bewohner suchen nach einem Schuldigen. Schon bald gerät die aparte Madda unter Verdacht, eine Hexe zu sein. Ihr bleibt nur die Flucht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ludwig Ganghofer
Der Mann im Salz
Heimatroman
Meinem FreundeVincenz Chiavacci
1
Die Leute, die zu Grödig vor den Häusern standen, sahen ihm verwundert nach. Ein junger Bursch, hoch gewachsen und schlank, an allen Gliedern von Gesundheit strotzend, mit Schultern, die gemacht schienen, um auch das Schwerste leicht zu tragen, aber dazu ein Gesicht, erschöpft und bleich, wie das Gesicht eines Kranken, der in den Fantasien seiner Todesfurcht die offene Grube sieht. Und Schritte machte er wie ein Flüchtling, hinter dem der Blutbann her ist. Solange sie ihn sahen, blickten ihm die Leute nach, schüttelten die Köpfe und schauten über die nach Salzburg führende Straße hinaus, von wo er gekommen war.
„Mensch“, sagte ein alter Bauer über die Gartenplanke zu seinem Nachbarn, „der hat entweder ein böses Stück getan oder will eins tun.“
„Kann auch der Beste sein“, meinte der andere, ein Schmied in rußigem Schurzfell, hager und gebeugt, mit tiefliegenden Augen in einem verbitterten Gesicht. „Heutigentags muss oft einer rennen, auf den unser Herrgott herunterschaut mit guten Augen.“
Der alte Bauer machte scheue Augen und setzte das Gespräch nicht fort. Er lehnte sich über den Zaun und sah dem jungen Menschen wieder nach. „Der muss ein Jäger sein.“
Das war am Weidgehenk und an der grünen Tracht nicht schwer zu erkennen. Und auf der Kappe saß die Weihenfeder, die nur der weidgerechte Jäger tragen durfte, der über das Meisterstück seiner Zunft hinaus war. Wie gut das aussah, dieser junge, schlanke Körper in den wehenden Pluderhosen und in dem kurzen, schmiegsamen Spenzer, über den sich der weiße Leinenkragen breit herauslegte.
Vor dem letzten Haus des Dorfes stand eine Dirn beim Brunnen und wusch. Die sah den Jäger kommen. Sie schien ein leicht entzündliches Herz zu haben. Am Glanz ihrer Augen war es zu sehen, wie gut ihr der Fremde gefiel. Sie trocknete die Hände an der Schürze und ordnete ihr Haar, als wäre sie überzeugt, dass diese Begegnung ohne lustigen Plausch nicht abgehen würde. Aber der Jäger wollte vorüber. Und da sah das Mädel erst, wie bleich sein Gesicht war. Ihr Wohlgefallen schlug in Barmherzigkeit um. „Jesu mein.“ Sie rannte auf die Straße hinaus und fasste den Jäger am Arm. „Bub, was ist denn mit dir? Bist du krank?“
Wie einer, der nicht weiß, was mit ihm geschieht, sah er das Mädel an. Weil er in seiner Verlorenheit so stumm blieb, rüttelte sie seinen Arm. „So red doch, Bub, bist krank?“
Der Jäger schüttelte den Kopf. Doch er atmete auf, als hätte ihm der Klang dieser Stimme wohlgetan. Stumm befreite er seinen Arm.
Das Mädel, ein wenig eingeschüchtert, sagte zu ihm: „So red doch ein Wort. Bist nur müd, so komm und lass dir Zehrung geben. Ist niemand im Haus als die Mutter und ich.“ Wieder schüttelte er den Kopf. Aber die Verstörtheit, die in seinen Augen flackerte, schien sich zu lösen. „Vergelt’s Gott“, sagte er freundlich. „Bist eine gute Dirn, du.“ Dabei hatte er dem Mädel die Hand gereicht. „Dich soll der Himmel schützen.“ Schwer atmend wandte er das Gesicht und blickte über die Straße zurück, hinaus gegen Salzburg.
Es war ein schöner Frühlingstag mit einer Sonne, die aus der Mittagshöhe über den Untersberg herunter lachte auf das junge Grün der Wiesen und Felder. Am blauen Himmel nicht ein einziges Wölklein. Und dennoch lag es da draußen über den Dächern von Salzburg und über den Zinnen der Bischofsfeste wie Dunst. Keine Wolke, das war anzusehen, als wäre in der windstillen Luft der Rauch einer großen Brandstatt über den Dächern hängen geblieben. Dem Jäger lief ein Schauder über den Nacken.
„Bub“, wiederholte das Mädel. „Was ist denn mit dir?“
Wie von Ekel gewürgt, befreite er seine Hand, hatte kein Wort mehr, keinen Gruß und schritt auf der Straße davon, den Bergen zu.
Als er den Wald erreichte, blieb er stehen und wandte sich um. Er sah über der Stadt da draußen wieder dieses Dunkle und schlug die Hände vor die Augen, lief von der Straße in den Schatten des Waldes, warf sich zu Boden und drückte das Gesicht ins Moos. Aber die Bilder, die ihn verfolgten, ließen sich nicht verjagen. Sie blieben vor seinen Augen hängen, wie der Rauch da draußen über den Türmen. Er dachte an alles, was ihm lieb war, an seinem jungen Leben. Aber keine Freude, an die er sich erinnerte, verscheuchte ihm das Grauenvolle dieses Morgens. Noch immer sah er die quirlenden Wolken des schwarzen Rauches, die schürenden Freimannsknechte in ihren roten Wämsern, die lodernden Scheiterhaufen, und an den Pfählen die vier brennenden Menschen. Immer sah er dieses junge Mädchen in den Stricken hängen, sah wie das Hexenhemd und das rote Haar zu einer schnellen Flamme wurden und wie für einen Augenblick der nackte, schöne Leib erschien, bevor ihn das Feuer ganz umschleierte. Und immer sah er, wie der Kopf der alten Frau in die Luft flog, als die Pulvertasche explodierte, die man ihr aus Gnade zur Erleichterung des Feuertodes um den Hals gebunden hatte. Und immer sah er dieses Kind, ein siebenjähriges Mädchen, das in seiner Marter nur einen einzigen Schrei noch hatte: „Mutter, hilf mir“, und dann in Ohnmacht fiel und stumm verbrannte. Das Grausen wucherte durch alle seine Sinne und wie er sich hingeworfen hatte, so blieb er liegen, mit verhülltem Gesicht, wohl eine Stunde lang.
Ein feiner Duft war um ihn her, den verströmte der blühende Seidelbast. Und der grüne Moosgrund war bunt in Farben gesprenkelt von wilden Veilchen, blauen Glockenblumen, roten Steinnelken und gelben Aurikeln. Ein goldenes Leuchten war in allen Dingen. Auch aller Schatten hatte noch Glanz und Wärme. Mit sanfter Murmelstimme floss ein kleiner Bach in der Nähe vorüber, und manchmal wusste man nicht, ob das die kleinen Wellen waren, die so fein und heimlich schwatzten, oder die Zwitscherstimmen der vielen Meisen, die in erregter Hast um alle Bäume huschten. Wie alles miteinander blühte, wie alles zusammenklang und in einander leuchtete, war es ein wundersames Lied.
Der Jäger hatte sich aufgerichtet und saß an einen Baum gelehnt, die Arme um das Knie geschlungen. Er lauschte dem zwitschernden Spiel der Meisen, deren winziges Leben nichts anderes zu kennen schien, als das Glück der Freiheit.
Endlich sprang er auf und ging auf den Wildbach zu. Lange stand er und blickte hinein in dieses reine Gleißen und Glitzern. Er trank aus der hohlen Hand, ließ sich auf die Knie nieder und wusch das Gesicht und das verstaubte Haar. Dann schüttelte er sich, dass von den feuchten Strähnen die blitzenden Tropfen flogen.
Mit der Kappe in der Hand ging er schräg durch den Wald hinaus. Als er die Straße erreichte, blickte er sich um, atmete auf wie ein Erlöster, denn die grüne Mauer des Waldes sperrte ihm die Sicht in das ebene Land. Er wandte sich und spähte über den Weg voraus, der sich am Ufer der rauschenden Ache hineinzog in die Berge. Der Weg, der da vor seinen Füßen lag, war der Weg in das neue Leben, das er suchen kam. Der Weg war schön, wie wird das Leben sein, zu dem er führt?
Immer nach vorn schauend in die Ferne, wanderte der Jäger durch das Tal. Zur Linken hatte er die Ache und waldige Hügel, zur Rechten die steilen Hänge des Untersberges, dessen steinerne Türme manchmal herunter grüßten über die Wälder.
Ein Zug von Salzkärrnern begegnete ihm, die unter Geschrei ihre Maultiere trieben und mit den plumpen, von weißen Blachen überspannten Karren auf der schrundigen Straße ein schweres Fahren hatten.
Nach einer Stunde kam der Jäger zur Grenze des Berchtesgadener Landes. Da war ein breiter Streif durch die Wälder gehauen, und hart an der Straße war das Wappen des Fürstprobstes zu Berchtesgaden auf einen überhängenden Stein gemalt. Mit frischen Farben hatte man das alte, halb erloschene Bild erneuert, und unter dem Schild standen zwei Jahreszahlen, eine, die schon ganz verwittert war, 1595, und die zweite in neuer Farbe, 1618. Neben den gekreuzten Schlüsseln, dem Wahrzeichen des gefürsteten Stiftes, zeigte das Wappen den bayrischen Löwen und das Rautenfeld. Ein Wittelsbacher, Herzog Ferdinand, war Fürstprobst des Berchtesgadener Landes. Aber er residierte in Köln am Rhein, und hatte die ihm anvertraute Fürstprobstei noch niemals betreten. Aufmerksam betrachtete der Jäger den bunten Schild, es war das Wappen des Herrn, dem er dienen wollte.
Aber der Friede schien in diesem Herrenland nicht immer heimisch gewesen zu sein. Denn der Jäger kam zu den Trümmern eines Tores, das sich einst über die Straße gespannt hatte. Daneben sah man die Reste einer gebrochenen Mauer und die mit leeren Fenstern gähnende Ruine eines niedergebrannten Hauses. Nur der mächtige Turm war unversehrt noch übrig von der ‚Burghut am Hangenden Stein‘, die Wolf Dietrich, der Erzbischof von Salzburg, vor acht Jahren in Scherben geworfen hatte.
Vor der Tür der Wachtstube saßen zwei stutzerhaft gekleidete Musketiere rittlings auf einer Holzbank in der Sonne beim Kartenspiel. „Hex“, schrie der eine und schlug die Schellensau auf die Bank.
„Und Teufel“, lachte der andere, der mit dem Schellenober stach. Als er den eingestrichenen Gewinn in dem flatternden Wust von buntem Tuch verschwinden ließ, aus dem seine Hose bestand, gewahrte er den Fremden, der über die Straße daherkam.
„Der ist von auswärts“, sagte der Musketier zu seinem Kameraden, nahm das Feuerrohr mit der glimmenden Lunte von der Mauer und lief auf die Straße hinunter.
„Woher des Land’s? Und wohin?“
„Von Schloss Buchberg komm ich und will nach Berchtesgaden ins Stift.“
„Was suchst du im Stift?“
„Das sag ich schon, wenn ich dort bin.“
Dieses Wort hatte den Musketier an der Galle gekitzelt. Aber die Vorsicht war stärker in ihm als der Zorn. Erst musterte er den Fremden mit einem wägenden Blick, dann legte er, wie zu friedlicher Gesinnung beredet, die Muskete quer über den Arm. „Ihr müsst einen Pass weisen.“
Der Jäger griff in den Spenzer und reichte dem Musketier ein Blatt, das er aus einem ledernen Täschlein nahm.
Der andere las.
Das war Arbeit für ihn, die langsam vorwärts ging. Er nickte. „Der Pass weiset, dass ihr römisch seid. Aber ich muss euch proben, das ist Fürschrift. Ein Evangelischer geht bei uns nicht ein ins Land. Schlaget das Kreuz.“
Eine Furche grub sich zwischen die Brauen des Fremden, doch er bekreuzte das Gesicht und die Brust.
„Passiert“, sagte der Musketier und gab das Blatt zurück. „Freilich, mancher reißt ein Kreuz um das andere her, und doch lügt er.“
Dem Jäger fuhr das Blut ins Gesicht und seine Augen blitzten. „Willst du sagen, dass ich lüg?“
„Ich hab nicht von euch geredet. Mancher hab ich gesagt, ganz deutlich, eurem Kreuz muss ich glauben.“
Es hatte dem Jäger in den Fäusten gezuckt. Aber dann zog er ruhig die Kappe übers Haar und schritt die Straße hinaus, der Ortschaft entgegen, deren Kirchturm und Dächer über einen grünen Hügel herauslugten. Als er eine Brücke erreichte, auf der sich die Straße über das Bett der rauschenden Ache schwang, vernahm er lauten Stimmenlärm, das Rollen von Baumblöcken und hallende Beilschläge. Da arbeiteten an die zwanzig Leute, um einen Bergrutsch einzudämmen, dessen Geröll den Lauf des Baches zu verschütten drohte. Neben der Brücke stand ein alter Mann, der die Arbeiten überwachte, und den Leuten Befehle zurief. Er war in schwarzes Tuch gekleidet, mit hohen Stiefeln und auf der schwarzen schirmlosen Kappe trug er eine weiße Feder. Ein struppiger Bart hing um das Gesicht, und sein Rücken war gekrümmt wie unter schwerer Last. Als er den Gruß des Fremden hörte, sah er sich gleichgültig um. Aber dann erschrak er und seine Augen starrten, als käme ein Gespenst auf ihn zu.
Der Jäger sah verwundert drein. „Was ist an mir, dass ihr so erschrecken müsst?“
„Bub“, stammelte der Alte. „Wer bist?“
„Ein Jäger. Ich komm von weit her und will zu Berchtesgaden einen Dienst suchen. Der Ort da drüben, ist das schon Berchtesgaden?“
Längere Zeit schwieg der alte Mann. Dann sagte er: „Dich wird der Wildmeister nimmer auslassen. Einen Buben, wie du einer bist, so hat er keinen in seiner ganzen Jägerei. Aber das wird für mich ein hartes Stück werden, dich allweil sehen müssen.“ Er nahm die Kappe herunter und strich mit der Hand über das graue Haar. „Jetzt soll mir unser Herrgott sagen, wie das sein kann, ein Gesicht, das zweimal auf die Welt kommt. Hätt ich meinen Buben nicht selber hinuntergelegt, und tät ich nicht wissen, dass er acht Jahr schon unter dem Wasen liegt … ich tät drauf schwören, du wärst mein Bub.“
Der Jäger fand keine Antwort. Doch er streckte dem Alten die Hand hin. Der nahm sie, scheu und zögernd. Aber dann hielt er sie fest und sah dem Fremden in die Augen. Und nach einer Weile sagte er: „Das da drüben, das ist Schellenberg. Bis auf Berchtesgaden streckt sich der Weg noch gute zwei Stunden. Und des Wildmeisters Haus, das steht im alten Hirschgraben, gleich unterhalb vom Stift. Aber sag mir, Bub, wie heißt du?“
„Adelwart.“
„Der meinig hat David geheißen. Und ist schon Häuer gewesen mit zwanzig Jahr. Und du bist Jäger? Da hast ein Leben in Licht und Sonn. Mein Leben ist halb in der Nacht. Wir zwei, mein’ ich, laufen nicht oft aneinander hin. Aber wenn sich’s gibt, Bub, dass ich dir einmal helfen kann, komm nur zu mir. Ich bin der Jonathan Köppel, der Hällingmeister zu Berchtesgaden.“
Weil ihn die Arbeitsleute riefen, ging der Alte zur Ache hinunter. Aber alle paar Schritte sah er sich nach dem Buben um.
Noch lange blieb Adelwart auf der Brücke stehen, in einem Widerspiel von Gedanken. Aus den Worten des alten Mannes war ihm etwas ins Herz geklungen, das ihn erschütterte, aber dabei empfand er Freude, dass er an der Schwelle seines neuen Lebens einen Menschen gefunden hatte, der ihm Freund wurde. Er rief, bevor er die Brücke verließ, dem Meister noch einen Gruß hinunter. Versunken in Gedanken ging er der Straße nach. Er erschrak, als er aufblickte und den schwarzen Rauch sah, der bei der Kirche heraufstieg über die Dächer. Das Grausen dieses Morgens stand ihm wieder vor Augen. Und mit beklommener Stimme rief er einem Knaben an, der neben der Straße in der Wiese saß und aus den Stielen der Schlüsselblumen eine Kette flocht.
„Kind, was raucht denn da?“
Das Bübchen sah zu dem Dorf hinüber. „Die Pfannhauser Öfen.“
„Gott sei Lob und Dank.“
Adelwart wanderte dem Dorf entgegen. Doch immer sah er die Blumen der Wiese an, um diesen Rauch nicht sehen zu müssen. Der wurde dünner und dünner, als er ganz verschwunden war, blieb über dem steilen Schindeldach des Salinenhauses nur das feine weiße Qualmen des Wasserdampfs, der aus den Salzpfannen stieg und durch das Dach hinausquoll in die Sonne.
Wo die Schellenberger Gasse begann, stand neben der Straße ein zerstörtes Haus, schon ganz verwittert in seinen Trümmern. Über der leeren Türhöhle trug die Mauer das aus Stein gemeißelte Salzburger Wappen, von Beilhieben zerhackt und halb zersplittert. Spielende Kinder tollten mit Geschrei und Lachen in den kahlen Räumen umher, und auf den roten Marmorstufen der Hausschwelle waren sich zwei Buben in die Haare geraten. Die rauften wie junge Bären. Die Frühlingssonne lachte auf die balgenden Buben herunter, vergoldete die Trümmer des zerstörten Hauses und spiegelte sich in den Pfützen, die sich wie eine Kette großer Silberplatten durch die Gasse hinzogen. Enten und Hühner pluderten sich im Sand, und zwitschernde Schwalben jagten um die Firste. Nur selten erhob sich ein steinernes Haus zwischen den armseligen Holzhütten, die sich wie in Angst vor bösen Zeiten eng aneinander schmiegten. Hier und dort im Schatten der vorspringenden Schindeldächer sah man Frauen vor dem Spinnrad sitzen, die geschlossenen Hauben übers Haar gebunden, mit weißen Krausen um den Hals. So dürftig ihr Leben auch war, die Mode, die sie an den Salzburger Frauen sahen, machten die Schellenbergerinnen immer mit. Kein Mann in der langen Gasse. Die Männer waren alle bei der Arbeit, im Pfannhaus, im Bergwerk, auf den Feldern, oder im Leuthaus beim Trunk. Um einen Brunnen standen schwatzende Mädchen bei ihren Eimern und Wasserzubern. Sie stießen sich mit den Ellbogen an, als sie den Jäger kommen sahen, und kicherten hinter ihm her.
Auf dem Platz vor dem Leuthaus stand ein Dutzend rastender Salzkarren, deren Gäulen und Maultieren die Futtersäcke umgebunden waren. Zwei wohlgenährte Schimmel, die aus einem Barren gefuttert hatten und jetzt von einem Knecht getränkt wurden, standen an der Deichsel einer kleinen Kutsche.
„Hans, können wir fahren?“, klang von der Tür des Leuthauses eine helle Mädchenstimme.
„Ein paar Vaterunser lang wird’s allweil noch dauern, Jungfer“, gab der Kutscher zur Antwort, der die beiden Schimmel tränkte, „ich muss zum Schmied, der Handgaul hat ein Eisen locker.“
„Aber eil dich, gelt. Wir müssen in Salzburg sein, so lang die Läden offen sind.“
Adelwart, der auf der Straße vorübergehen wollte, hatte beim Klang dieser Stimme aufgeblickt. Er machte einen raschen Schritt, um zwischen den Salzkarren eine Lücke auf die Tür zu finden, und sah ein junges, schlankes Mädchen in das Leuthaus treten, in dunkles Blau gekleidet, eine Mantilla um die Schultern, und über dem reichen schwarzen Haar ein hellgraues Hütchen mit flacher Krempe und weißem Federbusch. Zwei schwere Zöpfe, mit roten Schnüren durchflochten, hingen über der weißen Krause auf die Brust herunter, und ließen, als die Jungfer in die Türe trat, von ihrem Gesicht nur einen schmalen Streif der Wange sehen.
Ein liebes Ding muss das sein, dachte Adelwart und wollte seiner Wege gehen. Aber da rief ihn aus einem offenen Fenster der Leutgeb an: „Heh, Jäger, willst nicht zukehren? Grad zapfen wir an.“ Adelwart zögerte. Dann trat er in das Haus und in die Leutstube. Noch auf der Schwelle warf er einen raschen Blick über die Tische hin. Aber da saßen, mit Geschrei, nur die zechenden Salzkärrner hinter ihren Branntweinstutzen und Bierkannen, ein paar Salzknappen und Bauern dazwischen. Beim Ofen schwatzte ein invalider Spießknecht mit der Harfenistin, die unter wenig melodischem Getön die Saiten schnurren ließ. Als der Jäger in die Stube trat, dämpfte sich der Lärm ein wenig, und alle guckten nach ihm. Dann fing das Geschrei wieder an, die Fäuste trommelten und die Würfel rollten. Während der Leutgeb für den neuen Gast schon den Brotlaib und die Bierkanne brachte, setzte sich Adelwart an einen Tisch, an dem ein Bauer und ein Salzknappe in eine aufgeregte Debatte verflochten waren. Sie stritten mit so heißen Köpfen, als ginge es um den teuersten Besitz ihres Lebens. Was die beiden so in Feuer brachte, war eine Meinungsverschiedenheit über Gottes Güte.
„Dass unser Herrgott gut ist“, schrie der Knappe, „ist das wahr, oder nicht?“
„Wird wohl wahr sein.“ Der Bauer wetterte die Faust auf den Tisch. „Aber wenn ihn der Zorn halt packt, rebellt er auf.“
Der Leutgeb, als er vor den Jäger einen Holzteller mit einem dampfenden Stück Lammsbraten hinstellte, mahnte die heißblütigen Gottesstreiter zur Ruhe. Aber das half nicht viel.
„Meinst, unser Herrgott ist so wie du bist?“, kreischte der Knappe.
„Unser Herrgott fabelt nicht und bleibt bei der Stang. Ist er einmal gut, so muss er’s allweil sein und gegen alle. Und Gerechte und Ungerechte müssen teilhaben an seiner Gütigkeit.“
„Ketzerei, Ketzerei“, brüllte der Bauer. „Wenn Gottes Güte überall wär in der Welt, was tät denn übrig bleiben für des Teufels Regiment? Und wo kämen denn die Flöh und Wanzen her, die Maden und Blindschleichen, die Hexen und Zauberleut?“ Da warf der Jäger die Gabel aus der Hand und stieß den Holzteller mit dem dampfenden Braten über den Tisch. Bei dem Wort des Bauern und bei dem Geruch des gebratenen Fleisches waren alle Bilder dieses Morgens mit so schmerzhaftem Grausen in ihm wieder wach geworden, dass er wie ein Wahnsinniger aufsprang und aus der Stube rannte. In der Tiefe des dämmerigen Hausflurs sah er das leuchtende Viereck einer offenen Gartentür, und draußen die reine Sonne, das lichte Grün. Das waren nur wenige Schritte, doch für das quälende Entsetzen, das ihn noch einmal erfüllte, war’s eine endlose Zeit. Immer diese tausendköpfige Menge vor seinen Augen, die Richter in schleppenden Talaren, diese rauschenden Wolken des Rauches, die lohenden Feuerstöße, die brennenden Menschen in ihrer Marter. Er hatte ein Gefühl, als stünde er so nahe am Feuer, dass ihm die Hitze das Haar und die Haut versengte. Und deutlicher als alles andere sah er hinter dem wogenden Flammenschleier dieses schöne, leichenblasse Greisengesicht des Chorherren, den sie als Teufelsbündler verbrannten, weil er drei gefangenen Lutheranern zur Flucht aus dem Hexenturm verholfen hatte. Immer sah der Jäger wieder im Gewirbel des Feuers diese blasse Stirn, diese ruhigen, trauervollen Augen, und hörte diese Stimme, die aus dem Rauschen der Flammen heraus das Wort des Heilands hinrief über die tausendköpfige Menge: „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“
Das alles wirbelte dem Jäger durch Herz und Sinne, als er hinauswankte ins Freie, ins Grün und in die Sonne. Ein kleiner Garten, umschlossen von einer Hecke grüner Haselnussstauden. Ein schmales Beet mit roten Aurikeln, die man Liebherzensschlüssel nannte. Und im Schatten eines blühenden Birnbaums, von dessen Zweigen im lauen Wind die weißen Blütenflocken wehten, saß jenes junge Mädchen mit ausgebreiteten Armen auf einer Bank. Den Hut hatte sie neben sich auf die Bank gelegt. Die schwarzen, rot durchflochtenen Zöpfe hingen ihr über die ruhig atmende Brust. In strenger, fremdartiger Schönheit hob sich der Kopf aus der weißen gefältelten Krause. Die Augen hatte sie geschlossen, doch sie schlief nicht, sie hatte nur die Lider zugetan und genoss mit Behagen dieses sanfte Spiel von Schatten und Sonne auf ihrem Gesicht. Gleich schwarzen Mondsicheln lagen die Wimpern auf den leicht gebräunten Wangen, und ihre Lippen waren halb geöffnet. In diese Umgebung, das Leuthaus mit seinen Hällingern und Salzkärrnern, Bauern und Handwerksleuten schien sie nicht zu passen. Der Jäger stand vor ihr. Was ihn trieb, das wusste er nicht. War es die Sehnsucht, nach allem Entsetzen und Grauen dieser verwichenen Minuten, das schöne, blühende Stück Leben zu umarmen? War es der bangende Gedanke, ein Weib bist auch du, auch dir kann drohen, was den anderen geschah? War es eine plötzlich erwachte Sehnsucht seines Herzens? Er wusste es nicht. Kein Besinnen war in ihm. Er umschlang sie mit beiden Armen, hob sie an seine Brust und küsste leidenschaftlich ihren Mund.
Das Mädchen wehrte sich in stammelndem Schreck. Mit kräftigen Fäusten stieß sie ihn zurück, und Zorn blitzte in ihren dunklen Augen. Dann warf sie die Zöpfe über die Schultern, nahm den Hut von der Bank und verließ den Garten. Adelwart stand mit bleichem Gesicht und griff an seine Stirn, als müsse er sich erst besinnen, was da geschehen war.
„Jungfer … ich bitt euch, Jungfer …“
Aus dem Haus, von der Leutstube her, hörte man einen wüsten Lärm. Allen Spektakel übertönte eine schrillende Stimme: „Ein Ketzer, ein verkappter Luthrischer ist er. Von Gottes Gütigkeit, sagt er … von Gottes Gütigkeit …“
Der Jäger hörte das gar nicht. Er sprang in den Flur und seine Augen suchten. Da gab es in der Leutstube ein wildes Rumoren. „Jesus Maria.“ Mit langen Sprüngen jagte einer im Bauernkittel auf den Platz hinaus, ein paar Salzkärrner und Knappen hinter ihm her, und der ganze Flur füllte sich mit drängenden, schreienden Leuten. Als sich Adelwart einen Weg schaffen wollte, fiel sein Blick in die Stube. Da lag der Knappe auf dem Lehmboden, die Stirn von Blut besudelt, und neben ihm lag eine zinnerne Bierkanne, die aus der Form geraten war. Ein alter Bauer, der seinen Kopf durch die Tür streckte, murmelte vor sich hin: „Allweil sag ich’s, allweil, das ganze deutsche Reich wird noch drüber in Scherben fallen, weil jeder von Gottes Gütigkeit ein anderes Meinen hat.“
Von dem Gedränge, das den Flur erfüllte, wurde Adelwart zur Haustür geschoben. Er stand schon draußen auf dem sonnigen Platz und sah weit drunten in der langen Gasse die Kutsche mit den beiden Schimmeln um eine Ecke biegen. Da fühlte er an seinem Spenzer einen derben Griff. Und der Leutgeb sagte zu ihm: „Jäger, das Zahlen hast aber vergessen.“
Adelwart holte ein Silberstück aus dem Geldbeutel und warf es dem Leutgeb hin. Als er hinunterging zur Berchtesgadener Straße, klang aus dem Lärm, der in der Leutstub war, ein wirres Saitengeklirr heraus. Dort hatte einer das Instrument der Harfenistin umgeworfen.
2
In dem Jäger brannte eine Ungeduld nach seinem Ziel. Er sah nicht mehr nach vorn in die Ferne, in der sich ein weites Tal zu öffnen begann, nur immer nach der nächsten Biegung der Straße spähte er, ob ihm der zurückweichende Wald nicht die Mauern und Türme des Stiftes zeigen möchte.
Wie viele hundert Stunden seit seinen Kinderjahren hatte er vom Mauerkranz des Buchberger Schlosses aus hinausgespäht über das dunkle Meer der Wälder, oft hatte er im ersten Grau des Morgens, oder in der Abenddämmerung die fernen Berge zu erspähen versucht, immer die Sehnsucht im Herzen, dort, wo die Welt so blau ist, dort möcht ich einmal leben. Und vor drei Jahren, als sein Herr den Söllmann gekauft hatte, einen roten Schweißhund, der aus dem Zwinger des Berchtesgadener Stiftes kam, hatte Adelwart mit dem Klosterknecht, der den Hund gebracht hatte, die ganze Nacht beisammen gesessen und hatte sich unermüdlich von ihm erzählen lassen. Wie hoch man zu Berchtesgaden das Weidwerk hielte, wie schön das Land wäre, und wie froh seine Menschen. Das hatte er wieder den anderen im Schloss erzählt, und so oft er das erzählte, wurde das blaue Land da draußen noch schöner um ein Stück. So gerne, mit solcher Liebe und solchem Feuer sprach er davon, dass ihn die Schlossleute in Scherz und Spott nur noch den Berchtesgadener nannten.
Vor drei Tagen, als der Freiherr zu Buchberg hinter der Kutsche, in der seine Frau und seine Kinder saßen, mit bleichem Gesicht zum Schlosshof hinausgeritten war, um für sich und die seinen irgendwo in evangelischem Land eine neue Heimat zu suchen, da hatte Adelwart mit der Faust die Augen getrocknet, und auf die Frage des Salzburger Vogtes den Kopf geschüttelt. „Nein, unter der neuen Farb, da mag ich nit dienen. Mein Herr ist fort, jetzt bin ich ein freier Mensch und geh nach Berchtesgaden.“
Noch in der gleichen Stunde hatte er sein bisschen Hab und Gut gepackt, hatte den kleinen Koffer über den Schlossberg hinuntergezogen, hatte ein letztes Mal das namenlose Grab seiner Eltern besucht, und war mit den dreißig Pfunden seines Reichtums auf einen Salzkarren gestiegen, der von der Donau heimkehrte in die Berge.
Eine Nacht und einen endlosen Tag hatte die träge Fahrt gedauert. Und als er Salzburg am Abend erreichte, was war das für ein Schauen und Staunen. Er hatte noch nie eine Stadt gesehen, konnte gar nicht glauben, dass es so viel Häuser, so viele Menschen gibt. Schwindlig vom Lärm und Schauen war er in den Straßen umher gelaufen, bis das Gebimmel der Bürgerglocke und das Trommelgerassel der Ronde die Leute in ihre Stuben trieb und die dunklen Gassen still machte. Weil Adelwart seine Herberge nicht gleich gefunden hatte, hatte er spüren müssen, aus wie hartem Holz zu Salzburg die Spießschäfte geschnitten wurden. Derbe Püffe waren seine Wegweiser zum ‚Goldenen Stern‘. Das hatte er mit Lachen übertaucht. Und die Nacht in der Herberge wurde für ihn zwischen Wachen und Schlummer zu einem einzigen kindhaft schönen Traum von dem blauen Land des Glücks.
Und da stand nun die Erfüllung vor ihm, groß und herrlich, schöner als sie in seinen Träumen gelebt hatte. Aber es war kein froher Blick, den er, als die Wälder zurücktraten, hinausgleiten ließ in die Schönheit dieses weiten Tales. Schwül atmend blieb er stehen, die Beine brennend vom schnellen Marsch. Er schien den Widerspruch zwischen dieser Stunde und all seinen Träumen der vergangenen Jahre zu fühlen. Er presste den Arm über die Augen. „Wär ich nur da nicht hinausgegangen … hätt ich nur das nicht sehen müssen …“ Aber der lärmende Menschenhaufe, der am frühen Morgen vor dem ‚Goldenen Stern‘ mit Geschrei durch die Gasse gezogen war, hatte ihn mit hinausgerissen zur Nonntaler Wiese. Das Wort, das er immer wieder hörte, ‚Hexenbrand‘, hatte ihn neugierig gemacht. Davon hatten seit seiner Kindheit im Buchberger Schloss alle Mägde getuschelt. Aber nie im Leben war ihm eine Hexe begegnet. Auch hatte die Buchberger Herrschaft darauf gehalten, dass die Greuel der um sich greifenden Hexenjagden von dem jugendlichen Personal ferngehalten wurden und in dem Seelen- und Gemütsleben der jungen Menschen keine Verheerungen anrichten konnten. Drum hatte Adelwart auch immer bei dem Getuschel der Mägde ungläubig den Kopf geschüttelt. Aber nun sollte er das einmal mit eigenen Augen sehen, wie Hexen ausschauen, und wie sie beim Hexenbrand um das Feuer tanzen. Aber ganz anders war das alles gekommen.
Lange stand er auf der Straße, den Arm über die Augen gedrückt, und zwischen den Wolken des schwarzen Rauches, zwischen den rauschenden Flammen sah er immer zwei große, dunkle Mädchenaugen, die in Zorn und Empörung blitzten.
„Hätt ich nur das nicht getan, das wird ein Elend für mich.“
Wie war es denn aber nur geschehen? Er sann und grübelte. Er fand in seiner wachsenden Unruhe keine Antwort. Wie ein Blitz herunterfährt, so war das über ihn gekommen. Das war wie eine dunkle Gewalt, wie ein machtvoller Zauber.
Eine abergläubische Regung zuckte in ihm auf. Aber da schlug er im Zorn über diesen Gedanken mit der Faust vor sich hin in die Luft, und atmete auf und lächelte. Was so schön ist, muss das nicht etwas Heiliges sein? Woher sollte das kommen, wenn nicht aus des Herrgotts Hand? Und wenn des Herrgotts schöne Schöpfung nach einem jungen Herzen greift, ist das nicht ein Zauber? Einer, der heilig ist und den der Herrgott will?
Und die Kutsche, die in der Schellenberger Gasse verschwunden war? Diese Kutsche musste von Berchtesgaden gekommen sein, das musste ihre Heimat sein. Mit hastigem Schritt folgte er jetzt der Straße. Die machte eine Biegung um den Wald herum, und da hörte Adelwart ein grimmiges Schelten und Fluchen. Von einer Felswand sickerte eine Quelle in blitzenden Fäden herunter. Aber das Wasser hatte die Straße auf eine weite Strecke in Morast verwandelt. Und da steckte ein Salzkarren festgefahren bis an die Naben seiner Räder. Der Kärrner peitschte unter Fluchen auf die Maultiere los. Aber die abgerackerten Heiter standen im Schlamm und wollten nicht mehr ziehen.
„Heh, Fuhrmann“, rief der Jäger. „So schlag doch nicht auf die Tiere los. Lass gut sein, ich will dir helfen.“
Der Zorn des Kärrners war rasch beschwichtigt. „Ja, Bub, da tät ich dir ein Vergeltsgott wissen.“
„Die Blache musst auftun. Ich mach mich fertig derweil. Wir müssen den Karren ein bissel leichtern.“
Während sich Adelwart am Ufer der Ache auf einen Stein setzte und die Schuhe und Strümpfe herunterzog, stieg der Fuhrmann auf den Karren und schlug die weiße Blache über die Reifen zurück. Es war ein magerer Kerl, schon über die fünfzig, mit borstigem Haar und einem rötlichen Bart, der wie ein kleines Schurzfell ein verwittertes Gesicht verdeckte. Adelwart watete mit den nackten Beinen in den Schlamm und gemeinsam hoben sie ein halbes Dutzend Salzsäcke vom Karren und trugen sie auf trockenen Boden. „So, jetzt nimm den Leitstrang“, sagte der Jäger und warf auch noch den Spenzer ab. „Ich tauch am Wagen an, und wenn ich ‚Hopp‘ schrei, lass die Heiter ziehen.“ Er stieg in den Sumpf und legte sich mit der Schulter gegen das Gestäng des Karrens.
„Hopp!“
Der Fuhrmann schrie mit hoher Fistelstimme sein ‚Hjubba‘ und ließ die Peitsche niedersausen. Schnaubend zogen die Tiere an und der Jäger schob am Karren, dass ihm die Stirn blau wurde. Erst machten die Räder in dem zähen Schlamm nur einen trägen Ruck, dann fingen sie im Sumpf zu rollen an und rollten hinaus auf die trockene Straße.
„Vergelt’s Gott, Bub.“ Der Kärrner lehnte die Peitsche an einen Baum. „Du musst Eisen in den Knochen haben.“
Adelwart lachte. „Wenn’s sein muss, bring ich schon ein paar Bröckel fürwärts.“ Er sah an sich hinunter. „Gut schau ich aus, aber komm, lass aufladen.“ Als sie den ersten Sack auf den Karren hoben, fragte Adelwart: „Bist du in Berchtesgaden daheim?“
„Nein, Bub, ich bin ein Passauer.“ Der Kärrner begann zu erzählen, dass er einen Kramladen hätte, ein braves, fleißiges Weib und sieben Kinder. Und zweimal des Jahres, im Maien und im Herbst, da kommt er mit seinem Karren den weiten Weg gefahren, um die vierzig Mezen Salz für seinen Laden zu holen. Und von dem Spielzeug, das sie zu Berchtesgaden schnitzen, bringt er jedes Jahr ein Kistlein voll mit heim für seine lieben kleinen Töchter.
„Da wirst dich in Berchtesgaden nit viel auskennen?“
„Weg und Steg kenn ich wie meinen Jankersack. Jedsmal bleib ich drei Tag. Da guckt man sich allweil ein bissel um.“
Sie hoben den letzten Sack auf den Karren. Das war keine harte Müh, und dennoch brannte dem Jäger das Gesicht.
„Hast in Berchtesgaden nie eine Jungfer gesehen, schön wie ein Herrgottstag? Und Augen hat sie wie dunkle Brunnen, und ihre schwarzen Zöpf hat sie rot gebändert.“
Der Passauer schaute ihn an und schmunzelte. „Nein, Bub. Auf die Jungfern dreh ich mich nimmer um.“ Er stieg auf den Karren und schob die Blache über die Reifen. Plötzlich hob er den Kopf. „Halt du, voriges Jahr, ja Bub, da hab ich so eine gesehen. Der hab ich wirklich nachschauen müssen. Eine, so um die zwanzig Jahr, gelt? Anzuschauen wie eine italienische Prinzessin? Und an ihrem feinen Hals hat sie ein kleines rotes Mal, als wär ein Hanneskäferlein hingeflogen. Ist das die?“
„Das weiß ich nicht.“
Die Schnüre der Blache waren festgebunden und der Passauer sprang vom Wagen. „Also Bub, vergelt’s Gott halt.“
Der Jäger nickte und hob seinen Spenzer vom Straßenrand. „Und wer die Jungfer ist, Passauer … weißt das nicht?“
„Nein Bub.“
Da sah der Kärrner, dass an Adelwarts Schultern ein paar rote Tropfen durch das Hemd herausquollen.
„Meiner Seel’, Bub, du hast dich letz gemacht, um meinetwegen.“
Das hatte der Jäger gar nicht gemerkt. Er sah es erst jetzt und schob das Hemd zurück. Handbreit lief ein blauer Striemen über die Schulter und ein Stück Haut war abgeschürft. „Das tut nichts“, sagte Adelwart und haftelte den Kragen wieder zu. „Fahr nur. Und guten Heimweg.“ Er ging hinüber zur Ache, setzte sich ans Ufer, wusch den Schlamm von den Beinen und schlüpfte in die Strümpfe.
Da strich ihm der Kärrner mit der Hand über die wunde Schulter. „Ein Salbesblatt musst auflegen, da ist’s gleich wieder gut. Und vergelt’s Gott halt. Und führt uns der Weg wieder einmal überzwerch und ich kann dir was tun Bub, da brauchst es nur sagen.“
Adelwart band die Riemen seiner Schuhe. „Hjubba“, klang es hinter ihm. Ein Peitschenknall, dann zogen die Maultiere den rasselnden Karren davon.
Bei der Arbeit, die der Jäger für den Karren getan hatte, war ihm all das Quälende aus den Gedanken gefallen. Und als er einen Fußpfad am Ufer der Ache einschlug, sah er nur das Land, das ihn erwartete, und sah zwei große dunkle Mädchenaugen, in denen sich der blitzende Zorn zu freundlichem Blick verwandelt hatte.
„Eine, nach der man sich umschaut? Die muss es sein, die der Passauer gemeint hat. Sie ist in Berchtesgaden daheim, ich seh sie wieder.“
Bei allem Schauen merkte er nicht, dass sich der Fußpfad, den er eingeschlagen hatte, immer weiter von der Straße entfernte, auf schmalem Steg die Ache überquerte und im Tal durch die Wiesen ging, während die Straße drüben am Waldsaum zu steigen begann.
Und wie hübsch die Jungfer gekleidet war, nur hübsch, nicht reich. Sie musste eines Bürgers Kind sein. Wär sie aus eines Herren Haus, so hätte sie die Straußenfeder oder die Reihergranen auf dem Hut getragen. Und ob sie nicht gar eines Jägers Kind ist, schoss es ihm durch den Kopf, denn der Federstoß auf ihrem Hut, das waren die weißen Schäuflein eines Birkhahns. Käme nur ein Mensch, den er fragen könnte. Aber der Pfad, so weit er sich überschauen ließ, war leer. Überall sah er Leute gehen, droben auf der Straße, rechts und links in den Wiesen. Nur der Pfad war leer, und doch nicht ganz. In den Erlenbüschen am Ufer des Baches bewegte sich etwas Weißes. Dort saß einer mit der Angelgerte, in Hemdärmeln, mit einer buntgestreiften Hose, wie die Landsknechte sie getragen hatten, als der Jäger noch ein Kind war.
Wo der Fischer saß, bildete der Bach einen großen Kolk. Weiter draußen war das Wasser spiegelklar, am Ufer war es trüb, als hätte man den Grund mit einer Stange aufgerührt. Über einem langsamen Wirbel, den das Wasser bildete, schwamm die Schnur mit dem Federspließ, nach dem der Fischer guckte. Ein Mann, schon an die sechzig, klein und wohlgenährt, mit einem gut gepolsterten Bäuchlein, über dem der Hosenbund nicht mehr zusammenging. Die runden, wasserblauen Augen saßen in einem fetten, gutmütigen Gesicht mit Schlotterbacken. Ein grauer Schnauzer hing ihm über die Mundwinkel und aus dem breiten Doppelkinn stach der Knebelbart heraus. Ein Fischer von Beruf? Den macht sein Handwerk mager. Adelwart riet, ein Bäcker oder Müller. Die pflegen sich bei gutem Verdienst zu runden. Freilich eine Mühle war nirgends zu sehen. Auf einen Steinwurf von der Ache entfernt, zwischen Erlen, Weiden und blühenden Obstbäumen stand ein kleines aus Steinen gebautes Haus mit geweißten Mauern, bis über die Fensterhöhe von einer dichten Bretterplanke umzogen, an der auch die Fugen der Bretter wieder mit Brettern vernagelt waren.
Beim Rauschen der Ache und bei dem Eifer, mit dem der Fischer den Federspließ belauerte, überhörte er die Schritte des Jägers. Jetzt zog er die Schnur aus dem Wasser, so geschickt, dass ihm die Forelle, die gebissen hatte, gleich in den Schoß fiel. Und wie er den Fisch packte, mit dieser kleinen, weibisch gerundeten Hand! Das war ein seltsam sicherer Griff. Vergnügt, mit einem fetten Gemecker, rief er zum Haus hinüber: „Hulda, ich hab schon wieder einen.“ Dann riss er dem Fisch die Angel aus dem Schlund, mit so hurtigem Ruck, dass die ganze Zunge der Forelle am Haken hängen blieb.
„Aber Mensch“, sagte Adelwart geärgert, „das macht man nicht so. Man kann dem Fisch das Eisen doch sanft auslösen.“
Mit flinker Bewegung hob der Fischer das gutmütige Gesicht, sah den Jäger verwundert an, maß ihn vom Kopf bis zu den Füßen und schmunzelte, wie ein erfahrener Greis zur Weisheit eines Kindes lächelt. Vom Haus herüber kam mit hölzernem Kübel in der Hand ein Mädchen gelaufen, kaum über die zwanzig. Sie war barfüßig und trug nur ein kurzes schwarzes Röcklein über dem Hemd. In wirren Strähnen hingen ihr die schweren, rostbraunen Haare um das Gesicht, das nicht hässlich war, trotz dieser galligen Vergrämtheit und dieser hungernden Sehnsucht in den Augen. Erschrocken stand das Mädel, als es den Jäger gewahrte. Sie starrte ihn an, wie man ein Wunder anstarrt, und stammelte: „Vater …“
„Siehst du den Ferch nicht, da im Gras.“
Das Mädchen bückte sich nach dem Fisch, der nicht mehr zuckte, und legte ihn in den Kübel. Zögernd ging sie davon und drehte immer wieder das Gesicht.
Der Fischer hatte die Zunge der Forelle gleich wieder als Köder benützt und einen Wurm dazu gespießt. Den beköderten Haken tauchte er in einen kleinen, irdenen Napf, der ein weißliches Fett enthielt.
„Gelt, das ist Reiherschmalz?“, fragte Adelwart, der von den geheimen Künsten der Fischerei allerlei verstand.
„Reiherschmalz?“ Der Fischer guckte auf und lachte sein gutmütig vergnügtes Gemecker. „Reiherschmalz, freilich, das ist auch gut. Da beißen sie gern, aber dies da? Das ist noch viel was Besseres. Da schnappen sie wie närrisch.“ Er warf die Schnur ins Wasser. „Reiherschmalz!“ Wieder lachte er. „Da hast dich um ein paar Buchstäblein verredet.“ Lustig blinzelte er an dem Jäger hinauf. „Das hier ist Räuberschmalz.“
Da schnellte der Fischer schon wieder eine Forelle aus dem Wasser und rief über die Schulter: „Hulda!“
Schnell war das Mädchen zur Stelle, als hätte sie auf diesen Ruf schon gewartet. Jetzt trug sie ein geblumtes Mieder aus gelber Seide, hatte blau gezwickelte Strümpfe und niedliche Pantoffeln an den Füßen, und die Haare waren zurückgekämmt und in einen Knoten gebändigt. Ständig sah sie den Jäger an, und Flecke brannten ihr auf den Wangen. „Vater“, fragte sie, „soll ich gleich auf den nächsten warten?“
Aus dem Gesicht des Fischers schwand die lustige Gemütlichkeit. „Geh ins Haus“, sagte er grob. Aber kaum war das Mädel verschwunden, da lachte der Alte schon wieder sein behagliches Gemecker. Und während er die Angel frisch beköderte und den Köder in das Tiegelchen eintauchte, schwatzte er vergnügt vor sich hin: „Ja, da beißen sie wie närrisch. Und das da, das ist besonders gut, weil’s von einem Kirchenschänder ist. Den hab ich vor drei Wochen schinden müssen, weil er in der Ramsau die Monstranz gestohlen hat.“
Erbleichend stammelte der Jäger: „Mensch, wer bist denn du?“
„Und du bist ein Fremder, gelt? Sonst tätst den Jochel Zwanzigeissen kennen.“ Der Dicke warf die Schnur ins Wasser. Dann hob er lachend das runde, glänzende Gesicht. „Ich bin der Freimann von Berchtesgaden.“ Und erheitert über den Schreck, mit dem der Bub vor ihm zurückwich, fragte er: „Hast vielleicht ein schlechtes Gewissen, du?“
Durch alles Grausen, das den Jäger befallen hatte, zuckte ihm der Gedanke, wie man so fett werden und so lustig sein könne bei dieser Art von Handwerk. Und das Wirbeln der Bilder, die quälend wieder in ihm erwachten, zwang ihn zu der Frage: „Und du hast auch schon Hexen verbrannt?“
„Freilich, weit über die hundert schon. Und knusprige Weiblein sind dabei gewesen. Der Teufel hat einen feinen Geschmack.“ Schmunzelnd beobachtete der Dicke den auf dem Wasser tanzenden Federspließ. „Wie ich noch Gesell zu Bamberg und in Salzburg gewesen bin, da haben wir allweil fleißig brennen müssen. Aber seit ich zu Berchtesgaden bin, hab ich Feierabend.“ Das lustige Mekkern des Dicken hatte plötzlich einen ganz anderen Klang. „Meine Herren im Stift und unsere Patres Franziskaner denken so viel gut von der bäuerischen Menschheit. Die glauben allweil, es gäb im Berchtesgadner Land keine Hexen. Aber tät einer besser hinschau’n …“ Den Hals strekkend, schwieg er und guckte schärfer nach dem Federspließ, der auf glattem Wasser zu zittern anfing.
Mit jagenden Schritten eilte Adelwart davon. Und als ihm dichtes Erlengebüsch das Haus des Freimanns schon verdeckte, hörte er noch die lustige Stimme: „Hulda, ich hab schon wieder einen.“
Grauen rüttelte seinen Leib. Er rannte über die Wiesen und hielt erst inne, als er zu einem das Tal durchquerenden Sträßlein kam, auf dem er Fuhrwerke und Menschen gewahrte. Aufatmend drückte er die Fäuste auf die Brust. „Meinem Herrgott danke ich, dass ich den nicht gefragt hab um die Jungfer.“ Zögernd wandte er das Gesicht und sah draußen bei den Erlenbüschen die Freimannstochter stehen, in der Ferne so klein, dass ihr gelbes Mieder im Grün wie eine Blume aussah. Da musste er an die Fische denken, und sah wie die beiden bei der Schüssel hockten und aßen und der Ekel fuhr ihm in alle Knochen. Er sprang auf die Straße und wollte rennen. Doch wie angewurzelt stand er und alles Böse seiner Sinne war verwandelt in helle Freude. Weit offen lag das herrliche Tal mit allen Bergen vor ihm in der Sonne, überwölbt vom reinen Blau des wolkenlosen Himmels. Von den smaragdgrünen Wiesenhängen, die sich zur Rechten gegen die Wälder des Untersberges hoben, grüßte der mächtige Bau des Stiftes mit blinkenden Fenstern. Kleine Gärten mit blühenden Obstbäumen hingen zwischen Mauern auf dem steilen Gelände und auf der Höhe schob sich überall der Bergwald mit lichten Buchen und leuchtendem Felsgeschröf bis dicht an die Häuser heran. Den grünen Hügeln zu Füßen, am Ufer der blitzenden Ache, lag ein riesiges Gebäude, das Pfannhaus der Saline Frauenreut. Silberweißer Wasserdampf quoll über das hochgegiebelte Dach hinaus und verwehte mit zarten Schleiern in der Sonne. Überall im Tal, so weit man sehen konnte, lagen umzäunte Gehöfte einsam zwischen Wiesen und Wäldern. Hoch im Bergwald droben, auf kleinen Lichtungen, leuchteten noch die Dächer, und über dem Kranz der Almen, die zu grünen begannen, stiegen die Wände ins Blau, halb übergossen von Schnee und gleißend wie Silber.
Nur weil Adelwart unter Bäume kam, deren dichte Kronen ihm das Bild der Ferne verhüllten, fand er auch einen Blick für die Nähe. Da stand auf der einen Seite der Straße ein stattliches Gebäude, das neue Hällingeramt, auf der anderen Seite die Salzmühle, in der es rauschte, rasselte und pochte. Dunkel gähnte am Berghang das Tor eines Stollens. Auf hölzerner Rollbahn kamen die mit rötlichen Salzsteinen beladenen Hunde herausgefahren. Zuerst hörte man nur das dumpfe Rollen, ohne dass in dem finsteren Schacht etwas zu sehen war, dann plötzlich schoss der Wagen heraus in den Tag, und der Hundsmann, der ihn führte, mit dem rußenden Grubenlicht am Gürtel, blinzelte, weil ihn die Sonne blendete.
Als Adelwart die Straße weiter hinausschritt, schoss ihm das Blut in die Wangen. Er sah einen greisen Priester kommen, im weißen Habit der Augustiner, mit einer pelzverbrämten Kappe über dem grauen Haar, das ihm in schütteren Strähnen herunterhing bis auf die Schultern. Sie umrahmten ein feines, bleiches Gesicht mit dem Ausdruck tiefen Kummers und mit brütender Sorge in den Augen. Doch Adelwart las nicht die Sprache dieses Gesichts, er sah nur das Kleid und dachte, das ist von meinen Herren einer. Er zog mit einem Gruß die Kappe. „Herr, möget ihr mir aus Gütigkeit verlauben, dass ich eine Frage an euch tu?“
Der Priester hob das Gesicht. Adelwart fuhr fort: „Gelt, ihr seid von den Herren einer, aus dem Kloster da droben?“
Der Stiftsherr nickte.
„So habt die Güt und sagt mir, Herr, welchen Weg ich machen muss, dass ich mit dem gnädigen Herrn Fürsten zu reden komm?“
Ein Lächeln ging dem Stiftsherrn um die schmalen Lippen. „Das kann ich dir leider nicht sagen. wüsst ich da einen Weg, so würd ich ihn selber machen, noch heut.“
Er wollte weiter gehen, aber da sah er die Ratlosigkeit im Gesicht des Jägers. „Bist du fremd hier? Weißt du das nicht, dass Seine Liebden Herzog Ferdinand, unser Fürst, der Erzbischof zu Köln am Rhein ist. Seit wir ihn zum Fürsten wählten, hat er sein Land nicht gesehen. Seit zweiundzwanzig Jahren.“
„Jesus.“ Der Schreck war dem Jäger in die Glieder gefahren. „Was soll ich denn da jetzt tun?“
Schweigend betrachtete ihn der Stiftsherr, und in seinen Augen erwachte ein freundlicher Blick. Dann fragte er: „Was wolltest du denn beim Fürsten? Sag es mir.“
„Ach Herr …“ Dem Jäger sprudelte die ganze Geschichte seiner Träume aus dem Herzen. „Und da komm ich jetzt her von so weit. Und möcht eurem Fürsten dienen als Jäger. Und das darf ich sagen, Herr, ohne Hochmut, ich bin ein guter Jäger. Aber was tu ich denn jetzt? Wenn euer Fürst zu Köln hockt? Ich kann doch nicht durchs ganze deutsche Reich hinunterlaufen bis an den Rhein, und möcht doch bleiben, ums Leben gern.“ Mit einem wohlgefälligen Blick legte der Stiftsherr dem Jäger die Hand auf die Schulter. „Dazu brauchen wir den Fürsten nicht. Geh hinüber zum Wildmeister, da drüben am Stiftsberg, in dem Haus bei den Birnbäumen, da wohnt er. Wenn du ihm gefällst, und wenn er dich tüchtig findet in allem Weidwerk, dann wird sein Antrag, dich als Jäger zu dingen, auch bei mir ein williges Ohr finden.“ Er nickte lächelnd, verschränkte die Hände hinter dem Rücken und ging seiner Wege. Dem Jäger aber glühte die Freude im Gesicht. Und einen Knappen, der von der Saline kam, fasste er am Arm. „Du, ich bitt’ dich, sag mir, wer das ist, der gute Herr dort auf der Straß’?“
„Das ist der edel Herr von Sölln, unser Kanzler und Dekan im Stift.“
„Jesus, und dem hab ich gefallen? Da muss mir einer geholfen haben, der mehr weiß als wir.“
Der Knappe sah ihn an, als hätte er einen Narren vor sich, und schüttelte den Kopf, während er dem Jäger nachsah, der mit langen Schritten über die Straße hinauseilte, der Achenbrücke zu. Die Kappe unternehmungslustig zurückschiebend überquerte er die Brücke und näherte sich dem Haus des Wildmeisters.
Das lag am Fuß des Stiftsberges, in einer Wiesenmulde, die sich ansah wie ein aufgefüllter Wallgraben. Überall in der Nähe gewahrte man eingefallene oder halb abgetragene Festungsmauern, immer noch drohend in den zertrümmerten Resten. Um das Gehöft zog sich eine beschnittene Weißdornhecke, so hoch, dass man mit der Hand kaum hinaufreichte. Über der Hecke sah man nur die Kronen der blühenden Birnbäume und ein steinbeschwertes Schindeldach mit einem Hirschgeweih am First. Die Hecke war unterbrochen von einer klobigen Brettertür, aber sie war verschlossen. Als Adelwart an der Klinke rüttelte, erhob sich hinter der Hecke ein vielstimmiges kläffendes Hundegebell. Drinnen brachte ein gellender Pfiff die Hunde zum Schweigen und von innen wurde die Tür geöffnet. Vor Adelwart stand der Wildmeister Peter Sterzinger in grünen Bundhosen und im hirschledernen Wams, um den Hals einen breiten Leinenkragen, der ein weites Maß hatte. Böse Zungen konnten behaupten, dass der freie Atem des Wildmeisters durch einen linksseitigen Kropf beengt wäre. Aber für ein nachsichtiges Urteil war es nur jene Ausbuchtung der Halslinie, die der der Volksmund als ‚Wimmerl‘ bezeichnet. Über dem weit geschnittenen Leinenkragen saß ein kräftiger Kopf mit kurz geschorenem Haar. Kleine kluge Augen blitzten in dem braunen Gesicht, dessen Kinn und Wangen rasiert waren, während über dem Mund ein dicker Schnauzbart sein dunkles Dächlein sträubte.
Ein hurtiger Blick musterte den Jäger und mit einer strengen etwas kurzatmigen Stimme fragte der Wildmeister: „Wer bist? Was willst?“ Adelwart zog die Kappe. „Weidmannsgruß, Herr Wildmeister. Ein Jäger bin ich und tät gern dienen unter euch. Mit dem edlen Herrn von Sölln, den ich aus Zufall getroffen hab, hab ich schon geredet. Der tät mir ein willig Ohr geben, hat er gesagt, wenn ich euch gefall, und wenn ihr mich gerecht findet in aller Jägerei.“
Noch einmal musterte der Wildmeister die Gestalt des Jägers mit einem prüfenden Blick. Dann machte er eine merkwürdige Bewegung mit dem Kopf, wie ein Specht, der den Schnabel in eine Baumrinde schlägt. „Komm“, sagte er dann.
Adelwart trat hinter den Wildmeister ins Gehöft und bekreuzte sich. So weit hatte er den Peter Sterzinger bereits kennengelernt, um zu wittern, dass es ein scharfes Examen absetzen würde.
3
In dem sauber gepflegten Gemüsegarten, der das kleine einstöckige Haus des Wildmeisters umgab, waren alle Blumen des Frühlings in Blüte. Vor allen Fenstern hingen Blumengitter aus Weidengeflecht, und an den Rosenstöcken, mit denen sie besetzt waren, begann das Laub zu sprießen.
Ein Stall und eine Tenne waren unter gleichem Dach an das Haus angebaut, und im Hintergrund eines langen Wiesgartens sah man den großen Hundezwinger, hinter dessen Staketen an die dreißig Hunde umherliefen, gelbe Bracken und gefleckte Rüden.
Vor der Tenne saß ein Knecht in der Sonne und schor einem Schaf die Wolle herunter. Zwei hübsche Kinder standen dabei und sahen zu, ein vierjähriger Bub mit schwarzem Krauskopf, hemdärmelig, in kurzen Lederhöschen, und ein fünfjähriges Mädchen mit blondem Zopf, in einem lichtblauen Leinwandröcklein. Als die Kinder den Fremden sahen, kamen sie neugierig gelaufen. Der Vater drückte ihre Köpfe zärtlich an sich, aber dann sagte er: „Marsch weiter, ihr kleine War. Hier wird eine ernste Sach geredet.“ Zu dem Knecht rief er hinüber: „Heh, Schinagl, tu mir die Kinder hüten.“
„Miggele, Bimba!“ Der Knecht winkte mit der Schere. „Kommt her da, ich verzähl euch was Schönes.“
„Vater“, fragte das kleine Bürschlein, „ist das noch lang, bis auf morgen?“
„Nein, Miggele, das wird’s gleich haben. Am Abend, da schlafst ein bissel, und wenn du die Guckerln auftust, ist’s schon Morgen und die Maddalena ist wieder da.“
„In der Früh schon?“, sagte das Dirnlein.
„Wie bräver du bist, wie bälder kommt sie. Aber jetzt geht miteinander zum Schinagl.“ Die Kinder gehorchten und der Wildmeister ließ sich neben der Haustür auf die Steinbank nieder. „Also Bub, sitz her da. Und die erste Frag: Warum bist du fort von deinem Herrn?“
„Der ist fort von mir.“
„Wieso?“
„Evangelisch ist er, und war allweil ein guter, lustiger Herr. Aber vier Jahr kann’s her sein, da ist er einmal heimgekommen von seiner Fahrt zum Regensburger Reichstag, ganz verdrossen …“
Peter Sterzinger nickte. „Das ist selbigsmal gewesen, wie die luthrischen Unisten und die römischen Ligianer so schiech aneinander geraten sind.“
„Davon weiß ich nichts. Aber ich seh’s noch allweil, wie mein Herr zum Tor einreitet, sein Gesicht ist völlig ein anderes gewesen und noch im Stegreif hat er seiner Ehefrau zugeschrien: ‚Böse Zeiten, Weib, das Feuer geht auf, und Gut und Leben, Volk und Reich und alles ist in Gefahr.‘ Und selbigsmal zu Regensburg, da muss mein Herr mit dem Salzburger bös überzwerch geraten sein. Der hat ihm derzeit kein Stündl Ruh nimmer lassen, und hat ihm das Leben so hart und sauer gemacht, dass mein Herr verkaufen hat müssen. Und vor drei Tag, da ist er fort mit Weib und Kind hinauf ins Brandenburgische.“
Der Wildmeister schwieg dazu und drehte mit wenig freundlichem Blick das Gesicht über die Schulter, als könne er über die Berge hinausblicken nach Salzburg. Dann sagte er kurz und hart: „Du gefällst mir Bub. Aber wenn du deines Herren Glauben hast, so ist kein Bleiben für dich.“
„Ich bin römisch getauft und bin’s geblieben.“
Peter Sterzinger sah verwundert hoch. „Dein Herr hat nicht verlangt, dass sein Gesind zum gleichen Herrgott betet, wie er?“
„Der hat jeden glauben lassen, was einer mögen hat.“
Der Wildmeister machte mit dem Kopf die Bewegung des hämmernden Spechtes. Und das schien bei ihm ein Zeichen des Wohlgefallens und gebesserter Laune zu sein. „Wer ist denn dein Herr gewesen?“
„Der Edelherr von Buchberg.“
„Buchberg, Buchberg?“ Peter Sterzinger besann sich. „So hat doch einer geheißen, an den das Stift vor vierthalb Jahr den Söllmann verkauft hat?“
„Freilich, den Söllmann, Wildmeister, den hab ich wohl hundertmal am Riemen auf die Rotfährt angelegt. Herrgott, ist das ein Hund gewesen. So einen darf man suchen.“
Das begeisterte Lob auf den Hund ließ die beiden auf der Steinbank näher aneinanderrücken. Ein Stündlein ging mit all den Geschichten hin, die der Jäger von Söllmanns Wundertaten im Buchberger Forst zu erzählen hatte. Immer häufiger machte der Wildmeister den Specht, und schließlich klatschte er dem Jäger die Hand aufs Knie. „Jetzt sag mir aber, Bub, wie heißt du denn überhaupt?“
„Adelwart.“
„Wie noch?“
„Ich hab sonst keinen Namen.“
„Aber du musst doch auch nach deinem Vater heißen?“
Der Jäger schüttelte den Kopf und begann zu erzählen: Vor sechsundzwanzig Jahren hatten zu Buchenau, in dem kleinen Dorf, das mit seinen hundert Häusern dem Buchberger Schloss zu Füßen lag, die Bauern in einer Herbstnacht wildes Geschrei auf der Landstraße gehört, ein Dutzend Musketenschüsse, Waffengeklirr und den Hufschlag jagender Pferde. Niemand hätte sich aus dem Haus gewagt. Und im Grau des Morgens, als es lang schon wieder still geworden war, hätte man auf der Straße einen umgestürzten Blachenkarren gefunden. Erschossen lag der Fuhrmann unter dem Bauch eines toten Pferdes, und zwischen den Rädern ein erschlagener Mann, der wie ein Knecht gekleidet war, aber weiße Hände ohne Schwielen hatte. Unter der Blache des Karrens hätte man leises Wimmern gehört und in Magdkleidern eine junge Frau gefunden, die gesegneten Leibes war, mit einem Säbelhieb über das Gesicht. Sie hätte ein paar Worte in einer Sprache gehaucht, die keiner verstand. Die Bauern hätten die Frau zum Widum getragen und auf den Dielen der Pfarrstube habe sie sterbend einem Knaben das Leben gegeben. Einem Würmlein zum Erbarmen, kein Härchen auf dem Kopf, keinen Nagel an den winzigen Fingerchen.
„Und bist so ein starker Bub geworden.“
Adelwart nickte. Die drei toten Menschen hatte man bei der Friedhofsmauer zur Ruh gelegt. Der Pfarrer hatte nicht den Mut, sie christlich zu begraben, dazu hätte er wissen müssen, ob sie auch christlich getauft waren. In dem geplünderten Karren auf der Straße und in den Kleidern der Toten hatte man nicht das Geringste gefunden, was Aufschluss hätte geben können. Aber diese Härte wider die namenlosen Toten machte der Pfarrherr an dem lebenden Buben wett. Den behielt er im Widum, und seine Magd musste das Kind mit Geißmilch aufpäppeln. Und als der Bub heranwuchs, sollte ein Priester aus ihm werden.
„Mein guter Pfarrvater hat mir Lesen und Schreiben beigebracht und hat schon Lateinisch mit mir angefangen. Aber im Herbst einmal, mitten in einer Lektion, da ist er auf den Boden hingeschlagen und tot gewesen. Der junge Kaplan, der ihm nachgefolgt ist, der hat nichts wissen mögen von mir. So bin ich mit vierzehn Jahr im Buchberger Schloss als Trossbub eingestanden. Und weil mir allweil der Wald das Liebste gewesen ist, bin ich Jäger worden.“
„Und ein guter.“ Peter Sterzinger legte ihm die Hand auf die Schulter. „Das hab ich schon herausgehört, wie mir vom Söllmann erzählt hast. Aber dass ich vor meinem Herrn das Gewissen sauber halt, müssen wir die Prob aufs End bringen.“
Er ging ins Haus und brachte eine Armbrust und ein Luntengewehr mit Pulverhorn und Kugelbeutel. „Jetzt zeig, was du kannst.“
Adelwart griff zuerst nach der Armbrust.
„Brauchst eine Zwing?“
Der Jäger schüttelte den Kopf und spannte den Stahlbogen frei mit den Händen. „Gebt mir ein Ziel, Wildmeister.“ Er legte den Bolzen auf. Peter Sterzinger zupfte von den roten Aurikeln ein Blütchen ab und steckte die Blüte auf fünfzig Gänge in die Rinde eines Baumes. Wie ein winziger Blutstropfen sah das aus. „Meister, auf das Liebherzensschlüsselein schieß ich nicht gern.“
„Warum nicht? Das ist närrischer Aberglauben.“
Schweigend hob Adelwart die Wehr ans Gesicht, und man sah es ihm an, wie eiserner Wille alle Muskeln seines Körpers straffte. Die Sehne schnurrte, und ein Zischen ging durch die Luft.
„Brav, Bub.“
Um die Breite eines Messerrückens steckte der Bolz neben der roten Blüte. Adelwart schmunzelte, jetzt hatte er es allen beiden recht gemacht, seinem pochenden Herzen und dem Wildmeister. In Eifer legte er die Armbrust fort und griff nach dem Luntengewehr. Aufmerksam sah Peter Sterzinger zu, während der Jäger das Pulver, auf der Hand gemessen, in die Röhre schüttete, die Kugel aufsetzte, bis der Ladstock aus dem Lauf sprang, Feinkorn in die Pfanne gab und die angebrannte Lunte in der Hahnschnäppe befestigte.
Auf achtzig Gänge lag ein weißer Kiesel am Wiesenrain. Während Adelwart zielte, kräuselte sich vor seiner Stirn der Luntenrauch in die Höhe und drüben bei der Tenne hielten sich die Kinder die Ohren zu. Der Schuss krachte und der weiße Kiesel war verschwunden. Lachend machte Peter Sterzinger den Specht, und die Kinder schrien in hellem Vergnügen. Adelwart aber blickte verwundert in die Luft. Wie der Donner eines Ungewitters rollte das Echo des Schusses über die Berge hin, und als dieses Rollen schon erlöschen wollte, begann es wieder von neuem und verging mit leisem Hall in der Ferne.
Das hatte der Jäger noch nie gehört. Aufatmend stellte er den Kolben des Feuerrohrs zu Boden. Der Wildmeister war guter Laune. Doch er schenkte dem Jäger kein Quentlein der gewichtigen Probe. Als sie wieder auf der Hausbank saßen, wurde Frage um Frage die ganze Jahresarbeit des Weidwerks durchgegangen, die Fallenarbeit im Winter, das Legen der Wolfseisen und die Blendung der Bärengruben, das lustige Frühlingswerk auf den Urhahn und den Birkvogel, der Schnepfenfang mit dem Hochnetz und der Bau der Dohnenstiege, die Sommerpirsch auf den Rehbock und den edlen Hirsch, die Arbeit mit dem Leithund und den Saufindern, die Stelljagd mit Netzen und Tüchern, das Fanggeben mit dem Kurzeisen und der Feder, das Zerwirken des Wildes und das Pfneischen der Hunde, die Kurtoasey vor dem Jagdherrn und die Spruchweisheit des fährtengerechten Jägers.
Der Wildmeister war mehr als zufrieden. Er stand auf. „Jetzt muss ich sehen, wie du mit den Hunden reden kannst.“ Sie gingen durch die Wiese zum Zwinger hinaus, in dem die Hunde beim Anblick des Fremden ein so wildes Gekläff erhoben, dass man die Ache nicht mehr rauschen hörte. Adelwart griff nach dem Riegel der Zwingertüre.
„Bub, sei fürsichtig“, warnte Peter Sterzinger, „unter den Rüden sind ein paar wilde Beißer.“
Aber der Jäger hatte schon das Türchen geöffnet und schlüpfte in den Zwinger. Mit Geheul fuhr die ganze Meute auf ihn los. Die Arme breitend, unter leisen Locklauten, die einen singenden Klang hatten, beugte sich der Jäger zu den Hunden nieder. Die wurden plötzlich still, sahen den Buben mit funkelnden Augen an und begannen an seinen Händen und Beinen zu schnuppern. Mit den Rüden schwatzend wie mit Kindern, kraulte ihnen Adelwart die Ohren und streichelte ihnen das Fell. Draußen vor den Latten des Zwingers machte Peter Sterzinger den Specht.
Er kehrte zum Haus zurück. „Jetzt musst mir noch die Ruf blasen.“
Er holte ein Jagdhorn, setzte sich mit Adelwart auf die Bank und sagte die Reihe her, in der ihm der Bub die Jägerrufe blasen sollte: Den Tagruf, den Herrengruß, Aufbruch zur Jagd, das Treiben an, das Treiben aus, Hirsch tot und Sau tot, die Strecke und den Heimruf.