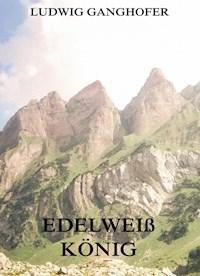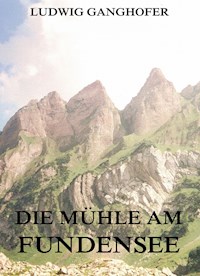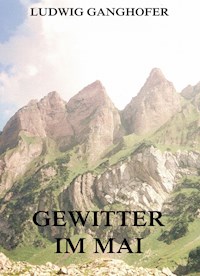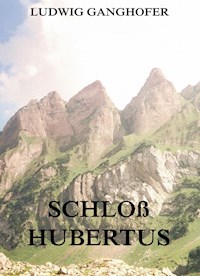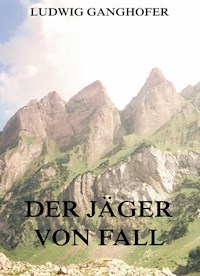
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sennerin Marei steht zwischen zwei Männern: Blasi ist zwar der Vater ihres unehelichen kleinen Sohnes, jedoch ein Wilderer. Von seiner Liebe zu ihr merkt sie nichts mehr, vielmehr dient ihre Almhütte ihm zunehmend als Versteck vor den Jägern. Jäger Friedl wiederum liebt Marei schon seit langer Zeit, ist jedoch gleichzeitig ein Gegner von Blasi, dem er das Handwerk legen will. Marei verschließt vor Blasis Tun die Augen und glaubt, die Wilderer wollen nur ungebunden in der Natur jagen. Dass sie wahllos Jungtiere schießen, erfährt Marei erst, als Friedl nach einem derartigen, vermummten Wilderer sucht, der neun Nägel an den Schuhsohlen hat - und Blasi eben solche Schuhe trägt. Blasi und die anderen Wilderer jedoch können von Friedl nicht gestellt werden .... (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Jäger von Fall
Ludwig Ganghofer
Inhalt:
Ludwig Ganghofer – Biografie und Bibliografie
Der Jäger von Fall
Vorspiel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Der Jäger von Fall, Ludwig Ganghofer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN:9783849614706
www.jazzybee-verlag.de
Ludwig Ganghofer – Biografie und Bibliografie
Dichter und Schriftsteller, Sohn des August Ganghofer, geb. 7. Juli 1855 in Kaufbeuren, wandte sich erst der Maschinentechnik zu, betrieb dann in Würzburg, München und Berlin philosophische, naturwissenschaftliche und philologische Studien und widmete sich, nachdem er 1879 in Leipzig promoviert worden war, ausschließlich literarischer Tätigkeit. Er lebt in München. G. errang seine ersten Erfolge als Dramatiker durch die für die Wandertruppe der Münchener Dialektschauspieler gemeinsam mit Hans Neuert geschriebenen Volksstücke: »Der Herrgottschnitzer von Ammergau« (Augsb. 1880; 10. Aufl., Stuttg. 1901), »Der Prozeßhansl« (Stuttg. 1881, 4. Aufl. 1884) und »Der Geigenmacher von Mittenwald« (das. 1884, neue Bearbeitung 1900). Später folgten das gemeinsam mit Marco Brociner geschriebene Trauerspiel: »Die Hochzeit von Valeni« (Stuttg. 1889,.3. Aufl. 1903), die Schauspiele »Die Falle« (das. 1891), »Auf der Höhe« (das. 1892) und das ländliche Drama »Der heilige Rat« (das. 1901). Einen großen Leserkreis erwarb sich G. durch sein frisches Erzählertalent, insbes. mit seinen Hochlandsgeschichten. Wir nennen davon die meist in einer Reihe von Auflagen erschienenen Werke: »Der Jäger von Fall« (Stuttg. 1882), »Almer und Jägerleut« (das. 1885), »Edelweißkönig« (das. 1886, 2 Bde.), »Oberland« (das. 1887), »Der Unfried« (das. 1888), »Die Fackeljungfrau« (das. 1893), »Doppelte Wahrheit« (das. 1893), »Rachele Scarpa« (das. 1898), »Tarantella« (das. 1898), »Das Kaser-Mandl« (Berl. 1900) sowie die Romane: »Der Klosterjäger« (Stuttg. 1893), »Die Martinsklause« (das. 1894), »Schloß Hubertus« (das. 1895), »Die Bacchantin« (das. 1896), »Der laufende Berg« (das. 1897), »Das Gotteslehen« (das. 1899), »Das Schweigen im Walde« (Berl. 1899), »Der Dorfapostel« (Stuttg. 1900), »Das neue Wesen« (das. 1902). Daneben veröffentlichte er noch: »Vom Stamme Asra«, Gedichte (Brem. 1879; 2. vermehrte Aufl. u. d. T.: »Bunte Zeit«, Stuttg. 1883), »Heimkehr«, neue Gedichte (das. 1884), »Es war einmal«, moderne Märchen (das. 1891), »Fliegender Sommer«, kleine Erzählungen (Berl. 1893) u. a. Im Roman »Die Sünden der Väter« (Stuttg. 1886, 7. Aufl. 1902) versuchte sich G. ohne rechtes Glück als Sittenmaler; er hat darin den Dichter Heinrich Leuthold geschildert. G. gab auch eine Übersetzung von A. de Mussets »Rolla« (Wien 1880) und mit Chiavacci die »Gesammelten Werke Johann Nestroys« heraus.
Der Jäger von Fall
Vorspiel
Eine stille, kalte Dezembernacht lag über dem Bergdorfe Lenggries. Die beschneiten Berge schnitten scharf in das tiefe Nachtblau des Himmels, aus dem die Sterne mit ruhigem Glanz herunterblickten in das lange, schmale Tal. Dick lag der Schnee auf Flur und Weg, auf den starrenden Ästen der Bäume und auf den breiten Dächern der Häuser, hinter deren kleinen Fenstern das letzte Licht schon vor Stunden erloschen war.
Nur die Wellen der Isar, deren raschen Lauf auch die eisige Winternacht nicht zum Stocken brachte, sprachen mit ihrem eintönigen Rauschen ein Wort in die alles umfangende Stille; und zwischendrein noch klang von Zeit zu Zeit der Anschlag eines Hundes, dem die Vergesslichkeit oder das harte Herz seines Herrn die Tür verschlossen hatte, und der nun aus seiner fröstelnden Ruhe unter der Hausbank auffuhr, wenn vor dem Hofgatter die Tritte des Nachtwächters im Schnee vorüberknirschten.
Langsam machte der Mann dieses einsamen Geschäftes seine Runde im Dorf, eine hagere, noch junge Gestalt, eingehüllt in einen weitfaltigen, bis auf die Erde reichenden Mantel, dessen Pelzkragen aufgeschlagen war; eine dicke Pudelmütze war tief über den Kopf gezogen, so dass zwischen Mantel und Mütze nur der starke, eisbehauchte Schnurrbart hervorlugte. Die Hände des nächtlichen Wanderers staken in einem Schliefer aus Fuchspelz. Mit dem Quereisen in den Ellbogen eingehakt, hing unter dem rechten Arm der hellebardenähnliche „Wachterspieß“, dessen Holzschaft lautlos nachschleifte im fußtiefen Schnee.
Plötzlich hielt der Wächter inne in seiner Wanderung. Vor ihm stand ein kleines Haus, dessen Giebelseite bis dicht an die Straße reichte, von der es durch einen schmalen eingezäunten Raum getrennt wurde. Wenn man sich ein wenig streckte, konnte man mit der Hand über den Zaun bis ans Fenster greifen. So tat der Einsame, und zwei Mal klirrte unter einem schwachen Klopfen das letzte der drei Fenster. Nach einer Minute klopfte er wieder, etwas stärker. Wieder wartete er, klopfte von neuem und immer wieder. Hinter dem mit Eisblumen bedeckten Fenster wollte nichts lebendig werden.
„Heut hört’s wieder amal gar nix, dös Teufelsmadl!“, brummte der Wächter, während er zusammenschauerte und mit den Lippen schnaubte, dass ihm die Eistropfen vom Schnurrbart flogen. Eine Weile besann er sich, ob er gehen oder bleiben sollte. Dann schlug er mit der ganzen Hand an die Scheibe, die bei dieser groben Misshandlung so heftig klirrte, dass auch ein stocktauber Schläfer hätte erwachen müssen. Und wirklich, in der Stube ließ sich ein Geräusch vernehmen, als würde ein Stuhl gerückt; gleich darauf zitterte die Fensterscheibe, öffnete sich um ein paar Fingerbreiten, und durch den Spalt fragte eine gedämpfte Mädchenstimme: „Was is denn? Was für einer is denn schon wieder da?“
„Ich bin’s, der Veri!“, klang leise die Stimme des Wächters. „Geh, Punkerl, mach a bissl auf! Ich muss schier sterben von Kält und Langweil.“
„Was hast gsagt?“
Veri neigte den Oberkörper so weit als möglich über den Zaun. „Dass ich a bissl fensterln möchte bei dir!“
„Was dir net einfallt!“, lautete die unwillige Antwort des Mädels. „Es scheint, du bist noch net gscheid auf deine dreißg Jahr? Meinst, ich stell mich bei so einer Kälten im Hemmed daher ans offene Fenster?“
„Kannst ja in a Rock einischlupfen.“
„Ah na! Gut Nacht! ’s warme Bett is mir lieber.“
Das Fenster schloss sich, und alles war still.
„So, so? An andersmal mag ich halt nimmer. Weißt was? Steig mir am Buckel auffi!“ Diese Worte schienen den Ärger des Abgeblitzten beschwichtigt zu haben. Gleichmütig, als wäre nichts Kränkendes geschehen, schritt er wieder die Straße dahin.
Die Langeweile machte ihn gähnen. In der ersten Hälfte der Nachtwache hatte er von Stunde zu Stunde auf den Glockenschlag passen können, um seinen Wächterspruch in die Nacht hinein zu singen. Das letzte seiner Lieder war längst erledigt:
„Ös Mannder und Weibsleut, lasst senk sagen, Die Glock am Turm hat zwei Uhr gschlagen! Bewahrt das Feuer, bewahrt das Licht, Das enk an Leib und Seel kein Schaden gschicht!“
Nun war ihm auch sein Gesangsvergnügen genommen, weil ihm von dieser Stunde an die Gemeindevorschrift das Absingen des Wächterspruches untersagte. Ein nächtliches Unheil, das um zwei Uhr morgens noch nicht geschehen ist, kann warten, bis es Tag wird und bis sich die Bauern den Schlaf aus den Augen reiben. So schritt der Wächter seines Weges, sich damit unterhaltend, dass er von den Stangen der die Straße geleitenden Zäune mit dem Schaft seines Spießes den Schnee wegstreifte. Von dem vielstündigen Umherwandern ermüdet, setzte er sich auf einen der dicken Holzpflöcke, die an Stellen, wo von der Straße ein Fußpfad durch die Gärten führt, zum leichteren Überstiegen der Zäune dienen.
Veri machte sich’s bequem, scharrte von dem Fleck, wo seine Füße standen, den Schnee fort und betrachtete das ihm gegenüberliegende Gehöft des Meierbauern. Es war ein hölzernes Haus: Wohnraum, Stallung und Scheune in ein Ganzes zusammengebaut und alles überdeckt von dem lang gestreckten, weit über die Holzmauern vorspringenden Schindeldach, über dem sich der Schnee mit fester Decke gelagert hatte. Es war kein großer, reicher Bauernhof, aber Veri wäre glücklich gewesen, sich im Besitz eines solchen Gütls zu wissen; vielleicht wäre dann das verfrorene Punkerl vor einer halben Stunde weniger empfindsam gegen die Kälte gewesen.
Beim Meierhofer ging Veri häufig ein und aus, als Freund und „Spezi“ des fünfundzwanzigjährigen Lenzl, der mit den Eltern und seinem dreijährigen Stiefschwesterchen Modei, einem Kind aus zweiter Ehe, hier wohnte. Es war ein bisschen Neid gegen Lenzl, was Veri empfand, als er sich dachte, wie hübsch es wäre, wenn er mit Punkerl, nein, mit einem anderen, mildherzigen und warmblütigeren Mädel durch diese schmale, niedere Haustür einziehen könnte als Mann und Frau. Er dachte sich mit einem junge, fröhlichen Weiberl in die geräumige Wohnstube, die mit der Küche den Raum zu ebener Erde einnahm; die große Bodenkammer, die über dem Stalle lag, an der Langseite ein Dachfenster hatte und den beiden alten Leuten als Schlafraum diente, erschien ihm in seinen Träumen von Glück und bettwarmer Liebe als die gemütlichste Ehestube; für die kleine Kammer, deren einziges Fenster nach der vorderen Giebelseite ging und in welcher Lenzl mit dem Schwesterchen schlief, hätte sich im Lauf der Zeit wohl auch eine passende Verwendung gefunden, meinte Veri. Und nun gar der schöne Stall mit den acht Kühen! Und die große Scheune, dick voll gepfropft mit dem besten Heu!
Aber Veri war ein armer, heimatloser Bauernknecht, der, um sich ein paar Kreuzer zu verdienen, jede Nacht für irgendeinen faulen und schläfrigen Burschen die von Haus zu Haus wechselnde Nachtwache übernahm. Ein Seufzer hob seine Brust, während sein Blick über das stille Gehöft glitt. Da bemerkte er auf dem Dach eine schwarze, schneelose Fläche, die ihm früher nicht aufgefallen war. Je schärfer er hinsah, desto deutlicher kam es ihm vor, als würde dieser Fleck immer größer; nun schwand auch an anderen Stellen der Schnee, und es klang dabei wie das Klatschen fallender Tropfen.
Kam Tauwetter? Veri hauchte kräftig in Luft. Als er im Dämmerschein des Schneelichtes den feinen Eisstaub gewahrte, zu dem sein Atem in der Kälten gerann, schüttelte er nachdenklich den Kopf und sah wieder hinauf zu den rätselhaften Flecken, die sich erweitert hatten und schon hinaufreichten bis zur Schneide des Daches. Nun war es ihm, als kräuselten sich da oben kleine, weiße Dampfwölkchen in die Luft; nun kam es dicker, nun grau, nun in schwarzen Wolken – nun barst das Dach, und eine Funken sprühende Feuergarbe schoss gegen den Himmel.
„Feuerjo! Feuerjo!“
Gellend hallte der Schreckensruf in die Nacht.
Veri stürzte auf das Haus zu und sprengte das verschlossene Gartenpförtchen. In hallenden Schlägen fuhr der Schaft seines Spießes gegen die verriegelte Haustür. Nichts regte sich da drinnen; nur im Stall war es unruhig; dort rasselten die Ketten, und dumpf brüllten die Kühe durcheinander. Immer wieder schlug Veri gegen die Tür und schrie den Feuerruf. Das war es ihm, als hätte er im Haus ein Poltern und Rufen vernommen; hastig sprang er auf die Straße hinaus, und in keuchendem Laufe rannte er hinunter durch das Dorf, vorüber an den Häusern, deren Fenster sich zu erleuchten begannen.
„Feuerjo! Feuerjo!“
Die Fenster klirrten, die Türen wurden aufgerissen. „Jesus, Mar’ und Joseph!“, klang es. „Wo brennt’s?“ Und der Schreckensruf des Wächters fand in hundert Kehlen ein kreischendes Echo. Wenige Minuten, und das stille Dorf war Leben und Aufruhr. Lärmend liefen die Leute zum Unglückshaus.
Der ganze Dachstuhl war schon umwirbelt von Flammen, die das brennende Heu und Stroh in dicken Bündeln mit sich hinaufrissen in die Lüfte und einen sprühenden Funkenregen niedergossen über die Nachbarhöfe. Und immer noch standen die Türen geschlossen. Aus der Stallung klang ein Poltern, Klirren, Stampfen und Brüllen, dass es zum Erbarmen war. Und immer noch standen die Türen geschlossen.
„Wo is der Bauer, die Bäuerin? Wo is der Lenzl?“, scholl es um das brennende Haus. „Heiliger Herrgott! Helfts! Um Gotteswillen, helfts! Schlagts alle Türen und Fenster ein!“
„Da her, Mannder, da her!“, schrie im Hintergrund des Gartens eine Stimme. „Da liegen zwei Zaunpfosten, da können wir d’ Haustür einschlagen!“
Wer in der Nähe stand, griff zu, die Balken wurden herbei getragen, dröhnend schlugen sie gegen die Haustür. Einige Sekunden noch, und krachend flog die Tür in den Flur zurück. Ein paar der Mutigsten versuchten einzudringen. Eine stickende Rauchwolke schlug ihnen entgegen, und im Dunkle des Flures leuchtete das vom Luftzug ermunterte Feuer. Alles da drinnen war altes, hundertjähriges Holz, an das die Flamme nur zu rühren brauchte, um Nahrung zu finden.
Ein Jammern ging durch das Gedränge der Leute; die Weiber fingen zu beten an, und vom Kirchturm klang das schrille Wimmern der Feuerglocke.
Plötzlich hörte man laute Hilferufe von der Giebelseite des Hauses. Die Leute rannten dieser Stimme nach.
„Heilige Maria! Helfts! Helfts! Mein Vater verbrennt und d’ Mutter!“ An dem kleinen Fenster der Giebelkammer stand Lenzl, in den Armen das Schwesterchen, dessen herzzerreißendes Geschrei sich in die Hilferufe des Bruders mischte. Über seinem Kopfe qualmte der Rauch durch das Fenster, steig an der Holzwand in die Höh und verschwand in den Flammen des Firstes. Eine wilde Aufregung bemächtigte sich der Leute, die zu dem grauenvollen Bild hinaufsahen. „Lenzl, spring aussi!“, rief ein Bauer. „Bringts Leitern!“, schrie ein zweiter. Ein dritter: „Tragts Betten her, dass er draufspringen kann!“ Ein anderer wies auf einen großen, mit Brettern überdeckten Heuhaufen, der im Hof eines Nachbarn stand. Männer und Burschen sprangen hinzu, rissen die Bretter fort und schleppten das Heu herbei, das sie unter dem Fenster auf die Erde warfen, während die anderen zu Lenzl hinaufschrieen: „Spring, Bub! Jesus, Maria! Spring!“
Lenzl schien nicht zu sehen, was unten vorging. Mit erwürgter Stimme schrie er immer hinein in die Tiefe des Hauses: „Vater! Mutter! Vater! Mutter!“
Da scholl aus dem Innern des Hauses ein dumpfes Krachen. Hoch schlugen über dem Dach die Flammen auf und leckten über den First gegen die Wände des Giebels. Es war höchste Zeit für die beiden Menschen dort oben am Fenster. Der ausströmende Rauch zeigte schon eine rote Färbung, die vom Feuer im Innern herrühren musste. Und immer noch wollte Lenzl nicht springen. Das schreiende Kind an seine Brust gedrückt, neigte er nur manchmal den Oberkörper heraus über die Fensterbrüstung, wenn der Rauch stärker anschwoll. Dann klangen wieder seine Jammerrufe: „Vater! Mutter!“
„Er springt net! Und verbrennt mitsamt dem Kind!“, flüsterte einer der Bauern dem Pfarrer zu. „Ich bitt Ihnen, rufen S’ auffi zu ihm, dass der Vater und d’ Mutter schon heraußen sind.“
„Seid ruhig“, gebot der Pfarrer den Leuten, „damit er mich hören kann!“ Dann hob er die Stimme: „Lenzl! Spring herunter! Dein Vater und deine Mutter sind nicht mehr im Haus!“ Ein wilder Freudenschrei gellte droben von den Lippen des Burschen; hastig schwang er sich auf die Fensterbrüstung und sprang herunter in das aufgeschüttete Heu, das über ihm zusammenschlug. Alles drängte auf den Heuhaufen zu, aus dem sich Lenzl herauswühlte. Das Hemd und die kurze Lederhose war alles, was er am Leibe trug, und an der Brust hielt er das Kind umklammert, eingewickelt in eine Lodenjoppe.
„Wo is der Vater? Wo is d’ Mutter?“, fragte er mit bebender Stimme, zitternd an allen Gliedern. Er hörte keine Antwort von den Leuten, die still und bleich den Geretteten umstanden. „Wo is der Vater? Wo is d’ Mutter?“, schrie Lenzl wieder. Ein Schauer rieselte über seine Gestalt. Da trat der Pfarrer auf ihn zu und legte ihm die Hand auf die Schulter: „Fasse Mut! Wir alle sind sterbliche Menschen. Der Tod ist nur ein Übergang zu besserem Leben. Dort oben im Himmel wohnt ein Gott –“ Er konnte seine Trostrede nicht zu Ende bringen. Mit weit geöffneten, verglasten Augen hatte ihm Lenzl auf die Lippen gestiert. Nun fuhr er auf, stieß mit harter Faust den Tröster von sich und schrie: „Ich will kein’ Herrgott jetzt! Ich will den Vater haben! Und d’ Mutter!“ Scheu wichen die Leute vor ihm zurück, als er mit taumelnden Knie auf sie zuwankte. Er irrte durch Garten und Gehöft, im Kreis um das brennende Haus. Jedem Menschen spähte er ins Gesicht. „Vater! Mutter!“, klang immer wieder sein Geschrei. Und wenn das Kind in seinen Armen zu wimmern begann, neigte er das Gesicht zu ihm und flüsterte: „Sei stad, liebs Modei, sei stad! Ich find ihn schon, mein’ Vater! Und die’ Mutter! Sei stad, sei stad!“
Er fand sie nicht.
Gewaltsam musste man ihm den Weg zur Haustür verlegen, aus der schon die Flammen lohten. Mit geballter Faust schlug er auf die Burschen ein, die ihm den Zugang verwehrten, dann wankte er nach der Giebelseite des Hauses, trat wie ein Irrsinniger auf den Pfarrer zu und schrie ihm ins Gesicht: „Anglogen hast mich, Pfarrer! Sag mir’s, du! Was für a Herrgott is denn der deinig? Einer, der d’ Leut verbrennt? Mein Vater und d’ Mutter –“ Seine Worte verloren sich in ein schweres Stöhnen.
Da drängte sich durch den Kreis der Leute eine alte Bäuerin und fasste den Schluchzenden am Arm. „Komm, Lenzl! Dein Schwesterl kunnt verkranken in der Kält.“
Lenzl starrte in das vom Feuerschein gerötete Gesicht der Alten. „Grüß dich, Gold! Bist auch da? Weißt es schon?“ Tränen erstickten seine Stimme. „Der Vater und d’ Mutter –“
Es waren nicht übermäßig kluge Worte, die das alte Weibl in Lenzls Ohr flüsterte, aber es waren Worte, die aus einem fühlenden Herzen kamen. Lenzl hörte nur den warmen Klang dieser Worte, nicht ihren Sinn. Seine Kraft war zerbrochen. Willenlos folgte er der Alten, die ihn mit sich fortzog, hinaus aus dem Hofraum, ein Stück entlang die Straße und durch die niedere Tür ihres kleinen Hauses. Als sie mit ihm in die enge, vom Abend her noch wohl durchwärmte Stube trat, die von dem durchs Fenster hereinfallenden Feuerschein und von einer kleinen, auf dem Tische stehenden Öllampe rötlich erleuchtet war, stieg ein achtjähriger Knabe von der Fensterbank. „Grüß Gott, Ahnl“, sagte er schüchtern, „wo is denn der Vater und d’ Mutter?“
„Draußen sind s’ und helfen löschen. Geh zu, Friederl, hol a paar Kissen aussi aus der Kammer, und warme Decken! Geh, tummel dich!“ Der Bub warf einen scheuen Blick auf Lenzl und auf das klagende Kind, dann sprang er davon und verschwand in der Kammertür.
Nun nahm die Alte das Kind aus den Armen des Burschen, der wie geistesabwesend vor sich hinstarrte, und zog ihn zum Tisch. „Geh, setz dich a bissl nieder!“ Sie drückte ihn auf die in das Mauerwerk eingelassene Bank; willenlos ließ Lenzl alles mit sich geschehen; dann kreuzte er die Arme über dem Tisch, und stöhnend vergrub er das Gesicht. Mit zitternder Hand fuhr ihm die Alte ein paar Mal über das kurze, struppige Haar.
Da kam der kleine Bub. Er trug zwei große weiße Bettkissen und schleifte eine wollene Decke hinter sich her. Mit der freien Hand ergriff die Alte die beiden Kissen und legte sie, jedes ein wenig aufschüttelnd, über die niedere Lehne des neben dem Ofen stehenden Ledersofas. Dann wickelte sie das Kind aus der Joppe heraus, legte es in die Kissen, zog ihm das Hemdchen glatt, breitete ihm über die nackten Füße die Joppe und darüber die doppelt gefaltete Decke. Als sie das Kind noch auf dem arm getragen, war es schon eingeschlafen, und regungslos lag nun das Köpfchen mit den heißroten Wangen in den Kissen; die halb geöffneten Lippen zitterten unter stockenden Atemzügen, und von Zeit zu Zeit flog ein Zucken über die geschlossenen Lider.
Während die Alte sich in Sorge über das Kind beugte, fühlte sie ein leises Zupfen am Rock. Als sie aufsah, hingen die großen Augen des Buben angstvoll an ihrem Gesicht. „Ahnl, was is denn?“, fragte er scheu die Großmutter. „Is denn ’s kleine Maderl krank?“
„Gott soll’s verhüten!“, lautete die flüsternde Antwort. „Geh, Friederl, bet a Vaterunser! Dem armen Kindl is der Vater und d’ Mutter verbrennt.“
Die Tränen schossen dem Buben in die Augen, und erschrocken faltete er die Händchen über der Sofalehne.
Die Alte ging zum Tisch hinüber. Lenzl rührte sich nicht, als sie halblaut seinen Namen rief. Sie glaubte, dass auch ihn nach Aufregung, Schmerz und Ermattung der Schlaf überkommen hätte. Liese schlich sie durch die Stube und kauerte sich beim Ofen nieder, um das Feuer anzuschüren. Während sie langsam, jedes Geräusch vermeidend, die kurzen, dürren Holzscheite unter dem Ofen hervorzog, murmelte sie einen Feuersegen und bekreuzigte sich. Von draußen leuchtete noch immer mit wechselnder Helle die Lohe des brennenden Hauses in die Stube.
Friederl hatte, als die Großmutter hinter dem Ofen verschwunden war, die Hände unter das Kissen geschoben. Immer betrachtete er das schlafende Mäderl. Jetzt kam die eine Hand wieder zum Vorschein und glitt über das Kissen, bis sie das Kind berührte. Ein Zittern überflog die schmächtige Gestalt des Buben; nun neigte er das Gesicht und küsste schüchtern die heiße Wange des Kindes.
Da scholl von draußen ein dumpfes Krachen, begleitet von hundertstimmigem Geschrei. In der Stube zitterte der Boden, und die Fenster klirrten.
Lenzl fuhr auf und blickte verstört um sich.
Da fiel ihm der Feuerschein in die Augen. „Heilige Maria!“, schrie er. „Vater! Mutter! Es brennt!“ Dann sprang er zur Tür und stürzte hinaus. „Wo brennt’s denn? Jesus, wo brennt’s denn?“, scholl von draußen seine Stimme.
„Lenzl!“, jammerte die Alte, während sie sich aufrichtete und dem Burschen nachrannte. „Lenzl!“, schrie sie über die Straße hinaus. „Lenzl, wo bist denn?“ Sie sah und hörte nichts mehr von dem Burschen. So schnell, als ihre alten Füße sie zu tragen vermochten, lief sie hinüber zur Brandstätte.
In sich zusammengestürzt lag das Haus; glühend, glimmend und rauchend kreuzten sich auf der Erde die eingesunkenen Balken und Sparren; nur auf der Stelle, wo der Stall gewesen, prasselte noch eine helle, gelbe Flamme, und zugleich mit ihr wehte ein dicker Dampf und ein widerlicher Fettgeruch in die Lüfte. Vor dem Gluthaufen, im Hofe, stand die Feuerspritze des Dorfes und sandte stoßweise ihren dünnen Wasserstrahl zwischen das eingestürzte Gebälk. In zwei langen Reihen standen die Leute bis hinunter an die Isar, und die leeren und wieder gefüllten Wassereimer wanderten durch hundert Hände hin und zurück. Diese Arbeit ging schon träge vonstatten; das verschüttete Wasser hatte in der scharfen Kälte die Hände der Leute starr gemacht; auch sahen sie ein, dass hier nichts mehr zu retten und für die Nachbarhäuser ein Schutz nimmer nötig war. Die einen und anderen waren schon, aus der Reihe getreten, die Hände reibend und behauchend oder die Arme um die Brust schlagend.
Bei allen Gruppen, überall hatte die Alte nach Lenzl gefragt; niemand konnte ihr Bescheid geben, niemand hatte den Burschen gesehen.
„Mich sollt’s gar net wundern“, sagte ein Bauer, „wann der arme Kerl mitten eini gsprungen wär ins Fuier oder am End gar in d’ Isar. Vater und Mutter verlieren! Und so a schöns Anwesen! Dös is kein Spaß. Mich dauert er schon recht, der Lenzl!“
„Und erst die armen Küh!“, jammerte ein anderer. „Die dauern mich am meisten. So viel dumm is so a Viech. Wann’s brennt und man macht ihm d’ Stalltür auf, meinst, es lauft aussi? Na! Erst recht rennt’s mitten eini ins Fuier!“
„Jesus! Da ist der Lenzl!“, scholl die Stimme der Alten aus einer Ecke des Gartens. Die beiden Bauern und mit ihnen noch ein paar andere liefen der Stimme nach. Lang ausgesteckt ,die Arme gespreizt und unbeweglich, lag Lenzl mit Brust und Gesicht im Schnee. Wie es schien, hatte er den Zaun überklettern wollen und einen bösen Sturz getan. An seiner Seite kniete die Alte, rief seinen Namen und schüttelte seine Schulter. Und bettelte: „Mannder, so helfts mir doch a bissl! Und hebts ihn auf! Und tragts ihn ummi zu mir! Ich fürcht, ich fürcht –„
Vier Männer hoben den Lenzl au fund folgten mit ihrer Last der Alten. Eine Schar von Neugierigen geleitete den Zug; ein Teil von ihnen kehrte auf halbem Wege wieder um, denn die Leute mussten nun auch daran denken, die ausgefrorenen Glieder zu wärmen und an die Arbeit zu gehen, die der Morgen brachte.
Längst schon hatte sich das Dunkle des Himmels abgetönt in das fahle Grau des werdenden Wintertages, und über die Spitzen der Berge fiel das erste Frührot.
Als die Alte mit den Männern, die den Ohnmächtigen trugen, in die Stube trat, fand sie den kleinen Friedl vor dem Sofa auf den Knien liegen. Sein Kopf ruhte auf den Kissen, und schlummernd hielt er ein Händchen des Kindes an seinen Mund gehuschelt.
Das Öllicht auf dem Tische musste eben erst erloschen sein; von dem rußigen Dochte stieg noch ein dünner Qualmfaden gegen die Stubendecke.
Kapitel 1
Wer von Lenggries an der Isar aufwärts wandert, um über Hinterriß und das Plumserjoch hinabzupilgern an den blaugrünen Achensee, der hat voraus zwei gute Stunden zu marschieren, um die erste Haltstation, den Weiler Fall, zu erreichen. Eng eingezwängt zwischen ragende Berge und bespült von den kalten Wassern der Isar und Dürrach, die hier zusammenfließen, liegt dieser schöne Fleck Erde in stillem Frieden. Hier ist nur wenig Platz für Sommergäste; ein kleines Bauernhaus zuvorderst an der Straße, dann das Wirtshaus, das den Köhlern und Flößern zur Herberge dient, dahinter das lang gestreckte Forsthaus mit den grünen Fensterläden und dem braun gemalten Altan, das neue weiß getünchte Stationshaus der Grenzwache, eine kleine rußige Schmiede und einige Köhlerhütten, das war um 1880 der ganze Häuserbestand von Fall.
Im Hochsommer, zur Zeit der Schulferien, sah man wohl von Tag zu Tag ein paar Touristen, selten einen Wagen. Die Stille des Ortes wurde nur unterbrochen durch das dumpfe Poltern der Holzstämme, die, von den Hebeln der Flößer getrieben, hinabrollten über die steilen Ufer der Lagerplätze und mit lautem Klatsch in das Wasser schlugen. Hier und da durchhallte ein krachender Schuss das kleine Tal, wenn der Förster oder einer der Jagdgehilfen seine Büchse probierte. Am lautesten war es, wenn des Abends die Schatten niederstiegen über die Berge; dann füllte sich die geräumige Gaststube des Wirtshauses mit Köhlern und Flößern, die Jagdgehilfen kehrten zu und die Holzknechte, die in den benachbarten Bergen arbeiteten. Durch die offenen Fenster schollen dann vergnügte Lieder hinaus in die Abendluft, die Zither klang, verstärkt durch die schnarrenden Töne einer Gitarre oder einer Mundharmonika, und der Fußboden dröhnte unter dem Stampftakte des Schuhplattltanzes. Dazwischen tönte lautes Gelächter über ein gelungenes Schanderhüpfel, über irgendeinen derben Witz oder über den misslungenen Sprung eines Tänzers, der es vergebens versuchte, im Tanz den schwer beschuhten Fuß bis an die Stubendecke zu schlagen. Das Wirtstöchterchen und die Kellnerin hatten dann vollauf zu tun mit Tanzen und Einschenken, und erst in später Nacht endete die laute Fröhlichkeit, wenn entweder das Bier ausging oder wenn die Gäste sich daran erinnerten, dass die frühe Morgenstunde sie wieder zur Arbeit rief.
So war’s im Sommer. Im Winter liegt hier alles eingeschneit; oft reicht der Schnee bis hoch an die Fenster, zum großen Leidwesen der Jagdgehilfen, die sich dann mit schwerer Müh einen gangbaren Weg bis zur Tür des Wirtshauses ausschaufeln müssen. Nur die Isar bleibt auch in solcher Zeit noch munter und lebendig. Jahraus, jahrein, durch Sommer und Winter, rauscht das eintönige Lied ihres hurtigen Wellenlaufes. Früher, vor Jahren, suchte sie nicht so gemütlich ihren Weg. Da grollte, brauste und toste sie in ihrem steinernen Bette, warf an den starrenden Felsen ihre lauten, weißen Wellen auf, mit wilder Gewalt zwängte sie ihre Wassermassen durch die einengenden Steinklötze der beiden Ufer und stürzte sie dann hinab, schäumend und wirbelnd, über drei aufeinander folgende Fälle. Da hatten die Flößer schwere Not, wenn sie mit ihren zerbrechlichen Fahrzeugen diese Stelle passieren mussten, und mancher verlor mit seinem Floße auch das Leben. Die meisten Schiffer zogen es vor, eine Strecke oberhalb der Fälle ans Land zu steigen, die steuerlosen Flöße an den Felsen der Flussenge zerschellen zu lassen und dann weiter unten im Storm die einzeln daher treibenden Stämme wieder aufzufangen. Die Klugheit der neuen Zeit hat sich auch hier betätigt. Pulver und Dynamit haben die „Steine des Anstoßes“ zertrümmert, und ungefährdet passieren jetzt die Flöße die einst so gefürchtete Stelle der Isar.
Hier in Fall, ganz zuvorderst an der Straße, die von Lenggries einher zieht, steht ein kleines, freundliches Bauernhaus. Der ebenerdige Stock, der einen nicht übermäßig geräumigen Stall und eine Futterkammer umfasst, ist aus Felsstücken aufgeführt und lehnt sich mit seiner Rückwand gegen einen Hügel, in dem Winkel, den die Straße mit dem Strom bildet, wo sie vom Ufer sich abzweigt gegen das Wirtshaus. Über dem Unterstock erhebt sich der aus Balken gefügte Oberstock, der die Wohnräume umfasst: Neben Flur und Küche eine Wohnstube und zwei Kammern. Darüber spannt sich, weit vorspringend über den Giebel, das mit schweren Steinen belegte Schindeldach. In seinem Schatten hängen drei Scheiben an der Giebelwand. Der kleine weiße Holzzapfen, den jede in ihrem durchschossenen Zentrum trägt, verkündet, wie gut der Herr dieses Hauses die Büchse zu handhaben weiß. Unter diesen Scheiben und zwischen den beiden Fenstern des Giebels führt in das Innere des Hauses eine niedere Tür, zu der sich vom Hügel her eine kleine Holzbrücke spannt.
Es ist ein heißer Augusttag. Die Sonne brennt vom Himmel herab und zeichnet mit dunklen Schatten die Umrisse des vorspringenden Daches auf die Holzwand des Hauses.
Auf der Brücke vor der Tür steht ein schlank gewachsener Bursch in der Tracht der Jagdgehilfen: Schwer genagelte Schuhe an den nackten Füßen, dickwollene weiße Wadenstrümpfe, die kurze gamslederne Hose, ein blaugestreiftes Leinenhemd, an der Brust offen und nur zusammengehalten von einem leicht geschwungenen schwarzen Halstuch, die graue Joppe mit dem grünen Aufschlag, der als Dienstzeichen das goldgestickte Eichenlaub trägt, der Bergsack auf dem Rücken, und auf dem Kopf der kleine, runde Filzhut mit dem nickenden Gamsbart. Das Gewand des Burschen ist abgetragen und verwittert; die Büchse, die er hinter dem Rücken trägt, ist neu und blank, und die Stahlläufe blitzen in der Sonne.
Die nachlässige, vornüber gebeugte Haltung des Oberkörpers lässt kaum vermuten, welch kraftvolle und sehnige Gestalt in diesem verblichenen Gewande steckt. Das Gesicht ist sonnverbrannt, ist dunkler als der leicht gekrauste, rötlichblonde Bart, der es umrahmt. Es redet eine stille, gewinnende Sprache; die klaren, lichtblauen Augen sind es, die dem Gesicht diesen freundlichen Ausdruck verleihen.
In der einen Faust hält der Jäger den langen Bergstock, während er mit der anderen die Hand einer alten Frau umspannt, die unter der Türe steht. „Pfüet dich Gott, Mutter! In vierzehn Täg bin ich wieder daheim vom Berg. Und sorg dich net!“
„Pfüe Gott halt, Friedl! Und gib mir a bissl acht beim Steigen!“
„Ja, ja!“
„Und was ich noch sagen will –„ Die Mutter zog ihn näher an sich. „Wann droben in d’ Näh von der Modei ihrer Hütten kommst, geh lieber dran vorbei!“
„Mutter, da bin ich, wie d’ Mucken sind! Allweil zieht’s mich wieder eini ins Licht, und ich weiß doch, wie’s brennt!“ Friedls Stimme klang gedrückt, und ein Schatten von Schwermut huschte über seine Augen.
Die Mutter legte ihm die Hände auf die Schultern. „Geh! So a Mannsbild wie du! Und so an unsinnige Narretei! Schau, ich setz den Fall, ’s Madl kunnt dich gern haben, so wär’s doch allweil nix mit enk zwei. Du weißt schon, wegen was! – Jetzt geh! Sonst kunnt der Herr Förstner schelten, weil dich so lang verhaltst. Pfuet dich Gott, mein Bub!“ Dabei schob sie ihn über die Brücke und durch die niedere Zauntür, die sie hinter ihm ins Schloss drückte.
Ohne ein Wort der Erwiderung hatte Friedl das mit sich geschehen lassen und stieg nun, den Blick zu Boden gerichtet, über den Hügel hinab zur Straße.
Er musste sich beim Förster abmelden, bevor er auf die Berge stieg, um nach den paar Ruhetagen, die er genossen hatte, dort oben seinen vierzehntägigen Aufsichtsdienst wieder anzutreten. Der Weg zum Förster führte am Wirtshaus vorüber. Vor der Tür, auf einer erhöhten Backsteinterrasse, stand im Schatten der aus dem Giebel vorspringenden Holzaltane ein Tisch. Hier saß ein junger Mann; während er mit beiden Händen den vor ihm stehenden Bierkrug umspannte, lauschte er aufmerksam den Worten des neben ihm sitzenden Wirtes, der seine Rede mit lebhaften Armbewegungen begleitete.
Der Wirt – von allen, die bei ihm aus und ein gingen, kurzweg „Vater Riesch“ genannt – verkörperte mit seiner breiten, gedrungenen Gestalt und dem verschmitzten Faltengesicht, in den langen Schlotterhosen, dem weißen Hemd und der offenen Weste den landläufigen Typus der Hochlandwirte; auch der große Kropf fehlte nicht, dem ein braunseidenes Halstuch zur bequemen Schlinge diente. Sein Zuhörer trug ein Gewand, das der Tracht eines Jagdgehilfen glich; es war verwittert und abgetragen, zeigte aber doch eine bessere Art und einen feineren Schnitt. Die nackten Knie waren wohl auch gebräunt und von mancher Narbe durchrissen, aber die Stirne war weiß, und der wohl gepflegte blonde Bart wie die goldene Brille vor den blauen Augen verriet den Städter. Der Förster und die Jagdgehilfen nannten ihn „Herr Doktor“. Sein Vater, der einst Oberförster gewesen, amtete seit einigen Jahren in der Residenz als Forstrat; den Sohn zog es mit jedem Sommer in die Berge, und gerne saß er mit Flößern und Holzknechten beisammen, plauderte und sang mit ihnen in ihrer Art und Sprache, oder zog, das Gewehr auf dem Rücken, mit einem der Jagdgehilfen hinauf ins Gamsrevier, wo er an Ausdauer und Handhabung der Büchse keinem gelernten Hochlandsjäger nachstand, oder er saß, wie eben jetzt, mit dem Wirte hinter dem Bierkrug und ließ sich alte Geschichten von Jägern und Wildschützen erzählen.
So eifrig waren die beiden in Schwatzen und Lauschen vertieft, dass sie den Jäger nicht bemerkten, bevor er nicht dem Doktor auf die Schulter klopfte mit den Worten: „Sie sind ja schon ganz blau! Was hat er Ihnen denn schon wieder für a grausige Gschicht aufbunden, der Vater Riesch?“
„Gehst net weiter, du Kalfakter!“, schalt der Wirt. „Willst mir leicht gar mein’ besten Kunden abspenstig machen? Da, trink lieber, is gscheider!“
Friedl fasste den Krug, den der Wirt ihm geboten hatte, und tat einen festen Zug.
„Gehst du in Dienst? Wohin?“, fragte der Doktor.
Friedl setzte den Krug auf den Tisch. „Zur Lärchkoglhütten muss ich heut auffi. Was is? Nix mit? Im Luderergwänd wär a guter Gamsstand. Ich mein’, da schauet was aussi, wann wir morgen durchsteigen möchten.“
„Oho! Gleich bin ich fertig!“, rief der Doktor erfreut, sprang auf, steckte die auf dem Tisch liegende Zigarrentasche zu sich, auf deren Leder in Silber der Name des Eigentümers, Benno Harlander, eingepresst war, bot dem Wirt einen hastigen Gruß und rannte zum Forsthaus hinüber.
„Pressiert net so!“, rief ihm Friedl nach. „Ich muss sowieso noch beim Herrn Förstner fürsprechen!“
Benno war bereits in der Tür des Forsthauses verschwunden. Den Krug, den er auf dem Tisch hatte stehen lassen, zog der Wirt an sich und untersuchte ihn auf seinen Inhalt. „Hat wirklich wieder ’s ganze Bier vergessen!“, brummte er. „Is dös a Herr! Grad reden därfst von eim Gams, nacher is er schon in der Höh. Geh zu, Friedl, trink’s aus, wär schad um dös gute Bier.“
„Muss net so arg gut sein, sonst tätst es selber abischlücken.“
„Red net lang, trink!“
Friedl leerte den Krug und setzte ihn auf den Tisch, dass der Deckel klappte. „So! Vergelts Gott! Und pfüet dich Gott!“
„Halt a bissl!“, rief der Wirt und fasste den Jäger an der Joppe. „Was ich sagen will – a Neuigkeit, ja! Weißt es schon? Der Huisenblasi is dagwesen, a Stündl mag’s her sein.“
Friedls Gesicht wurde hart. „So? Ich hätt gmeint, der Weg nach Fall wär ihm a bissl verleidet worden, seit er Isarwasser hat schlucken müssen, der Lump!“
Der Wirt zuckte die Achseln. „So einer vergisst leicht! Er wird sich halt denken, dass daheraußen in Fall die Hirschen und die Gams a bissl gar z’viel geschont werden, und da meint er wohl, er kunnt dem abhelfen, dass in der nächsten Brunst die Hirschen wieder dutzendweis auf meiner Wiesen schreien.“
Friedl lachte kurz und rückte den Hut aufs Ohr. „Es scheint, der Blasi hat Langweil nach seinem Bruder, der in Fall den letzten Schnaufer gmacht hat? Wann er wieder zuspricht, der Blasi, kannst ihm ausrichten, dass ihm z’helfen wär. Adjes!“ Kurz wandte Friedl sich ab und ging auf das Forsthaus zu.
„Oho, oho!“, brummte der Wirt. „Meintwegen derschieß ihn heut oder morgen! Is grad a reicher Tagdieb weniger auf der Welt.“
Als Friedl in den Flur des Forsthauses trat, kam ihm Benno bereits entgegen, Rucksack und Büchse hinter den Schultern und den Bergstock in der Hand. Noch ein kurzer Plausch mit dem Förster. Dann wanderten die beiden über die Wiesen hinaus.