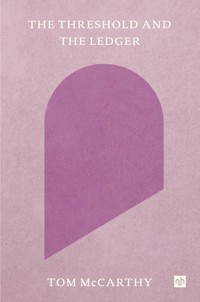21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Tief in den Archiven der Zeit- und Bewegungspionierin Lillian Gilbreth liegt ein Geheimnis. Berühmt für die Herstellung solider Lichtspuren, die die Bewegungsmuster von Arbeitern aufzeichnen, hatte Gilbreth, zur Begeisterung von NASA und KGB, die Möglichkeiten von Massenüberwachung und Big Data revolutioniert. Aber hatte sie, wie sie in einem ihrer Briefe andeutet, gegen Ende ihres Lebens tatsächlich auch ein »perfektes« Uhrwerk entdeckt, das »alles verändern« würde?
Eine weltumspannende Jagd beginnt, nach dieser einen Box, die in ihrem Nachlass fehlt, und wir folgen einem jungen Bewegungserfassungsforscher namens Mark Phocan durch unsere flirrende Gegenwart, über geopolitische Verwerfungslinien und durch Experimentierzonen und mitten hinein in die Dreharbeiten zum Blockbuster-Film Inkarnation, einer epischen Weltraumtragödie, die endgültig die Geheimnisse menschlicher Erfahrung lüften soll...
Der Dreh von Inkarnation ist eine hellsichtige Breitwand-Odyssee durch medizinische Labore, Computergrafikstudios und militärische Forschungseinrichtungen, dunkle Orte, an denen die Grenzen unserer Möglichkeiten – zu unterhalten, zu verstehen, zu heilen, zu töten – ständig getestet und weiter verfeinert werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Tom McCarthy
Der Dreh von Inkarnation
Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel The Making of Incarnation bei Jonathan Cape, London.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2023.
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023© Jonathan Cape, London, 2021
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung: Blue D.1., Gemälde von Wojciech Fangor, 1962, Öl auf Leinwand, 88 x 64 cm, ASOM Collection, (c) Fangor Foundation
eISBN 978-3-518-77549-3
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Isadora und Alexis Lemon McCarthy
Motto
Die bestehende Inkarnation ist unsere Gnade. Sie erschafft zugleich Farbe, Berührung, Weitsicht und Musik, die geschmeidige Widerstandskraft des Fleischs und die Sehnsucht, die nicht enden wird …
Denis de Rougemont
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Inhalt
Prolegomenon
Über die dynamischen Eigenschaften von Wellen in periodischen Systemen
Buch Eins
1. Markies Verbrechen (Wiederholung)
2. Aufliegten Höhe
3. Die Zehn Gebote für die Darstellung von Raumflügen in Filmen
4. Corydon und Galatea
5. Klient A
6. Inszenierungen
7. Ground Truth
8. Der eine beste Weg
Buch Zwei
1. Und runter gings
2. Liebestrank
3. Die Gesellschaft zur Würdigung Norbert Wieners
4. The Girl with Kaleidoscope Eyes
5. Kritisches Intervall
6.
DYCAST
7. Movement Underground
Buch Drei
1. Cidonija
2. Frisch weht der Wind
3. Eine Kugel Javaapfel
4. Assassiyun
5. The Beatitudes
6. Die Molekularität von Glas
7. Der Wrangler
Danksagungen
Textnachweis
Informationen zum Buch
Prolegomenon
Über die dynamischen Eigenschaften von Wellen in periodischen Systemen
Aus der S-Bahn, durch das wechselnde Gitter aus Ästen und Brückenpfeilern sieht man ihn am westlichen Zipfel des Tiergartens, wenn man in ostwestlicher oder westöstlicher Richtung unterwegs ist: einen fünf Stockwerke hohen blauen Klotz. Das Gebäude schwebt unnatürlich über dem Boden, aufgebockt auf zwei riesigen rosa Röhren, die aus seinen Seiten hervortreten, sich abwärtskrümmen und unter ihm vereinen wie eine Krabbe, die sich vor Angst oder Wut oder in einer Art Paarungsritual aufbäumt. Was ist das? Das ist die Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau, ein Außenposten, den die Technische Universität Berlin einem kaiserlichen Pachtvertrag verdankt. Die VWS hat Kriege, Bodenwerterhöhungen und alles andere irgendwie überdauert und steht auf der kleinen, länglichen Insel, um die herum sich der Landwehrkanal in zwei Schleusen teilt, die hinter ihr wieder verschmelzen, um alle Knoten, Spiralen und andere Spuren früherer Stockungen oder Sperren bereinigt.
Mit einer höheren Auflösung gescannt, als den meisten S-Bahn-Passagieren zur Verfügung steht, bildet sie einen Komplex von ineinandergesteckten Baukörpern. Das auffällige Krustentier ist der Umlauf- und Kavitationstank UT2, dessen Rohrschleife 3300 Tonnen Wasser fasst, die auf zehn Meter pro Sekunde beschleunigt werden können – ideal für Kielfeld- und Kavitationsforschung, Widerstands- und Propulsionsversuche sowie ähnliche Untersuchungen von Strömungsdynamiken. Im Dröhnen der zwei Megawatt starken Schiffsdieselmotoren und in den Schwingungen der Turbinenschaufeln der riesigen Pumpe, die die Blechverkleidungen der Wände und Böden erbeben lassen, spielen sich Dramen der Verdünnung wie der Verdichtung ab, zyklische Spannungen und Superkavitationen laufen sich auf Kommando tot, Schiffsmodelle, Steuerruder und Propeller werden auf verschiedenen Stufen belastet, denen dann Anfangsfließwerte und Erosionszuwachsraten entnommen werden. Zu Füßen des turmhohen Monstrums liegen wie Essensreste oder halbgelaichter Nachwuchs einige lange, flache Hangars. Im Hangar mit der Wellenmaschine im Seegangsbecken – das genau wie der UT2 immer wieder mit Wasser aufgefüllt wird, das dem Landwehrkanal entnommen wird, dann in diesen zurück und weiter in die Spree fließt – findet das heutige Geschehen statt.
Hier wird Neptuns Zorn entfesselt und auf ein Versorgungsschiff gelenkt, einen Ankerziehschlepper und zwei Bohrinseln. Dipl.-Ing. Arda Gökçek, Haustechniker und Flutenwächter der VWS, steht am vertieften Ende des Flachwasserbeckens, Daumen und Finger gleiten über das GlidePad eines MacBooks, skalieren Maße, modifizieren Kennziffern, justieren Wellenhöhe und Hublänge sowie charakteristische und gravitationsbedingte Geschwindigkeiten nach oben oder unten. Als sich das Profil auf seinem Monitor, der Rhythmus seiner Kurven und Intervalle mit den Zielvorgaben für heute deckt, löst sich Gökçeks Hand vom Laptop, schwebt ein paar Zentimeter über der Tastatur, seine Augen gleichen ein letztes Mal die graphischen Konturen ab, dann tippt er entschlossen auf die Leertaste. Gut hundert Meter weit weg ächzt die Wellenmaschine am anderen Beckenende; Antriebsarme, Riemenscheiben und Verbindungsarme, Antriebszapfen, Flanschlager und Pleuelstangen setzen sich in Bewegung, schließen sich, üben Schub aus und drücken einen schrägen Schwingflügel immer wieder gegen die Wassermassen. Und dann kommt sie die lange schmale Strecke entlang, die Kuppe verdoppelt das Licht der in regelmäßigen Abständen an der Decke angebrachten Neonröhren, eine nach der anderen, hebt jeden inversen Spektrallichtstrich seiner Quelle entgegen, bevor die Spiegelung von den dunklen Strudeln des nachfolgenden Tals wieder verschluckt wird: die erste Welle. Ihr folgen die zweite und die dritte und die vierte, sie überspülen die grünen Kacheln der Beckenwände und erneuern mit absoluter Präzision immer wieder dieselbe Hochwassermarke.
Spüren der Schlepper und die Bohrinseln ihr Kommen? Natürlich nicht; alle Ausbreitungsvektoren des Mediums, in dem sie sich befinden, sind hier aufgetragen, Phasengrenzen und Eigenfrequenzen sind transparent berechnet worden; es gibt keinen Spielraum für Unklarheiten und noch weniger für Phantasien – aber jedes Mal, wenn Gökçek in den letzten, schrumpfenden Sekundenbruchteilen vor dem Auftreffen der ersten Welle die nachgebauten Städte, Dämme, Kreuzfahrtschiffe, Hafenmauern oder Windparks im Ausbreitungsbereich sieht, hat er das Gefühl, in der bloßen Struktur der Modelle, im Zusammenhalt ihrer Atome eine Zunahme der konzentrierten Stasis zu spüren; geradezu eine Anspannung, als würden sie sich wappnen; als wüssten sie irgendwie …
Jetzt sind die Wellen da, durchrütteln und erschüttern die Modelle, lassen sie ausscheren – horizontal, vertikal, longitudinal, transversal und kreuz und quer dazwischen – auf Wegen, die zufällig scheinen, das aber keineswegs sind, und darum geht es: Kameras in den Beckenwänden verfolgen jede Welle, jede Woge und jedes Wiegen, erkennen und übersetzen in den wild verfilzten Linien ein Muster, das sich retro- wie prospektiv betrachten lässt und dessen Unschärfe in klare Parameter transformiert wird, die sich, einmal modelliert, nicht nur zum Nutzen künftiger Planungen von Offshore-Anlagen wieder aufskalieren, sondern bei Kreuzung ihrer eigenen Verbreitungs- und Verschiebungsvektoren auch übertragen, extrapolieren und in wer weiß was alles einspeisen lassen. In den nächsten sechzehn Monaten werden die aufbereiteten Daten von heute auf so verschiedenen Gebieten wie Infraschall und Seismokardiographie zum Tragen kommen, in der Erforschung von Keimkonvektionen in Flugzeugkabinen und der Ausbreitung von Gerüchten in sozialen Medien. Die Dinge stehen in Verbindung mit anderen Dingen, die mit anderen Dingen in Verbindung stehen. Gestern sind 103 asiatische Bergarbeiter bei einer Methanexplosion ums Leben gekommen; in einem kleinen südamerikanischen Staat hat ein Putsch stattgefunden; eine große Walschule ist an Westeuropas Küste gestrandet. Die Seiten von Gökçeks Zeitung, die aufgeschlagen auf einem Hocker neben einem halbvollen Kaffeebecher liegt, rascheln in seinem Windschatten auf, als er eine Trittleiter hochsteigt. Von der erhöhten Position aus beobachtet der Techniker die Boote, die in Dünung und Seegang wie betrunken schlingern und tanzen und an den zerschmetterten Riffen der Gerüstbeine und Anker der Bohrplattformen vorbeischießen. Die Erhöhung beruhigt ihn; er steht über den in der Ebene tobenden Schlachten, ist unbeteiligt. Bilder vom Bosporus regen sich bei ihm im Hinterkopf, durchlaufen verschiedene Gestalten – weniger ein in Urlauben und bei längeren Familienbesuchen aus Autofenstern und von Moscheeterrassen flüchtig erblicktes Panorama als eine überkommene Erinnerung, eine Idee …
Die Wellenmaschine ächzt; der Schwingflügel bewegt sich im selben Rhythmus. Die Lagerzapfen der Gleitlager, die die Kurbelwelle an Ort und Stelle halten, müssen geölt werden, das hört Gökçek am gereizten Ton. Wo die glatten Wasserflächen im Becken noch nicht von den Modellen aufgebrochen werden, sind sie von einem Öl- und Schmutzfilm überzogen, einem Niemandsland, übersät von toten Insekten, die sich von den Spiegelungen breiter Streifen freien Luftraums und leuchtender Dachsparren haben anlocken lassen, den trügerischen Versprechen der Gemeinschaft. Der Ankerziehschlepper mit dem gehärteten Paraffinbug hat sich in den Gerüstbeinen der einen Bohrplattform verkeilt. Computermodellierungen können einem nicht alles zeigen. Manchmal muss man etwas selber machen, eine kleine Welt erschaffen und der Tücke der chaotischen Objekte entgegentreten. Am Beckenrand greift Gökçek nach einer Stechstange, die neben Schlauch- und Drahtrollen sowie Tuchfetzen und Schnüren an J-Haken hängt, beugt sich über den Beckenrand und versucht, den Schlepper freizubekommen. Sein rechter Fuß, den er nach hinten ausstreckt, um das Gleichgewicht zu halten, stößt gegen den Hocker; Kaffee schwappt aus dem Becher auf die Zeitung. Auf einer Arbeitsfläche neben dem Hocker liegen eine Dose Isopropanolspray, eine CD-Rom, eine Rolle Toilettenpapier, ein Eislutscherstiel, ein zerknautschter Plastikhandschuh, wie er zum Geschirrspülen verwendet wird, Gewichte, Schwimmer, ein Feuerlöscher, ein übriggebliebener Holzklotz, ein Zollstock, eine Taschenlampe, eine Einkaufstasche, eine externe Festplatte, ein roter Textmarker, ein Plastikbecher mit kleinen Schrauben, ein blaues Set Kreuzschlitzschraubenzieher, eine Dose Schmieröl und ein zerknülltes Stück Küchenpapier mit roten Flecken. Dahinter sind an der Wand Modelle aufgestapelt, die heute nicht gebraucht werden: ein U-Boot, ein ICE, fünfzehn Windräder, ein lebensgroßer Kaiserpinguin und die Stadt Mumbai. Davor steht ein neues, vor einer Stunde erst in einem übergroßen Karton aus London in der VWS angeliefertes Requisit, von dessen Verpackung noch Styroporpellets und ‑keile auf dem Boden liegen, die für den Transport des Modells passgenau zugeschnitten wurden und jetzt spiegelbildlich (und zerlegt) die äußere Form der kostbaren Fracht wiedergeben, die ebenfalls aus Styropor ist: ein Raumschiff mit separaten, unterteilten Rumpf- und Tragflächenkonfigurationen und einer Art halb freistehendem, golfballartigen Annex, der genau über dem höchsten Abschnitt aufgeteet worden ist. Gökçeks Stechstange findet den idealen Druckpunkt am Kiel des Schleppers und bekommt ihn frei. Der Schlepper krängt kurz, dreht sich auf der Seite liegend im Uhrzeigersinn einmal um sich selbst und eine Dritteldrehung entgegen dem Uhrzeigersinn zurück, richtet sich auf, umschifft die Gerüstbeine und findet ins offene Fahrwasser. Der Schwingflügel bewegt sich, die Wellenmaschine ächzt. Gökçek hängt die Stechstange an die J-Haken zurück und macht sich auf die Suche nach Motoröl.
Der Kaiserpinguin ist als einziges Requisit nicht nur im Maßstab eins zu eins nachgebildet, sondern (da es bei der Untersuchung, in der er eine Hauptrolle spielte, auch um den Effekt der Turbidität auf die Färbung flacher Substrata ging) an den entsprechenden Stellen auch schwarz, gelb und weiß angemalt worden. Er ist in »Tümmler«-Haltung gegossen worden: Flügel an den Rumpf geklappt, Kopf in einer Flucht mit der Zentralachse des Körpers gestreckt, Füße geschlossen und vertikal so nach unten gerichtet, dass sie ein Ruder bilden. Die sorgfältig nachgebildete Stromlinienform ist allerdings durch seine Positionierung rückgängig gemacht worden: Damit seine Masse außerhalb des Beckens nicht auf dem Boden hin- und herrollt, hat man seinen Hals auf das Dach eines Güterwaggons gelegt, was den Pinguin (da der Waggon einen Maßstab von 1:22,5 hat) monströs und riesig erscheinen lässt, ihn aber auch unnatürlich und unaerodynamisch nach oben ausrichtet. Seine gemalten Augen schauen zur Decke des Gebäudes und suchen das Oberlicht. Dahinter ist die Luft frisch, und es weht eine leichte Brise. Höher, viel weiter oben haben zwei sich überlagernde Kondensstreifen ein Kreuz ins Blau geritzt – das Votum auf einem Wahlzettel, die Unterschrift eines Analphabeten, ein X zur Ortsmarkierung: Hier.
Buch Eins
1. Markies Verbrechen (Wiederholung)
Im dritten der vier Schulbusse, die sich durch die Camberwell New Road schieben, sitzt Markie Phocan. Die Busse bewegen sich im Verband, bilden eine Kolonne. Taxis, Lieferwagen, Doppeldecker, Müllwagen und ab und zu ein Lumpensammlerkarren versperren ihnen in loser Folge den Weg, wenden, parken oder setzen zurück und schaffen Lücken, durch die sie ihnen zwar nicht entkommen, aber doch ein paar Meter vorrücken können, bis sie dann wieder auf kompakte Strukturen aus unbeweglichen Stoßstangen und Auspuffrohren stoßen. Der Schauplatz liegt in der Wintersonne; wären die Busse neu oder sauber, würden sie glänzen; da sie weder noch sind, werden sie nur von einer Staub- und Dieselaura überzogen. Bei einem hat jemand mit den Fingern Fuck in den Dreck geschrieben; darunter hat jemand (vielleicht derselbe) Thatcher geschrieben; dieser Name ist durchgestrichen und durch GLC Commies ersetzt worden – was ebenfalls durchgestrichen worden ist, und jetzt steht da You.
Markie sitzt in der vierten Reihe am Fenster (Fahrerseite). Neben ihm sieht Nainesh Patel einen Stoß Fußballerbilder durch und zieht Karten zum Tauschen heraus. Auf der anderen Seite des Gangs legt Polly Gould den Kopf in den Nacken und lässt sich Space Dust auf die rausgestreckte Zunge rieseln. Hinter ihr beugt sich Trevor Scotter vor, schiebt die Hand horizontal in die Lotrechte zwischen Tütchen und Mund und kann das Rieseln lange genug unterbrechen, um etwas Brausepulver in der Handfläche zu erwischen. Polly fährt herum, aber als sie ihn ansieht, ist ihre Empörung schon halb verflogen. Was soll sie auch machen? Sie dürfen keine Süßigkeiten dabeihaben. Trevor wirft sich das Pulver in den Mund und grinst sie an. Dann sieht er zur Seite, Polly und er sehen Vicky Staples Kopf, er fährt ihr mit der Hand über das krause Haar und hinterlässt einen Fallout aus Zucker und Zusatzstoffen. Polly und er lachen.
»Die hat ja rosa Schuppen …«
Vicky starrt durch ihre dicke Kassenbrille die Rücklehne des Sitzes vor ihr an und sagt nichts. Papierschwalben und ‑kügelchen schwirren durch die laute Luft. Ganz vorn auf der Türseite sitzt Miss Sedge teilnahmslos und mit hängenden Schultern. Niemand wird verletzt. Jetzt zuckeln sie um The Oval herum. Über der Mauer kann Markie die Anzeigetafel und die obersten Reihen der oberen Tribüne erkennen; hinter dem Stadiongelände und dieses überragend dann die Gasometer. Der größte davon ist heute zu etwa zwei Dritteln voll, und der konvexe Meniskus seiner grünen Kuppel geht in ineinander verschränkte Rauten über. Der Heißluftballon schwebt über den Vauxhall Gardens Richtung Norden zu den Gasometern, und die Seile unter ihm konvergieren zum hauchdünn wirkenden Korb hin. Als der Bus die Kurve zur Harleyford Road nimmt, duckt sich Markie, verdreht den Kopf und kann durch die Windschutzscheibe den Fesselballon sehen, bis er an deren oberem Rand außer Sicht verschwindet. Das Aluminium der Busschale, hinter dem der Ballon verschwindet, ist dünn und lichtdurchlässig; das Licht der jetzt schräg vor ihnen stehenden Sonne durchdringt es und konturiert die aufgeprägten Buchstaben SCHOOL BUS, nur dass die Mitfahrenden sie spiegelverkehrt sehen: SUB LOOHCS. Darunter erscheinen dieselben Buchstaben, kleiner und genauso spiegelverkehrt, diesmal aber als Spiegelung vom Vordergehäuse des ihnen folgenden Busses im Rückspiegel des Fahrers: SUB LOOHCS. Für Markie sind das echte Wörter einer hybriden Sprache, deren Wortschatz und Grammatik er bestenfalls erahnt; verdoppelt präsentieren sie ihm eine Überschrift und einen Untertitel, die dieselbe kryptische Anweisung wiederholen: sub loohcs – schau unten …
Die letzten beiden Busse sind mitten auf der Kreuzung von Vauxhall Cross stecken geblieben, blau-weiße Insekten im gelben Netz, ihre alten Karosserien erschauern, während PKWs sich hupend an ihnen vorbeischlängeln. Der Fahrer von Markies Bus stützt sich gleichgültig auf sein übergroßes Lenkrad, pult in den Zähnen und ignoriert die Rufe und Stinkefinger anderer Autofahrer. Als Nainesh »Heighway … Shilton … Coppell« murmelt, springt die Ampel endlich auf Grün. Markie fragt sich, ob es zwischen den beiden Ereignissen, der Beschwörung der Spielernamen und der Freilassung der Busse einen Zusammenhang gibt; ob Nainesh die Lösung des Bannspruchs verursacht hat. Ein letzter langer Hupton klingt hinter ihnen ab, als sie sich in Bewegung setzen und auf die Vauxhall Bridge zubrausen. Neben dem Bus liegt auf der rechten Seite eine riesige Baugrube, notdürftig von Stöcken und Vermessungsband eingezäunt. Nainesh sieht von seinen Karten hoch, zeigt auf die Baulücke und verkündet: »Das wird eine geheime Zentrale für Spione.«
»Woher weißt du das?«, fragt Trevor.
»Hat mein Vater gesagt.«
»Wenn’s geheim ist, woher weiß er das dann?«
»Weiß er eben«, nuschelt Nainesh und vertieft sich wieder in seine Karten.
Polly legt den Kopf in den Nacken und krümelt sich die nächste Ladung in den Mund. Auf dem Platz vor ihr starrt Bea Folco, das Stirnband an der rechten Schläfe verknotet, aus ihrem Fenster. Es gibt weder einen Rückspiegel noch eine andere spiegelnde Fläche, die Bea ihm und ihn ihr zeigen würde, aber trotzdem spürt Markie eine Symmetrie – beide wenden oder drehen sie sich vom gewölbten Rückgrat der Brücke nach außen, er nach Osten, sie nach Westen – was sie irgendwie verbindet. Auf seiner Seite überprüfen Löschboote der Lambeth River Fire Station auf der Themse ihre Löschkanonen. Die Wasserstrahlen schießen an den Düsen kräftig und hart hoch, kurven auf ihre Scheitelpunkte zu und verformen sich zu einer Reihe flüssiger Haken, von denen ein Nebelschleier mit kleinen Regenbogenintarsien herabhängt. Schießen die Salut für sie? Für die vierbussige Prozession der Lyndhurst Primary? Auch mit zehn Jahren weiß Markie, dass das nicht sein kann, dass das Tun und Treiben der Welt auch dann weitergeht, wenn er in Klassenzimmern festsitzt; dass dieser verstohlene Blick in ihr Wochentagsgetriebe etwas Besonderes und Ungewöhnliches ist – fast unzulässig, als würde er es ausspionieren: In eine Sperrzone eingebettet, kundschaftet er die Gebäude und den Verkehr aus, die Uferdämme und heruntergekommenen Lastkähne, Hochhäuser, Kräne, Kirchtürme und durch den Dunst das Parlament weiter unten am Fluss; dann schickt er (wem?) supergeheime, in Spiegelschrift erstellte oder gleich telepathisch übermittelte Berichte …
Ohne Vorwarnung übergibt sich Polly. Erst reihert sie zwischen den Beinen auf den Boden, dann dreht sie sich beiseite, selbst angeekelt von dem, was sie da hochgewürgt hat, und kotzt in den Gang. Das löst Kreischen und raues Lachen aus, Beine werden hastig an Brüste gezogen, alle Körper werden aus dem Mittelpunkt des Geschehens evakuiert, und gleichzeitig kommt es von den Plätzen an der Peripherie zur gegenläufigen Bewegung, einer Welle neugierigen Vordringens. Miss Sedge kommt – etwas zu energiegeladen, so dass ihre kniehohen Lederstiefel fast in dem Erbrochenen ausrutschen, das grellrosa ist und noch knistert und poppt, wie von den Herstellern vorgesehen, weil die ausgespienen enzymatischen Säfte die in den schmelzenden Flöckchen gespeicherte Kohlensäure freisetzen.
»Sie hat Pop Rocks gelutscht, Miss«, sagt Vicky.
Miss Sedge stellt die Füße an die Küsten des Kotzesees, beugt sich vor und winscht Polly von ihrem Platz hoch. Als das Mädchen nach vorne abgeführt wird, dreht es sich um und schreit die Verräterin an:
»Vieräugige Fotze!«
Den Rest der Fahrt ändert der See mit den Busbewegungen die Form, bringt Tümpel und Kanäle hervor, Flussbögen, Gabeln und Abzweigungen. Trevor gibt den Klassenclown, klemmt den Arm zwischen zwei Rückenlehnen und lässt sich darüber hängen; als der Bus von der Brücke scharf nach rechts in die Millbank abbiegt, verliert er das Gleichgewicht und rutscht aus – oder gehört das noch zu seiner Show? Das bleibt offen, denn Miss Sedge kommt zurück, führt auch ihn ab, scheuert ihm mit beiden Seiten ihrer freien Hand ein paar und verfrachtet ihn in die erste Reihe neben Polly und sich. Als er sich zur Schlussverbeugung mit glühenden Wangen zu seinen Klassenkameraden umdreht, grinst er Markie an, der seinem Blick ausweicht. Das Erbrochene riecht jetzt stechender; die Kinder halten sich mit Schals und Kragen die Nasen zu. Markie klemmt seine durch Umkrempeln an den Manschetten zum Ball verbundenen Handschuhe zwischen das Gesicht und die Fensterscheibe und sucht in ihrer Weichheit und ihrem süßlichen Gegengeruch einen Passepartout, der die Flucht aus dem Bus ermöglicht und ihn ins Freie zaubert, wo er mit der reinigenden Gischt und dem dem Licht abgerungenen Spektrum verschmelzen kann …
Sie sind da. Die Busse biegen in die Parkbucht ein, je zwei auf beiden Seiten des Mr.-Whippy-Eisverkäufers, der die Mitte blockiert. In Markies Bus gibt es einen Ansturm auf die Ausgänge, die geschlossen bleiben, bis Miss Sedge ihre Anweisungen zur Aufstellung im Freien gerufen hat. Als sich die Türen endlich auffalten, purzeln die Kinder auf den Asphalt und holen Luft wie an die Oberfläche kommende Freitaucher. Von hoch oben starrt die mit Flagge und Dreizack bewaffnete und von Löwe und Einhorn flankierte Britannia vom Steinportikus der Tate wie eine missbilligende Schulleiterin auf sie herab. Die Anordnungen werden ignoriert, die Busladungen mischen sich und bringen sich auf den neusten Stand: Auch Cudjo Sani im vordersten Bus hat sich übergeben; Jason Banner aus dem zweiten hat von einer Prügelei eine blutende Schramme an der Wange … Einige Kinder schleichen in den Park davon; andere hüpfen die Museumstreppe auf und ab. Auf dieser Treppe treiben die Lehrer sie wieder zu Klassengruppen zusammen: vier schräge Kolonnen, die an den vertikalen Säulen der Tate vorbeigeführt werden – nur um am Engpass der Drehtür wieder zu zerbröckeln. Dahinter bildet das Marmoratrium eine Echokammer, die das Geschrei und Gepfeif zu einer unerträglichen Kakophonie vervielfältigt; alle vier Klassenlehrer versuchen, den Lärm durch eigenes Brüllen unter Kontrolle zu bringen, und verschlimmern ihn nur. Ein Wachmann der Tate, dessen stämmige Figur und Haltung ihn als Ex-Militär ausweisen, schaltet sich ein und lässt eine tiefe Bassstimme von der Leine, die die Kinder weniger aus Gehorsam als aus Neugier verstummen lässt: Sie scheint aus den quirlständigen Tiefen des Treppenhauses zu dringen, in dem das zweifarbige Bodenmosaik verschwindet. Als er ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weist er sie an, ihre Mäntel im Gruppenbereich der Garderobe aufzuhängen, überwacht die Durchführung seiner Anweisung, und Erinnerungen an Kantineninspektionen gehen ihm durch den Kopf, während sich Arme aus Anoraks und Dufflecoats winden.
Markie hängt seinen Mantel an einen Haken, behält die Handschuhe aber. Er hält sie sich wieder vor die Nase, und als er verfolgt, wie Bea ihren Parka auf den Boden fallen lässt und heraussteigt (der Reißverschluss hat sich verklemmt), hat er dasselbe Gefühl der Überlagerung wie im Klassenzimmer, wenn Miss Sedge auf dem Overhead-Projektor zwei Plastikfolien übereinanderlegt, um an der Wand ein Bild zu erzeugen, das sich auf den einzelnen Folien nicht finden lässt. Einen Augenblick lang ist er halb im Nebenraum der Tate und halb in den Umkleidekabinen der Peckham Baths – an beiden Orten gleichzeitig und an keinem ganz. Ausgelöst wird das nicht nur von der Busfahrt und dem Jackenausziehen und auch nicht davon, dass an den Wänden dieselben eisernen Kleiderhaken angebracht sind. Nein, die gedankliche Verknüpfung ist an etwas Spezielleres gekoppelt: an einen Nachmittag vor gut zwei Wochen; Markie bildete wie heute ein Paar mit Nainesh, sie teilten sich eine Kabine, zogen Socken und Hosen aus – und erkannten an den Stimmen, die von der dünnen Metalltrennwand zur Nachbarkabine kaum gedämpft wurden, dass sich nebenan Bea und Emma Dalton umzogen.
Beide Jungen begriffen das im selben Augenblick; beide verstummten plötzlich; ihre Blicke huschten über die zerschrundene Trennwand, die viel zu hoch war, um darüber hinwegzuspähen – aber (verständigten sie sich mit den Augen) unten … unten endete sie in Schienbeinhöhe, und darunter blieb eine schmale Lücke. Nainesh grinste, kniete sich leise auf den Boden und bedeutete Markie: Hier, komm her … Sie mussten die Wangen auf die Quarzgranitplatten drücken, um den richtigen Blickwinkel zu bekommen: Von dort schob sich um den unteren Metallbeschlag herum der verborgene Raum in Sicht; und als schauten sie in einer so erhabenen Säulenhalle wie der der Tate empor, sahen sie zwei nackte Beinpaare, die wie die Stämme von Redwood-Bäumen über ihnen emporragten, wobei die Parallelen ihnen perspektivische Streiche spielten und sich zu Schenkeln verjüngten und weiteten, bevor sie sich schnitten, was im Unendlichen hätte geschehen sollen, in Wahrheit aber nicht mal einen Meter weit weg war, sie konvergierten zu laublosen hüfthohen Baldachinen, Verbindungen, die Falten bildeten, die andere Falten in Klammern setzten, und alle Fleischlinien bewegten sich seltsam synchron, denn Bea und Emma ahnten nichts von den ihnen geltenden widernatürlichen Blicken von unten, marschierten auf der Stelle und sangen die Arie, die sie für das bevorstehende Schulkonzert einstudierten:
Auf in den Kampf, Torero! Stolz in der Brust, siegesbewusst, Wenn auch Gefahren dräun, Sei wohl bedacht, dass ein Aug dich bewacht Und süße Liebe dir lacht. Sei wohl bedacht, dass süße Lieb’ dir lacht.
Durch den spitzen Winkel konnte Markie Beas Gesicht nicht sehen; Emmas genauso wenig – aber Bea stand ihm am nächsten, und Bea ist in den seitdem vergangenen fünfzehn Tagen das optische Vexierbild zugewachsen: Wie bringt er die beiden Bilder in Einklang? Die zwei Winkel, die zwei Ansichten – Rumpf und Gesicht – zwei Teile eines Ganzen, dessen Ganzheit er so gern an sich drücken würde, an dem er sich festhalten und in dem er versinken möchte; aber …
Sie werden einer Tate-Guide für Schülergruppen übergeben. Die zierliche Frau in den Zwanzigern erzählt den Kindern alles über Joan Miró.
»Miró«, trillert sie mit einer Stimme, in der keine echte Begeisterung liegt, sondern die begeistern soll, wie Markie sofort merkt, »hat mit dem Malen angefangen, als er ungefähr in eurem Alter war. Er liebte die Formen und Farben seiner Heimatstadt Barcelona, die hell, geschwungen und einfach voller Leben waren. Er liebte diese Formen und Farben so sehr«, fährt sie fort, »dass er sie sein ganzes Leben in sich gehabt hat. Auch wenn er jetzt ein alter Mann ist und einer der berühmtesten lebenden Künstler der ganzen Welt, malt er immer noch mit der Phantasie und dem Vorstellungsvermögen eines Kindes – und deshalb sind wir immer besonders glücklich, wenn Kinder wie ihr kommen und seine Werke sehen wollen. Ich gebe euch jetzt diese …«
Arbeitsblätter werden ausgeteilt. Es gibt Kästchen, die angekreuzt werden sollen; desgleichen Symbole (Sonne, Mond, Frau); dann Fragen dazu, was für Gefühle die Bilder in den Kindern auslösen; ein Kästchen, in das sie ihre eigenen hellen und geschwungenen Bilder zeichnen können; und so weiter. Trevor dreht seines zu einem Rohr zusammen und zieht es Jo Fife über den Kopf; Vicky hat Angst, ihres könne Eselsohren bekommen. Sie bekommen eingeschärft, die Kunstwerke nicht zu berühren und nicht zu nah an sie heranzutreten. Dann werden sie durch zwei weitere Säulengänge und das gebohnerte Mausoleum der Innenhalle des Gebäudes zu den Seitengalerien geführt. Dort angekommen, verteilen sie sich in die angrenzenden Räume, laufen im Zickzack von Wand zu Wand und spielen ›Ich sehe was, was du nicht siehst‹; stehen in Zweier- und Dreiergrüppchen zusammen, vergleichen Notizen und Vorankommen; drängeln auf Bänken oder setzen sich im Schneidersitz auf den Boden, um Bildtitel abzuschreiben. Markie zottelt an Galgenmännchen, hingekrakelten Sternen und sympathisch unvollkommenen Kreisen vorbei, welligen Harlekinen, hängenden Pendeln aus Köpfen und Gliedern, an Drachen und Sonnen (die hakt er ab) und einem Leiterspiel, das das Spielbrett verlassen hat, um ein Haus zu übernehmen – auf- und abwärts, diagonal, den ganzen Raum –, Katzen, Fische und Springteufel beteiligen sich, und aus dem Spielwürfel, der sich zu einer quaderförmigen Larve verpuppt hat, schlüpft eine Libelle, eine Hornisse oder sonst ein deformiertes Insekt. Jedes Mal, wenn er vor einem Bild stehenbleibt, hält er sich den Handschuhball vors Gesicht, atmet seine verdichtete Weichheit ein und lässt das Bild auf sich wirken. Auch der Handschuhball ist deformiert und streng genommen kein Ball – zumindest keine regelmäßige Kugel –, sondern langgezogen und mit Fingertentakeln, deren Futter ebenfalls nach außen gestülpt ist und die aus dem Zentrum herausragen, ein gebrechlicher selbstgemachter Kuschelkalmar oder Oktopus …
Im dritten oder vierten Saal bleibt er am längsten. Die Schulkindstreuung ist inzwischen deutlich ausgedünnt; Markie findet sich allein vor einem großen Gemälde. Es zeigt eine irgendwie kegelförmige Figur, die an einem Strand steht und einen Stein auf einen aus Grundformen zusammengesetzten Vogel wirft. Die Figur hat einen einzigen großen Fuß, auf dem sie sich zu wiegen scheint; der Vogel ist ein punkiger Schock aus roten Haaren, ein Hahnenkamm. Das Gesicht der Figur hat keine Züge bis auf ein eidottergelbes Auge mit rotgesprenkelter, schwarzgetüpfelter Pupille; auch der Vogelkopf besteht aus nichts als einem blauen Kreis mit schwarzen Punkten für Auge und Nase. Und er hat eine Mondsichel als Schwanz. Auch der Stein zwischen Figur und Vogel ist eine Art Mond: blatternnarbig, halb im Schatten und halb in blassgraues Licht getaucht. Die Figur wirft ihn auf den Vogel mittels eines dünnen schwarzen Strahls, der ihm als Arm dient und sich um einen schwarzen Punktnabel dreht: Die Figur lehnt sich auf ihrem geschwollenen Fuß nach hinten, und der Strahl scheint zu rotieren oder wie ein Katapult gespannt zu werden, um den Stein auf den Vogel zu schleudern. Es gibt sogar eine gestrichelte Linie, die seine Flugbahn zu diesem zeigt wie die Konturlinie auf dem Schnittmuster einer Schneiderin. Das selbst in dieser Konstellation Seltsame ist, dass nicht nur der Stein auf den Vogel zuschießt; auch der Vogel scheint absichtlich auf den Stein zuzufliegen und den Kopf zu recken, um ihn mitten im Flug zu treffen. Um dieses Drama herum dehnt sich der Strand, leer und gelb wie das Eidotterauge des Werfers. Das Meer hinter dem Strand ist schwarz und zeigt weder Boote noch Badende oder auch nur Wellen und Dünung, Licht- und Schattenflecken oder sonst irgendetwas, das die Eigenschaften von Wasser vermitteln würde. Es will gar kein Meer repräsentieren – ist nur schwarz deckende Ölfarbe aus der Tube, die unvermischt und unverdünnt als horizontaler Streifen in der Leinwandmitte aufgetragen worden ist. Darüber und über dem Strand, über dem Jungen, dem Vogel und dem Stein, entlädt sich eine Lasurmasse aus dunkelgrünen Wolken, wabert wütend, entfaltet sich an den Säumen und mischt sich mit noch mehr Dunkelheit.
Warum bleibt Markie vor diesem Bild so lange stehen? Es hat jede Menge »Ich sehe was …«-Motive zu bieten (zwei Monde), die er aber nicht abhakt. Es hat etwas mehr als Seltsames, etwas stimmt da nicht, etwas ist da – selbst nach den Spielregeln der gemalten Welt, in die er hier eindringt – falsch. Es hat damit zu tun, dass der Vogel auf den Stein zu- und nicht vor ihm wegfliegt. Mit seinem rot flackernden Hahnenkamm und dem strammen Kreissegmentflügel scheint er aus einem Unterholz oder einer Heidelandschaft außerhalb des unteren Bildrands zu springen, jubelnd dem Stein entgegenzusteigen und die Kollision richtig zu wollen. Der ganze Raum scheint es zu wollen. Das Ganze hat eine Unausweichlichkeit; alle Richtungen und Räume der Szene, all ihre Bereiche, Steigungen und Verlaufslinien scheinen vorgezeichnet – Linien und Winkel, Punkte und Nähte. Aber nicht nur das ist falsch: Da ist noch mehr … Am Strand, an dem kargen und nichtssagenden Strand, an der vorspringenden Küstenlinie, wo Gelb auf Schwarz trifft, sind zwei dorn- oder flossenförmige Sandpunkte rotgetüpfelt (genau wie das Punktauge des Werfers) – also blutbetropft. Und das muss heißen, dass die Steinigung des Vogels, das vom Bild gezeigte Ereignis, schon stattgefunden hat – was es nicht hat: Es geht ihr voraus, ist der Augenblick unmittelbar vor … Das ist falsch – so falsch, dass Markie das Gefühl hat, er müsse seine Füße nachdrücklicher in die Dielen stemmen, um sich selbst seinen stabilen Stand, seine Bodenhaftung zu beweisen. Er versucht es sich so zu erklären, dass die Kegelfigur vielleicht schon einen anderen Vogel gesteinigt hat, bevor sich der Vorhang zu dieser Szene gehoben hat; vielleicht ist das ein Massenvogelmörder, der einen Vogel nach dem anderen kaltmacht, klonk klonk klonk, den ganzen Tag lang; vielleicht gehört er zu einer Vogeljagdgesellschaft, deren andere Mitglieder wir nicht zu sehen bekommen … Aber noch während Markie sich diese Erklärungen zusammenreimt, weiß er, dass sie nicht stichhaltig sind: Im Universum dieses Bildes gibt es nur einen Vogel und nur eine Person – sonst nichts. Sie sind sein Universum, in himmlischem Grauen aneinandergefesselt, die gelbe, lidlose und schwarzzentrige Sonne im Gesicht des Werfers ist die einzige Lichtquelle, verdammt zum unverwandten Starren und zum dauerhaft rotfleckigen Leuchten über dem eigenen Verbrechen …
»He! Phocan!«
Trevor ist im Saal aufgetaucht. Ist er gerade hereingehuscht oder schon länger da? Auch er hat das Bild anscheinend auf sich wirken lassen, und auch er ist offenbar gebannt von ihm, wenn auch auf andere Weise. Er schaut zwischen Markie und dem Bild hin und her und grinst heimtückisch, aber auch konspirativ. Befreundet sind die beiden nicht, aber ähnlich wie bei Nainesh in der Umkleidekabine ist Trevor das Wissen um eine Gemeinsamkeit anzusehen, als würde er einen Mitverschwörer wittern. Er steht ein paar Schritte links von Markie – hockt, genauer gesagt, Kopf und Schultern auf Hüfthöhe gesenkt und einen Fuß nach hinten gestreckt: unter Spannung stehend, kann er jede Sekunde auf und nach vorn schnellen. Er sieht den Vogel an, dann den Stein, dann den Handschuhball in Markies rechter Hand.
Markie weiß so genau, was Trevor will, als könnte er Gedanken lesen. Es ist weder Mutwille noch der Wunsch nach einem Regelverstoß, der ihn jetzt den rechten Arm strecken lässt; es liegt rein an ihren Haltungen, Entfernungen, Beziehungen … Er befolgt das in die Leinwandtafel eingeritzte Gebot. Er zieht den Bauch ein, spürt, wie sein Nabel zu einem Wirbel dunkler Energie wird, holt mit dem gestreckten rechten Arm über dem Kopf aus, lehnt sich auf seinem plötzlich riesig wirkenden Absatz erst zurück und schwingt dann mit aller Kraft nach vorn, dreht den Arm im Gelenk, und seine Hand fährt in einem gestrichelten Bogen herab, dessen geometrische Regelmäßigkeit ihm kein Pinsel demonstrieren muss; die flache Parabel wird in die Luft geschrieben, der Flug des Handschuhballs, den die Hand loslässt und der jetzt durch den leeren Raum der Galerie schießt, um Trevors Kopf zu treffen – der ihm gespannt entgegensegelt, denn Trevors Beine haben seinen Körper auf einen kurzen Flug geschickt …
Klonk. Der Zusammenprall ist weicher, filziger als der von Vogel und Stein. Und Trevor stirbt nicht: Er lässt sich fallen, die Füße kommen nicht im Gleichtakt auf, und auf reizlose, unästhetische Weise kommt der Rumpf über ihnen zur Ruhe. Er reckt die Fäuste, um ein imaginäres Kopfballtor zu feiern – aber um ihn geht es nicht mehr: Er hat seine Rolle gespielt; Trevors Körper und seine ganze Existenz können jetzt zurückbleiben wie verbrauchte Treibstofftanks. Jetzt geht es nur noch um den Handschuhball, der eine Kursänderung und eine jähe Beschleunigung erfahren hat: Der Kontakt mit Trevors Kopf hat ihn fortkatapultiert – nicht zu Markie zurück, sondern auf eine neue, dritte Ebene; die Ebene, die es auf einem Bild nur in illusionärer oder perspektivischer Form gibt, die in einem Raum, einem so realen Raum wie dieser Galerie, aber da ist, ausgedehnt, leicht, staubig und passierbar. Kurz gesagt: Der Ball fliegt durch die Luft auf das Bild zu. Einen nur Sekundenbruchteile langen Zeitraum, aber Markie kann später von den verschiedensten Punkten aus in ihn eindringen und ihn noch einmal abspielen; er schaut ihm nach, steht erstarrt da (der rechte Arm und die Schulter hängen vom Durchschwung des Wurfs herab) und stürzt gleichzeitig mit dem Flugkörper vor, direkt in die Wolken mit ihrem zornigen schwarzgesäumten Grün …
Dann trifft der Handschuhball mit dem nächsten Klonk – das laut durch die Galerie hallt – die Leinwand. Er trifft sie hoch oben in der Mitte, oberhalb und rechts vom Flugkörper auf dem Bild, in der Nähe des Scheitelpunkts des Armstrahls. Verharrt er dort wirklich einen Moment lang, oder ist das nur eine Netzhautverzögerung? Markie hat das Gefühl, ihn mehrere Sekunden lang an der gemalten Fläche haften zu sehen. Figur, Vogel, Stein, Strand, Himmel und Meer erschauern, sind in ihrer aus dem Lot gebrachten Welt verunsichert. Langsam und quasi lustlos löst sich der Handschuhball dann und fällt ebenfalls erschöpft zu Boden. Dann nichts: Absoluter Stillstand – im Werk, im Raum, überall und in allem. Wie eine Art Vakuum. Markie hat ein schwummeriges Gefühl in den Ohren; im Raum zwischen ihnen herrscht diese laute Abwesenheit von Geräuschen, die Schwindelgefühle erzeugt, eine Ausdehnung des Schädels, die kein Gerät messen kann. Von allen Objekten und allen Flächen – Vogel und Figur, Rahmen und Wand, Lampen und Türschwellen, Bänken, Ausgangsmarkierungen und Luft – ertönt dann ringsum der Alarm, schießt herab, bauscht sich, rast auf ihn zu und nimmt anklagend und selbstgerecht ihn allein aufs Korn (Trevor hat sich sofort verdrückt).
Einiges geht sehr schnell. Mit verschwimmenden Gliedmaßen und Gesichtern erscheinen um ihn herum hektische Erwachsene: Irgendwo sind da Miss Sedges Lederstiefel, aber auch Museumswärtermützen und ‑jacken, scharenweise klappen wütende Münder in seine Richtung auf und zu, Wörter sind in den elektronischen Heultönen aber nicht zu verstehen, und Hände packen ihn an den Armen. Markie macht keine Anstalten, weicht ihnen nicht aus. Seit der Alarm losgegangen ist, hat er sich überhaupt nicht bewegt. Auch Kinder drängeln herein, wieseln herbei, wollen die Ergreifung nicht verpassen, genießen, wie er auf frischer Tat ertappt wird, sichern sich die besten Plätze für die Urteilsfindung des pantomimischen Scheingerichts und sind gespannt, ob sich vor ihren Augen eine rituelle Bestrafung oder ein Opfer abspielen wird. Sie werden aber enttäuscht. Markie wird von einem Wärter aus der Galerie geführt, der das Meer der Schaulustigen mit gebieterischer Geste teilt; wird durch eine Seitentür mit der Aufschrift Zutritt nur für Mitarbeiter geführt, durch eine Brandschutztür und einen Korridor mit ungefliestem Betonboden entlang; durch einen muffigen Umkleideraum, in dem Straßenbekleidung hängt, und schließlich eine nicht sehr stabil wirkende Metalltreppe hoch in eine Kammer, in der zwei weitere Wärter – einer weiß, einer schwarz – vor einer Konsole sitzen.
Hier lässt der Wärter Markies Arm endlich los – und der Junge fängt an zu zittern. Die sitzenden Wärter mustern ihn ein paar Sekunden lang; dann wendet sich der weiße mit demonstrativem Desinteresse ab und fragt:
»Wo ist seine Mutter?«
»Er gehört zu einer Schulklasse«, antwortet der Wärter.
»Dann eben Lehrerin.«
Der Wärter geht. Der weiße Wärter wendet sich wieder seiner Konsole zu, einer Reihe von Überwachungsmonitoren, unter denen ein Schaltpult ist. Der schwarze betrachtet Markie weiter. Er ist älter, hat einen stämmigen Körperbau und wie elektrisch geladen abstehende Haare, die an den Schläfen grau werden. Nach einer Weile murmelt er:
»Vielleicht will der was trinken.«
Der weiße Wärter wirft erst Markie und dann seinem Kollegen einen flüchtigen Blick zu, dem dieser ausdruckslos standhält. Sie sehen sich ein paar Sekunden lang an, dann schnalzt der Weiße gereizt mit der Zunge, steht auf und verlässt die Kammer. Der Blick des Schwarzen schweift geruhsam zum Jungen zurück. Ein herrischer Blick – aber auch beruhigend: Nach einiger Zeit merkt Markie, dass er nicht mehr zittert.
»Willste die Wiederholung sehen?«
Der Mann hat eine tiefe und ruhige Stimme: derselbe karibische Bass, den Markie von den Brixtoner Marktständen und Gewürzbuden kennt, von den Rastas, die mit ihren Strickmützen an offenen Taxitüren und Cafétresen zusammenstehen. Endlich verstummt die Alarmsirene, die ihn die ganze Zeit aus der Galerie bis in die Kammer hier verfolgt hat.
»Willste sie sehen oder nicht?«
Markie weiß nicht genau, was der Mann meint. Er steht bloß da und gafft ihn an.
»Komm her.«
Er winkt ihn zu sich. Markie gehorcht. Der Erwachsene deutet auf eine Stelle neben seinem Sitz, von der aus der Junge die Monitore sehen kann. Es gibt neun davon, drei Reihen mit jeweils drei Bildschirmen: normale kleine Schwarzweißfernseher, wie sie auch in den Schaufenstern von Elektronikläden stehen könnten – nur bekommen abwägende Konsumenten hier nicht ein ganzes Sortiment verschiedener Modelle verschiedener Hersteller vorgestellt, sondern alle Geräte sind absolut identisch: abgespeckte Monitore in grauen Gehäusen mit zwei schwarzen Drehknöpfen und ohne schmückendes Beiwerk wie Sendermarkierungen. Auf den ersten Blick zeigen alle dasselbe Bild: einen ruhigen Saal aus Deckenperspektive mit etwas schiefen Winkeln. Das ist aber eine von der Gleichförmigkeit der Maßstäbe und Umgebungen erzeugte Illusion: Nach und nach merkt Markie, dass es in manchen Sälen Bänke gibt und in anderen nicht; bei einigen liegen die Ein- und Ausgänge auf den Monitoren links, bei anderen rechts oder oben oder sie haben keine; in einigen Sälen sind einzelne Leute, in anderen niemand, in dritten herrscht ein Gewimmel. Die Menschen gehen seltsam: mit normaler Geschwindigkeit, aber irgendwie mit so unpräzisen wie flüssigen Bewegungen, als wären die Säle Aquarien, und sie würden sich unter Wasser bewegen. Seit der Durchquerung der Personal- und Brandschutztüren hat Markie den Eindruck, in einem Backstage-Bereich zu sein, mitten unter den Bühnenbildern und Requisiten nicht nur des Museums, sondern irgendwie der Gesamterfahrung, die er hier und heute machen sollte. Diese Übersicht jetzt – vielfältig, in Waben unterteilt, deren Bewohner einander nicht sehen können, in die er aber wie eine unbeachtete Britannia hinunter- oder hinaufsehen kann oder auch beides – verstärkt diesen Eindruck. Es ist, als würde er eine andere Welt sehen – eine andere Welt, die aber noch erkennbar diese ist. Auf drei Monitoren wuseln Kinder herum; auf dem einen ist Polly zu sehen; auf einem anderen kann er Nainesh erkennen, Vicky … da ist Miss Sedge … und da ist auch Trevor, der steht für sich, macht sich mit seinem Arbeitsblatt zu schaffen, linst ab und zu zur Kamera hoch und fragt sich wahrscheinlich, ob die ihm schon auf die Schliche gekommen ist …
Der Wärter drückt auf einen Knopf auf seiner Konsole; auf einem Monitor friert das Bild ein, taut wieder auf, und Linien flackern und zucken über die Mattscheibe. Der Mann erzeugt diesen Effekt durch Betätigung eines Hebels, eines kleinen Joysticks; als sein Daumen den Hebel loslässt, hört das Zucken auf – und Markie sieht einen kleinen Jungen, den die ineinandergekrempelten Handschuhe in der rechten Hand und die Position vor einem entfärbten Bild mit Figur, Vogel und Landschaft eindeutig als ihn identifizieren.
»Aber wie …?«, setzt er an.
Der Wärter hält den Joystick an, zieht eine Augenbraue hoch und bedeutet ihm so, die Frage abzuschließen.
»Ich meine …«, setzt Markie wieder an, »ich bin doch hier.«
Jetzt lächelt der Wärter zum ersten Mal.
»Ich hab doch gesagt, wir schauen uns die Aufzeichnung an«, erklärt er Markie. »Schau.«
Sein Daumen drückt den Joystick leicht nach rechts. Der Junge auf dem ausgewählten Monitor tut nichts. Geraume Zeit steht er einfach nur da. Der Wärter drückt den Joystick etwas weiter nach rechts und zerhackt das Bild wieder in zuckende Linien; dann lässt er ihn los, als eine veränderte Textur der Zeilen die Anwesenheit einer zweiten Person verrät, die links von dem Jungen ins Bild kommt.
»Und jetzt geht die Post ab«, murmelt der Wärter.
Wieder unzerhackt, wandert der gestreckte Arm des identisch-anderen Markies zurück und vor, und der Handschuhball fliegt zum aufsteigenden Kopf des identisch-anderen Trevors und von dort auf die Leinwand, alles mit denselben disloziert-fließenden Bewegungen wie alles auf diesen Monitoren. Der Wärter nickt bedächtig. Als er sein Gesicht wieder Markie zuwendet, ist ihm die Anerkennung deutlich anzusehen.
»Action vom Feinsten«, sagt er. Er spricht es Eck-schann aus. »Und jetzt in Slow Motion«. Wieder: Mou-schann.
Wieder Joystickdrücken, wieder Zucken, dann steht der Junge wieder teilnahmslos in der Galerie. Diesmal wandert sein Arm in inkrementellen Einzelschritten zurück, deren konstitutive Einheiten aus einer Position in die nächste morphen und ihren Ort zu erreichen scheinen, bevor das Bild jeder neuen Position aufgebaut worden ist – und kaum ist es da, rutscht es schon wieder zur nächsten Position weiter, was darauf hinausläuft, dass der Arm in jedem gegebenen Einzelmoment mindestens zwei Phasen des Bewegungsablaufs simultan einzunehmen scheint.
»Charlie Griffith in seinen besten Jahren«, sagt der Wärter andächtig. »Offene Schultern, Beine fest auf dem Boden, Kopf gesenkt …«
Markie weiß nicht, wovon er redet. Auf einem anderen Monitor redet ein anderer Wärter, vielleicht der, der ihn in die Kammer hier gebracht hat, mit Miss Sedge, und dann gleiten beide in diskontinuierlichen Bewegungen aus dem Bildschirmbereich. Der Wärter neben ihm spielt noch einmal die Wurfszene und stellt direkt nach dem Loslassen auf Pause, als wollte er Markies Haltung mit der Figur auf dem Gemälde vergleichen, das immer noch den Hintergrund abgibt. Markies Blick wird aber von einer Szene abgelenkt, die sich auf dem linken Monitor in der unteren Reihe abspielt. Auf dem Parkett einer bis auf sie leeren Galerie steht eine einzelne Person: ein Mädchen. Ihr Gesicht ist von der Kamera abgewandt, aber er erkennt Bea am Stirnband. Nicht nur am Stirnband: Als sie jetzt losgeht, von der Kamera weg auf ihren Bildschirmrand und den Rand der ganzen Bildschirmreihe zu, übermittelt etwas in ihren Bewegungen trotz der aquariumsartigen Verlangsamung Markie eine Botschaft – so klar, dass er sie fast für Absicht hält – einen Ruf. Dabei sind die Monitore stumm. In der Kammer ist es still. Der karibische Wärter ergeht sich inzwischen in Erinnerungen an Drehballwerfer in Bridgetown. Miss Sedge und der weiße Wärter sind auch fort, in einem Korridor verlorengegangen, in irgendeinem Zwischenraum. Alles passiert und passiert nicht in Graustufen, hier und anderswo, und löst sich auf.
2. Aufliegten Höhe
Das Erste, was Dossier C16 im Archiv des Instituts für Arbeitspsychologie hervorwürgt, nachdem es von keiner Schnur mehr zusammengehalten wird – das Erste, was aus dem Pappschuber herausgleitet und mit der Bildseite nach oben auf dem Tisch liegt, den man Monica Dean hier in der hellerleuchteten Bibliothek der London School of Economics zugewiesen hat –, ist eine Photographie von Frauen, die unter großen Pflanzen arbeiten. Sie strecken sich nach Früchten, schneiden sie mit Gartenscheren ab, bücken sich und legen sie in große Körbe. Die Pflanzen (Hopfen oder riesige Feuerbohnen) sind an Stangen gebunden, die in schnurgeraden Reihen stehen, hinter denen andere, noch höhere Stangen das über die gesamte Anlage gespannte Netz tragen und dessen Geflecht zu Senkungen und Hebungen formen, wie man sie von Zirkuszelten oder alten Radiogehäusen kennt. Auf der Rückseite des Photos steht eine handschriftliche Notiz: Landarbeiterinnen, England, 1882.
Die nächste Aufnahme des Dossiers zeigt Frauen, die Baumwolle in Maschinen eingeben, die sie schwingen, kardieren und auf Haspeln wickeln, die, zu einem Ring angeordnet, ihre Fasern dann in eine größere Spindel einspeisen, die sie verzwirnt. Auf dem nächsten Bild – aus demselben Jahr, 1889 – hat sich diese Zwirnspindel (oder eine ihresgleichen) in eine Revuespinnerin neben dutzenden anderer verwandelt: Im Kreis angeordnete Hohlspindelvorlagen stecken in den feststehenden Töpfen eines Turms, der über der einsamen Frau aufragt, und sie kümmert sich um die Doppeldrahtmaschine, fädelt das Garn in den Fadenführer ein und achtet darauf, dass die Stapelgarne zur erforderlichen Spannung gedämpft worden sind. Auf den ersten Blick könnte man die Maschinistin (gesichtslos, denn sie kehrt der Kamera und damit auch Dean den Rücken zu) für eine Musikerin halten, die Harfe oder Klavier spielt. Der Eindruck verfliegt aber schnell. Ihre Haltung hat nichts Souveränes: Der gesenkte Kopf, der ausgestreckte Arm und der gekrümmte Rücken werden scheinbar von den Schnüren gehalten und nicht umgekehrt – sie werden von ihnen beherrscht wie früher die Gliedmaßen und der Rumpf einer Marionette.
Alle Pappschuber sind mit den gleichen rosa Bändern verschnürt. Sie erinnern dadurch an Geschenke, an Pralinenpackungen, Parfumschachteln – oder an die Exposés, die Dean früher für die Anwälte von D&G erstellt hat. Nicht nur Rechtsverfahren haben ihre rituellen Elemente, sondern auch die Präsentationen dieser Bibliotheksbestände: die Heraufbeförderung in Holzliften aus verborgenen Magazinen; das ruhige Gleiten der Archivarin von der Ausgabe zum hüfthohen Drehkreuz, das die zugangsbeschränkten von den (nach Voranmeldung) öffentlichen Bereichen trennt; Deans Einschwören darauf, die Archivalien erst nach Anlegen weißer Handschuhe zu berühren … Dann die unzähligen Aufnahmen dieser anderthalb Jahrhunderte alten Menschen in Reihen, Werkhallen und Gestellen. Die meisten scheinen so in ihre Arbeiten vertieft, dass ihnen gar nicht bewusst wird, photographiert zu werden; gelegentlich schaut sich jemand nach der Kamera um, aber nicht trotzig oder wissbegierig, sondern einfach nur schicksalsergeben: noch mehr Gerätschaften …
Auf dem hier ist auf hohen Hockern vor einer Werkbank eine Reihe von Frauen zu sehen, die durch festmontierte Vergrößerungslinsen Ritzel und Zahnräder prüfen, die sie nach dem Zufallsprinzip von dem vor ihnen vorbeiziehenden Fließband genommen haben. Diese Aufnahme ist jünger: 1925, erfährt sie aus einer diesmal getippten Bildlegende … Beseitigung des Schattens auf Arbeitsplatz durch Erhöhung der Hockerentfernung von Arbeitsfläche auf 46cm. Durch daraus resultierende Anpassung der Armwinkel Reduktion der Belastung um 5% … Das nächste Dossier enthält noch mehr davon: Frauen an Werkbänken, Tischen und Spindeln; überall um sie herum Treibriemen und Kabel – horizontal, vertikal, diagonal; Drähte, Walzen, Laufrollen und Haken. Auch Männer, die verseilen, vulkanisieren, kochen, pressen, isolieren, flechten; die Kabeltrommeln auf riesige Drehscheiben wie die der Baumwollhasplerinnen spulen, von denen noch größere Scheiben gespeist werden; die mit Eisen, Kautschuk, Blei arbeiten. Sie stellen Brückenteile her, lackieren Herde … Einsparung von 25% Lackierzeit durch Ersetzung von Rund- durch Flachpinsel mit breiteren Farbauftragsspannen … Sie setzen Dioden in Lautsprecher ein und montieren Batterien; bauen Staubsauger, Kühlschränke und Traktoren; gießen Golfbälle, Flugzeugreifen und Gummihandschuhe und ziehen die Letzteren zur Qualitätskontrolle gusseisernen Testhänden über, die als salutierendes Ehrenspalier über dem (ebenfalls aus Gummi bestehenden) Fließband vorbeiwandern; zentrieren Fahrradräder, indem sie sie in automatisierte Ständer einsetzen, deren Mechanismen von ihrerseits auf Fahrradrädern aufgespannten Treibriemen bewegt werden …
Hier ist eine seltsame Aufnahme: Arbeiterinnen in einer Haarbürstenfabrik, die neben Poliermaschinen hocken. Sie nehmen fast fertige Bürsten aus Behältern auf Laufrädern, die sich jeweils zu ihrer Linken befinden, und halten sie an ihre Polierscheiben (entsprechend den Abständen der Arbeiterinnen voneinander an den Rückwänden ihrer Arbeitsbereiche befestigt: zwanzig Arbeiterinnen, zwanzig Poliermaschinen) – die sich drehen, wie sowohl die verschwommenen Scheiben als auch die implizite Mechanik der Szene Dean kombinieren lassen: Die Frauen rauen die Rückseiten der Haarbürsten auf, damit sie auch als Kleiderbürsten verwendet werden können. Am Photo ist ein Blatt mit maschinengeschriebenem Text angebracht, der aber nicht direkt getippt worden ist: Die Buchstaben haben sich dem Papier nicht eingeprägt, und das blasse Violett der Beschriftung deutet auf eine Frühform des Photokopierens hin – unsachgemäß durchgeführt, denn die Textspalte ist genau in der Mitte durchgeschnitten und die linke Hälfte zensiert oder ediert worden:
rt, so dass der Polierschwamm ruhig aufliegt
en Höhe und Abstand eingestellt werden
stieg um 12%
Dean hält das Blatt hoch, führt sich Photo und Bildlegende näher vor Augen und streckt den Arm dann wieder. Das ändert aber nichts: Die Frauen kehren ihr nach wie vor die Rücken zu und bedienen weiter ihre Poliergeräte. Ihre Haare sind unter Stoffhauben verborgen, unter denen sich hier und da eine vorwitzige Locke hervorstiehlt und über eine Wange schlängelt. Phantombilder, aus Kindheitsbibliotheken in Deans Gedächtnis hängengebliebene Harems, Mägde und Vestalinnen treiben über das Bild und verwandeln die glanzlosen Fabrikmädchen in Kammerzofen einer Kaiserin, die aufgelöste Zöpfe kämmen und neu flechten, züchtige und schickliche Nachmittage in königlichen Schlafgemächern, aus der Welt der Männer und der Zeit herausgefallene Enklaven, in die aus benachbarten Räumen, Festhallen und Ballsälen, Foyers, Kabinetten und Salons leise Musik herüberweht …
Sie hat das Poliermaschinenphoto jetzt geraume Zeit in der Hand gehalten. Warum? Weiß sie nicht. Was verrät es ihr? Nichts. Also weiter: Sie hat zu arbeiten. Sie hat ihre Anweisungen.
3. Die Zehn Gebote für die Darstellung von Raumflügen in Filmen
Oder nur: Die Zehn Gebote – der Rest versteht sich von selbst, aus dem Zusammenhang. Der Titel ist neu; das Format stärker. Nach Lage der Dinge läuft es folgendermaßen:
1.Die Physik – Festkörper- und Teilchenphysik, angewandte, molekulare, atomare, photonische und planetare Physik, Plasma-, Nuklear-, Nano-, Astro-, Geo- und Etceterophysik – ist der Herr, Ihr Gott. Die Physik hat Ihr Raumschiff gebaut; sie hat es aus der Knechtschaft der Erde befreit und treibt es an auf seiner Reise zu fremden Welten, wo noch nie ein Mensch gewesen ist. Sie ist ein eifersüchtiger Gott: Machen Sie sich ein anderes Bildnis – zumal eines vom Gott der Ästhetik, deren Idol die Dirne der Sinneswahrnehmung ist –, und sie wird die Missetaten der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern und fürwahr bis ans Ende Ihrer Franchise-Verträge.
2.Sie sollen keine Astronauten zeigen, die auf den Oberflächen von Exoplaneten herumspazieren, als wär’s der Central Park. Gucken Sie sich bloß Arnie an (Folie 1), wie der durch die Marslandschaften stromert: Auch ein Muskelprotz wie er hätte dort nur rund ein Drittel seines Erdgewichts. Haben Sie sich mal gefragt, warum Armstrong und Aldrin auf den Mondlandungsfilmen so in der Gegend rumhüpfen? (Und falls jetzt ein Klugscheißer mit seinem Weil die ein Fake sind ankommt, beschlagnahme ich seinen Körper, verfrachte ihn ins Antimaterielabor vom Marshall Space Flight Center und lass ihn verdichten und annihilieren!) Auf dem Jupiter neigen sich die Waagschalen in die andere Richtung: Der Erdenrest, zu tragen peinlich, brächte dort fast das Dreifache auf die Waage. Wenn Sie dort Schenkel und Knie anheben, um einen Schritt zu machen, wäre das (Folie 2) wie das Trainieren in der Beinpresse mit maximalem Steckgewicht.
3.Sie sollen Ihre Jungs von den Special Effects nicht jedes Mal eine riesige Explosionswolke erzeugen lassen, wenn ein Space Fighter oder eine Raumstation zerstört wird. Dass Sie ein Vermögen damit scheffeln, Sachen auszuhecken, die cool aussehen, ist keine Entschuldigung dafür, gegen elementare Naturgesetze zu verstoßen. Für eine Explosion oder andere Verbrennungsprozesse braucht man Sauerstoff – und den gibt es im Weltraum nicht. Gucken Sie sich diese (Folie 3) Flammen in Starship Troopers an: Die züngeln an den Schiffsrümpfen sogar nach oben (wofür’s die zweite gelbe Karte gibt: Im Weltall gibt’s kein ›Oben‹ oder ›Unten‹). Und wenn die Raumer dann komplett verpuffen, kriegen wir immer ein Riesenwumms – was kraft des besagten Mangels an Sauerstoff oder einem anderen schallleitenden Medium gleichermaßen unmöglich ist. Kubrick dagegen kriegt das in 2001 mehr oder weniger richtig auf die Reihe: Als Bowman (Folie 4) die Luke von Discovery One sprengt, um wieder ins Schiff reinzukommen, gibt es eine Implosion, die sich in einem Vakuum abspielt, und man hört gar nichts …
Ben Briar schaut aus dem Flugzeugfenster. Hinter der Dreifachscheibe kann er erste Zeichen der transatlantischen Morgendämmerung um die Erdkrümmung herum sehen, die ebenfalls eine Dreifachmembran ist: Dunst, Wolken, Landmassen im Permafrost. Sie müssen irgendwo über Neufundland oder Grönland sein. Troposphäre und arktischer Flor, Whisky auf Eis, seine PowerPoint-Präsentation. In Interstellar sorgen gefrorene Wolken auf dem Ammoniakplaneten des Wissenschaftlers Mann für einen oberen Boden, auf dem man gehen kann – was auch Schwachsinn ist: Eis könnte sich nicht so in der Schwebe halten. Das sollte er noch aufnehmen; vielleicht im neunten Gebot zur Schwerkraft …
4.Sie sollen die Gesetze der Geschwindigkeit und der Entfernung ehren. Ein Funksignal von der Erde braucht zwanzig Minuten, um auf dem Mars anzukommen, unserem unmittelbaren Nachbarplaneten. Wenn Sie ein bisschen verwegener drauf sind und Einsatzteams ans andere Ende der Milchstraße schicken, können Sie diesen Zeitraum ohne weiteres auf Monate und sogar Jahre verlängern. Verzögerungsfreie Telekommunikation und Hin-und-her-Geplänkel à la Hitzeschild öffnen! / Wie geht’s der Gattin? / Beißen die Fische? zwischen Bodenkontrolle und dem Sirius sind absolut tabu. Wenn ein Astronaut, der durch Andromeda oder den Dreiecksnebel gurkt, eine Nachricht empfängt, kann man darauf wetten, dass der Sender vor über hundert Jahren gestorben ist.
Und apropos:
5.Sie sollen Ihren Helden nicht in der Zeit zurückreisen lassen. Die Zeit kann sich krümmen und dehnen, wie Einstein uns gezeigt hat, aber weder er noch irgendein anderer Experte von minimaler Glaubwürdigkeit hat je behauptet, sie könne rückwärts laufen. Die einzige Eigenschaft, die einzige dimensionsübergreifende Eigenschaft ist die Schwerkraft (vgl. Gebot Nr. 9). Selbst wenn Zeitreisen möglich wären (und ich wiederhole: Das sind sie nicht), bräuchte man zu ihrer Durchführung mehr als die gesamte im Universum existierende Energie. Nach der Reise in die Vergangenheit könnte man dort nichts tun, und es gäbe auch kein ›Dort‹, wo man hingehen könnte, um nichts zu tun. Das Hirngespinst, man könne zum Abschlussball einer Highschool in den Dreißigern zurückgehen, die eigene Großmutter vögeln, den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verhindern und das Ergebnis der World Series 1953 ändern, ist eben nur ein Hirngespinst …
Ist die Bemerkung über die Großmutter zu gewagt? Er hat es in London ja nicht mit Disney zu tun. Degree Zero ist das Nonplusultra der Hipness – oder jedenfalls so hip, wie man mit einem Umsatz von über fünfzig Millionen im Jahr eben sein kann. Und nach den Daten zu urteilen, wird dieses Projekt über den Daumen gepeilt mit der doppelten Summe budgetiert. Es handelt sich um eine bombastische Weltraumsaga im Stil von Star Wars mit Prinzessinnen, Entführern, Piraten und Schmugglern; imperialen Föderationen, denen benachbarte Vasallenplaneten Tribute zu zahlen haben, deren Höhe jeden Sonnenzyklus auf galaktischen Ratssitzungen neu ausgehandelt werden muss, und in den Sitzungspausen werden in Auditorien, Korridoren und auf den Andockbrücken der Botschafter Geheimbündnisse angeboten, eingegangen und gebrochen … Briar hat das Treatment unter dem Whiskyglas eingeklemmt vor sich liegen. Geschrieben hat es ein Norman Berul, und es wimmelt nur so vor Kardinalfehlern. Die Szene zum Beispiel, in der die mitgiftbestückte Braut und Friedenskitterin einen Geliebten hat, der seiner Buhle (der besagten – wenn auch nicht mit ihm – Verlobten) Lasersignale zukommen lässt, die am Himmel über ihren königlichen Gemächern langzucken und von seinem Raumschiff abgestrahlt werden, das knapp außerhalb der Stratosphäre des Planeten ihres baldigen Ehemanns (der der Adoptivonkel ihres Geliebten ist) im Orbit steht … Mal davon abgesehen, dass nicht nur die schmachtende Braut die Laserstrahlen sehen würde, sondern auch der gehörnte König und all seine Höflinge, Diener und Untertanen bis hin zum letzten Weltraumspritter, der in der Gasse hinter der Pinte des Raumhafens am Pissen ist – von all dem mal abgesehen, ist die Szene ein Reinfall, denn … Briar legt den Ausdruck mit dem Kondenswasserkreis des Glasbodens weg und lässt Gebot 7 um einen Platz aufrücken:
6.Lassen Sie sich gesagt sein: Laserstrahlen sind im Weltall unsichtbar. Die Laserpointer, die die Kiffer bei Dead-Konzerten zücken –
Lass die Grateful-Dead-Anspielung weg; die Kids waren da noch gar nicht auf der Welt
– in ihren Techno-Clubs zücken, sind nur zu sehen, weil die Luft in Konzertsälen und Lagerhäusern mit Staubpartikeln gesättigt ist. Das ist wie bei uns im Schlafzimmer: Nur weil wir nie staubsaugen, können wir uns darüber amüsieren, wie der Kater (Folie 5) aus dem Gleichgewicht kommt, wenn er nach den roten oder grünen Linien tappt, sie aber nie zu fassen kriegt. Wir Fieslinge. Aber im Weltall – kein Staub, keine Kater, keine Linien. Der Weltraum ist gestaubsaugt; da gibt es nur Vakuum. Die Strahlen feindlicher Laserkanonen durchlöchern Ihnen vielleicht das Schiff, aber sehen werden Sie sie nicht. Auch ein Jedi-Ritter sieht keinen Laserstrahl, und von der Reaktionszeit, um den mit seinem eigenen Lichtschwert zu parieren, reden wir gar nicht erst. Licht bewegt sich mit … genau, Lichtgeschwindigkeit. Ein Reflex, der auftritt, bevor seine Ursache vom Reagierenden registriert werden kann, ist kein Reflex, sondern ein Zeitparadox, also ein physikalisches Unding (vgl. Gebot Nr. 5).
7.Diese Dinge sind wichtig. Vor hundertfünfzig Jahren beteiligte sich Präsident Lincoln (Folie 6) an der Gründung der National Academy of Sciences. Warum? Weil er begriffen hatte, dass naturwissenschaftliche Kenntnisse einer breiten Bevölkerungsmehrheit die Grundlage für Modernität und Fortschritt, für die Republik und die Demokratie selbst waren. Der andere Weg, der Weg von Unwissenheit und Aberglauben, führt direkt nach Salem zurück. Und vielleicht, ganz vielleicht ahnte Lincoln sogar schon, welche Rolle Spekulationen, Entertainment und Einbildungskraft in der Zukunft der Republik spielen würden. Erforderte und beinhaltete nicht schon ihre Erschaffung eine riesige Phantasieleistung? Auch die Physik ist all ihrer evidenzbasierten Grundausrichtung zum Trotz eine schöpferische Reise, ein Kopfsprung in die weitverstreutesten –
weitestverstreuten
– weitestverstreuten Welten der Phantasie. Im Versuch zu veranschaulichen, wie das Universum gestaltet ist, krempeln wir den Raum um. Wir piesacken Parallelwelten durch Guckfenster in Schachteln mit Katzen drin (auch Physiker sind Fieslinge). Wir schießen aus Daffke Teilchen mit Wahnsinnsgeschwindigkeiten aufeinander, um zu sehen, was passiert. Und alle diese Aktivitäten kosten Geld (Folie 7) und noch mehr Geld (Folie 8) und noch mehr Geld (Folie 9). Wir Naturwissenschaftler verbrennen so viel Geld, dass sich die Preisschilder an Ihren popligen Extravaganzen wie das Kleingeld im Klingelbeutel ausnehmen. Wo kommt unser Geld her? Von den Regierungen. Worauf beruht die Haushaltspolitik der Regierung? Auf der öffentlichen Meinung. Wenn Otto Normalverbraucher nicht begeistert ist von der Aussicht auf die Entdeckung der Higgs-Bosonen und das Aufsperren der Multiversen, schickt der Kongress uns keine Steuerdollars fürs Entdecken und Aufsperren.
8.Und da kommen Sie ins Spiel: Sie sind unsere Schnittstelle. Über Sie pflanzen wir der Öffentlichkeit die Liebe zur Naturwissenschaft ein. Umgekehrt sind wir Ihre Schnittstelle: zur Glaubwürdigkeit, zur Preisgabe des Unglaubens, zum ganzen Krempel aus dem Proseminar Aristoteles. Wenn die Grundlagen Ihres Streifens nicht plausibel wirken, sind Ihre Zuschauer nicht hingerissen oder entzückt und haben schlimmstenfalls von vornherein keine Lust, sich für den Film von ihren Tacken zu trennen. Und das ist schlecht – für Sie, für uns, für alle. Wir sind Ihre Absicherung gegen diesen Ernstfall, so wie Sie die unsere gegen das plötzliche Durchhacken unserer Versorgungskette sind. Eine symbiotische Beziehung: Kolibri und Bienenbalsam, Eingeweide und Darmbakterien, Pilotfisch und Hai. Womit ich wieder an unserem Nullpunkt im Multiversum angekommen wäre, wo sich die Raumzeit neu um diese Sterngestade krümmt, denn darum haben Sie mich ja in Ihre schönen und beeindruckenden Studios eingeladen und darum bin ich als Seniorpartner von Two Cultures Consultancy Ihrer Einladung gern nachgekommen. Damit kommen wir zu …
Briar greift wieder zum Glas, trinkt einen Schluck, lehnt sich im Sitz zurück, und die Lordosestützpolster schmiegen sich an Wirbelsäule und Rippen. Die NASA