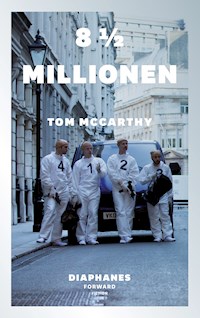9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: DENKT KUNST
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mit einer ganz besonderen Zeitform setzt sich Tom McCarthy in seinem Essay auseinander, einer Zeit, die zurücksetzt, sich absetzt, etwas ausspart, in die gewöhnliche Zeit einsticht. Sie hält an, bildet eine Pause, hält aber auch etwas zurück, bewahrt es auf. Interim – eine Pause, ein Intervall, ein Zaudern. Dabei interessieren ihn Thomas Pynchon, Maurice Blanchot und Thomas Mann ebenso wie Joseph Conrad, James Joyce und William Faulkner. Den Generalbass seines rasanten Textes gibt MC Hammer: Can't touch this … it's hammer time. Die »Zeit des Hammers« ist eben jene Zeit der Fiktion, jenes buffering, um das auch McCarthys eigene Texte kreisen. An den Essay schließt ein Gespräch mit dem Autor an, welches seine eigene Schreibpraxis erörtert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 84
Ähnliche
Tom McCarthy Interim, oder: Die Zeit des HammersHerausgegeben von Elisabeth Bronfen Aus dem Englischen von Sabine Schulzdiaphanes
Reihe DENKT KUNST des Instituts für Theorie (ith) der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und des Zentrums Künste und Kulturtheorie (ZKK) der Universität Zürich.
ISBN (ePub) 978-3-03734-909-0
ISBN (Mobipocket) 978-3-03734-910-6
© diaphanes, Zürich-Berlin 2016
All rights reserved.
Inhalt
Interim, oder:
Die Zeit des Hammers
Über Buffering, symbolischen Terrorismus
und andere Störungen
Fragen an Tom McCarthy
»Etwas, das nicht nichts ist«
Tom McCarthy Interim, oder: die Zeit des Hammers
Irgendwann inThomas Pynchons MonumentalromanGravity’s Rainbowwird der täppisch-naive Held Tyrone Slothrop auf einen Kommando-Einsatz geschickt. Das Territorium, das er und sein Trupp durchstreifen, ist eine riesige Metropole, ein »Fabrikstaat«, in dem Kapital, Technologie und Macht, perfekt aufeinander abgestimmt, Luftschiffe durch die Straßenschluchten gleiten lassen, vorbei an Chromkaryatiden, an Dachgärten und an Wolkenkratzern, die an senkrechten Kabeln auf und ab sausen: eine Konurbation, die bei Pynchon »Stadt der Zukunft« heißt, oder [deutsch] »Raketenstadt«. Das Ziel des Einsatzes aber ist weder ein Gebäude noch eine Person, sondern dieZeit. Slothrops Auftrag ist die Rettung der »Strahlenden Stunde« (›the Radiant Hour‹), welche die Mitarbeiter eines nur als »der Vater« (›the Father‹) bekannten Schurken von den übrigen vierundzwanzig des Tages »gesondert« [›abstracted‹] haben sollen. Gerade als es losgehen soll, erhält Slothrop einen Zettel ausgehändigt, der ihm wie in einem alten Gangsterfilm mitteilt: »Die Strahlende Stunde wird gefangen gehalten, wenn Sie sie sehen wollen …«, und während noch die Kugeln über seinen Kopf hinwegpfeifen, treibt »wie gerufen« ein weißes Zifferblatt am Himmel vorbei, genau wie die Luftschiffe.
Wie sollen wir diese bizarre Episode verarbeiten oder einordnen? Dass einer im Kommando der »FlounderingFour« (»Verwirrten Vier«) ein »äußerst ernsthaft dreinblickendes französisches Flüchtlingsbübchen« namens Marcel ist, »ein mechanischer Schachautomat aus der Zeit des Zweiten Kaiserreichs« mit einem Hang zu langatmigen Monologen, mag uns auf Proust verweisen und uns dazu verleiten, Slothrops Unternehmung als ein erneutes Durcharbeiten jenes anderen Einsatzes auf der Suche nach verlorener (oder veruntreuter) Zeit zu betrachten, in Szene gesetzt von einem Schriftsteller, der sich was ganz Spezielles in seine Madeleines getan hat. Wahrscheinlich lag das in Pynchons Absicht – aber als ich die Episode vor ein paar Wochen wiederlas, musste ich (wer weiß, vielleicht war es der französisch-deutsche Mix aus Marcel undRaketen-Stadt) immer wieder an eine andere Szeneriedenken, ein anderes, halbverschüttetes Vergleichsbeispiel; eine Szenerie, die wie der Vortrag, auf den dieser Essay zurückgeht, in der Schweiz angesiedelt ist.
Thomas Manns gleichermaßen monumental angelegtes Werk Der Zauberberg kündet gleich zu Beginn von einer Fixierung auf die Zeit. Als Hans Castorp (noch so ein naiver Protagonist) ins Davoser Sanatorium auf Besuch zu seinem tuberkulosekranken Vetter fährt und immer weiter hinauf ins Hochgebirge vordringt, da gewinnt der Raum, den sein Zug hinaufkeucht, »Kräfte, die man sonst der Zeit vorbehalten glaubt«. Es folgen zahllose Betrachtungen über die Zeit – über Dauer, Weile, Stetigkeit, Wiederholung. Als habe er gewusst, dass Davos einmal Gastgeber des World Economic Forum werden würde, lässt Thomas Mann einen von Hans’ Lehrmeistern, Naphta, den globalen Finanzmarkt als ein zeitbasiertes System erklären, als einen Mechanismus, »sich für den bloßen Zeitverlauf eine Prämie zahlen zu lassen, nämlich den Zins«. Zu Beginn eines Kapitels mit dem im Deutschen unverfänglichen Titel »Strandspaziergang«1 werden die Form, ja die Möglichkeit selbst des Buches, das wir lesen, auf ähnliche Weise an die Zeit ›indexgebunden‹: »Die Zeit ist das Element der Erzählung«. »Kann man die Zeit erzählen, diese selbst, als solche, an und für sich?«, fragt sich Mann. Nein: »Das wäre ein närrisches Unterfangen.« Er räumt jedoch ein, dass jede Erzählung zweierlei Arten Zeit hat: ihre eigene, die Zeit, die sie zu ihrem Ablauf braucht; und die Zeit ihres Inhalts, die in äußerstem Maße »perspektivisch« sei, solcherart, dass eine Erzählung, »deren inhaltliche Zeitspanne fünf Minuten« beträgt, hunderte von Stunden dauern kann, und umgekehrt der Inhalt eines in einem Moment Wiedergegebenen »die Grenze aller menschlichen Zeiterfahrungsmöglichkeit zurück[lässt]«. Diesen überdehnten Momenten hafte »ein krankhaftes Element« an; sie seien Opiumträumen nicht unähnlich, in denen sich die Zeit zusammendränge, als wäre »aus dem Hirn des Berauschten etwas hinweggenommen gewesen wie die Feder einer verdorbenen Uhr«.
Hans plant einen dreiwöchigen Aufenthalt im Sanatorium; da ihm aber selbst Tuberkulose diagnostiziert wird, sitzt er sieben Jahre dort fest. Seine Krankheit erzwingt nicht nur einen fortgesetzten Aufschub, eine Freistellung von seiner Arbeit als Ingenieur, eine generelle Auszeit von seinem Leben; sie erzwingt auch ihre eigene Zeitlichkeit. Wenn man krank zu Bett liegt, schreibt Thomas Mann, ist es
immer derselbe Tag, der sich wiederholt; aber da es immer derselbe ist, so ist es im Grunde wenig korrekt, von ›Wiederholung‹ zu sprechen; es sollte von Einerleiheit, von einem stehenden Jetzt oder von der Ewigkeit die Rede sein. Man bringt dir die Mittagssuppe, wie man sie dir gestern brachte und sie dir morgen bringen wird. Und in demselben Augenblick weht es dich an – du weißt nicht, wie und woher; dir schwindelt, indes du die Suppe kommen siehst, die Zeitformen verschwimmen dir, rinnen ineinander, und was sich als wahre Form des Seins dir enthüllt, ist eine ausdehnungslose Gegenwart, in welcher man dir ewig die Suppe bringt.
Von Ewigkeit und Entropie oder Niedergang einge-trübt, ist Krankheitszeit die Zeit, die auf den Tod zudriftet. Aber sie ist auch, klassisch nach Freud, Zeit, die sich auf die Lust ausrichtet. »Krankheit macht den Menschen viel körperlicher«, notiert Thomas Mann; befällt sie den weiblichen Körper, führt die Schwindsucht zu einer »Steigerung und ungesittete[n] Überbetonung« seiner Rundungen, macht Frauen zu Wesen mit einem »durch die Krankheit ungeheuer betonten und noch einmal zum Körper gemachten Körper«. »Die Phthise« sei »nun mal mit besonderer Konkupiszenz verbunden«, bemerkt Dr. Behrens, während sein Kollege Dr. Krokowski davon spricht, dass die Liebe, unterdrückt gehalten durch »Furcht, Wohlanstand, züchtige[n] Abscheu, zitterndes Reinheitsbedürfnis«, in Gestalt der Krankheit wiedererscheine. »Das Krankheitssymptom sei verkappte Liebesbetätigung und alle Krankheit verwandelte Liebe.«
Wie alle wissen, die das Buch gelesen haben, findet dieser Gedankengang seine dramatische Umsetzung im Verhältnis zwischen Hans und seiner Mitpatientin Clawdia Chauchat (ihr Name steht nicht nur für Weiblichkeit und Laszivität, sondern auch für ein bestimmtes Maschinengewehr-Modell). Hans erlebt sein Begehren nach ihr als Erweiterung und Intensivierung seiner Krankheit. In einer Geste, die ein romantisches Klischee ins Buchstäbliche auflöst, lässt Thomas Mann Hans’ laufend gemessene Temperatur um zwei Striche ansteigen, wann immer er sie sieht; und in einer ähnlichen Materialisierung des ritterlichen Codes lässt er ihn eine Röntgenaufnahme ihrer Lungen eng an seine Brust gepresst mit sich herumtragen: wodurch Clawdia, wie Pynchons gestohlene Stunde, so strahlend wie negativ, ›abstrahiert‹ wird. Wenngleich sie praktisch während des gesamten Romans unerreichbar für ihn ist, veranstaltet er in der zentralen Episode des Buches eine Verführung, die sich in der Walpurgisnacht abspielt – einem Fest oder Feiertag, der sich selbst vom abgehobenen, abstrahierten Leben des Sanatoriums noch abstrahiert, als eine Zeit außerhalb der Auszeit (»ein beinahe aus dem Kalender fallender Abend … ein Extraabend, ein Schaltabend, der neunundzwanzigste Februar«, wie Hans anderswo sagt). Die Verführungsszene beginnt mit der Wiederholung eines prägenden Kindheitserlebnisses an der nichtsahnenden Clawdia: Im Alter von dreizehn Jahren hatte er sich einen Bleistift von einem Jungen geliehen, in den er verliebt war.
Schon früher im Roman hatte die Erinnerung an dieses Kindheitserlebnis zur Folge, dass Hans »so stark, so restlos […] ins Dort und Damals entrückt« wurde, als sei sein gegenwärtiger Leib »ein lebloser Körper«, »während der eigentliche Hans Castorp weit fort in früherer Zeit und Umgebung stünde«; und als er die Szene während der Walpurgisnacht nochmals abruft und diesmal Clawdia um einen Bleistift bittet, versetzt es ihn einmal mehr »auf den Klinkerhof« seiner alten Schule.
Es offenbart sich damit eine komplexe, sprungfederähnliche Struktur, eine Struktur des Dehnens und Zusammenziehens, derart, dass recht entfernt voneinander liegende Momente sich berühren oder ineinanderschieben, vermittels einer durchweg wirksamen Synekdoche oder eines »Markers« für den Akt des Schreibens (der Bleistift). Nach einer schwelgerischen Ode an Clawdias Leib, »destinée pour l’anatomie du tombeau«, verlangt Hans zu sterben, seine Lippen auf die ihren gepresst. Die meisten Kommentare zum Zauberberg lesen die Tatsache, dass Clawdia daraufhin die Feier verlässt, als eine Abfuhr. Doch ihre letzten, in der Tür gesprochenen Worte (»N’oubliez pas de me rendre mon crayon«), Hans’ betont späte Rückkehr auf sein Zimmer sowie Thomas Manns nebulöse Erwähnung von »Versicherungen, direkte[n] und mündliche[n], die nicht in dem mitgeteilten […] Dialog gefallen waren, sondern folglich in die unsererseits wortlose Zwischenzeit, während welcher wir den zeitgebundenen Fluß unserer Erzählung unterbrochen und nur sie, die reine Zeit, haben walten lassen« – dies weist doch stark auf das Gegenteil dieser Lesart hin. Wenn es das Schreibgerät ist, das den Zugang zu todesähnlicher Lust eröffnet, dann verlagert es aber auch – in Manns Händen – den Vollzug dieser Lust an einen blinden Fleck. So oder so gewinnt die erzählte Zeit am nächsten Tag wieder die Oberhand, und Clawdia reist ab. Sehr viel später kehrt sie als die Geliebte des älteren Mynheer Peeperkorn zurück, der, nachdem er nun zwischen Hans und ihr steht, für Hans ein weiterer Ersatzvater wird. Zuletzt begeht Peeperkorn Selbstmord, während Hans nach seiner Entlassung an die Front des Ersten Weltkriegs geschickt wird und zum ironischen Schluss des Romans die lange, intime, todesähnliche Pause, das Interim des Sanatoriums dem mechanisierten generellen Gemetzel des historischen Fortschritts weicht.
*
Natürlich ist Hans Castorp nicht der einzige literarische Held mit TBC. Wir alle könnten eine Handvoll Schriftsteller aufzählen, die daran gestorben sind, und literarische Figuren noch und noch. Einer aus dieser zweiten Gruppe, dessen Geschichte – nicht zuletzt wegen des rassistischen Epithetons im Titel – heutzutage eher selten zum Thema gemacht wird, ist der Held von Joseph Conrads NovelleThe Nigger of the Narcissus. Zur Erinnerung: Der Schauplatz ist ein britisches Handelsschiff auf der Rückfahrt von Bombay nach London – eine kleine Welt für sich, genau wie Thomas Manns Sanatorium, mit ihren eigenen Hierarchien und Betriebsabläufen, isoliert von der größeren Welt, die das Schiff im Mikroformat spiegelt, diesmal auf Nullniveau, sprich auf Meereshöhe