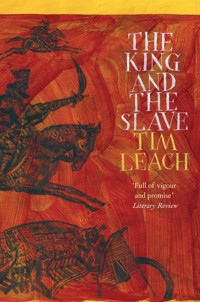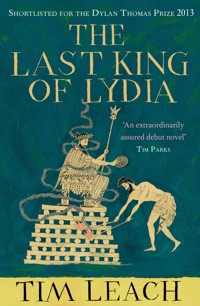7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Sarmaten-Trilogie
- Sprache: Deutsch
175 n. Chr., Vindolanda, Britannien: Die sarmatische Kavallerie wurde bei der Donauschlacht von den römischen Legionen zerschlagen. Nun muss sich Kai, ihr stolzester Krieger, das Überleben seines Volkes mit dem Versprechen erkaufen, Rom zu dienen. Obwohl die Sarmaten unter der Schmach der Niederlage leiden, sind sie bereit, für Kaiser Marc Aurel zu kämpfen und zu sterben. Aus ihrer Heimat verbannt, sollen sie sich auf dem Eisernen Weg bis zum Rand des Römischen Reiches begeben. Hier durchschneidet der Hadrianswall das Land und trennt die römischen Gebiete vom Rest der Insel. Für die nomadischen Sarmaten ist der Garnisonsdienst eine grausame Strafe. Doch als es auf beiden Seiten des Walls zu Unruhen kommt, entdeckt Kai, dass jedes Bollwerk seine Schwächen hat: Das ist seine Chance, für sein Volk zu kämpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
175 n. Chr., Vindolanda, Britannien: Die sarmatische Kavallerie wurde bei der Donauschlacht von den römischen Legionen zerschlagen. Nun muss sich Kai, ihr stolzester Krieger, das Überleben seines Volkes mit dem Versprechen erkaufen, Rom zu dienen. Obwohl die Sarmaten unter der Schmach der Niederlage leiden, sind sie bereit, für Kaiser Marc Aurel zu kämpfen und zu sterben. Aus ihrer Heimat verbannt, sollen sie sich auf dem Eisernen Weg bis zum Rand des Römischen Reiches begeben. Hier durchschneidet der Hadrianswall das Land und trennt die römischen Gebiete vom Rest der Insel. Für die nomadischen Sarmaten ist der Garnisonsdienst eine grausame Strafe. Doch als es auf beiden Seiten des Walls zu Unruhen kommt, entdeckt Kai, dass jedes Bollwerk seine Schwächen hat: Das ist seine Chance, für sein Volk zu kämpfen.
Autor
Informationen zu Tim Leach und seinen Romanen finden Sie am Ende des Buches
TIM LEACH
DEREISERNE WEG
DIE CHRONIK DER SARMATEN
Historischer Roman
Aus dem Englischenvon Julian Haefs
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Iron Way« bei Head of Zeus, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Januar 2024
Copyright © der Originalausgabe 2022 by Tim Leach
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Arcangel/Collaboration JS, Nik Keevi; FinePic®, München
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Karte: © Peter Palm, Berlin
BH · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30952-7V004
www.goldmann-verlag.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Teil 1 Der Wall
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teil 2 Das Versprechen
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Teil 3 Die Verlorenen
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Historische Anmerkung
Danksagung
Glossar
Die Sarmaten-Trilogie
Leseprobe: Tim Leach, Der letzte Thron
Newsletter-Anmeldung
Für Sara
Teil 1 Der Wall
1
In der erbarmungslosen Landschaft am nördlichen Rand des Imperiums ragte ein monströser Schatten am Horizont auf.
Es war weder der schartige Rand einer Klippe noch ein mächtiger Wald, denn dies war ein Schatten, den Menschen geschaffen hatten. Hoch und unvorstellbar ausufernd zog sich eine gewaltige Mauer aus Stein über die sanften Hügel mit ihren vereinzelten Bäumen. Sie zerteilte die Landschaft so schnurgerade, als hätte man sie mit dem Schwert gezogen.
Einst war die Reichsgrenze an diesem Ort, der den Römern als Britannien bekannt war, bei den örtlichen Stämmen jedoch ein halbes Hundert verschiedener Namen trug, nur ein Gebilde aus Gedanken und Träumen gewesen. Ein eisiger Hauch auf der Haut des Mannes, der die weite Heide überquerte; eine Frage, die einheimische Häuptlinge bei Viehdiebstahl und Blutfehden diskutierten; ein Rätsel, das sich in der Position der Sterne und in Zeichen verbarg, die man nur aus dem Land selbst lesen konnte. Manche behaupteten, sie als weißen Stein in einem Haufen grauer Kiesel entdeckt zu haben, andere im ausgetrockneten Bett eines alten Baches oder an dem Ort, wo an jenem Tag, als die Römer den Boden dieser Insel zum ersten Mal betreten hatten, ein Haselstrauch vom Blitz getroffen worden war. Jeder Mann und jede Frau hatten für sich im Kopf die Grenze ziehen müssen – zwischen den letzten fernen Ausläufern des Imperiums und den wilden Landen jenseits davon.
Eines Tages aber, so erzählte man sich, hatte sich der große Kaiser auf der anderen Seite des Meeres nicht länger mit einer Grenze aus Gedanken und Träumen begnügen wollen. Er hatte sich nach einem steinernen Vermächtnis gesehnt, das dieses Land als sein Eigentum markieren sollte, und so war dieser Wall auf seinen Befehl hin aus der Erde gehoben worden, in einer solchen Geschwindigkeit, dass die ansässigen Stämme darauf bestanden, es müsse die Tat eines rachsüchtigen Gottes gewesen sein.
Aus der Ferne sah er uneinnehmbar aus. Angeblich konnte man oben auf seinem Scheitel von einem Ozean zum anderen gehen, ohne jemals mit den Füßen die Erde berühren zu müssen. Jede Meile gab es eine kleine Festung, jeder Fußbreit Boden stand unter Beobachtung, die ganze Nacht hindurch brannten Fackeln auf den Wehrgängen, getragen von schlaflosen Wächtern, die mit Speer und Bogen gerüstet hinaus in die Finsternis starrten.
Aber jede Grenze hat eine Schwachstelle, wenn man nur gründlich genug danach sucht.
Etwa auf der Hälfte des Walls stand ein Meilenkastell, das einst einen Hauch von kaiserlicher Erhabenheit ausgestrahlt hatte. Stolze blasse Steinquader und ein eisenbeschlagenes Tor aus dunklen Eichenstämmen, das dem Faustschlag eines Riesen standgehalten hätte. Aber es war nachlässig errichtet worden, von einer Legion, die wärmeres Klima gewöhnt war und der das geistige Format gefehlt hatte, ihre Arbeit an diese andere Welt anzupassen. Denn mittlerweile waren die Holzplanken der Wehrgänge modrig und verzogen, der Mörtel zwischen den Steinblöcken von Regen und Wind zersetzt und das mächtige Tor mit Rost überzogen.
Die Wächter hingegen standen stramm und aufrecht oben hinter der Brüstung, während unter ihnen der einsame Torwächter in den wilden Norden starrte. Alle hielten sich mit erhobenem Kinn, duckten sich nicht vor dem schneidenden Wind und vernachlässigten nicht ihre Pflicht, während sich die Stunden hinzogen. Selbst hier, am äußersten Rand des Imperiums und in tiefster Nacht, schien der Geist von Rom wachsam zu bleiben.
Schon bei Tag gab es für die Wächter wenig genug zu sehen – Nebel, der über die fernen Hügel rollte, ein Schäfer, der wurmgeplagte Schafe durch den Morast lotste, ein einsamer Händler mit seinem Maulesel, der den Soldaten des Walls Heidebier und fragwürdige Tinkturen verkaufen wollte. Und nachts gab es noch weniger zu sehen, denn die Einheimischen waren davon überzeugt, dass es Unglück brachte, nach Sonnenuntergang noch draußen unterwegs zu sein. Ein Wächter mochte seine gesamte Nachtwache verbringen und sich glücklich schätzen, dabei überhaupt irgendetwas zu entdecken, was ihm die Eintönigkeit ein wenig auflockerte – den geisterhaften Anblick einer Schleiereule vielleicht, die ihr Revier absuchte, oder das Leuchten eines fernen Blitzes aus dem nächsten Tal.
Aber nicht in dieser Nacht, denn in der Dunkelheit krochen Schatten durchs Farnkraut.
Sie hielten sich tief geduckt und bewegten sich nur, wann immer der Wind die Geräusche ihrer Schritte verwehte. Ein Wächter mit müden Augen hätte sie für nicht mehr als eine Brise im Unterholz halten können oder für ein Wolfsrudel, das dem Duft einer Herde nachstellte. Aber so vorsichtig diese Plünderer auch waren – sie konnten sich nur bis zu einem gewissen Punkt leise und ungesehen bewegen. Das Kratzen und Rascheln aufgewühlter Blätter drohte sie zu verraten, ebenso das Klappern einer Speerspitze, die nicht fest genug im Schaft verankert war und im Wind säuselte. Auch wechselten jetzt die Wolken, die ihr Näherkommen gedeckt hatten, plötzlich die Seite und zerfaserten zu dünnen Schlieren, sodass sich der Schimmer des Mondlichts auf der breiten Klinge einer Speerspitze spiegelte, auf gefletschten Zähnen, auf kalkweißen Gesichtern mit Kriegsbemalung.
Aber noch immer ertönte kein Alarm, flüsterten keine Pfeile durch die Luft, um sich in die Eindringlinge zu bohren. Noch immer wurden weder Hörner gezückt noch Signalfeuer entfacht, um die nächsten beiden Meilenkastelle zu warnen. Oben auf dem Wehrgang begann der Kopf eines Wächters auf und ab zu nicken – er stand im Halbschlaf auf seinem Posten, wie es schien. Hexenwerk, ein mächtiger Glücksbringer oder göttliche Gunst ließen die Plünderer unbemerkt bleiben, während sie immer weiter auf den Wall vorrückten.
Aber irgendwann endet jede Erfolgssträhne, denn die Götter sind wankelmütig, und zu viel Glück weckt schnell ihren Neid.
Vor den Plünderern lag offenes Gelände, da das Umland der Straße und des Walls vor langer Zeit von jeglichem Unterholz befreit worden war. Nach vielen Jahren der Vernachlässigung kämpfte es sich nun langsam zurück, aber noch war zu viel freies Land vorhanden, als dass ein feindlicher Stoßtrupp es unbemerkt hätte durchqueren können.
Die Schatten krochen hierhin und dorthin und verharrten scheinbar unschlüssig, denn ihre Wahl bestand darin, entweder in Schande durchs Heidekraut zurück zu ihren Heimstätten zu kriechen oder das offene Gelände im Sturmangriff zu überqueren und zu Füßen des Walls zu sterben. Finger krümmten sich um Speerschäfte, Blicke zuckten durchs Dunkel in Richtung der Gefährten. Niemand wollte der Erste sein, der floh, oder der Erste, der sein Leben im nackten Gras aushauchte.
Dann aber wählten sie einen dritten Weg. Als der Mond am Himmel tiefer sackte und ihn die Wolken in voller Größe enthüllten, standen die Angreifer auf, traten vor und warteten.
Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, an dem man ihnen herausfordernd zurufen musste, an dem Hörner erschallen mussten, an dem ein Hagelschauer aus Speeren und Pfeilen und geschleuderten Steinen die Angreifer an Ort und Stelle niederstrecken musste, an dem die Macht Roms jene zermalmen musste, die es gewagt hatten, mit Waffen in der Hand zur Grenze zu kommen.
Nichts dergleichen geschah.
Gelächter erhob sich aus den Reihen der dunklen Gestalten, Jubel und Siegesschreie, Dank und Segen an die Götter des Krieges und der Jagd. Ohne Hast spazierten sie vorwärts, die Schilde und Speere gesenkt, und näherten sich dem Tor des Meilenkastells. Einer der Männer gab dem Wächter vor dem Tor einen kleinen Stoß – er schwang sanft an Ort und Stelle, drehte sich wie eine Vogelscheuche. Das Mondlicht fiel auf ihn, und seine durchtrennte Kehle schimmerte schwarz in der Nacht; darunter leuchtete fahl der Schaft des Speeres, auf den sein Leib gespießt war. Ein zweiter Angreifer winkte spöttisch hinauf zur Brüstung, wo zwei Männer gegen die Ecken der Festungsmauern gelehnt standen. Denn diesen Ort bewachten nur noch die Toten, und sie waren schlechte Aufpasser.
Das Tor war unverschlossen und schwang unter dem Druck einer flachen Hand quietschend nach innen. Die sanften Hügel dahinter erstreckten sich vor den Angreifern, und plötzlich war ein merkliches Zögern zu spüren, diese Grenze zu übertreten. Wie Kinder, die sich einem verbotenen Ort nähern, Kinder, die auch fern der wachsamen Blicke von Mutter und Vater diese Blicke sehr wohl spüren und die Verurteilung fürchten, die ganz sicher folgen muss. Sie schauten einander an und stellten fest, dass sie allesamt Angst hatten.
Da ertönte aus dem Farndickicht in ihrem Rücken der Klang gleichmäßigen Hufschlags.
Wie ein Wesen aus einem Albtraum wirkte diese Gestalt zuerst – ein großer Mann in Umhang und Kapuze, der auf einem mächtigen Ross ritt und durchaus einer der todbringenden Geister sein mochte, von denen es hieß, sie durchstreiften dieses Land in tiefer Nacht und entführten Reisende, die unglücklich genug waren, zu dieser Zeit fern von ihren Behausungen zu weilen. Die Angreifer aber begrüßten den Reiter mit leisen Willkommensrufen und reckten die Hände zu seinem Sattel, als suchten sie seinen Segen.
Der Reiter hielt nicht an, sondern ritt geradewegs durch das Tor, räusperte sich und spuckte auf römischen Boden. Kurz danach folgten ihm die anderen, die wie Wölfe die Hälse reckten und schnüffelten, denn in der Luft lag der sanfte Rauch von Kochfeuern und der beißende Hauch des Mists auf den Feldern. Die nächsten Höfe lagen ganz in der Nähe, vollkommen schutzlos. Die Vorhut pfiff durch das Tor nach ihren Gefährten, sich zu beeilen.
Ein Anblick allerdings ließ sie zögern. Ein Meer aus Feuer, ein großes Heerlager weiter im Süden. Nicht das quadratische Marschlager einer römischen Legion, sondern etwas anderes, etwas ganz und gar Fremdes in diesem Land. Dort bewegten sich die Schemen von vielen Tausend Männern und Pferden. Es war eine Armee, die hier im Schatten des Walls nichts zu suchen hatte.
Ihr berittener Anführer aber schenkte dem fernen Lager nicht mehr als einen kurzen Blick. Er flüsterte seine Befehle und führte sie in einem großen Bogen um die nächtlichen Feuer herum. Es war Zeit für die Jagd.
Hinter ihnen auf dem Wall drehten sich die gepfählten Wächter im Wind und schienen zu nicken, während die erste Fackel auf dem Wehrgang zu flackern begann und schließlich stotternd erlosch.
2
Ein Heerlager umschloss das römische Kastell von Vindolanda, das dort im Schatten des Walls stand. Ein verirrter Wanderer hätte es wohl für eine Belagerungsarmee gehalten, für eine Horde von Barbaren, die gekommen waren, um das Imperium mit Krieg zu überziehen. Denn das flackernde Licht der Lagerfeuer fiel auf die kalten, harten Augen erfahrener Schlächter, auf Tätowierungen von Wölfen und Drachen und Adlern, auf pirschende Raubtiere. Dies waren keine Soldaten der römischen Legionen – es waren Sarmaten, nomadische Krieger, die sich seit Jahrhunderten gegen die Grenzen des Reiches geworfen hatten, immer hungrig nach Eisen und Gold und Blut. Fünftausend von ihnen waren dort im Schatten des Walls versammelt – eine Macht, gegen die nur wenige Feinde bestehen konnten.
Sah man jedoch genauer hin, so konnte man die Anzeichen von Scham und Unterwerfung erkennen, die schwer auf ihnen lasteten – die müde Reglosigkeit, mit der sie im Gras hockten, die hängenden Schultern und schlaffen Kiefer. Keine Waffen trugen diese Sarmaten, auch wenn einige von ihnen Äste zu Messern oder Schwertern geschnitzt hatten, wie ein Kind ein Stöckchen zu einem Spielzeug formen mag. Bloße Schatten von Waffen, die ihnen ein Mindestmaß an Beruhigung verschafften, denn es war ein Zustand der Schande, so entwaffnet auszuharren. Und wo in der Vergangenheit rings um ihre Feuer stets große Gesänge zu hören gewesen waren, Lieder über Liebende und Helden, voll von Lachen und Poesie, saßen sie jetzt stumm da, die Zungen von ihrer Schmach gebunden.
Nur hier und da flüsterten einige Männer untereinander. Immer wieder fielen die gleichen Worte, wie Gebete an ihre Götter. »Fünfundzwanzig Jahre«, hieß es. »Fünfundzwanzig Jahre, dann dürfen wir endlich nach Hause zurück.« Denn dieser Gedanke, so schien es, war alles, was diesen Männern noch blieb. Verloren die große Freiheit der weiten Steppe, verloren der verwegene Kreislauf von Fehden und Beutezügen, in dem sie Ehre erlangten. Nur noch das langsame Abarbeiten ihrer Schuld, Jahr für Jahr, bis sie endlich ihre Heimat wiedersehen durften.
Rings um die Feuer hockten sie in großen versprengten Gruppen, teilten Wärme und Gesellschaft. Denn die Sarmaten taten nichts allein, hatten keine Geheimnisse voreinander. Alles wurde mit dem Stamm und der Sippe geteilt, denn diese Männer und Frauen waren durch Blut verbunden oder durch die Eide, die sie auf ihre Klingen ablegten. An einem der Feuer aber saßen nur zwei Männer.
Der eine von ihnen hatte rotgoldenes, von wenigen silbrigen Strähnen durchzogenes Haar, und sein Bart war nach dem Vorbild des Kaisers geschnitten – er war das Ebenbild eines römischen Soldaten. Der andere Mann trug die Lederhose und den gegürteten Mantel der Steppe, hatte kupferfarbene Haut und schwarzes Haar und frische zerklüftete Narben im Gesicht, unter denen sich die durchtrennten Linien alter Tätowierungen abzeichneten – ein geschupptes Untier mit gewundenem Leib, zerschnitten von den frischen weißen Spuren einer Klinge.
Bezwinger und Bezwungener saßen gemeinsam an diesem Feuer und teilten sich einen Weinschlauch, als wären sie Brüder. Dann und wann ertönten leise und gedämpft Hörner oder Trommeln in der Nähe. Lange Zeit saßen die beiden in geselliger Stille da und schürten abwechselnd das Feuer.
Schließlich schaute der Römer auf.
»Spricht irgendwer noch von Meuterei?«, fragte er.
»Mir ist nichts zu Ohren gekommen«, sagte Kai. Er führte die Hand zum Feuer und prüfte die Hitze. »Jetzt, wo wir fast am Ende der Reise angelangt sind, werden sie ruhiger.«
»Ich dachte, es würde Ärger geben, nachdem die neuen Vorräte eingetroffen sind. Verrottetes Fleisch und verdorbenes Getreide.«
Kai zuckte mit den Schultern. »Die Pferde sind wohlgenährt. Das ist alles, was mein Volk kümmert. Was sollte es Männern, die in Schande leben, ausmachen, dass sie verhungern?«
Abermals Stille, und im Licht der Flammen betrachtete Kai den Mann, mit dem sein Schicksal untrennbar verbunden war. Der Römer trug einen dieser nicht enden wollenden Namen, die sein Volk so schick fand. Für die Sarmaten aber war er ganz einfach Lucius oder, wie er manchmal genannt wurde, der Große Anführer, ein Mann, der während der Kriege in der Steppe fern im Osten in Kais Gefangenschaft geraten war und durch seinen Mut mit dem Schwert die Freiheit wiedergewonnen hatte. Ein Mann, der mit seinem Kaiser einen Frieden zwischen ihren Völkern ausgehandelt und so die Sarmaten vor dem Untergang bewahrt hatte. Allerdings zu einem hohen Preis – für sie beide.
»Es war ein langer Weg«, sagte Lucius, als hätte er Kais Gedanken gelauscht, »und ein beschwerlicher für dein Volk, ich weiß. Aber morgen bekommt ihr eure Waffen zurück. Ihr könnt wieder Krieger sein.«
»Du klingst wie jemand, der sich selbst von etwas überzeugen will«, sagte Kai.
»Du glaubst, ich lüge dich an?«
»Ich glaube, dass Krieger einen Feind brauchen, den sie bekämpfen können.« Er schirmte die Augen ab und schaute sich demonstrativ um. »Hier sehe ich aber niemanden.«
Lucius deutete in Richtung des Walls, dieser schwarzen Linie, die sich vor dem Horizont abzeichnete. »Und glaubst du, das da ist grundlos gebaut worden?«
»Ah ja.« Kai grinste säuerlich. »Zweifellos lebt dahinter ein Volk von Riesen. Deshalb ist dieses Land auch halb verlassen, und man schickt verhungernde Leute her, um diesen Steinhaufen zu bewachen. Was für Helden wir sein werden.«
Lucius schwieg.
»Wir haben die Gerüchte alle gehört«, fuhr Kai fort. »Und du hast es nie in dir gehabt, überzeugend zu lügen. Man hat uns nicht zum Kämpfen hergeschickt. Wir sollen verrotten und vergessen werden. Aber man hat uns einen Krieg versprochen.«
Der Römer verzog das Gesicht – der Mann war wütend auf sich selbst, so kam es Kai vor. »Manch einer wäre dankbar für Frieden«, sagte Lucius dann, »statt nach Krieg zu gieren. Ich kenne viele Legionäre, die den Wall dem Danubius vorziehen würden.«
»Es ist nicht das, was uns versprochen wurde.«
Lucius schüttelte den Kopf. »Manchmal klingst du wie ein Kind, wenn du von diesen Versprechen sprichst.«
»Wie ein Mann, der erwartet, dass man sich an einen Eid hält, der auf die Klinge abgelegt wurde.«
Wieder Stille, bis auf das Knacken des Feuers.
Beide wussten, dass Kai die Wahrheit sagte. Fern im Osten hatte man ihnen etwas versprochen. Als sich ein römischer General in Ägypten aufgelehnt und zum neuen Kaiser erklärt hatte, hatten die Sarmaten gegen ihn ins Feld ziehen sollen, in den größten aller Kriege. Seine Rebellion aber war vorbei gewesen, noch ehe sie wirklich begonnen hatte, der Kopf des Verräters von einem der eigenen Centurionen abgeschlagen, wie ein Stück kostbaren Fleisches gepökelt und in Tuch gewickelt und dem Kaiser von Rom als Geschenk zugesandt. Es gab keinen Krieg mehr für die Sarmaten, also hatte man sie stattdessen nach Nordwesten geschickt, weit übers Wasser und die weißen Klippen in den entlegensten Winkel des Reiches.
»Ich will nicht undankbar erscheinen«, sagte Kai. »Ich weiß, dass du viel aufgegeben hast, um uns hierher zu bringen. Ich bitte dich nur, mich nicht zu belügen.«
»Ich weiß. Es tut mir leid.«
Kais Grinsen blitzte in der Dunkelheit auf. »Vielleicht bin ich im Unrecht. Es muss ein furchterregendes Volk sein, das jenseits des Walls lebt, wenn Rom solch ein Bauwerk errichtet, um sich zu schützen. Und so mächtige Krieger wie uns.«
»Ich glaube, jetzt bist du derjenige, der nicht glaubt, was er selbst sagt.«
»Ich übe nur, was ich den anderen erzählen soll.« Wieder richtete Kai den Blick auf den gewaltigen Schatten am Horizont. Er fragte sich, ob er sich je an den Anblick des Walls gewöhnen würde. Die Sarmaten entstammten einem Ort, an dem man monatelang reiten konnte, ohne auf ein Hindernis zu stoßen, ohne feste Gebäude oder Grenzen – bis auf jene in den Köpfen der Menschen. Sie waren ein Volk, das nichts Dauerhafteres errichtete als Hütten, um sich vor den schlimmsten Wintern zu schützen, und ihm erschien es wie ein böses Omen, das Land auf solche Weise zu zerschneiden und zu verstellen. Ein Akt wider die Natur und wider die Götter selbst. »Was, glaubst du, erwartet uns hier wirklich?«, fragte er.
»Das Soldatenleben. Wachen und warten. Steuern im Land eintreiben. Den Frieden sichern.« Lucius deutete auf die verstreuten Gebäude vor den Toren des Kastells, als wäre er ein gewiefter Führer, der einem Reisenden die Wunder Roms zeigte. »Im vicus – das ist das Dorf außerhalb der Festung – gibt es Wein und Weiber. Außerdem kann man hier gut jagen, schätze ich, in den umliegenden Wäldern und Hügeln. Es ist kein schlechtes Leben.« Aber seine Stimme klang halbherzig.
»Wo würdest du jetzt sitzen, wenn alles anders gekommen wäre?«
»Immer noch am Ufer des Danubius. Ein Krieg nach dem anderen. Oh, ich hätte vielleicht mittlerweile den Rang eines primus pilus und einen Lorbeerkranz auf dem Kopf. Und sehr bald einen Grabstein außerhalb dieses oder jenes Lagers. Am Danubius führen Centurionen ihre Abteilungen in die Schlacht und leben meist nicht mehr besonders lange.«
Kai lächelte abermals und stimmte ein altes sarmatisches Sprichwort an: »Wenn unser Leben auch kurz ist …«
»… soll unser Ruhm doch groß sein«, ergänzte Lucius. »Ja, wir hätten fern im Osten beide den Tod eines Kriegers gefunden. Tapfer und nutzlos. Hier müssen wir deinem Volk ein neues Motto geben, nach dem es leben kann.«
»Einverstanden. Lange zu leben und unsere Heimat wiederzusehen.« Eine Pause. »Das hoffe ich, mehr als alles andere.«
»Ich weiß«, sagte Lucius.
Kai nahm einen Schluck aus dem Weinschlauch und verzog dank der Schärfe der posca das Gesicht. »Für eine Sache immerhin bin ich dankbar. Dass ich einem Anführer wie dir diene.«
Der Römer wurde rot – es war sehr einfach, ihn in Verlegenheit zu bringen, das hatte Kai schon lange herausgefunden. Denn die Sarmaten redeten stets offen, sprachen ihre Liebe oder ihren Hass füreinander so selbstverständlich aus, wie sie sich über die Gesundheit ihrer Pferde oder Veränderungen des Wetters austauschten. Und Lucius war, wie es schien, nicht daran gewöhnt, dass man freundlich über ihn redete.
Einmal mehr deutete der Römer auf den großen Schatten am Horizont. »Siehst du das Meilenkastell dort?«, fragte er, und Kai folgte seinem ausgestreckten Finger zu einem Abschnitt des Walls, wo kein Licht zu sehen war. »Die Fackeln sind erloschen. Ein Haufen fauler Wachen. Entweder sie schlafen oder sie sind betrunken.«
»Was wird mit ihnen passieren?«
»Wenn sie Glück haben, werden sie ausgepeitscht. Wenn sie Pech haben, werden sie von den eigenen Kameraden totgeschlagen.« Er schaute mit ernster Miene auf. »Ich werde es ähnlich handhaben müssen, ebenso die anderen, die euch befehligen mögen. Sorg dafür, dass deine Leute das wissen.«
»Das werde ich. Sie fürchten sich nicht vor strengen Befehlen.«
Aber während er das sagte, fragte Kai sich im Stillen, ob das wirklich stimmte, sollte sein Volk an diesem Ort einen Befehl bekommen, den es nicht befolgen konnte – den er selbst nicht befolgen konnte. Denn selbst unter freiem Himmel spürte Kai die unsichtbaren Gitterstäbe eines Käfigs, der sich um ihn schloss. Stets war ihr Volk frei durch die Steppe gezogen, und jetzt sollte es für fünfundzwanzig Jahre an einen einzigen Ort gebunden sein. Da stand er auf, war plötzlich unruhig und gierte nach der einen Sache, die ihm ein wenig Frieden verschaffen konnte. Eine gefährliche Art von Frieden, wie ein Mann mit einer offenen Wunde im Bauch nach dem Schluck Wasser betteln mag, der ihn umbringen wird – aber trotzdem Frieden.
Hinter sich hörte er Lucius. »Wo willst du hin?«
Kai antwortete nicht.
Lucius starrte ins Feuer und schwieg eine Weile. Dann sagte er leise: »Du solltest nicht nach ihr suchen.«
»Sagst du das als mein Anführer?«
»Als dein Freund.«
»Dann weißt du, dass ich es tun muss.« Und ohne eine Antwort abzuwarten, trat Kai in die Dunkelheit hinaus, spürte das nasse Gras unter den Fußwickeln und das leichte Stechen des Windes in den Narben auf seinen Wangen.
Oft hatte er während ihrer langen Reise nach Nordwesten nachts wachgelegen oder war rastlos umhergelaufen. Es war die Tageszeit, die ihm am meisten behagte, eine Zeit der Träume und des Vergessens; wenn man im Dunkeln die Feuer und die Schatten der um sie versammelten Sarmaten betrachtete und die schemenhaften Umrisse der Pferde, konnte man fast glauben, noch immer im großen Grasmeer zu sein. Wenn er sich nur Mühe gab, nicht die brutale Linie der geraden Straße in der Nähe zu sehen oder die gedrungenen Gebäude, die den Horizont wie Beulen in der Haut durchbrachen; wenn er in der Finsternis die Getreidefelder zum hohen wilden Gras der Steppe werden ließ. Und was ihn selbst anging – in der Nacht mochte man ihn mit jedem anderen Mann verwechseln, mit der Sorte Mann, die er einst gewesen war; mit einem Mann, der noch Teil des eigenen Volkes war.
Er durchstreifte das Lager und kam an einigen Kriegern vorbei, die sich ausreichend mit Wein betäubt hatten, um ihre Schande zu vergessen – sie hüpften und tanzten und versuchten offenkundig zu verdrängen, wo sie sich befanden. An vielen anderen kam er vorbei, die reglos dasaßen und ins Feuer starrten und dem Leben nachtrauerten, das sie einst geführt hatten. Wieder andere saßen gemeinsam in der Dunkelheit und klammerten sich aneinander fest.
Er gesellte sich zu keiner dieser Gruppen, denn ihm stand der Sinn weder nach Singen noch nach Grübeln noch nach Männerliebe. Stattdessen schloss er sich einer ungeordneten Reihe von Männern an, die auf dem gleichen Weg waren wie er selbst. Gemeinsam schlurften sie zum Ostrand des Lagers, um die Frauen zu betrachten.
Denn da draußen gab es ein zweites Lager, nicht mehr als einen Pfeilschuss entfernt, umstanden von Wachtposten und kaum ein Zehntel so groß wie das Hauptlager. Dort waren die Frauen untergebracht, denn die Römer hatten darauf bestanden, dass Männer und Frauen während der Reise getrennt kampierten – aus imperialem Misstrauen womöglich, dass diese Barbaren aus lauter Fleischeslust ihre Aufgaben vernachlässigen würden. Oder sie bezweckten, den Männern die Frauen als Geiseln vorzuenthalten, da sie den Eiden nicht trauten, die diese Fremden auf ihre Klingen geleistet hatten. Einmal hatte Kai mit einem anderen Sarmaten darüber gesprochen, der nur gelacht und erwidert hatte: »Da kennen sie unsere Frauen aber schlecht. Es wäre sicherer, uns als Geiseln zu halten, um sie zu befrieden.«
Jede Nacht zog es Männer zum Rand des Lagers, wie die Helden aus den alten Geschichten, die durch verzaubertes Wasser in die jenseitigen Lande spähten, um den Schatten einer verlorenen Liebe zu sehen. In dieser Nacht mochten es an die hundert Männer sein, die wie auf eine unausgesprochene Vereinbarung hin alle keine Notiz voneinander nahmen. So konnte jeder hier vorgeben, ganz allein zu sein, und nur seinen privaten Träumereien nachhängen. Und so betrachtete Kai die fernen Umrisse auf der Suche nach einer ganz bestimmten Gestalt. Einer Frau namens Arite.
Die Chancen standen eins zu tausend, dass sie die Reise aus der Steppe mit ihnen angetreten hatte. Fünfhundert Frauen hatten sich den fünftausend Männern angeschlossen, die nach Westen geschickt wurden, erwählt mittels Losverfahren, durch das Ziehen eines schwarzen Steines aus einem Gefäß mit lauter weißen. Aber so sehr Kai gehofft hatte, sie würde eine der Auserwählten sein, spürte er doch gleichermaßen Sehnsucht und Reue, als er in der Dunkelheit Ausschau nach ihr hielt.
Da glaubte er, sie zu sehen, als der Flammenschein Gold und Silber in langem Haar erhellte. Eine groß gewachsene Gestalt, die rastlos von Feuer zu Feuer ging wie ein Anführer, der seine Wachleute abschreitet. Und vielleicht stimmte es wirklich, was die Geschichtenerzähler sagten, dass sich Verlangen selbst in Stille und von Ferne noch bemerkbar machte, denn dieser Schatten verharrte und schien in seine Richtung zu blicken. Er erinnerte sich an viele kleine Dinge aus dem vergangenen Winter. An Augen, die in der Dunkelheit leuchteten, an die raue Haut ihrer Handflächen, die seinen Rücken umfassten, und daran, wie sein Kopf in der weichen Kuhle zwischen ihrem Hals und ihrer Schulter ruhte.
Aber etwas stimmte nicht. Da war jemand, der sich Kai näherte, ein weiterer Schatten in der Nacht, der die unausgesprochene Übereinkunft zwischen den Anwesenden verletzte. Ein gesichtsloser Mann in der Finsternis, und doch hätte Kai ihn überall erkannt.
Einst war Bahadur einer jener stets glücklichen und fröhlichen Männer gewesen, die das besondere Wohlwollen der Götter genießen, und sein Gesicht eher von Lachen als von Alter gezeichnet. Aber die Gefangenschaft bei den Römern hatte sein Lachen verstummen lassen, hatte ihm die Lieder genommen. Und da waren noch tiefere Wunden in seinem Herzen, die nicht die Römer ihm zugefügt hatten. Denn in dieser Nacht gab es nur eine Sache, die Kai und Bahadur miteinander verband. Beide hielten Ausschau nach derselben Frau.
Der Schatten neigte den Kopf ein wenig zur Seite – ein Stich fuhr Kai ins Herz, diese Bewegung zu sehen. Es war eine Geste, die er sehr gut kannte; Bahadur vollführte sie, wann immer er nach der Lösung für ein unmögliches Problem suchte. Und immer hatte er auch eine gefunden, denn das war seine Gabe gewesen. Ehe Kai das Einzige getan hatte, was Bahadur niemals verzeihen konnte, und das Band zwischen ihnen zerrissen war.
Eine knappe Handbewegung – nicht der Gruß, den man einem Freund erbieten würde, sondern eine Geste, wie um einen streunenden Hund von der Herde zu verscheuchen. Eine Geste, der allzu oft bald ein geworfener Stein nachfolgte, oder ein Speer. Kai wusste, dass Bahadur dort stehen bleiben und ihn beobachten würde – falls nötig, bis die Sonne aufging, bis die römischen Peitschen seine Schultern berührten. Und trotzdem würde er nicht weichen, bis er sah, dass Kai vor ihm vertrieben wurde.
Kai tat einige stolpernde Schritte, fühlte sich plötzlich ungelenk in der Dunkelheit, wie Trauer manchmal die ganze Welt ins Wanken zu bringen scheint. Zurück ins Innere des Lagers, zur Sicherheit des Feuers, zu Lucius und der Gesellschaft anderer Männer. Und dann zu schlafen, zu träumen, wenn möglich zu vergessen.
Als er sich abwandte, sah er am Horizont ein neues Feuer entstehen. Eine große Blüte aus Gelb und Orange, die sich in den Himmel wölbte und dichten schwarzen Qualm hoch empor schickte. Zuerst hielt er es für ein Ritual dieses Landes, für ein Fest, um die Geister der Nacht zu vertreiben oder Segen für die Ernte zu erbitten. Wer konnte schon sagen, welch seltsame Gebräuche die Menschen hier pflegten, am Rand der Welt?
Dann aber sah er auch die Signalfeuer erwachen, helle Lichtpunkte, die den großen Wall in beide Richtungen entlang tanzten. Die Hörner schollen durchs Tal, dröhnten und hallten von den Steinen wider, eine Musik, die Kai auch fern im Osten vernommen hatte. In vielen Jahren des Krieges und der Beutezüge jenseits der Grenze war sie erschollen, und Kai und sein Volk hatten gelernt, diesen Klang zu fürchten, dem sie nun gehorchen mussten.
Das Alarmsignal der Legionen, das die Sarmaten in die Schlacht rief. Um für ihre neuen Meister zu sterben. Für Rom.
3
Blut in der Luft. Der Ruf der Jagd – Kai spürte ihn deutlich, obwohl von einem Feind nichts zu erkennen war. Nur der Klang der Hörner und die Feuer am Horizont.
Sie hatten keine Waffen, aber ringsum sah er, wie die Männer brennende Äste ergriffen und ihre Pferde bestiegen, um die Grenzen des Lagers zu verteidigen. Nirgendwo war Furcht zu spüren, nur eine wölfische Freude, dass sie endlich die Schlacht bekommen könnten, die man ihnen versprochen hatte. Da gab es nur noch einen Platz für Kai, den an Lucius’ Seite, und trotz der Dunkelheit hatte er seinen Anführer bald gefunden. Denn Lucius war der Einzige, der ganz still dort stand, eine Insel im Fluss der Männer, die in alle Richtungen strebten und im Vorbeigehen Befehle von ihm erhielten.
»Alarm?«, fragte Kai, sowie er neben Lucius stand.
»Ich weiß nicht, was ihn ausgelöst hat.«
Kai deutete in Richtung des großen Feuers im Osten. »Ein Signalfeuer?«
»Zu groß«, sagte Lucius beim Anblick der mächtigen Flamme und der Rauchsäule, die zum Himmel aufstieg. »Da muss ein Gebäude in Brand stehen. Vielleicht ein betrunkener Schmied, der seine Esse unbeaufsichtigt gelassen hat. Oder Plünderer südlich des Walls.«
»Was tun wir?«
»Feldposten ausschicken und die Hälfte der Männer zu Pferd das Lager umrunden lassen.«
»Keine Waffen?«
»Ich kann nicht fünftausend Mann im Dunkeln bewaffnen«, gab Lucius zurück. »Und wir sollten sie nicht brauchen, solange diese Plünderer nicht gekommen sind, um eine Armee anzugreifen.«
»Was ist mit den Wächtern auf dem Wall? Werden sie kommen und kämpfen?«
Lucius schüttelte den Kopf. »Sie werden zuallererst ihre Posten verteidigen. Bis zum Morgen kommen sie nicht raus.«
»Sich hinter Mauern verstecken, das ist eure Methode«, sagte Kai und reckte stolz das Kinn. »Mein Volk geht auf die Jagd.«
»Ich habe dir doch gesagt, ich kann im Dunkeln keine fünftausend Mann bewaffnen.«
»Dann lass zwanzig von uns ausreiten.«
Lucius schüttelte abermals den Kopf. »Wir kennen das Gelände nicht, und es bleibt keine Zeit, uns richtig auszurüsten.«
Kai spürte den Anflug eines Lächelns über seine Lippen huschen. »Dann haben sie vielleicht eine faire Chance.«
Einen Moment lang stand Lucius unschlüssig da – vielleicht fragte er sich, ob Kai seinem Jagdinstinkt folgte oder nur dem Wunsch eines einsamen Mannes nach dem Tod. Kai musste sich eingestehen, die Antwort selbst nicht zu kennen.
»Na schön«, sagte Lucius. »Nimm dir zwanzig Mann.« Er stockte. »Aber geht kein unnötiges Risiko ein. Ich werde dich wieder nach Sarmatien zurückbringen, zu deiner Tochter. Lass nicht zu, dass ich mein Versprechen brechen muss.«
Kai packte den Unterarm seines Anführers zum Abschiedsgruß unter Kriegern. Dann war er zwischen den Schatten seiner Männer verschwunden und suchte jene, die ihn begleiten sollten.
Ihm blieb keine Zeit, alle zusammenzusuchen, die ihm vertraut waren – er würde auf Glück und Schicksal und die Götter vertrauen müssen. Er warf sich ins Meer seines Volkes, ließ sich von den Wellen und Strömungen der Männer treiben, die ihn umspülten, suchte nach etwas, das er nicht benennen konnte. Er sah eine Kriegsmeute auf ihren Rössern, die gemeinsam Schlachtenlieder sang, aber als er näher kam, roch er den Wein in ihren Atemwolken und nahm Abstand davon, sie zu sich zu rufen. Ein Stück weiter sah eine andere Gruppe ebenfalls wie erfahrene Krieger aus, doch dann schien das Licht der Flammen in ihre Augen, die gleichsam leer und von stumpfer Todessehnsucht erfüllt waren – Männer, die Speerspitzen suchten, auf die sie sich werfen konnten.
Endlich erreichte er eine Gruppe Sarmaten, die still und stumm in der Dunkelheit standen. Und in ihrer Stille fand er, wonach er gesucht hatte.
»Ich brauche zwanzig Reiter«, sagte er, als er zwischen sie trat. »Nur die, die fähig sind, zu reiten und zu kämpfen. Lügt mich nicht an, falls ihr krank seid, ihr würdet uns nur aufhalten.«
Sofort scharten sie sich um ihn, streckten die Hände nach ihm aus, starrten ihn wild vor Verlangen an. Er bat sie, sich einem Kampf im Dunkeln zu verschreiben, gegen unbekannte Feinde von unbekannter Zahl, aber sie zögerten nicht. Nichts anderes hatte er von seinem Volk erwartet.
Reihum fasste er sie bei den Händen, zählte bis zwanzig, und so war es vollbracht. Keine Zeit, um festzustellen, ob es Freunde waren oder Fremde, mit denen er ausreiten würde, gestählte Krieger oder Knaben ohne jede Erfahrung, ehe er sie zu den Pferden führte, die in ihrem Pferch aufstampften und die Köpfe herumwarfen, nicht weniger begierig auf einen Kampf als ihre Reiter. Monströse Schlachtrösser einer Rasse, die in diesem Land nie zuvor gesehen worden war – massig wie bei professionellen Ringern tanzten die Muskeln unter ihrer Haut. Pferde, die zum Kämpfen und Töten gezüchtet worden waren. Sie hatten leuchtende Augen und die Häupter hoch erhoben, denn nie waren sie besiegt worden. Es waren nicht die Pferde, die sich Rom gebeugt hatten.
Lucius stand ein Stück voraus bei den Vorratskarren und verteilte in der harten Sprache der Römer Befehle an jene, die die Wagen bewachten. Und die Sarmaten, die Kai um sich versammelt hatte, saßen auf und warteten geduldig auf diese Gelegenheit, ihre Ehre wiederherzustellen. Darauf, dass der lange Weg der Scham endlich hinter ihnen liegen sollte und sie ihre Waffen wieder tragen durften.
Sie sahen zu, wie die langen Bündel von den Karren gehoben wurden, fest vertäut und in gewachste Tierhäute geschlagen, um sie vor dem Regen zu schützen, als wären es Seidenballen von unschätzbarem Wert. Dann wurden sie entpackt und unter den Sternen ausgebreitet, die großen Speere ihres Volkes, die langen beidhändigen Lanzen der Steppe. Mit ihnen hatten sie römische Legionen gebrochen, die Daker vor sich hergetrieben und stolz um ihre Freiheit gekämpft. Nun mochten sie stattdessen etwas anderes zurückgewinnen. Kai schloss die Finger um die Lanze, die man ihm reichte, und fühlte sich endlich wieder vollständig.
»Reitet sachte«, sagte er zu den anderen, »und achtet auf den Untergrund. Sollte euer Pferd lahmen, kehrt allein um und sorgt dafür, dass ihr spätestens bei Morgengrauen wieder im Lager seid. Wer später zurückkommt, den werden sie als Deserteur hinrichten. Verstanden?«
Zwanzig Reiter nickten ihm zu und neigten die Speere zum Kriegergruß.
Hinaus in die Nacht – zerklüfteteres Gelände, als sie es aus der Steppe gewohnt waren, flache Hügel mit Heidekraut und Farn als mögliche Fallstricke für unachtsame Pferde, durchzogen von Sumpf und Schlamm. Die Luft war erfüllt von fremdartigen Gerüchen – Wildblumen und Birkenrinde, dazu der reiche Duft des Heidekrauts nach Regen und Sonne. Und auch von fremdartigen Geräuschen: Vogelrufe, die ihm nicht vertraut waren, überlagerten den bekannten wunderbaren Klang von Hufen, die auf vom Regen aufgeweichte Erde schlugen.
Sie bildeten eine breite Linie, bewegten sich gleichmäßig und achtsam durch die Finsternis und strebten in weitem Bogen zu einem Punkt nördlich der Stelle, wo das große Feuer brannte. Sie suchten eine Fährte – ein hoffnungsloses Unterfangen, wie es schien, denn obwohl das Gelände größtenteils frei vor ihnen lag, hatten sie nichts als den fahlen Halbmond, der sie leitete, und der Regen fiel in dichten Schleiern, die vom Wind verweht wurden und das Land verhüllten. Sie mochten in wenigen Pfeilschüssen Entfernung an ihrer Beute vorbeireiten und sie nicht entdecken, stundenlang nach einer Fährte suchen, die längst erkaltet war. Kai aber spürte das Flüstern eines Gottes in seinem Ohr und senkte schließlich den Speer in Richtung einer bestimmten Stelle am Horizont.
»Da hinten am Wall, bei diesem Kastell, wo kein Licht brennt. Dorthin müssen sie unterwegs sein.«
Sie bewegten sich jetzt schneller, denn die Pferde wurden vertrauter mit dem Gelände, und die Reiter saßen erwartungsvoll in ihren Sätteln. Sie waren in einem fremden Land und stellten Feinden nach, deren Bewaffnung und Anzahl sie nicht kannten. Aber in diesem Moment hätte Kai all die Jahre des Sklavendaseins für eine Nacht als Jagdherr eingetauscht.
Ob durch Glück oder Schicksal, irgendwann stolperten sie fast über ihr Ziel – Furchen von Wagenrädern, flankiert von schweren Hufabdrücken. Unter anderen Umständen eine unscheinbare Fährte, aber sie erkannten sofort, dass sich der Regen noch in den frischen Furchen sammelte, die nordwärts auf den Wall zuhielten. Als Kai sich nach seinen Leuten umdrehte, sah er sie grinsen. Ihre Zähne leuchteten hell unter den Sternen.
Ein Mann, den er nicht kannte, erhob die Stimme. »Vielleicht halten die Bauern in diesem Land ihre Märkte im Mondlicht ab.«
»Mag sein«, gab Kai zurück und tippte gegen den Schaft seiner Waffe. »Also lasst sie uns finden und schauen, was sie gegen unsere Lanzenspitzen tauschen wollen.«
Noch schneller ging es weiter. Die Pferde schwenkten ungeduldig die Köpfe – vielleicht witterten sie Dinge in der Nachtluft oder sahen etwas, das die Augen der Menschen nicht ausmachen konnten. Denn jeder Sarmate wusste, dass Pferde die Toten sehen konnten, und dieses Land sah aus, als wimmelte es darin von Geistern.
Ein Umriss in der Dunkelheit – der Karren eines Bauern; ein Rad war gebrochen und zur Seite geneigt. Im Näherkommen sahen sie, dass er schwer mit Getreidesäcken und geschlachteten Schweinen beladen war.
»Sie haben ihre Beute zurückgelassen«, sagte einer der Reiter. »Sie laufen davon.«
»Dann fangen wir sie ein«, gab Kai zurück.
Der schnellste Reiter an der Spitze beugte sich so weit im Sattel vor, dass er fast hinabzufallen schien. Er untersuchte die Spuren am Boden, pfiff und schnalzte mit der Zunge, um die anderen wissen zu lassen, wohin sie sich wenden mussten. Hoch ragte der Wall vor ihnen auf dem Grat des Hügels empor wie ein düsteres Monument für einen rachsüchtigen Gott.
Und da erblickte Kai sie, als Umrisse oben auf dem Hügel – Pferde und Reiter, die eilig gen Norden strebten. Auch wenn er nicht genau ausmachen konnte, wie viele sie waren. Unter diesen Schatten aber stach einer heraus, der wie ein Riese zwischen den restlichen Plünderern wirkte und auf einem Pferd saß, das seine Artgenossen um die Hälfte zu überragen schien.
Dieser große Mann rief seiner Truppe einen Befehl zu, von dem nur Fetzen an Kais Ohr drangen; verwischt von Wind und Regen klang es eher wie das Heulen eines Tieres als nach menschlicher Sprache. Und doch kam es Kai seltsam vertraut vor – fast konnte er es verstehen, wenn nicht die Worte selbst, so doch ihre Bedeutung. Dann hallten Schreie durch die Luft, und mehrere Plünderer fielen aus ihren Sätteln. Schwarzes Blut wallte im fahlen Mondlicht auf.
Keine Zeit, sich einen Reim darauf zu machen oder zu begreifen, was vorgefallen war, keine Zeit. Der Kampfrausch hatte sich seiner bemächtigt, sperrte Nachdenken und Erinnerung aus. Ein zitternder Schrei brach aus seiner Kehle hervor, damit war die Jagd eröffnet. Und wie als Antwort auf diesen Schrei sah er den großen Mann, den Anführer der Plünderer, sein mächtiges Ross von ihnen abwenden. Direkt nach Norden, in Richtung des Walls.
Es kroch ihm wie ein Omen über die Haut, den Feind fliehen zu sehen – denn er wusste, dass nichts mehr zählte, als diesen Mann zu töten. Da erscholl ein Pfeifen, und die Speere der Plünderer gingen zwischen den Sarmaten nieder. Kai hörte die spitzen Schreie ganz in der Nähe und die nassen Schläge von Pferden und Reitern, die zu Boden gingen.
Keine Zeit, einen Gedanken an die Gefallenen zu verschwenden oder an den großen Mann, der nach Norden floh. Er konnte nur an die Lebenden vor sich denken, an die Männer, die er töten musste. Er packte die Lanze mit beiden Händen und lenkte sein Pferd zwischen die Schatten in der Dunkelheit, dann der entsetzliche Ruck, als seine Waffe ins Fleisch drang, das Zerren und Drehen, als der Mann vor ihm aus dem Sattel gehoben wurde, wie im Flug in der Luft verharrte und dann gebrochen mit einem letzten Kreischen auf die Erde fiel und zur Seite rollte.
Die Sarmaten auf ihren großen Schlachtrössern mussten in der Finsternis wie Monster wirken, wie Riesen mit übergroßen Waffen, als sie die Plünderer in einem einzigen Sturmangriff in Stücke rissen. Kurz überkam ihn eine seltsame Scham, weil diese Feinde so einfach zu töten waren, und schon sah er die verbliebenen Plünderer die Speere fortwerfen und die Hände in die Höhe recken; die wortlosen Kriegsschreie verzerrten sich zu einer Sprache, die zweifelsfrei von Kapitulation kündete, auch wenn Kai die Worte nicht verstand.
Er rief seinen eigenen Reitern zu, diesen Schlächtern, die er durch die halbe Welt geführt hatte – rief sie zurück und befahl ihnen, Gnade walten zu lassen. Sie schienen ihn nicht zu hören. Ein Jahr der Schande lag hinter den Sarmaten, und dieses Jahr wollten sie mit Blut von sich abwaschen. Immer wieder stießen die Lanzen herab, und auch die Pferde töteten nicht weniger begierig als ihre Reiter, denn sie stampften mit ihren scharfen Hufen auf, bis auch der letzte Plünderer reglos auf der Erde lag.
Großes Schweigen. Nur Wind und Regen rollten weiter über sie hinweg, als der Kampfrausch langsam aus ihren Leibern wich und Pferde wie Reiter unter der seltsamen Kälte erzitterten, die sich nach dem Töten einstellt. Die letzte geisterhafte Berührung der Erschlagenen, wenn sie diese Welt verlassen und ihren Weg in die nächste antreten. Kai rutschte von seinem Ross und sah die Männer an, die sie niedergemacht hatten.
Ihre Pferde waren eher Ponys. Kleine gedrungene Tiere, bestens an die raue Landschaft angepasst, den sarmatischen Schlachtrössern jedoch hoffnungslos unterlegen. Die Gesichter ihrer Reiter waren rußgeschwärzt, nur an manchen Stellen leuchtete unter der Farbe blasse Haut hervor. Kai entdeckte die Wirbel und verschlungenen Formen von Tätowierungen, die ganz anders aussahen als seine eigenen – Knoten und Muster statt der Tierfiguren, mit denen die Sarmaten ihre Körper verzierten. Auch trugen sie keine Rüstungen, nur vereinzelt lagen kleine viereckige Schilde im Gras. Kai hob einen ihrer schön gearbeiteten Speere auf – er war kaum halb so lang wie die Lanzen der Sarmaten, aber eine prächtig polierte Waffe aus Esche und Eisen, am Übergang vom Schaft zur breiten Metallspitze geschmückt mit Federn und Amuletten. Ringsum sah er auch andere aus seinem Volk eilig diese schönen Waffen als Trophäen an sich nehmen, zum Zeichen, dass sie erfolgreich getötet hatten. Einige knieten mit gezückten Messern da, um weitere Trophäen zu nehmen, Trophäen aus Fleisch. Da erst sah er die Frauen und Kinder zwischen den Toten.
Keine Kriegerinnen, denn sie trugen einfache bäuerliche Kleidung, und ihre Hände waren mit Seilen gefesselt. Kai erinnerte sich an den lauten Befehl und die blutig herabstürzenden Körper, ehe der Kampf begonnen hatte.
»Sie müssen Gefangene gemacht haben, die sie als Sklaven über den Wall fortschaffen wollten«, sagte er halb zu sich selbst.
Und als er die Toten betrachtete, sah er einen, der zurückstarrte.
Einen Knaben, der reglos auf dem Boden lag, noch immer fest in den Armen seines Entführers wie im Schutz des eigenen Vaters. Das Kind lag so still da mit seinem blutverschmierten Gesicht, dass Kai es erst für tot hielt und das Licht in seinen Augen für einen Streich des Mondlichts. Bis ihn diese Augen anblinzelten, nur einmal, ganz langsam.
Kai faltete die Arme des Reiters auseinander und hob den Jungen hoch. Ein Kind von vielleicht acht Sommern, der Blick leer und matt. Schon oft hatte Kai diesen Ausdruck in den Augen eines Kindes gesehen, denn in der Steppe gab es viele, die ihre Familien an Krankheit oder Fehde verloren hatten oder als Geiseln verschleppt worden waren und ihrem Stamm erst zurückgegeben wurden, nachdem man bösen Spaß mit ihnen getrieben hatte, blutbefleckte Überlebende der Überfälle, die ihre Sippe in Stücke gerissen hatten. Gebrochene Überlebende. Manchmal genasen sie wieder, manchmal nicht.
Kai hob den Kopf und sah jene an, die mit ihm geritten waren. Eine trügerische Stille hatte sich um ihn gesenkt, eine Stille, die ihm nicht gefiel. Er sah, dass sie alle wie im Gebet vertieft waren und in dieselbe Richtung blickten. Sie schauten weder ihn noch das Kind an. Sie schauten nach Norden, in Richtung des Walls.
Ein böses Bauwerk, aus dieser Nähe betrachtet. Von Ost nach West durchzog es die Landschaft, und kein Ende in Sicht. Vielleicht lief es ewig weiter, schloss die ganze Welt ein, fesselte die Erde mit einer Kette aus Stein. Als er ihren Blicken folgte, sah er, dass sie eine bestimmte Stelle des Walls betrachteten. Das kleine Meilenkastell direkt voraus, diesen einen Abschnitt des Walls, wo die Fackeln erloschen waren. Kein Anzeichen mehr von dem großen Reiter, der nach Norden geflohen war, aber es konnte kein Zweifel daran bestehen, wohin er sich abgesetzt hatte. Denn das Tor dort stand offen, und jenseits konnte Kai den Himmel und die Sterne und die weite Ebene erkennen. Das Ende des römischen Imperiums. Ein freies Land.
Einer der Sarmaten, ein Mann, den Kai nicht kannte, sah ihn an und grinste. »Sollen wir?«
Der Plan eines Irren. In tiefer Dunkelheit in den unbekannten Norden zu fliehen, um zweifellos auf Verwandte der Männer zu stoßen, die sie soeben umgebracht hatten, deren Blut noch frisch an ihren Lanzenspitzen glitzerte. Trotzdem spürte Kai es genau wie sie, den Ruf der weiten Landschaft wie das Flüstern einer Geliebten. Das Verlangen nach Freiheit.
Ein Druck an seiner Hand, als das Kind sich an seine Finger klammerte. Und Kai beugte sich hinab und drückte den Jungen an sich. »Denkt an eure Eide«, sagte er. »Vergesst nicht, dass ihr sie auf eure Klingen abgelegt habt. Denkt an die fünfundzwanzig Jahre. Denkt an die Heimat, die ihr wiedersehen werdet.«
Eine andere Stimme antwortete aus der Dunkelheit. »Nicht immer bedeuten dir Eide so viel.« Und Kai erschauderte. Denn es war die Stimme einer Frau gewesen, einer Frau, die er sehr gut kannte.
Sie war nicht von mächtigem Wuchs wie die Helden aus den alten Geschichten. Nur ein Schatten von vielen und leicht zu übersehen. Trotzdem hätte er sie früher erkennen müssen, denn niemand kämpfte wie sie.
Die meisten kannten sie nur bei ihrem Kriegsnamen – Grausamer Speer. Er aber hatte sie gekannt, lange bevor sie zum Helden ihres Volkes geworden war, und kannte auch ihren richtigen Namen. Laimei – seine Schwester.
»Du hast doch nicht geglaubt, ohne mich auf die Jagd gehen zu können, Bruder?«
»Die Römer haben unseren Frauen das Kämpfen verboten«, antwortete er.
»Du hast nach zwanzig Reitern gefragt und zwanzig Reiter bekommen. Kein wahrer Sarmate würde meinen Platz in dieser Gruppe infrage stellen.« Sie zuckte mit den Schultern. »Aber ein Römer wohl, da hast du recht. Hältst du dich jetzt für einen von ihnen, nachdem du dir die Zeichen deines Stammes aus den Wangen geschnitten hast? Einer von uns bist du jedenfalls nicht.«
Die anderen setzten sich in Bewegung und versammelten sich nach und nach hinter ihr. Sie reckten die Hände nach ihrer Speerspitze und markierten ihre Stirnen mit den blutbenetzten Fingern. Denn weit im Osten war sie eine große Heldin ihres Volkes gewesen, eine, die hoch in der Gunst der Götter stand. Wieder und wieder hörte er die Reiter dieselben Worte flüstern. Grausamer Speer.
Kai deutete auf das Kastell und das Tor, den freien Weg in den Norden. »Hast du vor, den Wall zu durchqueren und deinen Eid zu brechen?«
»Mir haben sie keinen Eid abgenommen«, sagte sie. »Sie haben es nicht für nötig gehalten, die Frauen schwören zu lassen.«
»Ziehen wir also nach Norden?«, fragte einer der anderen. »Wir folgen deinem Befehl.«
Sie schwieg eine Zeit lang, neigte den Kopf und lauschte dem Wind, als wartete sie auf ein Omen.
»Nein«, sagte sie schließlich. »Ich will nicht, dass ihr eure Eide brecht. Ihr seid nicht wie mein Bruder.«
»Dann kehren wir um«, sagte Kai. »Mit Trophäen unseres Sieges und Blut an unseren Speeren.«
»Vielleicht«, sagte sie. »Vielleicht gibt es hier draußen aber auch noch mehr Blut zum Vergießen.«
»Sollen wir ihn töten?«, fragte einer der Männer. »Sag es nur, und es wird geschehen. Niemand wird davon erfahren. Unsere Speere sind dein.«
Sie antwortete nicht, und so wartete Kai, während sich die Männer in der Dunkelheit um ihn versammelten. Seine Hände lagen schlaff auf dem Speerschaft. Er spürte den Klammergriff des Jungen, den er gerettet hatte, und fuhr dem Burschen mit einer Hand durch die zerzausten Haare. Da war keine Furcht in seinem Herzen – aber dies weder aus Tapferkeit noch aus der Gewissheit, dass sie ihn verschonen würde. Nur hatte er solch einem Urteil bereits ins Auge geblickt, während der langen und bitteren Fehde mit seiner Schwester, die weit im Osten begonnen hatte. Schon einmal hatte er vor seiner Schwester gestanden und auf ihre Entscheidung gewartet, ob er leben oder sterben sollte. Damals hatte er all seine Furcht aufgebraucht.
Der Schatten seiner Schwester schüttelte den Kopf. »Kein Grund, jemanden zu töten, der bereits tot ist. Denn was ist ein Mann ohne Stamm, wenn nicht ein Leichnam, der bloß noch atmet?« Sie wandte den Blick ab und betrachtete die stillen Umrisse, die im Gras verstreut lagen. »Außerdem haben wir diese Nacht genug tote Sarmaten gesehen.«
Der Bann war gebrochen, der Blutdurst so schnell verflogen, wie er aufgekommen war. Einer der Männer trat vor und umfasste Kais Unterarm, als wären sie Brüder, und gemeinsam zogen sie los, um ihre Gefallenen zu bergen.
Zwei waren von Wurfspeeren getötet worden, und Kai hörte anerkennendes Raunen, dass diese Plünderer in der Dunkelheit so gut gezielt hatten. Ein weiterer war von einem Speerstoß getroffen worden und unter die Hufe des eigenen Pferdes geraten. Ein glücklicher Tod, so sahen es die Sarmaten, denn auf diese Weise riefen die Götter oft ihre bevorzugten Menschen zu sich, die weder durch die Hand von Männern oder Frauen noch durch das langsame Siechtum des Alters fallen sollten – stattdessen erwählten die Götter ein Pferd zum Henker.
Einer der Toten hatte noch keine zwanzig Sommer gesehen, die anderen beiden waren kaum älter. Sie waren gekommen, um ihre Jahre abzuleisten und von der Heimat zu träumen. Nicht eine Woche hatten sie auf ihrem neuen Posten überlebt. So erhob sich ein Gesang um ihre Leiber. Keines der alten Lieder oder Totengebete, denn hier, in diesem Augenblick, wurde ein neues Ritual geboren. »Fünfundzwanzig Jahre«, riefen sie wieder und wieder im Chor. Ein Gebet nicht für ihre gefallenen Kameraden, sondern für sie selbst, erfüllt von der Hoffnung, dass sie eines Tages nach Hause zurückkehren würden.
4
»Ein Tag nur.« Der Präfekt von Cilurnum beugte sich vor und stützte den Kopf in die Hände. »Warum konnten sie nicht noch einen Tag warten?«
Lucius Artorius Castus stand stramm und antwortete nicht. Er hielt den Blick auf eine Stelle ein Stück oberhalb vom Kopf des Präfekten gerichtet und begutachtete die Wand dort, den rissigen Verputz und die Fresken von Göttern und Helden, dazwischen ein Phallus als Glücksbringer. Die übliche Dekoration für das Quartier eines Kommandeurs im Herzen eines römischen Heerlagers. Sein Volk herrschte nun über die halbe Welt, und wo immer sie hinkamen, erfüllt von Stolz auf ihr Reich oder Sehnsucht nach Andenken an die Heimat, brachten sie ihre Kunst mit sich – denselben weißen Putz, dieselben Wandmalereien. Hätte man ihn mit verbundenen Augen in diesen Raum geführt, er hätte sich überall im Imperium wähnen können, sogar in Rom selbst. Bis der harsche Wind wieder auffrischte und sich durch Risse im Mauerwerk bis ins Innere des Gebäudes schlich – die ständige Erinnerung daran, dass sie sich am Rand des Reiches befanden, so fern der Heimat wie nur möglich.
Und genau wie Cilurnum ein Spiegelbild jedes Heerlagers im ganzen Reich war, galt das auch für seinen Präfekten Glaucus Montanus. Männer wie ihn hatte Lucius immer wieder erlebt – einst mochte Glaucus ein guter Soldat gewesen sein, nun aber lagen seine Augen tief in den Höhlen, seine Arme waren dünn und seine Bewegungen zögerlich. Ein altes Sprichwort der Legion kam Lucius in den Sinn – ein fetter Präfekt war ein Dieb, ein dünner ein Bestohlener.