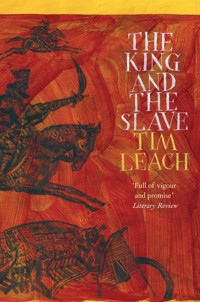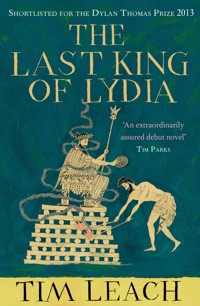7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Sarmaten-Trilogie
- Sprache: Deutsch
173 n. Chr. An den Ufern der zugefrorenen Donau versammeln sich die Clans der Sarmaten. Der Winter in der kargen Ebene war hart, und um zu überleben müssen sie den gefrorenen Fluss überqueren. Doch auf der anderen Seite des Eises liegt das Römische Reich, und vor ihnen steht eine ganze Legion. Die Sarmaten sind mit einer starken Kavallerie angerückt, darunter der junge Krieger Kai. Nach Jahren des Krieges ist das stolze sarmatische Volk der einzige Stamm, der den Römern noch die Stirn bietet. Doch diesmal haben sie keine Chance. Nach heftigen Kämpfen erwacht Kai auf einem blutigen Schlachtfeld. Verletzt und gezeichnet von der Schmach der Niederlage begibt er sich auf eine beschwerliche Reise in sein Heimatdorf. Doch dort erwartet ihn die bittere Erkenntnis, dass sich die Römer nicht mit dem Sieg zufriedengeben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
173 n. Chr. An den Ufern der zugefrorenen Donau versammeln sich die Clans der Sarmaten. Der Winter in der kargen Ebene war hart, und um zu überleben, müssen sie den gefrorenen Fluss überqueren. Doch auf der anderen Seite des Eises liegt das Römische Reich, und vor ihnen steht eine ganze Legion. Die Sarmaten sind mit einer starken Kavallerie angerückt, darunter der junge Krieger Kai. Nach Jahren des Krieges ist das stolze sarmatische Volk der einzige Stamm, der den Römern noch die Stirn bietet. Doch diesmal haben sie keine Chance. Nach heftigen Kämpfen erwacht Kai auf einem blutigen Schlachtfeld. Verletzt und gezeichnet von der Schmach der Niederlage begibt er sich auf eine beschwerliche Reise in sein Heimatdorf. Doch dort erwartet ihn die bittere Erkenntnis, dass sich die Römer nicht mit dem Sieg zufriedengeben …
Autor
Informationen zu Tim Leach und seinen Romanen finden Sie am Ende des Buches
TIM LEACH
DERWINTERKRIEG
DIE CHRONIK DER SARMATEN
Historischer Roman
Aus dem Englischenvon Julian Haefs
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »A Winter War« bei Head of Zeus, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung November 2023
Copyright © der Originalausgabe 2021 by Tim Leach
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Arcangel Images/Collaboration JS; gettyimages/Ahmet Tokucu; Trevillion images/Stephen Mulcahey; FinePic®, München Redaktion: Susanne Bartel
Karte: © Peter Palm, Berlin
BH · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30951-0V001
www.goldmann-verlag.de
Für Ness
Teil 1
Der Fluss aus Eis
1
Aus der Ferne hätte die Armee aus Statuen bestehen können. Oder aus Toten.
Sechstausend Reiter auf einer weiten Ebene aus Eis und Schnee, in einem Land, das nicht so aussah, als könnte dort etwas überleben. Der Wind schüttelte ihre langen Speere wie ein Sturm, der durch einen Winterwald fegt, die Pferde aber rührten sich nicht, und unterhalb der eng sitzenden Helme und dicken Fellkapuzen lagen die Augen der Männer scheinbar leblos in dunklen Höhlen. Aus einiger Entfernung mochte man sie für ein gewaltiges Monument halten, aus dem Fels gehauen für einen vergessenen König oder für die Armee eines längst vergessenen Krieges, durch Zauber oder Fluch an diesen Ort gebunden und dazu verdammt, auf ewig stillzustehen und auf einen Befehl zu warten, der niemals kommen würde.
Erst bei näherer Betrachtung waren die kleinen Wirbel aus Atemluft erkennbar, die von ihren Lippen aufstiegen, und hier wie dort einzelne Pferde, die den Kopf zurückwarfen oder im Schnee aufstampften. Noch näher, und auch das leise, ungeduldige Wiehern und Schnauben der Pferde war zu hören, die erpichter auf den Kampf zu sein schienen als die Männer auf ihren Rücken. Die Tiere dachten nur an die brausende Freude des Angriffs, an die Woge aus Hufen und Muskeln, denn anders als die Männer, die sie trugen, hatten sie keine Vorstellung vom Tod. Ihre Reiter starrten stumm auf den gefrorenen Fluss und warteten darauf, dass die Römer das Eis überquerten.
Ein Stück weiter in der ersten Reihe neigte sich ein Speer, als ein Krieger die Waffe auf dem Nacken seines Tieres ablegte. Die Stute schnaubte protestierend. Sie und ihr Reiter waren in Rüstungen aus schillernden Horn- und Knochenschuppen gehüllt, die wie eine zweite Haut saßen. Als der Reiter jedoch seine Handflächen auf den Speerschaft legte und ihn über ihren Widerrist rollen ließ, verstummte der Protest. Die Stute gab sich der Berührung hin und erschauderte vor Wonne.
Der Reiter daneben schüttelte den Kopf. »Ich glaube, Kai, du liebst dieses Pferd mehr als meine Frau mich.«
»Und warum nicht?«, gab der Angesprochene zurück. »Meine Stute hat ja auch mehr Liebe verdient als du. Sie ist tapferer. Und deutlich hübscher.« Er schlug die Fellkapuze zurück und entblößte seine Zähne zu einem freundlichen Grinsen.
Gelächter, um die Stille zu brechen – leise zwar und halb verkniffen, aber doch hörbar, wie es durch die Reihen lief. Selbst mancher, der den Scherz nicht gehört haben konnte, grinste schnell, tätschelte sein Ross oder reckte den Speer, um die kalten Muskeln geschmeidig zu machen. Für einen kurzen Moment war die Armee zu neuem Leben erwacht.
Bahadur, der zweite Reiter, versetzte Kai einen Schlag auf den Hinterkopf, ein Kuss aus Leder und Bronze, erwiderte aber auch das Lächeln. Dann beugte er sich vor, kam nahe genug, dass Kai jede Linie der Tätowierungen auf seinen Wangen erkennen und die grauen Haare in seinem Bart zählen konnte. »Bring sie noch mal zum Lachen, wenn du kannst. Viele haben Angst.«
Das letzte Wort wirkte wie ein Zauber, denn kaum war es ausgesprochen, schien die Luft wieder dünn und kalt zu werden wie auf einem hohen Pass in den Karpaten. In ihrem Volk wurde nichts und niemand so verehrt wie ein Krieger, kein Handwerk bewundert, nur das mit Speer und Pferd, kein Tod für süßer erachtet als jener, der in der Spitze einer Schwertklinge lauert. Und trotzdem hätte sich nur ein Wahnsinniger in dieser Situation nicht gefürchtet, denn die Sarmaten wussten zu gut, was ihnen über das Eis der Danu entgegenkam.
Kai spähte über den zugefrorenen Fluss, schützte seine Augen mit einer behandschuhten Hand vor dem feinen Flockenflug. Kaum was zu sehen da draußen, selbst wenn sich der Nebel gelichtet hätte. Im Sommer hätte man vielleicht Boote auf dem Fluss erblickt, Händler, die kamen, um Wein und Düfte, Felle und Bernstein einzutauschen. Oder Fischer, die sich um den Segen des Flussgottes bemühten, damit ihre Familien keinen Hunger leiden müssten. Doch sogar im Sommer schlichen sich die Händler wie Diebe über das Wasser, und die Fischer wagten nicht, lange zu verweilen. Denn die Danu war eine Grenze, und jenseits des Stroms lag mehr als nur ein anderes Land. Dort lag eine andere Welt.
Am anderen Ufer dieses Flusses begann das Römische Reich. Mit dem Gold eines Häuptlings am Hals einer jeden Frau und einem Schatz aus Eisen in der Hand eines jeden Mannes. Viel wichtiger aber: mit genug Weizen und Vieh, um alle Stämme der Sarmaten gleich doppelt zu ernähren. Für diese, die dank kränklicher Viehherden und verdorbener Ernte in diesem Winter schon halb verhungert waren, gab es auf der anderen Seite des Wassers schlicht Leben; Leben so nah, dass sie es fast berühren konnten.
Fast. Denn jenseits des Eises wartete der Feind. Ein Feind, dessen Name ihnen als Warnung für Kinder oder als finsterer Fluch gegen rivalisierende Stämme diente. Kai hatte diesen Feind in der Schlacht besiegt gesehen, seinen General bei lebendigem Leib aufgeschlitzt, aufgespießt und schreiend den Aasvögeln überlassen als Abschreckung für dessen Volk. Trotzdem waren die Römer zurückgekommen. Die Markomannen, ein anderer Stamm, hatten Kastelle und Städte niedergebrannt und den Kampf fast bis in Sichtweite Roms getragen, dennoch waren die Legionen unerschrocken zurückgekehrt. Selbst die Götter hatten vor einigen Jahren die Römer mit einer Pest verflucht. Die Leichenfeuer hatten bis in den Himmel gelodert und ganze Armeen verschlungen, bis es schien, als könnte es westlich der Danu kein menschliches Leben mehr geben. Und trotzdem saßen sie da in ihren Kastellen, kaum zwei Meilen entfernt, irgendwo jenseits des Eises. Denn offenbar konnten selbst die Götter diese Männer nicht töten.
»Wir sind die Letzten«, sagte Kai.
»Was?«
»Die Letzten, die noch gegen Rom kämpfen. Die Markomannen haben ihren König verloren. Die Quaden haben Rom nach dem Wunder des Regens den Treueeid geleistet. Die Daker …« Bei deren Erwähnung murmelte Bahadur eine finstere Verwünschung, und Kai sagte nichts weiter über sie, stattdessen stellte er fest: »Außer uns ist niemand mehr übrig, um die Römer zu bekämpfen. Was hat das zu bedeuten?«
Unter Kapuzenumhang und Helm war Bahadurs Miene nicht zu lesen. Nur seine Augen blitzten hell auf – war es aus Wut oder Trauer eingedenk Kais letzter Worte, dieser Worte, aus denen um ein Haar ernster Zweifel gesprochen hatte?
»Es bedeutet, dass wir hier heute gewinnen müssen«, sagte der Ältere, »falls wir in diesem Winter noch etwas zwischen die Zähne bekommen wollen. Falls wir weiter frei sein wollen. Was glaubst du denn, was es sonst zu bedeuten hat?«
»Dass unsere Großväter Skythien niemals hätten verlassen sollen. Dass unser Volk tief im Osten im Grasmeer hätte bleiben sollen.«
»Selbst dort hätten sie uns irgendwann heimgesucht. Nur ein bisschen später, das ist alles.«
»Dann sollten wir sie besser jetzt bekämpfen«, sagte Kai. »Bevor es unsere Kinder an unserer statt tun müssen.«
Ein kurzer Aufschrei erklang nach diesen Worten – nicht von Bahadur, sondern von dem Reiter hinter ihm, einem Jungen, der zusammengesunken auf seinem Pferd saß und zitterte und weinte. Er war zu jung für die Kriegsmeute, verschwand fast in seiner Rüstung und hätte mindestens noch einen weiteren Sommer haben sollen, ehe er sich mit seinem Speer zu ihnen gesellte. Aber ihre Reihen waren voll von solchen wie ihm, die eigentlich nicht kämpfen sollten – von grauhaarigen Alten, die ihre Speere kaum noch halten konnten, und von Burschen, die sich besser in der Steppe um ihre Schafherden gekümmert hätten. Es war Bahadurs Sohn Chodona, der mit seinen Tränen Scham auf sich lud, aber sein Vater legte den Arm um ihn, zog ihn an sich und wirkte den wortlosen Zauber, mit dem ein Vater die Angst seines Kindes vertreiben kann.
Kai betrachtete die beiden und spürte die feige Hoffnung aufkeimen, die Römer könnten nicht auftauchen. Sollten sie doch in ihren Kastellen jenseits des Flusses bleiben, damit der Junge zu einem Mann heranwachsen durfte.
Aber die Hoffnung war vergebens. Ein Geräusch hallte über die Danu, rollte durch den Nebel. Zuerst hielt Kai es für das Brechen und Knacken des Eises oder für das Echo eines fernen Sturms, der dröhnend über das weite Land fegte. Doch bald gab es keinen Zweifel mehr, worum es sich handelte.
Saß man abends am Lagerfeuer, erzählten Mütter ihren Kindern mit leiser Stimme Geschichten von diesem Geräusch. Krieger sprachen davon, wie sie sich gefühlt hatten, als sie es zum ersten Mal hörten; als wäre ein gewaltiges Monster aus den Abgründen einer anderen Welt emporgeklettert, um auf zehntausend Füßen durchs Land zu kriechen. Wohin auch immer es sich wandte, überall hinterließ es Berge aus Leichen, zu viele Tote, um sie alle zu ehren und mit Eisen und Gold ins nächste Leben zu schicken. Und für all jene, die überlebten, hielt das Monster eine andere Art von Tod bereit. Den Tod durch Unterwerfung und Sklaverei.
Eine Armee im Gleichschritt. Der Klang einer marschierenden Legion.
Das Geräusch traf die Reiter wie ein Fluch. Die leisen, ermutigenden Worte, die Prahlereien und die bösen Scherze – nichts davon war mehr zu hören. Die Reiter zogen ihre Umhänge enger, selbst die stolzen Pferde gaben keinen Laut mehr von sich. Auch sie hatten diesen Lärm schon oft gehört. Hart erkämpfte Siege, bittere Niederlagen; Rückzüge, die sie weit über Steppe und Ebene verstreut hatten. Ob Sieg oder Niederlage, nichts änderte etwas daran, dass die Legion weitermarschierte.
Kai hörte, wie Bahadur sich neben ihm auf dem Pferd zurechtsetzte. Die Schuppen seiner Rüstung stießen aneinander, klimperten wie ein Windspiel. Die Kapuze glitt dem älteren Mann vom Kopf, dann hielt er seinen Helm in der Hand. Sein schütteres Haar flog im Wind, seine Haut wirkte im Vormittagslicht erschreckend blass. Bahadur drehte den Kopf zur Seite und lauschte dem schrecklichen Geräusch so andächtig, als wäre es das Flüstern einer Geliebten in tiefer Nacht.
Dann lachte er.
»Du kannst darüber lachen?«, fragte Kai.
»Hör genau hin. Du bist jünger als ich. Deine Ohren sollten noch besser sein als meine.«
Kai zog sich die Kapuze vom Kopf und schob sich den Helm in den Nacken. Der Wind erstarb für einen Moment, und wieder hörte er den dumpfen Gleichschritt der Legion. Aber er hörte noch andere Dinge – ein Klappern und Rasseln, eine laut hallende Verwünschung, ausgestoßen in einer fremden Zunge, eine Art Schaben übers Eis. Da spürte er, wie sich auch auf sein eigenes Gesicht ein Lächeln stahl, denn er wusste, was das zu bedeuten hatte.
Neue Geräusche mischten sich darunter – das Getrappel von Hufen, die schnell näher kamen. Schatten schälten sich aus dem Nebel, während sich links und rechts von ihm die Speere senkten und die Hauptleute barsch befahlen, sich zum Angriff bereit zu machen. Kurz darauf hoben sich die Speere wieder gen Himmel, und Rufe freudiger Begrüßung erfüllten die Luft. Denn es war nicht der Feind, der da aus dem Nebel kam, sondern eine Gruppe sarmatischer Reiter. Einige Dutzend, nicht mehr, manche von ihnen führten ein zweites Pferd mit leerem Sattel neben sich. Hier und da waren die hellen Speerspitzen von Blut verdunkelt.
Die Rückkehrer schlossen sich ihren Stammesgemeinschaften an. Manche sammelten sich unter dem Banner von Kai und Bahadur – darauf eine sich windende Kreatur mit Schuppenpanzer und wehrhaften Zähnen und Klauen. Denn ihr Stamm ritt unter dem Wappen der Flussdrachen.
»Sie haben den römischen Eber verwundet«, sagte Bahadur. »Aber es wird an uns sein, ihn zu erlegen.« Er drehte sich im Sattel und wandte sich an den Rest der Truppe. »Sie werden bald hier sein. Wenn ihr einander noch etwas zu sagen habt, sagt es jetzt.« Wieder beugte er sich zu Kai hinüber. »Das gilt auch für dich.«
»Bahadur, ich …«
»Du sollst nicht mit mir sprechen, du Narr«, sagte der Ältere, senkte die Lanze und deutete mit der Spitze die Schlachtreihe entlang.
Überall war zu sehen, wie alte Fehden beigelegt wurden. Zwei Männer aus den beiden unterschiedlichen Stämmen Steppenwölfe und Leuchtende Kompanie, Männer, die seit fast zehn Wintern im Streit miteinander lagen, hatten sich nun kameradschaftlich die Arme um die Schultern gelegt. Andernorts hielten Vater und Sohn einander, die seit einem Messerkampf um eine Frau kein Wort mehr miteinander gewechselt hatten, der Kopf des Sohns an die Schulter des Vaters geschmiegt. Überall verließen Krieger die Schlachtreihe, um ein Stück weiter noch ein schnelles Wort zu wechseln oder ein vermeintlich letztes Geschenk zu überreichen. Kunstvoll geschnitzte Gürtelschnallen und lederne Messerscheiden wechselten ihre Besitzer und mancherorts, wo eine besonders grimmige Fehde begraben werden musste, auch ein kostbares Stück Eisen. Es hatte die Römer gebraucht, um die verfeindeten Fünf Stämme der Sarmaten zu einen, einen gemeinsamen Feind, der zumindest für diesen Winter alle anderen Fehden bedeutungslos machte.
Bahadur deutete auf einen Reiter, der ein wenig abseits stand. Der größte Recke ihres Stammes, gehüllt in einen Umhang aus Wolfspelzen. Seinen Speer zierten Quasten aus rotem Filz, die das Blut symbolisierten, das er vergossen hatte. Kai beobachtete, dass viele Kämpfer – hauptsächlich junge Kerle, aber auch der eine oder andere ältere, der besonderes Glück nötig hatte – zu dem Krieger ritten und ihn um seinen Segen baten. Eine Berührung des Speers, ein fester Händedruck, ein einziges Wort, hier und da ein kleines Andenken für die Würdigsten unter ihnen.
»Ich werde nicht betteln«, sagte Kai.
»Das verlangt auch niemand«, gab der Ältere zurück. »Halt einfach deine lose Zunge im Zaum.«
Kai drückte die Fersen in die Flanken seiner Stute – vielleicht spürte sie seinen Widerwillen oder focht selbst eine Fehde aus, die sie nicht beilegen wollte, denn sie setzte sich nur langsam in Bewegung, warf den Kopf herum und sah Kai an. In ihren schwarzen Augen lag ein beinahe menschlicher Blick. Bist du dir sicher?, schien sie ihn zu fragen.
»Nein, meine Beste«, sagte Kai, »aber wir müssen es versuchen.« Und wieder trieb er sie sanft an, bewegte sich allein übers Eis.
Stimmen ertönten, als er vorwärtsritt. Einige wünschten ihm Glück, andere murmelten Verwünschungen, wahrscheinlich Reiter, gegen die er in dieser oder jener Fehde geritten war oder denen er nach übermäßigem Weingenuss Dinge gesagt hatte, die nicht mehr zurückgenommen werden konnten. Aber die Worte der meisten waren so leise, dass sie über dem Knarren des Eises und dem Scheppern der Rüstungen kaum zu vernehmen waren. Gebetsfetzen, die er im Vorüberreiten aufschnappte. Bannsprüche gegen Pech und Unglück.
Er hielt nicht inne, um mit jenen zu sprechen, die ihn grüßten oder verfluchten. Er hielt den Blick starr auf den imposanten Reiter gerichtet, den sie Grausamer Speer nannten.
Selbst im fahlen Licht des Wintervormittags sah Kai das Gold an Gürtelschnalle und Brosche des Kriegers funkeln. Einst waren all ihre Kämpfer mit Gold geschmückt in die Schlacht gezogen. Die Grabbeigaben selbst der Geringsten unter ihnen hatten im Schein der Totenfeuer geglitzert. Jetzt ritten nur noch Recken und Häuptlinge goldverziert in einen Krieg, und selbst in ihren Gräbern lagen nur Beigaben aus Ton und Knochen.
Mit diesem Gedanken kam die Furcht zurück – keine Furcht um sein eigenes Leben oder vor der bevorstehenden Schlacht, sondern die Sorge um ein ganzes Volk, eine Nation, eine Welt. Kai trieb seine Stute an. Bald würden die Römer auftauchen.
Der Recke grüßte ihn nicht, als er sich ihm näherte. Tatsächlich war es das Pferd, das seine Ankunft zuerst zur Kenntnis nahm – das linke Auge war ihm vor vielen Wintern von einem römischen Speer genommen worden, seither warf es den Kopf hin und her, auf der Suche nach einem Feind auf seiner blinden Seite. Als Kai nicht mehr weit entfernt war, drehte das Tier den Kopf zur Seite, um ihn mit dem einen verbliebenen Auge abweisend zu fixieren. Es stülpte die Lippen nach außen und legte die Ohren an, und der Klang seiner über das Eis scharrenden Hufe ähnelte dem einer Klinge am Schleifstein.
Kai ließ seine Stute vor dem Recken halten, verbeugte sich im Sattel und begrüßte ihn dem Ritus entsprechend. »Allzeit Glück dem Grausamen Speer. Möge ich deine bösen Tage verschlingen.«
Unter dem Helm funkelten ihn graue Augen an. Wortlose Stille.
Kai streifte einen Handschuh ab und spürte sofort, wie der eisige Wind in seine Haut biss. Er zog einen Ring aus Bronze vom Finger, der sich ohne Widerstand löste – er war ihm zu groß, denn er war nicht für ihn geschmiedet worden. Ihn bot er nun dar und bemühte sich, seine Hand dabei so ruhig wie möglich zu halten.
Endlich rührte sich der Recke. Erst ein kaum sichtbares Zucken seines Handschuhs, dann ein leicht gehobener Arm, der vorgestreckt wurde, ehe die Hand wieder herabfiel und sich erneut um den Speerschaft schloss. Dann sprach der Recke.
Es erstaunte Kai immer wieder, wie sanft ihre Stimme war. Wer sie einmal auf dem Schlachtfeld erlebt oder ihren wilden Blick gleich einer gezückten Waffe auf sich gerichtet gespürt hatte, für den würde ihre weiche Stimme stets eine Überraschung bleiben.
»Du willst meinen Segen?«, fragte sie. »Erbittest von mir den rechten Weg für deinen unglückseligen Speer?«
»Nein.« Er zögerte. »Ich will unsere Fehde begraben.«
Sie legte den Kopf schief. »Du fürchtest dich, mit solcher Scham beladen in die jenseitigen Lande zu reiten?«
»Ich verspüre keine Scham«, sagte Kai, obgleich er das Blut in seinen Wangen pulsieren fühlte. »Ich wünschte, das damals wäre nicht geschehen und würde uns heute nicht trennen.«
»Und doch ist es so passiert.«
»Böses Blut bringt der ganzen Kriegsmeute Unglück.«
»Nein. Nur dir.«
In der Reiterrotte hinter ihr brandete Gelächter auf, während sich in seinem Herzen und auf seiner Zunge der Wahnsinn regte.
»Es heißt, man braucht einen tapferen Speer, um eine Fehde zu beginnen, aber einen noch tapfereren, um sie wieder beizulegen«, erwiderte er. »Ich halte dich nicht für feige.«
»Ausgerechnet du willst über Tapferkeit reden? Dann ist deine Zunge mutiger als dein Schwert.« Sie schenkte ihm ein grässliches Grinsen. »Hegst du die Hoffnung, der Dritte zu werden, der durch meine Hand den Tod findet, Kai? Diese Ehre würde dir durchaus zu Ruhm verhelfen. Aber ich werde meinen Speer nicht mit deinem Blut verdunkeln.«
»Für die Römer sollte er auch besser hell bleiben. Selbst du könntest nach dieser Schlacht des Blutvergießens überdrüssig sein.«
»Das bezweifle ich.«
»Laimei …«, hob er an und wagte es, ihren Namen auszusprechen.
Eine Drehung im Handgelenk, zu schnell für sein Auge. Und zu schnell, um zu reagieren, ehe es zu spät war und der Speer bereits auf ihn zuschoss. Kai beugte sich mit einer raschen Bewegung nach hinten, um ihm zu entgehen. Aber er hatte sie falsch eingeschätzt, es war nur ein Trick – es war ihre Art. Ihre Angriffe kamen niemals so, wie man sie erwartete. Man wappnete sich für den Schlag eines Phantoms, nur um den Hieb einer Kriegerin aus Fleisch und Blut zu spüren.
Dieses Mal hatte sie nicht auf ihn, sondern auf seine Stute gezielt.
Der Speer jagte von oben herab wie ein Adler, der seine Beute fixiert hat. Das Pferd taumelte. Erst hielt Kai den Treffer für tödlich, aber der dumpfe Knall in der kalten Luft offenbarte ihm ein anderes Szenario – der Speer hatte das Tier mit dem stumpfen Ende getroffen.
Ein scharfes Wutschnauben, der Kopf der Stute flog herum, und sie bäumte sich auf, um anzugreifen, um diesen Feind mit dem Geruch und der Kleidung eines Freundes zu töten, denn Pferde hassen Verrat nicht weniger als Menschen. Einen schrecklichen Augenblick lang wollte Kai es geschehen lassen, damit die Fehde in einem Aufblitzen von Hufen und Blut auf dem Eis ein Ende fände. Aber dann rammte er seinem Pferd die Knie in die Flanken und riss an den Zügeln, während ihre Truppe johlte und spottete.
»Reit nur weiter, Junge«, sagte Laimei. »Nimm diese Berührung meines Speers als Segen an, sie soll dir gute Dienste leisten. Oder vielmehr deiner Stute, auf dass sie sich einen besseren Reiter erwählt. An dich vergeude ich keinen Zauber.«
»Das wird die letzte Schlacht sein, in die du reitest. Selbst du wirst nach heute genügend Leben genommen haben.«
»Wenn meine Haare mit Grau durchzogen sind, ich nicht mehr aufsitzen oder einen Speer gerade halten kann, dann ist meine Zeit zu sterben gekommen. Aber ich werde länger in Schlachten reiten und länger leben als du. Mein Speer ist grausam, deiner verflucht.«
Es gab Worte – er wusste, dass es sie irgendwo gab –, die ihre Fehde beendet hätten. Manchmal träumte er davon, wie sie einander voll Vergebung umarmten und gemeinsam durchs Grasland um die Wette ritten, wie sie es als Kinder getan hatten. Wenn er erwachte, konnte er sich an jede tänzelnde Drehung ihrer Pferde erinnern, an die Muster der Wolken am Himmel, an den Klang ihres Lachens. Jede Einzelheit dieses Traums war ihm präsent, nur nicht die Worte, die gesprochen worden waren, die Worte, die ihre Fehde endlich hätten begraben können.
Da erscholl ringsum aus vielen Kehlen das Lied. Der Kriegsgesang ihres Volkes, den es seit Generationen anstimmte, seit der Zeit, als sie noch über die große Ebene im Osten geritten waren, die die halbe Welt umspannte. Ein Siegeslied. Erst von den Männern mit den tiefen Stimmen in der Zunge ihrer Vorfahren gesungen, dann fiel eine zweite Gruppe ein, mit höheren und süßeren Stimmen. Die Frauen.
Denn noch andere Frauen waren Teil der Kriegsmeute. In dicke Felle und Rüstungen gehüllt hätte ein ungeübter Betrachter sie wohl für junge Männer gehalten. Und doch waren sie hier, die Enkeltöchter der Amazonen und Skythen, die jungen Frauen, die noch nicht ihre drei getöteten Gegner vorweisen konnten, die sie vom Kriegsdienst befreien würden. Auch sie sangen von Kampf und Sieg. Als Kai sich nach dem Fluss umdrehte, sah er, was das Lied heraufbeschworen hatte. Zuerst nur Schatten, eine Linie aus schwarzen Gestalten. Dann die roten Umhänge, die im Wind tanzten, die riesigen Schilde und die schmalen Speere, die goldenen Adler, die über ihnen im Nebel flogen. Die Legion war gekommen.
Ehe er wieder seinen Platz in der Reihe einnahm, warf er Laimei einen letzten Blick zu. Er dachte an das Gesicht, das der Helm verbarg, an die bräunliche Haut, übersät von Narben und Kerben, an das schwarze Haar, eng anliegend, grob abgeschnitten mit einem stumpfen Bronzemesser. Er konnte das Gesicht jederzeit erblicken, wenn er in einen polierten Kupferspiegel schaute. Ein Gesicht wie sein eigenes.
Was hätte man bei Bruder und Schwester auch anderes erwarten sollen?
***
Die Schlachtreihe formierte sich, die Anführer schrien ihre letzten Befehle, während sich die Reiter vorbeugten und ihren Pferden Worte der Liebe und Ermutigung zuflüsterten. Weiter weg hielt der Furchtlose Banadaspus, Häuptling der Flussdrachen, eine Rede – er war eine ferne Gestalt, die vor dem Sarmatenstamm auf und ab ritt, brüllte und ermahnte und bejubelt wurde. Aus dieser Distanz war bei dem Wind kaum mehr als ein Murmeln zu vernehmen. Sollten sie gewinnen, würde Kai später erfahren, was er gesagt hatte. Sollten sie verlieren, spielte es ohnehin keine Rolle.
Als er wieder zu seinem Platz ritt, beobachtete Kai, wie Weinschläuche weitergegeben wurden, aus denen die Reiter so gierig tranken, dass sich Bart und Kinn rot färbten. Kai hatte gehört, dass seine Landsleute in anderen Gegenden für Kannibalen gehalten wurden, für Esser der Toten – sicher hatten solche Geschichten ihren Anfang mit einer zitternden Hand genommen, die vor einer Schlacht den Weinschlauch hob. Hier und da sah er einen von den Göttern berührten Mann, der einen zuckenden Hasen aus einer Gürteltasche zog, ihn aufschlitzte und seine Eingeweide aufs Eis warf, um darin nach Zeichen göttlicher Gunst zu suchen.
Unter dem Banner der Flussdrachen war die Schlachtreihe fast geschlossen, jeder Veteran stand an der Seite eines Kameraden, der noch in keinem Sturmangriff geritten war. Ein einäugiger Krieger saß neben einem zitternden Jungen, ein Graubart gab einer Frau, die noch keinen Feind in den Tod geschickt hatte, flüsternd Ratschläge. Kai nickte der Reiterin zu, mit der er ein Paar bildete, ein untersetztes Mädchen von sechzehn Sommern. Sie wirkte jetzt gefasster – vorhin hatte er die Mischung aus Galle und Wein in ihrem Atem gerochen, den süßlich verrotteten Geruch eines verängstigten Kriegers.
Bahadur gab seinem Sohn letzte Anweisungen, korrigierte dessen Griff um den Speer und zog die schlecht sitzende Rüstung so fest wie möglich. Als Kai näher kam, lag eine stumme Frage in Bahadurs Blick, und Kai beantwortete sie mit leichtem Kopfschütteln. Der Ältere sog Luft zwischen den Zähnen ein und kreuzte seinen Speer mit Kais, Metall schlug auf Metall. Mehr gab es nicht zu sagen.
Draußen auf dem Eis näherten sich die Römer nicht als Horde, sondern in den präzisen Reihen und Kolonnen, die dieses Volk so liebte. Krieger, die zu Fuß gingen, statt zu reiten – ein schändliches Verhalten, wenn man die Tradition der Sarmaten zugrunde legte, denn nur Feiglinge und Verrückte gingen freiwillig zu Fuß. Viele der Fremden waren bartlos, eine Armee aus Kindern, wie es schien, auch wenn die Sarmaten diese Kinder zu fürchten gelernt hatten. Rote Umhänge, hohe Helmbüsche und überall das kalte Glitzern von Eisen: auf den Kettenringen der Rüstungen, die sie trugen, auf den dünnen Speerspitzen, auf den runden Schwertknäufen und den Wölbungen ihrer Helme. Ein gewaltiger Eisenschatz draußen auf dem Eis – und über ihren Köpfen auf den Standarten flogen die goldenen Adler, die der Nebel fast verschluckte.
Die Legion hielt in ihrem Vormarsch inne. Weder Kriegsschreie noch Todeslieder ertönten aus den römischen Reihen, das war nicht ihre Art. Sie kämpften stumm, nur manchmal ertönten Signale von Trommel, Horn und Pfeife, die Formationswechsel, Vorrücken oder Rückzug befahlen. Sie waren leidenschaftslose Mörder.
Die Ansprachen der Häuptlinge und Anführer erstarben, die letzten Ratschläge waren erteilt, die letzten Kommandos gegeben worden. Die sarmatischen Reiter warteten, die Römer warteten, und die einzigen Geräusche waren das Säuseln des Windes und das Knacken im Eis.
Kai spürte das Gewicht des Speers und die Struktur des Holzes in seiner Hand. Eine Erinnerung wehte herauf: wie er sich einen Weg durch die Wälder der Nordlande bahnte, mit einer Hand Zweige beiseiteschob, mit der anderen fest die Finger einer Geliebten umfasste. Er spürte den dumpfen Schmerz, dieses Verlangen nach Liebe, das nur Krieger direkt vor der Schlacht kennen, im letzten Moment, in dem das Leben so süß erscheint wie nie zuvor.
Dann stand ihm ein anderes scharfes Bild vor Augen. Das eines Kindes, in der Hand eine Spielzeugfigur, die Bahadur geschnitzt hatte. Mit einem nahezu zahnlosen Lächeln hob sie den Kopf und sah ihn an. Seine Tochter, Tomyris, irgendwo weit im Osten. Eine noch größere Liebe, sie jetzt zu sehen, und das wahnsinnige Verlangen, sein Pferd anzutreiben und diese Traumgestalt vom Boden hochzuheben, sie an sich zu drücken und nie wieder loszulassen. Sie schien ihn zu rufen, aber die Worte kamen nicht von ihr – es war der ohrenbetäubende Sprechchor all jener, die bald töten und sterben würden, den er hörte und der ihn aus seinen Gedanken zurück aufs Eis holte.
Er wusste nicht genau, wo der Sprechchor zuerst erschollen war – irgendwo rechts von ihm, bei den Kriegern der Steppenwölfe oder der Grauen Hand. Es war keines der alten Lieder, das an Kais Ohr drang, es war überhaupt kein Lied, es waren nur drei Worte, immer und immer wieder ausgestoßen.
Eisen und Gold. Eisen und Gold.
Die Schätze, die ihnen gehören würden, sollten sie gewinnen, würden ihr Volk heilen. Eisen, um sich die Freiheit zu sichern. Gold, um die Toten zu ehren.
Kein Signal ertönte, kein Hornstoß oder Kommando. Aber wie ein Vogelschwarm, der über den Himmel jagt, wie ein Wolfsrudel, das gemeinsam aus dem Schnee zum Angriff springt, wussten die Sarmaten, dass die Zeit gekommen war, und trieben unter lautem Geklapper von Schuppen und Klingen ihre Pferde voran. Fünf Stämme ritten vereint, vielleicht zum letzten Mal.
Die Reiter ließen den Schnee des Ufers hinter sich und begaben sich auf die eisige Weite des Flusses. Ein kritischer Moment, die Pferde konnten ausrutschen und stürzen, die Schlachtreihe konnte auseinanderbrechen, ehe der Kampf überhaupt begonnen hatte. Das Eis war durchsichtig und glatt, und doch bewegten sich die Pferde darauf so sorglos und gekonnt wie durch das hohe Gras einer Steppe.
Denn genau das war ihr Vorteil bei diesem Spiel. Sie hatten das Leben ihres gesamten Volkes auf diesen einen Angriff gesetzt, bei dem alle Voraussetzungen gegen sie sprachen – bis auf eine: dass die sarmatischen Pferde den Tanz auf dem Eis kannten und beherrschten, die Römer aber nicht.
Eisen und Gold. Eisen und Gold.
Vielleicht war es nur Einbildung, aber Kai glaubte zu sehen, wie die Legion – die unerschrockene, unerschütterliche Legion – beim Anblick der Leichtigkeit, mit der sich ihr die Pferde übers Eis näherten, kaum merklich erbebte. Die Römer erkannten die Falle, die in dem Moment zuschnappte, als sie des Todes ansichtig wurden, der ihnen da gelassen entgegenkam.
Nicht nötig, in Trab oder Galopp zu wechseln. Noch nicht.
Eisen und Gold. Eisen und Gold.
Vor ihnen formierte sich die Legion zu einem großen Viereck, ihre einzige Chance, einem Sturmangriff, wie er folgen musste, standzuhalten.
Mannshohe Schilde schlossen sich zusammen, dann lief ein Zittern durch die römischen Reihen, als die Legionäre versuchten, einen sicheren Stand zu bewahren. Zum ersten Mal, seit Kai sich erinnern konnte, zeigte der Schildwall Schwäche.
Eisen und Gold! Eisen und Gold!
Der Geschmack von Sand in seinem Mund, in seinen Ohren das Blut, das wie eine mit flacher Hand geschlagene Trommel dröhnte. Scharfe, kalte Nadelstiche überall dort, wo ihn eine Klinge am ehesten treffen mochte – ein Stoß in den Bauch, ein eisiger Schlitz quer über die Kehle, ein Schmerz im Unterleib, bei dessen Vorstellung er schon die Beine zusammenpressen wollte. Als er das erste Mal bei einer Blutfehde mit den Steppenwölfen in die Schlacht geritten war, war seine Furcht so stark gewesen, dass er glaubte, wahnsinnig zu werden. Und die Furcht war noch immer da, so übermächtig wie eh und je. Mittlerweile hatte er nur gelernt, dass sie sich stets im entscheidenden Moment verflüchtigte.
Eisen und Gold! Eisen und Gold!
Dann waren alle Worte verloren, und ein Schrei erscholl, der zu allen Sprachen und zu keiner gehörte. Der Schrei zum Sturmangriff.
Als stürzte man durch den Himmel – so fühlte es sich an, als sie den entscheidenden Satz nach vorn machten. Als wäre die ganze Welt zur Seite gekippt. So fielen sie schreiend über ihre Feinde her.
Der kalte Wind saugte Tränen aus seinen Augen, nur noch das donnernde Krachen von Hufen, die auf Eis trafen. Kai lenkte seine Stute mit den Knien, hielt den Schaft der Lanze vor sich mit beiden Händen umfasst, eine hielt, die andere führte, wie ein Fischer, der seinen Speer gleich im See versenkt.
Vor ihnen bebte die Schildreihe. Die Pferde stürmten voran. Die Legion war auf dem Eis gefangen.
Und dann ertönten die Hörner.
Römische Hörner, alle auf einmal. Sie stießen kein Signal aus, das ihm aus vergangenen Schlachten bekannt gewesen wäre, gaben nicht den Befehl zum Rückzug oder Vorrücken, zum Formieren im Quadrat oder in Keilform. Kai sah die Männer vor sich wie ein Mann die Schilde heben und herabstoßen. Ein Bersten erfüllte die Luft, das selbst über den Hufschlag der Pferde hinweg zu hören war, als die Schilde an Ort und Stelle verankert wurden, ihr unterer Rand im Eis vergraben.
Die Welt schien stillzustehen. Die drängende Vorwärtsbewegung war plötzlichem Innehalten gewichen, wie durch die Berührung einer Gottheit oder den Zauber eines Magiers. Und in diesem Augenblick großer Stille sah er die Gesichter der Römer. Wie sie über ihre Schilde hinwegstarrten, halb verborgen von ihren Helmen. Und dennoch konnte er sie sehen.
Sie wirkten verängstigt.
In dem Moment wurde der Speer aus seinen Händen gerissen, der Himmel taumelte und wirbelte herum, und Kai fiel schreiend durch die Luft, bis er mit dem Rücken aufs Eis krachte und die Welt um ihn abermals abrupt verstummte.
Während er halb benommen dalag, sah er den Sturmangriff scheitern.
In letzter Sekunde versuchten die Pferde umzudrehen, schreckten vor dem Schildwall zurück. Dabei schob sich die zweite Reihe der Reiter unweigerlich in den Rücken der ersten, eine Masse aus Männern und Pferden, die sich wie eine Welle über die Schilde ergoss. Die Römer mussten nur nach oben greifen, um die Reiter aus dem Sattel zu ziehen.
Es hätte in einem Gemetzel enden müssen, die Reiter von ihren Pferden gerissen und auf dem Eis aufgeschlitzt. Aber wie eine Reihe von Bestien im entsetzlichen Chaos der Schlacht ragten plötzlich dunkle Umrisse auf, die sich gegen die Römer auflehnten. Es waren die Pferde, die jetzt die Schlachtreihe hielten – auf den Hinterbeinen stehend brachen sie Schilde und Helme mit ihren Vorderhufen oder wandten sich um und keilten nach hinten aus. Reiterlos, unerschrocken, erfasst vom Kampfrausch, blutiger Schaum vor den Lippen und mit den wild rollenden Augen von Berserkern.
Keine Zeit, um zu überlegen, um sich der feineren Art des Tötens zu entsinnen. Nicht einmal Zeit, um eine Waffe in die Hand zu nehmen. Kai kroch übers Eis, kam auf die Beine und warf sich mit bloßen Händen dem nächstbesten Römer entgegen. Ringsum taten es ihm andere pferdelose Sarmaten gleich, stürzten sich in die Reihen der Römer wie Schwimmer in tosende Gischt. Sie rutschten, stolperten, kämpften sich durchs Gedränge, suchten Kehlen zum Zusammendrücken und Herzen, die sie zum Stillstand bringen konnten. Überall wurde mit Händen und Zähnen an Fleisch gerissen und gezerrt, sodass jetzt selbst von der Legion Schreie erklangen.
Kai ließ sich beim Kampf von seinem Tastsinn und seiner Intuition leiten. Als er die Hand ausstreckte, berührte er ein bartloses Gesicht – das Gesicht einer Frau oder eines Knaben seiner eigenen Leute? Nein, denn dann bemerkte er die kratzenden Stoppeln und wusste, dass es sich um das Gesicht eines Römers handelte. Er drückte einen Daumen in ein Auge, hörte einen spitzen Schrei und erstickte ihn mit seinem Handschuh. Im nächsten Moment wurde er in die Menge zurückgezogen, Hände rissen von hinten an ihm, er trat zu und fühlte Zähne unter seinem Stiefel brechen.
Zurück im brodelnden Gemenge, kaum Raum zum Atmen, vom möglichen Führen einer Waffe ganz zu schweigen. In seinem Blick nur Fleisch und Metall. Ab und an, wenn die Menge sich kurz lichtete, konnte er einen Blick auf die Schlacht selbst erhaschen – ein Sarmate ohne Augen, blind nach dem Schnitt einer Schwertklinge, riss einem seiner Gefährten mit den Zähnen die Kehle heraus, weil er ihn für einen Römer hielt. Ein Pferd schleppte die eigenen Eingeweide wie einen gestürzten Reiter hinter sich her und trat nach allem, was ihm zu nahe kam. Und hoch über ihnen flogen die goldenen Adler im Himmel, drehten sich und wankten, als die Menge übers Eis glitt, drohten aber nie zu fallen.
Um ihn herum öffnete sich so urplötzlich ein Raum, wie er sich zuvor geschlossen hatte, und Kai fand sich auf Händen und Knien wieder, kroch und schlitterte übers Eis, versuchte, auf die Füße zu kommen. Ein Schlag prallte krachend von seiner Rüstung ab, dann noch einer. Kai schlug mit der Faust zu und schickte einen Mann rutschend übers Eis, klaubte eine sarmatische Axt vom Boden auf und wandte sich einem zweiten Angreifer zu. Für eine Ermüdungstaktik oder ausgefeilte Beinarbeit war keine Zeit, also griff er auf der Stelle an. Der Steinkopf der Axt zerbrach an der Rüstung, und der Römer reagierte mit einem schnellen Schwertstoß. Kai riss die Arme hoch, um die Klinge abzufangen, und spürte eine Linie aus kaltem Schmerz, die sich quer über seine Handgelenke zog, als das Eisen durch die Schuppen aus Horn und Knochen schnitt.
Der Römer bleckte die Zähne zu einem erleichterten Lächeln und wollte einen Schritt nach vorn machen, aber das Eis zog ihm die Beine weg. Kai trat zu, ein Mal, zwei Mal, drei Mal, bevor er ihm das Schwert aus den zuckenden Fingern riss. Überall sah er sarmatischen Stein an römischem Eisen zerschellen. Die Reihe der römischen Schilde schloss sich wieder, dazwischen stachen Schwerter hervor wie die Klauen eines riesigen Monsters. Und über allem unverändert die goldenen Adler.
Ganz in der Nähe ertönte ein heller Schrei – Chodona, Bahadurs Sohn. Er lag auf dem Eis, halb unter einem gestürzten Pferd begraben, und wirkte winzig zwischen den stattlichen Legionären. Mit hoher Kinderstimme schrie er sie an zu warten, einzuhalten, dass er sich ergebe. Aber sie verstanden seine Sprache nicht, und als die Klingen niederfuhren, hörte Kai nur noch ein gellendes Kreischen wie von einem Hasen, der sich in einer Schlinge verfangen hat.
Er wandte den Blick ab – suchte nach Bahadur oder Grausamer Speer, hatte den Namen seiner Schwester bereits auf den Lippen. Aber die einzigen bekannten Gesichter ringsum gehörten Toten.
»Kai!«
Der Ruf schnitt durch die Luft; die laute Stimme eines Sängers, die selbst den Schlachtenlärm durchdrang. Was es doch bedeutete, an einem solchen Ort den eigenen Namen zu vernehmen. Kai drehte sich um und erblickte Bahadur, noch immer zu Pferd, seine lange Lanze rot getränkt. Er ritt mit sicherem Tritt voran, eine Hand am Speerschaft, während er mit der anderen gestikulierte.
Etwas jagte an Kais Kopf vorbei. Eine dünne Linie aus Dunkelheit, der Schatten eines Speers.
Plötzlich stimmte etwas nicht mehr mit Bahadur. Er war aschfahl und stumm, als hätte ihn der Fluch einer Hexe in einem Augenblick um Jahrzehnte altern lassen. Dann drehte er sich im Sattel, und Kai sah den Speer in seiner Seite, die brutale Spitze tief versenkt, während Bahadur schon in das Schlachtgetümmel hinabfiel. Die wabernde Masse stahl ihn davon, helle Schwerter schlugen wie eine Welle über ihm zusammen und tauchten blutig wieder empor.
Überall schossen Speere aus dem römischen Schildwall hervor, dünne Spitzen, auf denen Männer und Pferde starben, und Kai vernahm die Hörner seines Volkes, die zum Rückzug bliesen.
Ein Ring aus Eisen schloss sich um ihn – kein Pferd, um aufzusitzen, kein sicherer Weg, der ihn vom Eis führen würde. Dann die Gelassenheit, die sich im Angesicht des sicheren Todes einstellt, die kalte Berührung eines Omens und des eigenen Schicksals, die alle Angst vertreibt. Und auch eine Art von Erleichterung, denn wer wollte schon als Einziger das eigene Volk überleben? Wer wollte der Letzte sein, der übrig blieb, wenn alles verloren war?
Noch mehr Gestalten kamen – sie waren jetzt überall, tanzten auf dem Eis, grauer Tod in ihren Händen. In welche Richtung auch immer er sah, sie näherten sich. Sein Atem ging schnell, durch die Augenschlitze des eng anliegenden Helms war sein Blickfeld schmal, auch sah er unscharf. Er wandte den Kopf von einer Seite zur anderen, wollte wissen, wer zuerst bei ihm sein würde, wollte den Mann sehen, der ihn in die jenseitigen Lande schicken mochte.
Aber noch eine andere Gestalt neben den Römern nahte, schneller und größer als sie. Sie schlitterte, ihre Hinterbeine schleiften, die Vorderbeine scharrten übers Eis. Sie näherte sich einem der Legionäre – ein Huf flog durch die Luft, und der Römer hielt sich vornübergebeugt die Seite. Ein zweiter Tritt, ein metallisches Geräusch wie der Schlag einer Glocke, und der Römer lag auf dem Boden, die Augen zu reinem Weiß verdreht. Blut rann aus dem eingedrückten Helm.
Bahadurs Pferd setzte sich wieder in Bewegung, und Kai spürte die schreckliche Freude von jemandem, der nicht länger allein sterben muss. Zu spät sah er den Wahnsinn in den rollenden Augen, den blutigen Geifer am Maul. Noch immer dem letzten Befehl seines Herrn hörig – Bahadur hatte Kai retten, ihn in Sicherheit bringen wollen, so wie jetzt sein Ross. Es stürzte auf ihn zu, rammte ihn in den Boden, legte sich mit erstickender Liebe auf ihn.
Kai schrie auf, drückte mit aller Kraft, kämpfte gegen das Gewicht an, aber der massige Tierkörper rutschte nur weiter auf seinen Leib, tauchte alles um ihn herum in Dunkelheit.
So schwer. Er konnte nicht atmen.
2
Ein Kreis im Schwarz des Traums. Ein Rund aus Männern und Frauen, die sich stumm umschauten und warteten, für den Krieg gerüstet.
Das Land pulsierte und verwandelte sich auf die unmögliche Weise, wie es nur in einer Traumwelt möglich ist. Manchmal schien die Gruppe auf grünem, saftigem Weideland zu stehen, dann wieder auf einer Lichtung in einem Wald kahler Bäume. Oder inmitten der Hütten eines sarmatischen Dorfs, wo er die Tochter, die er zurückgelassen hatte, zu hören glaubte, aber nicht sehen konnte. Der Kreis schien sich überall und nirgends zu befinden.
Auch die Gesichter veränderten sich. Manche gehörten den Lebenden, andere den Toten. Er sah den ersten Mann, den er je getötet hatte, einen groß gewachsenen Daker mit weicher Miene – ihm fehlte der Unterkiefer, sabbernd hing ihm die Zunge bis zum Kehlkopf, wo Kais ungelenk ausgeführter Axthieb ihm das halbe Gesicht abgetrennt hatte, statt ihm sauber den Schädel zu spalten. Manchmal erblickte er seine Mutter, aber auch ihr Gesicht war ständigem Wandel unterworfen. Sie war bei seiner Geburt gestorben, sodass sich ihre Züge aus den Fragmenten dessen zusammensetzten, was man ihm über sie erzählt hatte.
Alle Gesichter änderten sich – bis auf eines. Direkt vor ihm kniete ein Mann, genau in der Mitte des Kreises. Und dieser Mann blieb stets derselbe.
Der Schwertgriff lag glitschig in Kais Hand, während er die Klinge neben den Kopf des Mannes hielt. Sein Atem beschlug die eiserne Schneide. Eine gebrochene Waffe, denn die Hälfte der Klinge war in einer Schlacht lange vor Kais Geburt verloren gegangen. Dennoch ein seltener Schatz für ein Volk, das dazu verdammt war, fast nur noch mit steinernen und knöchernen Waffen zu kämpfen.
Der saure Gestank fermentierter Milch lag in der Luft, hing nass in den Bärten der Männer, aus denen der Kreis bestand. Er stammte von einem Trunk aus alten Tagen, denn dies war ein Ritual aus alten Tagen. Sie schlugen ihre Waffen gegen Schuppenpanzer und Schilde – ein Scheinkampf, die Musik für einen Krieg, der geführt werden musste.
Kai reckte das Schwert noch höher, die Arme gerade, die Klinge in den Himmel gerichtet. Alles um ihn herum drehte sich und tanzte, und das war nicht nur den seltsamen Regeln geschuldet, denen dieser Traum folgte. Auch als er noch in der Welt der Lebenden in diesem Kreis gestanden hatte, war sein Blick verschwommen gewesen.
Der Sprechgesang verhallte.
In dem Traum hoffte er, schnell zuzuschlagen, seinen tödlichen Hieb innerhalb eines Herzschlags auszuführen. Aber wie immer war er zu langsam. Der kniende Mann hob den Kopf und hielt Kai mit seinem Blick gefangen. Diese Augen – hell und gütig – musterten ihn voller Liebe.
Das Schwert zischte und biss zu, der Traum drehte sich und wirbelte, dann war da nur noch Dunkelheit.
***
Zuerst wusste er nicht, ob er wirklich aus dem Traumland zurückgekehrt war. Schwarze Stille um ihn herum und eine unsichtbare Last, die ihn unter sich begraben zu haben schien – alles Empfindungen, die ihm aus seinen Träumen bekannt waren. Doch die Luft war erfüllt vom Blutgestank, vom heißen Kupferdunst, der noch nie den Weg in seinen Schlaf gefunden hatte. Auch war es keine unsichtbare Kraft, die ihn an Ort und Stelle hielt; ein schwerer Körper lag auf seinem. In diesem Moment erinnerte Kai sich an das Pferd.
Er schien nicht mehr atmen zu können, seine Lunge war halb zerquetscht, aber zugleich ließ ihn die Panik zu tief keuchen und trieb ihn für einen Moment wieder zurück in die Bewusstlosigkeit. Die Schwärze stahl sich schon zurück, doch er holte abermals Luft, diesmal flach und langsam, bis er die Ketten des Traums endgültig gesprengt hatte.
Er steckte unter dem Pferd fest. Den Kopf konnte er immerhin ein Stück weit drehen, und als er das tat, kroch ein wenig Helligkeit seitlich in sein Sichtfeld. Er erblickte Eis, übersät mit dunklen Blutlachen. Und auf dem Boden reglose Körper.
Er horchte nach Geräuschen der Schlacht, die noch immer wüten musste – nach Totengesängen eingekesselter Männer, die ihrem Untergang ins Auge sahen, nach den gellenden Schreien der Besiegten, die von Pferden niedergeritten wurden. Und schließlich auch nach Geräuschen, die auf das Gemetzel folgten, von den schweren Schritten all jener, die über das Schlachtfeld zogen, die Ringe von Fingern und Haarschöpfe von Schädeln schnitten und die Kehlen der zurückgelassenen Verwundeten öffneten.
Doch da war nichts als Stille. Und der Wind.
Unter Mühen begann Kai, sich von seiner Last zu befreien, wand sich wie eine Schlange unter dem riesigen Pferdeleib hervor. Seine Seite schmerzte, ein stechender Dreizack der Qual, aber daran durfte er keinen Gedanken verschwenden. Also kroch er weiter und weinte und fluchte und bewegte sich quälend langsam übers Eis vorwärts, bis die Last des Kadavers endlich von ihm genommen war. Er versuchte aufzustehen, aber seine zitternden Beine wollten ihn nicht tragen, also saß er da und betrachtete das stille Schlachtfeld um sich herum.
Ein gewaltiger Schatz aus Eisen umgab ihn. Er erinnerte sich an Geschichten, die die Alten am Feuer erzählten, von Männern, die mit nutzlosem Reichtum bestraft wurden, die weinend vor Hunger in einer Welt aus Gold und Eisen saßen und doch nur für Fleisch und Milch beteten. Hätte er die Wagen und Pferde zur Verfügung gehabt, um all die Reichtümer fortzuschleppen, wäre er – vorausgesetzt, er erlebte den kommenden Morgen – zu einem der großen Helden seines Volkes geworden.
Aber es sollte nicht sein. Nichts regte sich auf der weiten Fläche aus Eis. Überall Tote, die er kannte, Freunde und Gefährten. Da war Padagos – Kai rief sich eine kalte Winternacht ins Gedächtnis, die er und der Mann eng umschlungen verbracht hatten. Damals hatten sie gemeinsam die Gegend für einen Viehdiebstahl ausgekundschaftet und zu nah an den Dakern ihr Lager aufgeschlagen, um ein Feuer zu riskieren. Nun hatte sich Padagos einmal mehr zusammengerollt und sah fast so aus, als schliefe er nur, gebettet auf ein Kissen aus rotem Blut. Auch Galatus, der immer einen Witz auf den Lippen gehabt hatte, lag ganz in der Nähe. Jetzt war sein Gesicht zu einem immerwährenden Lachen zerschnitten. Und Mada – die vor der Schlacht so ängstlich gewesen war. Er erinnerte sich an das Zittern ihrer Hände am Speerschaft, das sich allmählich gelegt hatte, als Kai und Bahadur ihr die alten Lügen des Krieges erzählten. Sie musste sich nun nicht mehr ängstigen, denn ihre Hände hielten tapfer und still den Schaft des Speers umschlossen, der ihre zerrissene Rüstung durchbohrt hatte. Selbst so aufgespießt schien sie noch an das Unmögliche geglaubt, für das Unmögliche gekämpft zu haben – ihr Überleben.
Überall Leichen. Auch viele von Römern. Zwischen ihnen die der Sarmaten und ihrer Pferde, unzählbar. Irgendwo unter ihnen lag auch Bahadur.
Endlich kam Kai auf die Füße und keuchte gegen den frischen Schmerz an. Seine Hand tastete über seine Seite, forschte nach zerrissener Rüstung und offenen Wunden, aber die Finger blieben unbefleckt, und als er auf den Boden spuckte, war auch sein Speichel frei von Blut. Drei gebrochene Rippen waren offenbar die Ursache für das Stechen. Aber Schmerzen wie diese waren ihm nicht unbekannt – nach einem Überfall auf die Daker vor drei Sommern war er von einem verängstigten Pferd getreten worden, mit ähnlichem Resultat. Jetzt freute er sich fast über den vertrauten Schmerz und stolperte vorwärts, eine Hand in die Seite gestemmt, um sich auf die Suche nach Bahadur zu machen.
Ein schier hoffnungsloses Unterfangen, trotzdem musste er es versuchen. Bahadur war für ihn zurückgeritten, und das verrückte Verlangen, ihn zu finden, sich neben ihn zu legen, sich wieder Schlaf und Traum hinzugeben, war übermächtig. Und warum auch nicht? Die Sonne rollte über den Himmel. Bald würde die Nacht hereinbrechen und mit ihr ein tödlicher Wind aufkommen. Schon jetzt spürte er, wie ihm die Kälte immer tiefer ins Fleisch biss. Der kurze Tag war fast vorüber, und es gab keinen Unterschlupf, den er zu Fuß erreichen konnte. Er würde weitergehen, bis er sich nicht mehr aufrecht halten konnte, bis er spürte, wie der zärtliche, verführerische Schlaf über ihn kam, der all jene besucht, die verloren durch Eis und Schnee irren.
Dann, plötzlich, ein Geräusch ganz in der Nähe. Ein Kratzen auf dem Eis, das Scharren von Armen und das Flüstern eines Lebenden, erschreckend laut inmitten der großen Stille des Schlachtfelds. In einem der Leichenhaufen regte sich etwas, so als kehrten die Toten selbst zurück, um weiterzukämpfen. Kai griff einen Speer vom Boden, um sich dem Geräusch entgegenzustellen.
Eine Bestie, eine Kreatur aus Fleisch und Hufen, mit einem menschlichen Gesicht. Erst als sie sich schüttelte und ein Leichnam von ihrem Rücken fiel, begriff Kai, welchen Streich ihm seine Augen gespielt hatten. Ein Pferd – ein großes sarmatisches Ross, die Rüstung nur noch zur Hälfte vorhanden und die Flanken mit dunklem Blut beschmiert. Wie er selbst war es unter Toten begraben gewesen. Als sich das Tier erhob, sah er Frost von seinen breiten Lippen platzen. Es schnaubte und keuchte, warf den langen Kopf herum wie betrunken. Dann drehte es ihn zur Seite und betrachtete ihn mit einem vertrauten Auge. Das Pferd seiner Schwester.
Das Tier starrte ihn an – schien den Wert seines Lebens abzuwägen und zu überlegen, die alte Fehde anstelle seiner Herrin ein für alle Mal zu beenden. Es hob den Kopf und wieherte, als würde es nach Gefährten, der Kriegsmeute, der Herde rufen. Nur der Wind antwortete ihm, und so starrte es wieder Kai an.
Langsam bewegte er sich übers Eis. Er bückte sich, ließ klappernd den Speer fallen. Das Pferd machte einen Schritt nach hinten und riss den Kopf herum, um zu sehen, ob sich auf seiner blinden Seite Feinde näherten. Kai trat noch einen Schritt nach vorn, und noch einen. Er war jetzt sehr nah – so nah, dass er den sauren Atem des Pferdes riechen und die leere Höhle des geblendeten Auges erkennen konnte, in der noch immer Sehnen und andere Fasern zuckten. Eine Hand hielt er abwehrbereit auf Kinnhöhe, während er die andere an die baumelnden Zügel legte.
Das Pferd fletschte die Zähne und legte die Ohren an. Kai hörte das Schleifen eines Hufs, der über das Eis gezogen wurde. Mit der freien Hand berührte er die Stirn des Pferdes, ließ sie dort verharren. Er wartete geduldig und war sich plötzlich sicher, dass er und das Pferd in diesem Moment den gleichen Gedanken hatten. Sie beide dachten an Laimei.
Sie war also tot. Erst jetzt, seine Hand an ihrem Ross, wusste er das mit Bestimmtheit. Er konnte sich keine andere Erklärung dafür vorstellen, dass sie sich von dem mächtigen Tier getrennt hatte.
»Laimei«, sagte er, als hätte der Klang ihres Namens die Kraft, sie zurückzubringen. Er hatte von Männern gehört, die eine solche Kunst beherrschten: Hexer und Magier des großen Grasmeers, Meister alten Wissens, das längst verloren war.
Vielleicht war das der Grund dafür, dass sich das Pferd nicht sträubte. Vielleicht ahnte es tief in seiner Pferdeseele, von der alle Sarmaten wussten, dass sie weiser war als die Seelen der Menschen, dass Laimei tot und die Fehde damit beendet war.
»Rache«, sagte Kai, und wieder zeigte das Pferd die Zähne. Es schien ihm zuzulächeln.
Kai sah sich die Kostbarkeiten um ihn herum an – zwei römische Schwerter, ein Kettenhemd, das nur noch halb an seinem toten Besitzer hing, einer der langen, dünnen Wurfspeere, die die Legionen bevorzugten. Keine Zeit, noch mehr mitzunehmen. Er band seine Beute an der Seite des Pferdes fest, so gut es ging. Das Tier stampfte sichtlich ungeduldig auf dem Eis auf, zeigte sich aber unbeeindruckt von der neuen Last.
Wäre er nicht in Eile gewesen, Kai wäre viele Stunden Seite an Seite mit dem Pferd marschiert – hätte lange und behutsam um die Gunst seines neuen Reittieres geworben. Aber es war ihnen nicht vergönnt.
Er legte die Hände an das Sattelhorn und biss die Zähne zusammen, die Augen halb geschlossen. Dann nahm er einen tiefen Atemzug, hielt die Luft an, sprang in den Sattel und keuchte vor Schmerz, als er landete.
Das Pferd warf den Kopf in den Nacken und tänzelte seitwärts übers Eis. Kai spürte die mächtigen Muskeln in Rücken und Flanken unter ihm zucken. Das Tier war kurz davor, sich aufzubäumen, und er zweifelte daran, dass er die Kraft haben würde, noch einmal aufzusitzen, sollte es ihn abwerfen. Eher würde er gebrochen auf dem Eis liegen, bis ihn die Kälte übermannte.
Doch endlich beruhigte sich das Tier, als hätten sie einen unsicheren Waffenstillstand geschlossen. Kai trieb das Pferd an, las die Spuren vor ihnen, so gut er konnte, und damit auch die Geschichte, die in Eis und Schnee geschrieben stand.
3
Fünf Tagesreisen östlich der Danu hätte ein Reisender vielleicht eher ein kleines Lager als ein Dorf erwartet. Doch im Zwielicht der sinkenden Sonne und im Schatten der Berge, die sich am Horizont erhoben, würde er eine Ansammlung runder Hütten entdecken. Aus der Ferne waren sie kaum von Zelten zu unterscheiden, denn der Schnee, der sich auf ihren Dächern gesammelt hatte, ließ diese wie blasse Pferdehaut wirken, die über hölzerne Gestelle gezogen war, und verdeckte Lehm und Flechtwerk, aus denen sie in Wirklichkeit bestanden.
Dieser Ort war kein temporäres Lager, kein Nachtquartier, das bei Tagesanbruch auf Wagen verladen und später anderswo in der Steppe neu errichtet werden würde. Iolas war eines der Winterdörfer der Sarmaten; der zerfurchte Grund zwischen den Hütten war von Generationen von Füßen zu Wegen geebnet worden. Kinder waren auf ihnen gelaufen, alte Frauen gewankt. Rings um das Dorf hatte man, sofern es der sumpfige Untergrund zuließ, einige Felder abgesteckt und für die Saat vorbereitet. Der lehmige Boden versprach nur wenig Ertrag – wenn schon nicht weise, so waren die Bauern hier zumindest stur, wie es schien. Sie bemühten sich, die Kunst von Getreideanbau und Münzherstellung zu lernen, die ihre Nachbarn reich gemacht hatte, sodass sie nun im Winter über genug Nahrung verfügten, ohne Raubzüge jenseits der Danu unternehmen zu müssen. Die Sarmaten aber hatten diesen Weg zu spät eingeschlagen. Sie waren weder ein Volk der Steppe noch ein Volk der Siedlungen, sondern irgendwo dazwischen gefangen.
Im Westen des Dorfes fand gerade eine Versammlung statt. Die Frauen und jene Söhne und Töchter, die zu jung waren, um eine Lanze zu tragen, standen da und starrten, wie im Gebet vertieft, in die sinkende Sonne. Selbst die kleinen Kinder waren still; geschnitzte Holzpferdchen und Schwerter aus Stöcken lagen in ihren schlaffen Händen.
Keine der Frauen trug Häuptlingskennzeichen, die langen Gewänder und die hoch gewickelten Kopftücher gaben keinen Aufschluss über ihre Rangfolge. Trotzdem schien eine von ihnen eine Art Anführerin zu sein. Wie bei vielen anderen Frauen waren auch ihr Gesicht und ihre Hände mit weißen Narben übersät, Überbleibsel der Schlachten, die sie geschlagen hatte. Ihre Zöpfe schimmerten golden und silbern. Sie war nicht die älteste unter ihnen, viele der Frauen hatten bereits gänzlich weißes Haar und eine tief zerfurchte Haut von den vielen Jahren unter der Sonne. Dennoch hatte diese eine Frau beschlossen oder war dazu auserwählt worden, sich um sie alle zu kümmern. Sie kommunizierte mit ihnen – eine sanfte Berührung am Arm hier, ein Flüstern dort, eine scharfe Anweisung an eine Frau, die mit vor Kummer gebeugtem Kopf dastand – und sorgte dafür, dass alle Blicke gen Westen gerichtet blieben.
Die Sonne sank und küsste den Horizont. Man erzählte sich, dass sich in alten Zeiten einmal eine Königin gewünscht hatte, das Licht möge noch einen Moment verweilen, damit sie ihren Liebsten betrachten konnte. Und so hielten seither die Götter die Sonne stets noch einen Augenblick länger fest, bevor sie unter den Rand der Erde fiel. Die Frau, die im Dorf das Sagen hatte, murmelte nun leise vor sich hin, bat die Götter um ein weiteres Wunder. Dass die Wartenden Umrisse in der Ferne ausmachen würden, scharf gezeichnet vor der schwindenden Sonne. Dass sie alle die Kriegsmeute erblicken mochten, die nach Hause zurückkehrte.
Doch auch das letzte dünne Band der Sonne glitt unter den Horizont, ohne dass ein Reiter aufgetaucht wäre. Ein leises Seufzen erhob sich aus den Kehlen der Gemeinschaft, die am Rand des Dorfes stand, mehr nicht. Dann aber, als würde sie ein Horn zur Schlacht rufen, setzten sich die Kinder in Bewegung, jauchzten, bildeten unter lautem Geschrei kleine Gruppen und jagten einander zwischen den Hütten und unter den Wagen hindurch. Die Frauen folgten ihnen langsam und widerstrebend.
Nur eine blieb am Dorfrand zurück, die Augen noch immer in Richtung der verschwundenen Sonne gerichtet, wie in Trance oder durch einen Zauber gebannt. Die ältere Frau eilte zu ihr durch den Schnee, der unter ihren Stiefeln knirschte, und sagte: »Komm mit zurück. Es hat keinen Sinn, noch länger hier in der Kälte auszuharren.«
Langsam drehte die andere Frau den Kopf. Ihre Augen waren stumpf. Sie war jung, die Kriegsnarben waren noch frisch auf ihrer Haut. »Sie hätten längst zurück sein sollen, Arite«, sagte sie. »Oder nicht?«
»Nicht, wenn sie gewonnen haben«, gab Arite zurück. »Wenn sie die Römer in die Flucht schlagen konnten, sind sie immer noch jenseits der Danu und setzen ihren Raubzug fort.«
Die jüngere Frau heftete den Blick wieder an den Horizont. »Manchmal glaube ich, wir sollten gar nicht mehr nach ihnen Ausschau halten. Unser Warten bringt nur Unglück.«
»Denk nur an den Moment, wenn sie zurückkehren – das wird ein schöner Tag.«
»Und wenn es so bleibt wie jetzt? … Das wäre doch gar nicht so schrecklich.«
Arite grinste, ein wölfisches Aufblitzen ihrer Zähne in der Dämmerung. »Du würdest die jungen Männer im Dorf nicht vermissen? Ich auf jeden Fall.«
»Ich würde das Töten nicht vermissen.«
Arites Lächeln erstarb auf der Stelle, und der Zug um ihren kantigen Kiefer wurde hart. »Ab nach Hause«, sagte sie. »Und pass auf, dass dich niemand anders so reden hört.«
Das Knirschen und Trippeln schneller Schritte im Schnee, dann war die junge Frau verschwunden. Arite verharrte noch einen Moment und warf einen letzten Blick zum Horizont. Dann war auch sie wieder zwischen den Hütten verschwunden, zupfte mit der einen Hand ruhelos an den langen Enden ihres Gewandes und hielt sich mit der anderen den Kragen zu. Aus dem Westen blies ein grausamer Wind.
Die Kinder rannten noch immer durcheinander und balgten sich, auch wenn ihre Zahl abgenommen hatte, da mehr und mehr Verwandte auftauchten und sie mitnahmen. Ohne anzuhalten, schnappte sich auch Arite eine Gestalt aus einer wild tobenden Schar kleiner Krieger. Das Mädchen hatte keine Ähnlichkeit mit ihr, was an diesem Ort aber nichts Ungewöhnliches war. Überall gingen Kinder mit Frauen nach Hause, die nicht ihre Mütter waren.
Die Kleine, die so jäh aus dem Spiel gerissen worden war, schmollte und jammerte wie ein getretener Hund. Sie ließ sich schlaff hängen, und kurz darauf gestattete Arite ihr, zur Hütte zurückzugehen, statt getragen zu werden – eine Geste der Wertschätzung für ihre Gefangene.
Arites Heim war schlicht und primitiv, es spiegelte ihr Leben wider. Wegen eines schlecht geschnittenen Abzugs hing im Inneren oft der Qualm, und ihre Bettstatt bestand aus nichts als einem Haufen Decken. Es gab besser gebaute Zelte, die mehr Schutz vor der Kälte boten als diese Hütte mit den vielen kleinen Rissen in den Wänden, durch die einem der Wind ins Fleisch schnitt wie eine Messerklinge.