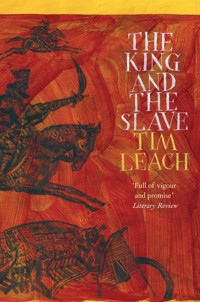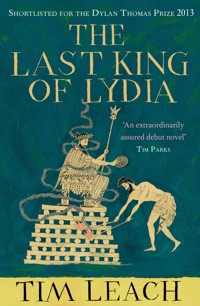7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Sarmaten-Trilogie
- Sprache: Deutsch
180 n. Chr.: Nördlich des Hadrianswalls kämpfen der sarmatische Krieger Kai und sein Adoptivstamm, die Votadini, ums Überleben, nachdem sie durch römische Repressalien in ein unbekanntes Land vertrieben wurden. Dann trifft die Nachricht ein, dass ein verfeindetes Volk sich bereit macht, gegen die Votadini ins Feld zu ziehen, angeführt von einem altem Feind Kais. Sofort macht sich Kai auf den Weg nach Süden, in der Hoffnung, sich mit den Römern gegen diese neuerliche Bedrohung zu verbünden. In der Zwischenzeit haben die Römer jedoch von Chaos und Gemetzel jenseits des Walls gehört. Der Legat Lucius glaubt, dass Kai und seine Verbündeten dafür verantwortlich sind, und schickt eine Expedition aus, um seinen alten Kameraden zu ergreifen. Und Kai droht in eine tödliche Falle zu geraten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
180 n. Chr.: Nördlich des Hadrianswalls kämpfen der sarmatische Krieger Kai und sein Adoptivstamm, die Votadini, ums Überleben, nachdem sie durch römische Repressalien in ein unbekanntes Land vertrieben wurden. Dann trifft die Nachricht ein, dass ein verfeindetes Volk sich bereit macht, gegen die Votadini ins Feld zu ziehen, angeführt von einem altem Feind Kais. Sofort macht sich Kai auf den Weg nach Süden, in der Hoffnung, sich mit den Römern gegen diese neuerliche Bedrohung zu verbünden. In der Zwischenzeit haben die Römer jedoch von Chaos und Gemetzel jenseits des Walls gehört. Der Legat Lucius glaubt, dass Kai und seine Verbündeten dafür verantwortlich sind, und schickt eine Expedition aus, um seinen alten Kameraden zu ergreifen. Und Kai droht in eine tödliche Falle zu geraten …
Autor
Informationen zu Tim Leach und seinen Romanen finden Sie am Ende des Buches.
TIM LEACH
DERLETZTE THRON
DIE CHRONIK DER SARMATEN
Historischer Roman
Aus dem Englischenvon Julian Haefs
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »The Hollow Throne« bei Head of Zeus, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Februar 2024
Copyright © der Originalausgabe 2023 by Tim Leach
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Arcangel/ Collaboration JS, Nik Keevill; FinePic®, München
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Karte: © Peter Palm, Berlin
BH · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30953-4V001
www.goldmann-verlag.de
Für Emma, Sarah und Kathy
Der Verstümmelte König A.D. 175
1
Über die Hügel und durch die Heide wanderte ein gebrochenes Volk gen Norden.
Tausende waren sie, aschfahl vor Erschöpfung, die Haut mit Blut und Erde beschmiert. Sie stolperten und schlurften, erinnerten eher an eine Armee der Toten denn der Lebenden, als wäre ein uraltes Hügelgrab aufgebrochen worden und zahllose Leichen wären daraus hervorgekrochen. Auf ihren Schilden und ihrer Haut waren die Zeichen vieler verschiedener Stämme zu sehen – Dumnonier, Veniconen, Taexalier und mehr. Ein halbes Dutzend Stämme aus dem Norden, welche die tiefen Wunden alter Fehden unter einem gemeinsamen Banner begraben und sich selbst das Bemalte Volk genannt hatten.
Keine Armee verfolgte sie, kein lebender Feind war in Sichtweite. Nur ganz im Süden ragte der gewaltige Wall aus Stein auf, der die Grenze eines großen Reiches markierte. Das Bemalte Volk floh vor diesem Wall, und fast sah es aus, als hätte diese Armee der Toten gegen ein Monster aus Stein gekämpft – und verloren.
Aber kein Monster hatte sie besiegt, auch nicht die Legionen Roms – das immerhin wäre eine vertraute Erniedrigung. Dies aber war ein neuer Feind gewesen, eine neue Schmach, die sie tragen mussten. Ein Volk aus einem fernen Land, zum Dienst für das Imperium verpflichtet; Krieger, die drachenartige Schuppen auf der Haut trugen und enorme Lanzen, die dafür gemacht schienen, Riesen niederzustrecken. Sie ritten auf monströsen Pferden, die gemeinsam mit ihren Reitern kämpften und töteten.
Was sollte man gegen solche Krieger ausrichten, die scheinbar aus alten Sagen hervorgeritten waren? Und obwohl das Bemalte Volk kaum die Kraft aufbringen konnte, zu laufen oder auch nur zu stehen, wiederholten sie immer wieder einen Namen, wie einen Fluch oder ein Gebet: Sarmaten, Sarmaten. Der Name jener, von denen sie besiegt worden waren. Der Name, den sie hassen lernen mussten.
Das Bemalte Volk bewegte sich wie ein verwundetes Tier, schleppte sich blutend voran über Heide und Hügel, ließ eine Fährte von Leichen hinter sich, als immer wieder blutbefleckte Männer strauchelten und fielen und sich zum Sterben niederlegten. Sie flohen in einen tiefen Wald in einem Tal in den Nordlanden, an einen der Orte, wo ihr Volk seine geheimen Handlungen durchführte, heilig und verboten. Da endlich, durch die dichten Wipfel vor den Augen der Menschen und Götter gleichermaßen verborgen, sanken sie zu Boden.
Anfangs sprach niemand. Abgesehen von der wiederholten Nennung des Namens ihres Feindes hatten Scham und Erschöpfung sie an einen Ort jenseits von Worten gebracht, zurück auf die alten Pfade des Herzens und des Geistes, als ihre Vorfahren noch ohne Sprache geliebt und gekämpft und gehasst hatten. Ganz langsam, Stück für Stück, schien die Gabe der Worte zurückzukehren. Sie aber brauchten nur ein einziges. Sie sprachen nichts als einen Namen, immer und immer wieder.
»Corvus, Corvus, Corvus.«
Der Name ihres Kriegshäuptlings, Hochkönig des Bemalten Volkes. Der Mann, der sie in ihre Niederlage geführt hatte.
Noch tags zuvor hatten sie seinen Namen als Schlachtruf auf dem Feld hervorgestoßen, denn er hatte ihnen großes Kriegsglück gebracht, sie gut gelehrt, ihre Feinde zu hassen und zu vernichten. Jetzt sprachen sie seinen Namen wie einen Fluch und einen Befehl, denn sie verlangten, dass er vor sie trat und sich ihrem Urteil stellte.
Von ihrem Wort beschworen, wie feenhafte Kreaturen gezwungen sind, zu erscheinen, wenn man ihren wahren Namen spricht, trat eine Gestalt auf die Lichtung. Das Mondlicht leuchtete auf seiner leichenblassen Haut.
Er war groß, größer als alle anderen Männer – ein blonder Krieger aus einer anderen Welt, aus den Wäldern jenseits des Rhenus am anderen Ende des Imperiums. Seine blauen Augen waren so still und leer wie die Wasser des Nordmeeres, seine blasse Haut versehen mit den Zeichen der Legion, aus der er vor langer Zeit desertiert war. So stand er vor ihnen, ungebeugt und scheinbar furchtlos. Er wartete ab, wie das Bemalte Volk mit ihm verfahren würde.
Die Menschen versammelten sich um ihn, während die Mordlust in ihren Herzen anschwoll. Die rachsüchtige Wut besiegter Männer und noch mehr – trotz all der Toten, die sie im Schatten des Walls zurückgelassen hatten, wussten sie, dass noch ein letztes Opfer nötig war. Es musste ein Fluch der Götter auf ihnen lasten, dass sie solch eine Niederlage erlitten hatten. Einzig das Blut eines Königs würde diesen Fluch brechen, und er war ihrer aller König gewesen.
Corvus schien all das zu wissen. Er flehte jedoch nicht, fluchte nicht, hob nicht die Waffe, um sich zu verteidigen. Er löste nur die Fibel seines Umhangs und warf diesen zu Boden, zog sich die Rüstung aus Leder und Stoff ab, löste die Riemen seiner Stiefel. Mit langsamen, achtlosen Bewegungen warf er seine Kleider fort – er hätte ein Reisender sein können, der nach einer langen Wanderung ans heimische Feuer zurückkehrt, um sich zu wärmen, oder ein Mann, der sich anschickt, zu seiner Liebsten ins Bett zu steigen.
Schließlich stand er nackt zwischen ihnen und bot sein Fleisch dar.
Kein Feuer war entfacht worden, denn niemand hatte die Kraft oder den Willen besessen, eines zu errichten. Aber der Mond war halbvoll, und die fast unaufhörlichen Wolken hatten sich für einen Moment zurückgezogen. Es war windstill; die Lichtung im Wald lag unter freiem Himmel. So konnte das Bemalte Volk Corvus gut erkennen, genau wie das Messer in seiner Hand.
Es hätte nur einen Atemzug gedauert, über ihn herzufallen und ihn in Stücke zu reißen. Aber noch verharrten sie reglos. Nicht aus Angst, was sein Messer ihnen antun könnte, denn sie waren zu erschöpft, um noch Todesangst zu verspüren. Irgendwie fürchteten sie sich in diesem Moment eher vor dem, was Corvus sich selbst antun wollte.
Das Messer erhob sich weit über seinen Kopf, als er die Klinge der Göttin des Mondes darbot. Corvus legte die Waffe an seine Stirn, suchte vielleicht Trost im Gefühl des trockenen, kalten Eisens auf kriegsfiebriger Haut. Die Spitze der Klinge wanderte zu seiner Brust, als habe er vor, sich ein schnelles Ende zu setzen, dann hinab zum Bauch, dem Ort des langsamen Todes. Noch tiefer rutschte die Klinge, bis unterhalb seines Gemächts, und das Bemalte Volk wusste, was er vorhatte.
Da riefen sie ihm zu, es nicht zu tun. Denn so sehr sie vor einem Moment noch willens gewesen waren, ihn zu töten, fürchteten sie jetzt um ihn. Sie spürten seinen Schmerz als ihren eigenen. Er war ihr Bruder, und sie liebten ihn.
Aber es war zu spät. Er hatte den Schnitt bereits gesetzt.
Ein wilder Schrei brach die Stille des Waldes – Corvus hatte viele Wunden auf dem Schlachtfeld davongetragen, aber dieser Schmerz war ungekannt. Mit gefletschten Zähnen, knochenweiß im Licht des Mondes, richtete er das gequälte Gesicht gen Himmel, während die Stränge in seinem Hals tanzten und zuckten.
Dann war es vollbracht, Blut und Samen ergossen sich auf die Erde. Corvus kniete und hielt sich mit roten Händen, als fürchtete er, den Boden berühren zu lassen, was er weggeschnitten hatte. Stille breitete sich um ihn aus, denn alle wussten, dass sie Zeugen von etwas Entsetzlichem und Heiligem wurden.
Corvus sprach – er richtete weder ein Gebet an einen Gott, seine Tat ungeschehen zu machen, noch verfluchte er seine Feinde. Er sagte nur: »Bringt ihn mir.«
Das Bemalte Volk hatte keinen Zweifel, wovon er sprach. Es gab nur einen Schatz, den er meinen konnte.
Er war geheim und verboten und nur den Stämmen des Nordens bekannt. Sie hatten ihn mit auf die Reise genommen, es aber nicht gewagt, ihn einzusetzen, selbst nicht, als sie wussten, dass sie besiegt waren. Besser zu sterben, so hatten sie gedacht, als dieses Unheil freizusetzen. Jetzt aber verbreitete sich die Kunde, und aus dem Herzen des Waldes reichten sie, von Hand zu Hand und mit großer Zärtlichkeit, ihren schrecklichen Schatz bis auf die Lichtung weiter.
Zuerst schien es, als trügen sie ein Stück greifbarer Nacht – eine Sphäre aus völliger Schwärze, die das einfallende Mondlicht verschluckte. Erst aus der Nähe sah man die alten Hammerabdrücke im Metall, das vor über einem Jahrhundert geglättet worden war. Jene, die es trugen, spürten die Muster unter ihren Fingern. Die eingearbeiteten Bäume, Ulme und Eiche und Esche. Die Gesichter von Männern, lächelnd und lachend und schreiend.
Es war ein alter Kessel, geschmiedet aus schwarzem Eisen. Ein schlichtes, einfaches Ding, ein Gerät von der Sorte, wie man es im ganzen Land nördlich des Walls über sein Kochfeuer hängen würde. Aber in den Geschichten ihrer Völker gab es viele geheiligte Kessel. Den Kessel von Ceridwen, der Weisheit braute wie Suppe. Den Kessel des Dagda, der niemals leer wurde. Und diesen hier – den Brennenden Kessel, das Grab längst vergangener Götter.
Jeder Mann in der Kette berührte ihn nur für kurze Zeit und stolperte fast, um ihn so rasch wie möglich weiterzugeben. Hinterher schworen sie alle, dass der Kessel ihnen fast die Finger verbrannt habe, so heiß sei er gewesen, obwohl er seit hundert Jahren kein Feuer mehr berührt hatte.
So reiste er von Hand zu Hand, bis er schließlich vor Corvus stand. Vor dem Mann, den sie bald schon den Verstümmelten König nennen würden und der nun mit einer zitternden, blutigen Hand hineingriff.
In dem Kessel lag kein Schatz aus Gold und Silber, keine Königskrone, kein Zauberstab. Nichts als Asche und Ruß. Und in diesen Kessel warf Corvus nun das zerstörte Stück seiner selbst. Dann beugte er sich vor und lag weinend auf dem Boden. Alle Kraft und aller Mut waren versiegt.
Sofort scharte sich das Bemalte Volk um seinen König. Einer bedeckte seine Nacktheit mit einem Umhang, ein anderer legte sich neben ihn und wiegte ihn wie einen Bruder im Arm. Alles war vergeben, denn sie kannten das blutige Opfer, das er dargebracht hatte. Das große Opfer für die alten toten Götter – ein verbotener, mächtiger Zauber, der ihr Volk vielleicht wieder erheben mochte.
Die Mordlust war gänzlich verflogen. Es gab nur noch geteiltes Leid und eine stumme Trauer, die sie alle verband. Denn es konnte keinen Frieden geben, nicht nach solch einem Opfer. Keinen Rückzug in die Täler zwischen den Flüssen, kein friedliches Leben zwischen Vieh und Acker. Sie hatten sich ganz einem einzigen Ziel verschrieben – der Rache an den Römern und den Sarmaten, an jenen, die ihnen Unrecht getan hatten. Rache für ihren Verstümmelten König, der so viel für sie geopfert hatte.
Es würde eine geduldige Rache sein, eine Aufgabe für viele Jahre. Erst einmal begnügten sie sich damit, in Wald und Heide zu verschwinden. Ihre Wunden zu lecken, neue Kraft zu sammeln und das Böse im Kessel wachsen zu lassen, bis es bereit war, gegen die Welt entfesselt zu werden.
Alles, was wächst und gedeiht, muss zuerst aus der Erde kommen – das wusste das Bemalte Volk. Und so fingen sie im Licht des Mondes und benetzt mit dem Blut ihres Königs zu graben an.
Der Brennende Kessel A.D. 180
2
Als Kai das Tal erblickte, wirkte es nicht wie ein Ort des Todes.
Es war dasselbe bekannte Tal von Dùin, das er schon oft besucht hatte, um in der herb duftenden Senke Wild zu jagen oder im hohen Gras am Fluss eine Herde weiden zu lassen. Keine Speerspitze funkelte zwischen den Bäumen des Waldes, keine eidgebundenen Krieger sammelten sich an der Furt, keine knarrenden Bogensehnen hallten oberhalb von den grauen Klippen wider. Aber als Kai diesmal über die offenen Weideflächen schaute, als die Sonne durch die Wolken schnitt und ringsum auf den Hügeln tanzte, sagte ihm eine innere Vorahnung, dass ihn hier der Tod erwartete.
Nur eine einzige Sache gab es, die nicht stimmte – es war ein heller, klarer Tag, wie man ihn so hoch im Norden nur selten erlebte, und vielleicht erzeugte dieser Umstand allein seine Vorahnung. Bei seinem Volk, den Sarmaten der großen Steppe des Ostens, gab es das Sprichwort, man solle einen hellen klaren Tag stets fürchten, denn die blutdürstigen Götter des Krieges wollten freien Blick auf das Töten tief unten genießen. So saß er auf seinem hohen Pferd und wartete – wenn er nur aufmerksam genug lauschte, würde er vielleicht ein Flüstern dieser Götter auffangen, die ihn in den Tod locken wollten.
Hinter ihm wartete rastlos seine Reitertruppe – ein Dutzend Krieger, alte und junge, deren Tätowierungen sie als Votadiner auswiesen. Die meisten Pferde trugen noch einen zweiten Reiter: eine Ziege, gefesselt und quer über den Sattel gelegt. Ihre Waffen blitzten hell in der Sonne, nur hier und da war eine Klinge von Blut verdunkelt, denn ihre Feinde vom Stamm der Novanter hatten diese Tiere nicht kampflos aufgegeben. Sie hatten keinen glorreichen Sieg errungen, aber obwohl nur wenige Lieder von gestohlenen Ziegen handelten, waren sie für ein verhungerndes Volk ein wertvollerer Schatz als alles Eisen und Gold.
Denn die Votadiner hungerten. Nachdem die Römer sie fünf Jahre zuvor verbannt und aus der Heimat vertrieben hatten, besaßen sie keine Felder mehr, die sie bestellen konnten, keine Winterweiden, die ihre mageren Herden am Leben hielten – sie lebten allein von der Jagd und von Raubzügen. Jeden Sommer drangen römische Patrouillen weiter nach Norden vor. Jeden Winter wurden die Herdentiere dünner und weniger, und auch der Stamm selbst verblasste, starb dahin. An diesem Tag hatte Kai seinen Plündertrupp tiefer ins Gebiet der Novanter geführt, als ihm lieb gewesen wäre. Zu lange hatten sie auf der Lauer gelegen und darauf gewartet, dass ein Schäfer mit seiner Herde ihren Weg kreuzte. Jetzt aber hatten sie die ersehnte Beute: genug Nahrung, um ihren Stamm zu ernähren. Nun mussten sie sie nur noch behaupten und sicher den Weg zum Rest ihres Stammes zurückfinden.
Kai sah die Blicke seiner Gefährten rastlos über den Horizont schweifen, um nach dem zu suchen, was ihn hatte innehalten lassen. Schließlich ritt einer von ihnen, ein Mann namens Comhnall, vor und fragte: »Welcher Gott flüstert dir heute ins Ohr?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Kai, »aber ich sollte besser auf ihn hören.«
»Vielleicht wartest du, bis die Novanter zurückkommen«, sagte der andere knapp. »Sie werden sicher eine Kriegsmeute aufstellen, um uns zu jagen.«
»Ich weiß. Aber hier lauert ebenfalls Gefahr.«
»Keine, die ich oder sonst irgendwer sehen könnte.«
Kai ignorierte ihn. Er beugte sich vor und legte die Lippen an die Stirn seines Pferdes, um es um Rat zu fragen. Es war ein altes sarmatisches Sprichwort, dass ein Pferd nur ein Drittel der Lebensspanne eines Menschen hatte, dafür aber die dreifache Weisheit. Dass sie, wann immer sie scheuten und vor sich hinstarrten, die Geister der jenseitigen Lande sahen; dass sie, wenn sie mit den Ohren zuckten, hörten, wie geisterhafte Wesen Geheimnisse flüsterten. Doch trotz aller Weisheit konnten Pferde nicht sprechen – man musste die Furchen deuten, die ihre Hufe in den Boden kratzten, den sanften Schwung, mit dem sie den Kopf in den Nacken warfen, oder die Art, wie sie manchmal einen Fluss betrachteten und dabei seufzten wie eine Frau, die sich nach ihrem Liebsten sehnt.
Sein Pferd gab kein Zeichen, das er hätte deuten können. Vielleicht lauerte hier tatsächlich keine Gefahr. Oder vielleicht wusste die Stute nicht, wie sie die Omen dieses Landes zu deuten hatte – sie war hier ebenso eine Fremde wie Kai.
Schließlich sagte er: »Wir müssen uns dicht am Fluss halten.«
Mürrisches Raunen von den anderen. Einer von ihnen, der eine tiefe Schnittwunde im Arm davongetragen hatte, kauerte elend im Sattel und schloss die Augen gegen den Schmerz.
Es gab zwei Wege, die sie zurück zu ihrem Stamm führen würden. Einen langen, offenen Pfad entlang des Flusses, wo jeder Späher der Novanter sie aus großer Entfernung entdecken würde, um ihnen an der nächsten Furt den Weg abzuschneiden. Oder den kürzeren Pfad durch den Wald, einen Weg, den sie schon viele Male genommen hatten. Ein rascher und verborgener Weg, wie es schien, und doch war Kai überzeugt, dass die Omen, die seinen Tod verhießen, von den raschelnden Blättern dort herrührten.
Comhnall spuckte aus. »Warum?«, sagte er.
»Der Wald behagt mir nicht.«
»Habt ihr in Sarmatien keine Bäume? Warum machen sie dir solche Angst?«
»Ich kann es nicht sagen«, meinte Kai widerstrebend. »Aber ich habe schon vorher Omen ignoriert und es stets bereut.«
»Der Weg durch den Wald ist kürzer«, sagte Comhnall. »Wenn wir durch offenes Gelände reiten, überfällt uns noch vor Ende des Tages eine Kriegsmeute der Novanter.« Er senkte den Speer und richtete ihn auf Kais mächtiges sarmatisches Schlachtross, so viel größer und stärker als die Ponys der anderen. »Und du würdest es vielleicht schaffen, ihnen im offenen Gelände davonzukommen. Wir aber nicht. Der Wald wird uns beschützen.«
»Comhnall …«
»Nein«, sagte der Votadiner und schüttelte den Kopf. »Du bist kein Anführer, der uns Befehle geben kann. Du bist nicht mal …«
Die Worte versiegten, bevor er den Satz vollenden konnte, aber Kai kannte sie nur zu gut – er war nicht wirklich Teil ihres Stammes. Seine Kupferhaut neben ihrer Blässe, verziert mit verschlungenen Drachen und Antilopen, die in diesem Land keinerlei Bedeutung hatten. Man konnte ihn genauso wenig für einen Votadiner halten wie sein Schlachtross für eines ihrer zottigen Ponys. Fünf Jahre hatte er unter Votadinern gelebt, seit er den Wall überquert und die Römer und den Rest seines Volkes zurückgelassen hatte, aber sooft sie auch behaupteten, ihn aufgenommen zu haben, und sooft er mit Pferd und Lanze für ihren Stamm gekämpft hatte, gehörte er doch immer noch nicht zu ihnen. Vielleicht würde er es nie tun.
Der Reihe nach sah er die übrigen Mitglieder der Truppe an und suchte nach Verbündeten. Er sah nur die sorgsam leeren Blicke von Männern, die sich längst entschieden hatten. Einer, ein junger Kerl namens Oisean, der kaum alt genug war, seinen Speer zu heben, wirkte, als wollte er etwas sagen, aber im letzten Moment senkte er den Kopf und hielt den Mund.
»So sei es«, sagte Kai. »Wollen wir hoffen, dass mich dieser Gott nur in die Irre führen will.«
Ein bitteres Lachen von Comhnall. »Wirklich eine gute Hoffnung. Wann wären die Götter je auf unserer Seite gewesen, seit du zu unserem Volk gestoßen bist?«
*
Am Waldrand herrschte tiefe Stille. Kein Vogelsang, kein Rascheln von Wolf oder Wildschwein oder Reh im Gehölz, und selbst die Bäume schienen gespannt den Atem anzuhalten.
Kai schaute noch einmal Comhnall an, eine stumme Frage in seinem Blick.
»Die Novanter können nicht so schnell hergekommen sein«, sagte Comhnall wie einer, der sich selbst von etwas überzeugen will. »Die Selgovier meiden diesen Ort. Und die Römer fürchten sich sogar noch mehr vor Wäldern als du. Es ist niemand hier.«
»Sag das den Vögeln«, gab Kai zurück.
Sie bewegten sich langsam zwischen den Bäumen, bahnten sich den Weg über alte Wildwechsel, auf denen Hirsche seit Jahrhunderten den Wald durchstreiften. Ohne darüber zu reden, hielten sie sich nah am Waldrand, wie Seeleute, die das Ufer nicht aus den Augen lassen, denn sie alle fürchteten sich davor, den Blick auf das offene Gelände zu verlieren.
Die Sonne sank, das rötliche Licht stach schräg zwischen den Bäumen hindurch, scharf und grell. Noch immer sang kein Vogel, und selbst die Ziegen – gefesselt auf den Pferderücken und umgeben von Männern, die nach Blut stanken – verstummten, wie Tiere es tun, wenn sie wissen, dass sich ein Raubtier in der Nähe befindet.
Dann zügelte Comhnall, der vorneweg ritt, sein Pferd und saß völlig reglos im Sattel. Kai versuchte die Gefahr auszumachen, die sein Begleiter gesehen haben musste, und schon fingen seine Augen an, ihm Streiche zu spielen – Regenwasser auf einem breiten Blatt wurde für einen Augenblick zu einer schimmernden Speerspitze; eine ringförmige Ansammlung von Flechten auf der Borke eines Baumes sah aus wie zwei aufgerissene Augen, die ihn anstarrten. Aber als er blinzelte und genau hinschaute, war nirgends ein böses Omen zu erkennen. Nichts als der leere, stille Wald.
Kai trieb sein Pferd an und ritt ans Kopfende des Zuges. »Was siehst du?«, fragte er.
Comhnall antwortete nicht. Er senkte den Speer und deutete mit bebender Spitze voraus. Da sah Kai, was den Mann mit Furcht erfüllt hatte.
Der Boden auf der Lichtung war aufgerissen worden. Schwarze Erde lag offen unter freiem Himmel wie altes Blut, das um eine schwärende Wunde gerinnt. Er sah die Abdrücke der Hände und Klingen, die die Erde aufgehackt hatten, als hätte sich etwas Großes und Schreckliches mit seinen Klauen aus dem Boden ans Licht gegraben – ein Monster, das sich aus dem eigenen Grab freigekämpft hatte.
»Ein Aasfresser?«, sagte Kai. »Vielleicht ist hier jemand zu flach begraben worden?«
»Das hat kein Tier getan«, sagte Comhnall mit seltsam ausdrucksloser Stimme. »Und es sieht wie kein Grab aus, das ich je gesehen hätte.«
Er hatte recht – kein Anzeichen eines Steinhügels, und bei den Stämmen des Nordens galt der Wald als böser Ort für die Bestattung der Toten. Nachts versammelten sich finstere Geister zwischen den Bäumen, so hieß es, und ein Toter, der dort begraben wurde, würde es nicht lange bleiben.
Kai streckte die Hand aus und legte sie dem anderen auf den Arm, aber Comhnall reagierte nicht. »Wir müssen weiter«, sagte Kai.
Comhnall nickte, die Augen trübe, als erwachte er gerade aus einem Traum. »Ja. Aber es tut nichts mehr zur Sache.« Er drehte sich um und tätschelte Kai sanft die Hand. »Es tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe.« Da lag ein entsetzlicher Frieden in seiner Stimme.
Es war ein Frieden, den Kai nicht teilte, als sie tiefer in den Wald vordrangen. Da war nur ein lähmendes Gefühl der Angst, das wie ein Fluss im Frühling immer weiter anschwoll. Er versuchte sich einzureden, ein Narr zu sein – Comhnall hatte recht gehabt, als er sagte, dass andere Stämme diesen Ort mieden, und die Krieger, die er bei sich hatte, waren mutig und kampferprobt. Und obwohl man sich erzählte, dass Götter stets die Wahrheit sagten, waren sie Wesen, die außerhalb der Zeit standen. Vielleicht hatten sie an diesem Ort ein Massaker gesehen, dass erst in hundert Jahren stattfinden würde, vielleicht riefen sie ihm Warnungen zu über ein blutiges Ereignis, das noch nicht stattgefunden hatte.
All das war die Wahrheit. Am Ende aber spielte es alles keine Rolle.
Sie tauchten hinter den Stämmen auf und schienen aus dem Boden zu wachsen – kein kunstfertiger Überfall von mehreren Seiten, sondern eine plötzliche Welle aus Männern, die so wortlos und stumm über sie herfielen, dass es schrecklicher war als jeder Kriegsgesang. Sie waren Geister, die aus dem dichten Farn auftauchten, die sinkende Sonne hell auf ihren Speeren, blitzend auf Pfeilspitzen, die auf gespannten Sehnen saßen, dann pfiffen die Pfeile durch den Wald, und die Luft war plötzlich voller Leben wie eine erwachte, beißende Kreatur.
Schon war der erste Votadiner getroffen und fiel schreiend aus dem Sattel, aber Kais Angst war sofort verflogen. Denn Angst speist sich aus Entscheidungen, und Kai blieb nur noch ein einziger Weg – er legte die Lanze an und rief seine Begleiter zum Sturmangriff.
Der Boden war uneben, die Bäume standen in dichten Gruppen, und ihre Äste ragten wie greifende Hände nach unten, drohten sie aus dem Sattel zu heben. Aber Kai hatte diese votadinischen Reiter gut ausgebildet, ihnen Vertrauen in das Gewicht von Pferd und Reiter gegeben, in die große Reichweite der Lanze. Sofort preschten die Pferde vor, und die Speerspitzen senkten sich, um einen zweiten Wald aus Esche und Eisen zu bilden.
Die Angreifer hätten sich vor ihnen teilen sollen – es war ein Gesetz des Krieges, so unverrückbar wie die Grundlagen der Natur. Jeden Tag ging die Sonne auf und unter, Frühling folgte auf Winter, und Männer aus den Nordlanden konnten einem Kavallerieangriff nicht standhalten. Aber diese Krieger kamen stumm heran, mittlerweile nah genug, dass Kai ihre leeren, ausdruckslosen Augen sehen konnte und die Arme, die geschwärzt waren von der Erde, wo sie etwas aus dem aufgebrochenen Boden gegraben hatten. Als wären die Toten vor ihnen aufgestanden, furchtlos und schrecklich in ihrem Rachedurst.
Kai sah einen tätowierten Mann heraneilen, die Haare steif vor Kalk und den Bart säuberlich gestutzt, einen Krieger, der sich für den eigenen Tod aufgeputzt hatte. Er schien seinen Tod willkommen zu heißen – mit weit geöffneten Armen warf er sich in Kais Speer, und selbst das Lächeln auf seinen Lippen flackerte nur unmerklich, als ihn die Spitze durchbohrte.
Auch die Votadiner sahen es. Furcht befiel sie, und die Pferde strauchelten, stolperten, wandten sich ab, der Sturmangriff brach in sich zusammen, während die Feinde wie eine Welle über sie hereinbrachen und in die Höhe sprangen, um die Votadiner aus dem Sattel zu ziehen, oder abtauchten, um die Kniesehnen und Bäuche der Pferde aufzuschlitzen. Manche wurden unter den Hufen zermalmt, andere von Speeren aufgespießt. Aber nicht genug.
Einzig Kais Pferd hielt ihn am Leben, denn es kämpfte und biss und trat um sich – seine alte Stute hatte viele Kämpfe erlebt und war zum Menschenschlächter erzogen worden. Wie die Feinde, die ihr gegenüberstanden, hatte auch sie keine Angst vor dem Tod.
»Vorwärts! Durchbrechen, durchbrechen!«, schrie Kai, als er sein Pferd zur Flucht nach vorn anspornte und hoffte, die anderen würden folgen.
Taumelnd hielt er auf die Bäume zu – beißender Pferdeschweiß lag in der Luft, die Schreie der Sterbenden bohrten sich in seine Ohren, während er auf den kalten Druck von Eisen auf seiner Haut wartete und sich vorankämpfte, immer auf das Licht zu, das zwischen den Bäumen schimmerte, wo der Wald dem offenen Gelände wich.
Und er hatte den Waldrand fast erreicht, konnte fast schon die Hand ausstrecken und die Sicherheit ertasten, als der Speer sein Ziel fand.
Seine Stute hätte die Gefahr erkennen sollen, aber sie war halb blind durch das Blut, das aus einem Schnitt über ihrem Auge strömte, und sah den Mann nicht rechtzeitig – einen Krieger, der von links kam und bereits so nah war, dass Kai ihn an der Wange hätte berühren können. Er schien sich sehr langsam zu bewegen, aber Kai war noch langsamer, hob und schwang das Schwert mit all der Unbeholfenheit eines Mannes, der im Traum in einem gefrorenen Augenblick feststeckt.
Ganz plötzlich drehte sich die Welt wieder schneller. Der Speer biss rasch zu, ein Zittern durchlief Kai, ein heißer Strom floss seine Beine hinab. Noch konnte er die Wunde nicht spüren, und eine wunderbare Ruhe bemächtigte sich seiner. Keine Sorge, ob er leben oder sterben würde, jetzt nicht – nur die Hoffnung, dass er ein paar seiner Leute in Sicherheit bringen konnte. Dass sein Tod einen Sinn haben würde.
Er ließ das Schwert auf den Mann niedersausen, der ihn stark verwundet hatte, sah seinen Körper zwischen die Hufe rollen und brechen. Dann war er hindurch, draußen und frei. Gleißendes Licht blendete ihn, als er aufs freie Feld hinauskam und den Wald hinter sich ließ wie ein Erwachender, der einem Albtraum entflieht.
Kai ließ seine Stute einen Moment lang galoppieren, ließ sie Leben und Freiheit kosten – und sich selbst ebenfalls, diese Freude, die jeder Sarmate beim Ritt durch offenes Gelände empfindet. Er war dankbar, sie ein letztes Mal zu spüren. Denn immer noch fühlte er das Blut an seinem Körper herabströmen, so viel, dass er wusste, es konnte sich nur um eine tödliche Wunde handeln.
Er musste all seinen Mut zusammennehmen, um an sich hinabzuschauen und zu sehen, wo man ihn verwundet hatte – nicht im Bauch oder am Rücken, nicht an dem geheimen Ort am inneren Oberschenkel, wo der Lebenssaft wie ein reißender Strom fließt. Er fuhr sich mit den Fingern über die Haut und wartete darauf, dass sie an einem offenen Schnitt stockten, dass er die Wallungen seines Blutes spürte. Er konnte nichts finden. Dann sah er sich gründlicher um und entdeckte endlich, woher das Blut kam.
Die Ziege, die er bei dem Raubzug gewonnen hatte und die noch immer um sein Sattelhorn gebunden hing. Er sah Blut aus ihrem Mundwinkel rinnen, sah die leeren Augen, die blind in den Himmel starrten und die rote Spur, die ihre Wolle wie Farbstoff verklebte. Sie hatte den Speer für ihn abgefangen, wie Helden ihr Leben für jene geben, die sie lieben.
Ein fröhliches, irres Lachen entfuhr ihm, im Wissen, dass er weiterleben würde, weil ihn eine Ziege gerettet hatte. Bis er über die Schulter blickte und ihm das Lachen so schnell verging, wie es gekommen war.
Er hatte Hufschläge hinter sich gehört und gehofft, dort viele seiner Begleiter zu sehen. Aber es war nur das Echo seiner Stute gewesen, das wie Hohn von den Klippen widerhallte. Von dem Dutzend Männer, das er geführt hatte, war allein er geblieben.
Und diese Männer im Wald – Kai wollte glauben, dass sie Banditen oder Plünderer gewesen waren, vielleicht irgendein Kult der Selgovier, der von den Prophezeiungen eines Traumdeuters in den Wahnsinn getrieben worden war. Aber tief im Herzen wusste er, gegen wen sie gekämpft hatten. Ein Feind, von dem sie geglaubt hatten, ihn vor fünf Jahren vernichtet zu haben.
Das Bemalte Volk.
3
Als Kai die Votadiner erreichte, dämmerte der Abend bereits.
Es war eine erschreckend langsame Reise gewesen, auf einem erschöpften Pferd, das zitterte und bebte und schwitzte, nachdem der Kampfrausch aus seinen Adern wich. Die immer dunkleren Schatten schienen von Feinden zu wimmeln, jede Änderung der Windrichtung drohte, den Klang von Kriegsgesängen mit sich zu bringen, von Bogensehnen, von hoch geschleuderten Speeren und donnerndem Hufschlag. Aber auf dem ganzen langen Weg zurück nach Hause, durch die Hügel in Richtung der westlichen Küste, war nichts als Wind zu hören. Bis er endlich, als die Sonne schon fast vom Himmel gefallen war, doch etwas Neues hörte.
Zuerst die Klänge der See, das flüsternde Tosen endlos brechender Wellen. Kurz darauf mischte sich in den Ruf des Wassers und die Schreie der Möwen noch etwas anderes – Musik.
Die Votadiner hatten ihr Lager gut versteckt in einer geschützten Bucht errichtet. Die Kochfeuer glommen sanft, der spärliche Rauch wurde vom ewigen Wind davongetragen und verschwand über dem Meer im Nebel. So hörte Kai sie, bevor er sie sehen konnte – die Stimmen der Votadiner, erhoben zum Gesang. Die rastlosen Choräle von Tod und Wiedergeburt, die halb vergessenen Hymnen ihrer Götter. Alte Musik, so alt wie die Hügel und die Heide, gesungen in einer nur halb verständlichen Sprache, die er selbst kaum sprach.
Aber er hörte auch andere Lieder, die er nur zu gut kannte, sarmatische Lieder, die er zuerst in der Steppe fern im Osten vernommen hatte. Da lagen fröhliche Lieder über waghalsige Heldentaten in der Luft – über einen sterbenden König, der sein Schwert ins Wasser warf, über einen Baum voll goldener Äpfel, die eine Frau in einen Mann verwandeln konnten, über die Suche nach einer Stadt unter dem Meer. Und er hörte die süßen traurigen Gesänge, mit denen die Sarmaten ihrer Toten gedachten, die Musik, die von Dunkelheit und Staub und von dem Halbleben jenseits des Grabes erzählte. Während der langen Jahre im Exil hatte er den Votadinern diese Lieder beigebracht, damit er sich, wenn er abends mit geschlossenen Augen am Feuer lag, für einen Moment wieder in die Steppe des Ostens zurückträumen konnte. Damit er, wenn auch nur im Traum, den Weg nach Hause fand.
Und dann, als hätte ihn ein Zauber wirklich zurück in die herrliche Steppe entführt, rief ihm aus der Dunkelheit eine Stimme in der Sprache der Sarmaten zu – die Stimme einer Frau, die Kai die erste Hälfte eines Sprichwortes darbot: »Wenn unser Leben auch kurz ist …«
»Soll unser Ruhm doch groß sein«, antwortete Kai. Aus dem Schatten kam eine Reiterin, um ihn zu Hause willkommen zu heißen.
Im Mondlicht wirkte ihr Gesicht wie ein Spiegelbild seines eigenen – scharfe hohe Wangenknochen, dichtes schwarzes Haar, sehr kurz geschoren, kalte graue Augen. Und ein Lächeln auf den Lippen, schnell und schüchtern und seltsam schief, als wäre es eine einstudierte Geste, die sie nur durch Nachahmung gelernt hatte. Selbst in diesem Zwielicht hätte ein Fremder bloß einen Atemzug gebraucht, um die große Ähnlichkeit zwischen Kai und Laimei zu sehen, um in ihnen Bruder und Schwester zu erkennen.
»Ich hätte dich aufspießen sollen«, sagte sie und tippte mit den Fingern gegen den Speerschaft, »so viel Zeit hast du dir mit der Antwort gelassen.« Laimeis Blick huschte über die Stute, die vor Müdigkeit nickte, zur aufgeschlitzten Ziege an seinem Sattel. Zuletzt sah sie seine Speerspitze an, deren Klinge dunkel von Blut war. »Die anderen?«, fragte sie.
Kai schüttelte stumm den Kopf.
»Sieht dir nicht ähnlich, in einen Hinterhalt zu reiten«, sagte sie.
»Ich habe die Warnung eines Gottes gehört«, sagte er, »aber ich konnte die anderen nicht dazu bringen, zuzuhören.«
»Waren es Novanter auf der Suche nach ihren Herdentieren?«
»Nein«, sagte Kai. »Sie sind mitten im Wald im Tal von Dùin über uns hergefallen, außerhalb der Novanter-Gebiete.«
»Wer dann?«
Kai antwortete erst nicht. In seinem Herzen wusste er, was er gesehen hatte, anhand der leeren Augen und der verschlungenen Tätowierungen, an der achtlosen Art, mit der die Männer gekämpft hatten und gestorben waren. Dennoch schien es ihm unheilvoll, es laut auszusprechen. Er konnte sich nur dazu bringen, in Rätseln zu sprechen und ihrer Stimme die richtige Antwort zu überlassen.
»Männer aus vielen Stämmen und keinem«, sagte er endlich. »Von denen, die ursprünglich in den Norden gehören, aber einmal nach Süden gekommen sind. Männer, die wir schon sehr oft getötet haben, die aber immer wieder aufstehen, um ein weiteres Mal zu kämpfen.«
»Das Bemalte Volk«, sagte sie ohne Zögern, denn sie war schon immer sehr viel tapferer gewesen als er.
»So ist es«, sagte Kai. »Ich hatte gehofft, sie nie wieder zu sehen, aber so ist es.«
Als er diese Worte sprach, glaubte er einen altbekannten Ausdruck in ihrem Gesicht zu erkennen – ein wölfisches Grinsen aus purer Vorfreude auf den möglichen Kampf gegen einen furchteinflößenden Gegner, der vielleicht bald bevorstand. Unter den Sarmaten war sie eine große Kriegerin gewesen und hatte sich den Kampfnamen ›Grausamer Speer‹ verdient. Sie lebte für die Schlacht, hatte seit jeher mit der sorglosen Gleichgültigkeit einer wahren Heldin dem Tod nachgejagt.
Aber da war doch kein Lächeln auf ihrem Gesicht, er hatte sich die heldenhafte Vorfreude auf die baldige Schlacht offenbar eingebildet. Nur eine plötzliche Stille, ein Schwinden des Leuchtens in ihren Augen, ein etwas zu lange angehaltener Atem. Hätte er sie nicht so gut gekannt, hätte er geglaubt, sie fürchte sich.
»Komm«, sagte sie abrupt und drehte ihr Pferd den Klängen von Gesang und Meer zu. »Mor muss deine Neuigkeit sofort erfahren.« Gemeinsam ritten sie hinab zum Strand, wo die Votadiner ihr neues Zuhause errichtet hatten.
Obwohl Musik die Luft erfüllte, war es kein fröhliches Lager, das sie nun betraten. Der Ort war nicht für seinen Komfort, sondern als gutes Versteck gewählt worden – sumpfiger Untergrund mit einem einzigen, recht weit entfernten und brackigen Fluss als Frischwasserquelle, eine Uferböschung aus Erde, die den Votadinern Sichtschutz gewährte, aber wenig geeignet war, sie vor Wind und Regen zu schützen, die meist von Westen kamen. Überall eilten Männer und Frauen mit rastlosen Blicken umher, noch immer fern der Heimat.
Kai und Laimei, die als Nomaden in der Steppe fern im Osten aufgewachsen waren, kannten nur ein Leben auf Wanderschaft. Ihnen machte es nichts aus, ein Jahr zu verbringen, in dem sie kaum zwei Nächte am gleichen Ort schliefen – sie würden spüren, wie die Götter und ihre Vorfahren sie von den Sternen aus leiteten, wohin auch immer sie sich begaben. Aber die Votadiner hatten sich dieses Leben nicht ausgesucht. Ihr Volk war tief mit dem eigenen Land verwurzelt, über viele Generationen hinweg. Die Gunst der Götter ließ sich durch langes, sorgfältiges Umwerben eines bestimmten Flusses gewinnen, eines Waldes, dessen Bäume fast zu Familienmitgliedern wurden, eines Berges, der die Votadiner ein Jahrhundert lang betrachtete, ehe sich der Geist in seinem Innern dazu entschloss, seine Geheimnisse mit ihnen zu teilen. Vor fünf Jahren waren sie von den Römern aus der Heimat vertrieben worden, und jetzt reisten sie in schrecklicher Stille, verloren und ziellos – ein Volk, dessen Götter nicht mehr zu ihm sprachen.
In diesen fünf Jahren hatten die Votadiner mehrfach versucht, sich eine neue Heimat aufzubauen. Zuerst waren sie ins hohe Hügelland tief im Landesinneren gezogen und hatten Ziegen an den kahlen Hängen gezüchtet, bis die Herde von Siechtum befallen wurde und ein bitterer Winter sie zurück ins Tal zwang. Sie hatten eine Zeit lang an einem großen See gelebt, bis eine Kriegsmeute der Selgovier die Hälfte ihres Stammes erschlagen und sie vertrieben hatte. Jetzt lagerten sie an der Küste, obwohl sie weder mit Schiffen noch mit dem Meer vertraut waren. Ohne Hoffnung hatten sie sich hier niedergelassen, wie ein verhungerndes Tier, das sich von der Herde absetzt, um einen ruhigen, abgeschiedenen Platz zum Sterben zu finden.
Und trotzdem standen sie noch immer – die stolzen Votadiner. Kinder spielten ungezwungen, rannten von Feuer zu Feuer mit Stöcken in der Hand, kleine Krieger in den Kampf vertieft. Die Frauen waren oft in größeren Gruppen von Freundinnen anzutreffen, kümmerten sich gemeinsam um die Herden und Kochfeuer, lachten und sangen zusammen. Nur die Männer wirkten geschlagen, saßen trübsinnig mit stumpfen Speeren da und brüteten über ihre Scham.
Beim Anblick dieser Leute zügelte Kai sein Pferd und brachte es zum Stehen. »Ich weiß nicht, wie ich ihnen unter die Augen treten soll«, flüsterte er. »Ich komme allein zurück. Eine schändliche Sache.«
Laimei zischte genervt. »Wir stellen uns ihnen gemeinsam«, sagte sie knapp. »Und du hast getan, was nötig war.«
»Was?«
Sie nickte der toten Ziege an seinem Sattel zu. »Du hast Nahrung mitgebracht«, sagte sie mit der Kälte einer Heldin, »und weniger hungrige Mäuler.«
Kai antwortete nicht. Er sah, dass es zu spät war, um zu wenden und ungesehen im Lager zu verschwinden. Schon erhoben sie sich von den Feuern und sammelten sich, kamen mit schlurfenden Schritten näher. Die Angehörigen derer, die Kai zurückgelassen, die er dem Tod überlassen hatte.
Comhnalls Frau war da, schaute Kai ins Gesicht und bekam eine stumme Antwort auf ihre unausgesprochene Frage. Sie wirkte wie eine geschnitzte Statue der Trauer, und Kai hatte den Eindruck, sie würde sich nie wieder bewegen. Ein anderer Mann lachte zunächst, als er Kai allein zurückkehren sah, als hätte der Sarmate einen besonders köstlichen Witz erzählt, bis sich das Lachen zu Weinen verzerrte, in einen klagenden Schrei, der von den Klippen widerhallte, deren Felsen ihn wie hohlen Spott zu erwidern schienen. Andere schauten Kai einfach nur an und nickten einmal knapp mit trüben Augen, zeigten aber sonst keine Trauer. Ihr Volk hatte sich mittlerweile an Verlust gewöhnt.
Laimei ging zwischen ihnen entlang und war aus dem Sattel geglitten, um den Gebrochenen und Trauernden ihren Segen als Heldin zu geben. Also ging Kai allein durch das Lager der Votadiner, vorbei an brutzelnden Kochfeuern und den Menschen, die sich zum Schutz vor Kälte und Dunkelheit aneinander kauerten. Er kam zum Strand, wo eine einsame Gestalt auf ihn wartete – ein Schatten in der Finsternis, der sich an einem sterbenden Feuer zurücklehnte.
»Möge ich deine bösen Tage verschlingen, Mor«, bot Kai ihm die alte Begrüßung der Sarmaten dar.
»Und ich die deinen.« Eine schattenhafte Hand deutete aufs Feuer. »Setz dich und erzähl deine Geschichte, dann wollen wir unsere spärlichen Gaben teilen.«
Als Kai sich niederließ, sah er, dass der Häuptling ihm in der Tat nur wenig anzubieten hatte – ein paar Löffel Haseneintopf, einen einzigen Schluck Heidebier. Trotzdem fühlte Kai ein wenig Kraft zurückkehren, gefestigt eher durch Mors Anwesenheit als durch das karge Essen.
»Ein unzureichendes Mahl, um es als Häuptling einem Recken anzubieten«, sagte Mor, »aber es wird genügen müssen.«
»Ich fühle mich heute nicht wie ein Recke«, sagte Kai.
»In der Tat. Die Geister der Toten begleiten dich.«
Kai schauderte. »Kannst du sie um mich sehen?«, fragte er.
Ein kratziges Lachen. »O nein, nein, diese Gabe habe ich nicht. Aber ich weiß trotzdem, dass sie da sind. Komm, sag mir, wie sie gestorben sind, damit sie vielleicht ein wenig Ruhe finden.«
Also erzählte Kai ihm von den Toten, und auch von den Lebenden. Von dem flüsternden Gott, der versucht hatte, ihn zu warnen, und von den Männern im Wald, die keine Angst vor dem Tod hatten.
Als Kai sprach, beugte der Häuptling sich vor und ließ das Licht des Feuers über sein Gesicht spielen – ein Gesicht, das weniger von Alter als von Lachfalten gezeichnet war, obwohl Kai wusste, dass der Mann mehr als fünfzig Sommer erlebt haben musste. Er hatte noch immer rotes Haar, das nur hier und da von Silber durchzogen war, wie das Feuer einer Esse an manchen Stellen Weißglut bildet. Einige Votadiner raunten ab und an etwas über Hexenwerk, das ihm den Fluch des Alterns ersparte, aber Kai glaubte, dass es sein Geist allein war, der Mor jung hielt; ein rastloser Geist, der noch zu viel auf dieser Erde zu erledigen hatte, um rasch zu altern, der zwei Lebzeiten brauchen würde, um alles zu erreichen, wonach er strebte. Manch Häuptling hielt sich durch Brutalität und einen festen Speer auf seinem Posten, andere durch Omen oder Herkunft. Bei diesem Mann, bei Mor von den Votadinern, war es ein Gespür für Glück und Lebensfreude, das ihm seinen Platz als Anführer eingebracht hatte, und dieses Gespür war auch nach all den Jahren im Exil noch nicht gebrochen.
Kai erzählte ihm alles – fast alles. Denn als er fertig war und Mor eine Zeit lang ins Feuer gestarrt hatte, fragte der Häuptling: »Und was ist es, wovor du dich fürchtest, es auszusprechen?«
»Ich kann vor dir nichts verbergen, wie es scheint.«
»Mir wurde einmal gesagt, das sei meine Gabe«, sagte Mor. »Den Menschen ins Herz schauen zu können.«
»Nein.«
»Nein?«
»Deine Gabe«, sagte Kai, »ist, dass du behutsam mit den Geheimnissen umgehst, die du dort findest.«
Mor klatschte in die Hände, warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Ach, das ist wirklich lieb von dir. Und ich hoffe, es ist wahr.« Er beugte sich wieder vor. »Also, erzähl mir dein Geheimnis, und ich verspreche, behutsam damit umzugehen.«
Kai senkte den Kopf und schaute auf seine Hände – Blut und Dreck waren tief in die Falten eingegraben und zeichneten ihn wie neue Tätowierungen. »Es waren keine Novanter, gegen die wir dort im Wald gekämpft haben«, sagte er. »Auch keine Selgovier. Es war das Bemalte Volk.«
Mors Lächeln verblasste. »Ich hatte gehofft, sie nie wiederzusehen«, sagte er. »Aber tief im Herzen war mir klar, dass uns das nicht vergönnt ist.« Er sah sich im Lager um und betrachtete die eingefallenen Wangenknochen der Kinder, die leeren Plätze an den Feuern, wo Geister den Lebenden Gesellschaft leisteten, die Angst, mit der die Wachen hinaus ins Dunkel schauten. All die Anzeichen eines sterbenden, gejagten Volkes.
»Was sollen wir tun?«, fragte Kai.
Mor schob Stöckchen ins schwindende Feuer und antwortete nicht, sondern starrte in die frisch aufspringenden Flammen. Endlich sagte er: »Wir können nicht vor ihnen davonlaufen – wir schaffen es kaum, den anderen Stämmen der Nordlande auszuweichen. Also müssen wir sie bekämpfen. Und wir können sie nicht allein bekämpfen.«
»Du kannst unmöglich …«
»Nicht die Römer, Kai. An die wende ich mich nur, wenn mir kein Ausweg mehr bleibt.« Mor warf das letzte Stück Holz ins Feuer. »Wir gehen zu den Novantern und den Selgoviern. Zu jedem anderen Stamm im Norden, der sich mit uns gegen das Bemalte Volk stellen will.«
Kai schüttelte den Kopf. »Wir plündern ihr Vieh; sie jagen uns wie Wölfe. Es kann keine Freundschaft zwischen uns geben.«
»Wie lange hat deine Fehde mit deiner Schwester angedauert?«, fragte Mor leise.
Kai wandte sich ab und schaute ins Lager. Er entdeckte ihren Umriss, der hierhin und dorthin wanderte wie ein rastloser Jagdhund. »Zehn Jahre«, sagte er.
Und es stimmte – die Fehde war vom Blut ihres Vaters gezeichnet gewesen und fast ein Jahrzehnt lang wie eine schwärende Wunde immer weiter gewachsen, und solche Dinge wurden in ihrem Volk nur selten anders beigelegt als durch den Tod einer der beiden Seiten. Trotzdem hatten sie hier im Exil nördlich des Walls wundersame Vergebung gefunden, fast sogar eine Art zurückhaltender Liebe.
»Ihr habt euch gehasst und kämpft jetzt wieder Seite an Seite«, sagte der Häuptling. »So wird es auch mit den Novantern und den anderen kommen.«
»Mag sein«, sagte Kai. »Wenn sie glauben, dass sie gewinnen können.«
»Warum sollten sie das nicht? Das Bemalte Volk ist furchterregend, aber es ist schon einmal besiegt worden. In der Schlacht im Schatten des Walls haben wir sie gebrochen.«
Kai schüttelte den Kopf. »Heute im Wald war irgendetwas an ihnen anders. Ich habe noch nie gegen Menschen gekämpft, die sich so benommen haben.« Und wieder schaute er ins Lager und suchte den Umriss seiner Schwester. »Die haben gekämpft wie sie.«
»Du glaubst, etwas hat sich verändert?«
»Ja.« Kälte kroch über seine Haut. »Und ich habe noch etwas gesehen«, sagte er. »Im Wald, wo sie über uns hergefallen sind, ist etwas ausgegraben worden. Weißt du, was es sein könnte?«
Noch während Kai es sagte, ging eine Veränderung in Mor vor.
Kai hatte einmal eine Geschichte über die Votadiner gehört, erzählt an einem nächtlichen Feuer. Von einem Helden, der ins Land des Ungesehenen Hofes reiste, um eines der dort lebenden Geisterwesen zur Frau zu nehmen. Er wurde mit ewigem Leben gesegnet, um ein angemessener Gatte für seine Geisterfrau zu sein, unter der Bedingung, niemals wieder einen Fuß auf die Erde der sterblichen Welt zu setzen. Aber eines Tages fiel der Held von seinem Pferd, und als seine Haut die Erde küsste, kamen all die Jahre auf einmal über ihn.
So schien es jetzt Mor zu ergehen. Zweifellos ein Trugbild von Feuer und Schatten, aber es war, als wüchsen die Lachfalten plötzlich wie Spinnweben über sein Gesicht, während das feurige Haar im Mondlicht erbleichte – dann war er wieder er selbst, seine Haare gewannen ihre Farbe zurück, die Falten verblassten. Binnen eines einzigen Herzschlags schien ein Jahrzehnt auf ihn einzustürzen und sich wieder zurückzuziehen.
»Weißt du, was dort vergraben war?«, fragte Kai noch einmal.
Mor antwortete nicht. Er beugte sich vor und blies in die sterbende Glut – sie flammte auf und schlug lebhafte Funken, ehe sie endgültig in Dunkelheit verlosch. »Mag sein, dass ich es weiß«, sagte er irgendwann. »Aber noch kann ich nicht darüber reden.«