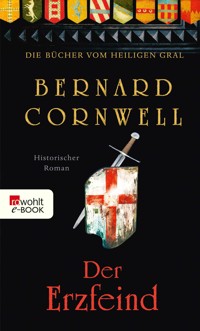
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Bücher vom Heiligen Gral
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Für welche Wahrheit, welche Schätze lohnt es sich zu sterben? In einer blutigen Schlacht erobern die Engländer 1347 Calais. Der lange Krieg mit Frankreich scheint beendet. Nur für Thomas von Hookton gibt es keine Rast. Seine Suche nach dem Heiligen Gral geht weiter. Sie führt ihn in die Gascogne, zum Schloss von Astarac, das einst seinen Vorfahren gehörte und heute Guy Vexille, dem Mörder seines Vaters. Genau an diesem Ort ist der Gral zum letzten Mal gesehen worden. Als Thomas das Schloss erreicht, wird er Zeuge einer Tragödie: Eine junge Frau soll als Ketzerin verbrannt werden. Thomas kann sie vor dem Scheiterhaufen bewahren, und sie fliehen, durch ein blutgetränktes Land, einer Schlacht entgegen, die nicht nur über Leben und Tod entscheiden wird, sondern auch über die Zukunft der Christenheit. Der Abschluss der großen Grals-Trilogie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Ähnliche
Bernard Cornwell
Die Bücher vom Heiligen Gral. Der Erzfeind
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Claudia Feldmann
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Für welche Wahrheit, welche Schätze lohnt es sich zu sterben?
In einer blutigen Schlacht erobern die Engländer 1347 Calais. Der lange Krieg mit Frankreich scheint beendet. Nur für Thomas von Hookton gibt es keine Rast. Seine Suche nach dem Heiligen Gral geht weiter. Sie führt ihn in die Gascogne, zum Schloss von Astarac, das einst seinen Vorfahren gehörte und heute Guy Vexille, dem Mörder seines Vaters. Genau an diesem Ort ist der Gral zum letzten Mal gesehen worden. Als Thomas das Schloss erreicht, wird er Zeuge einer Tragödie: Eine junge Frau soll als Ketzerin verbrannt werden. Thomas kann sie vor dem Scheiterhaufen bewahren, und sie fliehen, durch ein blutgetränktes Land, einer Schlacht entgegen, die nicht nur über Leben und Tod entscheiden wird, sondern auch über die Zukunft der Christenheit.
Der Abschluss der großen Grals-Trilogie.
Über Bernard Cornwell
Bernard Cornwell, geboren 1944, machte nach dem Studium Karriere bei der BBC, doch nach Übersiedlung in die USA entschloss er sich, einem langgehegten Wunsch nachzugeben, dem Schreiben. Im englischen Sprachraum gilt er als unangefochtener König des historischen Abenteuerromans. Seine Werke wurden in über 20 Sprachen übersetzt – Gesamtauflage: mehr als 20 Millionen. Als Rowohlt Taschenbuch sind folgende Romane lieferbar:
Die Uhtred-Serie
Band 1: Das letzte Königreich
Band 2: Der weiße Reiter
Band 3: Die Herren des Nordens
Band 4: Schwertgesang
Band 5: Das brennende Land
Die Artus-Chroniken:
Band 1: Der Winterkönig
Band 2: Der Schattenfürst
Band 3: Arthurs letzter Schwur
Die Bücher vom Heilgen Gral:
Band 1: Der Bogenschütze
Band 2: Der Wanderer
Sowie
Das Zeichen des Sieges
Stonehenge
Das Fort
Gemeinsam mit seiner Frau Judy hat Bernard Cornwell unter dem Pseudonym «Susannah Kells» zwei weitere historische Romane verfasst:
Das Hexen-Amulett
Die dunklen Engel
Weitere Informationen zum Autor
Erfahren Sie mehr über Bernard Cornwell und entdecken Sie spannende Hintergrundinformationen und spannende Aktionen auf www.bernard-cornwell.de
Inhaltsübersicht
Der Erzfeind ist für Dorothy Carroll –
sie weiß, warum
PROLOG
CALAIS, 1347
Die Straße kam von den Hügeln im Süden und durchquerte die Marschen, die bis ans Meer reichten. Es war eine schlechte Straße. Der regenreiche Sommer hatte sie in zähen Schlamm verwandelt, dessen Furchen zu hartem Ton erstarrten, wenn die Sonne herauskam. Aber es war die einzige Straße, die vom höher gelegenen Sangatte zu den Häfen von Calais und Gravelines führte. Bei Nieulay, einem gänzlich unbedeutenden Weiler, kreuzte sie mittels einer Steinbrücke den Ham, einen trägen Flusslauf, der sich durch das fieberverseuchte Marschland schlängelte und im Watt verlor. Er war so kurz, dass man in kaum mehr als einer Stunde von seiner Quelle bis zum Meer waten konnte, und so flach, dass man ihn bei Ebbe durchqueren konnte, ohne einen nassen Leib zu bekommen. Er bewässerte die dicht mit Schilfrohr bewachsenen Sümpfe, in denen Reiher nach Fröschen schnappten, und wurde von einem Gewirr kleiner Bäche gespeist, in denen die Bewohner von Nieulay und Hammes und Guîmes ihre Aalreusen auslegten.
Nieulay und seine Steinbrücke hätten vermutlich auf ewig im Dunkel der Geschichte vor sich hin geschlummert, hätte nicht im Sommer 1347 eine Armee von dreißigtausend Engländern das nur zwei Meilen entfernte Calais unter Belagerung genommen und ihr Lager zwischen den gewaltigen Mauern der Stadt und den Marschen aufgeschlagen. Die Straße, die von den Hügeln kam und bei Nieulay den Ham kreuzte, war die einzige, über die ein französischer Verstärkungstrupp anrücken konnte, und im Hochsommer, als die Einwohner von Calais kurz vor dem Verhungern waren, führte Philippe de Valois, König von Frankreich, seine Armee nach Sangatte.
Zwanzigtausend Franzosen hatten auf der Anhöhe Stellung bezogen, und ein dichter Wald von Bannern flatterte im Seewind, darunter auch die Oriflamme, die heilige Kriegsfahne von Frankreich. Sie war lang und dreispitzig, ein blutrotes Band aus Seide, und dass sie so leuchtete, lag daran, dass sie neu war. Die alte Oriflamme befand sich in England, eine Kriegstrophäe, errungen im vergangenen Sommer auf den weiten grünen Hügeln zwischen Wadicourt und Crécy. Doch die neue Fahne war ebenso heilig wie die alte, und sie war umrahmt von den Bannern der höchsten französischen Adelsgeschlechter: Bourbon, Montmorency und Armagnac. Auch weniger hochstehende Wappen waren vertreten, doch alle verkündeten, dass die größten Krieger aus Philippes Königreich gekommen waren, um gegen die Engländer zu kämpfen. Doch zwischen ihnen und dem Feind lagen der Fluss und die Brücke bei Nieulay, die von einem steinernen Turm bewacht wurde, um den die Engländer Gräben gezogen hatten. Diese Gräben waren mit Bogenschützen und Soldaten bemannt. Dahinter kam der Fluss, dann die Marschen, und auf dem höher gelegenen Land, das die imposante Mauer und den doppelten Wassergraben von Calais umgab, breitete sich eine improvisierte Stadt aus, in der die englische Armee lebte. Und es war eine Armee, wie man sie in Frankreich noch nie zuvor gesehen hatte. Das Feindeslager war größer als Calais selbst. So weit das Auge reichte, reihten sich Zelte und Holzhäuser und Pferdekoppeln aneinander, und überall wimmelte es von Soldaten und Bogenschützen. Die Oriflamme hätte ebenso gut zusammengerollt bleiben können.
«Wir können den Turm einnehmen, Sire.» Geoffrey de Charny, einer der kampferfahrensten Männer in Philippes Armee, deutete hinunter zu der englischen Garnison bei Nieulay, die isoliert auf der französischen Seite des Flusses lag.
«Wozu?», fragte Philippe. Er war ein schwacher Mann und zögerlich in der Schlacht, doch seine Frage war berechtigt. Selbst wenn sie den Turm eroberten und die Brücke von Nieulay so in seine Hände fiel, was würde ihm das nützen? Die Brücke führte lediglich zu einer noch viel größeren englischen Armee, die sich bereits auf dem festen Grund am Rand ihres Lagers aufzustellen begann.
Die Bürger von Calais, ausgehungert und verzweifelt, hatten die französischen Banner auf der Anhöhe im Süden erblickt und als Antwort darauf ihre eigenen Flaggen auf den Zinnen der Brustwehr gehisst. Sie zeigten die Jungfrau Maria, St. Denis, den Schutzheiligen Frankreichs, und, hoch oben auf der Zitadelle, die blau-gelbe Standarte des Königs, um Philippe zu verkünden, dass seine Untertanen immer noch lebten, immer noch kämpften. Doch das stolze Präsentieren der Fahnen änderte nichts an der Tatsache, dass sie seit elf Monaten belagert wurden. Sie brauchten Hilfe.
«Nehmt den Turm ein, Sire», drängte Geoffrey, «und dann greift über die Brücke an! Bei den Knochen Christi, wenn die elenden Hunde sehen, wie wir diesen Sieg erringen, verlässt sie vielleicht der Mut!» Die umstehenden Fürsten stießen ein beifälliges Knurren aus.
Der König war weniger optimistisch. In der Tat hielt die Garnison von Calais der Belagerung noch immer stand, und die Engländer hatten es nicht geschafft, den Stadtmauern nennenswerten Schaden zuzufügen, geschweige denn die beiden Wassergräben zu überwinden, doch ebenso wenig war es den Franzosen gelungen, Vorräte in die Stadt zu schaffen. Die Menschen dort brauchten keine Ermutigung, sie brauchten etwas zu essen. Jenseits des Lagers zeichnete sich eine Rauchwolke ab, und einen Herzschlag später grollte das Donnern einer Kanone über die Marsch. Das Geschoss musste die Mauer getroffen haben, doch Philippe war zu weit weg, um die Wirkung des Einschlags sehen zu können.
«Ein Sieg hier wird die Garnison der Stadt ermutigen», fiel der Baron von Montmorency ein, «und Verzweiflung im Herzen der Engländer säen.»
Doch warum sollte die Engländer der Mut verlassen, wenn der Turm von Nieulay fiel? Philippe nahm an, es würde sie eher dazu veranlassen, die Straße jenseits der Brücke umso hartnäckiger zu verteidigen, doch ihm war auch bewusst, dass er seine scharfen Hunde nicht an der Leine halten konnte, wenn der Feind in Sicht war, und so gab er ihnen die Erlaubnis. «Erobert den Turm», befahl er. «Möge Gott Euch den Sieg schenken.»
Der König blieb, wo er war, während die Fürsten ihre Männer um sich scharten und sich bewaffneten. Der Seewind trug Salzgeruch heran, aber auch einen fauligen Gestank, der vermutlich von verrottenden Algen im Schlick stammte. Er stimmte Philippe melancholisch. Sein neuer Astrologe weigerte sich unter dem Vorwand, er leide an einem Fieber, seit Wochen, vor ihm zu erscheinen, doch Philippe hatte erfahren, dass der Mann sich bester Gesundheit erfreute, was nur bedeuten konnte, dass er ein großes Unglück in den Sternen gesehen hatte und nicht den Mut aufbrachte, es dem König zu sagen. Möwen kreischten unter dem wolkenverhangenen Himmel. Weit draußen auf dem Meer glitt ein schmutzig graues Segel Richtung England, während ein anderes Schiff vor dem englisch besetzten Strand ankerte und in kleinen Booten Männer ans Ufer brachte, um die feindlichen Truppen zu verstärken. Philippe wandte den Blick zurück zur Straße und sah eine Gruppe von vierzig oder fünfzig englischen Rittern auf die Brücke zureiten. Er bekreuzigte sich und betete, dass sein Angriff sie überwältigen würde. Er hasste die Engländer. Aus tiefster Seele.
Der Herzog von Bourbon hatte die Leitung des Angriffs Geoffrey de Charny und Edouard de Beaujeu übertragen, und das war gut so. Der König vertraute darauf, dass beide mit Bedacht handeln würden. Er zweifelte nicht daran, dass sie den Turm einnehmen konnten, obwohl ihm noch immer nicht klar war, wozu das gut sein sollte; doch es war gewiss besser, als wenn die Ungestümeren unter seinen Edelleuten in einem wilden Ausfall die Brücke stürmten und in den Marschen vernichtend geschlagen wurden. Er wusste, dass sie einen solchen Angriff förmlich herbeisehnten. Für sie war der Krieg ein Spiel, und jede Niederlage bestärkte sie nur in ihrem Eifer. Narren, dachte er und bekreuzigte sich erneut, als er sich fragte, welch düstere Prophezeiung der Astrologe wohl vor ihm verheimlichte. Was wir brauchen, dachte er, ist ein Wunder. Ein deutliches Zeichen von Gott. Dann fuhr er erschrocken herum, als ein Trommler auf seine große Pauke schlug. Ein Fanfarenstoß ertönte.
Doch die Klänge verkündeten noch nicht den Angriff, sondern die Musiker erprobten nur ihre Instrumente. Edouard de Beaujeu stand auf der rechten Seite, wo er über tausend Armbrustschützen und ebenso viele Soldaten versammelt hatte. Offensichtlich beabsichtigte er, die Engländer von der Seite anzugreifen, während Geoffrey de Charny mit mindestens fünfhundert Soldaten geradewegs den Hügel hinab auf die englischen Gräben zustürmen würde. Geoffrey marschierte an der Linie entlang und befahl seinen Rittern und Soldaten, vom Pferd zu steigen. Sie folgten ihm nur unwillig. Für sie war das Glorreichste am Krieg der Angriff der Kavallerie, doch de Charny wusste, dass Pferde gegen einen von Gräben geschützten Steinturm nichts ausrichten konnten, und so bestand er darauf, dass seine Männer zu Fuß kämpften. «Schilde und Schwerter», rief er ihnen zu. «Keine Lanzen! Zu Fuß! Zu Fuß!» De Charny hatte aus eigener bitterer Erfahrung gelernt, wie hilflos Pferde den englischen Pfeilen ausgeliefert waren, während Männer, die zu Fuß kämpften, geduckt im Schutz solider Schilde vorrücken konnten. Einige der Männer von edlerer Abstammung weigerten sich abzusteigen, doch er beachtete sie nicht. Immer mehr französische Soldaten eilten herbei, um sich dem Angriff anzuschließen.
Der kleine Trupp von englischen Rittern hatte jetzt die Brücke überquert, und einen Moment sah es so aus, als wollten sie die Straße hinaufreiten und die gesamte französische Armee herausfordern, doch dann zügelten sie ihre Pferde und blickten nur zu den Massen auf der Anhöhe hinauf. Der König, der sie beobachtete, sah anhand der Größe des Banners, dass sie von einem hohen Edelmann angeführt wurden, und mindestens ein Dutzend der übrigen Ritter trugen quadratische Standarten an ihren Lanzen. Ein reiches Grüppchen, dachte er. Ihre Lösegelder würden ein kleines Vermögen einbringen. Er hoffte, dass sie zu dem Turm reiten und ihm so in die Falle gehen würden.
Der Herzog von Bourbon ritt zu Philippe zurück. Er trug einen Plattenpanzer, der mit Hilfe von Sand, Essig und Stahlwolle poliert worden war, bis er silbern glänzte, und sein Helm, der noch am Vorderzwiesel des Sattels hing, war mit einem blau gefärbten Federbusch geschmückt. Der Herzog hatte sich geweigert, von seinem Streithengst abzusteigen, der mit einer stählernen Rossstirn und einer Schabracke aus Kettenpanzern ausgestattet war, um ihn vor den Pfeilen der Engländer zu schützen, die zweifellos bereits in den Gräben hockten und ihre Bogen schnürten. «Die Oriflamme, Sire», sagte der Herzog. Es sollte eigentlich eine Bitte sein, klang jedoch eher wie ein Befehl.
«Die Oriflamme?» Der König tat, als verstünde er nicht.
«Gewährt Ihr mir die Ehre, Sire, sie in die Schlacht zu tragen?»
Der König seufzte. «Eure Truppen sind zehnmal stärker als die der Engländer», sagte er. «Ihr braucht die Oriflamme nicht. Lasst sie hier. Der Feind hat sie gesehen.» Und der Feind wusste, was die wehende Oriflamme bedeutete. Sie wies die Franzosen an, keine Gefangenen zu nehmen und alle zu töten, obgleich ein wohlhabender Ritter mit Sicherheit trotzdem gefangen genommen und nicht getötet werden würde, denn ein Leichnam brachte kein Lösegeld ein. Dennoch sollte das dreispitzige Banner Furcht in den Herzen der Engländer säen. «Sie bleibt hier», bestimmte der König.
Der Herzog setzte zum Widerspruch an, doch in diesem Augenblick erklang ein Fanfarenstoß, und die Armbrustschützen setzten sich in Bewegung. Sie trugen grün-rote Waffenröcke mit dem Abzeichen der Stadt Genua, dem Heiligen Gral, auf dem linken Arm, und jeder von ihnen wurde von einem Fußsoldaten mit einer Pavese begleitet, einem großen, schweren Schild, der dem Armbrustschützen Schutz bot, während er seine sperrige Waffe lud. Unten am Flussufer, eine halbe Meile entfernt, liefen Engländer aus dem Turm zu den Gräben, die nach den langen Monaten längst dicht mit Gras und Unkraut bewachsen waren. «Ihr werdet Eure Schlacht verpassen», bemerkte der König, woraufhin der Herzog, ohne noch einen Gedanken an das rote Banner zu verschwenden, seinem schweren Streitross die Sporen gab und zu Geoffrey de Charnys Männern ritt.
«Montjoie Saint Denis!» Der Herzog stieß den französischen Schlachtruf aus, die Trommler schlugen auf ihre mächtigen Pauken, und ein Dutzend Trompeter schmetterten ihre Herausforderung gen Himmel. Ein vielstimmiges Klacken ertönte, als die Visiere heruntergeklappt wurden. Die Armbrustschützen waren bereits am Fuß des Abhangs angekommen und schwenkten nach rechts aus, um die englische Flanke einzuschließen. Dann schwirrten die ersten weiß gefiederten Pfeile über die grüne Ebene, und der König, der sich in seinem Sattel vorbeugte, sah, dass der Feind zu wenig Bogenschützen hatte. Wenn die verfluchten Engländer in die Schlacht zogen, führten sie für gewöhnlich mindestens dreimal so viele Bogenschützen wie Ritter und Soldaten mit sich, doch der Außenposten bei Nieulay schien vorwiegend mit Soldaten besetzt zu sein. «Gott sei mit euch!», rief der König seinen Männern zu. Erregung packte ihn, denn er witterte bereits den Sieg.
Nun flogen auch die Armbrustbolzen. Ein Zischen erfüllte die Luft, als Hunderte der mit Lederflügeln versehenen eisernen Schäfte auf die Gräben zuschossen. Dann traten die Armbrustschützen hinter die großen Schilde, um ihre mit Stahl verstärkten Bogen mit einer Zahnradwinde zu spannen. Ein paar englische Pfeile bohrten sich in die Pavesen, doch dann wandten sich die Bogenschützen dem von Geoffrey de Charny geführten Angriff zu. Sie legten Pfeile mit langer, nadelförmiger Spitze auf ihre Bogen, die Kettenpanzer durchdrangen, als wäre es Leinen. Sie spannten und schossen, spannten und schossen, und die Pfeile donnerten in Schilde und in die geschlossenen französischen Schlachtreihen. Ein Mann wurde am Oberschenkel getroffen und stürzte, doch die Masse der Soldaten schloss sich sofort wieder um die entstandene Lücke. Ein englischer Bogenschütze, der gerade in Schussposition stand, bekam einen Armbrustbolzen in die Schulter, und sein Pfeil flog in unkontrollierter Linie davon.
«Montjoie Saint Denis!», brüllten die Soldaten herausfordernd, als sie die flache Ebene am Fuß des Hügels erreichten. Die Pfeile hagelten mit furchteinflößender Wucht auf die Schilde ein, doch die Franzosen hielten ihre enge Formation, Schild an Schild, und die Armbrustschützen rückten im Schutz ihrer Pavesen vor, um auf die englischen Bogenschützen zu zielen, die ihre Pfeile nur aus dem aufrechten Stand abschießen konnten. Ein Bolzen fraß sich durch eine stählerne Beckenhaube in einen englischen Schädel. Der Mann fiel mit blutüberströmtem Gesicht zur Seite. Ein Pfeilhagel peitschte von der Turmspitze herunter, eine Gegensalve von Armbrustbolzen prallte gegen die Steine, und als die englischen Soldaten sahen, dass ihre Pfeile den feindlichen Angriff nicht zum Stillstand gebrachten hatten, zogen sie ihre Schwerter.
«St. George!», brüllten sie, dann hatten die französischen Angreifer den ersten Graben erreicht und hieben auf die tiefer stehenden Engländer ein. Einige von ihnen entdeckten schmale Verbindungsdämme zwischen den Gräben und strömten hinüber, um den Feind von hinten anzugreifen. Die Bogenschützen in den beiden hintersten Gräben hatten leichte Ziele, aber dasselbe galt für die Genueser Armbrustschützen, die hinter ihren Pavesen hervortraten, um die Feinde mit ihren Bolzen zu spicken. Einige von den Engländern, die die bevorstehende Metzelei ahnten, verließen die Gräben und rannten auf den Fluss zu. Edouard de Beaujeu, der die Armbrustschützen anführte, bemerkte die Flüchtenden und rief den Genuesern zu, sie sollten ihre Waffen fallen lassen und sich dem Angriff anschließen. Mit Schwertern und Äxten stürzten sie sich auf den Feind. «Tötet sie!», brüllte de Beaujeu, zog sein Schwert und gab seinem mächtigen Streithengst die Sporen. «Tötet sie!»
Die Engländer im vordersten Graben waren dem Tod geweiht. Sie versuchten verzweifelt, sich vor dem Ansturm der französischen Soldaten zu schützen, doch die Schwerter, Äxte und Speere hackten auf sie nieder. Einige der Männer versuchten sich zu ergeben, doch die Oriflamme war gehisst, und das bedeutete keine Gefangenen, also tränkten die Franzosen den zähen Schlamm des Grabens mit englischem Blut. Die Verteidiger aus den hinteren Gräben liefen jetzt allesamt davon, doch die französischen Reiter, die zu stolz gewesen waren abzusteigen, galoppierten über die schmalen Verbindungsdämme, drängten ihre eigenen Soldaten beiseite und trieben ihre massigen Pferde unter wilden Schlachtrufen auf die Fliehenden am Flussufer zu. Die Hengste bäumten sich auf, während die Schwerter niederfuhren. Ein Bogenschütze wurde geköpft, und der Fluss färbte sich rot. Ein Soldat schrie auf, als er von einem Pferd niedergetrampelt und dann von einer Lanze durchbohrt wurde. Ein englischer Ritter hob die Hände und bot seinen Handschuh als Zeichen der Kapitulation, doch er wurde von hinten niedergeritten, der Reiter bohrte ihm sein Schwert in den Rücken, und ein anderer hieb ihm die Axt ins Gesicht. «Tötet sie!», brüllte der Herzog von Bourbon mit bluttriefendem Schwert. «Tötet sie alle!» Er erblickte eine Gruppe von Bogenschützen, die Richtung Brücke flohen, und rief seine Männer. «Zu mir! Zu mir! Montjoie Saint Denis!»
Die Bogenschützen, es waren fast dreißig, liefen auf die Steinbrücke zu, doch als sie bei den strohgedeckten Häusern ankamen, die verstreut am Flussufer lagen, hörten sie das Hufgetrappel und drehten sich alarmiert um. Einen Moment sah es so aus, als würden sie in Panik ausbrechen, doch einer von ihnen hielt sie zurück. «Schießt auf die Pferde, Jungs», sagte er, und die Bogenschützen spannten ihre Sehnen, und die weiß gefiederten Pfeile bohrten sich in die Streitrösser. Der Hengst des Herzogs von Bourbon taumelte zur Seite, von zwei Pfeilen getroffen, und stürzte, als zwei weitere Pferde mit wild um sich schlagenden Hufen zu Boden gingen. Die übrigen Reiter wichen zurück. Der Knappe des Herzogs überließ seinem Herrn das Pferd und starb einen Augenblick später, als der zweite Pfeilhagel aus dem Weiler herüberzischte. Der Herzog versuchte gar nicht erst, sich auf das Pferd seines Knappen zu hieven, sondern lief in seinem kostbaren Plattenpanzer, der ihn vor den Pfeilen geschützt hatte, ungelenk davon. Vor ihm, am Fuß des Turms von Nieulay, hatten die Überlebenden aus den englischen Gräben eine Wand aus Schilden errichtet, die von blutrünstigen Franzosen umzingelt war. «Keine Gefangenen!», brüllte ein französischer Ritter. «Keine Gefangenen!» Der Herzog rief seine Männer herbei, damit sie ihm in den Sattel halfen.
Zwei seiner Gefolgsleute saßen ab, um ihrem Herrn auf das neue Pferd zu helfen, da ertönte plötzlich donnerndes Hufgetrappel. Sie fuhren herum. Ein Pulk englischer Ritter preschte aus dem Dorf auf sie zu. «Süßer Jesus!» Der Herzog hing halb im Sattel, mit einem Bein im Steigbügel, das Schwert in der Scheide, und als seine beiden Männer ihrerseits die Schwerter zogen, verlor er das Gleichgewicht und fiel hinunter. Wo zum Teufel kamen diese Engländer her? Dann eilten seine Ritter herbei, um ihren Lehnsherrn zu beschützen, klappten ihre Visiere herunter und wandten sich den Angreifern zu. Der Herzog, der hilflos auf dem Boden lag, hörte, wie die Waffen der Reiter aufeinanderprallten.
Die Engländer waren die berittenen Männer, die der französische König zuvor gesehen hatte. Sie hatten im Dorf angehalten, um das Gemetzel in den Gräben zu beobachten, und wollten gerade über die Brücke zurückreiten, als die Männer des Herzogs von Bourbon sich in ihr Gebiet vorwagten. Und zwar zu weit – eine Herausforderung, die sie nicht ignorieren konnten. Also hatte der englische Lord die Ritter seines Gefolges zum Angriff gegen den Herzog geführt. Die Franzosen waren auf diese Attacke nicht vorbereitet, die Engländer ritten in korrekter Gefechtsaufstellung, Knie an Knie, und die langen Eschenholzlanzen, die während des Ansturms noch in die Luft ragten, senkten sich plötzlich in Angriffsposition und durchbohrten Leder und Kettenpanzer. Der Anführer der Engländer trug einen blauen Waffenrock, durchteilt von einem diagonalen weißen Band, auf dem drei rote Sterne prangten. Steigende gelbe Löwen zierten die beiden blauen Felder, die sich schwarz verfärbten, als er sein Schwert in die ungeschützte Achselhöhle eines französischen Soldaten rammte und das Blut ihm entgegenspritzte. Der Mann zitterte vor Schmerz, versuchte noch, mit seinem Schwert auszuholen, doch dann hieb ein anderer Engländer ihm seinen Streitkolben in das Visier. Der Stahl verformte sich unter dem Schlag, und aus den Ritzen quoll Blut. Ein Pferd, dem jemand die Sehnen durchtrennt hatte, stürzte wiehernd zu Boden. «Zusammenbleiben!», brüllte der Mann in dem bunten Waffenrock seinen Männern zu. «Zusammenbleiben!» Sein Pferd stieg und schlug mit den Hufen nach einem Franzosen, der mit zertrümmertem Helm und Schädel zu Boden ging. Dann bemerkte der Reiter den Herzog, der hilflos neben einem Pferd stand; der schimmernde Plattenpanzer verriet ihm, dass es sich um einen reichen Mann handeln musste, und so ritt er auf ihn zu. Der Herzog wehrte den Schwertstreich mit seinem Schild ab und stieß seinerseits mit der Klinge zu, die jedoch am Beinpanzer seines Gegners abprallte, und dann war der Reiter plötzlich verschwunden.
Einer der Engländer hatte das Pferd seines Anführers weggezogen. Ein Ansturm französischer Reiter galoppierte den Hügel hinunter. Der König hatte sie losgeschickt, in der Hoffnung, den englischen Lord und seine Männer gefangen zu nehmen, und zahllose weitere Franzosen, die beim Turm nichts mehr ausrichten konnten, weil bereits zu viele von ihren Landsleuten damit beschäftigt waren, die Überreste der Garnison zu vernichten, stürmten jetzt auf die Brücke zu. «Zurück!», brüllte der englische Anführer, doch die Dorfstraße und die schmale Brücke waren von Fliehenden blockiert. Er hätte sich mit Gewalt hindurchdrängen können, doch das hätte bedeutet, seine eigenen Bogenschützen zu töten und in dem panischen Gedränge einige seiner Ritter zu verlieren. Stattdessen sah er sich um und bemerkte einen Pfad, der entlang des Flusses verlief. Vielleicht führte er zum Strand, überlegte er, und von dort könnte er möglicherweise Richtung Osten reiten, um zu den englischen Truppen zurückzukehren.
Die englischen Ritter hieben ihren Pferden die Sporen in die Flanken. Der Pfad war schmal, nur zwei Reiter hatten nebeneinander Platz; zur einen Seite verlief der Ham, zur anderen lag ein schlammiges Sumpfgebiet, doch der Pfad selbst war fest, und die Engländer ritten darauf, bis er sich zu einer höher gelegenen Ebene verbreiterte, auf der sie sich versammeln konnten. Doch fliehen konnten sie nicht. Die Ebene war nahezu eine Insel, erreichbar nur über den Pfad und umgeben von einem Morast aus Schilf und Schlick. Sie saßen in der Falle.
Hundert französische Reiter setzten an, ihnen über den Pfad zu folgen, doch die Engländer waren abgestiegen und hatten einen Schutzwall aus Schilden gebildet, und die Aussicht, sich durch diese massive Wand kämpfen zu müssen, veranlasste die Franzosen, sich lieber wieder dem Turm zuzuwenden, wo der Feind verwundbarer war. Noch immer schossen Bogenschützen von der Brustwehr, doch die Genueser Armbrustschützen erwiderten den Pfeilhagel, und jetzt prallten die Franzosen auf die englischen Soldaten, die sich unten vor dem Turm aufgestellt hatten.
Die Franzosen griffen zu Fuß an. Der Boden war glitschig vom Regen, und die gepanzerten Stiefel verwandelten ihn in eine Schlammwüste, als die Soldaten sich unter lautem Schlachtgebrüll auf die zahlenmäßig unterlegenen Engländer stürzten. Die Engländer hatten ihre Schilde dicht an dicht gelegt und stießen sie vor, um den Angriff abzuwehren. Stahl krachte auf Holz, dann ein Schrei, als eine Klinge unter den Rand eines Schildes glitt und auf Fleisch traf. Die Männer in der zweiten, hinteren englischen Schlachtreihe schwangen ihre Streitkolben und Schwerter über den Köpfen ihrer Kameraden. «St. George!», brüllten sie, «St. George!», und die Soldaten warfen sich nach vorn, um die Toten und Sterbenden von ihren Schilden zu stoßen. «Tötet die Bastarde!»
«Tötet sie!», brüllte Geoffrey de Charny seinerseits, und die Franzosen stürmten erneut vor, wenn auch behindert von den Toten und Verwundeten. Diesmal schlossen die Schilde nicht Rand an Rand, und die Franzosen fanden Lücken. Schwerter knallten auf Plattenpanzer, bohrten sich durch Kettenhemden, schlugen Helme ein. Einige Verteidiger versuchten, über den Fluss zu fliehen, doch die Genueser Armbrustschützen verfolgten sie, und es war kein Kunststück, einen mit Kettenpanzer gerüsteten Mann unter Wasser zu halten, bis er ertrank, und dann seinen Leichnam auszurauben. Ein paar von den Flüchtlingen schafften es, bis zum anderen Ufer zu gelangen, wo sich eine englische Schlachtreihe aus Soldaten und Bogenschützen formierte, um jedweden Angriff über den Ham abzuwehren.
Am Fuß des Turms hieb ein Franzose immer wieder mit seiner Streitaxt auf einen Engländer ein. Er zertrümmerte das rechte Schulterstück, hieb durch den Kettenpanzer darunter, schlug auf den Mann ein, bis er am Boden kauerte, und immer weiter, bis die Axt die Brust des Feindes freigelegt hatte und ein Stück weiße Rippe aus dem zerfetzten Fleisch und Panzer ragte. Blut und Schlamm vermischten sich zu einer zähen Masse. Auf jeden Engländer kamen drei Franzosen. Das Tor des Turms war offen gelassen worden, um den Männern eine Rückzugsmöglichkeit zu geben, doch stattdessen drängten sich nun die Feinde hinein. Die letzten Verteidiger außerhalb des Turms wurden niedergemetzelt, während die Angreifer sich die Stufen im Innern hinaufkämpften.
Die Treppe drehte sich für die Hochsteigenden nach rechts, was bedeutete, dass die Verteidiger ihren Schwertarm ohne allzu große Einschränkungen einsetzen konnten, während die Angreifer ständig durch den breiten Mittelpfosten behindert wurden, doch ein französischer Ritter mit einem Kurzspeer stürmte vor und schlitzte einem Engländer den Bauch auf, bevor einer von dessen Kameraden ihn mit einem Schwerthieb über den Sterbenden hinweg tötete. Hier drinnen hatten alle die Visiere hochgeklappt, denn es war dunkel im Turm, und mit dem Stahlgitter vor dem Gesicht konnte niemand etwas sehen, also zielten die Engländer auf die Augen ihrer Feinde. Französische Soldaten zerrten die Toten von den Stufen, wobei ein Teil der Eingeweide liegen blieb, sodass die nächsten beiden Angreifer, die voranstürmten, darauf ausrutschten. Sie parierten die Hiebe der Engländer, bohrten ihnen das Schwert in die Leiste, und unten strömten immer noch mehr Franzosen in den Turm. Ein grauenvoller Schrei hallte durch das Treppenhaus, dann wurde ein weiterer blutverschmierter Leichnam nach unten geschleudert. Wieder waren drei Stufen frei, und die Franzosen schoben sich weiter nach oben. «Montjoie Saint Denis!»
Ein Engländer mit einem Schmiedehammer kam die Treppe hinunter und drosch auf die französischen Helme ein. Ein Mann brach mit eingeschlagenem Schädel zusammen, und die anderen wichen zurück, bis einer der Ritter auf den Gedanken kam, sich eine Armbrust zu schnappen und sich damit nach vorn zu schieben, bis er freie Sicht hatte. Der Bolzen bohrte sich dem Engländer mit solcher Wucht in den Mund, dass er im Nacken wieder austrat. Unter wüstem Schlachtgebrüll stürmten die Franzosen vor, trampelten mit ihren von Blut und Innereien verschmierten Stiefeln über den Sterbenden hinweg, bis sie mit gezückten Schwertern am Ende der Treppe ankamen. Oben versuchten ein Dutzend Engländer, sie wieder hinunterzutreiben, doch von unten drängten immer mehr Franzosen nach, die die Anführer des Angriffs den Schwertern der Verteidiger auslieferten. Die Nachfolgenden kletterten über die Toten und Sterbenden hinweg und vernichteten die Überreste der Garnison. Sämtliche Männer wurden niedergemetzelt. Ein Bogenschütze lebte lange genug, um sich die Finger abhacken und die Augen ausstechen zu lassen, und er schrie noch immer, als er über die Zinnen auf die darunter wartenden Schwerter geworfen wurde.
Die Franzosen jubelten. Der Turm war ein Schlachthaus, aber auf der Brustwehr würde das französische Banner flattern. Aus den Gräben der Engländer waren Gräber geworden. Die Sieger begannen bereits, den Toten die Kleider vom Leib zu reißen, um nach Münzen zu suchen, als ein Fanfarenstoß erschallte.
Es waren immer noch Engländer auf der französischen Seite des Flusses: ein Reitertrupp, der auf einer Landzunge festsaß.
Das Töten war noch nicht vorbei.
Die St. James ankerte vor dem Strand südlich von Calais und brachte ihre Passagiere mit Ruderbooten an Land. Drei der Passagiere, alle in Kettenhemden, hatten so viel Gepäck, dass sie zwei Männer von der Besatzung der St. James bezahlten, damit diese es zum englischen Lager trugen. Dort angekommen, machten die drei sich auf die Suche nach dem Earl of Northampton. Einige der Häuser in dem Lager hatten zwei Stockwerke, und über den Türen hingen die Schilder von Schuhmachern, Waffenschmieden, Sattlern, Obsthändlern, Bäckern und Fleischern. Es gab Bordelle und Kirchen, Wahrsagerbuden und Schankstuben. Kinder spielten auf den Straßen. Einige hatten kleine Bogen und schossen mit stumpfen Pfeilen auf herumstreunende Hunde. Die Quartiere der Edelmänner waren an ihren Flaggen zu erkennen, und in den Eingängen standen mit Kettenpanzern gerüstete Wachen. Am Rand des Marschlandes lag ein Friedhof, in dessen feuchten Gräbern die Männer, Frauen und Kinder ruhten, die dem Fieber zum Opfer gefallen waren, das in den Sümpfen von Calais umging.
Das Quartier des Earl of Northampton war ein großer, hölzerner Bau unweit des Zeltes, an dem die königliche Flagge gehisst war, und zwei der Männer, der jüngste und der älteste, blieben mit dem Gepäck dort, während der dritte nach Nieulay hinüberging. Man hatte ihm gesagt, dass der Earl mit einigen seiner Männer zur französischen Armee hinübergeritten war. «Die Bastarde hocken da drüben auf den Hügeln und bohren sich in der Nase», hatte der Steward des Earls berichtet, «und da wollte Seine Lordschaft mal ein bisschen Unruhe stiften. Langweilt sich wohl, der Gute.» Sein Blick war auf die große Holztruhe gefallen, die die beiden Männer bewachten. «Was ist da denn drin?»
«Nasenpopel», hatte der große Mann erwidert, dann hatte er seinen langen schwarzen Bogen geschultert, seine Pfeiltasche genommen und war gegangen.
Sein Name war Thomas. Manchmal Thomas von Hookton, manchmal auch Thomas der Bastard, und wenn er ganz förmlich sein wollte, konnte er sich auch Thomas Vexille nennen, doch das tat er nur selten. Die Vexilles waren eine Adelsfamilie aus der Gascogne, und Thomas von Hookton war der illegitime Sohn eines geflohenen Vexille, weshalb er weder ein Edelmann noch ein Vexille war und erst recht kein Gascogner. Er war ein englischer Bogenschütze.
Thomas zog die Blicke auf sich, als er durch das Lager ging. Er war groß. Unter dem Rand seines Stahlhelms schaute schwarzes Haar hervor. Er war noch jung, aber der Krieg hatte seine Spuren hinterlassen. Er hatte ein hageres Gesicht, dunkle, wache Augen und eine lange Nase, die bei einem Kampf gebrochen und schief wieder angewachsen war. Sein Kettenpanzer war matt von der weiten Reise, und darunter trug er ein ledernes Wams, schwarze Beinlinge und lange schwarze Reitstiefel ohne Sporen. An seiner linken Seite hing ein Schwert in einer Scheide aus schwarzem Leder, auf seinem Rücken eine Provianttasche und an seiner rechten Hüfte eine weiße Pfeiltasche. Er humpelte leicht, was den Gedanken nahelegte, dass er in einer Schlacht verletzt worden war, doch in Wirklichkeit hatte ihm ein Geistlicher die Verletzung zugefügt, und zwar im Namen Gottes. Die Narben der Folterung waren unter seinen Kleidern verborgen, abgesehen von denen an seinen Händen, die verkrümmt und knotig waren, aber noch immer einen Bogen spannen konnten. Er war dreiundzwanzig Jahre alt, und sein Beruf war das Töten.
Er kam an den Zelten der Bogenschützen vorbei. Die meisten von ihnen waren mit Trophäen geschmückt. An einem Pfosten hing ein französischer Brustpanzer aus massivem Stahl, der von einem Pfeil durchbohrt war, um allen zu zeigen, was Bogenschützen Rittern zufügen konnten. Ein Stück weiter hing ein ganzes Bündel von abgeschnittenen Pferdeschweifen. Ein rostiger, eingerissener Kettenpanzer war mit Stroh ausgestopft, an einen jungen Baum gehängt und mit Pfeilen gespickt worden. Jenseits der Zelte begann das Marschland, das nach fauligem Abwasser stank. Thomas ging weiter und sah zu den französischen Truppen auf der Anhöhe im Süden hinüber. Es waren verdammt viele. Jetzt konnte er die Brücke und den kleinen Weiler dahinter sehen, und hinter ihm strömten Männer aus dem Lager und nahmen Schlachtaufstellung ein, um die Brücke zu verteidigen, denn die Franzosen griffen den kleinen englischen Außenposten am anderen Flussufer an. Thomas sah, wie sie den Abhang hinunterströmten, und er sah auch einen kleinen Reitertrupp, vermutlich der Earl mit seinen Männern. Irgendwo in der Ferne hinter ihm feuerte eine englische Kanone ein Geschoss gegen die ramponierte Stadtmauer von Calais. Der Donner hallte über die Marschen und verebbte, übertönt vom Waffengeklirr aus den englischen Gräben.
Thomas beeilte sich nicht. Es war nicht sein Kampf. Dennoch nahm er den Bogen von der Schulter und schnürte ihn. Ihm fiel auf, wie leicht es ging. Der Bogen war alt; er ermüdete. Der schwarze Eibenstab, einst vollkommen gerade, war jetzt leicht gebogen. Er war der Sehne gefolgt, wie die Bogenschützen sagten, und Thomas wusste, es war an der Zeit, eine neue Waffe zu fertigen. Doch für ein paar Franzosenseelen würde der alte Bogen mit dem silbernen Abzeichen, auf dem ein merkwürdiges Tier zu sehen war, das einen Kelch in den Klauen hielt, allemal noch reichen.
Er sah nicht, wie die englischen Reiter auf die Flanke des französischen Angriffs zustürmten, weil die halb verfallenen Häuser von Nieulay das kurze Gefecht verbargen. Doch er sah sehr wohl, wie kurz darauf die englischen Soldaten auf die Brücke zurannten, um ihren mordlustigen Angreifern zu entkommen, und wie die Reiter am gegenüberliegenden Ufer ein Stück oberhalb Richtung Meer ritten. Er folgte ihnen auf der englischen Seite des Flusses, verließ den befestigten Weg und sprang von Grasbüschel zu Grasbüschel, so gut es ging, landete jedoch bisweilen in Pfützen oder auf schlammigem Grund, in dem seine Stiefel beinahe stecken blieben. Schließlich kam er beim Fluss an. Die herannahende Flut wirbelte schlammiges Wasser landeinwärts, und der Wind roch nach Salz und Verwesung.
Dann erblickte er den Earl. Der Earl of Northampton war der Mann, dem Thomas diente, ein Herr mit lockerem Zügel und großzügiger Börse. Der Earl beobachtete die siegreichen Franzosen, wohl wissend, dass sie ihn angreifen würden. Einer seiner Soldaten war abgestiegen und suchte nach einem Pfad, der fest genug war, um die schweren Pferde zum Fluss hinunterzuführen. Etwa zehn weitere Männer knieten oder standen auf dem Pfad, bereit, einen französischen Angriff mit Schild und Schwert zurückzuschlagen. Und drüben im Weiler, wo die letzten Soldaten der Garnison getötet waren, wandten sich die Franzosen blutgierig den auf der Landzunge eingeschlossenen Engländern zu.
Thomas watete in den Fluss, den Bogen hoch über dem Kopf, denn eine nasse Sehne verlor jede Spannung, und stemmte sich gegen den Sog der Flut. Das Wasser stieg ihm bis zur Hüfte, dann erreichte er das schlammige Ufer und lief zu den Soldaten, die kampfbereit auf die französischen Angreifer warteten.
Die ersten Franzosen kamen. Ein Dutzend von ihnen näherte sich zu Pferd über den Pfad, während rechts und links von ihnen Fußsoldaten durch den Sumpf wateten. Thomas beachtete diese Männer nicht – sie würden eine Weile brauchen, bis sie festen Boden erreichten –, sondern begann, auf die Reiter zu schießen.
Er schoss, ohne nachzudenken. Ohne zu zielen. Das Schießen war sein Leben, seine Berufung, sein Stolz. Man nehme einen Bogen, größer als ein Mann, aus Eibenholz gefertigt, und lege Pfeile aus Eschenholz darauf, gelenkt von Gänsefedern und bewaffnet mit einer scharfen Stahlspitze. Da der große Bogen bis zum Ohr gespannt wurde, war es zwecklos, mit dem Auge zu zielen. Doch nach jahrelangem Üben wusste ein Mann, wohin sein Pfeil fliegen würde, und Thomas schoss in einem irrwitzigen Tempo, ein Pfeil alle drei bis vier Herzschläge. Die weißen Federn flirrten über die Marsch, und die langen, stählernen Spitzen bohrten sich durch Kettenpanzer und Leder in französische Leiber, Brustkörbe und Oberschenkel. Sie trafen mit dem dumpfen Geräusch einer Axt, die sich in Fleisch gräbt, und brachten den Angriff der Reiter zum Erliegen. Die vordersten zwei rangen mit dem Tod, ein dritter war in der Leiste getroffen, und die Männer dahinter kamen nicht an den Verwundeten vorbei, weil der Weg zu schmal war, also nahm Thomas sich die Fußsoldaten vor. Wenn einer von ihnen den Schild hob, um seinen Oberkörper zu schützen, schoss Thomas auf die Beine. Der Bogen war zwar alt, aber er tat immer noch seinen Dienst. Thomas war über eine Woche auf See gewesen, und er spürte, wie seine Rückenmuskeln schmerzten, als er die Sehne spannte. Selbst bei seinem abgenutzten Bogen brauchte er dafür genauso viel Kraft, als wenn er einen ausgewachsenen Mann mit einer Hand hochhob, und all diese Kraft ging in den Pfeil. Einer der Franzosen versuchte, durch den Morast zu reiten, doch sein schweres Streitross rutschte auf dem glitschigen Boden aus. Thomas wählte einen Pfeil mit breiter, mit Widerhaken versehener Spitze, die die Eingeweide und Adern des Pferdes aufreißen würde, schoss tief und sah, wie das Tier erbebte. Dann zog er einen spitzen Pfeil aus dem Boden und zielte damit auf einen Fußsoldaten, der sein Visier hochgeklappt hatte. Thomas wartete nicht ab, ob seine Pfeile ihr Ziel trafen, er schoss, nahm einen neuen Pfeil und schoss erneut, und die Sehne peitschte gegen den Hornschutz, den er am linken Handgelenk trug. Früher hatte er seinen Arm nie geschützt, sondern den brennenden Schmerz der Sehne genossen, aber die Folterungen des Dominikaners hatten dicke Narben an seinem linken Unterarm hinterlassen, sodass er die Haut jetzt mit einer Hornscheibe schützen musste.
Der Dominikaner war tot.
Noch sechs Pfeile. Die Franzosen wichen zurück, aber sie waren noch nicht besiegt. Sie brüllten nach Armbrustschützen und weiteren Soldaten, und im Gegenzug schob Thomas seine beiden Sehnenfinger zwischen die Lippen und stieß einen gellenden Pfiff aus. Ein hoher und ein tiefer Ton, dreimal im Wechsel, kurze Pause, dann dasselbe noch einmal, und schon liefen die ersten Bogenschützen auf den Fluss zu. Einige gehörten zu dem Trupp aus Nieulay, der über die Brücke geflohen war, andere lösten sich aus der englischen Schlachtreihe, denn es war das Signal, dass einer ihrer Kameraden Hilfe brauchte.
Thomas nahm seine sechs Pfeile und blickte über die Schulter. Einige von den Reitern des Earls hatten einen Pfad zum Fluss hinunter gefunden und führten ihre mit schweren Kettenpanzern geschützten Pferde durch das wirbelnde Wasser. Es würde noch eine Weile dauern, bis alle am anderen Ufer waren, aber die Bogenschützen wateten jetzt auf der anderen Seite ins Wasser, und diejenigen, die Nieulay am nächsten waren, schossen bereits auf die Armbrustschützen, die ihrerseits zur Verstärkung heraneilten. Von den Hügeln von Sangatte stürmten weitere Reiter herbei, wütend, dass die englischen Ritter zu entfliehen versuchten. Zwei von ihnen galoppierten in das Sumpfgebiet, wo ihre Pferde in dem trügerischen Grund den Halt verloren. Thomas legte einen seiner letzten Pfeile auf die Sehne, ließ den Bogen jedoch wieder sinken. Der Morast würde die beiden Männer verschlingen, dafür brauchte er keinen Pfeil zu verschwenden.
Hinter ihm erklang eine Stimme. «Thomas, nicht wahr?»
«Mylord.» Thomas riss sich den Helm vom Kopf und beugte das Knie.
«Du bist nicht ungeschickt mit dem Bogen», sagte der Earl mit leiser Ironie.
«Übung, Mylord.»
«Und eine gewisse Bosheit, schätze ich», erwiderte der Earl und bedeutete Thomas aufzustehen. Der Earl war ein kleiner Mann mit mächtiger Brust und einem wettergegerbten Gesicht, von dem seine Bogenschützen sagten, es sehe aus wie der Hintern eines Bullen. Dennoch schätzten sie ihn, denn er war ein Kämpfer, gerecht und ebenso hart wie jeder einzelne von seinen Männern. Er war ein Freund des Königs, aber auch ein Freund eines jeden, der sein Abzeichen trug. Er gehörte nicht zu denen, die andere in die Schlacht schickten und selbst in sicherer Entfernung blieben; er war vom Pferd gestiegen und hatte seinen Helm abgenommen, damit die Nachhut ihn erkannte und wusste, dass er sich ebenso in Gefahr begab wie sie. «Ich dachte, du wärst in England», sagte er zu Thomas.
«Das war ich auch», erwiderte Thomas auf Französisch, da er wusste, dass dem Earl diese Sprache angenehmer war. «Danach war ich in der Bretagne.»
«Und jetzt rettest du mich.» Der Earl grinste und entblößte dabei seine Zahnlücken. «Wie wär’s zum Dank mit einem Humpen Ale?»
«So viel, Mylord?»
Der Earl lachte. «Wir haben uns wohl ziemlich blamiert, was?» Er sah zu den Franzosen hinüber, die nun, da gut hundert englische Bogenschützen am Flussufer aufgereiht waren, zögerten, einen weiteren Vorstoß zu versuchen. «Wir dachten, wir könnten vierzig von ihnen zu einem Ehrengefecht drüben beim Dorf herausfordern, und dann stürmt ihre halbe verfluchte Armee auf uns zu. Gibt es Neuigkeiten von Will Skeat?»
«Tot, Mylord. Er starb im Kampf um La Roche-Derrien.»
Das Gesicht des Earls wurde ernst, und er bekreuzigte sich. «Armer Will. Bei Gott, ich habe ihn wirklich gern gehabt. Der beste Soldat, den ich je gekannt habe.» Er sah Thomas an. «Und das andere. Bringst du es mir?»
Er meinte den Gral. «Ich bringe Euch Gold, Mylord», sagte Thomas. «Aber das andere nicht.»
Der Earl klopfte Thomas auf die Schulter. «Wir reden später.» Dann wandte er sich zu seinen Männern und erhob die Stimme. «Zurück! Alle zurück!»
Die Männer seiner Nachhut, deren Pferde bereits am anderen Ufer in Sicherheit waren, liefen zum Fluss und wateten hindurch. Thomas folgte ihnen, und der Earl war der Letzte, der mit gezücktem Schwert in die wirbelnden Fluten trat. Die Franzosen, denen ihre kostbare Beute entwischt war, verhöhnten seinen Rückzug.
Und damit war der Kampf für diesen Tag vorüber.
Die französische Armee blieb nicht. Die Garnison von Nieulay war vernichtet, aber selbst die Heißblütigsten unter den Rittern wussten, dass sie mehr nicht ausrichten konnten. Die Engländer waren zu viele. Tausende von Bogenschützen warteten nur darauf, dass die Franzosen den Fluss überquerten und sie zur Schlacht herausforderten, also kehrten Philippes Männer den mit Leichen gefüllten Gräben von Nieulay und den windumtosten Hügeln von Sangatte den Rücken, und am nächsten Tag ergab sich die Stadt Calais. König Edwards erster Impuls war, sämtliche Einwohner abzuschlachten, sie entlang der Wassergräben aufzureihen und jedem einzelnen den Kopf vom ausgemergelten Körper zu schlagen, doch seine hohen Fürsten wandten ein, dass die Franzosen dann mit jeder englisch besetzten Stadt in der Gascogne oder in Flandern ebenso verfahren würden, wenn sie sie zurückeroberten, und so beschränkte der König sich widerstrebend darauf, nur sechs Einwohner zu töten.
Sechs Männer, hohlwangig und in Büßerhemden gekleidet, wurden mit Stricken um den Hals aus der Stadt gebracht. Alle sechs waren wohlhabende und angesehene Bürger, Kaufleute oder Ritter, genau die Art von Männern, die Edward von England elf Monate lang Widerstand geleistet hatten. Auf den Händen trugen sie Kissen mit den Schlüsseln der Stadt, die sie dem König zu Füßen legten. Dann streckten sie sich bäuchlings vor dem hölzernen Podest aus, auf dem der König und die Königin von England sowie die hohen Würdenträger ihres Reiches saßen. Die sechs Männer flehten um ihr Leben, doch der König war wütend. Sie hatten ihm getrotzt, und so wurde der Henker gerufen, doch wiederum mahnten ihn seine Fürsten, eine solche Tat werde Vergeltungsmaßnahmen nach sich ziehen, und die Königin höchstpersönlich ging vor ihrem Gatten auf die Knie und bat ihn, die sechs Männer zu verschonen. Edward knurrte, überlegte eine Weile, während die sechs reglos zu seinen Füßen lagen, dann ließ er sie leben.
Den halb verhungerten Bürgern wurden Nahrungsmittel gebracht, aber davon abgesehen zeigte der König keine Gnade. Alle mussten die Stadt verlassen, sie durften nichts mitnehmen außer den Kleidern, die sie am Leib trugen, und selbst die wurden durchsucht, damit niemand Münzen oder Edelsteine durch die englischen Linien schmuggeln konnte. Eine leere Stadt mit Häusern für achttausend Menschen, mit Lagerhäusern, Läden und Schankstuben, mit einem Hafen, einer Zitadelle und Wassergräben gehörte England. «Ein Tor nach Frankreich», freute sich der Earl of Northampton. Er hatte sich ein Haus ausgesucht, das einem der sechs Bürger gehört hatte, der jetzt wie ein Bettler mit seiner Familie durch die Pikardie zog. Es war ein prachtvolles Steinhaus unterhalb der Zitadelle, mit Blick auf den Hafen, in dem jetzt lauter englische Schiffe lagen. «Wir werden die Stadt mit guten Engländern besiedeln», sagte der Earl. «Möchtest du hier leben, Thomas?»
«Nein, Mylord.»
«Ich auch nicht», gab der Earl zu. «Die Stadt ist ein Schweinestall, umgeben von Sumpf. Aber immerhin gehört sie uns. Wonach steht dir denn der Sinn, mein junger Freund?»
Es war Morgen, drei Tage nach der Kapitulation der Stadt, und die beschlagnahmten Reichtümer von Calais wurden bereits unter den Siegern verteilt. Der Earl war reicher, als er erwartet hatte, denn die große Truhe, die Thomas aus der Bretagne mitgebracht hatte, war mit Gold- und Silbermünzen gefüllt, die er nach der Schlacht bei La Roche-Derrien im Lager von Charles de Blois erbeutet hatte. Ein Drittel davon gehörte Thomas’ Herrn, und die Männer des Earls hatten die Münzen gezählt und wiederum ein Drittel seines Anteils für den König beiseitegelegt.
Thomas hatte seine Geschichte erzählt, wie er auf Geheiß des Earls nach England gegangen war, um in der Vergangenheit seines verstorbenen Vaters nach einem Hinweis auf den Gral zu suchen. Das Einzige, was er gefunden hatte, war ein Buch mit Aufzeichnungen von seinem Vater, einem Pfarrer, in dem es unter anderem auch um den Gral ging. Doch Vater Ralph hatte einen unsteten Geist gehabt und Träume nicht immer von der Wirklichkeit unterscheiden können, und Thomas war aus den Schriften nicht klug geworden. Dann hatte der Dominikaner, der Thomas gefoltert hatte, das Buch an sich genommen, doch zuvor war eine Kopie angefertigt worden, und nun saß ein junger englischer Geistlicher in dem neuen, sonnendurchfluteten Zimmer des Earls oberhalb des Hafens und studierte diese Kopie.
«Wonach mir der Sinn steht?», wiederholte Thomas. «Ich möchte Bogenschützen anführen.»
«Gott weiß, ob es überhaupt noch einen Ort gibt, an den du sie führen könntest», erwiderte der Earl düster. «Edward spricht davon, Paris anzugreifen, aber dazu wird es nicht kommen. Es wird eine Waffenruhe geben. Wir werden uns ewige Freundschaft schwören, und dann gehen wir nach Hause und wetzen unsere Schwerter.» Es raschelte leise, als der Geistliche eine Seite umblätterte. Vater Ralph hatte auf Lateinisch, Griechisch, Hebräisch und Französisch geschrieben, und offenkundig beherrschte der Geistliche alle diese Sprachen. Gelegentlich machte er sich Notizen auf einem Stück Pergament. Unten auf dem Kai wurden Bierfässer entladen, und das Rumpeln der mächtigen Tonnen auf dem Pflaster hallte wie Donner herauf. Oben auf der Zitadelle wehte die Flagge des englischen Königs mit seinen Leoparden und Lilien, und darunter das französische Banner, auf den Kopf gedreht, als Zeichen der Verachtung. Neben der Tür des Zimmers standen zwei Männer, Thomas’ Gefährten, und warteten darauf, dass der Earl sie in das Gespräch einbezog. «Wer weiß, ob es überhaupt noch Arbeit für Bogenschützen gibt», fuhr der Earl fort. «Abgesehen vom Bewachen der Festungen. Und darauf bist du versessen?»
«Das ist alles, was ich kann, Mylord: Bogenschießen.» Thomas sprach normannisches Französisch, die Sprache des englischen Adels, die sein Vater ihm beigebracht hatte. «Und ich habe Geld, Mylord.» Damit meinte er, dass er jetzt in der Lage war, selbst Bogenschützen zu rekrutieren, ihnen Pferde zu geben und sie in den Dienst des Earls zu stellen, was den Earl nicht nur nichts kostete, sondern obendrein bedeutete, dass ihm ein Drittel all dessen zustand, was sie erbeuteten.
Auf diese Weise hatte sich Will Skeat, der von einfacher Geburt war, einen Namen gemacht. Der Earl schätzte solche Männer, profitierte von ihnen, und so nickte er beifällig. «Aber wohin willst du sie führen?», fragte er.
Der junge Geistliche meldete sich von seinem Tisch am Fenster zu Wort. «Der König zöge es vor, wenn der Gral gefunden würde.»
«Sein Name ist John Buckingham», stellte der Earl den Geistlichen vor, «und er ist Großkämmerer, was dir vielleicht nicht viel sagt, Thomas, aber es bedeutet, dass er direkt dem König untersteht und vermutlich Erzbischof von Canterbury wird, bevor er dreißig ist.»
«Das glaube ich kaum, Mylord», sagte der Geistliche.
«Und natürlich will der König, dass der Gral gefunden wird», sagte der Earl. «Das wollen wir alle. Ich will das verdammte Ding in der Westminster Abbey stehen sehen! Ich will, dass der verfluchte französische König auf den Knien rutscht, um es anbeten zu dürfen. Ich will, dass Pilger aus der ganzen Christenheit kommen und uns ihr Gold bringen. Bei allen Heiligen, Thomas, existiert das elende Ding? Hatte dein Vater es in seinem Besitz?»
«Ich weiß es nicht, Mylord.»
«Du bist ja wirklich eine große Hilfe», knurrte der Earl. John Buckingham blickte auf seine Notizen. «Du hast einen Vetter, Guy Vexille?»
«Ja», sagte Thomas.
«Und er sucht den Gral?»
«Indem er mich sucht», sagte Thomas. «Aber ich weiß nicht, wo er ist.»
«Aber er suchte den Gral bereits, bevor er wusste, dass es dich gibt», hob der junge Geistliche hervor. «Was darauf schließen lässt, dass er etwas weiß, das wir nicht wissen. Ich würde empfehlen, Mylord, diesen Guy Vexille zu suchen.»
«Dann wären wir wie zwei Hunde, die den Schwanz des anderen jagen», bemerkte Thomas sarkastisch.
Der Earl bedeutete Thomas mit einer Handbewegung zu schweigen. Der Geistliche sah wieder auf seine Notizen. «Und so unverständlich diese Aufzeichnungen sind», sagte er missbilligend, «es gibt immerhin einen Lichtblick. Sie scheinen zu bestätigen, dass der Gral in Astarac war. Dass er dort versteckt war.»
«Und wieder von dort entwendet», wandte Thomas ein.
«Wenn du etwas Wertvolles verlierst», sagte Buckingham geduldig, «wo beginnst du mit deiner Suche? Doch wohl dort, wo es zuletzt gesehen wurde. Wo liegt Astarac?»
«In der Gascogne», sagte Thomas. «In der Grafschaft Berat.»
«Ah!», sagte der Earl, sichtlich überrascht, doch mehr kam nicht.
«Und warst du schon in Astarac?», fragte Buckingham. Obgleich er noch sehr jung war, besaß er eine Autorität, die nicht nur mit seiner Stellung als Großkämmerer des Königs zu tun hatte.
«Nein.»
«Dann würde ich vorschlagen, du begibst dich dorthin», sagte der Geistliche, «und siehst dich gründlich um. Wenn du bei deiner Suche genügend Lärm machst, wird dein Vetter dir vermutlich folgen, und dann kannst du herausfinden, was er weiß.» Er lächelte, als habe er damit das Problem gelöst.
Stille trat ein. Nur einer der Jagdhunde des Earls kratzte sich in der Zimmerecke, und draußen auf dem Kai stieß ein Matrose eine Salve von Flüchen aus, die selbst den Teufel hätte erröten lassen. «Ich kann Guy nicht allein gefangen nehmen», protestierte Thomas, «und Berat hat unserem König nicht den Lehnseid geschworen.»
«Offiziell», sagte Buckingham, «untersteht Berat dem Grafen von Toulouse, und das bedeutet derzeit dem König von Frankreich. Somit ist der Graf von Berat eindeutig ein Feind.»
«Bisher ist noch keine Waffenruhe unterzeichnet», sagte der Earl zögernd.
«Und das wird auch noch einige Tage dauern», bestätigte Buckingham.
Der Earl sah Thomas an. «Du willst Bogenschützen?»
«Am liebsten die Männer von Will Skeat, Mylord.»
«Sie würden dir sicher folgen», sagte der Earl, «aber du kannst keine Soldaten anführen, Thomas.» Er meinte damit, dass Thomas, der noch jung und nicht von adliger Abstammung war, zwar die nötige Autorität besaß, um Bogenschützen anzuführen, doch Soldaten betrachteten sich als höherrangig und würden ihn nicht als Anführer akzeptieren. Will Skeat, der aus noch einfacheren Verhältnissen stammte als Thomas, war es gelungen, aber er war auch wesentlich älter und erfahrener gewesen.
«Ich kann Soldaten anführen», verkündete einer der beiden Männer neben der Tür.
Thomas stellte die beiden vor. Derjenige, der gesprochen hatte, war ein älterer Mann, einäugig, voller Narben und hart wie Stahl. Sein Name war Guillaume d’Evecque. Er hatte einst ein Lehen in der Normandie besessen, bis sein eigener König sich gegen ihn gewandt hatte, und nun war er ein besitzloser Krieger und Thomas’ Freund. Der andere, ein jüngerer Mann, war ebenfalls ein Freund: Robbie Douglas, ein Schotte, der im Jahr zuvor bei Durham in Gefangenschaft geraten war. «Bei den Knochen Christi», sagte der Earl, als er von Robbies Situation erfuhr, «du müsstest doch längst dein Lösegeld beisammenhaben, oder?»
«Ich hatte es, Mylord», gestand Robbie, «aber ich habe es wieder verloren.»
«Verloren?»
Da Robbie nur betreten zu Boden starrte, erklärte Thomas die Sache. «Beim Würfelspiel.»
Der Earl schüttelte fassungslos den Kopf, dann wandte er sich d’Evecque zu. «Ich habe von Euch gehört», sagte er, und es war als Kompliment gemeint. «Ich weiß, dass Ihr Soldaten anführen könnt, aber wem untersteht Ihr?»
«Niemandem, Mylord.»
«Dann kann ich Euch meine Soldaten nicht geben», sagte der Earl herausfordernd und wartete.
D’Evecque zögerte. Er war ein stolzer Mann, fünfunddreißig Jahre alt und kriegserfahren, und er hatte sich seinen Ruf vor allem im Kampf gegen die Engländer erworben. Doch nun besaß er weder Land, noch hatte er einen Lehnsherrn, und er galt kaum mehr als ein Vagabund. So trat er schließlich vor den Earl, kniete nieder und hob seine Hände wie im Gebet. Der Earl legte seine Hände um die von d’Evecque. «Schwört Ihr, mir treu und ergeben zu folgen, mein Lehnsmann zu sein und niemandem sonst zu dienen?»
«Ich schwöre es», sagte Guillaume d’Evecque ernst. Der Earl bedeutete ihm, sich zu erheben, und die beiden Männer tauschten einen Kuss auf die Lippen.
«Ich fühle mich geehrt», sagte der Earl und schlug d’Evecque auf die Schulter, dann wandte er sich wieder zu Thomas. «Damit kannst du eine ordentliche Truppe zusammenstellen. Wie viele Männer brauchst du? Fünfzig, die Hälfte Bogenschützen?»
«Fünfzig Mann in einem abgelegenen, feindlichen Lehen?» Thomas sah ihn erstaunt an. «Die überleben keinen Monat, Mylord.»
«O doch», sagte der Earl und erklärte, weshalb er so überrascht gewesen war, als er erfahren hatte, dass Astarac in der Grafschaft Berat lag. «Vor vielen Jahren, als du noch an der Brust deiner Mutter lagst, besaß meine Familie Land in der Gascogne. Wir haben es verloren, aber niemals offiziell darauf verzichtet, und somit gibt es in Berat drei oder vier Festungen, auf die ich einen rechtmäßigen Anspruch habe.» John Buckingham, der sich wieder über Vater Ralphs Aufzeichnungen gebeugt hatte, zog skeptisch die Augenbraue hoch, sagte jedoch nichts. «Erobere eine dieser Festungen», sagte der Earl. «Plündere, geh auf Raubzug, dann werden sich dir Männer anschließen.»
«Andere werden uns bekämpfen», bemerkte Thomas ruhig.
«Und Guy Vexille wird einer davon sein», sagte der Earl. «Das ist deine Gelegenheit, Thomas. Ergreife sie und verschwinde von hier, bevor die Waffenruhe unterzeichnet wird.»
Thomas überlegte einen Moment. Was der Earl vorschlug, klang wie der reine Irrsinn. Er sollte mit einer kleinen Truppe in den tiefen französischen Süden ziehen, eine Festung erobern und verteidigen, seinen Vetter gefangen nehmen, Astarac finden, es durchsuchen und möglichst noch den Gral auftreiben. Nur ein Tor würde eine solche Aufgabe annehmen, aber die Alternative war, hier mit all den anderen Bogenschützen zu versauern. «Ich werde es tun, Mylord.»
«Gut. Dann seht zu, dass ihr in die Gänge kommt!» Der Earl führte Thomas zur Tür, doch als Robbie und d’Evecque auf der Treppe waren, nahm er ihn noch einmal kurz beiseite. «Lass den Schotten hier», mahnte er Thomas.
«Warum, Mylord? Er ist ein Freund.»
«Er ist ein verfluchter Schotte, und ich traue denen nicht. Das sind alles gottverdammte Diebe und Lügner. Schlimmer als die Franzosen. Wessen Gefangener ist er?»
«Lord Outhwaites.»
«Und Outhwaite lässt ihn mit dir reisen? Das erstaunt mich. Wie dem auch sei, schick deinen schottischen Freund zurück zu Outhwaite und lass ihn dort vor sich hin schimmeln, bis seine Familie das Lösegeld aufgetrieben hat. Ich will nicht, dass ein verdammter Schotte England den Gral wegschnappt. Hast du mich verstanden?»
«Ja, Mylord.»
«Guter Mann.» Der Earl klopfte Thomas auf den Rücken. «Jetzt geh und bring uns Ruhm.»
Leichter gesagt als getan, dachte Thomas. Er glaubte nicht, dass der Gral existierte. Er wünschte es sich, er hätte den Worten seines Vaters gern Glauben geschenkt, doch sein Vater war bisweilen verrückt und voll boshaften Schalks gewesen, und Thomas wollte nichts anderes sein als ein Bogenschütze und ein ebenso guter Anführer wie Will Skeat. Doch dieses nutzlose Unterfangen gab ihm die Gelegenheit, eine eigene Truppe aufzustellen, sie anzuführen und somit seinen Traum zu verwirklichen. Also würde er sich auf die Suche nach dem Gral machen und abwarten, was geschah.
Er begab sich zum englischen Lager und rührte die Trommel. Der Friede nahte, doch Thomas von Hookton brachte Männer zusammen und zog in den Krieg.
TEIL 1DIE GESPIELIN DES TEUFELS
Der Graf von Berat war alt, fromm und belesen. Er hatte fünfundsechzig Jahre gelebt und rühmte sich gern, dass er sein Lehen während der letzten vier Jahrzehnte nicht mehr verlassen hatte. Sein Sitz war die große Festung von Berat. Sie stand auf einem Kalkfelsen oberhalb der Stadt, um die sich der gleichnamige Fluss schlängelte, der das Lehen so fruchtbar machte. Es brachte Oliven, Trauben, Birnen, Pflaumen, Gerste und Frauen hervor, und der Graf schätzte sie alle. Er hatte fünfmal geheiratet, jede neue Frau jünger als ihre Vorgängerin, doch keine hatte ihm ein Kind geschenkt. Er hatte nicht einmal einen Bastard mit einer Milchmagd gezeugt, obwohl er es weiß Gott oft genug versucht hatte.
Diese Kinderlosigkeit hatte den Grafen zu dem Schluss gebracht, dass Gottes Fluch auf ihm lastete, und so hatte er sich im Alter mit Geistlichen umgeben. Die Stadt besaß eine Kathedrale und achtzehn Kirchen sowie den dazugehörigen Bischof und zahlreiche Kanoniker und Pfarrer, und in der Nähe des Osttores hatte der Dominikanerorden ein Haus. Der Graf schenkte der Stadt zwei weitere Kirchen und ließ hoch oben auf dem Hügel im Westen, jenseits des Flusses und der Weingüter, ein Kloster errichten. Er stellte einen Kaplan ein und erstand für ein Vermögen eine Handvoll von dem Stroh aus der Krippe, in der das Jesuskind nach seiner Geburt gelegen hatte. Der Graf ließ einen Schrein aus Kristall, Gold und Edelsteinen anfertigen, stellte die Reliquie auf den Altar der Burgkapelle und betete jeden Tag zu ihr, doch selbst dieser heilige Glücksbringer half nicht. Seine fünfte Ehefrau war siebzehn, drall und gesund, aber ebenso unfruchtbar wie die anderen.
Zunächst vermutete der Graf, man habe ihn beim Kauf des heiligen Strohs betrogen, doch sein Kaplan versicherte ihm, die Reliquie komme aus dem Papstpalast in Avignon, und präsentierte ihm ein Schreiben, unterzeichnet vom Heiligen Vater, in dem bestätigt wurde, dass das Stroh in der Tat aus der Krippe des Gottessohnes stammte. Daraufhin ließ der Graf seine neue Ehefrau von vier anerkannten Ärzten untersuchen, doch alle vier verkündeten, ihr Urin sei klar, ihr Leib gesund, und ihr Appetit ließe nichts zu wünschen übrig. Da beschloss der Graf, bei der Suche nach einem Erben auf seine eigenen Kenntnisse zurückzugreifen. Hippokrates hatte die Wirkung von Bildern bei der Empfängnis beschrieben, und so ließ der Graf einen Maler kommen, der die Wände der ehelichen Schlafkammer mit Darstellungen der Jungfrau und ihrem Kind verzierte; außerdem aß er rote Bohnen und sorgte dafür, dass seine Räume gut geheizt waren. Nichts half. Es war nicht seine Schuld, das wusste der Graf. Er hatte Gerstensamen in zwei Töpfe gesteckt und den einen mit dem Urin seiner Frau gegossen, den anderen mit seinem eigenen. Beide hatten Sämlinge hervorgebracht, und das bewies nach Ansicht der Ärzte, dass sowohl der Graf wie auch die Gräfin fruchtbar waren.
Das, so hatte der Graf geschlossen, konnte nur bedeuten, dass ein Fluch auf ihm lastete. Er wandte sich noch stärker der Religion zu, denn er wusste, er hatte nicht mehr viel Zeit. Laut Aristoteles endete die Zeugungsfähigkeit des Mannes mit siebzig, und so blieben dem Grafen nur noch fünf Jahre, um das Wunder zu bewerkstelligen. Dann, eines Herbstmorgens, wurden seine Gebete erhört, obgleich er es zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannte.





























