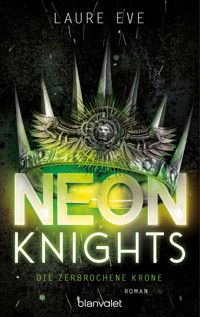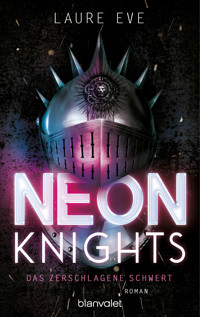16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Familie Grace
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die Graces sind wieder da! Die brillante Fortsetzung von Laure Eves großartigem Mystery-Roman »Familie Grace, der Tod und ich« Die Graces sind tatsächlich Hexen - aber die schwarze Magie fordert einen verhängnisvollen Preis. Sich nach den schrecklichen Ereignissen des Vorjahres wieder aufzurappeln ist nicht einfach, aber die Geschwister Grace sind fest entschlossen. Nach seinem vermeintlichen Tod ist ihr Freund Wolf wieder da, und alle sind sehr darauf bedacht, zum Alltag zurückzukehren. Außer Summer, der jüngsten Tochter der Familie Grace. Summer hat eine Gabe dafür, die Wahrheit zu entdecken – aber Geheimnisse zu enthüllen ist ein gefährliches Spiel und keins, das Summer allein gewinnen kann. Auf ihr Geheiß kommt der Hexenzirkel wieder zusammen und nimmt auch ihre frühere Freundin River wieder auf. Aber während die Kräfte des Zirkels wachsen, wird Wolfs Verhalten unvorhersehbar – und Summer zweifelt mehr und mehr am Charakter ihres Freundes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Ähnliche
Laure Eve
Der Fluch der Familie Grace
Roman
Aus dem Englischen von Alice Jakubeit
FISCHER E-Books
Inhalt
1
Wolf war seit fast drei Wochen von den Toten zurück, als wir das erste Mitternachtspicknick des Jahres veranstalteten.
Manche Kindheitserlebnisse prägen sich einem knochentief und unauslöschlich ein und werfen ihre langen Schatten voraus bis in die Zukunft. Unsere spontanen Mitternachtspicknicks waren ein Ritual, das meine Geschwister und ich als Kinder gemeinsam ins Leben gerufen hatten. Am Anfang waren es elektrisierende Akte der Rebellion gewesen, die einen ein bisschen süchtig machten, aber mittlerweile hatten wir sie mit stillschweigendem Einverständnis unserer Eltern so oft veranstaltet, dass sie zu einer festen Einrichtung geworden waren.
Beladen mit Leckereien aus der Speisekammer und dem Kühlschrank, schlichen wir uns dann nach draußen, streiften durch die Dunkelheit und suchten nach der passenden Stelle für diesen besonderen Augenblick. Es tat gut, für ein kurzes Weilchen unser geheimes Ich aus seinem Alltagskäfig zu befreien.
So kam es, dass ich unverhofft spätabends zitternd vor Kälte im Flur unseres Hauses stand und verschlafen blinzelnd meinen Bruder musterte, der mir meinen Lieblingsschal fest um den Hals wickelte. Ich war früh ins Bett gegangen und davon wach geworden, dass er mich an der Schulter rüttelte, wie ein hübsches zerzaustes Gespenst über mich gebeugt.
Es war Anfang Januar, und bisher war der Monat bitterkalt gewesen. Schnee war angekündigt, ließ aber noch auf sich warten. Für mich war Schnee immer schon ein reinigender Stoff gewesen, der einen Neuanfang versprach – bis er dann schmolz und den Schmutz enthüllte, der die ganze Zeit darunter verborgen gewesen war.
»Was soll das werden?« Ich war noch ganz benommen vom Schlaf.
Meine leider nicht geflüsterte Frage schallte durch den Flur, und Fenrin machte leise »Pst«. Kalte Luft drang durch die offene Gartentür und wehte um unsere Beine.
»Wirklich schockierend, dass du noch nicht drauf gekommen bist«, murmelte er und schenkte mir sein frechstes Grinsen.
Ich holte meine Handschuhe aus der Lederjacke und zog sie umständlich über. Fenrin nahm meine Hand und führte mich nach draußen, über das gefrorene, knisternde Gras in Richtung Obsthain am unteren Ende des Gartens, schnurstracks auf den Wachhund zu.
Der Wachhund war die uralte Eiche am Eingang zum Hain und hatte der Familienlegende zufolge schon dort gestanden, bevor unser Haus ganz bewusst in seinem Windschatten errichtet worden war. Er war ausladend, knorrig und hatte seinen eigenen Kopf: An manchen windstillen Tagen wiegte er die Äste in einer Brise, die sonst niemand wahrnahm. Im Frühjahr wuchsen überall auf seinem Stamm winzige sternenförmige Blüten, die Esther pflückte und zu einer exklusiven Gesichtscreme verarbeitete. Ihre Kundinnen schworen, sie lasse sie über Nacht jünger aussehen, und oft hatte Esther so viele Vorbestellungen für diese Creme, dass sie einige erst im nächsten Jahr liefern konnte. Eine anonyme Kundin bezahlte sogar ein hübsches Sümmchen für ein garantiertes Jahresvolumen, unter der Bedingung, es müsse aus den allerersten Blüten der Saison hergestellt werden, da diese Esther zufolge am wirksamsten waren.
Im Moment war es allerdings noch zu früh im Jahr für diese sternförmigen Blüten, und der Stamm des Wachhunds war kahl, aber sein Fuß war von Lichtern umringt. Winzige Flämmchen züngelten auf ihren Kerzensockeln, beleuchteten die Rinde und schickten orange-goldene Funken in die Dunkelheit. Weiter oben war der Baum mit Lichterketten geschmückt, die an den winterkahlen Zweigen glitzerten und den Himmel erleuchteten. Elektrische Magie.
Am Fuß des Wachhunds war eine Decke ausgebreitet, auf der Teller und Tabletts standen, und am Rand hockten zwei dunkle Gestalten. Als sie uns bemerkten, verstummten sie; ihre Gesichter wurden von unten her vom Kerzenlicht beleuchtet.
Ich schnappte vor Entzücken nach Luft, total untypisch für mich.
»Ein Mitternachtspicknick«, flüsterte ich begeistert, und Fenrin zwinkerte mir zu.
Meine Schwester Thalia, die mühelos in der Hocke balancierte, sah zu mir hoch. Sie hatte sich einen voluminösen weißen Wollschal um den Hals geschlungen, und ihr honigfarbenes Haar fiel in sanften Wellen darüber. Dazu trug sie ihren weinroten Winterrock, der ihr beim Gehen um die Knöchel wirbelte und gerade so lang war, dass er mit dem Boden flirtete. Ich hatte ihn mir einmal ausgeborgt, ohne sie zu fragen, und da ich kleiner als Thalia war, war ich versehentlich auf den Saum getreten und hatte ihn eingerissen. Thalia verlor kaum jemals die Beherrschung, aber wenn, dann war es spektakulär – es lohnte sich fast, sie zu provozieren, nur um das zu erleben.
Neben ihr saß Wolf, den ausgemergelten Körper in mehrere kieselgraue Stoffschichten gehüllt. Im warmen Schein der Lichterketten wirkte er trotz seiner schwarzen Augen und der bleichen Haut fast gesund – ähnelte wieder dem schlanken, hoch aufgeschossenen Geschöpf der Vergangenheit, jener fernen Zeit, in der wir Dinge wie Leben und Gesundheit noch alle für selbstverständlich gehalten hatten.
Ich sah ihn mit hochgezogener Augenbraue an. »Solltest du nicht mit den Fischen schwimmen?«
Er grinste. »Bin nur zurückgekommen, um euch alle zu quälen.«
Diesen Witz wiederholten wir in unterschiedlichen Varianten so oft, dass es schon peinlich war. Eigentlich war es überhaupt nicht witzig, aber wir taten so, als ob.
Es gab einmal eine Zeit, da hätte ich mich jetzt auf ihn gestürzt und ihn gnadenlos gekitzelt, bis er mich wegschoben hätte, aber das war ein anderer Wolf gewesen, ein anderes Wir. Jetzt trauten wir uns alle kaum, ihn zu berühren, als könnte er wie Glas zersplittern und die Illusion, dass er wirklich wieder da war, zerplatzen.
Wolf war zwar ins Leben zurückkehrt, aber er war ganz offensichtlich nicht bei bester Gesundheit. Die Untersuchungen im Krankenhaus hatten die vorsichtige Diagnose Lungenentzündung ergeben, mit dem vagen, sehr allgemeinen Zusatz »mit Komplikationen«. Dann hatte man ihn zur Genesung wieder nach Hause geschickt, versehen mit einer stattlichen Anzahl von Medikamenten. Bei der Hälfte davon hatte man den Eindruck, die Ärzte hätten einfach sicherheitshalber alles abdecken wollen.
Das konnte ich ihnen eigentlich nicht verübeln. Es musste ziemlich schwierig sein, einen schweren Fall von Auferstehung zu diagnostizieren.
Ich kniete mich auf die Decke. Hier am Boden waren wir durch die dicken knorrigen Äste des Wachhunds vom Wind abgeschirmt, und alles war still und ruhig. Nur an den Wangen spürte ich die beißend kalte Winterluft, ansonsten hielt meine Lederkleidung mich warm.
Es war perfekt.
Vor mir auf der Decke stand ein Tablett mit vier großen Trinkbechern, und in jedem davon wartete ein Häufchen winziger Marshmallows auf den mit Zimt gewürzten heißen Kakao, der in einem großen, in ein Wolltuch gehüllten Topf dampfte. Auf einer steinernen Servierplatte türmten sich Thalias berühmte Schokobrownies, und daneben stapelten sich Sirupplätzchen mit Zuckerrand.
»Wessen geniale Idee war das?«, fragte ich.
»Meine«, antwortete Wolf.
Fenrin schnaubte. »Nicht ganz. Er hat ständig genörgelt, ihm sei langweilig und er könne nicht schlafen, also habe ich das vorgeschlagen.«
»Wisst ihr, was wir tun sollten?«, fragte ich begeistert. »Wir sollten eine späte Julfeier veranstalten.«
»Ähm, ich glaube, der Zug ist abgefahren«, sagte Fenrin. »Der Witz an einer Julfeier ist doch, sie zur Wintersonnenwende zu veranstalten, weißt du? Und das haben wir nicht getan.«
»Warum nicht?«, fragte Wolf.
Schweigen senkte sich herab, so unbehaglich, dass meine Zehen sich in den Stiefeln krümmten.
Weil du tot warst und keinem nach Feiern zumute war.
»Wir sollten fragen, ob wir jetzt eine Party machen dürfen«, sagte ich stur, lehnte mich an den Baumstamm und drückte mein Rückgrat behaglich an die raue Rinde.
Thalia seufzte. »Klar. Und wo du schon mal dabei bist, kannst du auch gleich um Erlaubnis für eine Reise nach Atlantis fragen.«
Fenrins Lippen zuckten. »Mondscheiben in einem Kuchen.«
»Aus Einhornbutterblätterteig«, fügte ich hinzu. Mit einem Mal hungrig, beugte ich mich vor und nahm mir einen großen Schokobrownie. Thalia hatte sie heute Nachmittag gebacken. Der frische Ingwer, den sie verwendet hatte, brannte köstlich auf meiner Zunge.
»O Gott, es ist eisig«, klagte Fenrin. »Warum machen wir das nicht im Haus wie normale Menschen?«
»Es ist belebend«, sagte Thalia. »Wetter zum Wachwerden.«
Thalia war ein Geschöpf der Natur. Im Freien zu sein, vitalisierte sie. Ich wusste, dass manche Leute das für reine Show hielten, die sie nur in der Öffentlichkeit abzog, aber ich hatte sie barfuß durch frischen Schnee laufen sehen, spätabends, als sie dachte, sie sei allein. Später hatte ich meine geliebte Schwester, diese Idiotin, dann dabei ertappt, wie sie ihre blau gefrorenen Füße verzweifelt an die Heizung presste.
Normalerweise gingen wir weiter in den Wald hinein, aber im Moment fühlte es sich weit genug an. Wir hatten in den Weihnachtsferien kaum das Haus verlassen, weil es Wolf nicht gutging und die Erwachsenen ständig um uns herumkreisten, wie eine besonders lästige Kombination aus Habichten und Bienen. Aber es war uns nicht erstickend vorgekommen. Es hatte uns ein Gefühl von Sicherheit gegeben.
Wolf beugte sich vor und nahm sich zwei Brownies. Jeder davon war daumendick und fast so groß wie meine Handfläche. Beeindruckt sah ich zu, wie er den ersten mit zwei Bissen verdrückte und sich sofort an den zweiten machte. Wie hatte er das Ding bloß so schnell in den Mund bekommen?
Seinem Appetit hatte die Auferstehung jedenfalls nichts anhaben können. Unsere Mahlzeiten waren neuerdings echte Spektakel. Wolf aß alles, was in Reichweite war, und zwar so genussvoll, dass es ans Orgiastische grenzte. Das war eine ganz neue Seite an ihm: Der Wolf von früher war beim Essen immer wählerisch gewesen und hatte fast nie den ganzen Teller leergegessen. Der Rest der Familie zog ihn mittlerweile mit seiner neuen Gefräßigkeit auf, aber ich glaubte ihn zu verstehen. Genuss war eine sehr handfeste, naheliegende Möglichkeit, sich lebendig zu fühlen, und im Moment musste Wolf sich unbedingt lebendig fühlen.
Mit vollem Mund murrte ich: »Wer zum Teufel will denn wach werden? Es ist Winter. Wir sollten alle Winterschlaf halten wie die besten Säugetiere.«
»Du hörst dich an wie das personifizierte Klischee, Summer«, befand Thalia. »Bloß weil du nach dem Sommer benannt bist, musst du ihn nicht auch verkörpern.«
»Namen sind wichtig«, wies ich sie zurecht. »Namen formen uns. Wir wachsen in unsere Namen hinein, nicht umgekehrt. Wenn ich mich recht erinnere, leitet Fenrin sich zum Beispiel von einem nordischen Namen ab, der ›Arschloch‹ bedeutet.«
Wolf lachte schallend mit seiner wohltönenden Schokoladenstimme. Nachdem er uns so lange gefehlt hatte, klang das einfach herrlich. Fenrin grinste glücklich, aber dann setzte er hastig eine betont ausdruckslose Miene auf.
»Tja, und was ist dann mit Wolf?«, fragte er. »Willst du etwa behaupten, sein Name bedeutet, dass er ein haariges Raubtier ist, weil …« Er hielt inne. »Mist.«
»Siehst du?«, krähte ich. »Es ist Schicksal.«
»Thalia wurde nach der Muse der Dichtung benannt«, gab Fenrin zurück, »und wann hast du sie zuletzt ein Gedicht lesen sehen?«
»Die ursprüngliche griechische Bedeutung von Thalia, Brüderlein mein, ist üppig sprießend.« Thalia streckte die Arme nach oben, legte den Kopf in den Nacken und entblößte ihre Kehle. »Blühend.«
»Und sie lässt wirklich alles Mögliche erblühen«, pflichtete ich ihr bei. »Kräuter. Blumen. Die Lendengegend von Schuljungen.«
Thalia ließ die Arme sinken und schubste mich. »Du musst immer alles in den Schmutz ziehen.«
»Dann gebt mir was von dem Kakao, bevor er kalt wird«, sagte Fenrin und rückte verstohlen näher an Wolf heran. Schon seit einer Weile fragte ich mich, ob Wolfs neue Genussfreudigkeit sich auch auf meinen Bruder erstreckte. Wenn der Junge, in den man verliebt war, von den Toten zurückkehrte, musste das die Beziehung zum reinsten Minenfeld machen.
»Gieß dir selbst was ein, Faulpelz«, erwiderte Thalia behaglich, aber dann tat sie es doch für ihn, weil sie eben Thalia war. Ich legte den Kopf in den Nacken und war zum ersten Mal seit langer Zeit schmerzlich glücklich.
Während hoch über uns der Wind pfiff, verkündete Wolf in der Stille hier unten: »Ich habe euch was zu sagen.«
Mein Magen krampfte sich zusammen, aber ich wusste nicht recht, warum. Wolf drückte sich die Hand aufs Herz.
»Was ihr alle für mich getan habt, indem ihr mich ins Leben zurückgeholt habt …«, begann er so feierlich, dass ich ganz verlegen wurde. »Eines Tages finde ich eine Möglichkeit, mich bei euch zu revanchieren, das verspreche ich.«
Das war so untypisch für den ansonsten eher verschlossenen Wolf, dass es mir die Sprache verschlug.
»Wenn man es recht bedenkt, seid ihr so was wie meine Götter«, fuhr Wolf nachdenklich fort, während wir ihn entgeistert anstarrten. Er hob die Augenbrauen. »Ich sollte euch verehren.« Er drehte sich zur Seite und legte die Hände vor Fenrin flach auf die Decke. Der sah ihn mit großen Augen an. »Ich sollte auf die Knie gehen und eure Namen preisen«, erklärte Wolf überschwänglich, und seine Stimme wurde höher.
Ich lachte, aber Thalia machte »Pst«, während Fenrin Wolf nur mit offenem Mund anstarrte.
»Summer, ich danke Euch«, heulte Wolf zum Himmel. »Thaliaaa, Ihr seid meine Retterin. Fenrin, ich verehre Euch …«
»Pst, du weckst noch die Oldies auf«, zischte Thalia hektisch.
»Also bitte, als ob die nicht wüssten, dass wir hier draußen sind«, sagte ich naserümpfend. Normalerweise tolerierten sie, was wir uns so einfallen ließen, sofern wir es auf heimischem Territorium taten, wo wir »sicher« waren.
Fenrin war rot geworden, was total süß war. Der Schelm in mir hätte zu gern eine Bemerkung dazu gemacht, aber ich hielt den Schnabel. Wolf setzte sich wieder und grinste mich ausgesprochen nett an.
»Nur euretwegen bin ich noch am Leben«, sagte er, und mein Herz kam aus dem Takt.
Nun wusste ich, warum Wolf dieses Mitternachtspicknick gewollt hatte – warum wir alle es gewollt hatten. Es war ein seltener und kostbarer gemeinsamer Augenblick, den wir uns da genommen hatten. Unsere gemeinsame Zeit ging schon wieder zu Ende; am nächsten Tag würden wir zurück in das Internat fahren, in dem uns unsere Eltern in einem ihrer regelmäßigen Anfälle von Beschützerwahn im letzten Jahr angemeldet hatten.
Erneut würden wir von dem Freund getrennt sein, der gerade erst wieder in unser Leben getreten war, nachdem sein Tod ein tiefes, zerklüftetes Loch hinterlassen hatte. Dieses Loch tat immer noch weh. Die Wunde klaffte noch. Wir hatten das Gefühl, er könnte jeden Augenblick wieder verschwinden. Das war ein schreckliches Gefühl, wie ein Sturz ins Bodenlose.
Irgendwo in der Dunkelheit ertönte ein dumpfes Knacken und unterbrach diesen Augenblick.
»Ein Dachs«, flüsterte Thalia, und ihre weit aufgerissenen Augen funkelten im Kerzenlicht.
»Sind Dachse denn so tollpatschig?«, flüsterte ich zurück.
»Sie haben diese riesigen Krallen. Da ist es wahrscheinlich schwer, das Gleichgewicht zu halten …«
»Leute«, sagte Fenrin.
Eine Gestalt trat zwischen den schemenhaften Stämmen jenseits unseres Lichtkreises hervor. Der Hain grenzte an die Dünen, die bis runter zum Strand führten, wo das weite Meer alle möglichen phantastischen Geschöpfe ausspucken konnte – im Dunkeln war meine Phantasie noch blühender als sonst. Vor meinem geistigen Auge sah ich ein schlangenartiges Meeresungeheuer, das sich aus der Brandung hervorgeschleppt hatte und nun zu uns heraufglitt. Oder einen Werwolf mit gebleckten, speichelglänzenden Fängen, der bebend und mit angespannten Muskeln vor uns lauerte.
Die Wirklichkeit war deutlich trivialer, wenn auch vielleicht nicht weniger gefährlich.
Es war Marcus.
Marcus Dagda, unser ehemals bester Freund und Thalias frühere Liebe. Er hatte Hausverbot bei uns. Er war aus unserem Leben verbannt worden. Er hätte gar nicht hier sein dürfen.
Marcus sah uns lange an. Sein Gesicht wirkte bleich und wächsern im grauen Halbdunkel jenseits unseres Kerzenscheins.
Dann brach er zusammen.
2
»Sie werden den Motor hören«, sagte Fenrin.
Ich drehte den Zündschlüssel und spürte, wie der Wagen unter meinen Schenkeln zum Leben erwachte.
»Sag ihnen einfach, ich wäre zur Nachttanke gefahren, um Eis zu holen, weil wir so verrückt sind, so jung und sorglos, so unvernünftig und unbeherrscht, dass wir finden, es ist nichts dabei, bei eisiger Kälte eisige Sachen zu essen«, erwiderte ich.
Fenrin seufzte. »Dann … beeil dich einfach.« Sein Blick fiel kurz auf Marcus, der zusammengekrümmt wie ein unglücklicher Käfer auf dem Beifahrersitz hockte. »Sorg dafür, dass er nach Hause kommt.«
Ich war mir nicht ganz sicher, ob er um Marcus besorgt war oder ihn bloß so weit wie möglich von uns weg haben wollte. Wie ich Fenrin kannte, war es ein bisschen von beidem.
Sie waren einmal beste Freunde gewesen. Ich wusste noch gut, wie sie bis zum Abwinken alte Zeichentrickklassiker geguckt hatten, die außer ihnen niemand kannte. Stundenlang hatten sie sich über Marcus’ Laptop gebeugt und bei jeder einzelnen Episode die Titelmelodie mitgesungen, ohne je eine zu überspringen. (Einer ihrer absoluten Favoriten war Pinky und der Brain gewesen, ein abgedrehter Zeichentrickfilm über zwei Labormäuse, die planen, die Weltherrschaft an sich zu reißen.) Sie hatten sich gegenseitig mit obskuren Anspielungen zum Lachen gebracht, die wir anderen nie kapiert hatten. Beste-Freunde-Sachen, Sachen, die Herzen verbinden.
Es muss ihnen beiden sehr weh getan haben, das zu verlieren.
Behutsam fuhr ich aus der Auffahrt auf den Zufahrtsweg. Jedes Mal, wenn ein loser Stein unter den Reifen knirschte, klang das in der stillen Nacht wie ein Salutschuss. Im Rückspiegel sah ich meinen Bruder, der uns mit verschränkten Armen hinterhersah. Thalia war bei Wolf geblieben, während der im Garten gierig die letzten Cookies verdrückte.
Thalia ertrug Marcus’ Gegenwart in letzter Zeit nicht gut.
Ich warf einen Blick auf den Verursacher unserer kollektiven Anspannung. Er sah mich irgendwie komisch an.
»Was?«, fragte ich. »Hab ich was im Gesicht? Schokolade? Blut? Ein unsichtbares außerirdisches Monster?«
»Du bist bloß so … hell«, sagte er.
Ich musste ihn fragen. »Marcus, bist du etwa high?«
Er seufzte. »Nein, nichts dergleichen. Schau, es tut mir leid.«
»Das hast du schon gesagt, mehrfach. Bist du sicher, dass es dir gutgeht?«
So sah er nämlich nicht aus. Er wirkte angespannt und irgendwie ausgeblichen, als hätte er beim Waschen Farbe verloren. Das Haar klebte ihm in schlaffen Strähnen auf der schweißnassen Stirn, und seine hellen Augen leuchteten im Abglanz des Armaturenbretts.
Es war keine angenehme Erfahrung gewesen, ihn ohnmächtig werden zu sehen. Zwar war er ziemlich schnell wieder zu sich gekommen, aber eine Weile hatte ich gefürchtet, er könnte eine Gehirnerschütterung haben, obwohl es nicht so ausgesehen hatte, als hätte er sich den Kopf gestoßen.
»Mir geht’s gut«, murmelte er. »Nach einer Weile geht es vorbei. Es hat erst vor kurzem angefangen. Mir wird total schwindlig, und um manche Leute herum werden die Farben richtig grell.« Er hielt inne. »Früher bin ich nie ohnmächtig geworden, aber es gibt ja für alles ein erstes Mal, oder? Sie meinen, es könnte Migräne sein.«
Das klang gar nicht gut, und sofort bekam ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ihm unterstellt hatte, er sei high. »Warst du beim Arzt?«
»Ja. Die haben alle möglichen Untersuchungen gemacht. Haben mich auf den Kopf gestellt. Sie können nichts finden.«
Das war vermutlich besser, als auf einem MRT-Bild einen beängstigenden Schatten zu entdecken, aber zugleich war die Ungewissheit fast noch schlimmer.
»Das tut mir wirklich leid«, sagte ich, »hoffentlich geht es wieder weg.« Egal, was zwischen uns allen vorgefallen war, das würde ich niemandem wünschen.
Marcus klang müde. »Glaub ich kaum.«
»Warum?«
Aber darauf wollte er nichts sagen, und ich wollte nicht nachfragen. Jetzt, wo wir nicht mehr befreundet waren, durfte ich ihn auch nicht mehr nach Geheimnissen löchern.
»Marcus«, sagte ich stattdessen, als ich Richtung Stadt abbog, »du musst damit aufhören.«
»Womit?«
»Bei uns zu Hause aufzuschlagen. Ich weiß, dass du bei der Geburtstagsparty der Zwillinge im Garten aufgetaucht bist. Thalia hat es mir erzählt. Wenn unsere Eltern dich da erwischt hätten, hättest du jetzt ein fettes Problem.« Ich riskierte einen Blick. Er sah aus dem Beifahrerfenster und betrachtete die vorüberziehende Landschaft.
»Das weiß ich«, sagte er schließlich. »Aber ihr seid alle da oben in diesem Internat, ihr seid ja nie hier. Ich habe euch seit Wochen nicht mehr gesehen und anrufen kann ich euch ja auch schlecht … ich weiß nicht, wie ich sonst mit euch reden soll.«
»Worüber?«
Schweigen.
Es spielte keine Rolle. Ich wusste, worum es ging. Neuerdings ging es bei Marcus nur noch um eins.
»Sieh mal«, sagte ich und bemühte mich, nett zu sein. »Ich weiß, es ist total ätzend, aber sie darf nicht mit dir zusammen sein, okay? Es ist einfach zu riskant. Sie ist darüber hinweggekommen, und ich glaube wirklich, du solltest das auch tun.«
Das war eine barmherzige Lüge. Ich hatte keinen echten Beweis dafür, dass Thalia über Marcus hinweggekommen war, sondern behauptete es einfach, hoffte, dass es wirkte, rechnete aber mit der üblichen verletzten Reaktion. Sie war meine Freundin. Ich liebe sie noch immer. Das ist nicht fair. Bloß weil ich ein Außenseiter bin.
Euer bescheuerter Familienfluch hat mein Leben ruiniert.
Deshalb war ich total erstaunt, als er in hörbar gereiztem Ton sagte: »Was? Nein. Das ist vorbei, klar? Es ist schon lange vorbei. Meinst du, das wüsste ich nicht? Hier geht es nicht um Thalia.«
»Worum geht es dann?«
»Um River.«
Unwillkürlich umklammerte ich das Lenkrad fester.
Es war das erste Mal, dass ich ihren Namen laut ausgesprochen hörte seit der Nacht, in der Wolf zurückgekehrt war. Wir sprachen nicht darüber, wer seinen Tod verursacht und wer ihn zu uns zurückgebracht hatte. Wir sprachen nicht darüber, dass es sich anfühlte, als wäre in der Mitte unseres Hexenzirkels eine Lücke, eine Leerstelle, die von einem gewissen Mädchen gefüllt werden sollte.
Wir sprachen nicht über River.
»Sie hat mir erzählt, was sie getan hat«, fuhr er fort, und ich spürte, dass er mir verstohlen einen prüfenden Blick zuwarf.
Ich zwang mich, ruhig zu bleiben. »Ach?«
»Sie hat mir das von Wolf erzählt.«
»Und was hat sie darüber erzählt?«
»Sie hat mir erzählt, dass sie die Welle heraufbeschworen hat, die ihn ins Meer gezogen und ertränkt hat. Und dann hat sie erzählt, wie sie ihn von den Toten zurückgeholt hat. Herrgott, Summer …«
»Tut mir leid.« Mit wild hämmerndem Herzen brachte ich den Wagen wieder auf Spur. Vor Schreck über Marcus’ Unverblümtheit hatte ich das Lenkrad nach links verrissen, so dass wir quer über die Straße geschlingert waren. »Noch mal … noch mal zum Mitschreiben. Das hat sie dir wirklich alles erzählt?«
»Ich hab ihr nicht geglaubt. Zuerst. Es geht das Gerücht, dass Wolf sich mit den falschen Leuten eingelassen hätte, alle möglichen Drogen genommen hätte, dass es ihn aus der Bahn geworfen hätte und er für sechs Monate verschwunden wäre, um einen Entzug zu machen. Das ist einfacher, nicht? In Ermangelung anderer Beweise passt es.«
So war es, und ich war erleichtert zu hören, dass es funktioniert hatte.
Fenrin, Thalia und ich hatten einen Pakt geschlossen. Wir würden Wolfs Leben nicht in einen albtraumhaften Zirkus verwandeln, indem wir verrieten, was in Wirklichkeit passiert war. Jetzt, wo wir ihn zurückhatten, war es unsere Pflicht, ihn nach Kräften zu beschützen.
Also logen wir.
Wir belogen unsere Eltern, und seine ebenfalls. Eigentlich hasste ich Lügen, aber uns blieb nichts anderes übrig. Wolf hatte uns einmal gestanden, als er mit vierzehn zum ersten Mal den ganzen Sommer bei uns verbracht hatte, hätten seine Eltern ihn dadurch von seinen ihrer Meinung nach falschen Freunden trennen wollen – von Freunden, die sich ihren Teenagerkick gern mit kleinen Straftaten und mittelschwerem Drogenmissbrauch geholt hatten.
Es war Wolf peinlich gewesen, und er hatte behauptet, er habe dabei nie mitgemacht, aber wir hatten die Geschichte für plausibel genug gehalten, dass so etwas in größerem Ausmaß noch einmal hatte passieren können. Wenn man Wolfs dünnen, ausgemergelten Körper betrachtete, war leicht nachvollziehbar, warum die Erwachsenen sofort glaubten, es seien Drogen im Spiel gewesen, und wir konnten es uns nicht leisten, sie von dieser Idee abzubringen.
Wolf war kein Grace, jedenfalls nicht im engeren Sinne. Er lebte mit seinen Eltern, die alte Freunde der Familie waren, in der Hauptstadt, aber die Sommer verbrachte er bei uns, und er besuchte uns zu Jul, Beltane und Imbolc, zu meinem Geburtstag und dem der Zwillinge. Wolf gehörte einfach zur weiteren Familie, so selbstverständlich, dass er ein gefundenes Fressen für die Gerüchteküche war. Uns war klar gewesen, dass die Neuigkeit von seiner Rückkehr sich schnell herumsprechen würde – wie auch nicht in einer Kleinstadt mit lauter Kleingeistern? – , deshalb hatten wir bloß noch dafür zu sorgen, dass wir die Kontrolle über die Geschichte behielten.
Eine Auferstehung – so etwas hatte es noch nie gegeben. Es widersprach sämtlichen Naturgesetzen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass uns das überhaupt jemand geglaubt hätte. Das Szenario mit dem Drogenabsturz war da in jeder Hinsicht glaubwürdiger.
»Es passt«, wiederholte ich, »weil es so passiert ist.«
»Nein, ist es nicht«, widersprach Marcus. Er klang so sicher, dass ich unwillkürlich mehrmals verstohlen zu ihm sah, um herauszufinden, wie er über das, was er heute Nacht gesehen hatte, dachte.
»Wie kannst du bloß jemandem wie River so eine durchgeknallte Geschichte glauben?«, fragte ich.
»Wegen dem, was sie sonst noch kann.«
»Wovon redest du?«
Betreten rieb er sich das Gesicht. »Ich glaube … sie ist der Grund, warum es mir neuerdings manchmal so schlechtgeht.«
Ich fuhr auf den Seitenstreifen, hielt neben einem Waldweg, der parallel zur Straße verlief, an und schaltete den Motor aus.
»Tja, das fühlt sich entschieden nicht an wie der Anfang eines Serienmörderthrillers«, sagte Marcus so nervös, dass seine Stimme bebte.
»Ich will bloß nicht irgendwo gegenfahren«, sagte ich nachdrücklich. »Und jetzt will ich wissen, ob ich richtig verstehe, was du mir erzählt hast, nämlich dass River dich krank macht.«
Marcus dachte einen Moment nach. »Ich wollte ihr das mit Wolf glauben«, sagte er dann, »aber ich konnte irgendwie nicht. Also habe ich sie auf die Probe gestellt. Herrgott, war das bescheuert von mir.« Er atmete flach ein. »Sie hat gesagt, ich soll mir was wünschen. Etwas, was ich unbedingt will, wovon aber andere nicht notwendigerweise wissen würden. Ein geheimer Wunsch.«
»Und was hast du dir gewünscht?«, fragte ich sanft.
»Ich habe ihr gesagt, dass ich eine Hexe sein will.«
Mein Herz setzte kurz aus und rutschte mir dann in die Hose. »Wegen Thalia.«
Ich konnte Marcus’ Überlegung nur zu gut nachvollziehen. Es ging um den Grace-Fluch. Um das kostbare, brutale Vermächtnis unserer Familie. Immer dann, wenn einer von uns in das Alter kam, in dem man sich zum ersten Mal verliebt, zeigte dieser Fluch seine hässliche Fratze und nahm dann seinen unheilvollen Verlauf, bis einer von uns tot war. Entweder wir oder der geliebte Mensch, für den wir uns entschieden hatten. Durch Unfall oder Vorsatz – das Ergebnis war immer dasselbe. Jemand starb, weil wir es wagten, zu lieben. Und konkret war der Fluch auch noch – er schien sich nur dann zu entfalten, wenn ein oder eine Grace sich in einen Außenseiter verliebte anstatt in eine andere Hexe.
Falls Marcus irgendwie zur Hexe wurde, müsste er theoretisch die Fallstricke des Fluchs umschiffen und wieder mit Thalia zusammen sein können, oder? Doch er schüttelte den Kopf.
»Nein«, beharrte er und ergänzte dann: »Jedenfalls nicht nur. Ich wollte … die Magie spüren können, so wie ihr. Früher habe ich euch alle beobachtet, weißt du, und euch beneidet. Ihr habt keine Ahnung, wie es ist, dabei nur am Rand zu stehen. Eure Konturen scheinen dann irgendwie satter und heller als alles um euch herum zu werden. Der Hexenanteil in euch – diese Intuition, diese Macht, dieses Mehr, was ihr alle habt –, der ist immer da, in euch, wie ein angeborener Teil von euch. Ich will spüren, was ihr spürt. Ich will die Magie spüren können, tief drin in meinem Blut.«
Mit einem Mal schien ihm klarzuwerden, was er da gesagt hatte. Er zappelte ein bisschen, saß wieder still und wich meinem Blick aus.
Letztes Jahr hatte ich eine Website namens »Die Wahrheit über die Graces« entdeckt. Sie war ein Infosammelbecken, das ausschließlich meiner Familie gewidmet war und anonym sämtliche Gerüchte und Einsichten wie auch die Ammenmärchen aufführte, die man sich in der Kleinstadt, in der wir lebten, im Lauf der Jahre über uns ausgedacht hatte.
Offiziell mochte der Betreiber anonym sein, aber mir war sonnenklar, dass es Marcus war.
Eine Weile war ich stinkwütend gewesen, aber auch wenn es anfangs vielleicht nur seine indiskrete, kleinliche Rache dafür gewesen war, dass er rüde aus unserem Leben verbannt worden war, nachdem man ihn in flagranti mit meiner Schwester erwischt hatte, ging es Marcus dabei eigentlich um etwas anderes. Marcus war ein begeisterter Forscher mit einem scharfen Verstand und einer unersättlichen Neugier, die womöglich sogar meine übertraf, und er war total fasziniert von Magie. Damit hatten wir ihn am liebsten aufgezogen, damals, als wir noch eng befreundet gewesen waren. Er sehnte sich danach, wie manche Menschen sich nach Sonnenschein sehnen. Seine Website hatte sich von einer billigen Gerüchteküche zu einer ausufernden Forschungsarbeit über Magie und Macht, Bräuche und Rituale, volkstümliche Überlieferungen und Religion entwickelt.
»Und was hat River getan?«, fragte ich.
Er lachte bitter. »Ich habe sie ja gebeten, mich Magie spüren zu lassen, oder? Tja, jetzt spüre ich sie, und wie. Ich spüre sie so stark, dass es mich krank macht.«
Schleichendes Entsetzen erfasste mich wie billiger Fusel, der einem im Magen brennt. »Was? Nein. Woher willst du wissen, dass es das ist?«
»Es gibt da ein Muster. Ich fühle mich nur in ihrer Nähe so.« Er zappelte ein bisschen. »Und jetzt … bei euch allen.«
Der Groschen fiel.
»Deshalb bist du ohnmächtig geworden? Unseretwegen?«
»Sieh mal, ich war mir nicht sicher. Ich bin zu euch gegangen, weil ich meine Theorie überprüfen wollte.«
»Tolle Testmethode, Marcus.«
Er zuckte bloß die Achseln. Ich wusste, dass er zum Äußersten entschlossen war, wenn es um eine seiner geliebten Theorien ging.
»Es ist schrecklich von ihr, jemandem so etwas anzutun«, sagte ich bedächtig.
»Ich glaube nicht, dass sie das gewollt hat, nicht so. Sie hat mir von all den anderen Sachen erzählt, für die sie verantwortlich ist. Zum Beispiel wenn sie eigentlich bloß will, dass jemand die Klappe hält oder weggeht, und es dann auch passiert, aber es passiert wirklich, und zwar so, dass sie keine Kontrolle darüber hat. Es ist, als ob – bei ihr kann ein Wunsch zum Fluch werden.«
Wünsche als Flüche.
Letztes Jahr hatte Jase Worthington, ein Typ, mit dem ich mal was gehabt hatte, eine Menge seiner kostbaren Zeit auf Erden damit verbracht, manch hässliches Gerücht über mich in Umlauf zu bringen. Während wir zusammen gewesen waren, war ich mir immer bloß wie sein schmutziges kleines Geheimnis vorgekommen. Jeder wusste, dass man sich nicht richtig mit einer Grace einlassen konnte, also hatte es für ihn nur der Reiz des Neuen sein können; ich war ein glänzendes, exotisches Spielzeug gewesen, das er benutzen und bestaunen konnte. Zum Surfen hatte er eine weitaus leidenschaftlichere und innigere Beziehung, weil der Sport keine Ansprüche an ihn stellte.
Nicht lange, nachdem wir uns getrennt hatten, hatte Jase sich das Bein gebrochen, als er wieder einmal seinem liebsten Zeitvertreib nachgegangen war, und deshalb waren alle an der Schule zu dem Schluss gekommen, ich hätte ihn aus Rache verflucht – aber das hatte ich nicht, auch wenn die Versuchung groß gewesen war. Ich hatte ihn weder mit einem Bannzauber belegt noch verletzt, und ich hatte ihn auch nicht mit irgendwelchen magischen Tricks zum Schweigen gebracht, höchstens mit meinem scharfen Mundwerk.
Weil ich wusste, wie es sich anfühlte, mit einem Fluch zu leben, verfluchte ich nicht leichtfertig Leute.
Was ich allerdings niemandem je gesagt hatte, war, was ich gedacht hatte. Ich hatte mir gewünscht, dass er sich das Bein brach. Daran erinnerte ich mich noch ganz deutlich. Wenn er das Surfen so liebte, wäre es dann nicht einfach jammerschade, wenn etwas passierte, was ihn daran hinderte, wenigstens vorübergehend?
Es war ein gemeiner, finsterer, flüchtiger Gedanke gewesen. Bloß hatte ich damals noch nicht gewusst, dass gemeine, finstere, flüchtige Gedanken in Rivers Nähe häufig wahr wurden. Später, viel später, hatte sie mir gestanden, dass sie ihm mit einem ihrer eigenen Gedanken das Bein gebrochen hatte, als sie ihn beim Surfen beobachtet hatte. Sie hatte ihn bestrafen wollen.
Meinetwegen.
»Wie ist es, Wolf zurückzuhaben?«, fragte Marcus. »Geht es ihm gut?«
Ich atmete geräuschvoll aus. »Größtenteils.«
»Wirkt er verändert?«
»Er hat viel durchgemacht. So was muss einen doch verändern. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob er das alles schon ganz verarbeitet hat, aber das ist okay. Wir werden ihm helfen, und er kommt wieder in Ordnung, und dann ist er wieder ganz der alte lachende und spöttelnde Wolf.«
Mit der letzten Bemerkung hatte ich die Stimmung heben wollen. Marcus war Wolf im Lauf der Jahre ein paarmal begegnet und kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass »lachend und spöttelnd« eine Beschreibung war, die so gar nicht auf unseren bulgarischen Grübler passte.
Ich ließ den Motor an und hatte dabei das Gefühl, dass Marcus die Zweifel zwischen den Zeilen gehört hatte. Nein, genau genommen wusste ich nicht, ob Wolf jemals wieder ganz der Alte sein würde, aber wir würden verdammt nochmal dafür sorgen, dass sein Leben von jetzt an so schön wie möglich sein würde.
Der Rest der kurzen Fahrt verlief schweigend. Wir erreichten die ruhige Wohnstraße, in der Marcus lebte, und ich parkte ein Stückchen von seinem Haus entfernt.
Er blieb sitzen.
»Soll ich dich zur Tür bringen …?«, fragte ich versuchsweise.
»Ich kann allein gehen«, antwortete er leise. »Alles gut.«
Da seufzte ich geräuschvoll. »Das ist doch lächerlich. Woher willst du wissen, ob River wirklich dafür verantwortlich ist, dass es dir schlechtgeht? Vor allem wenn sie es selbst gar nicht merkt.«
»Du hast recht«, sagte er, und zwar so friedfertig, dass ich verblüfft war. »Wir brauchen mehr Beweise.«
»Wir? Sind wir jetzt ein Team, ja?«
Marcus zuckte die Achseln. »Ich kann das auch allein untersuchen. Aber du solltest dir in der Zwischenzeit lieber einen Plan B überlegen, denn wenn ich recht habe, dann wird das nicht aufhören. Es wird nur schlimmer werden.«
»Wie kommst du darauf?«
Er öffnete die Beifahrertür. Zögerte.
»Du glaubst, ich wäre der Einzige, der sie um etwas gebeten hat?«, fragte er. »Es gibt noch mehr Leute.«
Dann ging er mit hochgezogenen Schultern davon. Ich saß im Auto und sah ihm hinterher, und mein Herz flatterte nervös.
Es gibt noch mehr Leute.
»River«, sagte ich in die Dunkelheit hinein. »Was zum Teufel treibst du da?«
3
Das war kein Herumschnüffeln, redete ich mir ein, als ich vor der Tür zum Arbeitszimmer meines Vaters stand.
Es ging um einen Plan B.
So behutsam ich konnte, öffnete ich die Tür, schlüpfte hinein und nahm die gedämpfte, samtige Stille des Raumes in mich auf. Hier hatte ich im Lauf der Jahre viel Zeit verbracht, hatte mich mit einem Buch neben dem dunklen Schreibtisch aus Walnussholz zusammengerollt oder in den pflaumenblauen Sessel am Fenster plumpsen lassen, um über Kopfhörer Musik zu hören. Aber normalerweise betrat ich ohne Erlaubnis weder den Raum, noch rührte ich hier irgendetwas an.
Als Kind hatte ich unter Aufsicht die robusten Vitrinen an der hinteren Wand des Arbeitszimmers öffnen und mir all die faszinierenden Sachen ansehen dürfen, die Gwydion darin aufbewahrte. Es waren die verschiedensten Wahrsagewerkzeuge – obskure, sonderbare, wunderschöne Gegenstände aus aller Welt. Die riesige goldene Kugel mit dem komplizierten Mechanismus darin. Die schlanken Stäbe aus verschiedenen Metallen, die parallel zueinander, doch ohne sich zu berühren, im mittleren Fach auf einem Samttuch angeordnet waren. Aus Hirschknochen geschnitzte Runen, die in einem wirren Haufen auf einem dicken Wollbeutel lagen – die cremefarbenen Oberflächen leuchteten sanft in der Wintersonne, wenn das Licht genau im richtigen Winkel durchs Fenster fiel. Die Werkzeuge seines Gewerbes, sagte Gwydion immer trocken.
Mein Vater, der Wahrsager.
Er war sehr gefragt bei erfolgreichen Geschäftsleuten jeder Couleur, denen er half, »Strategien für die Zukunft zu entwickeln«. Seine offizielle Berufsbezeichnung lautete »Prognose-Consultant«, weil niemand je zugeben würde, dass er die Dienste einer Hexe in Anspruch nahm. Der einzige echte Unterschied zwischen ihm und den billigen Wahrsagern, die hinter Satinvorhängen saßen, war der, dass er viel mehr Geld dafür nahm.
Früher hatte mich jeder der glänzenden Gegenstände in diesen Vitrinen fasziniert, und sooft Gwydion es mir erlaubte, hatte ich sie in die Hand genommen, weil ich wollte, dass sie mir die Geheimnisse meiner bezaubernden kleinen Welt enthüllten. Aber nicht wegen der Wahrsagewerkzeuge war ich hier. Nicht heute.
Mir ging es um die Notizbücher.
Die gedruckten Bücher über Magietheorie im schwarzen Bücherregal unter dem Fenster waren ziemlich abgegriffen – meine Schwester Thalia hatte ständig einen Stapel davon in ihrem Zimmer, an irgendeiner Stelle aufgeschlagen und teilweise mit Knicken in den Seiten –, aber außerdem stand auf dem obersten Regalbrett in der Vitrine neben der Tür eine Reihe schlichter ledergebundener Notizbücher.
Als wir jünger waren, hatte Fenrin mir erzählt, das seien die persönlichen Tagebücher unseres Vaters und voller Geheimnisse, peinlicher Gedanken und skandalöser Anekdoten über alle, die wir kannten. Thalia hatte sie als Notizen zu seinen Kunden abgetan, die er nur deshalb in einem abgeschlossenen Schrank verwahrte, weil sie vertrauliche Informationen enthielten. Als ich Gwydion selbst einmal danach gefragt hatte, hatte er gesagt, es seien seine persönlichen Notizen zu seinem Gewerbe, in jahrelanger Forschung gesammelt – sein eigenes Buch der Schatten.
Er hatte mir einmal eines dieser Notizbücher gezeigt, es kurz vor meiner Nase durchgeblättert – aber damit hatte er mein »Neugiermonster«, wie er es immer nannte, auch nicht annähernd zufriedengestellt. Meine gierigen Augen hatten nur seitenweise Notizen in Gwydions dünner, schnörkeliger Handschrift gesehen, hier und da aufgelockert mit der Zeichnung eines Symbols oder eines Talismans.
Ich hätte sie so gern gelesen, aber das hatte er mir nie erlaubt, und keiner der Schränke in Gwydions Arbeitszimmer ließ sich ohne den winzigen Messingschlüssel öffnen, den er immer in der Brieftasche verwahrte.
Genau der winzige Messingschlüssel, von dem eine Kopie in der verborgenen Schublade seines Schreibtischs lag.
Diese Schublade und damit den Schlüssel hatte ich erst vor kurzem rein zufällig entdeckt – und sie mir prompt wieder aus dem Kopf geschlagen. Das ging mich nichts an.
Aber jetzt?
Gwydion war auf Geschäftsreise, und Esther hatte Fenrin, Thalia und mich den Vormittag über allein gelassen, um in der Stadt etwas zu erledigen. In nicht mal drei Stunden würden wir im Zug zurück ins Internat sitzen. Eine bessere Gelegenheit würde es nicht geben.
Ich holte den Schlüssel aus der geheimen Schublade, schloss die Vitrine auf und nahm den ersten Satz Notizbücher heraus. Dann setzte ich mich damit auf den Teppich am Bücherregal, wo mir durchs Fenster das matte Winterlicht über die Schultern fiel. Der Kaffeebecher neben meiner Hüfte dampfte aromatisch. Regen prasselte sanft ans Fenster, und der bedeckte Himmel hinter mir war hellgrau.
Als ich das erste Notizbuch aufschlug, hatte ich ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich befürchtete, dass Fenrin womöglich richtig gelegen hatte und ich gleich ein paar viel zu persönliche Dinge über meinen eigenen Vater erfahren würde – nein, nein und, lieber Gott, nein! –, aber zu meiner Erleichterung enthielten sie, genau wie Gwydion gesagt hatte, Fragmente von Mythen und überliefertem Wissen, die er irgendwo gefunden hatte, Informationen über Rituale und Zauber, teilweise in seiner nur für Eingeweihte lesbaren Stenoschrift, sowie magische Theorien, von denen ich noch nie gehört hatte. Erst nachdem ich drei Notizbücher überflogen hatte, fand ich im vierten das, was ich suchte.
Auf der ersten Seite prangte in Gwydions sorgfältiger, schnörkeliger Handschrift:
Vom Wesen des Enakelgh.
Auf den folgenden Seiten fand ich statt der handschriftlichen Aufzeichnungen Computerausdrucke. Vielleicht hätte ich es mir damit erklärt, dass er aus irgendeinem mir rätselhaften Grund beschlossen hatte, seine Gedanken abzutippen, auszudrucken und in sein Notizbuch einzukleben … wäre da nicht die URL unten auf jeder Seite gewesen: thetruthaboutthegraces.com.
Marcus’ Website.
Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass Gwydion überhaupt von der Seite wusste. Ebenso wie über erstaunlich viele andere Themen war in unserer Familie schlicht nie darüber gesprochen worden, und ich hatte auch nicht diejenige sein wollen, die meiner wegen Marcus ohnehin schon todunglücklichen Schwester davon erzählte. Theoretisch war mir zwar klar gewesen, dass unsere Eltern unter Umständen viel mehr über unsere verworrenen Beziehungen wussten, als sie sich anmerken ließen, aber mit dem Beweis dafür konfrontiert zu werden, war doch etwas anderes.
Die erste ausgedruckte Seite begann in Marcus’ förmlichem Geschichtenerzählerstil, den ich sofort wiedererkannte:
Haben Sie sich schon einmal darüber gewundert, dass die Graces ihre Magie vier Elementarmächten zuordnen? Der Ursprung ist in der Legende von den vier Kirchenglocken zu finden, die jeder hier wahrscheinlich irgendwann in seinem Leben schon einmal gehört hat.
An diesen Abschnitt der Website erinnerte ich mich nur zu gut. Hier ging Marcus ausführlich auf die Ursprünge des Grace-Fluchs ein.
Aber vielleicht wissen Sie nicht, dass die Legende von den vier Kirchenglocken ältere, vorchristliche Wurzeln hat, und diese Wurzeln sind fest mit der Familie Grace verknüpft. Falls Sie also die ältere Version nicht kennen – hier ist eine kurze Zusammenfassung:
Eines Tages kommt ein Dämon in die Stadt, getarnt als junger Mann. Wie es die Natur solcher Geschöpfe ist, macht er sich sogleich daran, Unheil und Finsternis unter den Bewohnern der Stadt zu verbreiten, und sorgt voller Schadenfreude für Tod und Verderben. Im Verlauf seiner chaotischen Umtriebe begegnet er der Tochter einer Familie von Hexen, und in einem Anfall leidenschaftlicher Lust versucht er, sich mit ihr davonzumachen.
Ihre Familie ist darüber natürlich nicht erfreut, aber dem geschickten und äußerst überzeugenden Dämon gelingt es, die halbe Stadt gegen sie aufzubringen. Er wird erst besiegt, als vier der Hexen ihre Macht vereinen und ihn mit einem Bannfluch aus der Stadt vertreiben.
Kurz vor seiner Vertreibung belegt der Dämon allerdings seinerseits die Hexenfamilie mit einem Fluch – wenn er selbst nicht mit einer von ihnen glücklich werden kann, dann auch niemand anderes.
Seit jenem Tag, so die Legende, neigt jede Grace-Hexe zu tragischem Pech in der Liebe. Ob dies nun eine selbsterfüllende Prophezeiung ist oder nicht (wenn man glaubt, man sei in der Liebe verflucht, fordert man dann unbewusst Situationen heraus, die diesen Glauben verstärken), das kann niemand mit Sicherheit sagen.
Ungeachtet dessen hat dieser jahrhundertealte Mythos eine Tradition in der Familie Grace begründet. Jedes Familienmitglied wird bei Vollendung des zehnten Lebensjahrs aufgefordert, sich für eine Spezialisierung zu entscheiden: Erde, Luft, Feuer oder Wasser. Zu jeder dieser Spezialisierungen gehören eigene Talente und Charakterzüge [klicken Sie hier, um zur Elementesektion dieser Website zu navigieren und mehr zu erfahren], und von da an arbeitet jede Hexe vorzugsweise mit Talenten ihres Elements.
Vier Hexen, eine für jedes der Elemente, bilden vereint ein machtvolles Team, machtvoll genug, um einen Dämon zu besiegen. Solche Geschichten bergen immer ein Körnchen Wahrheit, gleichgültig, wie stark sie im Zuge der Überlieferung verzerrt wurden.
Aber was ist mit dem Dämon? Falls die Graces von jener ursprünglichen Hexenfamilie abstammen, sollte dann nicht auch er einen Nachfahren haben – eine Gegenkraft von gewaltiger Macht, die die Ordnung der Dinge bedroht?
Hier endete der Ausdruck von Marcus’ Ausführungen. Danach folgte wieder Gwydions Handschrift:
Wenn vier aneinander gebunden sind und eine Spirithexe dazugehört, verleiht dieser Seelenzirkel oder »Enakelgh« angeblich jedem seiner Mitglieder gewaltige potentielle Macht, mehr als sie es sich ohne die Spirithexe hätten erträumen können – aber dieses Element ist von Natur aus sehr chaotisch, und insofern bringt derjenige, der es repräsentiert, zugleich potentiell große Finsternis mit.
Eine Spirithexe an sich zu binden ist eine heikle, gefährliche Angelegenheit. Ja, es bedeutet, dass man sie und ihre Macht unter Kontrolle bringt, aber dieser Einfluss funktioniert in beide Richtungen – schließlich lässt man die Macht der Spirithexe dann auch in sich selbst ein. Das sind die Vor- und Nachteile des Enakelgh. Es ist eine wechselseitige Angelegenheit. Alle beeinflussen sich gegenseitig, bis man nicht mehr sagen kann, wo man selbst aufhört und das Chaos der Spirithexe beginnt. Womöglich kommt man sogar auf die Idee, es sei das eigene Chaos, und handelt dementsprechend …
Es ist weitaus sicherer für alle, sich von Außenseitern generell fernzuhalten. Enakelgh-Zirkel nehmen oft ein böses Ende. (Mögen wir nie vergessen, was mit E.s Cousine geschah …)
Mein Atem schien mir im Hals steckenzubleiben.
Immer wieder las ich diese Zeilen, bis sich allmählich Zusammenhänge herausbildeten. Ich wusste, dass Hexenzirkel – zumindest in unserer Familie – immer Vierergruppen waren: eine Hexe für jedes Element. Ich war eine Lufthexe, Fenrin eine Wasserhexe und Thalia eine Erdhexe. Bei einem Enakelgh war eine der vier jedoch eine Spirithexe. Eine Außenseiterin, die sowohl gewaltige Macht als auch gewaltige Finsternis mitbrachte.
Das war River.
Als wir letztes Jahr versucht hatten, den Fluch ohne Thalia, die in unseren Ritualen normalerweise die Erdhexe war, zu brechen, hatte River deren Rolle übernommen – allerdings hatte ich schon damals gewusst, dass Erde nicht ihr Element war. Erde war bodenständig und zeichnete sich durch eine tiefe Verbindung der Sinne aus, aber so war River nicht. Ich hatte schon immer gespürt, dass sie etwas anderes war.
Jetzt wusste ich auch, warum.
E.s Cousine. Mit E meinte Gwydion bestimmt Esther. Ich versuchte, im Geiste alle ihre Cousinen durchzugehen, die ich kannte, aber sie hatte etliche, denn unsere Familie war weitverzweigt. Ich konnte mich nicht erinnern, dass einer von ihnen etwas Schlimmes zugestoßen war, aber andererseits waren meine Eltern nicht gerade freigebig mit Informationen über die unzähligen Tragödien in unserer Familie.
Als unsere Großmutter noch gelebt hatte, hatte sie uns immer genüsslich mit morbiden Anekdoten aus früheren Generationen unterhalten, aber Esther hatte das nicht ausstehen können und normalerweise versucht, es zu unterbinden, bevor die Geschichte zu weit gediehen war. Ihr wäre es lieber, wir blieben unwissend, als dass wir die Wahrheit erführen, als wäre Unwissenheit eine wirksame Abwehrmaßnahme gegen Leid.
Das lag natürlich alles an dem Fluch.
Keiner von uns hatte bisher herausgefunden, ob und inwiefern er sich in der Generation unserer Eltern manifestiert hatte. Esther schien eine der wenigen Graces zu sein, die ihm erfolgreich aus dem Weg gegangen waren, und jeder wusste, wie sie das gemacht hatte.
Sie hatte jemanden geheiratet, den sie nicht liebte.
Ich verbot mir kategorisch, diesen Gedankengang weiterzuverfolgen. Thalia war geradezu besessen von der Beziehung unserer Eltern, aber ich dachte lieber nicht zu genau darüber nach. Kluges Verkuppeln war Tradition in unserer Familie. Zwar gingen wir nicht so weit, Ehen zu arrangieren, aber sehr viel fehlte nicht.
Ich war bisher erfreulicherweise von vielsagenden Rippenstößen verschont geblieben, aber Thalia hatte weniger Glück gehabt. Man hoffte oder ging vielleicht sogar davon aus, dass sie und Wolf ihre Freundschaft vertiefen würden, aber diese Vorstellung hatten beide immer schon total abstoßend gefunden. Für Thalia war Wolf ein Cousin, und für Wolf war Fenrin … tja. Ich fragte mich, ob Esther je mitbekommen würde, woher da der Wind wehte.
Als hätte der Gedanke an meine Mutter sie heraufbeschworen, hörte ich ein Auto in die Auffahrt kommen.
Sie war zurück.
Hastig sprang ich auf, schnappte mir die Notizbücher, klappte sie zu und stellte sie, hoffentlich in der richtigen Reihenfolge, zurück ins oberste Regal der Vitrine. Mit einem der Notizbücher blieb ich irgendwo hängen und konnte nur hilflos zusehen, wie etwas vom Regal rutschte und mit einem hörbaren dumpfen Knall zu Boden fiel.
»Mist!«, zischte ich erschrocken.
Das Ding musste ganz hinten im Regal gelegen haben. Ich hatte schon einmal zerstreut bemerkt, dass die Hälfte der Notizbücher ein Stück vorstand, aber weil das Regal so hoch war, hatte ich nicht erkennen können, warum.
Ich sah nach, was da heruntergefallen war. Es war ein schmaler, rechteckiger Block aus schwarzem Samt, dem Aufprall nach zu urteilen, schwer. Um das Ding zurück ins Regal zu legen, würde ich mich auf den Drehstuhl stellen müssen. Ich sah es schon vor mir, wie ich mich gefährlich weit nach oben streckte, die Sitzfläche unter meinen Füßen sich drehte, und ich mit lautem, sehr vernehmbarem Knall auf dem Boden aufschlug. Womöglich brach ich mir dabei noch das Genick.
Dafür blieb keine Zeit. Ich würde es eben später zurücklegen müssen.
Hastig richtete ich die Notizbücher aus, schloss die Vitrinentür und fummelte den kleinen Messingschlüssel aus meiner Jeanstasche. Als ich den Schrank abschloss und beim leisen Klicken zusammenzuckte, hörte ich schon Schritte im Flur. Ich kniete mich unter den Schreibtisch und tastete nach dem Öffnungsmechanismus, von dem ich wusste, dass er da war, er musste da sein, aber irgendwie hatte er sich verschoben – nein. Endlich ertastete ich ihn, öffnete die Schublade, legte den Schlüssel hinein, schob sie wieder zu. Dann kroch ich unter dem Schreibtisch hervor, ging in die Hocke hoch und atmete tief durch. Die Schritte wurden lauter, und dann hörte ich das verräterische Knarren der mittleren Stufe auf der Treppe in den ersten Stock.
Ich bückte mich und hob den Samtblock auf. Er entpuppte sich als Beutel, der mit einer Kordel zugezogen war, und darin befand sich etwas, das fast so lang wie meine Hand, aber dünn genug war, um es unter meinem Pulli in den Bund meiner Jeans zu schieben. Ich zog den Bauch ein, damit das Ding Platz hatte, drückte es tiefer in die Jeans, schlich hinaus auf den Flur und sah mich um.
Esther hatte den ersten Stock erreicht und ging gerade an meinem Zimmer vorbei zur Treppe, die zur Etage der Jungen führte. Garantiert wollte sie kurz bei Wolf reinschauen und sich vergewissern, dass alles in Ordnung war, wie sie es ungefähr jede halbe Stunde tat, seit er an diesem Wochenende angekommen war.