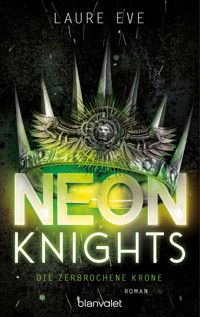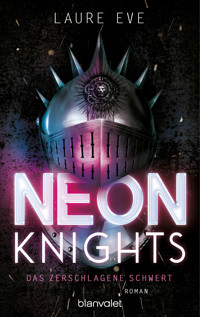
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark Camelot
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Camelot als Gotham City, Motorräder statt Schlachtrösser: So haben Sie die Artus-Sage noch nie gelesen!
Sie glauben, alles über die Artus-Sage zu wissen? Dann kennen Sie die Neon Knights noch nicht! In dieser düsteren Roman-Dilogie nehmen die Ritter nicht etwa an der Tafelrunde Platz, sondern ringen als geltungssüchtige Celebrities in Fernsehkämpfen um Ruhm, Reichtum und Gerechtigkeit. Allen voran die junge Red, die sich nichts sehnlicher wünscht, in die Riege der Ritter aufgenommen zu werden – um endlich Rache an dem Mann zu nehmen, der vor so vielen Jahren ihr Leben zerstört hat …
Verpassen Sie nicht »Neon Knights – Die zerbrochene Krone«, Band zwei der sagenhaften Urban-Fantasy-Dilogie von Laure Eve!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 679
Ähnliche
Buch
Sie glauben, alles über die Artus-Sage zu wissen? Dann kennen Sie die Neon Knights noch nicht! In dieser düsteren Roman-Dilogie nehmen die Ritter nicht etwa an der Tafelrunde Platz, sondern ringen als geltungssüchtige Celebrities in Fernsehkämpfen um Ruhm, Reichtum und Gerechtigkeit. Allen voran die junge Red, die sich nichts sehnlicher wünscht, als in die Riege der Ritter aufgenommen zu werden – um endlich Rache an dem Mann zu nehmen, der vor so vielen Jahren ihr Leben zerstört hat …
Autorin
Laure Eve ist Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Sie hat sowohl britische als auch französische Wurzeln, wurde in Paris geboren und wuchs in Cornwall auf. Die bereits veröffentlichten Werke der YA-Autorin waren ein internationaler Erfolg und wurden in zehn verschiedene Sprachen übersetzt. Mit ihrer neuen Urban-Fantasy-Dilogie, ein düsteres Re-Telling der Artus-Sage, begeistert sie nun auch eine erwachsene Fantasy-Leserschaft. Mit der Dilogie »Neon Knights – Das zerschlagene Schwert« und »Neon Knights – Die zerbrochene Krone« feiert Laure Eve ihr Debüt bei Blanvalet.
Die Dilogie von Laure Eve bei Blanvalet:
Neon Knights. Das zerschlagene Schwert
Neon Knights. Die zerbrochene Krone
LAURE EVE
KNIGHTS
DAS ZERSCHLAGENE SCHWERT
Roman
Deutsch von Charlotte Lungstrass-Kapfer
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Blackheart Knights« bei Jo Fletcher Books, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © Laure Eve 2021
Copyright der Originalausgabe © 2021 by Jo Fletcher Books, an imprint of Quercus Editions Ltd
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
The moral right of Laure Eve to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act, 1988.
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: © Anke Koopmann | Designomicon
Umschlagmotive: Shutterstock.com (Sibrikov Valery; Don_Mingo; Gilmanshin; Vitalii Gaidukov; beadrobin)
SH · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28124-3V002
www.blanvalet.de
Der echten Red gewidmet – multitalentierte Künstlerin, fabelhafte Freundin und eine ständige Quelle der Inspiration –, die auch noch besser aussieht als die Red im vorliegenden Buch
TEIL I
Stets beginnt es mit dem Begehren.
Es ist unser Antrieb, unser Feuer.
Aus dem Caballaria-Kodex
KAPITEL 1
Senzatown
Neunzehn Jahre zuvor
Ritterrekrutin Lillath o’Senzatown bohrt den Fuß in den Kies, sodass sich die Steinchen um ihre Ferse auftürmen.
Das leise Knirschen wird von dem dumpfen Summen des verfallenen Gebäudes übertönt, das hinter ihr aufragt. Darin befindet sich eine Relaisstation, ein brodelndes Energiemonster, eingekerkert in dickem Gestein. Von ihnen gibt es Hunderte in kleinen Einöden wie dieser hier, kreuz und quer über ganz London verteilt.
Lillaths schlanke Wade spannt sich an, als sie ihr Gewicht verlagert und den anderen Fuß wie in Zeitlupe zentimeterweise anhebt. Neben ihr steht Lucan, ebenfalls Ritterrekrut. Er hat die Arme vor der Brust verschränkt und das Gesicht in mahnende Falten gelegt. Vor den beiden wiederum steht ein Stuhl, auf dem sich ihr bester Freund Art fläzt, der von dem, was er sieht, belustigt zu sein scheint.
»Was soll das denn werden?«, fragt er. »Du siehst aus, als würdest du unter Wasser kämpfen.«
»Was eigentlich sogar die beste Trainingsmethode ist.« Lucan hebt belehrend den Finger. »Unser Ausbilder lässt uns diese Abläufe jeden Morgen im Salzwasserpool durchgehen, immer und immer wieder. Hinterher brennen meine Muskeln noch stundenlang.« Er wendet sich wieder Lillath zu, die mit erhobenem Bein stehen geblieben ist und in der Schieflage das Gleichgewicht hält. »Runter und nach vorne, Gewicht auf dem vorderen Bein, der rechte Arm beschreibt einen weiten Bogen, Handballen durchgedrückt.«
»Du klingst, als hättest du das Handbuch gefressen«, zischt Lillath, während ihre Gliedmaßen Lucans Anweisungen folgen, weiterhin so träge, als kämpften sie sich durch Sirup.
Lucan ignoriert den Kommentar. Er hat ein überragendes Gedächtnis. Vermutlich hat er das Handbuch einmal komplett gelesen und blättert nun in seiner Erinnerung, als wäre es tatsächlich auf einem Regal in seinem Gehirn abgelegt.
Art zieht an seinem Sicalo und stößt eine bläulich schimmernde Rauchwolke aus, während er seinen Freunden zusieht, deren Silhouetten sich scharf umrissen vor dem grauen Hintergrund aus Stein und Beton abzeichnen. Eine seiner Lehrkräfte merkte einmal an, dass er es offenbar vorziehe, sich mit Kuriositäten zu umgeben statt mit nützlichen Verbündeten. Dieser Feststellung haftete eine gehörige Portion Missbilligung an, doch Art beschloss sofort, es als Kompliment zu betrachten. Seiner Meinung nach sind seine Freunde nämlich ziemlich eindrucksvoll.
Lillath verfügt über die Art von Selbstvertrauen, von der die meisten nur träumen können, gepaart mit ausreichend Charme, um ihm die Schärfe zu nehmen. Zu ihren herausragendsten Eigenschaften gehört die Fähigkeit, stets zu wissen, was andere denken, und ihr Umfeld in einem Maße zur Ehrlichkeit zu zwingen, das zugleich anstrengend und bewundernswert ist.
Lucans strebsame Gelehrigkeit bestimmt auch die Art, wie er das Leben anpackt. Meist wird er wegen seiner geringen Körpergröße und seines unaufdringlichen Wesens von anderen unterschätzt, dabei ist er seinen Mitmenschen gewöhnlich ein bis zwei Schritte voraus. Zwar ist er in einigen Dingen recht speziell, doch das ist ein kleiner Preis, wenn man bedenkt, wie viel Talent er dieser Welt zu geben hat.
»Wenn ihr so weitermacht, zieht sich eure kleine Demonstration bis nach dem Nachtmahl«, stellt Art nun fest. »Dann werdet ihr wegen der Verspätung ausgepeitscht, und ich darf mir einen bissigen Kommentar von Hektor anhören. Ihr wisst ja, wie er sein kann.«
Lucan runzelt irritiert die Stirn. »Also, zunächst einmal – ›ausgepeitscht‹? Es ist eine Caballaria-Kaderschmiede, kein Gefängnis. Da wird niemand ausgepeitscht.«
»Echt nicht? Nicht einmal ein kleiner Schlag mit dem Übungsschwert, um euch zu lehren, wo euer Platz ist?«
Nun wirft Lucan ihm einen gereizten Blick zu. »Unser Ausbilder ist Si Vergo, Art. Erinnerst du dich etwa nicht an Vergo den Wagemutigen? Unglaublich berühmter Ritter? Ein wahrhaft großer Mann …«
»Selbst den größten Männern unterlaufen hin und wieder Fehler.«
Art beobachtet, wie seine Freunde innehalten. Er weiß, was sie jetzt denken, kann es ihnen am Gesicht ablesen. Für einen Moment glaubt er quasi zu sehen, wie in beiden Köpfen derselbe Gedanke entsteht, der ihn automatisch ausschließt.
Muss schön sein, sich nicht allein zu fühlen.
»Es ist ja nicht so, dass wir direkt für ihn arbeiten«, wiegelt Lillath dann ab.
Mit einem humorlosen Lächeln stellt Art fest: »Ihr lasst euch zu Rittern ausbilden. Und alle Ritter dienen dem König.«
»Die Ritter dienen in erster Linie London, dann erst dem König.«
»Das macht keinen Unterschied. Der König ist London, London ist der König.«
So geht es hin und her, aber die Worte haben inzwischen ihre Bedeutung verloren. Diese Diskussion haben sie schon unzählige Male geführt.
Art wirft den Stummel seines Sicalo weg und rutscht auf seinem Stuhl herum. Er hat ihn auf dem überwucherten Grundstück hinter der Relaisstation gefunden, das zu einer Müllhalde verkommen ist, zusammen mit drei anderen, die ebenfalls zum Set gehörten. Es sind teure Möbel aus aufwendig gedrechseltem Holz, aber ein Bein weist eine deutliche Kerbe auf, die wohl für Missfallen gesorgt hat, sodass alle vier entsorgt wurden. Sicher wurde bereits einen Tag später ein neues Set angeschafft. Und die von Makeln behafteten Stühle wurden hier zurückgelassen, bei alldem anderen unerwünschten Schrott.
Er weiß genau, wie sie sich fühlen.
Als nordwestlichster der sieben Bezirke, aus denen sich der ausgedehnte Stadtstaat London zusammensetzt, ist Senzatown für Art von seinem heimatlichen Landsitz aus am leichtesten zu erreichen. Er trifft sich nicht oft mit seinen Freunden, aber wenn es geschieht, kommen sie immer auf dieser kleinen Müllhalde hier zusammen. Vor etwa einem Jahr haben sie den Ort auf einem ihrer Streifzüge entdeckt, sofort erkannt, dass er nicht gesichert war, und ihn deshalb zu ihrem Territorium erklärt. In den verwilderten Ecken von London sind die Sicherheitsvorkehrungen eher dürftig.
Sollte Arts Vormund Si Hektor herausfinden, dass er seine Freizeit auf einem Schrottplatz in der Stadt verbringt, würde er vermutlich in aller Stille eine Herzattacke bekommen und anschließend damit drohen, Art für immer und ewig auf dem Land wegzusperren – ein Höllenszenario, das er nicht riskieren möchte. Im Prinzip hat er ja nichts gegen das Landleben, wenn es nur nicht so unglaublich öde wäre. Für seinen Geschmack ist die Natur einfach zu hübsch und idyllisch, während karge, schroffe Gegenden wie diese eine finstere, grimmige Schönheit in sich bergen, die sein Herz berührt. Hier arbeiten sich nur die zähesten Stadtpflanzen als dürre Gräser durch die Risse im Beton. Es herrscht Einsamkeit, ja, aber auch eine Unbezwingbarkeit, die er bewundert. Relaisstationen mögen vielleicht kein schöner Anblick sein, aber in ihrem Inneren bergen sie eine wichtige Funktion: Sie sind pulsierende Hüter des Lebensfunkens, der das Dasein aller anderen sichert.
Dies sind die verwunschenen Ecken der Stadt, oft eingenommen von den Lagern der Obdachlosen, improvisierten Zeltstädten zwischen Häusern, deren bröckelnde Überreste nach dem letzten Bürgerkrieg nie instand gesetzt wurden. Das Revier der Straßenköter, also der vielen Waisen, die keines der wenigen Herbergsbetten ergattern können, welche der Bezirk mühsam zusammengekratzt hat. Hier halten sie sich notdürftig über Wasser, indem sie die Achtlosen ausnehmen.
Ja, Art weiß um die Risiken, und er weiß auch, was Hektor davon halten würde, aber an diesem Ort kennt wenigstens keiner sein Gesicht. Außerdem kommt er ja nie allein hierher. Er hat schließlich seine Freunde.
Ein lautes Scheppern unterbricht die Trainingseinheit. Der Maschendrahtzaun, der ihr (zumindest für diesen Nachmittag) privates Königreich umgibt, meldet sich wie eine metallische Alarmanlage zu Wort. Lillath und Lucan halten inne und suchen automatisch nach der Ursache des Geräuschs, doch Art rührt sich nicht.
Später wird er jede Sekunde und jeden Gedanken dieses Tages durchgehen, jeden Moment, der sich in seinem Gehirn eingebrannt hat, und er wird sich darüber wundern. Warum er sich nicht umgedreht hat. Warum er nicht einmal aufgeblickt hat.
Hast du es irgendwie geahnt? Es gespürt?
»Hey-ho!«, ruft Lucan. »Du kommst unverzeihlich spät, Garad.«
Das vierte Mitglied ihrer Clique, das eigentlich schon vor einer Stunde hätte eintreffen sollen, stürmt durch das schäbige Tor im Zaun und kommt mit hochrotem Kopf vor ihnen zum Stehen. Die keuchenden Atemzüge übertönen sogar das Summen der Relaisstation.
Garad ist das menschliche Pendant einer mächtigen Raubkatze, gut einen Kopf größer als der Rest der Gruppe. Schon mit sechzehn ein brillanter Kämpfender, ist es xieses innigster Wunsch, der Caballaria beizutreten, um in der Arena für Gerechtigkeit, Ruhm und Ehre einzutreten. Die meisten hoffnungsvollen Anwärter scheitern an der brutalen Ausbildung, aber in der Gruppe herrscht die stillschweigende Überzeugung vor, dass Garad von ihnen allen die größten Chancen hat, es zum Ritter zu schaffen.
»Bin … den ganzen … Weg … gerannt«, presst xier mühsam hervor. »Sie sind … direkt … hinter mir.«
Im nächsten Moment geschieht etwas, das Arts Herz für einen Schlag aussetzen lässt.
Garad sinkt vor seinem Stuhl auf ein Knie.
»Was soll das, du Bauer?«, fragt Lucan verblüfft.
Art weiß, was es bedeutet, doch in seiner Brust hat sich ein so drückender Knoten gebildet, dass ihm die Stimme versagt.
»Art«, beginnt Garad, hält dann aber inne. »Sire …«
Ein lautes Dröhnen übertönt alles, was da vielleicht noch kommt. Hinter dem Maschendrahtzaun wird der Kies von zwei riesigen Motorrädern aufgewühlt. Es sind protzige Maschinen mit glänzendem Lack, deren Motoren ein extralautes Röhren verpasst wurde anstelle eines leisen Schnurrens. Sie dienen vor allem zeremoniellen Zwecken, bei denen die Fahrer sowohl gesehen als auch gehört werden wollen.
Diese beiden Fahrer schieben nun die Ständer heraus, gleiten von ihren Sätteln und treten durch das Maschendrahttor, das sanft vibriert, als sie es hinter sich schließen. Beide sind komplett in Schwarz gekleidet, nur an den Schultern ihrer Lederkluft prangt das Emblem des silbernen Schwertes – nicht sonderlich groß, dadurch aber noch eindrucksvoller. Wem das allein als Abschreckung nicht ausreicht (was eher unwahrscheinlich ist, denn wer der königlichen Garde in die Quere kommt, riskiert seine sofortige Hinrichtung), der lässt sich dann von den schweren Waffen an ihren Gürteln überzeugen.
Die beiden heben die Arme und nehmen die Helme ab. Darunter kommen die verschwitzten Gesichter eines Mannes und einer Frau zum Vorschein, die Art noch nie in seinem Leben gesehen hat. An der Hüfte der Frau hängt eine leicht gebogene elfenbeinfarbene Schwertscheide.
»Dein Vater …«, zischt Garad und erhebt sich eilig, als die beiden Fahrer auf die Gruppe zukommen. »Er ist …«
»Tot.« Mit Mühe presst Art seinen protestierenden Stimmbändern das eine Wort ab.
Lucan schnappt nach Luft.
»Ach du Scheiße«, flüstert Lillath.
»Artorias Dracones«, ruft der Mann, als er nahe genug herangekommen ist. Mit einem schnellen Blick mustert er Arts Freunde, muss dabei allerdings kurz den Kopf heben, um Garad in ganzer Größe zu erfassen.
Art sitzt wie festgewachsen auf seinem Stuhl. Ist mit ihm verschmolzen, eins geworden.
»Ja«, sagt er schließlich. Ganz ruhig klingt seine Stimme. Später wird er dafür dankbar sein. Später wird sich das zu einer Gabe entwickeln, auf die er sich oft verlassen wird: dass er rein äußerlich selbst unter größter Anspannung noch vollkommen gelassen wirkt.
Wie zuvor Garad sinken die beiden Motorradfahrer auf ein Knie.
Die Frau löst mit gesenktem Kopf die Schwertscheide vom Gürtel und zieht eine schmale Klinge daraus hervor – eine vor allem auf das Aussehen abzielende Waffe, dafür gemacht, an einer überladenen Wand in einem Palast zu hängen. Hier, im grellen, kalten Licht einer namenlosen Müllhalde am Stadtrand, wirkt sie protzig und aufdringlich.
»Ihr Vater«, beginnt die Frau förmlich, »wurde von Marvol in seine wartenden Arme geschlossen und reicht nun die Bürde seines Lebenswerks an Sie weiter.« Sie unterbricht sich kurz, dann fragt sie: »Nehmen Sie die Aufgabe an?«
Marvol, der Heilige des Todes.
Sein Leben lang hat diese grauenvolle Möglichkeit in der Dunkelheit gelauert, ist mitten in der Nacht hervorgekrochen, um sich brennend in Arts Innerem festzubeißen. Und doch hätte es nicht geschehen dürfen. Sein Vater ist – war – ein starker, gesunder Mann. Und er hat – hatte – in Lady Orcade eine junge Ehefrau. Er hätte nicht sterben sollen, bevor sie ihm einen Erben schenken konnte. Immerhin war das Sinn und Zweck ihrer Ehe.
Art ist das Produkt einer skandalösen Verbindung, illegitim gezeugt. Zwar trägt er daran keinerlei Schuld, doch diese Schande verfolgt ihn bereits seit seiner Geburt, hat seine Seele befleckt, noch bevor er auch nur die geringste Chance hatte, sich reinzuwaschen. Eigentlich sollte es gar nicht möglich sein, dass er die Nachfolge seines Vaters antritt. Und doch ist dieses unfassbare Szenario nun eingetreten, kniet sozusagen hier vor ihm auf der Erde.
Er könnte ablehnen. Könnte ihnen sagen, sie sollen ihr Glitzerschwert im nächsten Wasserkraftwerk versenken, wo der grelle Glanz von den Fluten des dreckigen Sees weggefressen wird. Unglücklicherweise gibt es aber keinen anderen Weg, den er wählen könnte. Er ist reich, er wird beschützt, aber die schwindelerregende Furcht der Entscheidung ist ihm völlig neu, und er hat keine Ahnung, welche Richtung er sonst einschlagen könnte.
Und so wird der siebzehnjährige Artorias Dracones in einem ausgemusterten Stuhl auf einer kleinen Müllhalde am Rande der Stadt, umgeben vom Summen einer alten Relaisstation und dem moderigen Geruch der Möbel zum neuen König von London.
Worüber er ganz und gar nicht glücklich ist.
KAPITEL 2
Caballaria-Arena, Rhyfentown
Ein Jahr zuvor
Der Herausforderer verbirgt sein Gesicht hinter einer schwarzen Vollgesichtsmaske, aus der ein schmaler Streifen für die Augen herausgerissen wurde und ein zweiter für den Mund.
Seine Knöchel sind mit Panzerband geschützt, das sich eng gewickelt bis zu den Handgelenken zieht. Der schmale Körper steckt in einem schäbigen, viel zu weiten Pullover, dessen Halsausschnitt so breit ist, dass die Schlüsselbeine daraus hervorlugen. Dazu eine einfache schwarze Hose. Die schweren Stiefel mögen in Sachen Tempo eher ein Hindernis sein, verleihen einem Tritt ins Gesicht dafür aber zusätzliche Wucht.
Insgesamt also ein billiges, zusammengeschustertes Outfit, aber unter den Herausforderern findet man so ziemlich alles: Manche werden von ihren reichen Familien bereits wie Rockstars ausstaffiert, andere kommen direkt von der Straße und sind verzweifelt genug, um eine Tracht Prügel zu riskieren, wenn sie dafür ein paar Nächte in einem der Ställe unterkommen können, und sei es nur in der vierten Liga. Viele von ihnen halten sich für eine große Nummer. Die meisten haben eine Scheißangst.
Dieser hier eher nicht. Kein erkennbares Zittern, sicherer Gang. Wer sich dem einfachen Bildschirm zuwendet, auf dem die Daten der Kämpfenden angezeigt werden, findet dort den Namen »Red«. Einfach nur Red. Keine Angaben zu Familie oder Bezirk, also muss es sich um eine Waise handeln, einen Straßenköter. Ein Straßenköter, dem keinerlei Furcht anzumerken ist, auch wenn sie sicherlich in seinem Inneren gärt. Ein vielversprechendes Zeichen. Es beweist, dass er ein guter Schauspieler ist, und Showtalent ist die halbe Miete, wenn man ein Ritter der Caballaria werden will.
Normalerweise müsste die Arena gerade mal halb voll sein, die Plätze nur von den fanatischen Fans besetzt, die zu jedem lokalen Kampf erscheinen, egal bei welchem Wetter. Heute aber ist das Stadion überfüllt, denn es ist ein besonderer Tag. Eigentlich sollte niemand wissen, dass es so ist, aber irgendwie ist etwas durchgesickert, und die Information hat sich in den Kneipen der Gegend verbreitet, hat schneller die Runde gemacht als Freibier.
Und nun drängen sich die Menschen ächzend und grölend auf den Rängen, nur notdürftig durch eine löchrige Plane vor dem Nieselregen geschützt. Landet ein Herausforderer im Dreck, zucken sie alle zusammen, doch die Reaktion ist von Gier geprägt, von Aufregung, von finsterem Vergnügen. Mag sein, dass sie zucken, doch dabei grinsen sie erwartungsvoll.
Auch die Scouts sind dort oben, immer auf der Suche nach neuen Talenten für die Stallbesitzer. Die führenden Ställe lassen sich bei kleinen Bezirkskämpfen wie diesem meist von jungen, unerfahrenen Scouts vertreten, die von der Hoffnung getrieben werden, hier eine große Entdeckung zu machen.
Sie tummeln sich in der VIP-Box zwischen blickdichten Wänden und mit bestem Blick auf die Arena, schlürfen billigen Whisky, der wie heißes Motoröl schmeckt, und kaufen die Gewinner der einzelnen Kämpfe ein. Manchmal auch die Verlierer, wenn das Budget klein ist und sie Potenzial zu erkennen glauben. Ja, immer ist die Hoffnung da, einen Funken Talent zu sehen, aus dem man mit etwas Training mehr herausholen könnte. Sollte dem nicht so sein, stehen die Kandidaten nach zwei Wochen wieder auf der Straße. Manche Ställe bieten eine längere Probezeit an, aber es sind nur sehr wenige.
Der aktuelle Herausforderer marschiert in der Kälte auf und ab und wartet darauf, dass sein Gegner seinen großen Auftritt hinlegt. Der Auftritt ist immer wichtig, selbst in einem Hinterwäldlerstadion wie diesem, was der Hexenritter wohl besser weiß als jeder andere.
Er ist der Grund dafür, dass sich vor der Arena all jene halb tot quetschen, die keine Tickets mehr bekommen haben, und nicht einmal vor dem Zorn der Security zurückschrecken, nur um einen Blick auf den berühmtesten Ritter von ganz London – wenn nicht sogar der Sieben Königreiche – zu erhaschen. Seinetwegen sind restlos alle Plätze in der Arena besetzt, sogar die nicht überdachten, auf denen man sofort nass wird, wenn es regnet. Karten für die großen, wichtigen Turniere, in denen er normalerweise kämpft, können sich die Menschen hier nicht leisten. Die müssen sie sich wie alle anderen auch in der örtlichen Kneipe auf dem Leuchtschirm ansehen, grölend und fluchend, während sie den Buchmachern ihre Lektrimünzen in den Rachen werfen.
In der Vorberichterstattung zu den großen Kämpfen reiten sie jedes Mal auf dieser Frage herum: Warum tritt der Hexenritter immer wieder bei durchschnittlichen Anfängerturnieren in Erscheinung? Manche behaupten, es geschehe aus Langeweile. Schließlich muss es doch irgendwann öde werden, zu wissen, dass man nicht geschlagen werden kann. Vielleicht also sucht er auf diesem Weg nach einem Überraschungsmoment. Andere sagen, er habe es sich mit seinem Stall verscherzt, und das sei Teil seiner Bestrafung: Er werde tageweise herabgestuft und zu Kämpfen geschickt, die für ihn nicht mehr Niveau haben als der Dreck unter seinen Stiefeln.
Nichts davon trifft zu. In Wahrheit tritt er bei Kämpfen in solchen Arenen an, weil er auf der Suche nach seinesgleichen ist. Das ist ein offenes Geheimnis. Ein Gerücht, das nie offiziell bestätigt wurde und doch allgemein bekannt ist.
Mit einem Knall öffnen sich die Türen am Ende der Arena. Aus der Menge erhebt sich Gebrüll, unzählige Stimmen schwellen in lautem Crescendo an, sind noch in einer Meile Entfernung zu hören. Schon zweimal haben sie ihn heute kämpfen sehen, kriegen aber nie genug davon. Und er ebenso wenig, wie es scheint.
Der Herausforderer mit dem Namen Red bleibt abwartend stehen. Vollkommen reglos sieht er zu, wie das prachtvolle Monster auf ihn zukommt.
Der Hexenritter. Die Geißel der Gottlosen. Londons linke Hand. Er hat viele Namen, alle wohlverdient. Trotz des kühlen Herbstwetters trägt er lediglich eine Hose, seine bronzefarbene Haut glänzt vom Regen. Die weichen Stiefel, die so gar keine Ähnlichkeit mit dem klobigen Schuhwerk seines Herausforderers haben, sind aus den feinsten Materialien gefertigt – leicht, absolut wasserdicht und mit winzigen, haarfeinen Klingen bestückt, die seine Tritte umso tödlicher machen. Die besten Waffenschmiede Londons überschlagen sich, um diesem Mann ihre Künste anzubieten. Tritt er bei großen, prunkvollen Disputkämpfen auf, die Millionen zum Zuschauen locken, erscheinen ihre Namen auf den Leuchtschirmen, und die Schmiede können in ihren Läden damit werben, dass ihre Ware von ihm getragen wird. So verdienen sie durch seinen Ruhm eine Menge Lektris.
Als die beiden sich einander nähern, wird deutlich, dass der Herausforderer nicht gerade klein ist – zumindest groß genug, um im Gegensatz zu den meisten anderen neben diesem Mann nicht wie ein kleinwüchsiges Gör zu wirken. Allerdings ist er eindeutig zu schmal, um dem breiten, unüberwindlichen Muskelberg viel entgegenzusetzen, der mit gelassenen Schritten auf ihn zukommt.
Sie bleiben stehen, sehen sich an. Hier gibt es keine schicke Lichtshow, keine Auftrittsmusik – so etwas wird nicht an Kämpfe verschwendet, die es nicht einmal auf die Schirme schaffen. Ein elektronischer Pfiff ertönt in den blechern klingenden Lautsprechern der Arena, und das war’s.
Der Kampf beginnt.
Anfangs bleiben sie vorsichtig. Das Gebrüll der Menge verebbt, während sie sich langsam umkreisen. Dieser Herausforderer ist kein Angeber, und der Hexenritter lässt ihm jede Möglichkeit, zu glänzen, um sich bei diesem Ungleichgewicht der Kräfte fair zu verhalten. Bei einem echten Kampf, wo viel auf dem Spiel steht, könnte die Sache bereits gelaufen sein.
Dann prallen sie aufeinander.
Überraschenderweise steht der Herausforderer noch, zieht sich wachsam zurück. Doch als sie erneut aufeinander losgehen, wittert das Biest von Publikum, dass es bald vorbei sein wird. Unruhe macht sich breit, es raschelt, die Menge regt sich, raunt. Dieser Herausforderer ist nicht schlecht genug, um Unterhaltung zu bieten, und nicht gut genug, um interessant zu sein.
Es sei denn, man weiß, worauf man achten muss.
Wieder prallen die Kontrahenten aufeinander, und mit jedem Mal hat es weniger den Anschein, als würde der Herausforderer zu Boden gehen. Es dauert gute drei Minuten, bis die Menge erkennt, was da vorgeht.
Die beiden testen sich gegenseitig.
Wieder breitet sich Stille aus. Sämtliche Blicke sind auf das Paar in der Arena gerichtet, sämtliche Münder fest geschlossen.
Und dann, einfach so, endet der Eröffnungstanz.
Jetzt legen sie richtig los. Der Herausforderer ist schnell, und – verdammt noch mal, staunt das Publikum – er ist gut. Wie ein Staubteufel wirbelt er über den mit einer Sandschicht bedeckten Betonboden des Kampfplatzes. Noch nie hat ein Herausforderer in einem Kampf dieser Klasse so lange gegen den Hexenritter bestanden. Er zeigt ein paar ungewöhnliche Moves, merkwürdige Drehungen und elegante Rutschmanöver. Aufregung macht sich breit. Sollte es etwa ausgerechnet diesem Straßenköter gelingen, den Unbesiegbaren …?
Nein.
Der Hexenritter landet einen so schnellen und brutalen Treffer, dass der Herausforderer bereits an der gegenüberliegenden Wand klebt, noch bevor die Bewegung ganz abgeschlossen zu sein scheint. Normalerweise reicht ein solcher Schlag aus, um den Gegner auszuschalten, aber dieser kämpft sich wieder auf die Beine. Der Hexenritter packt ihn an der Kehle, um ihn zu fixieren.
Gib auf, denkt die Menge.
Es ist nicht vorgesehen, dass in der Arena jemand stirbt. Der Stallbesitzer sieht sich einem zermürbenden, schmerzhaften Chaos rechtlicher und finanzieller Art gegenüber, wenn sein Ritter einen Gegner tötet, vor allem bei Turnieren, die in die ganze Welt übertragen werden. In manchen Fällen wird der Ritter zur Strafe sogar komplett vor die Tür gesetzt. In Kämpfen wie heute, ohne Leuchtschirmübertragung, würde man dem Ritter zumindest einige hohe Bußgelder auferlegen und seine Karriere könnte dadurch ruiniert werden.
Trotzdem kommt es hin und wieder vor. In der Hitze des Gefechts lässt sich oft nicht so einfach sagen, ob man den Gegner nur für den Moment oder für immer ausgeschaltet hat.
Der Herausforderer kämpft weiter. Er reißt das Bein hoch und rammt dem Hexenritter mehrmals das Knie in die Seite. Ohne erkennbare Wirkung. Nach und nach verliert er an Kraft, stemmt eine Hand gegen die Brust des Hexenritters. Nun, da das Ende abzusehen ist, geht ein zufriedenes Raunen durch die Menge.
Dann bewegt sich plötzlich der Spalt in der Maske des Herausforderers und zwischen seinen Lippen dringt …
… etwas hervor.
Seine Hand ballt sich zur Faust, aus seinem Mund dringen Laute, die allerdings im Lärm der Menge untergehen. Doch was dann geschieht, muss nicht erklärt werden. Der Hexenritter taumelt rückwärts, als hätte man ihm einen heftigen Stoß versetzt, er stolpert und fällt nach hinten, fängt sich im letzten Moment mit den Händen ab. Dabei hat der Herausforderer ihn gar nicht berührt.
Es dauert ein paar Sekunden, bis die Menge das verarbeitet hat, und letztendlich wird sie nur von einem feuchten, kalten Luftstrom gestreift. Trotzdem ist es unverkennbar.
Magie.
Die gesamte Arena ist wie erstarrt.
In der drückenden Stille stemmt sich der Hexenritter hoch, geht mit großen Schritten auf seinen Herausforderer zu und zieht ihm die Maske vom Gesicht.
Lange schwarze Haare quellen darunter hervor, fallen dem Mädchen über die Schultern. Im Bewerbungsformular steht, sie sei zwanzig Jahre alt, was ihr aber kaum anzusehen ist. Ihre Haut hat einen hellen, warmen Braunton, ihre Augen funkeln wie schwarze Münzen in dem schmalen Gesicht, das mit dem richtigen Make-up auf jedem Leuchtschirm gut rüberkäme. Anmutig ist sie und talentiert sowieso. Insgesamt hat sie alles, was sich die Caballaria von Kämpferinnen und Kämpfern wünschen kann.
Bis auf die Magie natürlich.
Dieses Mädchen spielt ein gefährliches Spiel, was ihm offenbar bewusst ist. Nun sieht man ihre Angst, für einen Moment zittert sie, bevor sie trotzig das Kinn reckt. Sie hebt die Hand, als wollte sie wieder angreifen, schafft es aber nicht ganz, denn der Hexenritter zieht ein Messer aus der Scheide an seinem Bein und rammt es ihr in die Schulter. Sanft wie ein Liebhaber beugt er sich über sie, treibt die Klinge immer tiefer in ihr Fleisch und presst sie gegen die raue Betonmauer. Die Herausforderin stößt einen kehligen, wütenden Schrei aus.
Nun wendet sich der Hexenritter ab und dreht sich zu der Loge um, in der die Scouts sitzen.
»Magie«, ruft er der Gruppe zu, die sich in den Tiefen der Box verbirgt. »Ihr habt es gesehen.«
Keine Reaktion.
Da ertönt irgendwo in der Dunkelheit eine Stimme, die an ein tuckerndes, hustendes Motorrad denken lässt. »Ich wusste nicht, dass sie eine Gottgleiche ist.«
Diese unverkennbare Stimme gehört Faraday, einem der ältesten Caballaria-Scouts überhaupt. Nur wer einen Platz in der Nähe der Box hat, wird sie bemerkt haben, doch die Erkenntnis verbreitet sich wie ein Lauffeuer im gesamten Publikum.
Die schlaueren Fans werden nun begreifen, dass dieses Event nie als gewöhnlicher Herausfordererkampf gedacht war. Der berühmteste Ritter und einer der bekanntesten Scouts von London sollen rein zufällig im selben Provinznest aufeinandertreffen?
Faraday hätte unter den reichsten Ställen die freie Auswahl gehabt, aber er scheint es vorzuziehen, im dreckigen Straßenmilieu zu arbeiten. In einem seiner seltenen Interviews sagte er einmal, es sei viel spannender, außerhalb der Stadt nach verborgenen Talenten zu suchen. Ursprünglich aus einem der sittsamen, sauberen Königreiche des Nordens stammend, hat es ihn schon in jungen Jahren nach London verschlagen. Die boshafteren Kommentatoren bringen gerne diese Abstammung ins Spiel, wenn eines seiner Talente in einem Kampf versagt.
Tja, wer aus einem Drecksloch kommt, kann wohl auch nur Dreck rekrutieren, nicht wahr?, witzeln sie dann.
»Sie gehört mir«, verkündet der Hexenritter nun.
In der Box regt sich Protest, der aber durch seinen unnachgiebigen Blick schnell zum Schweigen gebracht wird.
»Schön«, antwortet Faraday schließlich mit seiner knarrenden Stimme. »Verkauft.«
Faraday hat den Auftritt der Gottgleichen in der Arena finanziert, also darf er das Mädchen auch verkaufen.
Wieder melden die anderen Scouts ihren Protest an.
»Das kannst du nicht machen!«
»Es gibt Regeln!«
»Steht alles im Kodex der Caballaria!«
»Scheiß auf den Kodex«, erwidert der Hexenritter.
Eine solche Blasphemie wiegt schwer. Er ist bekannt dafür, dass er sich nicht immer ans Protokoll hält – unter anderem deswegen ist er so beliebt –, aber das könnte ihn einige Sympathien kosten.
Die Herausforderin versucht, möglichst keinen Mucks von sich zu geben, trotzdem hallen ihre keuchenden Atemzüge durch die Arena. Das Messer steckt noch immer in ihrer Schulter. Im Publikum rührt sich nichts, da niemand auch nur ein Wort des aufkeimenden Disputs verpassen will.
»Eine Gottgleiche, das ist illegal!«, empört sich einer der Scouts. »Sie sollte festgenommen werden.«
Die Menge am Rande der Box bemerkt den Fehler, noch bevor er dem Sprecher bewusst wird. Einige schnappen hörbar nach Luft.
»Mir war nicht klar, dass schon die Existenz von Gottgleichen einen Gesetzesverstoß darstellt«, erwidert der Hexenritter ausdruckslos.
Der Scout windet sich, doch niemand kommt ihm zu Hilfe.
»Nicht weil sie eine Gottgleiche ist, das selbstverständlich nicht, aber dass sie Magie gewirkt hat … So lautet nun einmal das Gesetz. Es ist … das Gesetz.«
Eine kalte Stimme schaltet sich ein: »Würde vielleicht jemand das Mädchen wegsperren, damit wir hier weitermachen können?«
»Sie wird nicht verhaftet«, bestimmt der Hexenritter. »Sie ist noch minderjährig, was bedeutet, dass ihr magischer Verstoß allein meine Person betrifft, und ich habe nicht vor, einen Disput zu eröffnen. Mein Interesse liegt einzig und allein darin, als Sponsor für ihre Ausbildung zu fungieren.«
Stille.
»Ein Kämpfer kann nicht als Sponsor für einen anderen Kämpfer fungieren«, erwidert die kalte Stimme schließlich.
»Der Besitzer meines Stalles wird das in meinem Namen regeln.«
Der Besitzer meines Stalles, sagt er, als ob nicht jeder in den Sieben Königreichen wüsste, für wen der Hexenritter in der Arena antritt.
»Gibt es noch andere Gebote?«, fragt Faraday.
Diesmal dringt kein Laut aus der Box. Sie alle fürchten sich vor dem Hexenritter und der Macht, über die er verfügt. Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde gegen ihn bieten.
»Wir werden das beim Seneschall deines Stallbesitzers verifizieren müssen«, erklärt die kalte Stimme.
»Dann tut das«, erwidert der Hexenritter gelangweilt. »Doch in der Zwischenzeit sollte jemand etwas dagegen tun, dass die Herausforderin hier unten verblutet. Beschädigte Ware ist für mich uninteressant.«
Damit dreht er sich zu dem keuchenden Mädchen um. Inzwischen scheint sie nur noch durch das Messer in ihrer Schulter auf den Beinen gehalten zu werden, das unverrückbar in der Mauer hinter ihr steckt. Voller Verbitterung verzieht sie die Lippen, dann räuspert sie sich hörbar und spuckt vor ihm aus.
Diesmal ist das Schweigen der Menge von ehrfurchtsvollem Entsetzen geprägt.
Einen schier endlosen Moment lang sieht der Hexenritter das Mädchen wortlos an. Das Publikum hält den Atem an, doch er wendet sich wortlos ab und verschwindet hinter der Tür, durch die er gekommen ist.
Nun schwärmen die Ärzte aus und umringen das Mädchen, dessen Gesicht sich eindeutig grau verfärbt hat. Auf den Rängen renken sich die Menschen beinahe die Hälse aus. Die Messerspitze steckt genau zwischen zwei Steinen fest. Auch wenn es möglicherweise nicht gut ist, die Kämpferin zu bewegen, bleibt ihnen keine andere Wahl. Einer der Ärzte tippt mit den Fingerspitzen kurz gegen den Messergriff, allerdings ist diese Vorsicht wohl eher der Furcht geschuldet, die jeden erfasst, der etwas berührt, was dem Hexenritter gehört – verflucht oder gesegnet, man ist sich nie ganz einig, woran man noch glauben soll. Doch selbst diese kurze Erschütterung lässt das Mädchen gequält zusammenzucken. Ihr Gesicht ist von einem feinen Schweißfilm überzogen.
»Zieht es doch einfach raus!«, ruft jemand im Publikum.
Damit ist die gespannte Stille gebrochen, einfach so. Der Lärmpegel steigt.
»Macht schon.«
»Schneller!«
»Zieht es raus!«
Zieht
es
raus!
Zieht
es
raus!
… skandiert das Biest von Publikum.
Die Ärzte versuchen, das Geschrei zu ignorieren, professionell zu bleiben. Ihre Haltung signalisiert, dass sie wissen, was nun das Beste ist, aber traurigerweise ist das vermutlich nicht der Fall. Wären es die Ärzte eines großen Turniers, läge die Sache anders, sie sind die besten im ganzen Land. Doch die Ärzte einer Kleinstadtarena? Eher nicht.
*
Die Anspannung, die die Menge erfasst hat, erinnert an einen geronnenen Geschmack in deren Mund. Jetzt, wo der Hexenritter Ansprüche angemeldet hat, sind sie plötzlich alle auf der Seite dieses waghalsigen kleinen Straßenköters. Das Mädchen muss wieder auf die Beine kommen. Die Ärzte spüren das. Wenn sie jetzt Mist bauen, ziehen sie sich nicht nur den Unmut des Hexenritters zu, sondern auch – was in London wesentlich schwerer wiegt – den des Publikums.
Letztlich muss einer der Ärzte neben dem Messer den Fuß an die Wand stemmen und die Spitze mit einer dicken Metallschere abschneiden, während zwei seiner Kollegen die Herausforderin festhalten, damit sie sich, falls sie das Bewusstsein verliert, nicht durch ihr eigenes Körpergewicht die halbe Schulter abreißt. Endlose Sekunden vergehen, in denen der Arzt die Scherenklingen zwischen Mauer und Fleisch schiebt und so vorsichtig wie möglich versucht, an die Klinge heranzukommen. Die rauen Schreie des Mädchens hallen durch die Arena.
Dann ist es plötzlich vorbei. Die Herausforderin sackt ohnmächtig zusammen, wird aber von den Ärzten aufgefangen, die sie unter dem gespannten Raunen der Menge auf eine Trage legen.
Red. Nur diesen einen Namen hat sie angegeben, doch bis zum nächsten Morgen wird er in aller Munde sein. Dann wird ganz London diesen Namen kennen.
Sie sollte sich besser darauf gefasst machen.
KAPITEL 3
Blackheart
Neunzehn Jahre zuvor
Kurz nach den Bikern mit dem Glitzerschwert trifft eine ganze Transportflotte aus Cair Lleon ein, dem Londoner Königspalast.
Sie schaffen Art von der Müllhalde weg, hinein in ein Leben, das er niemals wollte. Garad, Lucan und Lillath, seine Freunde, sein Rettungsanker, bleiben zurück. Er ist zu perplex, um zu protestieren, als man ihn in einen schicken schwarzen Geländewagen setzt, zusammen mit den beiden Bikern, die ihm die Nachricht überbracht haben. Schweigend nehmen sie auf der Rückbank Platz.
Benommen sieht Art zu, wie die Welt hinter der getönten Scheibe vorbeigleitet. Grellgrüne und leuchtend blaue Lichtflecke huschen über sein Gesicht, als der Wagen durch die reicheren, schickeren Viertel von Senzatown fährt – die nur zwei Blocks von den ärmsten und verrufensten Ecken entfernt liegen.
Die Straßen sind völlig leer, da sie kurz zuvor von den Rittern geräumt wurden, die auf ihren Motorrädern vor ihnen hergleiten wie ein Schwarm in Leder gekleideter Haie, der einen schwerfälligen Wal eskortiert. Die Nachricht vom Tod des Königs wird zwar erst am Abend bekannt gegeben werden, doch die neugierigen Massen, die bis zu den Schaufensterfronten zurückgedrängt wurden, wissen bereits, dass etwas im Busch ist.
Noch Jahre später werden sie einander erzählen, wo sie an jenem Tag waren. Einige werden sich auch an die Wagenflotte erinnern, werden begreifen, dass sie Zeuge davon wurden, wie er vorbeifuhr. In ihrer Vorstellung wird er aufrecht auf der Rückbank sitzen, mit wissendem Blick der schweren Bürde seines Schicksals entgegensehend, während ihm die eine oder andere Träne über die Wange rollt, da der Tod seines Vaters ein kompliziertes Geflecht aus Gefühlen in ihm bloßgelegt hat. Keiner von ihnen wird je darauf kommen, dass er sich in Wahrheit während der gesamten Fahrt schwitzend in den Ledersitz drückte und verzweifelt versuchte, sich nicht zu übergeben.
Von außen betrachtet hat das vielleicht auch Ähnlichkeit mit einem komplizierten Geflecht aus Gefühlen.
Eine halbe Ewigkeit später erreicht der Wagen den Kontrollpunkt zwischen Senzatown und dem Zellkern des Königreichs London, Blackheart. Die sieben Bezirke des Stadtstaates zweigen von ihm ab wie die Speichen eines großen Wagenrades. Auch hier wurden die Straßen zuvor geräumt, sodass die gesamte Entourage die Grenzkontrollen problemlos passieren kann. Die Wachsoldaten salutieren mehr schlecht als recht.
Nun sind sie in Blackheart. Dem infamen, lauernden Blackheart. Vierundzwanzig Millionen Leben werden von diesem Ort aus gesteuert. In seiner Mitte ragt Cair Lleon mit seinen berühmten Lavasteintürmen auf, die den Himmel in blutige Fetzen schneiden. Heute scheinen sie sich in tödliches Schweigen gehüllt zu haben.
Arts Wagen rollt die endlos lange, leere Zufahrt hinauf, an der sich der weitläufige, aus vielen verschiedenen Gebäuden bestehende Palastkomplex erstreckt. Er hat befürchtet, dass irgendein Gefolge aufmarschiert und steif salutiert, wenn er vorbeifährt. Dass hier nun absolut niemand zu sehen ist, macht alles irgendwie noch gruseliger und trägt kein bisschen dazu bei, die düstere Stimmung zu vertreiben, die ihn inzwischen fest im Griff hat: unerwünscht, unnötig, unnütz. Einfach un.
Du bist ein un-Mensch, Art. Du solltest überhaupt nicht hier sein.
Für einen Moment flackert Hoffnung in ihm auf. Es könnte alles nur ein Scherz sein. Warum sich jemand so etwas ausdenken sollte, begreift er zwar nicht, aber was soll’s. Gleich wird er durch das Palasttor in die weite Vorhalle treten, die er nur von Bildern kennt, denn obwohl er der Sohn des Königs ist, war es ihm nie gestattet, den Palast zu betreten. Die Kälte der Stahlsteinwände wird ihn einhüllen, er wird eine Gänsehaut bekommen. Und dann wird sein Vater dort stehen.
Auslachen wird sein Vater ihn – was für ein Spaß –, auch wenn Art keine Ahnung hat, was daran lustig sein soll, aber egal. Das hier fühlt sich an wie einer dieser Albträume, die einem selbst nach dem Aufwachen noch eine Weile real erscheinen, die das Gehirn mit einem klebrigen Film überziehen, bis man sie endlich abschütteln kann. Bis endlich die Erkenntnis greift, dass es nicht real ist, dass das Leben nun mal nicht so ist, und diese herrliche, allumfassende Erleichterung einsetzt.
Doch für Art gibt es keine Erleichterung.
Die beiden Biker führen ihn über eine Treppe zu dem mächtigen Eingangsportal, das dreimal so groß ist wie er, aus dickem grauem Metall geschmiedet und mit mattem Silberlack überzogen. Hinein bringen sie ihn dann aber durch eine normal große Seitentür, die vom Fuß der Treppe aus nicht zu sehen war. Drinnen erwartet ihn ein finsterer, höhlenartiger Raum – ohne seinen Vater. Das Gefühl, es könnte alles nur ein Scherz sein, verflüchtigt sich.
Es ist niemand da, um ihn zu begrüßen. Durch die hoch oben in die Mauer eingelassenen Fenster dringt nur wenig Licht, und selbst dieses bisschen fühlt sich kalt und leer an. Als wüsste der Palast, dass sein Herr tot ist und dessen Ersatz niemals in der Lage sein wird, seinen Platz auszufüllen.
Art wird durch einen langen Korridor geführt. Die Stiefel seiner beiden Begleiter – Bewacher, Kerkermeister – poltern laut in der drückenden Stille. Schließlich bleiben sie vor einer hölzernen Tür stehen, die sich kein bisschen von jenen unterscheidet, an denen sie bereits vorbeigegangen sind. Man schiebt ihn in ein Zimmer, offenbar einer der vielen kleineren Salons, die in diesem Palast als verschwiegene Warteräume dienen.
Dicke, weiche Teppiche bedecken den Betonboden. Dezent in die Wand eingelassene Projektoren tauchen die Porträts ehemaliger Herrscher in sanftes Licht und mildern die strengen Blicke, mit denen sie die Lebenden aus dem Reich der gemalten Toten mustern. An der hinteren Wand laufen holografische Aufnahmen der wichtigsten Caballaria-Kämpfe der letzten Zeit.
Und dann, ganz plötzlich, taucht sein Vater auf dieser Wand auf.
Uther Dracones, der bärenhafte Krieger, präsentiert seinen von Rhyfen gesegneten Körper, reckt die breite Brust, lässt den Doppelspeer über dem Kopf kreisen. In zwei Bezirkskriegen hat er gekämpft. Hat Leben gerettet und unzählige mehr ausgelöscht. Viele mögen ihn gehasst haben, aber jeder hat ihn gekannt. Furchtlos und laut hat er sein Leben gelebt.
Furchtlos, mal abgesehen von seinen Fehlern. Vor denen scheint er sich immer sehr gefürchtet zu haben. Und der vermutlich größte von ihnen steht nun hier in seinem Palast, um seine Krone zu übernehmen.
Die Aufnahmen verändern sich, der Film läuft weiter. Nun zeigt er Arts Vater als jungen Mann, kurz nach seiner Ernennung zum König des Schwertes. Ein Mann steht neben ihm, im Vergleich zu Uther klein und überkorrekt. Er trägt weiche Lederkleidung, wie sie in Gwanharatown üblich ist, dem Bezirk, aus dem er stammt. Schwarze Streifen zieren die Schultern seiner Jacke, außerdem ist über der Brust ein Aufnäher mit einem silbernen Schwert angebracht, der zeigt, dass er zum Gefolge des Königs gehört.
Mit der Gier eines Aasgeiers zoomt die Kamera an das sanftmütig wirkende Gesicht dieses Mannes heran. Art kennt dieses Gesicht gut, kann seine Züge ebenso blind nachzeichnen wie die seiner Eltern. Es gehört dem verrufensten Londoner, der je Teil des Königshofes war. Sein Name war Edler Feverfew. Ein Gottgleicher. Ohne ihn hätte es Art niemals gegeben.
Die Geschichte, wie Artorias Dracones entstand, beginnt gute siebzehn Jahre zuvor am fünften Abend des Lichterfestes. Es war Teil von Uthers inzwischen berüchtigter Friedenstour, einer einmonatigen Reise durch die Sieben Königreiche, die all ihre Völker mit dem Gurt der Einigkeit umschlingen sollte, nachdem die verheerenden Anschläge kembrischer Separatisten zuvor zahlreiche Todesopfer gefordert hatten.
Die letzte Station der Tour war Kernow, das südwestlichste der Reiche, abgelegen, wunderschön, geprägt von Armut und Stolz. Seine Herrscherin Meraud gehörte zwar der Minderheit der Christen an, war aber tolerant genug, um das Lichterfest der Saith zu feiern wie alle anderen auch.
Am ersten Abend des Festes wurde Uther an ihrem Hof unter anderem dem Laerd Gorlais vorgestellt, einem wichtigen Berater der Königin. Gorlais hatte seine Frau mitgebracht, eine Technologiestrategin von klassischer Schönheit mit dem Namen Ingerna. Jeder, der an diesem Abend dabei war (und viele andere ebenfalls, wie das eben immer so ist), schwor Stein und Bein, dass Uther sie keine Minute aus den Augen ließ.
Sie hingegen wurde nicht von diesem Leiden geplagt.
Angeblich sagte Uther ihr in einem Vieraugengespräch, wie sehr er sie begehre, doch Ingerna erteilte ihm eine Abfuhr. Er drohte ihr. Daraufhin erklärte sie ihm, dass sie das Organ, mit dem er seine aktuellen Denkprozesse vollziehe, mit einem Messer traktieren werde, sollte er sie noch einmal auf diese Weise bedrängen – König und Friedenstour hin oder her. Gorlais sei der einzige Mann, den sie begehre, und nur er könne sie haben.
Was Uther zu dem Entschluss brachte, sie sich eben als Gorlais zu nehmen, wenn er sie als Uther nicht haben konnte.
Auftritt Edler Feverfew. Als mächtigster thwimoren seit hundert Jahren lag Edlers Gabe in der Kunst der Illusion. Wenn er es einem weismachen wollte, hielt man eine Tasse für eine Ratte. Er konnte ganze Gebäude direkt vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer verschwinden lassen. Und er konnte jedem Menschen das Aussehen eines beliebigen anderen verleihen.
Manche sagen, es sei Edlers Idee gewesen, Ingerna zu täuschen. Andere behaupten, Uther sei der Kopf des Ganzen gewesen und habe seinen Hofzauberer zur Mitarbeit gezwungen. Nichts davon änderte etwas am Ergebnis, einer Verschwörung, an der beide beteiligt waren. Was spielte es da noch für eine Rolle, wessen Idee es gewesen war? Edler wirkte seine Magie, um Uther wie Laerd Gorlais aussehen zu lassen. So konnte der sich Zutritt zu Ingernas Schlafzimmer verschaffen, ohne dass jemand Verdacht schöpfte.
Und dann …
Uther liebt es heiß,
sei die Jagd auch schwer und öde
und die Fotze noch so spröde.
Art spürt, wie bittere Galle in seiner Kehle aufsteigt.
Dieses Lied über seine Empfängnis bekam er das erste Mal im Alter von acht zu hören. Es war ein brütend heißer Sommer, und ein entfernter Verwandter seines Vormunds Hektor war zu Besuch, um Geld und Gefälligkeiten zu erbetteln. Die Zwillingssöhne jenes Cousins lockten Art hinaus in die Gärten, während die Erwachsenen im Spielzimmer damit beschäftigt waren, sich zu betrinken. Als ihnen klar wurde, dass Art keinen blassen Schimmer davon hatte, welch schmutzige Gerüchte sich um seine Herkunft rankten, machten sie sich daran, ihm die Geschichte möglichst detailreich zu schildern. Allerdings konnten sie sich nicht an alle zwölf Strophen des Liedes erinnern, weshalb sie den Text fröhlich durch eigene, wesentlich prosaischere Erklärungen ergänzten.
Anscheinend blieb die von Edler geschaffene Illusion während der ganzen Woche erhalten, die Uther am Hof von Kernow verbrachte. Man war sich hinterher nicht ganz einig darüber, ob Ingerna es irgendwann bemerkte und gezwungen werden musste oder ob sie bis zu Uthers Abreise keinerlei Verdacht schöpfte. Jedenfalls wurde sie schwanger und wusste zu diesem Zeitpunkt zumindest, dass es nicht der Spross ihres Mannes war.
Monate später reiste sie nach London, erschien mit dickem Bauch in Cair Lleon und brachte erstaunliche Vorwürfe vor. Uther bezeichnete ihre Geschichte umgehend als lächerliches Lügengespinst, und sie hatte nichts in der Hand, um das Gegenteil zu beweisen. Die Höflinge von Kernow sagten geschlossen aus, sie hätten nie einen anderen Mann als Gorlais bei ihr gesehen. Den letzten, vernichtenden Schlag versetzte ihr dann ihr eigener Ehemann, als er sich auf die Seite des Königs stellte.
Zurückgewiesen, gedemütigt, wütend und einsam verschwand Ingerna aus der Öffentlichkeit und entzog das umstrittenste Kind der Sieben Königreiche den neugierigen Blicken der Welt. Unvorhergesehene medizinische Komplikationen endeten in einer Tragödie, und sie starb kurz nach Artorias’ Geburt.
Erst nach ihrem Tod entschloss sich Edler dazu, mit der Geschichte rauszurücken. Angeblich kam es zwischen ihm und Uther zu erbitterten Streitigkeiten, woraufhin er sich aus Rache an die Medien wandte, Ingernas Geschichte bestätigte und genau darlegte, was Uther ihn zu tun gezwungen habe, um sich einer flüchtigen Liebschaft mit Ingerna hingeben zu können, deren Leben er dadurch ruinierte.
Edlers verblüffende Entscheidung, die beiden auffliegen zu lassen, kam einem Selbstmord gleich. Er wurde verhaftet und des Hochverrats gegen den König von London angeklagt – allerdings nicht der illegalen Anwendung von Magie, da das ja dem Eingeständnis gleichgekommen wäre, dass die Geschichte der Wahrheit entspreche. Man befand ihn für schuldig, und er wurde mit seiner gesamten Familie des Landes verwiesen. Edler verschwand irgendwo jenseits des Kanals und ist Berichten zufolge vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Außer einer hochtrabenden Legende ist nichts von ihm geblieben.
Natürlich wurde Uther durch die Justiz der Caballaria in allen Punkten entlastet, was allerdings kaum noch eine Rolle spielte. Der Schaden war bereits angerichtet. Dieser Skandal überschattete den gesamten Rest seiner Herrschaft, und das Volk schüttelte in wohligem, verächtlichem Bedauern den Kopf über ihn. Magie korrumpiert – das war jedem klar. Die Geschichte hatte das durch vielfältige, schmerzvolle Lektionen bewiesen, und doch gab es immer wieder Menschen wie Uther, die sich für die Ausnahme hielten, für immun gegen ihren Einfluss.
Die Welt drehte sich weiter, man fand neue Skandale, an denen man sich ergötzen konnte. Ingerna Gorlais wurde zu einem Sinnbild des Tragischen. Artorias Gorlais wurde – wohl aus Mitleid – in aller Stille von Si Hektor Caballarias Pendennis o’Senzatown aufgenommen, einem wohlhabenden Ritter von tadellosem Ruf, der inzwischen im Ruhestand war und keine eigenen Kinder hatte.
Si Hektors Ehre verbot es ihm, das geschmacklose Thema der Herkunft seines neuen Schützlings anzusprechen. Man ging freundlich und liebevoll mit dem kleinen Art um, wenn auch vielleicht ein wenig vorsichtig und distanziert. Den Grund hierfür begriff Art erst, als er erfuhr, wer er war und wie sehr man ihn von der Außenwelt abschirmte.
Art weiß, dass noch immer über ihn geredet wird. Er ist so etwas wie ein störender Knoten im Geflecht der jüngeren Geschichte; eine halb geöffnete Muschel, auf der die Möwen immer wieder herumhacken; funkelnder, von Elstern gejagter Tand, der niemals hätte existieren dürfen.
Der eine Ritter räuspert sich plötzlich und reißt Art so aus seinen Gedanken.
»Bitte warten Sie hier … Sire«, sagt der Mann. »Es wird bald jemand kommen. Dann wird man Ihnen alles erklären.«
Das kurze Zögern vor der Anrede Sire sagt schon alles, ebenso wie die Formulierung »alles erklären«. Zwar ist Art nun König, allerdings nur vorübergehend, aufgrund eines politischen Schachzugs, der für Stabilität sorgen soll, bis die Caballaria ein offizielles Turnier ausrichten kann. Nach dem Tod seines Vaters haben die Herrscherfamilien der sieben Bezirke von London nun das Recht, nach dem Schwert zu greifen, das sie alle regiert.
Chaos wird ausbrechen. Das ist immer so.
»Wir können den Projektor auch ausschalten«, meint der Ritter leicht betreten.
»Nein.« Vollkommen ruhig sagt Art das, beinahe abwesend. Wieder ist er erstaunt darüber, wie gelassen er nach außen hin wirkt. »Bitte verzeiht mir, ich habe nicht einmal nach euren Namen gefragt.«
Das scheint den Ritter zu überraschen. Nachdem er einen kurzen Blick mit seiner Kameradin gewechselt hat, antwortet er: »Madoc, Sire.«
»Und deiner?«, wendet sich Art freundlich an die Frau. Beide sind ungefähr doppelt so alt wie er.
»Tepta.«
»Vielen Dank. Sicher ist die Situation nicht ganz einfach für euch.«
»Ich …« Madoc beißt sich auf die Zunge. »Nein, Sire.«
Die Tür öffnet sich, und ein akkurat gekleideter Diener mit raubvogelhaften Zügen tritt ein. Er balanciert ein silbernes Tablett auf der gestreckten Hand und geht mit lautlosen Schritten zu einem roten Diwan hinüber, wo er auf einem kleinen Tisch das Tablett abstellt. Darauf befinden sich eine grau marmorierte Teekanne, ein dickwandiger Kelch aus Glas und ein Teller mit kleinen Küchlein.
»Für die Wartezeit«, murmelt der Diener.
Art starrt das Tablett an.
»Habt ihr vielleicht noch einen Pollidori-Whisky dazu?«, fragt er.
Der Diener zögert. Aus dem Augenwinkel sieht Art, wie Madoc kaum merklich von einem Fuß auf den anderen tritt.
Dann neigt der Diener den Kopf. »Wie hätten Sie ihn gerne?«
»Zwei Finger, zwei Zerstoßene.«
Damit kann der Diener nichts anfangen. »Zwei Finger, zwei Zerstoßene« ist eine Bezeichnung aus dem Norden von Senzatown, die in einem Salon in Blackheart keinerlei Sinn ergibt.
»Zwei Maßeinheiten«, übersetzt Art, »mit Eis. Ich weiß nicht, wie das Eis hier serviert wird, aber wenn die Stücke ungefähr die Größe eines halben Daumens haben, hätte ich gerne zwei davon.«
Der Diener nickt wortlos und geht.
Dienstboten. Warum kann er nicht einfach selbst in die Küche gehen und sich einen Drink holen? Vermutlich, weil er die Küche gar nicht finden würde. Der Palast ist bekannt für seinen labyrinthartigen Grundriss; neues Personal muss wochenlang angelernt werden, damit es sich nicht verläuft. Ob neue Herrscher wohl ebenfalls so geschult werden? Uthers legitimer Nachfolger wäre natürlich hier aufgewachsen und würde sich bestens auskennen.
»Es wird bald jemand kommen«, sagt Madoc noch einmal, dann gehen die beiden Ritter hinaus.
Drückende Stille senkt sich über den Raum, nur durchbrochen vom leisen Surren des Projektors.
Erst jetzt bemerkt Art, dass seine Wangen feucht sind.
KAPITEL 4
Beinhaus, Blackheart
Ein Jahr zuvor
»Endlich aufgewacht, mein Star mit den verklebten Äuglein?«
Die Frage wird von einer rauen Stimme gestellt, die an einen schlecht laufenden Motor erinnert.
Red öffnet die Augen.
Sie befindet sich in einem Zimmer, das sie nicht kennt. Ein unfassbar hohes Deckengewölbe spannt sich weit über ihr, gestützt von Stahlträgern, die fast so breit sind wie ihr Körper. Durch ein großes Fenster mit gusseisernen Gitterstäben fällt Licht herein und zeichnet helle Streifen auf die weiße Decke, die über ihren Beinen liegt.
Red will etwas erwidern, aber die Laute bleiben wie ein trockener Brotrest auf halbem Weg in ihrem Hals stecken.
»Du befindest dich in einem Beinhaus in Blackheart«, erklärt die Stimme hilfsbereit, wohl ahnend, was sie fragen wollte. »Sie haben dich hierher verlegt, sobald sie sicher sein konnten, dass du beim Transport nicht verblutest.«
Blackheart. Das eine Wort setzt ihren Motor wieder in Gang.
»Ich bin …« Mühsam räuspert sie sich, doch es hilft nicht viel. »Ich bin in Blackheart?«
»Ja, so einfach ist das.« Faraday lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. »Du musstest lediglich dein Leben aufs Spiel setzen und schon bist du ein wahrhaftiger Lektriker.«
Lektriker – einer der vielen Slangausdrücke, mit denen die Londoner sich selbst betiteln, abgeleitet von Lektri, der in allen Sieben Königreichen anerkannten Währung, bei der elektrische Energie als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Erfunden natürlich in London, was gefälligst niemand vergessen sollte.
Und dann gibt es da auch noch den Begriff Murks, den Red als besonders verwirrend empfindet. In anderen Königreichen ist dies ein abfälliger Ausdruck für etwas, das aus verschiedenen Teilen zusammengeschustert wurde, doch die Londoner scheinen den Titel mit Stolz zu tragen. Wer ist denn bitte schön stolz darauf, Murks zu sein?
»Meine Schulter«, krächzt sie.
»Keine bleibenden Schäden, du bist immer noch im Spiel«, erklärt Faraday achselzuckend. »Die Ärzte haben keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber er hat dir kaum ein Haar gekrümmt. In ein paar Tagen müsste es wieder besser sein.«
Der brennende Schmerz, der sämtliche Nerven ihres Armes erfasste, als das Messer eindrang, ist noch in ihrem Fleisch gespeichert und wartet nur darauf, dass sie eine falsche Bewegung macht, um sofort wieder aufflammen zu können. Eine solche Stichverletzung hätte eigentlich jede Chance zunichtemachen müssen, dieses Jahr der Caballaria beizutreten. Zumindest ist sie davon ausgegangen.
Nun wagt Red, ein wenig Hoffnung zu schöpfen. »Wie ist das möglich?«
Faraday schenkt ihr ein trockenes Lächeln. »Durch Magie?«
Erleichtert schließt sie die Augen. »Was passiert jetzt mit mir?«
»Du warst so schlau, mit deinem Auftritt einen der mächtigsten Männer Londons zu beeindrucken«, erklärt ihr Faraday. »Deshalb wirst du sofort in einen Stall verfrachtet. Da du schon einigermaßen kämpfen kannst, lassen sie sogar die Probezeit weg. Was auch besser ist, denn die Probezeit wirst du sowieso verpassen, da du ja hier festsitzt, bis deine Schulter die sechsmonatige Tortur durchstehen kann, der dein Körper während der Ausbildung unterzogen wird. Und du kriegst keinerlei Vergünstigungen. Bestehst du die Ausbildung nicht, bist du raus. Setzt du auch nur ein einziges Mal Magie ein, und sei es nur ein laues Lüftchen, bist du raus.«
Ein gewisser Stolz schwingt in seinen Worten mit. In der gesamten Caballaria gibt es insgesamt nur vierzehn Gottgleiche, und keiner von ihnen beherrscht die seltene Form von Magie, zu der Red fähig ist. Das macht sie zu einem Exoten, einem Faszinosum, das sich automatisch von den anderen Rittern abhebt, die jedes Jahr zu Hunderten dem Orden beitreten. Vermutlich wird Faraday eine ganze Weile davon zehren können, dass er derjenige war, der sie entdeckt hat.
Glaubt man den Geschichten, so ist die Ritterausbildung in der Caballaria die reinste Hölle, und die meisten Anwärter scheiden vorzeitig aus. Red wird keine von ihnen sein. Sie wird es schaffen. Das muss sie. Es gibt keine andere Möglichkeit.
»Hast deine Nummer wirklich gut geplant«, fährt Faraday inzwischen fort. »Ein paar Wochen später, und du wärst ohne Registrierung eine Illegale gewesen.«
Red antwortet nicht. Ja, sie hat es extra so geplant – maximale Aufmerksamkeit bei minimalem Risiko, ins Gefängnis zu wandern. Faradays Tonfall verrät, dass ihm das durchaus bewusst ist.
»Wirklich eine Schande, dass sie das Gesetz geändert haben«, bemerkt er. »Ist noch gar nicht so lange her, da wurden sogar Kinder registriert.« Er schnaubt höhnisch. »Achtzehn, du meine Güte. Dabei sollte man schon mit zwölf Richtig von Falsch unterscheiden können.«
Bei der Registrierung werden die Daten der Gottgleichen behördlich erfasst – Name, Herkunft, magische Fähigkeiten –, und sie bekommen eine unauslöschliche Tätowierung verpasst, damit sie nicht verbergen können, was sie sind. Red hat altes Filmmaterial gesehen, auf dem schreiende Kinder ihren weinenden Eltern aus den Armen gerissen und tätowiert wurden, gebrandmarkt wie Vieh, bevor ihre Magie sich voll entfaltet hatte. Achtzehn ist immer noch jung für die Registrierung, egal, was Faraday davon hält. Nach dem Geburtstag hat man einen Monat Zeit, sich zur Tätowierung anzumelden. Reds Achtzehnter liegt nun zwei Wochen zurück.
Die Londoner lieben Tattoos. Sie lassen sich großflächig mit dauerhafter Körperkunst überziehen, egal ob hübsch oder hässlich, und stellen so ihre Bündnisse, Andenken und Festakte zur Schau. Für sie ist ein neues Tattoo ungefähr so alltäglich wie ein neues Paar Stiefel, aber Red hatte bisher noch nie eines. Ist sie erst registriert, wird sie für immer gezeichnet sein, wird sich nicht mehr verstecken können. Entschlossen verdrängt sie diesen Gedanken. Jeder muss Opfer bringen.
»Wenigstens muss ich mit der kaputten Schulter nicht weit reisen«, stellt sie fest.
Faraday legt den Kopf schief, dann scheint er zu verstehen, denn er verzieht kurz das zerfurchte Gesicht.
»Du bleibst nicht in Blackheart«, stellt er klar. »Sie haben dich der öffentlichen Kaderschmiede von Rhyfentown zugeteilt, ebendem Bezirk, unter dem ich dich zum Kampf angemeldet habe. So läuft das ab, denn dort wurdest du entdeckt.«
»Was? Wieso? Die Geißel hat sich zu meinem Sponsor erklärt, und er ist ein Blackheart-Ritter. Warum komme ich nicht dorthin, wo er ist?«
»Jetzt mach mal langsam, Kleine«, erwidert Faraday freundlich. »Mag ja sein, dass er dich eingekauft hat, aber das bedeutet nur, dass deine Ausbildung durch seinen Stall finanziert wird und nicht von Rhyfentown. Schließlich können sie nicht einfach irgendwelche Fremden mit unbekannter Herkunft im Bezirk des Königs herumtanzen lassen, oder? Du wirst dich beweisen müssen, und zwar doppelt und dreifach, denn du bringst einen ganz klaren Nachteil mit, Red: Du bist eine Gottgleiche. Niemand wird dir trauen.«
»Wyll trauen sie schon, und er ist vermutlich der berühmteste Gottgleiche überhaupt«, schießt Red zurück.
Faraday scheinen ihre Worte sehr zu amüsieren. »Oh, jetzt ist er also schon Wyll, ja? Nicht mehr der Hexenritter? Dein alter Kumpel Wyll?«
»Er hat mir ein Messer in die Schulter gerammt. Das schweißt zusammen, würde ich sagen.«
Faraday lacht polternd. »Du hast seine Aufmerksamkeit erregt, mehr aber auch nicht. Wenn du meinst, das reicht, um ihm nahezukommen, bist du schief gewickelt.« Er unterbricht sich kurz. »Ich bin gespannt, wie weit du es bringst, wenn er nicht da ist, um dich unter die Lupe zu nehmen.«
Das holt Red aus ihren gedanklichen Luftschlössern. Nun mustert sie den schlanken Mann mit dem markanten Gesicht um einiges aufmerksamer.
Vorsicht. Immer schön vorsichtig.
Faraday hebt eine Braue. »Oh, du dachtest, ich wäre simpel gestrickt, wie? Ja, diesem Irrtum erliegen viele. Mich stört das nicht, es macht manches einfacher.«
»Mich muss man nicht groß unter die Lupe nehmen«, sagt Red bestimmt. »Ich will einfach nur eine Ritterin werden. Davon träume ich seit …«
»Schon klar, ich erinnere mich noch gut an deinen kleinen Vortrag, als du mich angebettelt hast, dir Zugang zur Arena zu verschaffen. Was meinst du denn, warum ich das getan habe? Etwa, weil du eine Gottgleiche bist?« Faraday winkt ab. »Das ist nicht weiter von Interesse, da du deine Magie im Kampf ja nicht einsetzen darfst. Aber jeder hat seine ganz eigenen Gründe, warum er der Caballaria beitreten will, und ich kann sehen, dass deine äußerst speziell sind. Natürlich kenne ich sie nicht genau, aber ich freue mich schon darauf, es herauszufinden.«
Er weiß es. Du musst ihn zum Schweigen bringen. Endgültig.
Red spürt, wie ihr Temperament auf die mögliche Bedrohung reagiert. Die Gewaltbereitschaft in ihrem Inneren hebt gierig das Haupt, entzündet sich an diesem Funken. Doch mit den Schmerzen und den ganzen Medikamenten, die man ihr eingeflößt hat, wird sie ihm kaum etwas tun können.
»Neugier kann tödlich sein«, sagt sie leise.
Faraday schnalzt unbeeindruckt mit der Zunge. »Hier nicht, kleiner Straßenköter. In London ticken die Uhren anders. Und du bist nun in London, Kleines.«
Er steht auf und zieht den dicken grauen Mantel an, der über der Lehne hängt. »Ich werde deine Fortschritte genau im Auge behalten, Red o’Rhyfentown.« Nach einer bedeutungsvollen Pause fügt er hinzu: »Und ich werde nicht der Einzige sein.«
Seine Schritte verhallen in dem dunkel gefliesten Korridor.
Laut der Aufzeichnungen der Caballaria ist Red ein Waisenkind ohne Familiennamen, doch da sie nach dem Kampf von der Caballaria-Kaderschmiede in Rhyfentown angenommen wurde, wird sie nun zu einer o’Rhyfentown, trägt den Namen des Bezirks, um das neu geschmiedete Bündnis zu verdeutlichen. Dauerhaft behalten darf sie ihn allerdings nur, wenn sie die Ausbildung erfolgreich abschließt.
Der Hexenritter beherrscht ihre Gedanken. Wieder steigt seine beeindruckende Gestalt vor ihrem inneren Auge auf, seine ausdruckslose Miene während des Kampfes. Wie erstarrt liegt Red unter ihrer Decke, doch ihr Herz beginnt zu rasen. Für sie ist die Sache eindeutig: Sie hat in diesem Kampf restlos alles gegeben, aber dieser Mistkerl hat bloß mit ihr gespielt, hat zugesehen, wie sie sich vollkommen sinnlos in einen Rausch hineingesteigert hat, während er sie jederzeit hätte ausschalten können.
Vielleicht wollte er ihr auch nur die Chance geben, zu zeigen, was sie kann. Hätte er sich gelangweilt, wäre der Kampf nach drei Minuten vorbei gewesen. Aber wer außer dem Hexenritter selbst könnte das mit Sicherheit sagen? Wie aus Stein gemeißelt war sein Gesicht, hart und undurchdringlich – bis zu diesem kurzen Moment am Ende. Red spürte seine Hand an der Kehle, seinen durchtrainierten Körper direkt vor sich, während seine Finger langsam immer fester zudrückten, sich beinahe sanft in ihr Fleisch gruben. Dann, als sie sich zwang, in seine golden schimmernden Augen zu sehen, bemerkte sie es: Für den Bruchteil einer Sekunde weiteten sie sich schockiert, als die Magie sich Bahn brach und ihn zurückschleuderte.
Jeder weiß, dass er nahezu besessen davon ist, andere Gottgleiche aufzuspüren. So kann man ganz sicher seine Aufmerksamkeit erregen, es ist das eine, unfehlbare Mittel.