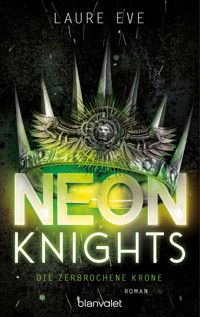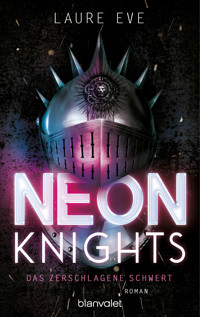16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Familie Grace
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein berauschender Mystery-Roman mit einem dunklen Sog, dem man sich kaum entziehen kann – Laure Eve erzählt die Geschichte einer gefährlichen Faszination, verhängnisvoller Liebe und von eiskaltem Tod »Ich bin bereit, alles zu tun, um eine von ihnen zu werden.« Alle sind fasziniert von der Familie Grace. Die Geschwister Fenrin, Thalia und Summer sind die geheimen Stars der Schule. Sie sind wunderschön und unnahbar – und manche glauben sogar, sie beherrschten dunkle Magie. Auch die Außenseiterin River fühlt sich unwiderstehlich zu ihnen hingezogen: Sie kann ihr Glück kaum fassen, als Summer sich mit ihr anfreundet, und sie in den inneren Kreis der Graces aufgenommen wird. Aber nichts in dieser Familie ist so, wie es scheint, und als einer von ihnen tot am Strand gefunden wird, beginnt ein Ringen dunkler Kräfte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Ähnliche
Laure Eve
Familie Grace, der Tod und ich
Aus dem Englischen von Christiane Steen
FISCHER E-Books
Inhalt
Erster Teil
1
Alle waren sich einig, dass die Graces Hexen waren.
Und ich wollte nichts mehr, als es zu glauben. Ich ging erst seit ein paar Monaten auf diese Schule, aber schon jetzt war mir klar, woher sie diesen Ruf hatten. Sie bewegten sich geschmeidig wie Fische durch die Flure, zogen die Blicke hinter sich her wie Wellen in ihrem Kielwasser. Die Leute aus ihrem eigenen Jahrgang hatten sich schon daran gewöhnt, zumindest taten sie so und versuchten angestrengt, gelangweilt auszusehen. Doch die Jüngeren hatten noch nicht gelernt, ihre unterwürfigen Blicke zu verbergen, ihre unverhohlene Bewunderung.
Die Jüngste von ihnen, Summer Grace, war fünfzehn und in meinem Jahrgang. Sie legte sich öfter als jeder andere mit den Lehrern an, war aber immer gerade so unhöflich, um ihrer Rebellion Ausdruck zu verleihen, aber nie unhöflich genug, um echte Schwierigkeiten zu bekommen. Sie hatte ihre hellen Grace-Haare rabenschwarz gefärbt und betonte ihre Augen immer mit dickem schwarzen Kajal und schwarzem Lidschatten. Sie trug Skinny-Jeans und Schnallen- oder Knöpfstiefel. An ihren Fingern steckten dicke Silberringe, und sie trug immer mindestens zwei Ketten um den Hals. Popmusik hielt sie für »Teufelszeug« – ein Ausdruck, den sie mit sarkastischem Lächeln zum Besten gab –, und wenn sie jemanden dabei erwischte, wie er sich über irgendwelche Boybands unterhielt, dann lachte sie ihn aus. Am schlimmsten war, dass dann alle mitlachten, sogar die Leute, mit denen man sich noch drei Sekunden zuvor begeistert unterhalten hatte. Eben weil sie eine Grace war.
Thalia und Fenrin Grace waren mit ihren siebzehn Jahren die ältesten. Sie waren zweieiige Zwillinge, sahen einander aber sehr ähnlich. Thalia war schlank und biegsam wie ein Weidenzweig und trug an ihren schmalen Handgelenken Unmengen von klimpernden Armreifen. In ihre dicken honigfarbenen Locken hatte sie eine karamellfarbene Strähne geflochten, ansonsten trug sie ihre Haare offen, so dass sie ihr lose über die Schultern flossen, oder zu einem flüchtigen Knoten gebunden, aus dem immer Strähnen herausfielen, die dann um ihren Hals flatterten. Sie trug lange Röcke, deren Säume mit Perlen und kleinen Spiegeln bestickt waren, dazu dünne, tief ausgeschnittene Tops, die an ihrem Körper herabflossen, sowie Fransenschals, die sie sich um die Hüften schlang. Einige Mädchen versuchten es ihr gleichzutun, doch sie wirkten immer wie verkleidet und mussten sich eine Menge Spott anhören. Danach versuchten sie es nie wieder. Auch ich hatte es einmal probiert, als ich noch neu war. Es sah idiotisch an mir aus. Thalia dagegen wirkte, als wäre sie in diesen Kleidern zur Welt gekommen.
Und dann gab es noch Fenrin.
Fenrin.
Fenrin Grace. Schon sein Name klang mystisch, als sei er mehr Märchenwesen als Junge. Er war der Pan der Schule. Seine Haare waren noch blonder als die seiner Zwillingsschwester, und er trug sie lang, so dass ihm die Locken ständig in die Stirn fielen. Er trug meistens weiße Musselinhemden, Lederbänder um die Handgelenke, und um den Hals ein verblichenes Haus einer Meeresschnecke an einem Lederband, das er niemals abzunehmen schien. Es hing wie ein perfektes V an seiner Brust. Er hatte eine schlanke, sehr schlanke Figur. Und ein arrogantes, träges Lächeln.
Ich war absolut rettungslos in ihn verliebt.
Was das dümmste war, was mir hätte einfallen können, und ich hasste mich dafür. Jedes Mädchen mit Augen im Kopf war in Fenrin verliebt. Leider gehörte ich nicht zu den Mädchen, denen Smalltalk besonders leichtfiel, die ihre Haare herumwarfen oder ihre Lippen mit Lipgloss betonten. Doch tief in meinem Inneren, wo niemand es sehen konnte, brannte es glühend wie Kohle.
Die Graces hatten einerseits Freunde, andererseits auch nicht. Hin und wieder ließen sie sich zu jemandem herab, den sie vorher nie beachtet hatten, und nahmen ihn eine Zeitlang bei sich auf, doch es war eben nur eine Zeitlang. Sie wechselten ihre Freunde wie andere Leute ihre Frisuren, als warteten sie immer darauf, dass noch jemand Besseres vorbeikäme. Sie gingen niemals am Wochenende in die Kneipe oder mittwochs abends wie alle anderen in den Jugendclub. Es hieß, sie dürften das Haus nicht verlassen, außer um die Schule zu besuchen. Keiner wusste etwas Genaues über ihr Leben – außer darüber, mit wem Fenrin gerade schlief, denn das verheimlichte er nie. Er führte das Mädchen durch die Schule, so lange es eben dauerte, einen Arm locker um ihre Schulter gelegt, und sie himmelte ihn an, kicherte die ganze Zeit und starb praktisch vor Glück. Ich hatte keines von diesen Mädchen länger als ein oder zwei Monate an seiner Seite gesehen. Sie bedeuteten ihm nichts, waren nur ein Zeitvertreib. Er wartete auf jemand Besonderen, jemand ganz anderen, der sofort seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde, und zwar so vollkommen, dass er sich fragen würde, wie er so lange ohne diesen Menschen hatte existieren können. Sie warteten alle, das konnte ich sehen. Meine Aufgabe war es, ihnen zu zeigen, dass ich es war, auf die sie so lange gewartet hatten.
2
Zuerst hielt ich es für meine persönliche Strafe, dass wir in diese Stadt zogen.
Sie lag Kilometer weit weg von dem Ort, an dem ich aufgewachsen war, und ich hatte vorher noch nicht mal von ihr gehört. Meine Mutter hatte als Kind ein paarmal ihre Ferien hier verbracht und dann irgendwann entschieden, dass diese winzige Küstenstadt zwischen Meer und Wildnis genau der richtige Ort war, um nach den vergangenen hässlichen Monaten unser Leben fortzusetzen. Dünen, Wälder und Moore, die mit Menhiren übersät waren, umringten die Stadt wie eine Grenze. Ich stammte aus einem Vorort voller Tante-Emma-Läden, Möbelhäusern und Frisören. Das einzige bisschen Natur waren die behördlich angelegten Blumenbeete an der Hauptstraße. Hier dagegen wurde man ständig daran erinnert, woher man stammte. Überall war Natur.
Bevor die Graces mich wahrnahmen, war ich eine stille Schülerin, die sich immer im Hintergrund hielt, um nicht aufzufallen. Ein paar Leute waren anfangs nett zu mir gewesen – wir hatten zusammen abgehangen, und sie hatten mir erklärt, wie hier alles lief. Aber dann wurden sie es irgendwann leid, dass ich so verschlossen war, dass niemand in mich hineinsehen konnte, und ich wurde es leid, Begeisterung dafür zu heucheln, über was sie die ganze Zeit redeten: wer mit wem schlief, welche Party gerade anstand und welche Fernsehserien sie gerade verfolgten, in denen es darum ging, wer mit wem schlief und welche Party gerade anstand.
Die Graces waren da ganz anders.
Als man mir erzählte, dass sie Hexen seien, hatte ich ungläubig gelacht und es für einen Test gehalten, so nach dem Motto: »Mal sehen, was die Neue so alles glaubt.« Aber auch wenn ein paar Leute die Augen verdrehten, spürte ich, dass jeder Einzelne von ihnen trotz ihres vorgetäuschten Spotts glaubte, es könne stimmen. Irgendetwas war mit diesen Graces. Sie waren anders als alle anderen auf der Schule, verhielten sich wie Stars, die ihre Geheimnisse wie eine Pelzstola mit sich herumtrugen, und das auf diese ätherische Weise, die um sie herumwehte und verführerisch von Magie flüsterte.
Aber ich musste es genau wissen.
Eine Weile beschäftigte ich mich damit, ihren Blickwinkel zu verstehen, genauer: damit, was ich tun konnte, um mich auf ihren Radarschirm zu bringen. Mit äußerer Attraktivität konnte ich nicht punkten, denn die besaß ich nicht. Ich konnte mich auch nicht mit ihren Freunden anfreunden, denn niemand, den ich bisher kennengelernt hatte, gehörte zu ihrem inneren Kreis. Ich hätte mich aufs Surfen verlegen können, ein Sport, den alle halbwegs coolen Leute hier beherrschten, aber ich hatte es nie versucht und würde mich vermutlich fürchterlich blamieren. Ich hätte laut sein können, aber laute Menschen werden schnell nervig. Also tat ich erst mal gar nichts und versuchte nur klarzukommen. Mein Problem war, dass ich gern alles gründlich durchdachte. Manchmal lähmten mich all diese Was-wäre-wenns, und dann tat ich lieber gar nichts, weil das sicherer war. Ich fürchtete mich oft vor dem, was passieren könnte.
Doch an dem Tag, an dem sie mich schließlich bemerkten, handelte ich aus reinem Instinkt – und das war genau das Richtige, wie ich nachher wusste. Denn echte Hexen fühlen sich vom geheimen Rhythmus des Universums angezogen. Als magische Wesen wägen sie niemals jede Möglichkeit ab, denn sie fürchten sich vor nichts. Sie haben den Mut, sie selbst zu sein, und sie kümmern sich niemals darum, was andere von ihnen denken. Weil es ihnen einfach nicht wichtig ist.
Ich wollte so gern so sein wie sie.
Es war Mittagspause, und die erste Frühlingswärme hatte alle nach draußen getrieben. Der Rasen war noch nass vom gestrigen Regen, also drängten sich alle auf den Hartplätzen herum. Die Jungs spielten Fußball, die Mädchen saßen an der Seite auf der niedrigen Mauer oder streckten ihre nackten Beine auf dem Asphalt aus und lehnten sich gegen den Maschendrahtzaun, redeten und lachten und tippten auf ihren Handys herum.
Fenrins aktuelle Truppe schoss mit einem Ball herum, und er spielte halbherzig mit, blieb aber immer wieder stehen, um mit breitem, lockerem Grinsen mit einem Mädchen zu sprechen, das zu ihm gelaufen war. Er stach wie ein Pfau aus der Menge heraus, auch wenn er mitten unter ihnen war. Er spielte mit ihnen und hing mit ihnen ab und lachte mit ihnen, doch etwas an seinem Verhalten sagte mir, dass er sein wahres Ich für sich behielt.
Und das war der Teil an ihm, der mich am meisten interessierte.
Ich war schon früh an der Mauer gewesen und hatte mein Buch aufgeschlagen, in der Hoffnung, damit selbstbewusst-cool und distanziert zu wirken, statt traurig und allein. Ich wusste nicht, ob er mich gesehen hatte. Ich blickte nicht auf. Wenn ich das getan hätte, wäre jedem klar gewesen, dass ich nur vorgab zu lesen.
Zwanzig Minuten später flirtete einer der Fußballjungen namens Danny, den alle nur Dannyboy nannten, als wäre das ein richtiger Name, mit einem besonders lauten, kichernden Mädchen namens Niral, indem er den Ball immer wieder dicht neben ihr gegen die Wand schoss, wobei sie jedes Mal laut aufkreischte. Je öfter er es tat, desto genervter verdrehten seine Freunde hinter seinem Rücken die Augen.
Niral mochte mich nicht. Was seltsam war, weil alle anderen mich in Ruhe ließen, wenn sie erst einmal beschlossen hatten, dass ich langweilig war. Aber ich hatte sie schon ein paar Mal dabei erwischt, wie sie mich anstarrte, als störte sie etwas an meinem Gesicht. Ich zermarterte mir den Kopf, was es war. Wir hatten nie ein Wort miteinander gesprochen.
Einmal hatte ich die Bedeutung ihres Namens nachgeschlagen. Er bedeutete »ruhig«. Das Leben war voller Ironie. Sie trug immer riesige, falsche Goldohrringe und winzige Röcke, und ihre Stimme schnarrte so laut wie die einer Elster. Ich hatte sie mal mit ihren Eltern in der Stadt gesehen. Ihre plumpe kleine Mutter trug wunderschöne Saris und die langen Haare zu einem Zopf geflochten. Niral hatte sich die Haare kurzgeschnitten und auf einer Seite abrasiert. Offenbar stand sie nicht zu ihrer Herkunft.
Wen Niral außerdem nicht mochte, war Anna, das schüchterne Mädchen, das mit ihren dichten schwarzen Locken und ihren großen dunklen Augen aussah wie eine Puppe. Niral zog andere Leute gern auf, und in ihrer Stimme schwang dann immer dieser fiese Hohn mit. Anna, ihr Lieblingsopfer, saß ein Stück von mir entfernt auf der Mauer. Niral war mit einer Freundin auf den Schulhof gekommen, hatte sich einen Moment umgesehen und dann beschlossen, sich direkt neben Anna zu setzen, deren winziger kindlicher Körper sich anspannte, während sie sich noch dichter über ihr Handy beugte.
Ich hatte Englisch und Mathe mit Niral, und sie schien nicht besonders schlau zu sein. Vielleicht war sie deshalb immer so laut, weil ein Teil von ihr das wusste. Sie schien Leute nicht zu mögen, die sie nicht sofort verstand. Und Anna war still und kindlich und daher ein leichtes Opfer. Niral erzählte den Leuten gern mit affektierter Stimme, Anna sei lesbisch. Anna wiederum hatte eine Haut, die mit Klebstoff überzogen zu sein schien, denn sie konnte nicht die kleinste Spitze ertragen. Die Bemerkungen glitten nicht von ihr ab, sondern hafteten an ihr wie große, leuchtende Falten. Niral flüsterte und deutete mit dem Finger auf sie, und Anna krümmte sich vornüber, als wollte sie sich am liebsten in ihrem eigenen Bauch verkriechen.
Dann kam Dannyboy und wollte Niral beeindrucken. Er knallte den Fußball mit bewundernswürdiger Präzision in Annas Richtung und schoss ihr das Telefon aus den Händen. Es landete mit einem matten Knacken auf den Boden.
Dannyboy schlenderte herüber. »Sorry«, sagte er lässig, aber dabei blickte er Niral an. Anna senkte den Kopf. Ihre schwarzen Locken hingen neben ihren Wangen herab. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Wenn sie nach ihrem Telefon griff, dann würde die Hänselei vielleicht weitergehen. Wenn sie nicht danach griff, würden sie vielleicht ihr Telefon nehmen und damit weitermachen.
Ich beobachtete sie über den Rand meines Buches hinweg.
Ich hasste diese Art von unauffälligem Mobbing, bei dem alle nur wegschauen, weil das eben einfacher ist. Ich war selbst schon Opfer gewesen. Ich sah den Ball langsam zu mir rollen und gegen meinen Fuß stoßen. Ich stand auf, nahm ihn, und anstatt ihn wieder zu Danny zu werfen, warf ich ihn zur anderen Seite auf den Sportplatz. Er hüpfte auf dem nassen Rasen davon.
»Warum hast du das gemacht?«, rief ein anderer Junge wütend. Ich kannte ihn nicht – er hing nicht mit Fenrin ab. Dannyboy und Niral starrten mich ebenfalls an.
»Tja, tut mir leid«, sagte ich. »Ich dachte, die beiden da wollen vielleicht lieber eine Weile allein sein, anstatt uns hier weiter anzuwidern.«
Es wurde komplett still.
Dann lachte der wütende Junge los. »Dannyboy, nimm deine Freundin und hol den Ball, Mann. Wir sehen uns in ein paar Stunden.«
Dannyboy fühlte sich sichtlich unwohl.
»Hinter dem Sportplatz ist das Wäldchen«, meinte ich. »Da habt ihr eure Ruhe.«
»Du blöde Ziege«, sagte Niral zu mir.
»Vielleicht solltest du nicht so viel austeilen«, antwortete ich, »wenn du selbst nicht einstecken kannst.«
»Die Neue hat recht«, sagte der wütende Junge.
Niral saß einen Moment unentschlossen da. Der Wind hatte sich zu ihren Ungunsten gedreht.
»Komm«, sagte sie dann zu ihrer Freundin. Sie sammelten ihre Taschen und ihr Make-up und ihre Handys zusammen und marschierten davon.
Dannyboy wagte nicht, ihr nachzublicken – der wütende Junge verspottete ihn immer noch. Stattdessen spielte er weiter Fußball. Anna holte ihr Handy und tat so, als ob sie eine Nachricht schreiben würde, doch ihre Finger tippten einen sinnlosen Rhythmus. Beinahe überhörte ich ihre leise Stimme.
»Dachte schon, das Display wäre gesplittert. Sah ganz kaputt aus.«
Sie bedankte sich nicht bei mir, sah nicht mal auf. Ich war froh darüber. Ich fühlte mich mindestens so unsicher wie sie, und wenn wir uns jetzt noch gegenseitig unsicher gemacht hätten, wäre das zu viel für mich gewesen. Ich setzte mich wieder neben sie, steckte den Kopf in mein Buch und wartete darauf, dass mein Puls aufhörte wie wild zu trommeln.
Als die Glocke ertönte, schulterte ich meine Tasche, und dann zog ich meine waghalsige Masche durch. Ohne nachzudenken, ging ich auf Fenrin zu, als wollte ich mit ihm reden. Ich spürte seinen Blick auf mir, als ich näher kam, und seine Neugierde. Doch statt mit ihm zu reden, ging ich einfach an ihm vorbei. Im letzten Moment hob ich den Blick, und bevor mein Gesicht zu glühen anfing, zog ich eine Augenbraue hoch. Das sollte so viel bedeuten wie: Und was kannst du so? Es bedeutete, Ja, ich sehe dich, und jetzt? Es bedeutete, Ich bin nicht wild darauf, mit dir zu reden, aber ich ignoriere dich auch nicht, denn das wäre ein bisschen zu gewollt.
Dann senkte ich den Blick und ging weiter.
»Hey«, rief er hinter mir her.
Ich blieb stehen. Mein Herz schlug heftig gegen meine Rippen. Er war nur ein paar Schritte hinter mir.
»Rächerin der Schwachen«, sagte er grinsend. Das waren seine ersten Worte an mich.
»Ich steh einfach nicht so auf Mobbing«, sagte ich.
»Du könntest ja unsere lokale Superheldin sein. Du rettest die Unschuldigen und trägst einen Umhang …«
Ich bot ihm ein Lächeln an, oder eher einen hochgezogenen Mundwinkel. »Für eine Superheldin bin ich nicht nett genug.«
»Ach nein? Willst du damit sagen, du bist hier der Bösewicht?«
Ich dachte einen Augenblick nach. »Ich glaube, keiner ist einfach nur schwarz oder weiß. Du auch nicht.«
Sein Grinsen wurde breiter. »Ich?«
»Ja. Ich glaube, dass es dich manchmal ganz schön langweilt, wie dich alle anhimmeln, obwohl sie dich wahrscheinlich gar nicht richtig kennen. Vielleicht ist dein wahres Ich viel dunkler, als du es der Welt zeigst.«
Sein Grinsen fror ein. Mein anderes Ich aus einer anderen Zeit wand sich vor Entsetzen über meine Dreistigkeit. Niemand hört solche Dinge gern.
»Hm«, sagte er nachdenklich, »du bist offenbar nicht auf der Suche nach Freunden.«
Innerlich schrumpfte ich zusammen. Ich hatte es vermasselt. »Ich schätze … ich suche bloß nach den richtigen«, sagte ich. »Solche, die so fühlen wie ich. Das ist alles.«
Ich hatte mir so fest vorgenommen, dass ich das nicht mehr tun würde. Schließlich kannte mich hier keiner – ich hätte ganz neu anfangen können, als 2.0 Version meines Ichs, aber mit verbesserten sozialen Fähigkeiten.
Hör auf zu reden. Hör auf zu reden. Geh weiter, bevor du es noch schlimmer machst.
»Und was fühlst du so?«, wollte er wissen. In seiner Stimme lag kein Spott. Er schien wirklich neugierig.
Na ja, ich konnte ebenso gut einen starken Abgang hinlegen.
»Als müsste ich die Wahrheit herausfinden«, sagte ich. »Dass es vielleicht mehr gibt als das hier.« Ich hob hilflos die Hand und deutete auf das Schulgebäude, das über uns aufragte. »Mehr als bloß … das hier, dieses Leben, jeden Tag und immer so weiter, bis ich tot bin. Es muss etwas anderes geben. Und ich will es finden. Ich muss es finden.«
Seine Augen verfinsterten sich. Ich meinte diesen Blick zu kennen – es war der vorsichtige Gesichtsausdruck, den man in Anwesenheit von Verrückten annimmt.
Ich seufzte. »Ich muss gehen. Sorry, wenn ich dich beleidigt habe.«
Er sagte nichts, als ich an ihm vorbeiging.
Ich hatte gerade vor dem beliebtesten Jungen in der Schule einen Seelenstriptease hingelegt, und als Gegenleistung schenkte er mir sein Schweigen.
Vielleicht konnte ich meine Mutter überreden, noch mal mit mir umzuziehen.
Am nächsten Tag regnete es, darum aß ich mein Mittagessen in der Bibliothek. Ich war allein – die netten Mädchen, mit denen ich anfangs abgehangen hatte, fragten mich nicht mehr, ob ich in der Cafeteria bei ihnen am Tisch sitzen wollte, und ich war froh über die Gelegenheit, noch ein bisschen zu lesen. Mr Jarvis, der Bibliothekar, war nirgendwo zu sehen, also stellte ich meine Tasche auf den Tisch und klappte dahinter meine Tupperdose auf. Kalte Bohnen auf Toast mit geschmolzenem Käse darüber. Ein bisschen schmierig, aber billig und leicht zuzubereiten – zwei wichtige Faktoren bei mir zu Hause. Ich nahm meine Gabel heraus – die einzige in unserer Besteckschublade, die nicht aussah wie aus einem Einmal-Picknick-Set. Stattdessen war sie aus Silber und hatte eine hübsche flache Verzierung am Griff. Ich spülte sie jeden Abend ab und nahm sie am nächsten Tag wieder mit zur Schule. Ich fühlte mich damit ein klein wenig besonders, so als wäre ich nicht völlig verarmt und als würde meine Mutter sich dafür interessieren, ob ich da war oder nicht.
Ich hatte mir den gesamten gestrigen Tag Sorgen über meine Unterhaltung mit Fenrin gemacht und auch einen Großteil des Abends, hatte meine Worte ständig im Kopf wiederholt und mich gefragt, was ich hätte besser machen können. In meinem Kopf klang meine Stimme ruhig und bestimmt, eine perfekte Kadenz zwischen affektiert und musikalisch. Doch in Wirklichkeit hatte ich einen albernen Kleinstadtdialekt. Ich fragte mich, ob es ihm aufgefallen war. Ich fragte mich, ob er mich danach beurteilte.
Ich aß und las mein Buch – es war einer dieser speziellen Fantasyromane, die ich heimlich liebte. Das war meine Lieblingsbeschäftigung: Essen und Lesen. Die Welt war eine Weile still. Ich war gerade an der Stelle, an der Prinzessin Mar’a’tha einen Pfeil in die Dämonenhorde schoss, die das königliche Jagdlager angegriffen hatte, als ich es spürte.
Ihn. Ich spürte ihn.
Ich blickte hoch in sein Gesicht, das sich herunter auf mein peinliches Buch und mein peinliches Essen beugte.
»Störe ich?«, fragte Fenrin. Eine lange Strähne seiner sonnengebleichten Haare hatte sich hinter seinem Ohr gelöst und baumelte neben seiner Wange. Ich nahm tatsächlich seinen Geruch wahr. Er roch nach Vanille, aber auf sehr männliche Art. Seine Haut war leicht gebräunt.
Ich hielt meine Gabel immer noch in der Luft und sah ihn wie gelähmt darüber hinweg an.
Es hat funktioniert. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt, und es hat funktioniert.
»Du isst wieder in der Bibliothek, obwohl alle anderen in der Cafeteria sitzen«, sagte er. »Offenbar bist du wirklich gern allein.«
»Ja«, sagte ich. Aber offenbar mit dem falschen Unterton, denn er zog die Augenbrauen hoch.
»Oh, okay. Sorry, dass ich dich gestört habe«, sagte er und wandte sich ab. Ich senkte meine Gabel.
NEIN, WARTE!, wollte ich schreien. An diesem Punkt sollte ich eigentlich irgendwas total Komisches sagen, und dann würden wir darüber lachen, und dann würde ich es in seinen Augen sehen – dass er mich für cool hielt. Und dann wäre ich drin.
Aber aus meinem Mund kam nichts, und meine Chancen schwanden dahin.
Die einzige andere Person in der Bibliothek war dieser Marcus aus Fenrins Jahrgang (nur Marcus, niemals nur Marc, hatte ich mal jemanden spotten hören). Er hatte die Art von Präsenz, die sich nach innen richtete, als könnte er es nicht ertragen, bemerkt zu werden. Ich verstand das gut und hielt darum immer Abstand zu ihm.
Darum fand ich es interessant, dass Fenrin sich jetzt zu Marcus herumdrehte, anstatt ihn zu ignorieren, und ihn direkt ansah. Und statt sich unsichtbar zu machen, erwiderte Marcus seinen Blick. Fenrins Mund bildete einen dünnen, festen Strich. Marcus rührte sich nicht. Keiner von beiden sah weg.
Nach einer ganzen Weile dieses seltsamen Verhaltens, das weder offen aggressiv noch irgendwie sonst verständlich war, schnaubte Fenrin, drehte sich um und merkte, dass ich ihn ansah. Ich versuchte zu lächeln, um ihn nicht wieder zu vertreiben.
Es schien zu wirken. Er verschränkte die Arme und wippte auf den Füßen hin und her.
»Auf das Risiko hin, mir eine weitere Abfuhr abzuholen«, sagte er zu mir, »warum bist du denn so gern allein?«
Mein Mund öffnete sich, und ich gab ihm eine ehrliche Antwort, denn das hatte mich immerhin bis hierher gebracht, und die Wahrheit schien mich ihm näherzubringen als alles andere.
Ich zwang mich, ihm direkt in die Augen zu sehen. »Wenn ich allein bin, muss ich mich nicht mehr verstellen.«
Fenrin lächelte.
Bingo, wie meine Mutter gesagt hätte.
3
Über die Familie Grace gab es eine Geschichte, die so sehr mit dem Stoff dieser Stadt verwoben war, dass selbst meine Mutter schon auf der Arbeit davon gehört hatte. Es ging um die Feier zu Thalias und Fenrins achtem Geburtstag.
Die Geburtstagspartys der Graces waren bis dahin legendär gewesen. Die meisten Mütter in der Stadt beteten darum, dass ihr Kind eine Einladung erhielt, damit sie selbst auch kommen konnten und in Esther Graces riesiger französischer Landhausküche sitzen durften, Cocktails aus schlanken Gläsern trinken und heimliche Blicke auf ihren hübschen Ehemann Gwydion werfen konnten, wenn er mit lässigem Schritt vorbeikam.
Auch dieses Mal war die Party wie gewohnt verlaufen. Die Mütter hatten ihre Outfits sorgfältig ausgewählt, leuchtenden Lippenstift aufgelegt, und in der Küche frisch gemixte Mojitos mit frischer Minze aus Esthers großem Kräutergarten getrunken. Im Verlauf des Nachmittags klang ihr helles Gelächter immer lauter, und sie sahen immer weniger nach ihren Kindern, die sich satt und von den Partyspielen ausgetobt im Salon beschäftigten. Denn im Haus der Graces gab es tatsächlich so etwas wie einen Salon.
Niemand wusste später mehr, wer auf die Idee mit dem Ouija-Brett gekommen war, doch die meisten Kinder erzählten, es sei Fenrin gewesen. Er war immerhin ein ziemlicher Angeber. Es war ihnen absolut verboten, das Brett auch nur anzufassen, aber das hinderte Fenrin nicht daran, den Schlüssel zum Schrank zu holen, in dem es verschlossen war, und auf einen Stuhl zu klettern, um das höchste Regalfach darin zu erreichen. Da lag es, eingewickelt in rostrotem Samt und mit schwarzem Seidenband verschnürt. Als das Band gelöst und der Samt heruntergezogen war, sahen sie eine Kiste aus Sandelholz, die einen weichen Duft verströmte, wenn man seine Nase daran hielt.
Die Hälfte der Kinder bekam vor Angst Herzklopfen. Was, wenn es nun doch gefährlich war? Aber Fenrin lachte sie bloß aus und sagte, es gäbe keine Geister, und ob sie nun spielen wollten oder lieber für den Rest ihres Lebens als Angsthasen gelten?
Also spielten sie – alle.
Wollte man die Wahrheit darüber erfahren, was dann passierte, hätte man die Salonwände befragen müssen. Die Berichte unterschieden sich von Kind zu Kind, und niemand erfuhr je genau, wie alles gekommen war.
Als die Erwachsenen das Geschrei hörten, eilten sie in den Salon und sahen Matthew Feldspar mit geschlossenen Augen und flacher Atmung auf dem Boden liegen. Egal, wie seine Mutter ihn auch schüttelte, er wachte nicht auf.
Er wurde eiligst ins Krankenhaus gebracht.
Als sie dort ankamen, war er wieder bei Bewusstsein, und der untersuchende Arzt versicherte seiner Mutter, dass es keine Anzeichen für körperliche Gewalt gab. Auch die Tests ergaben nichts Ungewöhnliches, und schließlich nahm man an, dass er aus irgendeinem Grund in Ohnmacht gefallen sein musste. Vielleicht hatte er an diesem Tag nicht genug gegessen. Vielleicht war es eine Reaktion auf die Aufregungen einer Geburtstagsparty.
Doch Mrs Feldspar glaubte nichts davon. Sie bestand darauf, dass Matthew kein schwächlicher Junge war und niemals zuvor in Ohnmacht gefallen sei. Stattdessen ging sie davon aus, dass jemand ihm etwas angetan hatte; etwas, dass ein Arzt nicht feststellen konnte. Etwas, dass nur das Kind einer Hexe tun konnte. Die nächsten Wochen flogen die Anschuldigungen nur so herum. Matthew war dafür bekannt, dass er gern Gerüchte verbreitete, ebenso wie er gern Kinder in den Hintern kniff, bis sie weinten. Er hatte das offenbar auch einige Wochen zuvor mit Fenrin gemacht und dann jedem erzählt, dass Fenrin das Kneifen sehr genossen hätte. Fenrin hatte versucht, ihn im Sportunterricht zu schlagen und dafür einen Verweis erhalten. Danach schien sich die Sache zu verlaufen. Bis zu der Geburtstagsparty.
Mrs Feldspar meinte, Matthew wäre eben ein ausgelassener Junge, das sei alles. Sie versuchte, die Graces anzuzeigen, doch die Polizei lachte sie bloß aus. Sie versuchte, die Graces zu verklagen, doch die Anwälte erklärten ihr, dass es keinerlei Beweise für einen Anschlag auf ihren Sohn gäbe, und ohne Beweise gäbe es auch keinen Fall.
Nicht lange darauf verließen die Feldspars die Stadt.
Keines der Kinder durfte zum neunten Geburtstag von Thalia und Fenrin gehen; doch statt brüskiert zu sein, luden die Graces eine ganze Horde von Leuten von außerhalb ein. Schon Tage zuvor sah man sie ankommen. Manche von ihnen sahen aus wie Rockstars und manche wie aus American Psycho. Ein paar waren Bohemians wie die Graces, und jeder Einzelne von ihnen fiel in irgendeiner Weise auf.
Der Geburtstag der Zwillinge war am 1. August, und wenn man an diesem Tag an ihrem Haus vorbeiging, hörte man Musik und Gelächter aus dem Garten und konnte den Duft von Ingwer-Karotten-Kuchen mit Frischkäse, Würstchen in Senfsauce und frisch angerührter Limonade riechen.
Jedes Jahr feierten Thalia und Fenrin ihre Geburtstagsparty, aber aus der Schule wurde niemand mehr eingeladen. Zwei oder drei Tage vorher war die Stadt voller Gäste der Graces, und zwei oder drei Tage später waren sie wieder fort. Das beliebteste Gerücht war, dass sie alle Hexen seien, die sich zu irgendeinem ausschweifenden Ritual zusammenfanden. Der Geburtstag sei bloß ein Vorwand, flüsterte man – sobald die Kinder im Bett seien, würden die Erwachsenen ihre eigene finstere Party feiern. Noch lange Zeit nach dem unangenehmen Zwischenfall am achten Geburtstag führte man alles, was in der Stadt schiefging, auf den 1. August zurück. Zuerst war es nur ein Witz unter den Erwachsenen. »Was, du hast dir den Zeh verstaucht? Das waren bestimmt die Graces.« Doch die Kinder nahmen es auf, und die Gerüchte entwickelten sich zu unheimlichen Tatsachen. Zum Beispiel war die alte Mrs Galloway ohne jeden Grund gestürzt und am nächsten Tag gestorben, keine Woche nach dem 1. August. In einem anderen Jahr war am 2. August ein Feuer in der Sporthalle der Schule ausgebrochen. Und wieso sollte es einfach in einer Sporthalle brennen? In einem anderen Jahr kamen vier Kinder im September aus den Ferien zurück, deren Eltern gerade beschlossen hatten, sich scheiden zu lassen. Irgendetwas Schlimmes passierte jedes Jahr nach Fenrins und Thalias Geburtstag.
Es war der ganz eigene Freitag der 13. dieser Stadt. Es war die Strafe für ihre Vorurteile.
4
Ich aß die ganze Woche in der Bibliothek.
Jedes Mal, wenn jemand hereinkam, setzte mein Herz einen Schlag aus, und ich wartete darauf, dass ein Schatten über meinen Tisch fiel. Doch der Einzige, der ebenso oft dort war wie ich, war Marcus. Ich fragte mich, warum er jede Mittagspause in der Bibliothek verbrachte. Vor allem fragte ich mich, was dieser Blick zwischen ihm und Fenrin zu bedeuten hatte. Es gab da eine Vorgeschichte, doch zu diesem Thema hatte die Gerüchteküche über die Graces nichts zu bieten, und ich konnte schlecht einen von ihnen dazu fragen. Noch nicht.
Fenrin kam nicht noch einmal. Aber Summer.
Am nächsten Freitag flogen die Doppeltüren der Bibliothek so heftig auf, dass sie gegen die Wand knallten. Marcus, der zwei Tische von mir entfernt saß, zuckte zusammen. Summer schritt herein und sah sich mit unverhohlener Abscheu um. Sie blieb stehen, als posiere sie bei einer Modenschau, und bei jedem anderen Mädchen hätte ich mich vor Lachen verschluckt. Aber Summer sah aus, als kümmere es sie einen Scheiß, was man über sie dachte. Und genau das funktionierte.
Sie verschränkte langsam die Arme vor der Brust und sah sich um. Ihre schwarzen Haare waren im Genick zu einem Knäuel zusammengebunden, und ihre langen Schnürstiefel knarrten leise, wenn sie das Gewicht verlagerte. All das nahm ich in der Sekunde wahr, bevor ihr Blick auf mich fiel und sie eine Augenbraue hochzog.
Dann kam sie zu mir herüber.
»Hey, Neue.«
»Hi«, sagte ich überrascht.
»Du bist schon ein paar Monate hier, oder?«
»Jep.«
»Es ist März. Wieso hast du mitten im Schuljahr gewechselt?«
Die offizielle Begründung lautete, dass wir wegen des Jobs meiner Mutter umziehen mussten.
Die inoffizielle Begründung würde ich mit ins Grab nehmen.
Sie verdrehte die Augen, weil ich schwieg, wandte mir dann den Rücken zu und drehte den Kopf, so dass sie mich über die Schulter ansah. Ich versuchte, diese Bewegung abzuspeichern.
»Kommst du?«, fragte sie.
»Wohin?«
»Einmalige Einladung.«
Das war es.
Vermassle es nicht, flüsterte eine Stimme in meinem Kopf.
Und das hatte ich auch nicht vor. Ich schob meine leere Tupperbox in meine Tasche, wobei die Gabel darin klapperte, und dann mein ausgefranstes Taschenbuch, das ich gerade las. Summer ging bereits in Richtung Tür und schien sich nicht darum zu kümmern, ob ich ihr folgte oder nicht. Ich sollte mich besser beeilen.
Sie ging mir voran durch die Flure. Die meisten Leute befanden sich in der Cafeteria, doch die wenigen, die sich in den Gängen aufhielten, sahen ihr verstohlen nach. Ich ging ein paar Schritte hinter ihr – nicht so dicht, dass es aussah, als würde ich ihr hinterherrennen, aber doch so dicht, dass die anderen mitkriegten, dass ich ihr folgen sollte.
Wir kamen in den Gang mit den Spinden, und als wir an Jase Worthington vorbeikamen, sagte er: »Dämliche Gothic-Hexe.«
Summer blieb stehen.
Sein Freund Tom, den ich anfangs ziemlich gut gefunden hatte, zischte: »Lass das, du Idiot.«
Sie gehörten beide zu den angesagten Surfertypen. Tom war allerdings viel kleiner als die anderen und deswegen ständig angenervt. Aber sie passten beide gut zu Fenrin und waren auch im selben Jahrgang, darum hatte ich angenommen, dass sie miteinander befreundet waren. Ein Freund von Fenrin würde so etwas allerdings nie zu seiner Schwester sagen.
Schon gar nicht zu Summer.
»Ach, Jase-ington«, seufzte sie. »Ich habe heute leider keine Zeit für dich.«
Ich atmete wieder. Summer ging weiter.
»Ooooh, was würdest du denn sonst tun?«, höhnte Jase. »Mich mit einem Fluch belegen?«
Sie warf ihm einen ungeduldigen Blick über die Schulter zu. »Genau.«
Schweigen.
Erst als wir die Doppeltür am Ende des Ganges erreicht hatten, rief Jase plötzlich: »Ich habe keine Angst vor dir! Du gibst doch bloß an! Deine ganze Familie ist ein einziger Haufen von dämlichen Fakes!«
»Was für eine herausragende Ausdrucksweise«, murmelte Summer. »Was für ein Intellekt. Was für ein –« Sie unterbrach sich.
Jeder andere hätte versucht sie zu trösten oder sich bei ihr einzuschleimen. Ich schwieg.
Wir gingen über den Schulhof, wo ein paar andere Jungs aus Fenrins Jahrgang Fußball spielten. Es hatte angefangen zu nieseln, und ihr Spiel sah im grauen Licht irgendwie trostlos aus.
»Hey, Summer«, sagte einer von ihnen. Sie streckte ihm im Vorbeigehen die Zunge heraus, aber sie lächelte etwas dabei.
Ich spürte, wie sie mich ansah.
»Was?«, fragte sie, als erwarte sie einen Kommentar.
Ich zuckte die Schultern.
»Wow, du bist echt der schweigsame Typ, oder? Immer schön die Karten verdeckt halten, was?«
War das schlecht? Benahm ich mich ihr gegenüber zu vorsichtig? Ich war mir nicht sicher.
Wir waren auf dem Weg zum Wäldchen am Ende des Sportplatzes, wo ein paar Bäume und niedrige Büsche die Schüler vor den Blicken der Lehrer schützten.
»Ich hatte mal was mit ihm«, sagte Summer, als ob wir schon mal darüber geredet hätten. »Mit Jase. Er sieht heiß aus, aber mein Gott, ist der langweilig! Lebt nur sein ›Ich-rauche-Gras-und-surfe-viel‹-Leben. Ich meine, es interessiert ihn echt nichts anderes. Und dann ist er noch mies im Bett. Stöhnt nur rum wie ein grässlicher Zombie.«
Ich mochte diese Art von Gespräch nicht. Und es gab keine gute Antwort darauf. Ich kannte Jase nicht, also konnte ich ihr schlecht zustimmen.
»Aha«, setzte ich an.
Wir erreichten das Wäldchen. Jemand stand Schmiere: dieses missmutige Mädchen Macy, die ein Talent dafür hatte, sich bei beliebten Leuten nützlich zu machen. Sie beäugte mich von oben bis unten.
»Alle da?«, fragte Summer.
»Alle, die eingeladen waren.«
Diese Bemerkung war gegen mich gerichtet, aber Summer schien es nicht mal zu bemerken.
»Komm«, sagte sie. Meine Schuhe glitten über einen dicken Teppich aus Blättern. Dieser Ort war ziemlich brauchbar. Die Lichtung war von einigen hohen Büschen vor allen Blicken geschützt. Es gab keinen anderen Zugang als über den Sportplatz, weil er auf der anderen Seite von der Mauer des Schulgeländes begrenzt wurde. Man brauchte also nur eine Person, die aufpasste, und dann konnte man hier ungesehen alles tun, was man wollte.
In der Lichtung saßen ein paar Mädchen aus unserem Jahrgang auf ihren Jacken im Kreis. Ich wusste, dass zwei von ihnen gerade besonders enge Freundinnen von Summer waren. Jede von ihnen hatte mindestens zehn Piercings, und sie trugen immer T-Shirts mit irgendwelchen Bandnamen, auf denen Schlangen oder Insekten oder Blutflecken zu sehen waren. Gemma mit ihren zerrupften ampelroten Haaren war eines dieser frechen Mädchen, das jeder mochte. Ich hatte nie was mit ihr unternommen, aber in Mathe ein paar Mal mit ihr zusammengearbeitet, und sie war immer sehr nett gewesen. Das andere Mädchen, Lou, hatte ebenso rabenschwarze Haare wie Summer, zwei Nasenpiercings, die sie jeden Tag vor der Schule rausnehmen musste, und ein tiefes, finsteres Lachen.
Dann waren da noch drei andere, und als ich erkannte, dass Niral unter ihnen war, sank mir das Herz.
Was machte die denn hier? Sie war nicht mit Summer befreundet. Wollte sie sich an Fenrin ranmachen? Unsere letzte Begegnung spulte sich in voller Farbpracht vor meinem geistigen Auge ab.
Hinter dem Sportplatz ist das Wäldchen. Da habt ihr eure Ruhe.
Summer ließ sich in einer Lücke im Kreis nieder, und Gemma rutschte gehorsam zur Seite, um mir Platz zu machen. Summer legte mit einer seltsam formellen Geste die Hände zusammen. Die anderen hörten auf zu reden und sahen sie erwartungsvoll an. Ich spürte, wie ihre Blicke mich streiften. Ich wusste, was ihre Augen sagen wollten: Ich gehörte hier nicht her.
»Habt ihr mitgebracht, um was ich euch gebeten habe?«, fragte Summer.
Alle fingen an in ihren Taschen zu kramen. Lou holte ein schwarzes Samttuch heraus und breitete es auf dem Boden aus. Darauf legte jedes Mädchen einen Gegenstand: roten Tee, helle Kerzen, einen tiefen, rotglasierten Kochtopf, kleine Kräuterbehälter aus dem Supermarkt, eine Schere.
»Was ist das denn?« platzte Niral lachend heraus und deutete auf den Kochtopf.
Eines der Mädchen wurde rot. Ich hatte sie immer mit mindestens zwei anderen Mädchen in unserem Jahrgang verwechselt, weil sie genau die gleichen langen blonden Haare hatten und ähnliche Kleidung trugen. »Sie hat gesagt, wir sollen einen roten Behälter mitbringen, und das habe ich getan!«
»Darin kocht man Eintopf, du Irre.«
»Das ist genau das, was wir brauchen«, sagte Summer, und ihre Stimme klang ungewohnt ruhig. »Habt ihr alle eure Gegenstände dabei?«
Niemand rührte sich. Ich hatte nichts mitgebracht, aber ich hatte ja auch nichts davon gewusst.
»Ich verstehe das mal als Ja. Keine Sorge, wir werden alle die Augen schließen, wenn ihr eure Dinge in den Topf werft. Niemand anderes wird sie sehen.«
Summer holte eine Schachtel Streichhölzer hervor, zündete die Teelichter an und stellte sie in einen Kreis um den roten Topf. Dann nahm sie einen der Kräuterbehälter – Basilikum stand auf der Seite – und verstreute den Inhalt um den Topf, ließ sie auf die Teelichter fallen. Die Flammen knisterten und verbrannten die getrockneten Kräuter, und ein feiner Geruch stieg auf.
Ich hätte glücklich sein sollen. Hier war er: der Beweis, den ich gebraucht hatte, um zu wissen, dass die Gerüchte über die Graces stimmten.
Ich hatte bloß geglaubt, dass diese Dinge mit ein wenig mehr … Stil durchgeführt werden würden.
Kräuter aus dem Supermarkt und rote Teelichter?
»Summer«, murmelte ich. Alle beobachteten sie.
»Ja«, sagte sie mit derselben ruhigen Stimme. Sie machte mich langsam nervös, und es ging nicht nur mir so. Die Welt war auf einmal seltsam ruhig geworden. Es gab nur noch die sicheren Bewegungen von Summer und die angespannte Stille der Gruppe.
»Ich habe keinen Gegenstand dabei«, sagte ich.
Sie richtete sich auf und hob die Stimme, damit alle sie hören konnten.
»Das macht nichts. Der Gegenstand bedeutet dir zwar etwas, aber er ist nur ein Medium.« Sie zuckte die Schultern. »Wenn du mächtig genug bist, brauchst du gar keinen Gegenstand mehr. Oder Kerzen oder all das hier. Dann reicht dein eigener Wille aus. Aber ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind.«
Ein oder zwei Mädchen kicherten nervös.
»Also, es läuft folgendermaßen ab«, sagte Summer, und niemand zweifelte an ihren Worten. »Wir sprechen den Zauber. Er lässt die Energie in uns aufsteigen. Wir sprechen mit geschlossenen Augen. Das tun wir so lange, bis genügend Energie aufgebaut ist. Wenn es eine Stunde dauert, dann ist es eben so.«
»Aber die Mittagspause ist in zwanzig Minuten vorbei«, sagte jemand.
»Wen interessiert das? Was ist dir wichtiger: das hier, oder Unterricht? Ihr wolltet es doch unbedingt. Seit Wochen nervt ihr mich deswegen. Und jetzt zieht ihr den Schwanz ein?«
Der Kreis schwieg.
»Es wird nur funktionieren, wenn ihr alles, was ihr habt, und alles, was ihr seid, mit einbringt.« Summer setzte sich auf ihre Fersen. »Wenn ihr eure Energien nicht bremst. Oder an andere Sachen denkt. Das hier ist Magie, und es ist schwer. Wenn ihr eure Konzentration unterbrecht, verliert ihr Energie. Und mit zu wenig Energie funktioniert der Zauber nicht. Ihr müsst jetzt mit mir zusammenarbeiten, und zwar so lange, wie ich euch brauche. So lange, wie es eben dauert. Seid ihr jetzt dabei oder nicht?«
Ich spürte, wie die Aufregung in mir wuchs. Ich hatte mich geirrt. Das hier war echt. Sie war echt.
»Sprecht es aus«, verlangte Summer mit kalter Stimme. »Jede Einzelne von euch sagt jetzt ›Ich bin dabei. Ich werde alles geben, was ich habe.‹ Jetzt. Lou?«
Lou antwortete ohne zu zögern und mit eifriger Stimme. Ich hätte mich für sie geschämt, wenn ich mich nicht genauso gefühlt hätte wie sie klang. »Ich bin dabei. Ich werde alles geben, was ich habe.«
Summer verlangte, dass wir es alle sagten. Ein paar versprachen sich. Als ich an der Reihe war, wunderte ich mich selbst darüber, wie fest und klar meine Stimme klang. Es ist erstaunlich, zu was man sich selbst bringen kann, wenn man etwas nur wirklich will.
»Der Zauberspruch geht so«, sagte Summer. »Führ sie zu mir. Lass sie mir hier.« Sie sah uns an. »Ihr könnt sie durch ihn ersetzen.« Sie grinste zum ersten Mal, seit wir das Wäldchen betreten hatten.
Niral schnaubte nervös und verärgert. »Das ist doch bloß ein Reim und kein Zauberspruch.«
»Worte haben Macht«, erklärte Summer. »Aber ohne deine Absicht dahinter sind sie bedeutungslos. Der Reim dient nur dazu, dass selbst Idioten nicht vergessen, was sie sagen sollen. Und jetzt halt die Klappe und mach mit, oder geh. Wenn du Zweifel säst, machst du es für uns alle kaputt.«
Ein paar von den Mädchen sahen Niral wütend an. Ich wagte, mich ihnen anzuschließen, und Niral merkte es.
»Ich säe keine Zweifel«, sagte sie und funkelte mich aus zusammengekniffenen Augen an. »Ich bin dabei.«
»Dann lasst uns anfangen. Schließt die Augen.«
Ich wartete, bis alle ihre Augen geschlossen hatten. Dann schloss ich meine auch.
Sofort fühlte ich mich verletzlich und verlegen.
Das hier war doch dämlich. Es war total dämlich. Was, wenn jetzt ein Lehrer vorbeikam?
»Bring ihn zu mir. Lass ihn mir hier«, sagte Summer mit leiser Stimme. »Bring ihn zu mir. Lass ihn mir hier.«
Zuerst stimmte keiner mit ein. Ich spürte den Drang zu lachen, unterdrückte ihn aber.
»Bring ihn zu mir. Lass ihn mir hier«, sagte ich in anderer Geschwindigkeit als sie. Doch ich wiederholte es so lange, bis wir die Worte gleichzeitig sprachen. Weitere Stimmen kamen dazu. Erst murmelnd und unsicher. Doch je öfter wir es sagten, desto weniger Sinn hörten wir heraus, und desto mehr fielen wir in die Stimmen der anderen ein wie ein Vogelschwarm, der zusammen flog.
Ich weiß nicht, wie lange wir so sprachen. Ich weiß es wirklich nicht. Es hätte ewig sein können, und ich hätte immer so weitergemacht, wie in einem Traum, wo die Zeit keine Bedeutung hat, weil man sie nicht länger spürt, und wir skandierten immer weiter Bring ihn zu mir, lass ihn mir hier, und ich versank in dem Rhythmus, denn es gab nichts anderes mehr.
»Lou«, sagte Summer, »öffne die Augen und leg deinen Gegenstand in den Topf. Die anderen hören auf keinen Fall auf zu sprechen.«
Ich nahm es kaum wahr. Ich hörte nur ein leises Klirren. Ich hätte gar nicht aufhören können zu skandieren. Meine Stimme wurde praktisch aus mir herausgezogen.
Summer sagte etwas mit leiser Stimme. Geraschel.
Ich hörte nicht auf. Niemand von uns hörte auf. Der Zauber flog um mich herum, wieder und wieder.
»Lou, schließ deine Augen und setz wieder ein. Gemma, öffne deine Augen und leg deinen Gegenstand in den Topf.«
Summer benannte nacheinander alle im Kreis. Es schien ewig zu dauern, bis ich dran war. Ich war die Letzte.
»Mach die Augen auf«, flüsterte sie mir ins Ohr.
Ich tat, was sie sagte, aber es fiel mir schwer, als wären meine Lider mit Honig zusammengeklebt. Ich blinzelte und sah mich um. Irgendwie hatte ich erwartet, dass es dunkel wäre.
»Schneid dir ein Stück von deinen Haaren ab«, sagte Summer und bot mir die Schere an. In der anderen Hand hielt sie etwas, das ich nicht erkennen konnte. »Leg die Haare in den Topf. Dabei stell dir denjenigen vor, den du erreichen willst. Stell dir ganz genau vor, wie er vor dir steht, als bräuchtest du dich nur vorzubeugen, um ihn zu küssen. Lass sein Gesicht nicht los.«
Ich nahm die Schere. Meine Muskeln waren weich und kraftlos. In meinem Kopf hallte der Zauberspruch wieder. Ich schnitt eine lange Strähne ab und hielt sie zwischen meinen Fingern. Dahinter erkannte ich ihn. Sein goldenes Haar, das ihm nach vorn ins Gesicht fiel, über seine Wangenknochen. Sein Grinsen. Seinen Blick, der auf mir lag.
Ich beugte mich vor und legte die Haare in den Topf.
Fenrin, dachte ich, während sich meine Lippen bewegten.
Rascheln. Schritte näherten sich.
Und dann hörten wir ein wütendes »Was zum Teufel macht ihr denn da?«
Unser Gesang holperte und brach schließlich ab. Das schwarze Samttuch war auf einmal beschämend. Der Topf peinlich. Niral hatte recht – diese Kräuterbehälter sahen aus, als wollten wir einen Eintopf kochen. Ich blickte mit glühenden Wangen auf.
Es war Thalia. Die Frühlingsfeuchtigkeit lag immer noch in der Luft; sie trug braune Lederstiefel und ein langärmeliges, mit Perlen besticktes Oberteil, das genau richtig über ihren Körper fiel. Ihre Haare waren zu einem lockeren Knoten hochgebunden, die Enden hingen ihr am Hals herunter.
Meine Erleichterung darüber, dass es kein Lehrer war, währte nur kurz, denn Thalia sah wütend aus.
»Also?«, verlangte sie zu erfahren und sah jeden in der Gruppe an.
»Ich denke, das ist doch ziemlich offensichtlich«, sagte Summer kühl.
»Räumt das hier auf und geht wieder in die Schule.«
Summer rührte sich nicht. Wir anderen wanden uns ertappt auf unseren Plätzen.
»Du bist so eine Drama-Queen, Thalia«, sagte Summer schließlich. »Das ist doch bloß Spaß.«
»Vorhin hast du aber was anderes gesagt«, fuhr Niral dazwischen. Sie klang sehr beschämt. »Du hast gesagt, wir müssten alles einbringen, was wir haben!«
Ich richtete meine Augen verzweifelt zum Himmel. Oh, Gott, was machst du denn da? Lass Summer nicht vor ihrer Schwester dumm aussehen. Thalia wird das nicht schätzen, und Summer verlierst du ebenfalls.
Thalias karamellfarbene Augen funkelten Niral an. »Geht zurück in die Schule«, wiederholte sie. »Ich bin sicher, ihr habt Unterricht. Sofort, sonst melde ich euch. Los jetzt, alle.«
Summer rührte sich immer noch nicht. Die anderen Mädchen standen mit brennenden Wangen auf, schüttelten ihre Jacken aus und verließen das Wäldchen. Niemand wagte es, den Topf oder irgendetwas anderes mitzunehmen.
Ich blieb, wo ich war. Wenn das hier ein Test war, dann würde ich ihn mit Auszeichnung bestehen. Es war klar, worum es hier ging: um Loyalität. Sie waren alle durchgefallen, aber ich nicht.
Thalia spähte in den Topf und rümpfte die Nase. »Wusstest du, dass man euch bis zum Schulhof hören konnte? Ihr habt bloß Glück, dass ich es war, die euch erwischt hat. Fen wäre geplatzt vor Wut.«
Bei seinem Namen schlug mein Herz schneller.
Summer schnaubte. »Dem ist ganz egal, was ich mache.«
»Bitte. Er hasst diesen Kram, und das weißt du«, fauchte Thalia.
»Das ist sein Problem. Nicht unseres.«
Thalia seufzte und ihre gesträubten Nackenhaare legten sich wieder. »Ich weiß. Aber trotzdem.« Sie sah vom Topf auf. »Und Fen ist nicht der Einzige, der ausflippen würde, stimmt’s? Falls Esther das hier rauskriegt, dreht sie völlig durch.«
Es dauerte eine Sekunde, bis ich verstand, wen sie mit Esther meinte. Dann erinnerte ich mich, dass es um ihre Mutter ging. Nannten sie sie immer beim Vornamen? Das war seltsam.
»Dann erzähl es ihr eben nicht«, sagte Summer.
»Dann mach so was nicht.«
»Die ganze Stadt weiß über uns Bescheid, Thalia.«
Thalia wandte sich abgelenkt ab. »Ich will nicht schon wieder darüber reden. Nehmt euren Kram mit, wenn ihr geht. Die Lehrer werden Fragen stellen, und dann kriegen wir alle eine Menge Probleme.«
Und damit stapfte sie davon.
Als sie nicht mehr zu sehen war, stieß Summer einen Seufzer aus. Sie schien ein wenig nervös zu sein. Als Thalia da war, hatte ich nichts davon gemerkt. Sie war gut darin, es zu verbergen.
»Alles okay?«, fragte ich vorsichtig und erwartete, angeblafft zu werden.
»Ja.«
»Wird Thalia dich verpetzen?«
»Nein.«
»Woher weißt du das so genau? Sie hat es nicht versprochen.«
»Hätte ich sie darum gebeten, es nicht zu tun, hätte sie es aus reiner Boshaftigkeit gemacht. So denkt sie, es ist mir egal, und darum verpetzt sie mich nicht.«
Summers andere Hand öffnete sich beim Reden, und ich warf einen schnellen Blick auf den Gegenstand, den sie die ganze Zeit festgehalten hatte. Es war eine kleine orange-braune Figur aus poliertem Stein in Form eines Vogels. Das Licht fing sich in den tiefen Rillen der Flügel. Ich starrte ihn verwundert an und fragte mich, was er wohl bedeutete.
»Die Gerüchte stimmen also«, versuchte ich es mit neckendem Ton. »Ihr seid wirklich Hexen.«
»Bist du deshalb heute mitgekommen?«
Ich versuchte, die richtige Antwort darauf zu finden. »Ich schätze, ich war einfach neugierig. Wieso hast du mich eigentlich gefragt?«
»Aus dem gleichen Grund.« Sie lächelte mich verschmitzt an, dann sah sie in die Bäume. Ich fühlte mich sicher genug, um noch ein Stück weiter zu gehen.
»Warum will deine Familie nicht, dass andere davon wissen?«
»Na ja, sagen wir mal, sie haben gern ihre kleinen Geheimnisse. Ich bin die Einzige, die damit offen umgeht. Warum sollen wir uns verstecken? Esther verdient damit immerhin ihr Geld.«
Ihre Mutter Esther Grace hatte einen Laden in der Stadt, in dem sie natürliche und biologische Gesundheits- und Schönheitsprodukte verkaufte. Es gab Tinkturen gegen Kopfschmerzen, Salben aus Pflanzen, von denen ich noch nie gehört hatte, und Gesichtsmasken, die nach Erde und Regenwasser rochen. Einige ihrer Kreationen wurden auch in den teureren Apotheken und Drogerien verkauft.
»Willst du mir erzählen, dass ihre Gesichtscreme magisch ist?«, sagte ich zweifelnd.
Summer lachte. »Der Preis könnte einen das glauben lassen.« Sie stand auf und klopfte ihre schlanken Schenkel ab. »Komm. Ich bringe Emily lieber ihren Topf zurück.«
Ich rührte mich nicht. »Wir haben den Zauber nicht beendet. Oder jedenfalls sieht es so aus, als wären wir nicht fertig geworden.«
Summer sah mich an. Ich versuchte, nicht zu blinzeln. Ich hatte keine Ahnung, was sie dachte.
»Stimmt«, sagte sie nach einer Weile. »Willst du noch?«
Ich sagte nichts. Sie sank wieder auf die Knie, zog ein Streichholz aus der Schachtel und zündete es an.
»Brauchen wir den Spruch nicht mehr?«
»Hier ist noch eine Menge Energie übrig«, sagte Summer. »Besonders nach Thalias kleinem Anfall. Kann immer noch klappen.«
Sie ließ das brennende Streichholz in den Topf fallen. Ich sah nicht hin. Nur sie kannte die Gegenstände, die darin lagen. Der Geruch von brennenden Haaren zog an uns vorbei. Ich starrte auf den Boden, gab mich dem Augenblick hin und stellte mir sein Gesicht vor, während alles in Flammen aufging.
Es war mir egal, ob es falsch war. Ich konnte mir keine Moral leisten, wenn ich ihn für mich haben wollte.
5
Zwei Wochen zuvor hatte ich begonnen, mein eigenes Buch der Schatten zu schreiben.