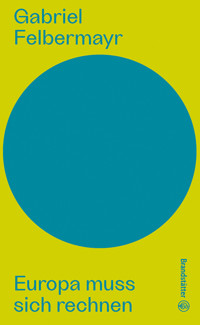Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ist unser Wohlstand in Gefahr? Während uns die Pandemie außenwirtschaftliche Abhängigkeiten schmerzlich vor Augen geführt hat und Putin Energieexporte als Waffe nutzt, legen Trump & Co. die Axt an genau jene Welthandelsregeln an, die die Welt so reich wie nie gemacht haben. China und die USA entkoppeln sich, die Globalisierung soll zurückgedreht werden. In der EU will man keine Freihandelsabkommen mehr, dafür Sanktionen gegen Schurkenstaaten, Lieferkettengesetze und Klimaprotektionismus zur Rettung der Welt. Der Freihandel weicht zunehmend geopolitischen und ökologischen Erwägungen. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind mit telstandsgeprägt und handelsorientiert – ihr Wohlstand steht auf dem Spiel. Die Außenhandelsexperten Felbermayr und Braml, beide mit langjähriger Erfahrung in der Politik(beratung), beleuchten überraschende Zusammenhänge, decken Irrglauben auf und zeigen Wege, wie unser Wohlstand trotz widriger Umstände erhalten und ausgebaut werden kann. Topaktuelle Analyse der Weltwirtschaftslage Von Handelskriegen, Protektionismus und Unfreihandel Wirtschaftsexperten mit hoher medialer Präsenz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Felbermayr & Martin Braml
Der Freihandel hat fertig
Gabriel Felbermayr & Martin Braml
Der Freihandel hat fertig
Wie die neue Welt(un)ordnung unseren Wohlstand gefährdet
Für Sophie und Markus
Bleiben wir verbunden!
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage amalthea.at und abonnieren Sie unsere monatliche Verlagspost unter amalthea.at/newsletter
Wenn Sie immer aktuell über unsere Autor:innen und Neuerscheinungen informiert bleiben wollen, folgen Sie uns auf Instagram oder Facebook unter @amaltheaverlag
Sie möchten uns Feedback zu unseren Büchern geben?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an [email protected]
Redaktioneller Hinweis:
In Fällen, in denen aus Gründen der Stilistik das generische Maskulinum verwendet wird, sind grundsätzlich immer alle Geschlechter gemeint.
Der Umwelt zuliebe #ohnefolie
© 2024 by Amalthea Signum Verlag GmbH, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung und Satz: Anna Haerdtl und Barbara Reiter mit Andrea Weingrill, Bureau A/O
Lektorat: Martin Bruny
Herstellung: VerlagsService Dietmar Schmitz, Erding
Gesetzt aus Freight Text Pro, Neue Haas Grotesk Display Pro, Ysans
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-266-2
eISBN 978-3-903441-34-7
INHALT
VORWORT
KAPITEL 1 WOHLSTANDSMOTOR FREIHANDEL
Eine kurze ideengeschichtliche Einordnung
Handelsoffenheit als Maß für Teilnahme am Welthandel
Der komparative Vorteil in Mitteleuropa
Auf die Wertschöpfung kommt es an
Die Güterhandelsstatistik
Warum Dienstleistungshandel immer wichtiger wird
KAPITEL 2 IST DIE WTO HIRNTOT?
Wie es zur Welthandelsorganisation kam
Das erste Grundprinzip des Welthandels: Meistbegünstigung
Das zweite Grundprinzip des Welthandels: Inländerbehandlung
Warum Handelsregeln?
Wie Handelsstreitigkeiten gelöst werden
Antidumping und die Frage, ob ein Ausgleich wirklich sinnvoll ist
Eine Frage der nationalen Sicherheit
Die Blockade der WTO-Gerichte
Warum die Großen mitmachen
Bilaterale Abkommen
Fazit
KAPITEL 3 COLBERTS VERMÄCHTNIS: EXPORTIEREN WIE DIE WELTMEISTER
Erklärbox: Leistungsbilanz
Warum Merkantilisten immer schon falschlagen
Von der Exportfinanzierung zum Auslandsvermögen
Wo Vermögen, da auch Schulden
Saldo der Leistungsbilanz und Arbeitslosigkeit
Die Struktur der Beschäftigung
Bilaterale Salden
Fazit
KAPITEL 4 TRUMPS HANDELSKRIEGE UND WAS SIE UNS LEHREN
Kalter Handelskrieg: Europa
Nachbarschaftsstreit: Mexiko
Vertane Chance: Pazifikregion
Die Mutter aller Handelskriege: Volksrepublik China
Das Vermächtnis der ersten Trump-Regierung
KAPITEL 5 WANDEL DURCH HANDEL?
Erklärbox: Externer Effekt
Über Krieg und Frieden
Handel als Beschaffungsexternalität: das Beispiel Erdgas
Sicherheit wurde zum blinden Fleck
Warum der Handel mit Diktaturen anders ist
Erklärbox: Kaufkraftbereinigung
Fazit
KAPITEL 6 ZURÜCK ZUR WIRTSCHAFTSSICHERHEIT
Resilienz versus Substitution
Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden
Abhängigkeiten verringern durch kluge Diversifizierung
Kapazitätsmärkte für Krisenfälle
Erklärbox: Kapazitätsmarkt
Fazit
KAPITEL 7 ANGRIFF IST DIE BESTE VERTEIDIGUNG
Die Umkehrung der klassischen Subventionspolitik
Branchenneutrale Förderung, die auf Technologien und Innovationen abzielt
Die Vorbereitung der Sanktionspolitik
Wirken Sanktionen überhaupt?
Wie umgehen mit Schmuggel?
Technologieausschluss
Fazit
KAPITEL 8 AUSLANDSDIREKTINVESTITIONEN: AUSVERKAUF VON TECH-JUWELEN?
Feindliche Übernahme
Erklärbox: Auslandsdirektinvestitionen
Investieren in China: Erzwungener Technologietransfer?
Investitionsschutz – Blinder Fleck des WTO-Rechts
Ausländische Infrastrukturinvestitionen als Stachel im Fleisch
Fazit
KAPITEL 9 FREIHANDEL UND NACHHALTIGKEIT
Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz
Der klimapolitische Rechenfehler: die Produktionsbasierung der Treibhausgasemissionen
Erklärbox: Grünes Paradoxon
CO2-Bepreisung und Grenzsteuerausgleich
Erklärbox: Emissionshandel
Klimaclub als Lösung?
Wie hältst du’s mit der Lieferkette?
Der falsche Weg: Europäische Lieferkettengesetze
Wie man es richtig machen sollte
Fazit
SCHLUSS: DER FREIHANDEL HAT FERTIG
ENDNOTEN
Vorwort
Der Freihandel hat fertig. Warum? Was hat das für unseren Wohlstand und unsere Sicherheit zu bedeuten? Was sollte nun passieren?
DIE AUTOREN beschäftigen sich schon viele Jahre mit den handelspolitischen Weichenstellungen der jeweiligen Zeit. Sie konzentrierten sich noch bis in das Jahr 2016 hinein auf Maßnahmen, die den Freihandel befördern sollten, wie das in Verruf geratene transatlantische Freihandelsabkommen TTIP oder andere ambitionierte Initiativen wie das geplante EU-Mercosur-Abkommen. Mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im Jahr 2016 geriet jedoch eine fast 30-jährige Freihandelsperiode an ihr jähes Ende, auch wenn Trumps Handelspolitik zwischen Protektionismus und Deal-Making hin- und herschwankte. Im Zuge des Brexits konnte der Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem Europäischen Binnenmarkt nicht verhindert werden. Auch darin sehen wir eine Abwendung von grenzüberschreitenden ökonomischen Verflechtungen.
Spätestens mit dem Ausbruch der Coronapandemie im Jahr 2020 erlebten wir hautnah, wie sehr unsere Volkswirtschaften im globalen Maßstab mit anderen Ländern verflochten sind. Lockdowns erzeugten weltweite Lieferschwierigkeiten, Staaten reagierten mit Abschottung. Alles hängt mit allem in komplexen und stets veränderlichen Netzwerken zusammen.
Seit 2022 werden wir in Europa Zeugen eines Eroberungs- und Vernichtungskrieges, der uns endgültig in eine neue Ost-West-Blockkonfrontation zurückkatapultiert. Dabei mussten wir mitansehen, wie Energie- und Weizenexporte strategisch ausgenutzt, ja sogar als Waffe missbraucht werden. Welche Abhängigkeiten hat der Welthandel noch geschaffen, die wir heute gar nicht im Blick haben? Wer besitzt noch eine Art Gashahn, mit dem er uns unter Druck setzen kann? Die Verunsicherung über den weiteren Fortgang dieser Entwicklungen ist groß. Manche fühlen sich nach 1913 zurückversetzt, andere an 1938 erinnert. Es ist Putins Werk und Chinas Beitrag.
Diese sechs Jahre zwischen 2016 und 2022 markieren eine epochale Wendung weg vom Ende der Geschichte (Francis Fukuyama). In der Rückschau wird man die Handelspolitik Trumps während seiner ersten Präsidentschaft nicht als Ursache, sondern eher als Katalysator für eine tieferliegende Entwicklung begreifen. US-Präsident Joe Biden führte die Handelspolitik seines Vorgängers fort, indem er an den massiven Handelsschranken gegen China festhielt und am 14. Mai 2024 mit einem gewaltigen Zollschlag (unter anderem 100-Prozent-Zölle gegen Elektrofahrzeuge) noch einen draufsetzte. »Fortiter in re, suaviter in modo.« (Hart in der Sache, gemäßigt in der Art und Weise.) Diese parteiübergreifende Position der USA findet sich auch in der Ablehnung der Rechtsprechung der Welthandelsorganisation (WTO) wieder, die bereits unter Barack Obama begann und die gesamte Organisation lähmt. Die WTO ist aber auch aufgrund historischer Pfadabhängigkeiten nicht in der Lage, angemessene Lösungen für die Probleme unserer Zeit zu finden. Ihre Liberalisierungsbemühungen verfangen nicht mehr.
Dagegen werden laufend neue Handelsbarrieren geschaffen, etwa mit Lieferkettengesetzen, der zollpolitischen Absicherung nationaler Klimapolitik und mit immer neuen Wirtschaftssanktionen. Auch hier zeigt sich eine Abkehr vom Freihandel als die idealtypische Zielvorstellung – ob berechtigt oder nicht, sei einmal dahingestellt. Der Nobelpreisträger und Erfinder des Vorschlags eines weltumspannenden Klimaclubs William D. Nordhaus (*1941) würde das Welthandelssystem nötigenfalls über Bord werfen, um damit das Klima zu schützen. Damit verfolgt er gewiss ein hehres Ziel, aber zu welchen Kosten? Mit den in Europa voranschreitenden Lieferkettengesetzen erleben wir einen neuen Protektionismus mit bestenfalls zweifelhaften Erfolgsaussichten. In einer deglobalisierten Welt wird es auf Dauer nicht einfacher, Wohlstand und Sicherheit für möglichst viele Menschen zu schaffen.
Der Harvard-Ökonom Dani Rodrik stellte noch in seinem Anti-Globalisierungs-Bestseller »The Globalization Paradox« aus dem Jahr 2011 die Frage, ob wir mit unseren ökonomischen Verflechtungen »nicht zu weit gegangen« wären. Er kritisierte, dass durch den weltweiten Freihandel Demokratie und nationale Selbstbestimmung ausgehöhlt wurden, weil die Logik der Märkte die Umsetzung nationaler Alleingänge erschwert oder gar verunmöglicht und weil immer mehr supranationales Recht die politische Macht unserer Parlamente relativiert. Die Globalisierungskritiker von damals sind heute, wenn nicht verstummt, so doch leiser geworden. Die Sorgen um die Globalisierung – und nicht die Angst vor der Globalisierung – treibt viele weit mehr um. Rodrik hatte allerdings recht: Wir gingen zu weit und büßten durch die Globalisierung an nationaler Souveränität ein. Nicht so sehr in seinem Sinne, sondern indem wir besorgniserregende Entwicklungen ignorierten und dem Irrtum aufsaßen, uns in der Hoffnung auf Wandel durch Handel wirtschaftlich an die teils ruchlosesten Diktaturen zu ketten.
Unsere Aufgabe ist es nun, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Unter dem Schlagwort der Wirtschaftssicherheit müssen westliche Staaten wieder ihre nationale Souveränität auch im ökonomischen Sinne zurückerlangen. Genauso muss es das Ziel sein, die Menschenrechtseinhaltung entlang der Lieferkette zu stärken und den Freihandel mit Klimaschutzpolitik kompatibel zu machen. Dabei sehen die Autoren jedoch die Gefahr, dass das Pendel zu sehr in Richtung Protektionismus zurückschwingt. Ein Autarkismus von der Wiege bis zur Bahre machte uns nicht nur bedeutend ärmer; vor allem würde die Welt dadurch nicht sicherer und gewiss auch nicht grüner. Vorsicht ist also geboten, denn es gibt viel zu verlieren: Es gilt, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Nie war die Welt als Ganzes so wohlhabend wie heute. Und die deutschsprachigen Länder Mitteleuropas spielen ganz oben mit: Unter 200 von der Weltbank erfassten Ländern liegt die Schweiz hinsichtlich des in Kaufkraftparitäten bewerteten BIP pro Kopf im Jahr 2019 an Stelle 10, Österreich an Stelle 18 und Deutschland an Stelle 23. Mehr als 93 Prozent der Weltbevölkerung leben in Ländern, die ein niedrigeres Durchschnittseinkommen aufweisen als Deutschland; nimmt man die USA aus, sind es gar fast 98 Prozent. Dieser Wohlstand ist nicht reichen Rohstoffvorkommen zu verdanken, wie etwa in einigen kleinen erdölexportierenden Ländern, die reicher sind als wir, oder steuerpolitischen Vorteilen für die Superreichen der Welt. Der heimische Wohlstand verdankt sich einer mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur, die allerdings auf den freien Welthandel angewiesen ist. Nur so finden hoch spezialisierte Unternehmen genügend Absatzmärkte und sorgen für Wohlstand und hohe Löhne in ihrer Heimat.
Die grundsätzliche Vorteilhaftigkeit des Freihandels ist unbestreitbar. Wir wollen daher die unterschiedlichen Motive für den Freihandel und die dahinterstehenden wissenschaftlichen Konzepte angemessen würdigen. Staatlich verordnete Handelsbeschränkungen – wir werden diese zuhauf diskutieren – sollen immer dem Idealtypus des Freihandels gegenübergestellt werden. Nicht der freie Handel ist rechtfertigungsbedürftig, sondern der Eingriff in diesen. Dabei versuchen wir, den institutionellen Rahmen des Welthandels sowie geschichtliche Hintergründe und Anekdoten in den aktuellen Kontext zu setzen. Auch mit dem einen oder anderen wirtschaftspolitischen Mythos möchten wir aufräumen. Gesonderte Erklärboxen zu manchen volkswirtschaftlichen Konzepten sollen zur besseren Lesbarkeit beitragen, denn wir wenden uns mit diesem Buch explizit an eine breite Leserschaft, die insbesondere Nichtvolkswirte und diejenigen einschließt, die bisweilen über die angesprochenen Themen nur beiläufig aus Nachrichten oder Zeitungen erfuhren. Die Autoren befassen sich seit Jahrzehnten mit dem Phänomen der Globalisierung und mit wirtschaftspolitischen Optionen zur Regulierung des weltweiten Wirtschaftslebens. Sie haben gemeinsam und getrennt zahlreiche wissenschaftliche Studien, Auftragsstudien für Ministerien, Institutionen und Verbände in verschiedenen Ländern durchgeführt und publiziert. Dabei stand bisher aber immer das Fachpublikum im Fokus der Autoren. Mit diesem Buch wollen wir auf eingängliche und (hoffentlich) unterhaltsame Art und Weise erklären, wie man konsistent über Globalisierung in einer Welt im Umbruch nachdenken kann.
Erste Ideen zu diesem Buch entstanden schon während Donald Trumps erster Präsidentschaft. Die rasante Schlagzahl an weltpolitischen Ereignissen führte nun erst zur umfänglichen Ausarbeitung und Fertigstellung. Für dieses Buch erhielten die Autoren keine Zuwendungen Dritter. Alle hierin vertretenen Ansichten sind ausschließlich die der Autoren und nicht die der mit ihnen in Verbindungen stehenden Institutionen.
Für wertvolle Hinweise und anregende Diskussionen möchten die Autoren in alphabethischer Reihenfolge folgenden Personen besonders danken: Richard Baldwin, Cosimo Beverelli, Chad Bown, Michael Eichenseer, Andreas Esche, Lionel Fontagné, Matthias Giesecke, Jasmin Gröschl, Inga Heiland, Martin Hellwig, Christoph Herrmann, Julian Hinz, Eckhard Janeba, Cora Jungbluth, Katrin Kamin, Alexander Keck, Wilhelm Kohler, Rolf Langhammer, Mario Larch, Dalia Marin, Devashish Mitra, Arash Molavi, Clifton Morgan, Martin Mosler, Simon Neumüller, Ralph Ossa, Thiess Petersen, Alexander Sandkamp, Hans-Werner Sinn, Moritz Schularick, David Streich, Jens Südekum, Constantinos Syropoulos, Feodora Teti, Erdal Yalcin und Yoto Yotov.
Kapitel1
Wohlstandsmotor Freihandel
»But the Russian invasion of Ukraine has put an end to the globalization we have experienced over the last three decades. We had already seen connectivity between nations, companies and even people strained by two years of the pandemic. It has left many communities and people feeling isolated and looking inward.«
Doch der russische Einmarsch in der Ukraine hat der Globalisierung, die wir in den letzten drei Jahrzehnten gekannt haben, ein Ende gesetzt. Wir hatten bereits erlebt, wie die Verbindungen zwischen Nationen, Unternehmen und sogar Menschen durch die zwei Jahre andauernde Pandemie belastet wurden. Sie hinterließ viele Gemeinschaften und Menschen mit dem Gefühl der Isolation und dem Blick nach innen.1
LARRY FINK (*1952)
DEUTSCHLAND, Österreich und die Schweiz sind offene Volkswirtschaften. Sie verfügen über wenige eigene Rohstoffe. Ihre mittelständisch organisierte Industrie und auch immer mehr Dienstleister sind hoch spezialisiert und leben vom Exportgeschäft. Auf Basis der internationalen Arbeitsteilung erreichten unsere Volkswirtschaften hohe Pro-Kopf-Einkommen und eine hohe Lebensqualität. Die freiheitliche Welthandelsordnung gerät nun aber seit gut zehn Jahren massiv unter Druck, und damit steht auch unser Wohlstandsmodell im Feuer. Seine Gegner sitzen nicht nur in Moskau, Peking oder bisweilen Washington; sie sind auch innerhalb unserer eigenen Gesellschaften zu finden. Die Globalisierung weckt nicht mehr Hoffnungen auf Wohlstand für alle, sondern schürt Ängste vor Kontrollverlust, Abhängigkeiten und ausländischen Erpressungsversuchen.
Handel gehört zur Fortschrittsgeschichte der Menschheit untrennbar dazu. Seit jeher trieben Menschen Handel – er ist nichts anderes als der Tausch wirtschaftlicher Güter. Handel ist immer für beide Seiten vorteilhaft, solange er freiwillig erfolgt, denn niemand würde einer Transaktion zustimmen, die individuelle Nachteile erzeugt. Handel erscheint als etwas sehr Natürliches, denn schon Kinder beginnen früh damit, Dinge untereinander zu tauschen oder mit ihren Eltern zu (ver-)handeln. Freier Handel liegt einer freien Gesellschaft zugrunde. Wir wollen einen engeren Fokus setzen und uns in diesem Buch mit dem internationalen Handel, dem sogenannten Außenhandel beschäftigen.
Die Unterscheidung zwischen Binnen- und Außenhandel ist erst sinnvoll, seit es staatliche Gebilde gibt. Damit blickt der Außenhandel zwar mittlerweile auf eine über 3000-jährige Geschichte, aber mitunter wirkt die Unterscheidung zwischen Binnen- und Außenhandel arbiträr: Wirtschaftlicher Austausch zwischen dem niederbayerischen Passau und dem oberösterreichischen Steyr – den Geburtsstädten der Autoren – fällt trotz einer Fahrdistanz von nur 139 Kilometern unter den Außenhandel, während etwa jener zwischen Passau und Flensburg mit einer Distanz von 979 Kilometern dem deutschen Binnenhandel zugerechnet wird. Dies ist so lange sinnvoll, wie der Nationalstaat unseren primären politischen Bezugsrahmen bildet. In der Europäischen Zollunion mit ihrer gemeinsamen Außenhandelspolitik sollte diese Unterscheidung aber an Relevanz verlieren. Es ist wenig verwunderlich und viel erforscht, dass der Handel mit der physischen Distanz abnimmt, sowohl innerhalb von Staaten als auch zwischen ihnen. Staatliche Grenzen wie die deutsch-österreichische stellen dennoch ein zusätzliches Handelshindernis dar, selbst wenn sich Währung, Sprache und Kultur gar nicht ändern. Gesetze, Regulierungen, Institutionen, Netzwerke und vieles mehr sind trotzdem anders. Innerhalb der EU ist der handelsabschreckende Effekt von nationalen Grenzen im Durchschnitt so hoch, wie das ein Zoll in der Höhe von 30 bis 60 Prozent wäre. Das sind sehr große Effekte, die den katalanischen Top-Ökonomen Jaume Ventura in einer aktuellen Studie zur Behauptung veranlasst, dass »Europa weit weg davon ist, einen gemeinsamen Binnenmarkt zu besitzen«.2
Außerhalb der EU sind diese Grenzeffekte noch mal virulenter. US-Präsident Trumps ehemaliger Handelsbeauftragter Robert Lighthizer (*1947) betitelte seine Memoiren, auf die wir noch an der einen oder anderen Stelle eingehen werden, mit der treffenden Feststellung: »No Trade is Free« (Kein Handel ist frei). Innerhalb gut integrierter Märkte, wie etwa jenem der USA, ist der Effekt von Grenzen als Handelsbarrieren allerdings um ein Vielfaches geringer, man ist also näher dran am idealtypischen Freihandel – obwohl auch dort etwa zwischen den vormaligen Parteien des Amerikanischen Bürgerkrieges (1861–1865) die Grenzen der Bundesstaaten immer noch deutliche handelssenkende Wirkungen haben.3 Globalisierung bedeutet, dass die handelsbeschränkende Wirkung von Grenzen abnimmt. Gleichzeitig haben Grenzen auch ihr Gutes, denn nur innerhalb von Grenzen kann ein Staat seine Klima- und Umweltpolitik umsetzen und seine Sicherheitspolitik definieren. Dieses Spannungsfeld ist Kern dieses Buchs.
Bevor wir auf den institutionellen Rahmen des Welthandels eingehen – die Regeln der WTO bilden trotz aller Unzulänglichkeiten nach wie vor die Basis dafür (vgl. Kapitel 2) –, wollen wir uns kurz der Geschichte der Globalisierung widmen und in die wesentlichen Theorien der Freihandelsliteratur einführen. Sodann tauchen wir in die Frage ein, ob es aus strategischen und ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll ist, Handelsüberschüsse zu erwirtschaften (vgl. Kapitel 3). Mit Blick auf die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen im November 2024 wollen wir in Kapitel 4 die Handelskriege aus der Zeit Trumps erster Präsidentschaft Revue passieren lassen und daraus Schlüsse für die Zukunft ziehen. Kapitel 5 befasst sich mit den derzeitigen geopolitischen Rivalitäten. In Kapitel 6 bis 8 diskutieren wir, wie es gelingen kann, kritische Abhängigkeiten zu verringern, Technologieführerschaft zu bewahren und Handelskriege auch offensiv zu führen – im Wesentlichen geht es dabei um handelsbeschränkende Maßnahmen. Der Anspruch dabei ist, trotz der Sicherung einer wohlverstandenen nationalen (oder europäischen) Souveränität so viel Freihandel wie möglich zu erhalten. Kapitel 9 zu Klima- und Menschenrechtsaspekten befasst sich ebenfalls mit Handelsbeschränkungen.
EINE KURZE IDEENGESCHICHTLICHE EINORDNUNG
Phönizier in der Antike, Venezianer im Spätmittelalter, Spanier und Portugiesen, die damit die Neuzeit begründeten, später Holländer und Briten – die Geschichte ist reich an Beispielen erfolgreicher Handelsnationen. Analytisch beschäftigten sich erstmalig die britischen Ökonomen Adam Smith (1723–1790) und David Ricardo (1772–1823) mit etwas, was man heute als die ersten Handelstheorien bezeichnet.
Auf Ricardo geht das bis heute fundamentale Konzept der komparativen Handelsvorteile (auch Kosten- oder Wettbewerbsvorteile) zurück: Danach haben selbst Länder mit einem absoluten Produktivitätsnachteil in der Produktion sämtlicher Güter in mindestens einem Gut einen komparativen Handelsvorteil. Ricardo leitet an seinem berühmt gewordenen Beispiel des Handels von Wein und Tuch zwischen Portugal und England, das heute jeder Erstsemesterstudent der Volkswirtschaftslehre kennenlernt, die Handelsgewinne her, die entstehen, wenn sich beide Volkswirtschaften auf ihren komparativen Vorteil spezialisieren. Die Arbeitsteilung schafft einen Mehrwert, weil sich die Länder auf die Herstellung jener Güter und Dienstleistungen spezialisieren können, bei denen sie im Vergleich zu anderen Branchen die höchste Produktivität aufweisen. Handel erlaubt allen teilnehmenden Ländern also gleichzeitig, ihre knappen Ressourcen in den Bereichen zu konzentrieren, in denen ihre Produktivität am höchsten ist.
Die Implikationen reichen allerdings weit über den simplen Lehrbuchfall hinaus: Auch wenn wir Handelsvorteile beziehungsweise -nachteile heute meist als Wettbewerbsfähigkeit bezeichnen, liefert uns diese Theorie die Rechtfertigung dafür, warum Handel selbst zwischen sehr unterschiedlichen Volkswirtschaften wie den reichen Ländern der Nordhalbkugel und den ärmsten Volkswirtschaften Afrikas für beide Seiten vorteilhaft ist. In einem ricardianischen Handelsmodell sind die Handelsgewinne – also die entstehenden Mehrwerte – umso größer, je unterschiedlicher die beteiligten Volkswirtschaften sind. Deutschland ist besser in der Fertigung von Maschinen und Argentinien in der Aufzucht von Rindern. Daher sollten Maschinen gegen Rindfleisch getauscht werden. In diesem Konzept ist der Handel mit Österreich aus deutscher Sicht weniger attraktiv; schlicht weil die Österreicher auch gute Maschinen bauen und die Rinderaufzucht ähnlich teuer ist wie in Deutschland.
Die Gründe für die komparativen Handelsvorteile sind bei Ricardo erst mal nachrangig. Entscheidend ist, wer ein Gut zu den geringeren relativen Kosten herstellen kann. Dabei nahm er Unterschiede im Klima und in der Bodenbeschaffenheit an, die für komparative Vorteile in Portugal bei Wein und in England bei Wolle sorgten. In modernen Volkswirtschaften sind es oft Unterschiede in den verfügbaren Produktionstechnologien und -verfahren.
Die schwedischen Ökonomen Eli Heckscher (1879–1952) und Bertil Ohlin (1899–1979) entwickelten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Handelsmodell, das die Struktur des Außenhandels als Folge von »Ausstattungen« liefert: Manche Länder sind mit viel Kapital ausgestattet, andere Länder wiederum mit einer großen Anzahl an Arbeitskräften. In einem kapitalreichen Land sind die Kapitalkosten relativ zu den Lohnkosten niedriger, folglich bilden sich in der kapitalintensiven Produktion komparative Kostenvorteile. Vice versa verfügt ein Land mit relativ vielen Arbeitskräften über komparative Vorteile bei der Produktion arbeitsintensiver Güter. Dass hoch entwickelte Volkswirtschaften heute einen Großteil ihrer Textilien importieren, liegt weniger daran, dass die Fertigungstechnik dafür nicht (mehr) bekannt wäre, sondern dass die Arbeitskosten dafür zu hoch sind.
Wir können heute mit dem sogenannten Balassa-Index die komparativen Vor- und Nachteile für alle Wirtschaftszweige und alle Volkswirtschaften quantifizieren. So ist nach wie vor empirisch klar, dass Deutschland, Österreich und die Schweiz in vielen Industriesektoren komparative Vorteile besitzen, wir gehen in Kapitel 7 darauf näher ein. Allerdings, das zeigen empirische Untersuchungen, wurden diese in den letzten Jahrzehnten kleiner. Wenn die Globalisierung für eine schnelle und gleichmäßige Verbreitung von Technologien sorgt, dann treten allmählich andere Determinanten komparativer Vorteile in den Vordergrund. Sowohl das Modell von David Ricardo als auch die Heckscher-Ohlin-Variante können nicht erklären, warum ein großer Teil des Handels zwischen Volkswirtschaften stattfindet, die einander sehr ähnlich sind. Produktionstechnologien dürften sich heutzutage insbesondere dadurch angeglichen haben, dass sie durch global operierende Unternehmen in aller Herren Länder gelangen. Damit entfiele ein Grund für David Ricardos Handel. Das Heckscher-Ohlin-Modell greift insofern jedoch zu kurz, als dass effiziente Produktion über unterschiedliche Input-Kombination gelingen kann. Die Automobilindustrie in Deutschland wurde mit der relativen Verknappung an Arbeitskräften über die Zeit immer stärker automatisiert und damit kapitalintensiver. Industrien sind dynamisch anpassungsfähig.
In den 1970er-Jahren, als neben der theoretischen Analyse immer bessere empirische Beobachtungen in den Wissenschaftskanon einflossen, konnten die Handelsstatistiken immer weniger mit den beiden Theorien in Einklang gebracht werden. Warum exportiert Frankreich Käse nach Italien und umgekehrt? Warum importieren die USA Automobile aus Japan und exportieren ihre eigenen anderswohin? Wenn die komparativen Vorteile rein industriespezifisch aufgeteilt wären, sollte man Käse oder Autos entweder importieren oder exportieren, aber nicht beides gleichzeitig. Statt interindustriellem Handel beobachtet man vorwiegend intraindustriellen Handel. US-amerikanische Ökonomen lieferten die Erklärung: Die nach ihren Erfindern benannten Dixit-Stiglitz-Präferenzen beschreiben Konsumwünsche in Form von Bündeln an Produktvarianten. Wer gerne Käse isst, möchte eben nicht nur eine Käsesorte essen, sondern eine Vielzahl genießen: Manchego aus Spanien, Parmesan aus Italien, Gruyère aus der Schweiz, französischen Camembert und so weiter. Waren kann man folglich nach ihrer Machart, den Zutaten und der Herkunft differenzieren. Anstelle von homogenen Gütern geht man heute bei den meisten Produkten von heterogenen Gütern aus. Rohstoffe sind typischerweise homogene Güter: Wer Benzin tankt, dem ist egal, ob es aus saudischem oder kolumbianischem Öl hergestellt wurde, ob Aral oder Shell oder Jet es vertreibt. Preis und Menge sind die einzig relevanten Faktoren. Aber schon ein Liter Milch ist nicht gleich ein Liter Milch: Regionalität, Tierfutter, Haltungsform und vieles mehr geben dem Produkt spezielle Charakteristika. Milch ist ein heterogenes Gut, unsere Supermärkte, Kaufhäuser, Modegeschäfte und Webstores sind voll mit verschiedenen Varianten aus denselben Güterklassen. Man kann getrost das Hauptanliegen aller Marketingabteilungen dieser Welt darin sehen, ihre Produkte möglichst stark auszudifferenzieren. Damit wird dann vielleicht sogar Benzin zum differenzierten Gut.
Durch die Annahme von Konsumpräferenzen, wonach die Verfügbarkeit möglichst vieler Varianten einen Mehrwert darstellt, und der Unterscheidbarkeit von Gütern ein und derselben Güterklasse wurde die sogenannte Neue Handelstheorie maßgeblich vom späteren Nobelpreisträger und heutigen Kolumnisten der »New York Times« Paul Krugman (*1953) entwickelt. Ab den 1980er-Jahren konnte damit erklärt werden, warum nahezu gleiche (aber nicht perfekt gleiche) Waren durch die Welt hin- und hergehandelt werden. Zu den Handelsgewinnen zählt nun auch die immer größer werdende Produktvielfalt, gerade bei individuellen Konsumwünschen ein nicht zu unterschätzender Mehrwert. Auch schlechtere Qualität verschwindet dadurch vom Markt. Die Ostdeutschen haben diese neue Vielfalt nach der Wiedervereinigung kennen- und schätzen gelernt. Den Russen kam sie infolge der Handelssanktionen nach der Annexion der Krim im Sommer 2014 und noch mehr nach dem 24. Februar 2022 teilweise abhanden.
All diesen Theorien ist aber eine zentrale Botschaft gemein: Die Möglichkeit, Handel zu treiben, schafft Mehrwerte, die weit über bloße Umverteilung hinausreichen. Die Spieltheorie nennt dies in Abgrenzung zum Nullsummenspiel ein Positivsummenspiel. Eine Partie Schafkopf oder Skat ist ein Nullsummenspiel: Was der eine am Tisch gewinnt, verliert der andere. Die Summe aller Gewinne und Verluste am Ende eines Spieleabends ist gleich null. Bei einem Positivsummenspiel ist dies anders, denn dabei kann jeder gewinnen. Roulette hingegen ist ein Beispiel für ein Negativsummenspiel, sofern man die Bank nicht als Spieler zählt, und genau deswegen bieten Spielkasinos nur solche Spiele an. Donald Trump (*1946) und seine zahlreichen Anhänger sitzen genau diesem fundamentalen Missverständnis auf, indem sie auch beim internationalen Handel eine Nullsummenlogik unterstellen. Wenn China so sehr vom Handel profitiert, müsse schließlich jemand anderer verlieren. Ein Win-Win findet in einer solchen Gedankenwelt keinen Platz.
HANDELSOFFENHEIT ALS MASS FÜR TEILNAHME AM WELTHANDEL
Die Außenhandelsquote Deutschlands lag 2021 bei 89 Prozent, in Österreich bei 111 Prozent und in der Schweiz sogar bei 130 Prozent. Sie ist ein Maß für die Handelsoffenheit einer Volkswirtschaft, also wie sehr ein Land in das internationale Handelssystem integriert ist, und errechnet sich, indem Importe und Exporte von Gütern und Dienstleistungen addiert und ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt werden. In anderen europäischen Ländern ist diese Quote geringer, zum Beispiel in Frankreich (61 Prozent), Italien (63 Prozent) oder dem Vereinigten Königreich (59 Prozent). In China liegt sie bei 37 Prozent, in den USA gar nur bei 25 Prozent.4 Woher stammen diese Unterschiede?
Grundsätzlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der Größe einer Volkswirtschaft und ihrer Offenheit. Danach gilt, dass kleinere Länder tendenziell offener sind. Dieser Zusammenhang ist kein Naturgesetz, zumal Handelspolitik eine große Rolle spielt. Nordkorea ist klein und de facto geschlossen für den internationalen Handel. Deutschland und Japan sind die dritt- und viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und relativ offen. Vielmehr ist dieser Zusammenhang ein Durchschnitt, siehe dazu Abbildung 1:
Abbildung1: Zusammenhang zwischen volkswirtschaftlicher Offenheit und Größe der Volkswirtschaft
Quelle: Daten der Weltbank von 2019. Eigene Darstellung (171 Länder). Die gezeigte Regressionsgerade hat eine Steigung von circa – 5. Das bedeutet: Ein Land, das ein um 100 Prozent höheres BIP als der Länderdurchschnitt aufweist, hat einen Offenheitsgrad, der um fünf Prozentpunkte unter dem Länderdurchschnitt (83 Prozent) liegt. Für das BIP ist eine logarithmierte Darstellung gewählt (log BIP).
Dieser grundsätzliche Zusammenhang folgt dennoch einer Logik: Internationaler Handel bedeutet internationale Arbeitsteilung. Arbeitsteilung ist dort am sinnvollsten, wo Spezialisierungsvorteile vorliegen und diese im Inland nicht erreicht werden können. Für Luxemburg mit seinen knapp 700.000 Einwohnern erschiene es wenig sinnvoll, wenn es eine eigene Automobilindustrie, Flugzeugindustrie, Fabriken für Kühlschränke und Fernseher und so weiter unterhalten müsste. Spezialisierung und technischer Fortschritt wären dann kaum erzielbar, weshalb kleine, geschlossene Volkswirtschaften – man denke wieder an Nordkorea als Extrembeispiel – so ineffizient wirtschaften und verarmen. Große Volkswirtschaften wie die USA mit ihren 330 Millionen Einwohnern oder China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern können dagegen schon im Inland viele Spezialisierungsvorteile erreichen. Deshalb können sie deutlich autarker sein. Bei den USA kommt hinzu, dass sie über viele Rohstoffe einschließlich fossiler Energien verfügen und ob ihrer gewaltigen Landesfläche – mehr als das Doppelte der EU – eine ungemein leistungsfähige Landwirtschaft hervorbrachten. Entsprechend ist der Bedarf an Importen geringer, und damit wird auch weniger exportiert. Eine wichtige Funktion von Exporten ist nämlich, Erlöse zu erwirtschaften, mittels derer Importe finanziert werden können. Möglichst hohe Exporte zu erzielen, wie es der Merkantilismus nach Jean-Baptiste Colbert (1619–1683) im vorrevolutionären Frankreich zum Staatsziel erklärte, widerspricht allen Grundprinzipien moderner Wohlfahrtstheorie. Exporte sind kein Selbstzweck, sondern Mittel, um Importe finanzieren zu können. Darauf – und ob sicherheitspolitische Überlegungen nicht doch eine Rechtfertigung des Colbert’schen Merkantilismus geben können – gehen wir in Kapitel 3 ein.
DER KOMPARATIVE VORTEIL IN MITTELEUROPA
Mitteleuropa ist deutlich ärmer an Rohstoffen als zum Beispiel die USA, sodass vieles zunächst importiert werden muss. Daraus entwickelte sich die Spezialisierung hin zur Weiterverarbeitung, auch Veredelung genannt. In den Veredelungsindustrien werden etwa aus Rohstahl Maschinen, aus Seltenen Erden Halbleiter und aus Erdöl Plastik hergestellt. Der Zweck der Importe ist dabei nicht immer der Letztverbrauch, sondern die Weiterverarbeitung. Das treibt mitunter bizarr anmutende Blüten: So wurde Deutschland etwa zum weltgrößten Exporteur von Kaffeeprodukten, ohne dass zwischen Garmisch-Partenkirchen und Flensburg je Kaffeebohnen kultiviert worden wären. Auch Schokolade aus der Schweiz erfordert offenbar keine heimische Kakaoproduktion. Die Spezialisierung auf die Weiterverarbeitung im Zuge der Globalisierung wurde charakteristisch für die Volkswirtschaften Mitteleuropas. Das verarbeitende Gewerbe ist damit der zentrale Wettbewerbsvorteil von Ländern wie Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Ausrichtung der Handelspolitik und die Konsequenzen aus neuen geopolitischen Gegebenheiten müssen dies mitdenken. Durch die Spezialisierung auf das verarbeitende Gewerbe entsteht nämlich eine doppelte Abhängigkeit vom außenhandelspolitischen Umfeld: einerseits von den Zulieferern, von denen die Inputs stammen, und andererseits von den Absatzmärkten, an die die Finalgüter verkauft werden sollen. Diese Mittellage in der Wertschöpfung hat erhebliche strategische Konsequenzen: Offene Märkte sind für das Wohl und Wehe der Staaten Mitteleuropas viel wichtiger als für andere Länder – die angeführten Außenhandelsquoten zu Beginn des Kapitels legen davon Zeugnis ab. Mittels moderner Handelsmodelle lässt sich ein Gefühl für die Größenordnungen ermitteln, die mit dem Welthandel zur Disposition stehen:
Abbildung2: Wohlfahrtsverluste bei Einstellung des internationalen Handels, in %
Quelle: Eigene Berechnungen.
Abbildung 2 entstammt einer aktuellen eigenen Studie, die untersucht, wie eine Abschottung von Volkswirtschaften vom Welthandel auf die Wohlfahrt – gemessen als das reale BIP pro Kopf – wirken würde.5 Dabei wird ein sehr umfangreiches Modell eingesetzt, das alle wesentlichen Länder der Welt auf detaillierter sektoraler Ebene erfasst und vor allem auch die komplexen inter- und intranationalen Lieferverflechtungen abbildet.
Große Volkswirtschaften wie die USA, China oder Indien würden weniger als zehn Prozent ihrer Wohlfahrt einbüßen, wenn sie in Autarkie leben müssten; mittelgroße Länder wie die Schweiz oder Österreich verlören mehr als 25 Prozent, die größere deutsche Volkswirtschaft knapp unter 20 Prozent, eine sehr kleine Volkswirtschaft wie Luxemburg sogar 80 Prozent ihres Wohlstands. Würden die globalen Wertschöpfungsnetzwerke (»kein Zwischengüterhandel«) zerstört, aber immerhin der Handel von fertigen Gütern bliebe erhalten, wären die Effekte naturgemäß kleiner. In den allermeisten Ländern wäre der damit verbundene Wohlfahrtsverlust jedoch größer, als wenn der Handel mit Finalgütern zum Stillstand käme. Solche Szenarien sind sicherlich extrem; sie illustrieren aber die zentralen Mechanismen, mit denen die internationale Arbeitsteilung unseren Wohlstand und unsere Art zu leben beeinflusst. Es steht einiges auf dem Spiel.
In letzter Konsequenz erfordern diese Außenhandelsverflechtungen und der damit verbundene Wohlstand eine sehr hohe Bereitschaft, den europäischen Binnenmarkt auszubauen (mindestens zu erhalten!), das Welthandelssystem gegenüber Protektionismus zu verteidigen und sich klug auf Handelskriege vorzubereiten (vgl. Kapitel 5 bis 7).
Ausweislich amtlicher Statistiken haben Österreich und die Schweiz Außenhandelsquoten von über 100 Prozent. Das ist kein statistischer Fehler, sondern deutet darauf hin, dass ein wesentlicher Teil der Importe eben wieder reexportiert wird, was die klassische Handelsstatistik unterschlägt: Es werden darin Umsätze erfasst, und diese führen zu Mehrfachzählungen, je öfter ein Gut Landesgrenzen passiert. Die Wertschöpfungskette eines in China gefertigten Smartphones kann wie folgt stilisiert beschrieben werden: Grafikelemente aus den USA, Software-Codes aus Frankreich, Silikon-Chips aus Singapur, Edelmetalle aus Bolivien. Nur etwa 30 Prozent des Handels finden in finalen Gütern statt, 70 Prozent sind Vorprodukte als Teil von Wertschöpfungsketten.6
AUF DIE WERTSCHÖPFUNG KOMMT ES AN
Wenn das bloße Ziel der Globalisierung möglichst viel Handel wäre, dann könnten wir den Welthandel ganz einfach dadurch verdoppeln, dass jegliche Ware, bevor sie ihr endgültiges Ziel erreicht, beispielsweise noch eine Station auf Malta macht und von dort aus wieder exportiert würde. Materiell änderte sich allerdings gar nichts an den ökonomischen Abhängigkeiten, nur die Transportkosten stiegen. Dies verdeutlicht, woran gewöhnliche Handelsstatistiken kranken. Um etwa festzustellen, wie wichtig der heimische Beitrag zum Endprodukt ist und welche ökonomischen Abhängigkeiten tatsächlich bestehen, muss auf den Handel im Sinne von Wertschöpfungsbeiträgen abgestellt werden. Die OECD führte hierzu eine entsprechende Datenbank ein (TiVA). Daraus lassen sich nicht nur viele Rückschlüsse über den Aufbau von Wertschöpfungsketten ziehen, sondern auch Abhängigkeiten besser bewerten.
In Deutschland liegt der heimische Wertschöpfungsanteil bei Güterexporten bei rund 78 Prozent, in Österreich bei 70 Prozent und in der Schweiz bei 77 Prozent (Zahlen für 2020). Die Differenzen zu 100 Prozent zeigen spiegelbildlich die Importabhängigkeit von Vorprodukten, die benötigt werden, um überhaupt exportieren zu können. Abbildung 3 gliedert diese Differenzen näher nach Partnerländern auf. Es zeigt sich für alle drei Volkswirtschaften, dass Inputs aus der Volksrepublik China quantitativ kaum relevanter sind als aus den USA, in der Schweiz haben sogar die USA die Nase leicht vorn. Dies spiegelt sich nicht so sehr in der amtlichen Handelsstatistik wider, die wie oben erwähnt den bloßen Bruttohandel misst. Ein Grund für die vergleichsweise hohe Bedeutung der USA liegt darin, dass 90 Prozent der US-Exporte wiederum tatsächlich US-amerikanischer Wertschöpfung entspringen, während Chinas Exporte zu rund einem Fünftel vorher von anderswo importierte Vorleistungen enthalten (häufig aus Japan, Korea und Taiwan). Dennoch wird man unseren Partnern in Übersee mit dem Hinweis, dass unsere wesentlichen Abhängigkeiten aus innereuropäischen Verflechtungen erwachsen, keinen Tort antun.
Dass insbesondere die Bedeutung Chinas häufig überschätzt wird, zeigt noch ein anderer Vergleich: Deutschland und Österreich importieren etwa im gleichen Maß Zulieferungen aus den Visegrád-Staaten – Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn – wie aus China. Dieses aggregierte Bild sagt noch wenig über produktspezifische Abhängigkeiten, die mitunter viel höher sein können. Aber es dient der quantitativen Einordnung davon, welches Land in welchem Ausmaß für uns wirtschaftlich wichtig ist.
Abbildung3: Importierte Wertschöpfung nach Partnerland, Anteil an Exporten, 2020, in %
Quelle: Daten von OECD-TiVa. Eigene Darstellung.
Inländische Wertschöpfungsanteile sind auch für andere wirtschaftspolitische Fragestellungen von höchster Relevanz: In Deutschland wird derzeit eine Debatte über eine vermeintlich stattfindende Deindustrialisierung geführt. Die Industrieproduktion, gemessen am Produktionsindex, liegt 2023 tatsächlich etwa 14 Prozent unter dem Niveau der Jahre 2017/18. Doch der Produktionsindex täuscht, denn gleichzeitig änderte sich die industrielle Wertschöpfung nicht merklich. Das bedeutet, dass die Wertschöpfungstiefe gestiegen sein muss, also weniger ausländische Wertschöpfung in der deutschen Industrie als Input dient.7 Es lohnt sich daher genau hinzusehen, bevor man wirtschaftspolitische Rückschlüsse zieht.
DIE GÜTERHANDELSSTATISTIK
Beim internationalen Handel denken wir üblicherweise an Waren, die von Fabriken meist per Lkw und seltener per Bahn zu Frachthäfen transportiert, dort zu Containertürmen gestapelt und schließlich auf gigantischen Schiffen durch die Weltmeere gefahren werden. Ganze 24.346 solcher standardisierter 20-Fuß-Container kann beispielsweise das weltgrößte Frachtschiff aufnehmen. Es zeigt damit die Dimension, in denen Handel des 21. Jahrhunderts stattfindet.8
Der Austausch dieser Waren wird in den amtlichen Import- und Exportstatistiken erfasst und monatlich veröffentlicht. Die Erfassung durch die Zollverwaltungen ist derart akkurat, dass nicht bloß die Zahl angelieferter Container oder der darin enthaltene Warenwert gemessen wird, sondern detailliert Buch über jeden einzelnen Warentyp geführt wird.
In der EU gibt es zur Klassifizierung von Gütern eine achtziffrige Systematik, wovon die ersten sechs Ziffern sogar weltweit harmonisiert sind: Hinter dem Code 84183020 verbergen sich beispielsweise hüfthohe Gefriertruhen mit einem Volumen von maximal 400 Litern. Dabei stehen die ersten beiden Ziffern für das Kapitel 84: »Kernreaktoren, Boiler, Maschinen und mechanische Anwendungen sowie Teile davon«. Der Viersteller 8418 spezifiziert dann näher: »Kühlschränke, Gefrierschränke, andere Kühl- und Gefriergeräte (elektrisch und andere) sowie Wärmepumpen und Klimaanlagen, sofern sie nicht unter 8415 fallen.« Der Sechssteller spezifiziert noch näher, der Achtsteller noch weiter. Wer einen mannshohen Gefrierschrank sucht, der sei auf 84184080 verwiesen, zumindest bei einem Volumen zwischen 250 und 900 Litern.
Wozu überhaupt eine solch akribische Buchführung? Die EU-Klassifizierung definiert rund 10.000 Güter, muss laufend an neue technische Entwicklungen angepasst werden und erfordert beim Abschluss eines Handelsabkommens, dass für alle diese Güter Zollsätze definiert werden. Wie so oft ist auch hier die Realität eine Reminiszenz der Vergangenheit: Traditionell waren Zölle auf Waren eine wichtige Einnahmequelle für Staaten, mitunter sogar die einzigen. Ein- und ausgehende Waren ließen sich seit jeher relativ leicht erfassen, sodass diese Form der Steuererhebung seit der Antike breite Anwendung findet. Kapitalertragssteuern, Lohnsteuern, Mehrwertsteuern hingegen erfordern eine deutlich komplexere Feststellung der Steuerbasis. Zur Zollerhebung reicht es, einen Zöllner am Wegesrand zu postieren oder auf die Hafenmauer zu setzen. Die Klassifikation hat allerdings ihre Tücken. Manche Segmente der Statistik sind extrem detailliert, auch wenn die Handelsströme klein sind – Lebensmittel etwa; andere, wichtige Bereiche, sind wenig untergliedert, zum Beispiel Personenkraftfahrzeuge.
Eine Anekdote über König Christian IV. von Dänemark und Norwegen (1577–1648) zeigt indes, wie kreativ man bei der Zollerhebung vorgehen kann: Zwischen 1426 und 1857 mussten ein- und ausfahrende Schiffe aus der Ostsee den sogenannten Sundzoll entrichten, wenn sie den Öresund passierten. Die Einnahme war wirtschaftlich sehr bedeutend für Dänemark und ein Ärgernis für alle Ostsee-Anrainerstaaten sowie die Städte der Hanse. Listige Händler versuchten damals, nicht anders als heute, den Warenwert ihrer Schiffsladungen bei der Zolldeklaration zu untertreiben, denn der Sundzoll war, wie heute auch die meisten Zölle, ein Ad-Valorem-Zoll, also ein wertbezogener Zoll (in Prozent des Warenwertes).9 Vom Jahr 1624 an behielt sich Dänemark allerdings das Recht vor, die Warenladung eines jeden Schiffs zu dem vom Kapitän deklarierten Wert zu kaufen. Damit war ein Anreiz hergestellt, den Warenwert wahrheitsgemäß zu deklarieren.10 Bis heute gilt dies als Musterbeispiel für ein Gesetz, das sich qua seiner Ausgestaltung selbst durchsetzt.
Heute sind Zolleinnahmen nur für weniger entwickelte Länder eine bedeutsame staatliche Einnahmequelle: In Namibia oder Botswana etwa machen diese über 30 Prozent des staatlichen Budgets aus.11 In hoch entwickelten Volkswirtschaften sind Zolleinnahmen dagegen vergleichsweise unbedeutend, sie tragen in Deutschland gerade einmal zu 0,7 Prozent zum Gesamtsteueraufkommen bei. Mitgliedstaaten der EU reichen diese abzüglich einer 25-prozentigen Erhebungsgebühr als sogenannte EU-Eigenmittel nach Brüssel weiter, denn die EU-Mitgliedstaaten bilden eine Zollunion, das heißt, ihre Mitglieder haben einheitliche Zölle nach außen und keine Zölle untereinander. Da die EU selbst nicht die Kapazität hat, Zölle zu erheben, ist die Erhebung aber weiterhin an die Mitgliedstaaten delegiert. Durch die prozentuale Beteiligung der Mitgliedstaaten am Zollaufkommen soll ein Anreiz gesetzt werden, diese auch ordentlich einzutreiben.12
Freihandelsabkommen beinhalten meist eine vollständige Aufhebung aller bestehenden Zölle. Dies legt nahe, dass Zölle kaum mehr der staatlichen Einnahmenerzielung dienen, ansonsten würde die EU nicht so eifrig Freihandelsabkommen mit anderen Staaten verhandeln. Bestehende Zölle sind meist als Schutzzölle gedacht, das heißt, sie sollen die heimischen Produzenten vor ausländischem Wettbewerb schützen (Protektionismus). Ist ein Zoll prohibitiv hoch, unterbindet er den Handel sogar vollständig. Damit lassen sich paradoxerweise überhaupt keine Einnahmen erzielen. Das Pendant zum Schutzzoll ist der aufkommensmaximierende Zoll.
Wie wir später noch sehen werden, ist die feine Granularität in der Güterhandelsstatistik sehr nützlich, etwa um spezifische Abhängigkeiten zu identifizieren. Theoretisch kann auf jedes der 10.000 Produkte ein anderer Einfuhrzoll gesetzt werden, auch unterschiedlich je nach Herkunftsland. Geschieht dies wohlüberlegt, fällt einem eine wirksame Waffe in Zollkriegen in die Hände (vgl. Kapitel 2 und 4).
WARUM DIENSTLEISTUNGSHANDEL IMMER WICHTIGER WIRD
Wir bezeichnen uns nicht ohne Stolz als »Industrienationen«, in Deutschland am liebsten noch mit dem Zusatz »führend«, wobei es zunehmend weniger selbstverständlich zu sein scheint, dass andere Länder Deutschland folgen wollen. In der Tat ist es die Industrie, in der ein großer Anteil des Produktivitätsfortschritts stattfindet, der für das gesamtwirtschaftliche Wachstum so wichtig ist. Die Industrie bezahlt typischerweise sehr gute Löhne für Menschen mittleren Ausbildungsniveaus und ist daher auch sozialpolitisch höchst bedeutend. Und sie ist für viele Dienstleistungsbetriebe, den Bau, den Rohstoffsektor und die Landwirtschaft ein sehr wichtiger Nachfrager.
Gleichwohl bleibt zu konstatieren, dass die Industriegüterproduktion in Deutschland und der Schweiz gerade einmal für 18 Prozent des BIP steht, in Österreich nur für 16 Prozent. In vielen hoch entwickelten Staaten liegt der Industrieanteil sogar noch niedriger, etwa im Vereinigten Königreich bei acht, in Frankreich bei zehn und den USA bei elf Prozent. Der Agrarsektor – neben der Industriegüterproduktion der zweite Sektor, der traditionell Waren herstellt, die auf Weltmärkten gehandelt werden – trägt in keinem der genannten Länder zu mehr als zwei Prozent zum BIP bei, in Deutschland und der Schweiz sogar zu weniger als einem Prozent. Die »Industriestaaten« sind in Wahrheit »Dienstleistungsstaaten«, denn im dominierenden Dienstleistungssektor werden zwischen 62 und 77 Prozent des BIP erwirtschaftet.13
Betrachtet man hingegen rein den Außenhandel, scheint die Bezeichnung Industrienation so falsch nicht: Hier beträgt das Verhältnis von Güter- zu Dienstleistungshandel etwa vier zu eins, es werden also viermal so viele Waren gehandelt wie Dienstleistungen. Was ist der Grund für diese Service-Schlagseite, und warum ist der Güterhandel so viel stärker internationalisiert?
Der US-amerikanische Ökonom Richard Baldwin (*1958) erklärt die Globalisierungsgeschichte anhand der Three Unbundlings, dreier großer technischer Revolutionen, die zur sukzessiven Auflösung von beinah allen natürlichen Handelsbarrieren führten: In der vorindustriellen Dorfwirtschaft waren Produktion und Konsum örtlich aneinandergeknüpft. Der Schmied produzierte, was er selbst und der Landwirt brauchten und umgekehrt. Städte waren zwar schon immer Handelszentren, aber alles von größerem Gewicht – Baustoffe, Grundnahrungsmittel, Werkzeuge – wurde selten über weite Wege gehandelt, am ehesten noch entlang von Flüssen. Der grenzüberschreitende Handel hingegen florierte insbesondere bei Luxusgütern: Seide aus China, Schokolade und Tabak aus der Neuen Welt, Porzellan aus Meißen, Salz aus dem Hochgebirge. Die Industrialisierung schuf mit Eisenbahn und großen Dampfschiffen schließlich gewaltige Transportkapazitäten, die physische Distanzen überwindbar machten. Mit diesen Transportkapazitäten fielen die Handelskosten dramatisch: Statt auf Postkutschen konnten Dinge schnell und günstig über die Weltmeere gefahren werden, die Landmassen der Kontinente wurden in der Tiefe erschlossen. Man denke etwa an den Bau der Transsibirischen Eisenbahn oder die Erschließung des amerikanischen Westens. Dadurch entwickelten sich völlig neue Wirtschaftsstrukturen. In Fabriken konnte die Massenproduktion einsetzen, und der lokale Überschuss an Waren konnte fast überallhin verkauft werden. Ohne entsprechende Transportkapazitäten in das gesamte Deutsche Reich hätte sich etwa die Kohle- und Stahlindustrie des Ruhrgebiets überhaupt nicht in dieser Größe herausbilden können. In den sich entwickelnden Produktionsclustern konnte schließlich ein viel höheres Maß an Spezialisierung erreicht werden, die Volkswirtschaften wurden arbeitsteiliger und damit effizienter.
Diese Transportrevolution hatte auch handelspolitische Implikationen zur Konsequenz: Massenproduktion erforderte große Absatzmärkte, die nicht durch Zölle geschlossen waren. Somit dürfte es kein Zufall sein, dass die Gründung des Deutschen Zollvereins 1834, der mit der wirtschaftlichen Kleinstaaterei Schluss machte (auch wenn Österreich, immerhin Teil des Deutschen Bundes, kein Teil davon war), in diese Zeit fiel. Ein Jahr später fuhr die erste deutsche Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth. Im Europa des 19. Jahrhunderts wuchsen die Reiche beständig, auch um die Binnenmärkte zu erweitern. Der Nationalismus verfolgte ökonomische Ziele. Die Suche nach Absatzmärkten setzte sich fort als Great Game