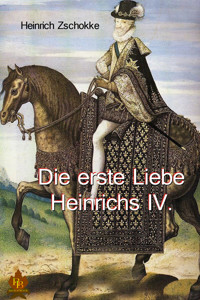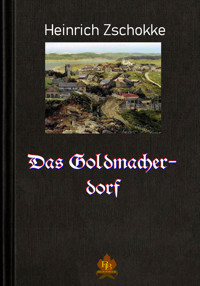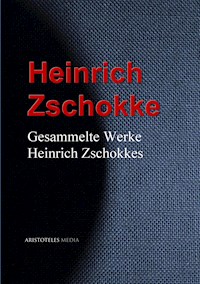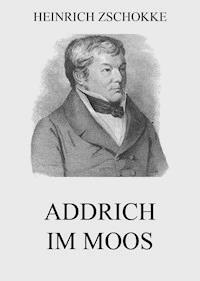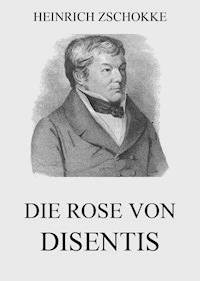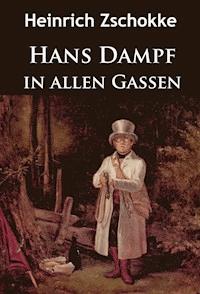Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
"Der Freihof von Aarau" ist ein spannender historischer Roman, der ins Mittelalter zurück führt und während des Zürichkriegs von 1444 von den Konflikten der noch sehr jungen Schweiz berichtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Freihof von Aarau
Heinrich Zschokke
Inhalt:
Heinrich Zschokke – Biografie und Bibliografie
Der Freihof von Aarau
1. Des faulen Friedens Ende.
2. Die Gesellschaft.
3. Der Lollhard.
4. Die Begutte.
5. Der Schultheiß von Brugg.
6. Die Braut.
7. Das Gastmahl des Schultheißen.
8. Der Ritt nach Aarau.
9. Der alte Rüdiger.
10. Die nächtliche Erscheinung.
11. Der Zug nach Seckingen.
12. Ritterliches Wohlleben.
13. Erklärung.
14. Der Nachtbesuch.
15. Die Ritterversammlung.
16. Die nächsten Folgen der Versammlung.
17. Schloß Greifensee.
18. Belagerung und Mordtag.
19. Die Hütte am Katzensee.
20. Die Erzählung.
21. Das Wiederfinden
22. Der zweite Besuch.
23. Böses Begegnen.
24. Fromme Unterhaltung.
25. Die Zigeuner
26. Die Entführung.
27. Die Ritter zu Gösgen.
28. Der Anschlag auf Aarau.
29. Panischer Schrecken.
30. Eine Umfahrt von zwei Tagen.
31. Die Mordnacht.
32. Die Zerstörung der Burg Gösgen.
33. Der Schatz von Grimmenstein.
34. Die Schlacht bei St. Jakob.
35. Freund und Feind.
36. Feierabend.
37. Nachwort.
Der Freihof von Aarau, H. Zschokke
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849640392
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Heinrich Zschokke – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, geb. 22. März 1771 in Magdeburg, gest. 27. Juni 1848 auf seinem Landsitz Blumenhalde an der Aare, Sohn eines wohlhabenden Tuchmachers, erhielt seine Bildung auf der Klosterschule und dem Altstädter Gymnasium seiner Vaterstadt, entfernte sich von dort plötzlich im Januar 1788, war ein Jahr Hauslehrer in Schwerin und trieb sich hierauf zwei Jahre hindurch als Theaterdichter mit einer wandernden Schauspielertruppe umher. 1790 bezog er die Universität in Frankfurt a. O., wo er Theologie und Philosophie, dann aber die Rechte studierte. Damals schrieb er seinen Roman »Abällino, der große Bandit« (Frankf. 1794), der bald darauf dramatisiert (das. 1795) über die meisten Bühnen Deutschlands ging. 1792 habilitierte er sich in Frankfurt als Privatdozent, ergriff aber im Mai 1795 den Wanderstab und ließ sich im September 1796 in Graubünden nieder, wo er in Reichenau die Leitung einer Erziehungsanstalt übernahm. Z. schrieb hier die »Geschichte des Freistaats der drei Bünde im hohen Rätien« (Zür. 1798, 2. Aufl. 1817). Nach Aufhebung des von Z. glänzend in die Höhe gebrachten Instituts zu Reichenau infolge der Zeitumstände 1798 ward Z., auf der Seite der gemäßigten Patrioten stehend, in Aarau Deputierter bei den helvetischen und französischen Behörden, 1799 Chef für das Departement des Schulwesens und Regierungskommissar des helvetischen Vollziehungsrats in Unterwalden, später auch in Uri, Schwyz und Zug. Auch rief er einen Verein zur Förderung des Gemeinsinnes ins Leben und begründete den »Aufrichtigen Schweizerboten«, ein einflussreiches Volksblatt. 1800 zum Regierungskommissar ernannt, organisierte er die italienische Schweiz (Kanton Lugano und Bellinzona). Als Regierungsstatthalter des Kantons Basel, wo die Bewegungen wegen des Bodenzinses und Zehnten einen aufrührerischen Charakter angenommen hatten, warf sich Z. mit persönlicher Gefahr dem Aufstand entgegen und hatte die Genugtuung, dass die Aufständischen seiner beschwichtigenden Rede sich fügten (Oktober 1800). In seinen Mußestunden arbeitete er an den »Historischen Denkwürdigkeiten der helvetischen Staatsumwälzung« (Bern 1803 bis 1805). Als nach dem Lüneviller Frieden die Zentralregierung in Bern sich anschickte, den abgeschafften Föderalismus wiederherzustellen, nahm Z. seine Entlassung und lebte zurückgezogen seinen Lieblingswissenschaften. Im Frühjahr 1802 kaufte er sich dem Schloss Biberstein bei Aarau gegenüber ein ländliches Besitztum. 1804 ernannte ihn die Regierung des Kantons Aargau unter Erteilung des Staatsbürgerrechts zum Mitglied des Oberforst- und Bergamtes, in welcher Eigenschaft ihm zuletzt die Leitung des gesamten Forst- und Bergwesens anvertraut wurde. In dieser Stellung schrieb er: »Der Gebirgsförster« (Aarau 1804, 2 Bde.) und »Der Alpenwäldler« (Stuttg. 1804). Durch den 1804 wieder aufgenommenen und mit allgemeinem Beifall begrüßten »Aufrichtigen und wohlerfahrenen Schweizerboten« und nachher durch »Des Schweizerlandes Geschichte für das Schweizervolk« (Zür. 1822; 8. Aufl., Aarau 1849) wirkte er gesund, kräftig und nachhaltig auf die politische und sittliche Neugestaltung seiner zweiten Heimat. Die von ihm 1807–13 ununterbrochen herausgegebenen »Miszellen für die neueste Weltkunde« zeichneten sich durch Reichtum des Inhalts und treffendes Urteil aus. Daneben gab Z. seit 1811 die Monatsschrift »Erheiterungen« heraus, in der er den größeren Teil seiner Erzählungen veröffentlichte. 1810 siedelte er von Biberstein nach Aarau über; in den Jahren 1813 und 1814 beschwor er das Feuer der Zwietracht mit Worten der Mäßigung und Vernunft, während er zugleich die Rechte und Freiheiten seines Kantons glänzend verteidigte. 1814 wurde er im Aargau in den Großen Rat der Gesetzgeber gewählt. Von Schlichtegroll aufgefordert, für die »Denkschriften der Münchener Akademie« einen Abschnitt der bayrischen Geschichte zu bearbeiten, schrieb er seine »Geschichte des bayrischen Volkes und seiner Fürsten« (Aarau 1813–18, 4 Bde.; 2. Aufl. 1821), die sich durch lichtvolle Anordnung und warme Darstellung auszeichneten. 1817 und 1818 erbaute er sich am linken Ufer der Aare, am Fuß des Jura, der Stadt Aarau gegenüber, ein anspruchsloses Landhaus, die »Blumenhalde«. Als Fortsetzung der »Miszellen für die neueste Weltkunde« erschienen die »Überlieferungen zur Geschichte unsrer Zeit« (Aarau 1817–23). Unterdessen waren Hass und Verleumdung unablässig gegen ihn tätig gewesen. Zwar überhäufte ihn sein neues Vaterland mit Ämtern aller Art, aber viele sahen in Z. nur den Mann der Revolution, einen Feind der Religion und bürgerlichen Ordnung und verdächtigten ihn auf der Kanzel und in Flugschriften und öffentlichen Blättern. Als Gesandter des Aargaues musste Z. 1833 bei der Tagsatzung in Zürich zu dem Beschluss mitwirken, dass sich der Kanton in zwei ungleiche Hälften schied. Da der Verfassungsrat des Aargaues 1831 beschlossen hatte, dass jeder nicht geborene Schweizer von Staatsämtern ausgeschlossen sein sollte, trat Z. aus, wurde indes bei einer Umgestaltung der Dinge nochmals als Mitglied des Großen Rates berufen. Mehr und mehr aber zog er sich von der Öffentlichkeit und seinen Ämtern zurück, um sich mit Muße seinen literarischen Arbeiten widmen zu können. 1894 wurde ihm in Aarau ein Standbild (von A. Lanz) errichtet. Eine Reihe seiner Erzählungen sind gesammelt in den »Bildern aus der Schweiz« (Aarau 1824–25, 5 Bde.), den »Ausgewählten Novellen und Dichtungen« (11. Aufl., das. 1874, 10 Bde.) und der »Ährenlese« (das. 1844–47, 4 Bde.). Seine »Ausgewählten historischen Schriften« erschienen Aarau 1830, 16 Bde.; seine »Gesammelten Schriften« daselbst 1851–54, 35 Bde. in 3 Abtlgn. Das verbreitetste und wirksamste aller seiner Werke aber, als dessen Verfasser er sich später bekannte, sind seine »Stunden der Andacht« (Aarau 1809–16), der vollkommenste Ausdruck des modernen Rationalismus (37. Aufl. »nach den Bedürfnissen der Gegenwart revidiert und geordnet« von Emil Zschokke, 1903). Eine Art Selbstbiographie ist die »Selbstschau« (Aarau 1842; 7. Aufl. 1877, 2 Bde.). Obgleich Z. in seinen Novellen und Dichtungen weder neue Bahnen brach, noch die sozialen Fragen in seine Darstellungen aufnahm, sich überhaupt als poetischer Eklektiker zeigte, haben sie doch durch künstlerische Besonnenheit, ausgezeichnete Charakterschilderung und glückliche Lebendigkeit des Vortrags eine große Verbreitung gefunden, wie kaum andre Erzeugnisse dieser Art. Auszuzeichnen unter seinen Novellen und Volkserzählungen sind: »Alamontade der Galeerensklave«, »Die Herrnhuterfamilie«, »Der Narr des 19. Jahrhunderts«, »Der Abend vor der Hochzeit«, »Abenteuer einer Neujahrsnacht«, »Meister Jakob«, »Die Branntweinpest«, »Das Goldmacherdorf« (worin er mit Pestalozzis »Lienhard und Gertrud« wetteifert), »Der Freihof von Aarau« und »Addrich im Moos«. Zschokkes »Sämtliche Novellen« gab Vögtlin heraus (Leipz. 1904, 12 Bde.; auch Auswahl in 6 Bdn.). Vgl. Emil Zschokke, H. Z., ein biographischer Umriß (3. Aufl., Berl. 1876); Born, Heinrich Z. (Basel 1885); J. Keller, Beiträge zur politischen Tätigkeit H. Zschokkes 1798–1801 (Aarau 1887); Wernly, Vater Heinrich Z. (das. 1894); Schneiderreit, Heinrich Z., seine Weltanschauung und Lebensweisheit (Berl. 1903).
Der Freihof von Aarau
1. Des faulen Friedens Ende.
Man weiß sehr gut, daß Leser und Leserinnen, besonders wenn sie Erheiterung suchen, die Vorreden nicht lieben. Diesmal aber kann ihnen selbst Rom keine Dispensation vom Lesen der meinigen geben, wenn sie anders als Ehrenleute in den Freihof treten wollen, das heißt: durch die zu öffnende Pforte des Burggrabens. Die Vorrede ist der Schlüssel. Wer auf die Ringmauer steigt, wird freilich auch von dem etwas sehen, was im Friedhof vorgeht: aber nur das Dach, nicht das Haus; nur die Kappe, nicht das menschliche Antlitz.
Es ist bekannt, daß die Schweizer ehemals, ehe sie ihr bürgerlich freies und glückliches Heimwesen bequem einrichten konnten, mit Adel und Geistlichkeit viel abzuthun hatten. Besonders in der nordöstlichen Hälfte der Schweiz war der Adel und das Haus Österreich noch im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts mächtig und begütert. Da lagen die Besitzungen und Hoheitsberechtigungen des Erzhauses zwischen denjenigen der freien Reichsstädte und Reichsländer der Eidgenossenschaft in größter Verwirrung, die durch menschliche Klugheit schwer zu lösen gewesen wäre, durcheinander.
Was körperliche und geistige Gewalt der Sterblichen nicht vermögen, vollführt oft mit einem einzigen Schlage das Schicksal. Die durch Huß' Scheiterhaufen berühmt gewordene Kirchenversammlung zu Konstanz hatte dem Gegenpapst Johann die dreifache Krone abgesprochen. Herzog Friedrich von Österreich nahm den verunglückten Statthalter Christi trotzdem in Schutz, was den heiligen Vätern in Konstanz ein großes Ärgernis sein mußte. Sie schleuderten deshalb ihren feurigsten Bannstrahl gegen ihn. Vermutlich hätte aber dieser auch schon zu jener Zeit mehr geblitzt, als gezündet, wenn ihnen nicht der Arm Siegmunds von Böheim, des römischen Königs, zu Hilfe gekommen wäre. Dieser Fürst, der den Mangel an innerer Kraft und äußerer Macht durch Prunk zu ersetzen oder zu verhüllen glaubte, hatte in denselben Tagen die Freude genossen, vielen Reichsstädten mit allem Gepränge damaliger Zeit ihre Lehen zu erteilen. Nur der mächtigste Herr in diesen Gegenden Deutschlands, Herzog Friedrich, hatte es abgewiesen, nach Konstanz zu kommen. Die schmerzlich gekränkte Eitelkeit des Königs trat daher mit dem Zorn der heiligen Versammlung willig in Bund. Er erklärte zwar den Herzog seiner Länder verlustig; leider fehlte es aber dem Könige an Geld und Soldaten, der Achterklärung Nachdruck zu geben. Er wandte sich deshalb an die Eidgenossenschaft, ermunterte, sie, sich der Besitzungen Österreichs in ihren Nachbarstaaten zu bemächtigen, und gab ihnen alle Hoffnung, daß sie Eigentümer ihrer Eroberungen bleiben sollten.
Zum Glück hatten die Schweizer erst drei Jahre vorher dem Herzoge einen fünfzigjährigen Frieden geschworen. Wiewohl sie nun bis dahin mit dem Erzhause in beständigen Kriegshändeln gewesen waren, hielten sie es doch für unehrlich, wo der Herzog im Unglück sei, wider ihn das Kriegsbanner zu erheben und den geschworenen Eid zu brechen. Der Adel im Thurgau und Schwabenland hingegen war darin weniger gewissenhaft. Er hoffte sich Land und Leute, Lehen und Reichsfreiheit zu erobern, fiel vom Herzoge ab und begann die Fehde. Als dies die Eidgenossen sahen und die heiligen Väter von Konstanz, kraft des Schlüssels Petri zu binden und zu lösen, ihnen wegen der Sünde des Eides- und Friedensbruches beruhigende Zusicherungen gaben, wurden sie doch nach guter Beute lüstern; Bern zuerst. Es rückte mit all seiner Mannschaft und dem groben Geschütz in den offenen, wehrlosen Aargau ein, längs den Ufern der Aar hinabziehend. Schnell folgten Solothurn und Freiburg unter des heiligen Reiches Bannern. Nun wollten auch Zürich und Luzern und die übrigen Schweizer nicht zurückbleiben und sich ihres Anteils versichern. In wenigen Tagen war alles österreichische Erbland in Helvetien von ihnen besetzt.
In den durch Überraschung fast blutlos eroberten Landen saß damals, auf Burgen und Schlössern, ein zahlreicher Adel. Ihm war es nicht gelegen, mit gemeinen Bürgern und Bauern zu halten; er zählte sich lieber zum Planetensystem einer königlichen Sonne, von deren Strahlen er seinen Glanz borgen konnte. Doch aus der Not machte er sich eine Tugend. Er gehorchte den Schweizern, aber mit dem heimlichen Vorsatz, früh oder spät dem Hause Österreich wieder zu Ehren und Recht zu verhelfen.
Unter allen Edeln im helvetischen Hochlande war zu jener Zeit der Graf von Toggenburg der Reichste an Grundbesitz. Seine Güter erstreckten sich von den Grenzen Tyrols, aus dem rhätischen Gebirge, abwärts bis zum Zürichersee. Mit den Eidgenossen hielt er aus Klugheit gute Freundschaft. In der Stadt Zürich hatte er Burgrecht, im Lande Schwyz Landrecht. Er mochte noch große Entwürfe hegen, als er ohne nahe Verwandte und eine letztwillige Verfügung zu hinterlassen starb.
Indessen zu einer stattlichen Erbschaft finden sich bekanntlich leicht die Erben. Unter denen, die hier auftraten, erschienen auch, und in erster Linie, Zürich und Schwyz. Die Züricher wollten ihn als ihren Mitbürger, die Schwyzer als ihren Mitlandsmann beerben. Als Zürich unbeugsam blieb, erhoben alle Eidgenossen ihre Waffen gegen die stolze Stadt und zwangen sie zu einem Frieden, eben so schmerzlich für die Ehre, als nachteilig für das Vermögen der Stadt. Das ertrugen die Züricher nicht. Sie wandten sich heimlich an den neuen römischen König, Friedrich von Österreich; warben um seinen Beistand gegen die Eidgenossen; spiegelten ihm vor, wie sie mit anderen benachbarten Herren und Städten eine neue Eidgenossenschaft unter der Hoheit Österreichs bilden, ja ihm wieder zum Besitz der dem Erzhause früher entrissenen Erblande verhelfen könnten.
Die Züricher meldeten zwar den übrigen Ständen der Eidgenossen, daß sie, in ihrem Bunde mit Österreich, sich die Rechte der eidgenössischen Verbindung vorbehalten, und durchaus friedfertige Gesinnungen hätten. Allein wer hätte ihnen glauben mögen? Innerhalb ihrer Mauern saß nun Markgraf Wilhelm von Hochberg und Röteln, der Herrschaft Österreich Statthalter in den vorderen Landen, welchem der König alle Geschäfte in seinem Namen zu führen übergeben hatte; ferner Thüring von Hallwyl, aus dem aargauischen Adel, in des Königs Diensten, war Kriegsoberster zu Zürich, und die Stadt wimmelte von fremden Söldnern und Kriegsknechten, die auch Rapperswyl am Zürichsee besetzt hielten und dort grausamen Mutwillen mit den Leuten trieben, die etwa aus Schwyz, Glarus oder Zug dahin zu Markte kamen. Alles Unterhandeln und Vermitteln blieb erfolglos. Der Grimm des Volkes forderte den Krieg gegen die abgefallene Stadt. Von allen Seiten kamen Boten nach Zürich mit Absagebriefen der Eidgenossen an den Herzog von Österreich und an die Stadt. Die Banner beider Teile brachen gegen einander auf, und der Bürgerkrieg erneuerte sich mit allen seinen Gräueln.
Die Eidgenossen, in den meisten Gefechten und Treffen Sieger, verwüsteten die schönen Ufer des Zürichersees. Nachdem die erste Wut ausgetobt, nachdem unter der Gewalt der Eidgenossen Bremgarten, Regensburg und Grüningen gefallen, die Vorstädte von Zürich selbst schon eingenommen, Bürgermeister Stüssy und viele andere im Kampfe für die Stadt erschlagen, Laufenburg und Rapperswyl belagert und in großer Not waren, ließ man sichs endlich wieder gefallen, vom Waffenstillstande zu reden.
Es ritt von Zürich hinaus, ins Lager der Eidgenossen, der Bischof von Konstanz und mahnte zur alten Liebe. Das hohe Alter und die salbungsvolle Beredsamkeit des vielvermögenden kranken Herrn rührte die Häupter und Gemeinen der Eidgenossenschaft. Es wurde darauf im Felde von Rapperswyl, am St. Laurenzisabend 1443, ein Waffenstillstand geschlossen, welcher bis zum St. Georgentag des Jahres 1444 dauern sollte. Die Haufen der Krieger zogen indessen in ihre Heimat zurück; das Volk jedoch murrte unzufrieden und nannte diese Ruhe, welche nur eine Erholungsfrist für Zürich und Österreich sein würde, den elenden oder faulen Frieden.
Und das Volk hatte recht. Der kurze Zeitraum wurde weniger zur Herstellung einer dauerhaften Versöhnung, als zu größeren Rüstungen benutzt. Früher schon hatte der Markgraf von Hochberg den gewandten Unterhändler, Herrn Peter von Mörsberg, mit glänzender Begleitung von Freiherren, Rittern und Edelknaben an den französischen Hof gesandt. Herr Peter, schlau, von gefälligen Sitten und der französischen Sprache mächtig, war in seiner Unterhandlung um so glücklicher gewesen, da Frankreich von Scharen unbeschäftigten Kriegsvolkes wimmelte, die bisher gegen Burgund und England und in den bürgerlichen Kriegen gedient hatten. Diese zahlreichen und zuchtlosen Horden, die man Armagnaken nannte, weil sie Graf Bernhard von Armagnac, Connetable von Frankreich, zuerst geworben und nach ihm auch sein Sohn Johann von Armagnac, befehligt hatte, waren die Plage und der Schrecken des Landes geworden. Sie wurden von den Franzosen selbst nur Schinder geheißen. Nichts greuelvolleres konnte es geben, als diese Rotten im Kriege zu sehen, die, mitten im Frieden, Raub und Mord nicht scheuten.
Der König von Frankreich versprach dem Kaiser, ihm diese Horden zu überlassen. Auch der Papst ermunterte, so dringend, wie der Kaiser, die Armagnaken bald in die Schweiz zu senden, denn er schmeichelte sich, das Erscheinen derselben vor Basel werde die ihm lästige Kirchenversammlung, welche damals in der alten Stadt ihre Sitzungen hielt, auseinander sprengen. Dem Könige von Frankreich aber selbst kamen die Bitten des Kaisers und des Papstes wohlgelegen, weil er dabei auch für seine eigene Krone Eroberungen zu machen hoffte. Er ließ die furchtbaren Armagnaken zusammenziehen und bot dazu noch frisches Kriegsvolk auf, also, daß er ein für jene Zeiten gewaltiges Heer von fünfzigtausend Mann zusammenbrachte. Davon sollten zweiunddreißigtausend Mann mit dem Dauphin gegen Basel ziehen.
Während dieser Rüstungen war die Frist des faulen Friedens indessen fast verstrichen. Noch hatten sich die sieben Orte der Eidgenossenschaft mit Zürich nicht ausgeglichen. Durch den Bischof von Konstanz war schon zweimal vergebens ein Tag zu Baden im Aargau angesetzt worden, um den Frieden zu vermitteln. Nun aber Peter von Mörsberg aus Frankreich nach Zürich zurückkam und zwar ein tröstliches Bild von den ungeheuren Rüstungen des allerchristlichsten Königs entwarf, jedoch zugleich daran erinnerte, daß sich der Heranzug von dessen Heeresmacht noch verzögern könne, fand man es nachgerade wohlgethan, um Zeit zu gewinnen, Unterhandlungen zu Baden zu eröffnen. Es wurde zu Baden zehn Tage hin und her geredet. Als aber der Markgraf von Hochberg zuletzt verlangte, man solle den Waffenstillstand verlängern, und als hingegen die eidgenössischen Gesandten das Gerücht vom Anzuge des französischen Heeres gegen die Schweizergrenzen vernahmen, wurde alle Verhandlung abgebrochen. »Nichts mehr mit diesem faulen Frieden!« riefen die Eidgenossen. »Fort! Gott und unser Arm helfe uns zu unserm Recht! Hier riecht es nach Betrug und Verrat!«
Jetzt lag dem kaiserlichen Statthalter vor allem daran, die Städte des Aargau's und noch mehr den aargauischen Adel zu thätiger Mitwirkung für das Haus Österreich zu bewegen und von Bern abwendig zu machen. Dazu erschien ihm Ritter Marquard von Baldegg willkommen, der desselbigen Tages in Baden eingetroffen war. Dieser, dessen Väter in den Schlachtfeldern von Morgarten und Sempach für Österreich gefallen waren, dessen Stammburg am Baldegger-See die Eidgenossen schon vor mehr denn hundert Jahren zerstört hatten, war jetzt im Besitz des Schlosses Schenkenberg, einer der größten Herrschaften im Aargau. Er war der bitterste Feind der Eidgenossen.
Als Marquard durch den Markgrafen die zuverlässige Anzeige vom Anzuge des Dauphins und der Armagnaken vernahm, schöpfte seine Rachsucht neuen Mut. Er erbot sich zu allem. Die im Juragebirge mächtigen Freiherren von Falkenstein waren ihm durch seinen Bruder Hans verwandt; aller Adel im Aargau und Breisgau war ihm befreundet. Er versprach, zuerst über Surzach in den Schwarzwald und den Breisgau zu reiten, um die Ritterschaft zu erwecken; dann die Falkensteine aufzusuchen, um den Aargau zu bewegen. Der faule Frieden war erst nach dreiundzwanzig Tagen am vollen Ende. Man schied. Der Markgraf reiste nach Zürich. Auch Marquard schwang sich aufs Pferd und jagte, von seinem Knecht begleitet, durch die engen und krummen Straßen der Stadt Baden, zum Thore hinaus. Der Regen rauschte in Strömen vom Himmel.
2. Die Gesellschaft.
Die schlechten Wege waren vom anhaltenden Regen noch ungangbarer geworden, so daß er bald langsam reiten mußte. Der Himmel hing wie ein graues Gewölbe über ihm, das sich auf die Felsenmauern und finstern Wälder des Siggisberges zu stützen schien. Links, jenseits des Limmatstromes, schwamm die Landschaft mit ungewissen Umrissen im falben Schein des Regens. Noch standen die Bäume laublos da; nur die geschwollenen Knospen des Kirschbaumes und einzelne Frühblümchen, die sich in den Wiesengründen oder hinter Felsblöcken gegen die rauhe Jahreszeit schützend verbargen, kündeten die Nähe des Lenzes an.
Herr Marquard schlug den Mantel fester um sich, denn der Wind blies kalt und scharf. Fast gereuete es ihn, die warme Herberge in Baden verlassen zu haben. Als er nach einigen Stunden aus dem Siggenthal herausgekommen, sich von der Limmat ab und rechts, um das schroffe Gebirge, in die Ebene gegen den Wald wandte, däuchte es ihm fast klüger, das näher gelegene Städtchen Brugg jenseits der Aar aufzusuchen, als die Straße nach Zurzach und dem Rheine zu verfolgen.
Mit diesem Gedanken beschäftigt und fast am Scheidewege, der seitwärts zur nahen Aar und zur Stilli führte, erblickte er von ferne einen Reitersmann, welcher ihm aus dem Walde rasch entgegen trabte, als flöge er zwischen den hohen Tannen und Eichen hindurch. Er hatte einen grünen Mantel, mit goldenen Spangen befestigt, um sich geworfen und die graue Filzkappe, der Nässe wegen, über die Ohren niedergekrämpt. Auch die rote und weiße Feder der Kopfbedeckung, vom Wasser herabgedrückt, war mit breitem goldenen Heft daran befestigt.
»Willkommen, Herr Marquard!« rief der Reiter, das Roß plötzlich anhaltend, indem er sich den Filz aus den Augen rückte und das schöne Gesicht eines jugendlichen Mannes sehen ließ.
»Straf' mich Gott, Ihr kommt mir zur rechten Stunde!« schrie der Herr von Baldegg fröhlich. »Wohin so eilig, Herr Gangolf Trüllerey?«.
»Nach Baden, zum Markgrafen.«
»Ihr könnt Euch den Weg sparen, wenn Euch nichts Dringendes treibt; alles ist auseinander seit gestern. In drei Wochen hebt der Tanz von neuem an, und so uns die Armagnaken nicht im Stich lassen, machen wir diesen Sommer, wills Gott! dein Bauerngesindel den Kehraus.«
»Wißt Ihr nicht, Herr Marquard, ob der Markgraf nach mir begehrt?« fragte Gangolf Trüllerey.
»Er gab mir Aufträge für Euch, bevor er nach Zürich zurückritt. Ihr solltet Hand anlegen und uns andern helfen, den Aargau aufzurütteln. denn diesmal gilts, oder, so lange die Welt steht, nimmer wieder. Euch ist Aarau auf die Seele gebunden. Die Stadt muß den Bernern absagen, und sich zu ihrem rechtmäßigen Herrn, dem römischen König wenden, wie Zürich, Winterthur, Rapperswyl, oder es bleibt von ihr kein Stein auf dem andern. Das sagt Euern Schultheißen, Klein- und Großräten und der ganzen ehrsamen Bürgerschaft. Doch fangt's gescheit an, daß die Berner nichts wittern! Verdammt fein müßt Ihr's antasten; der Schultheiß Erlach zu Bern hat eine spitze Nase.«
»Sonst habt Ihr nichts anderes zu sagen?«
»Straf' mich Gott! Zwei Tage und zwei Nächte hätt' ich zu berichten von allem, was in Baden verhandelt worden ist und was nun geschehen soll. Aber sind wir nicht Narren, hier unter freiem Himmel in Kot und Regen zu halten? Das kalte Wasser tritt mir, durch Mantel und Hut, an's Herz. Wär' ich Narr in Baden geblieben, da gab's vollauf. Mich reut der Auerhahn noch, den ich heut' zu Mittag unangerührt stehen ließ.«
»Und wohin wollt Ihr, Herr Marquard?«
»He, nach Zurzach, wäre das Mordwetter nicht! Jetzt lenk' ich, Euch zu gefallen, nach Brugg ein; denn dahin geht Ihr doch, Herr Gangolf! Ihr seid von schönen Augen erwartet, die Ihr lange nicht gesehen; Eure verlobte Braut ist seit zehn Tagen in Brugg.«
»Wißt Ihr's gewiß?« sagte der junge Mann, und sein ernster Blick wurde lebhafter; ein flüchtiges Rot färbte seine Wangen.
»Ob ich's weiß? Kehrte nicht Hans von Falkenstein auf der Heimreise mit seiner Tochter bei mir ein? Und vorgestern sah ich Jungfrau Ursula beim Schultheißen Effinger. Fort! Tröstet das Fräulein wegen Eurer langen Abwesenheit; unterwegs plaudern wir noch vieles.«
Damit wendeten beide ihre Pferde nach dem Seitenwege und trabten, durch den hohen Wald, der Aar zu. Bald erblickten sie in der Tiefe, unter sich, den breiten Strom, der, von Regengüssen des Gebirges angeschwollen, seine gelbgefärbten Wellen stürmisch fortwälzte. Als die beiden Herren langsam den steinigen, steilen Pfad von der Höhe zur Aar hinab ritten und weder Fährmann noch Fähre gewahr wurden, brüllte Herr Marquard in Ungeduld einmal über das andere sein Hop! Hop! über den Fluß hin, um die Schiffer aufmerksam zu machen. Es ist noch heutzutage unleidlich, bei Sturm und Regen am steinigen Ufer eine halbe Stunde zu harren, und ein gebrechliches Fahrzeug zu erwarten, das den Reisenden, zwei Zoll vom Tode entfernt, an's andere Ufer liefern soll. Herr Marquard fluchte mörderisch. Er war keine von den Naturen, die in der christlichen Geduld den Heiligenschein verdienen wollen; auch sah man's den rundlichen Formen seiner Gestalt, den vollen Wangen und den lachenden Augen des Krauskopfs wohl an, daß er unnützerweise nicht gern Not litt und sich's lieber an einer Tafel mit ausgewählten Speisen bequem machte. Wir müssen den Leser bitten, Herrn Marquard nicht nach seinen Worten zu beurteilen. Er pflegte in aller Fröhlichkeit zu fluchen. Seine gute Laune blieb sich sogar in den gefährlichsten Augenblicken des Gefechtes gleich, mochte er Wunden schlagen oder davontragen. Darum hatte ihn jedermann gern; er war ein lustiger Gesell, weil er kein trauriger sein konnte.
»Wo habt Ihr den französischen König verlassen?« fragte er Herrn Gangolf Trüllerey, indem er, gleich diesem, am Aarufer vom Pferde stieg, um sich durch Auf- und Abgehen zu erwärmen.
»Zu Langres, in der Champagne, beurlaubten wir uns von ihm. Burkhard Mönch von Landskron begleitete den Dauphin gen Mümpelgard; ich aber folgte Herrn Petermann von Mörsberg und Hansen von Rechberg.«
»Wann können wir des Dauphins Banner vor Zürich sehen?«
»Vor sechs Wochen kaum.«
»Nun, so müssen wir den Hungergürtel enger schnallen, weil der Braten noch weit abliegt.«
»Und Ihr wollt den Bernern im ganzen Ernst absagen, Herr Marquard?«
»Ich, Ihr und der ganze ehrliebende Adel vom Aargau! Sie haben mir übel mitgespielt, die von Bern, und ich war ganz unschuldig, wie Ihr wohl wißt. Aber – straf' mich Gott! – aus den Steinen ihres Rathauses will ich die Burg meiner Väter, am alten Turm der Hünegg, wieder aufrichten, und die von Luzern sollen mir die Steine dazu tragen. Und einen Keller – das schwör' ich Euch! – sollen sie mir in den Felsen drunter graben, daß das ganze Berner Münster darin Platz findet. Einen Weinkeller soll's geben, desgleichen kein Kloster im heiligen Reich, und der Papst samt seinen Kardinälen keinen größern hat. Heda! Ho! Hop! Seht doch, nun erst schleichen die faulen Schlingel zur Fähre drüben und binden sie los. Heda, ho, hop! Straf' mich Gott! ich breche jedem Kerl zum Andenken eine Rippe. Das schüttet wieder vom Himmel, wie aus Eimern. Wollt Ihr nicht im Regen ersaufen, Herr Gangolf, so kommt mit mir! Ich denke, unter dem alten Mauerwerk dort seitwärts giebts vielleicht ein Obdach.«
Herr Gangolf ließ sich den Vorschlag gefallen. Sie führten ihre Pferde längs dem Ufer des Flusses gegen die Trümmer einer Burg, die, kaum mehr denn hundert gute Schritte von ihnen entfernt, am Wasser lag. Nicht ohne Mühe überkletterten sie die Steinhaufen, um zum Bruchstück eines finstern Gewölbes oder Schwibbogens zu gelangen, das ihnen einigen Schutz gegen den Regen verhieß, welcher jetzt abermals in dichten Strömen rauschend niederfiel.
3. Der Lollhard.
Als sie sich dem Gewölbe nahten, sahen sie im Innern desselben sich Gestalten bewegen, während vorn ein Esel am dürren Grase des Gesteines nagte. Im dunkeln Hintergrunde saßen zwei Personen auf einer schmalen, vermutlich von Hirten der Gegend gezimmerten Holzbank. Es war eine männliche und eine weibliche Gestalt, die sich beim Eintritt der Fremden langsam erhoben, grüßend verneigten und wieder auf ihre Sitze niederließen.
Gangolf, der seine langen, hellbraunen, vom Regen benetzten Locken aus dem Gesicht, über die Achseln zurückstrich, beachtete die Anwesenden kaum. Desto mehr beschäftigte sich Herrn Marquard's Aufmerksamkeit mit ihnen. Er musterte beide neugierig. Die Frau trug ein langes Gewand, gleich einer Klosterfrau, von grobem, halbwollenem, aschfarbenem Zeuge. Ein breites Tuch von demselben Stoffe hing über Kopf und Stirn herab und über die Achseln bis zu den Hüften nieder; gleich einem Mantel, vorn zusammengeschlagen, so daß man von dem verhüllten Gesichte nichts erblickte. Unterhalb des Mantels waren die Enden eines Seiles sichtbar, welches, um den Leib geschlungen, wahrscheinlich die Stelle des Gürtels versah.
Der Begleiter dieser Vermummten war ein starkknochiger, aber magerer Mensch von ungewöhnlicher Länge, im Alter zwischen den Fünfzigern und Sechzigern. Aus seinem Gesicht, in welchem ein düsterer, melancholischer Zug auffiel, ragte zwischen den hohen Backenknochen eine Nase hervor, die man für sich selbst wohlgeformt genannt haben würde, wenn sie nicht für das schmale Hungergesicht eine ganz unverhältnismäßige Größe gehabt hätte. Wenn man dies seltsame Gesicht, dazu die langen eisgrauen Haupthaare, die überhängenden Augenbrauen, sowie den grauen, in zwei Spitzen auf die Brust auseinander fallenden Bart sah, und daneben dann wieder den lebhaften, seelenvollen, durchdringenden Blick der hellen, großen Augen: dann hätte man schwören sollen, es schaue ein feuriger Jüngling aus der vorgehaltenen Larve eines Greises. Der Alte trug auf dem Kopfe ein rundes, kleines Hütchen, welches schon manches Jahr treue Dienste verrichtet haben mochte, und vorn in einen langen Schnabel auslief, wie ein Regendach über der Nase. Hals und Brust waren trotz der rauhen Witterung entblößt. Ein langer, bis an die Waden reichender grober Leibrock, um den Hals mit schlechtem Pelz gefüttert, wurde über den Hüften durch einen breiten Ledergurt zusammengehalten.
»Nun, Gevatter Graubart!« redete ihn Marquard an. »Wohin geht Deine Reise?«
Mit einer seltsam harten, fast knarrenden Stimme erwiderte der Alte: »Zum gleichen Ziel wie die Eure!«
»Also frische Gesellschaft! Und weißt Du denn so genau, wohin mein Weg geht?«
»Allerdings, Herr! Zum Grab und zur Ewigkeit.«
Sowohl diese Antwort, als die harte Stimme, in der sie ertönte, hatte für Herrn Marquard etwas Unbehagliches. Er trat, wie von heimlichem Grausen befallen, einen Schritt zurück und betrachtete den wunderlichen Fremden mit einem stieren Blick, wie einer, der mit sich selbst im Zweifel ist, ob er einen vernünftigen Menschen oder einen Wahnsinnigen, einen Lebenden oder ein Gespenst vor sich habe.
»Hört doch, Herr Gangolf!« sagte er und drehte sich zu dem jungen Manne um, der am Ausgang des Gewölbes stand und sich mit seinem Pferde beschäftigte. »Hört doch, habt Ihr je im Leben etwas Ähnlicheres gehört, als das Kirren einer alten Hageiche, wenn sie der Sturm biegen will, und diese raspelnde Stimme des alten Schnabeltiers?«
Wirklich hatte Gangolf, als er die ungewöhnliche Stimme vernommen, das Gesicht einen Augenblick nach dem fremden Paare zurückgewandt, bald aber wieder seine vorige Arbeit begonnen, den Regen von der Mähne und dem Halse seines Pferdes zu streichen.
»Es ist hier, auf den Trümmern der Freudenau, der rechte Ort, eine Bußpredigt zu hören,« sagte Gangolf lächelnd. »Ihr könnet ihrer wohl bedürfen, Herr Marquard!«
»Nun, so stimme denn an, Du Stimme des Predigers in der Wüste!« sagte Marquard zum Alten. »Ich bin ohnedies lange in keine Kirche gekommen.«
»Verschonet mich, Herr!« erwiderte der Alte. »Wollet Ihr meiner spotten? Eure Ohren sind noch nicht gemacht zum Hören, Eure Augen noch nicht zum Sehen; darum wißt Ihr nicht, wer Ihr seid und wo Ihr seid!«
»Zum Teufel! Wer sagt Dir, daß ich taub und blind bin? Frage mich, was ich sehe, und ich will Dir treffende Antwort geben, die Dich freuen soll.«
»Nun denn, wißt Ihr, wo Ihr seid?«
»Entweder vor einem Bruder Lollhard, der nächstens gestäupt wird, oder es giebt keinen Lollhard. Hab' ich's getroffen?«
»Wenn ich zu den Lollharden gehöre, was ficht es Euch an? Aber Ihr sehet nur den Kittel, nicht den Leib; nur den Leib, nicht den Geist. Ihr kennt mich nicht und Euch nicht, und Eure Wege sind überall die Wege des Wahnes. Darum kommt Ihr nimmer zum Ziel und gelangt blos dahin, wohin Ihr nicht begehret.«
»Straf' mich Gott! Darin hast Du Recht, sonst wäre ich nicht in dies stinkende Gewölbe, auf dem Schutt der Freudenau, in Deine angenehme Gesellschaft geraten.«
»Die ganze Welt ist durch die Ruchlosigkeit der Sünder eine zertrümmerte Freudenau, ein verwüstetes Paradies geworden. An Euren Augen hängt die Wollust; an Euren Lippen Fluch; an Euren Händen Blut der Ermordeten. – Herr! Auch ich war, was Ihr seid; ich wünsche, daß Ihr einst, von der heiligen Gewalt des Geistes ergriffen, das werdet, was ich bin.«
»Sehr verbunden; doch kann ich Dir nicht verbergen, daß ich einstweilen die Gewalt des Geistes nicht bemühen möchte, aus meiner Wenigkeit einen fahrenden Bettler zu machen.«
»Der Herr ist allmächtig im Himmel und auf Erden; wer widersteht seiner Hand? Er wird Euren Stolz beugen und zur Erde schmettern, wie der Blitz den Wipfel der Tannen. Eure Burgen werden von den Höhen niedersteigen und die Grundmauern demütiger Strohhütten tragen. In Euren Helmen werden die Eulen nisten, und die Kinder auf den Straßen mit gebrochenen Wappenschildern spielen. Siehe, der Tag ist vor der Thür, da die Menschen unter dem Schrecken Gottes genesen sollen zur Wahrheit; da die verstoßenen Stiefkinder in ihr ewiges Recht und göttliches Erbe zurücktreten sollen, welches Euer geiziger Hochmut ihnen geraubt hat. Es werden die hochbelaubten Stammbäume am Licht des Himmels verdorren, wie Schwämme der Nacht, und die Söhne der Leibeigenen den Töchtern der Freiherren Brautringe geben. Denn wir sind allzumal Kinder Gottes, der da nicht kennt den Unterschied des edeln und unedeln Blutes, aber der da richten wird die Gerechten und Ungerechten.«
Die großen Augen des Alten leuchteten, indem er dieses sprach. Unwillkürlich erhob er sich während der Rede vom Sitze; doch mit sanfter Gewalt zog ihn seine Begleiterin wieder an ihre Seite nieder.
»Lollhard, Lollhard!« rief der Herr von Baldegg und drohte mit dem Finger. »Fast will mich bedünken, Du kommest aus den Bergen von Appenzell oder Schwyz, unser Bauernvolk gegen die gnädige Herrschaft von Österreich aufzuwiegeln. Hüte Dich, Prophet! Hier zu Lande ist der Hanf wohlfeil genug, um Dir dafür unentgeltlich einen Schmuck für den dürren Hals zu drehen. Kehre heim, wenn Dir zu raten ist, kehre heim zu Deinen aufrührerischen Kühmelkern und sag' ihnen, ihr jüngster Tag komme, ehe die Kirschen reifen! Ihre höllische Brut, die alle göttliche und menschliche Ordnung zerreißen will, soll von der Erde vertilgt werden; und die Nester, in denen sie der Teufel ausheckte, sollen verbrannt werden, daß die Flammen hinausfackeln bis zum letzten Stall in den Alpen.«
»Herr,« erwiderte der Lollhard gelassen, »ich stehe in keines Menschen Dienst und bin keines Gesandter. Darum lasset mich in Frieden ziehen! Fragt mich nicht weiter: der Gang des Ewigen ist unerforschlich und ich habe seinen furchtbaren Arm gesehen.«
»Mit nichten!« rief Marquard, »So wohlfeil kommst Du mir nicht wieder los, Du prophetischer Rabe! Bekenne nur, die Eidgenossen haben Dich in dies Land gesandt, um ihren verruchten Haß gegen Österreich zu predigen und Aufruhr gegen Adel und rechtmäßige Obrigkeit zu erregen. Was hast Du vorhin verlauten lassen? Sprich!«
»Ich sprach: Gott ist der Herr, und keiner ist Herr, als Er, der Lebendige,« schrie der Alte entflammt; »Ihr aber seid die Gefäße seines Zorns, die er zermalmen wird zu Scherben, weil Ihr seine Stimme nicht hören, seine Zeichen nicht sehen wollet. Er ist der Herr; darum sollen wir nicht Herren sein, nicht Knechte, sondern Brüder in ewiger Kindschaft zu Gott. Er zerbricht die Zepter und Kronen, wirft sie zu den Gebeinen der Toten und spricht: Nur die Lebendigen sollen leben, aber niemand kann leben, als in mir! So spricht der Herr. Wie lange will Eure Vermessenheit mit ihm rechten? Ihr habet Euer Gesetz gestellt über Gottes Gesetz; Eure Ordnung über die Ordnung der Natur; Euren Thron über den Stuhl des Weltenrichters. Eure Brüder habt Ihr zu Leibeigenen gemacht und in Knechtschaft verkauft, wie das Vieh. Ihr handelt Gold zu Euren Wollüsten ein um Menschenblut, und bauet Eure Paläste mit Hohnlachen aus den Scherflein der Waisen und Witwen. Aber der Grimm des Herrn ist über Euch erwacht, darum, daß Ihr Götter sein wollet auf Erden und Euch anbeten lasset von Euren Unterjochten. Es wird Entsetzen gehen durch die Gauen von Zürich und Wehklage sein unter den Mauern von Basel. Die Furchen der Äcker sollen Gräber werden und die Seen blutige Wellen werfen, auf daß die Kinder Gottes frei einhergehen und die Altäre der Abgötter in Staub zerfallen«
»Straf' mich Gott, der Kerl ist wahnwitzig!« rief Marquard und prallte zurück, als der Alte, welcher in der Begeisterung eines Sehers sprach, sich in seiner langen Gestalt emporrichtete und einen Schritt vorwärts that gegen den Ritter.
Die Gefährtin des Lollhard erhob sich nur ein wenig, um diesen wieder an ihre Seite zurückzuziehen. Sogleich gehorchte ihr der Alte, setzte sich und verstummte wieder. Bei der Anstrengung seiner Nachbarin, ihn zu ergreifen, war aus dem weiten Ärmel ihres Gewandes eine so weiße zarte Hand hervorgekommen, daß der Herr von Baldegg plötzlich den gespenstischen Greis vergaß und mit seinen Augen dem feinen Vermittlerhändchen folgte, welches sich ebenso schnell wieder im groben Tuche der Kleider verbarg.
»Bruder Lollhard,« sagte Marquard, »unter uns gesagt, ich kenne Dich und Deinesgleichen. Wir Andern sind in Euren Augen allzumal Sünder; aber wenn Ihr mit einem artigen Mägdlein Tag und Nacht umherschwärmt, so lebt Ihr, nach Eurer saubern Lehre, nur im paradiesischen Stande der Unschuld. Wer ist denn die hübsche Begutte dort neben Dir? Eine Schwester im Herrn? Alter, ich verspüre Unrat! Gestehe, aus welchem Kloster hast Du dies Nönnlein weggelockt, um mit Dir zu gehen?«
»Sie hat noch keinem Kloster angehört,« antwortete trocken und kurz der Lollhard.
»Ich verstehe, Alter! Also Dein Seelenweib, denn Dein wirkliches kann sie nicht sein. Du bist alt genug, um bei ihr heilig zu bleiben.«
»Herr, sie ist meine Tochter!«
»Eine geistliche Tochter, denke ich,« versetzte Marquard lachend, »und wie mich bedünken will, mit nicht ganz heilem Gewissen, denn umsonst verdeckt sie nicht das ganze Gesicht, als wär's gestohlene Ware. Nun, fromme Begutte, laß mich Dein Antlitz schauen, wenn Dein Gewissen gesund ist!«
»Herr,« rief der Alte ernst, »Euer Stand gebietet Euch Ehrfurcht gegen Frauen.«
»Hm, Lollhard! Nicht gegen alle, sonst müßte ich auch des Teufels Großmutter die Hand küssen. Drum mit Erlaubnis, lasset sehen!« rief Marquard und trat zu der weiblichen Gestalt.
Der Alte streckte den Arm zum Schutz vor und rief: »Wer giebt Euch ein Recht, unverschämt zu werden?«
Der Herr von Baldegg warf den Arm des Greises auf die Seite, riß im gleichen Augenblicke gewaltsam den groben Tuchmantel vom Gesicht der Verhüllten und staunte sie verblüfft an, weil er nicht wußte, wie ihm geschah. Es war freilich ein ihm unbekanntes Gesicht, aber eins, mit welchem man zeitlebens bekannt sein möchte; im rauhen Gewande das feinste Engelsköpfchen voll göttlichen Ernstes; zwischen Felsengrau eine sanftglühende Alpenrose. Der Herr von Baldegg war wohl über die Jahre hinweg, wo der goldbraune Glanz solcher Locken und der schöne Blick solcher blauen Augen gefährlich wirken kann, aber doch fühlte er sich von der eben hier nicht erwarteten Anmut betroffen. Die Frau hatte sich schon längst wieder und dichter denn vorher in den Mantel gewickelt, ehe Marquard von seinem Erstaunen sich erholt hatte. Er hörte und verstand keine Silbe von den Vorwürfen, welche ihm der erzürnte Alte von der Seite zuschnarchte.
»Höre, Lollhard!« redete er diesen endlich an. »Sei aufrichtig, bekenne, wo hast Du dies arme Kind geraubt? Das ist keine Ware für Dich und keine Ware von Dir. Ich lasse Dich ungestraft ziehen, wenn Du mir lauteren Wein einschenkst. Sperre Dich nicht; keine Winkelzüge; es ist schon alles verraten. Das Mägdelein ist gestohlen, entführt. Jungfer! Ihr seid in meinem Schutze; fürchtet nichts von mir, und noch minder von der Rache dieses Alten. Vertrauet Euch mir!«
Die Verhüllte bewegte den Kopf verneinend und streckte die Hand vor, als wolle sie in einer Bewegung des Abscheues den Ritter von sich stoßen.
»Versteh' ich Euch recht?« fuhr dieser fort. »Ihr wollt bei dem Lollhard verbleiben?«
Sie neigte bejahend das Haupt.
»Straf' mich Gott! So hat er Euch behext. Meinethalben, schöne Begutte! bleibt wo Ihr wollt; ich mag's wohl leiden, wenn Ihr mit dem lebendigen Tod, mit diesem Geripp und Gespenst, vorlieb nehmen wollt; aber vergönnt mir wenigstens, noch einmal Euer holdes Antlitz zu bewundern.«
»Hebet Euch von mir!« sagte die Begutte unterm Mantel, aber mit solchem Wohllaut der Stimme, daß Marquard nur den süßen Klang, nicht den Zorn darin hörte.
»Redet doch nicht zu mir, wie der Herr zum Satan! Ihr habt mir alle Herrlichkeit der Welt gezeigt; nicht ich zeigte sie Euch. Ich verlange von Euch keinen Fußfall, aber Eure Schönheit könnte wohl meinerseits darauf Anspruch machen.«
Als er dies gesagt hatte, stand sie rasch von der Bank auf, zog den Alten mit sich empor und rief: »Fort, fort von hier, mein Vater, daß wir zu andern Menschen kommen!«
»Warum flieht Ihr, fromme Begutte?« sagte Marquard lachend. »ich denke Euch kein Übles anzuthun, obschon Ihr in meiner Gewalt seid.«
»Sind wir,« rief der Lollhard, »unglücklicherweise in Eure Raubhöhle geraten, so solltet Ihr doch die Rechte der Gastfreundschaft gelten lassen. Übrigens stehen meine Tochter und ich nicht in Eurer, sondern in Gottes Gewalt. Laßt uns gehen!«
»Dich lasse ich wohl fahren, Graubart,« versetzte Marquard, »aber nicht also halten es Ritter mit artigen Mägdlein. Nun denn, spröde Büßende, versagt mir das Lösegeld nicht!«
Er legte bei diesen Worten die Hand an ihren Mantel. Der Lollhard aber warf sich ihm mit Macht entgegen, stellte sich zwischen ihn und die Jungfrau und faßte mit seiner dürren Hand einen keulenförmigen, langen Knotenstock, der, ihm zunächst, an das schwarze Gemäuer gelehnt war. Doch Herr Marquard ließ sich dadurch nicht irren, schleuderte den unkräftiqen Greis beiseite und schloß die zitternde Verhüllte, die ein klägliches Geschrei erhob, lachend in seinen Arm.
In diesem Augenblick kam Herr Gangolf Trüllerey, welcher inzwischen, weil der Regen nachgelassen hatte, zur Aar gegangen war, um das Landen der Fähre zu sehen, zurück. Er hörte das Hilferufen der weiblichen Stimme im Gewölbe, sprang hinein, sah Marquards Ringen mit der Vermummten und befreite diese, indem er den Ritter mit einem Wurf zum Gewölbe hinausfliegen ließ. Es war aber nicht gut fliegen über den Schutt der Freudenau. Herr Marquard drehte sich durch die Gewalt des Stoßes erst zweimal um sich selbst und fiel dann sehr unsanft auf das Steingetrümmer nieder.
»Verzeiht, Herr Marquard,« sagte Gangolf, »aber es ist nicht fein von Euch gethan, ein schwaches Weib zu überwältigen.«
Erst aus dieser Anrede konnte sich Marquard, der verwundert und erzürnt nach allen Seiten umher sah, den unwillkürlichen Flug und wie er zum Sitzen gekommen sei erklären.
»Ihr seid ein grober Gesell, Herr Trüllerey!« sagte Herr von Baldegg ärgerlich, indem er aufstand und sich den Schenkel rieb. »Wer hat Euch, Teufel! zum Ritter gemacht, da Ihr zum Drescher so gut taugt? Setzt künftig den Flegel, statt der Lilie, in Euer Wappenschild!«
»Den Flegel habe ich zur Hand,« erwiderte der Jüngling ruhig und legte den Zeigefinger auf den blanken Eisenknopf seines Schwertgriffes. »Wollt Ihr mir zum roten Felde meines Wappens die Farbe liefern, so soll der Flegel hinein.«
»Nehmt's nicht übel!« rief höhnisch lachend der Herr von Baldegg. »Euer Witz ist ein erbärmlicher Schmarotzer, der sich an fremden hängen und vollsaugen muß, um Leben zu haben. Ich frage nur, was mischt Ihr Euch in meinen Handel mit diesem Landstreicher und dieser Begutte? Verdächtiges Gesindel ist's, was durchs Land zieht, das Volk gegen den Adel hetzt, Wege und Stege ausspäht, um den hungrigen Räubern des Gebirges unsere Küchen, Keller und Speicher zu zeigen. Aufknüpfen sollte man diese Spürhunde längs den Landstraßen, allen Eidgenossen zur Warnung. Was hindert Ihr den Ausbruch meines gerechten Zornes?«
»Der Ausbruch Eures gerechten Zornes,« versetzte Trüllerey, »hatte mehr Zärtlichkeit, als die Sittsamkeit eines Weibes und die Würde eines ehrlichen Edelmanns ertragen mag.«
»Junger Mensch,« rief Marquard mit donnernder Stimme, und sein unvertilgbares Lächeln schien sich zu verlieren, »ich weiß nicht, ob Ihr Händel mit mir wollt; aber sucht Ihr, so sollt Ihr finden! Fast gereut es mich, daß ich Euch nicht die tölpelhafte Faust, als sie sich an mir vergriff, vom Rumpfe wegschlug. Jetzt schweigt und reizt mich nicht! Ich habe Eurer bis jetzt, mit Überwindung meines eigenen Ärgers, geschont. Ihr wißt, Ihr waret mir lieb; aber reizt mich nicht, oder die letzten Rücksichten fallen und ich zahle Euch den verdienten Lohn!«
»Ich werde Euch nicht reizen und werde Euch nicht fürchten,« entgegnete Gangolf; »lasset diese Leute unangefochten von hinnen ziehen. Sie bleiben unter meinem Schutze, und wehe dem, welcher ihnen ein Haar krümmt!«
»So lauft denn mit dem lüderlichen Volk bis an der Welt Ende, wenn Ihr es meiner Gesellschaft vorziehen wollt,« antwortete Marquard, ging zu seinem Pferde und schwang sich hinauf; »aber Junggesell, Junggesell, wahre Dich, es könnte Dich meine Vetterschaft kosten!«
Damit sprengte er längs dem Ufer hin, der Knecht ihm nach. Der Herr von Baldegg ritt wieder den stillen Weg am Rain hinauf, welchen er, in Gangolfs Gesellschaft, vor einer halben Stunde erst gekommen war; während dessen gingen die Übrigen mit Roß und Esel auf die Fähre und die Schiffsleute stießen ab.
4. Die Begutte.
Es hatte aufgehört zu regnen. Hin und wieder zerteilte sich das einförmige Grau des Himmels und ließ das reinste Blau sichtbar werden. Einzelne Buchfinken, diese fröhlichen Herolde des Frühlings, sangen in den Zweigen des Gebüsches ihre heitern Triller, die erwidernd aus der Ferne zurückgesungen wurden,
Während die Reisenden zwischen den hohen Ufern der geschwollenen Aar hinüberschwammen, beobachteten sie, mit sich selbst beschäftigt, gegenseitiges Schweigen. Der Lollhard hielt den Esel, auf dessen Sattel die daneben stehende Begutte ihre gefalteten Hände und Arme ruhen ließ und ihr verhülltes Antlitz niedersenkte. Herr Gangolf warf den vom Regen schweren Mantel ab, befestigte ihn auf dem Rücken seines Pferdes und stand dann, einen Fuß über den andern geschlagen, in Gedanken vertieft, an sein treues Tier gelehnt.
Er dachte noch an die letzten Worte des Herrn von Baldegg, die ihn sehr beunruhigten, weil ihr Sinn ihm kein Rätsel bleiben konnte. Marquard nämlich war dem reichen und mächtigen Geschlecht der Freiherren von Falkenstein verwandt und galt bei ihnen viel, wegen des Altertums seines Hauses; wegen geleisteter Freundschaftsdienste; wegen der Gleichheit seiner Gesinnungen mit den ihrigen und wegen seines aufgeweckten Wesens. Aber auch Ritter Gangolf Trüllerey war nahe daran, in die Verwandtschaft der Falkensteine zu treten, denn die reizende Ursula, Tochter des Herrn Hans von Falkenstein, war seine anverlobte Braut und die Vermählungsfeierlichkeit auf die Zeit festgesetzt, wo der Friede zwischen Zürich und Österreich einerseits und den Eidgenossen andererseits besiegelt sein würde. Gangolf hätte vielleicht auf die Hand der reichsten Erbin im Aargau keinen Anspruch wagen dürfen, da ihn, obschon altadeligen Herkommens, weder der Glanz seines Geschlechts, noch der Reichtum seines Hauses besonders begünstigten, aber die besondere Huld des Markgrafen Wilhelm von Hochberg, welcher für seinen Liebling selber Brautwerber beim Freiherrn von Falkenstein gewesen war, als auch die Neigung des Fräuleins, hatten alle Hindernisse besiegt. Der junge Mann liebte die schöne Braut mit aller Zärtlichkeit, welche ihre Anmut verdiente und die seinem warmen Blute natürlich war. Wiewohl diese Verbindung ursprünglich weniger das Werk der Liebe, als das des Markgrafen von Hochberg gewesen sein mochte, hatten die Herzen doch nachher gern gebilligt, was Klugheit und persönliche Vorliebe des kaiserlichen Statthalters der vordern Lande mit dem Vater der Braut, Hansen von Falkenstein, festgestellt.
Diese Verhältnisse dürfen dem Leser nicht unbekannt sein, um sich Gangolfs stilles und finsteres Benehmen, seit seinem Zusammentreffen mit dem Herrn von Baldegg, zu erklären. Schon die erste Botschaft, welche er von demselben vernahm, daß sich zu Baden alle Friedensunterhandlungen zwischen Zürich und den Eidgenossen zerschlagen hätten, vernichtete einen großen Teil seiner Hoffnungen. Mit der Gewißheit vom nahen Wiederausbruche des Krieges hatte er auch die Gewißheit von dem längeren Aufschube seiner Vermählung. Eine Aussicht, wie diese, ist nichts weniger als angenehm für einen Bräutigam, der in seinen Träumen die Geliebte schon hundertmal, als Neuvermählte, in die väterliche Burg eingeführt hat. Nun lagen noch blutige Schlachtfelder, kühne Stürme auf die Mauern fester Schlösser, Schlingen und Netze eifersüchtiger Nebenbuhler und zahllose Möglichkeiten von Trennung durch Gewalt oder Untreue zwischen ihm und dem Traualtar.
Die Fähre landete unterdessen am andern Ufer der Aar, unter den Hütten der Stilli. Gangolf warf den Schiffsleuten den Fährlohn hin für sich und die Begharden. Der alte Lollhard bemerkte diese Freigebigkeit, verbeugte sich und sagte: »Edler Herr! Ihr habt mir und meiner Tochter schon mehr als Fährgeld erspart; Gott lohne Eure Großmut!« Am Ufer hob derselbe dann die verhüllte Tochter auf den Sattel des Esels, auf welchem sie bequem und sicher saß. Der Alte ging mit langem Stabe neben dem Tiere her. Gangolf ritt langsam mit ihnen, den vom Ufer emporsteigenden Weg zum Dorfe hinauf, die Straße gen Brugg. Der Himmel erheiterte sich vollends und bald kamen sie unter den Felsen unweit der Kirche von Rain vorüber. Als der Lollhard bemerkte, daß Herr Gangolf den Lauf seines mutigen Pferdes nur zurückhielt, um sie zu begleiten, sprach er: »Wenn ich glauben darf, daß Ihr unsertwegen zögert, so bitte ich, lasset dem Roß die Zügel fahren; Veronika und ich reisen in Gottes sicherm Geleit!«
»Wenn Ihr mich nicht vorher verlasset, so verlasse ich Euch nicht bis zur Stadt,« antwortete Gangolf kurz, und verfolgte seinen bisherigen langsamen Schritt.
Indessen die träge Fortsetzung der Reise wurde selbst dem jungen Ritter ein wenig langweilig; es wurde ihm auch das fruchtlose Brüten über seine Grillen zuwider. Sich zu zerstreuen, warf er den Blick links, auf die weite Gegend hin, jenseits der Aar, auf die spiegelnden Wellen der Limmat und der Reuß, die beide aus fernen, weitgetrennten Quellen der Alpen sich hier zusammenfinden, um ihr Leben in dem des mächtigen Aarstroms aufzulösen. Dann, um seine Begleiter, die er bisher keines Blickes gewürdigt hatte, kennen zu lernen, wandte er den Kopf auf die andere Seite.
Mehr als der Alte, welcher mit gesenktem Haupte rasch vorwärts schritt und die Lippen bewegte, als wenn er still für sich betete, zog die Begutte seine Aufmerksamkeit auf sich, eben darum vielleicht, weil ihre Verhüllung seine Neugier mehr erregte. Sie saß, gegen ihn gerichtet, quer auf dem Sattel, den einen Fuß im eisernen Steigbügel, den andern frei hängen lassend. So viel unter dem Saum des faltenreichen Gewandes von den Füßen sichtbar wurde, ließ sich die niedliche Form derselben und ein noch sehr jugendliches Alter der frommen Reiterin ahnen. Damit schien auch die blendende Weiße und die Feinheit des Kinnes übereinzustimmen, in welchem ein zartes Grübchen unverkennbar blieb. Gangolf, welcher keinen andern Zeitvertreib hatte, verwandte kein Auge von dem Grübchen in diesem Schneehügel und bedauerte beinahe heimlich, daß seine Braut des kleinen Reizes entbehre. Da das Kleid dicht unterm Kinn zusammengeheftet war, so blieb der Weide seiner Augen nur ein kleiner Spielraum. Nichtsdestoweniger richtete er von Zeit zu Zeit den Blick dahin, in der Hoffnung, durch eine vielleicht vom Luftzuge veranlaßte günstige Bewegung des herabhängenden Tuches fernere Entdeckungen zu machen und die Lippen seiner verschleierten Begleiterin zu erblicken. Aber die Luft blieb still, und unbeweglich der Vorhang.
Schon einige Male hatte er sich vorgenommen, die stumme Reiterin anzusprechen; aber immer wieder, er selbst wußte nicht warum, hielt er seine Worte zurück. Plötzlich wandte sich die Begutte mit dem Kopf nach der entgegengesetzten Seite, wo der Lollhard auf der unebenen, durchweichten Landstraße trockene Stellen für seine Schritte suchte.
»Du bist müde, Vater; laß mich absteigen und ruhe Du!«
Sie hielt wirklich den Esel an, um abzusteigen; aber Gangolf war im gleichen Augenblick schon vom Pferde und führte sein Roß dem Alten zu.
»Nehmt meinen Platz ein,« sagte er zu dem Lollhard, »denn wer, wie ich, den ganzen Tag auf dem Gaul sitzt, findet Erholung, wenn er sich seiner Beine einmal wieder bedienen kann.«
Der Lollhard, welcher seine Müdigkeit nicht verleugnete, zeigte bei Gangolfs Antrage keineswegs jene Verlegenheit, die der Niedrige gewöhnlich bei der Herablassung und Güte empfindet, mit welcher ihn der Große überrascht, sondern nur ein freundliches Erstaunen über diesen Beweis von Leutseligkeit, die damals eben nicht zu den Tugenden der stolzen Ritterschaft gehörte. Er dankte, schwang sich ohne Mühe aufs Pferd, und seine Haltung und sein Anstand verrieten, daß er hier nicht an ungewohnter Stelle sei.
Gangolf ging nun zwischen beiden. So oft es ihm der Weg gestattete, warf er den Blick seitwärts, um aus seinem veränderten und günstigen Standpunkte unter der Kopfbedeckung der Jungfrau die Form des Mundes zu entdecken, der vorhin mit so vielem Wohllaut geredet hatte.
Der Lollhard seinerseits, nun er der Beschwerlichkeit des Fußwanderns überhoben war, überließ sich wohlgemut der Betrachtung der umherliegenden Gegend. Er warf noch einmal den Blick auf den Punkt zurück, wo die Gewässer der Aar, Limmat und Reuß zusammenfallen und sprach: »So löset sich mir das Rätsel, weswillen die Burg der Freudenau in so unbequemer Lage, so hart an die Aar, hingebaut worden sein mag: es galt dem Erbauer, Meister der Überfahrt zu sein, die nirgends als da stattfinden konnte, wo der Strom fast unbeweglich zwischen unveränderlichen Ufern breit und ruhig dahingleitet, nachdem er Reuß und Limmat in sich aufgenommen. Welch großes, herrliches Schauspiel gewähret diese Landschaft. Blicke auf, Veronika, und siehe die ewige Herrlichkeit Gottes!«
Veronika hatte das Tuch von ihrem Antlitz zurückgeschlagen und ließ die hellen, trunkenen Augen durch die Umgegend schweifen. Sie öffnete endlich die rosigen Lippen und sagte: »Welch eine unendliche Schönheit! Sieh' doch diesen Glanz in den Nebeln, dies Goldgrün unter den finstern Wäldern! Es ist das Lächeln eines Weinenden.« Und indem sie dies sagte, merkte sie selber nicht, daß die Rührung des Entzückens ihre blauen Augen mit einer Thräne schmückte. Gangolf verstand nichts von allem, was sie sonst noch zu ihrem Vater sagte. Ihre ersten Worte allein klangen ihm in der Seele fort: Welch eine unendliche Schönheit inmitten der winterlichen Natur!
Bei der Langsamkeit, mit welcher man die Reise fortsetzte, trat die Nacht ein, ehe die Stadt erreicht war. Während das geschlossene Thor der Ringmauer geöffnet wurde, stieg der Lollhard auf der Brücke vom Pferde und leitete es in die Stadt, die steile Straße hinauf, bis an das Thor der Herberge. Hier hob Gangolf die Begutte, deren Antlitz wieder vom Tuche bedeckt war, mit ritterlicher Höflichkeit vom Sattel des Esels. »Der Himmel lohne Euch, edler Herr, was Ihr uns armen Leuten heut gethan!« sagte sie mit halblauter Stimme. Auch der Lollhard kam herbei, seine Erkenntlichkeitsbezeugungen zu wiederholen. Gangolf aber wünschte beiden gute Ruhe und folgte schnell den Knechten, die ihm, mit brennenden Kerzen leuchtend, ins Haus voranschritten.
5. Der Schultheiß von Brugg.
Der junge Rittersmann erwachte am andern Morgen später als er selbst gewollt, und kleidete sich mit größerer Sorgfalt, um vor den Augen der Braut nicht mißfällig zu erscheinen. Sein Barett umwehten weiß und rot gekräuselte Federn; das Wamms, mit Goldstickerei an den Nähten, war um Hals, Brust und am Saum der faltenreichen Schöße mit kostbarem Pelzwerk verbrämt. Selbst die Ränder der weiten Stulpen an den Stiefeln, die nur bis zur halben Wade reichten, sah man mit Goldschnur besetzt. Das große Schwert hing an der Hüfte, nicht nur vom Leibgürtel, sondern auch vom breiten Gehäng über die Achsel gehalten, sowohl des besseren Aussehens wegen, als auch, daß die lange Klinge bequemer zu tragen sei.
Von den Wirtsleuten, die ihn, als er sich zum Schultheißen begeben wollte, ehrerbietig zur Hausthür begleiteten, vernahm er, daß die Begharden bei Anbruch des Tages wieder abgereist wären. Da gedachte er, nicht ohne stille Bewunderung, der schönen Reisegefährtin, doch bald war diese vergessen, als er nach wenigen Schritten das Haus des Schultheißen Ludwig Effinger erreichte, wo er Ursula von Falkenstein, seine Braut, zu finden erwartete.
Der Schultheiß, ein achtbarer Greis, saß im halbdunkeln Zimmer und las emsig und so gedankenvoll in einem vor ihm aufgeschlagenen dicken Buche, daß er sich nach dem Eintretenden nicht umsah. Den Tisch vor ihm, welchen viele Schriften und Pergamentbriefe mit großen daranhängenden Siegeln bedeckten, so wie ihn selbst, beleuchtete der durch die runden Scheiben des kleinen Fensters fallende Sonnenstrahl. Er war ein ehrwürdiger, frisch aussehender alter Herr, den das Gewicht der Jahre nicht beugen zu können schien. Über sein volles, rötliches Gesicht scheitelte sich das schneeweiße Haupthaar zu beiden Seiten, bis auf die Achseln, wo das einfache, schwarze Kleid von einem breiten, gefalteten Kragen aus den feinsten Linnen bedeckt war. Sobald der Schultheiß den Gast erkannte, erhob er sich freundlich, hieß ihn mit treuherzigem Händedruck willkommen, fragte um Wohlbefinden, um woher? und wohin? und befahl, zur Thür hinausrufend, daß man Erfrischungen bringe.
»Ihr trefft zur glücklichen Stunde ein, lieber Herr und Freund,« sagte er, »denn Jungfrau Ursula ist in unserer Stadt. Zwar hat sie mir das Leid angethan, nicht vor meinem Hause abzusteigen, doch wird sie heute mit uns zu Mittag speisen, und Ihr, versteht sich, seid von Herzen eingeladen.«
Nun erfuhr Gangolf, daß seine liebenswürdige Verlobte nur noch zwei Tage in der Stadt verweilen, dann zu ihrem Vater, Hans von Falkenstein, nach Seckingen reisen werde, daß sie, einige weibliche Bediente ungerechnet, einen Ritter Bentelin von Hemmenhofen und einen lustigen Gesellen von Waldshut, Namens Isenhofer, zur Begleitung habe, der kurzweilige Verse mache, aber ein Erzfeind der Eidgenossen sei.
»Dieser Isenhofer gefällt mir nicht!« sagte der Schultheiß. »Er ist ein Witzjäger, ohne Verstand. ein unbesonnener Schwindelkopf, der zu nichts rechtem taugt und da gern Feuer anbläst, wo er löschen sollte. Ich wollte, die Herren von Falkenstein duldeten ihn nicht um sich. Er regt gegen die Schweizer auf, wohin er kommt; das wäre jetzt am wenigsten nötig, wo die Zusammenkunft in Baden einen so üblen Ausgang genommen hat.«
Während eine Magd auf silbernem Teller in vergoldeten Bechern Malvasier, auch geröstete Brotschnitte und Backwerk aller Art zum Frühstück auftrug, wurde die letztberührte Begebenheit, das Anrücken der Armagnaken, die Stärke und Absicht des französischen Heeres, der Anspruch Friedrichs auf sein Recht im Aargau und andere Ereignisse dieser Tage besprochen. Lieber wäre der Bräutigam seiner Sehnsucht gefolgt und zur Verlobten hingeeilt, hätte ihn nicht der Schultheiß in ein Gespräch verflochten, welches seine ganze Aufmerksamkeit fesselte.
»Ich war erst unlängst im Freihof zu Aarau,« sagte der Schultheiß, »um mit Euerm Herrn Vater und seinen Freunden im dortigen Stadtrate vorläufige Abrede über das Verhalten unserer Städte beim Wiederausbruch des Krieges zu nehmen. Aber ich darfs Euch nicht verhehlen, ich erkannte Herrn Rüdiger, Euern Vater, meinen alten Freund, kaum wieder. Von Landessachen war nicht mit ihm zu plaudern. Ihr werdet ihn sehr verändert finden, lieber Herr und Freund, da Ihr ihn seit Eurer Reise zum König von Frankreich nicht gesehen habt.«
»Mein Vater?« sagte Gangolf bestürzt.
»Er ist hingeschwunden zu einem Schatten,« fuhr der Schultheiß fort: »Es scheint, ein unheilbarer Trübsinn verfinstert sein Gemüt und zehrt den Rest seiner Kräfte auf. Er teilt sich andern wenig mit, spricht viel für sich selber, ist oft ganze Tage im obern Gemach des Turmes Rore verschlossen, ja oft ganze Nächte, und man liest die Gleichgültigkeit, mit der er alle Vorgänge ansieht, in seinen Augen.«
»Ihr machet mich bange!« rief Gangolf. »Was ist ihm begegnet?«
»Eine schleichende Krankheit,« erwiderte der Schultheiß, »die ihren Sitz in der Leber hat, sagt der Arzt. Was weiß ich's? Gar nahe Gefahr ist wohl nicht da, doch solltet Ihr Euch auf alles bereit halten. Darum ist mirs lieb, Euch zu sprechen; denn ich meine, Ihr solltet bei Eurem Vater verbleiben und nicht weiter mit dem österreichischen Adel und im Dienste des Markgrafen umherziehen.«