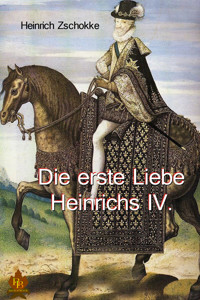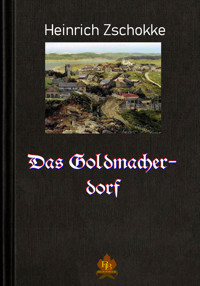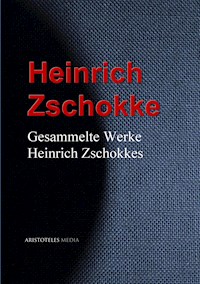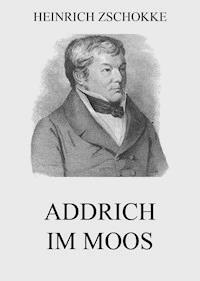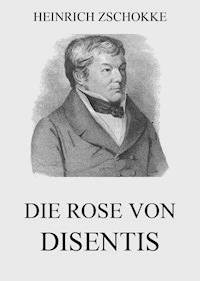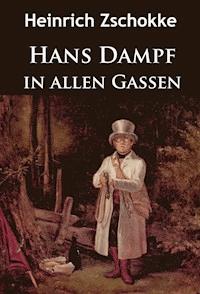1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Die Erzählung berührt ein trauriges Kapitel der Schweizer, speziell der Bündner Geschichte. Der Verfasser, Heinrich Zschokke, ein Deutscher, der in der Zeit der Helvetik eine Rolle in der Schweiz spielte, beschreibt in seiner Sprache das Geschehen in den drei Bünden, dem heutigen Kanton Graubünden zur Zeit der Franzosenherrschaft in unserem Land. Das Geschehen ist noch ganz frisch, nicht viele Jahre sind seither vergangen. Dies zeigt sich in der Sprache und der persönlichen Betroffenheit nicht nur des Protagonisten sondern auch in derjenigen des Verfassers, die mehr als einmal stark durchscheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Rose von Disentis
BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenVorwort
Wohl wäre eigentlich jedes Vorwort zu nachfolgender Kleinigkeit überflüssig, wenn ich nicht eine Art Gewissenszwang fühlte, das öffentliche Erscheinen dieser Kleinigkeit zu entschuldigen. Sie lag schon seit vielen Jahren angefangen, aber unvollendet, in meinem Pulte, wie manche andere Abhandlung, Novelle und Dichtung, die ich einst mit Vorliebe begann, und dann im Überdruß wieder wegwarf. Ich war von jeher im Umgang mit den neun Musen etwas flatterhaft; dieser Fehler gehörte zu meinen Lieblingssünden. Zur Strafe dafür, oder vielleicht auch, weil mein Haar grauer geworden, haben mich die pierischen Mädchen verlassen, was man in solchem Falle keinem Frauenzimmer verargen kann.
Jetzt einsam und müßig, blieb mir nichts Besseres zu tun, als die Bruchstücke der alten Arbeiten zum Zeitvertreibe zu mustern; mich daran, wenn's möglich wäre, mit Auffrischung gewisser schöner Erinnerungen zu ergötzen, und dann, wie der Pfarrer in Don Quixote's Bibliothek, damit ein Auto da fé oder Ketzergericht zu halten.
Da jedoch riefen einige liebe Leute, ich solle Barmherzigkeit haben, mit dieser Rose von Disentis, wie mit einigen andern Kleinigkeiten derselben Art. Auch Frauen waren's; und, man weiß wohl, wie schwer es ist, denen etwas zu versagen. Sie meinten sogar, es könne auch Andern noch eine frohe Stunde, und vielleicht selbst einige Belehrung gewähren.
Also fügte ich mich; blies den Staub von meinen Torso's und Antiken, und überlasse sie jedem, der sie will. Einstweilen sei es an dieser Rose, und auch wohl an einer gewissen kleinen Pandora genug. Ich werde nicht nachsehen, ob sie, im wilden Strome unserer Tagesliteratur, obenauf schwimmen oder untersinken.
1. Einleitung
Wer ein Leben voll reicher Ereignisse betrachtet, findet darin zuweilen Vorfälle, die romanhafter sind, als alle unsere Alltagsromane. Man kann die, von denen ich hier erzählen will, auch dazu rechnen. Ich will mir nicht die Mühe geben, den Leser oder Hörer dieser Geschichte von der Wahrheit derselben zu überreden. Mag jeder davon halten, was er will. Man traut heutigen Tages bekanntlich niemandem weniger, als sogenannten Novellendichtern und Diplomaten; mögen beide für ihre Aufrichtigkeit schwören, wie sie wollen.
Die hier besprochenen Begebenheiten fallen in die Zeit der französischen Umwälzungskriege, und stehen mit einem Vorgang derselben in Berührung, dessen die meisten Geschichtsschreiber kaum erwähnen, oder doch nur beiläufig gedenken, obgleich dieses nur beiläufig besprochene Ereignis viele Hundert Menschen in Elend und Tod stürzte.
Der Schauplatz des Trauerspiels sind wenig bekannte, selten besuchte Täler zwischen Felsen, von denen unsere Geographen und Reisebeschreiber kaum etwas zu sagen wissen, obgleich jene im Mittelpunkt Europa's liegen, und zu den sehenswürdigsten der Schweiz gehören. Ebenso fremd für die übrige Welt ist das darin wohnende Völkchen, obgleich es sich in seinen Wohnsitzen des ältesten und unvermischtesten Herkommens rühmen könnte, wenn ihm an solchem Ruhme etwas gelegen wäre.
Dieses Alles verpflichtet den Erzähler, seine Geschichte, die vielleicht doch wohl zur Unterhaltung dienen wird, mit einigen erläuternden Anmerkungen zu begleiten; und nötigt ihn, einen allgemeinen Überblick der Zeitverhältnisse und des Schauplatzes vorauszusenden, damit sich der geneigte Leser darin desto besser zurechtfinde.
2. Die Zeitverhältnisse
Am Ausgange des achtzehnten Jahrhunderts saßen auf den europäischen Thronen nur wenige, durch Erziehung und Schicksal zu ihrem hohen Berufe vorgebildete Fürsten. Die Meisten, wenn auch gutmütig und wohlwollend, hätten, als Privatleute, bei ihren Hausnachbarn kaum besondere Aufmerksamkeit erregt. Die Leitung des Staates überließen sie größtenteils ihren Kabinettsherren, Höflingen, Gewissensräten, oft sogar noch schlimmeren Händen; und sie hießen darum nicht minder die Vielgeliebten oder Väter des Vaterlandes. Einige waren sogar, wie man weiß, geistesschwach, oder vollkommen wahnsinnig.
Dabei fühlten sich die Untertanen so wohl oder übel, als es Zeit und Umstände erlaubten. Die obern Stände lebten im Genusse der wohlererbten Vorrechte ganz behaglich. ihnen gehörten die ersten Würden und Ämter, ohne andere Mühe, als daß sie sich hatten gefallen lassen, in, mit alten Stammbäumen wohlversehenen Familien, geboren zu werden. Weil sie dem Staate die unwichtigsten Dienste leisteten, belohnte man sie mit den vollwichtigsten Einkünften, wenigstens mit nicht geringeren, als vorzugsweise schöne Tänzerinnen und Sängerinnen, durch das angeborne Verdienst ihrer Kehlen und Füße, sich zu erfreuen hatten.
Was man eigentlich das Volk zu nennen pflegt, bewahrte man sorgfältig in altgewohnter frommer Einfalt und Treue. So arbeitete es in herkömmlicher Dienstbarkeit williger für das Wohlsein der Großen; steuerte im Frieden, wie im Kriege, schweigend Gut und Blut und wurde für die Entbehrungen und Leiden dieses Jammertales, mit den zukünftigen Freuden im Himmel getröstet. Die seefahrenden Mächte trieben, als gute Christen, Seelenverkäuferei und Sklavenhandel; die Landmächte mit ihren getreuen, lieben Untertanen ungefähr dasselbe Gewerbe auf Werbeplätzen oder beim Feilbieten ihrer Truppen an fremde Staaten.
Doch diese alte, gute Zeit drohte plötzlich ein Ende zu nehmen, als die französische Nation deshalb unwirsch wurde, weil der Bauer noch immer nicht, nach der Verheißung Heinrich's IV, an Sonntagen sein Huhn im Topfe fand; sondern kaum den Topf selbst behielt. Zur Verzweiflung getrieben, sprengte sie endlich sehr unerwartet ihre Ketten. Sie wollte frei sein, und wurde nur frech; zertrümmerte sogar den Königsthron, und errichtete auf einem vom Blute schlüpfrigen Boden das Gebäude der Republik.
Die Monarchen unsers Weltteils aber, empört über diese Verletzung des göttlichen Rechtes in der Person eines ihrer königlichen Brüder und Standesgenossen, brüteten Rache und begannen den Krieg. Nicht so göttlicher Natur hatte mehreren von ihnen damals das Völkerrecht geschienen. Sie hatten zum Beispiel ohne Bedenken das Leben Polens, des uralten Staates, vernichtet, ihn zerfleischt, und die Stücke desselben unter sich, als gute Beute, brüderlich verteilt. Man fand dieses sehr staatsklug und billig.
Der Krieg gegen Frankreich begann. Für den Fall des leisesten Widerstandes der Nation wurde ihr die Zerstörung von Paris angedroht, und daß man Salz auf die öde Stätte streuen werde. Die zuschauenden Völker sahen aber mit gerechtem Erstaunen, daß auch das Unglaubliche wahr werden, daß ungeübte Heere, die auf Paradeplätzen wohlgeübtesten, und daß unerfahrene Feldherren, die erfahrensten besiegen können; sie sahen mit eigenen Augen, daß Söhne gemeiner Bürger und Bauern eben so glänzende Taten verrichten können, als Prinzen und Herren vom ältesten Adel, daß in der Masse des Volks offenbar mehr hellsichtige Staatsmänner und geniale Heerführer unbekannt leben, als in der titel- und ämterreichen Region der wenigen Hochgebornen; und daß sich die Natur, ohne Scheu vor den Einrichtungen der Menschen, bei Verteilung ihrer Gaben, nicht im mindesten durch Stammbäume, Orden und Uniformen, bestechen lasse. Die Könige, nach langem Kampfe endlich erschöpft oder überwältigt, schlossen, nicht ohne bitteren Verlust auf einige Jahre oder Monate, ihren »ewigen Frieden« mit der verhaßten, aber siegreichen Republik.
Diese, durch Waffenglück nicht nur übermächtig, sondern auch übermütig geworden, trat sogleich selbst das Heiligtum des Völkerrechts, dessen Fürsprecherin sie gewesen, mit Füßen. Sie umgürtete sich stolz, sowohl mit Schlachttrophäen, als mit den Ländern der bezwungenen Nationen, und gab ihnen wohl den Namen selbstständiger, batavischer, cispadanischer, transpadanischer, ligurischer Freistaaten, aber dazu keine Freiheit von Innen, und keine Unabhängigkeit nach Außen. Ja, während sie jenseits des Meeres am fernen Nil das Mamelukenreich verwüsten ließ, zerstörte sie mit blutiger Faust auch in der Schweiz die Bundes- und Eidgenossenschaft der ältesten Republiken des Weltteils, und verwandelte sie in die eine und unteilbare helvetische Republik.
Nur ein einziges bisher dazu gezähltes Ländchen im Schoße der höchsten Alpen, Graubünden, oder Rhätien, ließen die französischen Machthaber unverletzt bestehen; und wohl nicht aus Großmut, oder wegen der Armut und Geringfügigkeit des kleinen Gebietes von anderthalb Hundert Geviertmeilen. Die Engpässe Bündens gegen Deutsch- und Welschland hin, hatten von jeher in den Augen der eifersüchtigen Nachbarmächte hohe Bedeutung gehabt. Für Oesterreich wurden sie aber eben jetzt von besonderer Wichtigkeit. Frankreich wollte den Frieden mit dem Wiener Hofe, welcher vor kaum einem halben Jahre erst zu Campo Formio geschlossen war, nicht schon wieder gewaltsam brechen. Man begnügte sich deshalb staatsklug einstweilen damit, das kleine Bündnervolk zu freiwilliger Vereinigung mit der helvetischen Republik höflich einzuladen.
Die Leute im Gebirge, deren Vorstehern wenigstens es nicht ganz an Kenntniß der Welthändel fehlte, sahen wohl ein, daß sie sich früher oder später, entweder mit der Schweiz vereinigen, oder, wie Venedig und Genua, ihrer alten Freiheit auf immer verlustig werden müßten. Doch weil man den Anschluß, als einen freiwilligen forderte, meinten sie, es habe damit keine Eile, er könne einst unter billigen, vielleicht sogar vorteilhaften Bedingungen stattfinden. Ohnehin war es keine leichte Sache, bei einer so wunderlichen Staatseinrichtung, wie hier, zu einer baldigen und besonnenen Entscheidung zu gelangen.
3. Der Schauplatz
Man denke sich ein Ländchen aus durcheinanderlaufenden Gebirgsketten und beinahe dreihundert Gletschern, wie ein Netz gestrickt, in dessen Maschen die Einwohner ärmlich, aber zufrieden, meistens vom Ertrage ihrer Herden, oder des sehr wenigen Landbaues leben. Dies ist Graubünden. Die geringe Bevölkerung, nicht nur in allen Richtungen durch himmelhohe Bergzüge, durch dreierlei Sprachen, und zweierlei Religionsbekenntnisse in sich geschieden, war es auch noch durch die vielfache politische Gestaltung. Das Ganze bildete nicht weniger, als eine Masse von fast dreißig kleinen, ziemlich selbstherrlichen Republiken, dort Hochgerichte genannt, mit besonderen Verfassungen, Gesetzen und Rechten. Diese Schar von Freistaaten hing teilweise durch drei unter sich abgesonderte, und zu verschiedenen Zeiten entstandene Bünde zusammen: Der Graue-, der Gotteshaus- und der Zehngerichts-Bund genannt, deren jeder wieder sein eigenes Bundeshaupt und seine eigene Bundesversammlung hatte. Die drei Bünde aber waren durch Verträge wieder mit einander in einen allgemeinen Bund zusammen geflochten, und stellten gegen das Ausland einen Gesamtstaat dar, dessen gemeinschaftliche Angelegenheiten durch Abgeordnete an einem gemeinsamen Bundestage beraten wurden. Die vollziehende Gewalt stand den drei Bundeshäuptern zu. Doch weder der Bundestag, noch die Regierung erfreute sich großer Machtvollkommenheit; denn ihre Anordnungen waren wieder der Genehmigung sämtlicher einzelner Republiken unterworfen. Die Mehrheit von den Stimmen derselben entschied dann; doch auch das Stimmrecht der Republiken war unter sich wieder sehr ungleich.
Nichts ist natürlicher, als daß bei solcher verworrenen Staatseinrichtung ewige Verwirrungen, Umtriebe des Eigennutzes und Ehrgeizes, politische und kirchliche Entzweiungen, zuweilen sogar bewaffnete Aufstände und Bürgerkriege, von denen die Weltgeschichte freilich wenig Notiz nahm, zu Hause waren.
Der souveräne Landesfürst, das Volk nämlich, hatte aber das gewöhnliche Los der Landesfürsten. Es wurde von Ratgebern und Günstlingen geschmeichelt; unwissend erhalten; nach deren Privatinteressen geleitet, und nicht selten betrogen. Trieben es die Herren manchmal zu arg, so warf der aufbrausende Selbstherr alles über den Haufen, das Gute, wie das Schlechte. Weil aber bei solchen Anfällen von böser Laune niemand größeren Schaden litt, als der Landesherr selbst, so legte sich sein Zorn bald wieder.
In einem Staate, so arm und klein, wie dies Gebirgsland, wo, was auch wohl in großen Staaten der Fall sein mag, politische Grundsätze und Meinungen gewöhnlich von den ökonomischen Vorteilen ihrer Bekenner abhängig waren, konnte es nie an Fraktionen fehlen. Lange Zeit spielte das, durch viele Täler verzweigte Geschlecht der Herren von Salis die Hauptrolle unter den Magnaten. An ihrer Spitze stand zuletzt ein Mann von großer Geschäftsgewandtheit und Tätigkeit, Ulysses von Salis-Marschlins. Er fand es lange Zeit mit seinem Patriotismus verträglich, als Geschäftsträger des französischen Hofes, mit dem Ministertitel geschmückt, die Interessen einer fremden Macht im eigenen Vaterlande zu vertreten. Sobald er jedoch, durch den Untergang Ludwig's XVI., seine einflußreiche Stellung, und sobald seine zahlreiche Verwandtschaft, oder Partei, ihre beträchtlichen Einkünfte von Kriegsdiensten und aus Jahrgeldern verloren hatte, verwandelte er und sein Anhang sich in Frankreichs Todfeinde und wendeten sich dem Erzhause Oesterreich zu, in der Hoffnung, durch dienstbeflissene Hingebung an dessen Interessen, neue Stützen ihres wankenden Ansehens zu gewinnen.
Ihrer altgewohnten Hoheit und Machtherrlichkeit war in der Tat schon früher mancherlei Abbruch geschehen. Die Gegenpartei in den Tälern des Hochlandes, reich an talentvollen und scharfsichtigen Männern, unter denen die der Familie Tscharner, Planta, Bavier, selbst einzelne Glieder des Hauses Salis - unter ihnen auch der liebenswürdige Dichter, Gaudenz von Salis-Seewis - hervorragten, ermüdete nicht, die größten, wie die kleinsten Staatssünden, Verfassungsverletzungen und Bestechungskünste der Oligarchie aufzuspüren und zu enthüllen. Sie setzte dem aristokratischen Stolze derselben, starrsinnigen demokratischen Trotz entgegen, und hatte sogar schon die Pacht der Landeszölle, welche das Haus Salis, seit einem halben Jahrhundert und länger, um 16,000 Gulden unangefochten zu seiner Selbstbereicherung besessen hatte, auf 60,000 emporgetrieben.
Dies und vieles Andere schwellte täglich mehr beider Parteien Zorn oder Rachsucht. Beide wetteiferten darin, sich beim vielhäuptigen Landesherrn gegenseitig zu verdächtigen, und ihn zum Verderben der andern aufzureizen. Man sieht, es geht in Republiken ungefähr eben so zu, wie in Monarchien. Als aber der Mißwachs des Jahres 1793, und die beschränkte Einfuhr schwäbischen Getreides dazu kam; als jene völkerrechtswidrige Gefangennehmung der französischen Gesandten, Semonville und Maret, auf Bündner Boden, und deren Auslieferung an Oesterreich, durch Anhänger der Partei Salis geschah (Am 25 Juli 1793 bei Navote am See von Chiavenna. Näheres darüber, mit Beweisstücken, findet sich im dritten Heft des »Prometheus für Licht und Recht,« S. 81 (Aarau, bei H. R. Sauerländer, 1833), mitgetheilt.); erhob sich in den Gemeinden tobender Unwillen. Eine außerordentliche Standesversammlung, ein unparteiisches Gericht, wurde vom Volke zusammenberufen. Ulysses von Salis-Marschlins floh aus dem Lande, sei es aus Furcht vor der Gerechtigkeit, oder aus Besorgnis vor der Ungerechtigkeit seiner Richter. Indessen sowohl er, wie mehrere der tätigsten Männer seiner, oder der sogenannten österreichischen Partei, büßten ihre politischen Sünden mit schweren Geldstrafen. Die siegreichen Gegner, nun französische Partei geheißen, nannten sich selbst Patrioten, sie feierten einen entschiedenen Triumph. Baptista von Tscharner, der Bürgermeister von Chur, stand fortan, als Standespräsident, an deren Spitze.
Doch war der Kampf der Fraktionen damit noch keineswegs beendigt. Als wenige Jahre später die empörten, Bünden untergebenen Landesteile, Valtelin, Chiavenna und Bormio, gleiche Rechte und Freiheiten mit dem Herrscherlande forderten; als die Mehrheit der landesherrlichen Räte und Gemeinden wirklich schon entschieden hatte, jene Gebiete als vierten Bund in den Staatsverband aufzunehmen; und als der zum Schiedsrichter in diesem Handel angerufene Eroberer Italiens, Napoleon Bonaparte, den Tag seines Spruches schon anberaumt hatte; gelang es den Gegnern Frankreichs, die Sendung der Abgeordneten an den französischen Oberfeldherrn, bis nach Ablauf der von ihm bestimmten Frist, zu verzögern. Darauf wurden die untertänigen Lande mit der cisalpinischen Republik vereinigt. Der Spruch geschah am 10. Oktober 1797..
Der Verlust eines fruchtbaren und schönen Gebietes von 60 Geviertmeilen und mehr als 80,000 Einwohnern, fast aber mehr noch der Verlust des dort gelegenen Privateigentums vieler Bündnerfamilien und der Verlust des Gewinnes derselben von der Ausbeute der Ämter und Vogteien, empörte das Gebirgsvolk von Neuem gegen die aristokratische Partei. Umsonst versuchte man durch Gesandtschaften zum Rastatter Kongreß, oder nach Paris, das Geschehene ungeschehen zu machen. Man mußte sich damit begnügen, die Urheber des Unglücks vor Gericht zu ziehen, und sie mit Geldbußen, mit Ausschließung von allen Staatsämtern, vom Stimmrecht u. dgl. m. zu bestrafen. Ein freilich schlechter Ersatz für ein großes, nun verlorenes Gebiet, welches seit beinahe dreihundert Jahren rhätisches Eigentum gewesen war.
4. Der Fraktionen-Kampf
Die Unterjochung und Staatsumwälzung der benachbarten bundesverwandten Schweiz durch Frankreichs Heere; die Umschaffung der alten Eidgenossenschaft zu einer helvetischen Republik, als deren Bestandteil, in der von Paris erschienenen Staatsverfassung. auch schon Graubünden genannt war, verbreitete gerechte Befürchtungen durch alle Täler des rhätischen Gebirges. Die aristokratischen Geschlechter, schon tief genug gebeugt, erblickten in der Vereinigung Bündens mit einem helvetischen Freistaat, den Untergang ihrer letzten Hoffnung, jemals wieder den alten Einfluß, Rang und von Fürstenhänden genährten Reichtum zurück zu erhalten. Eine so trostlose Aussicht erfüllte sie mit dem blinden Mute der Verzweiflung, Alles für Alles, selbst, wenn es sein müsse, die Freiheit ihres Volkes, das Bestehen ihres eigenen Vaterlandes, im gefährlichsten Spiel zu wagen. Sie versuchten, mit dem Wiener Hofe geheime Unterhandlungen anzuknüpfen, darüber, daß er, mit ihrer Hilfe, sich den Besitz Graubündens zusichere, bevor sich Frankreich desselben bemächtigen könne. Man legte dem, im Vorarlberg stehenden kaiserlichen General Auffenberg ausführliche Kriegspläne vor, in das Hochland einzurücken, von wo aus, wie aus einer starken Veste, die Franzosen sowohl in Italien, als in der Schweiz, mit entschiedenem Vorteil anzugreifen, und die Eingänge Tyrols am sichersten zu decken wären. Der »Militär-Plan« des Barons von Salis-Marschlins und der Briefwechsel mit General Auffenberg und Baron von Cronthal wurde nachher bei der Gefangennahme Auffenberg's, im März 1799, unter dessen Schriften durch einen französischen Lieutenant beim 7. Husarenregiment, namens Bacher, entdeckt und der provisorischen Regierung Bündens übergeben, dann im Archiv der helvetischen Regierung zu Bern niedergelegt, wo sich diese Papiere, bezeichnet A. bis R. und No. 1. bis 21. befinden. Der Kriegsplan ist in denselben unter No. 11. enthalten.. Man suchte mit allen Künsten der Überredung den Minister-Residenten Oesterreichs, Baron von Cronthal in Chur, zu gewinnen. Doch der Eine, wie der Andere, gab, weil Oesterreichs Rüstungen noch nicht beendet waren, zwar freundliche Hoffnung, doch ausweichende Antwort: man müsse den gelegenen Zeitpunkt erwarten; es fehle zu einem solchen Schritte bisher an einem guten Vorwande oder rechtfertigenden Grunde. Vorwand? Grund? Nichts leichter, als diesen zu finden, erwiderte man ihnen. Wir erregen einen großen Volksaufstand, und verbreiten damit den Aufruhr gegen Frankreich durch die ganze Schweiz. Laut Certifikat des helvetischen Archivars Vinet, fügt ein Schreiben unter Litt. A. an Auffenberg vom 28. Mai 1798 hinzu: »C'est ce que votre cour demande, pour avoir un prétexte plausible pour s'emparer des Grisons.« Gesagt, getan. Sogleich brachen in den katholischen Gemeinden der wilden Oberlands Täler Unruhen aus. Doch Cronthal selbst widersetzte sich dem voreiligen Ausbruche einer stürmischen Bauernerhebung. Wozu er sich außerdem noch durch ernste Vorstellungen bewogen finden mochte, welche ihm im Namen des Landtags-Ausschusses, der Hauptmann Joh. Baptista Bavier machen mußte.
Unter solchen Bewegungen und Umtrieben verfloß die erste Hälfte des verhängnisvollen Jahres 1798; offener und gewaltsamer traten sie aber in der andern Hälfte desselben hervor. Von Seiten der helvetischen Regierung, und unterstützt von der französischen, erschien die wiederholte Einladung zum Anschluß Bündens an die Schweiz. Eine Lebensfrage, wie diese, konnte nur durch die Gesamtheit des selbstherrlichen Volkes beantwortet werden. Jedem verständigen Manne war es aber zweifellos, daß der kleine Staat nicht länger vereinzelt für sich dastehen könne; daß er früher oder später, entweder zur Schweiz und in den französischen Machtkreis, oder in den österreichischen werde hineingezogen werden.
Die demokratische Partei, noch am Ruder des Staates befindlich, und in der Hoffnung, wenn auch nicht die Selbstständigkeit des Staates, doch die Freiheit des Volkes zu retten, mahnte zum treuen Verbleiben bei der alten bundes- und schicksalverwandten Schweiz, doch unter der Bedingung, daß die wirkliche Vereinigung nicht früher, als nach dem allgemeinen Frieden Europa's vollzogen werden; oder wäre dies nicht tunlich, daß wenigstens keine fremden Befehlshaber und Kriegsvölker den Bündnerboden betreten und das Gut des Landes antasten sollten.
Ohne Zweifel ein wohlgemeinter Rat; den Begriffen, Sitten und Gewohnheiten des größten Teiles der Bergbewohner klang indessen die Stimme der aristokratischen Ratgeber zusagender. „Keine Vereinigung,“ hieß es da, „mit der verwüsteten, unglücklichen Schweiz. Bleiben wir für uns; wir können es. Das erbvereinte Erzhaus Oesterreich ist zum Beistande bereit. Laßt Euch durch nichts verblenden. Wer ist ein Landesverräter? Wer französische Räuberbrigaden in unsere friedlichen Täler ruft, daß sie die Religion unserer Väter vernichten; unsere alten Freiheiten zertreten; unsere Hütten plündern; das Vieh der Alpen entführen; Weiber und Töchter schänden und die Söhne auf fremde Schlachtfelder schleppen. Wer will solchen Hochverrat? Niemand unter uns, als die französische Partei im Lande.“
Die große Mehrheit des Volkes verwarf also die Vereinigung mit der helvetischen Republik. Es wurde am 8. August 1798 erklärt., und überließ sich der ungezügelten Wut gegen alle, welche für das Gegenteil gesprochen, oder gestimmt hatten. Die demokratische Partei war verloren. Der landtägliche Regierungsausschuß wurde gezwungen, sich aufzulösen, und die öffentliche Verwaltung seinen aristokratischen Widersachern abermals zu überlassen. Feindschaft, Verfolgung und Ächtung aller, welche die Vereinigung mit der Schweiz empfohlen hatten, war die natürliche Folge hiervon. Privathaß und die Rache der Sieger feierten ihr Fest über die Besiegten. Nicht Eigentum noch Leben derselben blieben länger gesichert. Hundert um hundert der sogenannten Patrioten retteten sich durch die Flucht vor dem Grimme des aufgewiegelten Volkes, über die Alpen und den Rheinstrom, ins Ausland.
5. St. Moritz
Inmitten dieser Unordnung, welche beim Herandrängen österreichischer Kriegsvölker von Osten, und französischer von Süden und Norden her, gegen die Grenzen, täglich stürmischer wurde, zerrissen die Bande des geselligen Umganges, des häuslichen und Familienlebens. Selbst der berühmte, sonst zahlreich besuchte Sauerbrunnen von St. Moritz, im Hochtal des Engadins, war, während der schönsten Sommermonate, halb verwaist. Und doch ist die Kraft des Heiltrankes, welchen die Gnomen der Unterwelt hier brauen, nicht minder gepriesen, als jene von Spaa und Pyrmont, und noch erhöht durch die reine Luft der Alpen, welche hier erquickend die kranken Glieder badet. Zwar wölben sich nicht, wie dort, Prachthallen über der heiligen Quelle; noch prangen palastähnliche Kur- und Ballsäle, oder öffentliche Unglückshäuser des Glücksspiels neben ihr; doch spricht die Natur in wunderbaren Reizen hier den Wanderer mächtiger an, als in irgend einem anderen Schweizertale.
Fünftausend Fuß erhaben über dem Meeresspiegel, wohnt der Besucher im anmutigen, malerischen Gebirgstal, umringt von einer unbekannten Pflanzenwelt. Durch das Grün schlanker Lärchentannen blitzen drei helle Seen, in denen sich der junge Inn badet, von Wiesen umfangen, welche vom großblütigen Klee wie mit Rosen bestreut sind. Dunkle Zirbelnußkiefern steigen aus der Ebene an den Hügeln und Urgebirgen empor, die hier mit ihren nahen Gletschern und Silberfirnen das majestätische Bild umsäumen, großartiger als Chamouni und der Grindelwald. Zwischen benachbarten hohen Granitfelsen senkt sich, einem im Herabsturz erstarrten, breiten Strome gleich, der Rosatschagletscher herab, an dessen Enden die Lustwandler Alpen-Anemonen, dunkelblaue Gentianen und nordische Linneen pflücken.
Im Beginn des Herbstes des Jahres 1798 war es, als die hier noch zurückgebliebenen Brunnengäste, meistens Familien des Bündnerlandes, ihre mäßige Anzahl durch ein Paar Spätlinge vermehrt sahen, die einige Aufmerksamkeit erregten. Man hielt sie für ein junges Ehepaar, welches weniger die Heilquelle, als den Honig der Flitterwochen auf der Hochzeitreise, ungestört kosten zu wollen schien. Der junge Mann, kräftig und wohlgebaut, von blühender Gesichtsfarbe, blauen Augen und schwarzen, lockigen Haaren, trug vollkommen das edle Gepräge des Menschenschlages vom Ober-Engadin. Er mochte kaum dem Ende der zwanziger Jahre nahe sein, seine schöne Begleiterin aber dieselben kaum erst begonnen haben. Der Adel ihrer Gestalt und Haltung, das kindlich Zarte ihres Antlitzes, der schwärmerische Blick ihrer blauen Augen unter den schwarzbraunen Locken, und dabei ein um die Lippen spielendes schelmisches Lächeln, waren wie geschaffen, jeden zu erobern, der ihr nahte. Doch selten nur erschienen beide am Gesundbrunnen, der vom Dorfe St. Moritz etwa vierhundert Schritt entfernt, neben einem alten, hölzernen Gebäude gelegen war. Gewöhnlich sah man sie, Arm in Arm, durch Wiesen und Wälder allein umherstreifen. Es erhob sich sogar unter den neugierigen Kurgästen Streit darüber, wer von beiden den Preis der Schönheit verdiene? Und als die Damen sich zu Gunsten des Herrn, die Herren sich zu Gunsten der Dame erklärt hatten, blieb nur noch zu enträtseln, wer das Pärchen eigentlich sei?
Es wurde bald erforscht. Man erfuhr, es seien nichts weniger, als junge Eheleute, sondern Bruder und Schwester, Kinder längst verstorbener, wenig bemittelter Eltern aus dem angrenzenden Tale Bregell, jenseit des wilden Maloggiagebirges; durch eine unerwartete Erbschaft aus England beide plötzlich reich geworden. Er sei ein Schützenhauptmann, namens Flavian Prevost; sie eine Frau von Schauenstein, die ihren siechen Gemahl hieher begleitet habe, welcher aber kaum das Zimmer verlassen könne.
Die edle Neugierde oder Wißbegierde war also befriedigt; doch nicht ganz zum Vorteil des vielbesprochenen Pärchens. Man hatte nämlich zugleich erfahren, der Schützenhauptmann Prevost sei der Vertraute des französischen Residenten Florent Guiot, Freund der Tscharner, Planta, Joste und anderer Patrioten, das ist, Franzosenfreund, »Revoluzionär und Landesverräter«. Von Stunde an wich man ihnen, wie von Pest Befallenen, mit Scheu aus. Die sonst gar höflichen Herren erwiderten dem jungen Manne, im Begegnen kaum den Gruß; und auf die liebenswürdige Schwester schielten sie von nun an nur ganz verstohlen. Die Damen aber ließen selbst der unschuldigen jungen Frau keine Gnade mehr widerfahren; die eine fand sie frech und gefallsüchtig; die andere linkisch und bäuerisch; die Dritte äußerst geschmacklos und vernachlässigt in der Wahl des Putzes. Sie wendeten das Gesicht ab, wenn sie der Zufall ihr entgegenführte, und erlaubten sich höchstens, einen mitleidigen Blick über die Gestalt des Begleiters hinfliegen zu lassen.
6. Kannegießereien
„Nun endlich stehen wir anderen Ehrenleute einmal wieder auf festen Füßen,“ sagte einer der letzten Kurgäste zum andern, mit dem er an einem heiteren Oktobermorgen noch allein in der hölzernen Trinklaube plauderte.
Der Ehrenmann, der dies gesprochen hatte, obgleich nur halb städtisch gekleidet, groß und stark gebaut, schien darum nicht minder eine hochwichtige Staatsperson zu sein. Wenigstens verkündeten es die Mienen seines breiten, sonnenverbrannten Gesichtes, mit steifen, lederartigen Falten tapeziert. „Ja, ja, auf festen Füßen,“ wiederholte er, und rieb sich freudig die harten Hände, welche man beinahe rauschen hörte. „Nicht wahr, Ihre Weisheit.“ (Der Titel »Ihre Weisheit«, nicht schlechter oder wahrer, als Exzellenz oder Hochwürden, ward sonst den höheren Staatsbeamten des Bündnerlandes gegeben.) „Nicht wahr, die Nachricht ist Tonnen Goldes wert? Man konnte bisher nicht ruhig schlafen, weil die Franzosen im Stande gewesen wären, über Nacht ins Land einzubrechen. Der Prevost muß noch keinen Unrat wittern. Ich wundere mich, daß er sich nicht aus dem Staube macht, wie seine übrigen landesverräterischen Spießgesellen.“
„Man wird ihm bald den Weg weisen, wenn er ihn nicht finden kann, oder suchen will,“ erwiderte mit vornehm gleichgültigem Tone der Nebenmann, ein alter, zierlicher Herr mit gepudertem Haare, in pelzverbrämtem, aschfarbenem Überrock, mit einem im Knopfloche bescheiden sichtbar werdenden Ordensbändchen. Sein röthliches, übrigens nichtssagendes Gesicht war, seltsam genug, durch eine Nase geziert, die vorn in einen blaurötlichen Ballen endete. „Ich wundere mich bloß,“ fuhr er fort, indem er die Tabackspfeife mit dem silberbeschlagenen Meerschaumkopf einen Augenblick absetzte, um eine blaue Rauchwolke in Wirbeln fortzublasen; „ich wundere mich bloß, daß man aus dem Burschen so viel Wesens gemacht hat. Man weiß ja, Herr Landvogt, er ist von der gemeinsten Herkunft, ein bloßer Bauernkerl.“
Der Landvogt schien die letzten Worte etwas empfindlich zu nehmen und meinte: „Herkunft hin, Herkunft her, Ihre Weisheit. Bei uns zu Lande, denke ich, ist, wer Geld hat, Edelmann, und der Prevost da, wie man hört, besitzt Moses und die Propheten. Darum sage ich, Herkunft hin, Herkunft her! Manch uraltadeliges Bündnergeschlecht ist heutzutage froh, wenn es eine Kuh im Stalle oder einen Pflug im Haberfeld haben kann. Falls uns der Kaiser mit Jahrgeldern und Regimentern nicht wieder auf die Beine hilft, kann noch manches gute Haus, trotz dessen Wappen und Krone, zur Strohhütte werden.“
„Pah! sie scheinen heute einen kleinen Anstoß von Hypochonder zu haben, Herr Landvogt?“
„Hypochonder, Ihre Weisheit? Meiner Treu! die heutigen Zeiten sind wohl danach, und sind es schon lange. Die schönen einträglichen Ämter in den welschen Vogteien haben wir auf ewig verloren, wenn der Kaiser zur Wiedererlangung nicht die Hand reicht. Wohlfeil konnte man zwar die Ämter des Landes schon längst nicht mehr kaufen. Ich hatte von Glück zu sagen, als ich meine Stelle in Teglio für 5000 Gulden bar erstand, ungerechnet, was ich damals den Bauern an Brot, Käse, Würsten und Wein austeilen mußte, um die Wahl in geläufigeren Gang zu bringen. Seit der Vicari Ott Singer von Katzis den Lugnetzern für die Landeshauptmannschaft von Sondrio 15,000 Gulden zahlte, ja seitdem, Ihre Weisheit, war nicht mehr viel zu profitieren.“
„Sie haben nicht ganz Unrecht, Herr Landvogt,“ bemerkte die vornehme Weisheit. „Jetzt aber muß nicht mehr geklagt, sondern gewagt werden. Der Kaiser steht mit seiner ganzen Kriegsmacht auf unserer Seite. Wir vollziehen, was neulich der Bundestag von Ilanz beschlossen hat; rüsten sechstausend Mann aus; tapferes Volk und gediente Offiziere darunter. Es müßte im Himmel und auf Erden alle Gerechtigkeit ausgestorben sein, wenn die rebellische Canaille in Frankreich und der Schweiz nicht zu Paaren getrieben werden könnte. Die Stunde der Erlösung ist da, sage ich. Jeder von uns muß jetzt den letzten Blutzger (Ein Name der kleinsten Scheidemünze in Graubünden.) daran setzen.“
Der Landvogt nahm mit verdrießlicher Miene eine Prise aus seiner hölzernen Dose und meinte: „Der letzte Blutzger wird wohl davon fliegen, wir mögen ihn daran setzen wollen, oder nicht. Sechstausend Mann kaiserliche Einquartierung unterhalten, dazu die Kriegskosten, – zuletzt sind wir insgesamt Bettler. Ich habe schon oft im Stillen bei mir gedacht, der Battistin von Salis hatte keinen dumen Einfall, als er uns das Veltlin abkaufen wollte. Wir hätten eine schöne Summe gelöst, unter uns verteilt und so wenigstens bares Geld im Sacke gehabt.“ (Ein religiöser und politischer Schwärmer. der in allem Ernst ein Memorial mit dem Vorschlag eingab, das Valtelin, die Grafschaft Chiavenna und Bormio von den Bündnern zu kaufen. Man wollte argwöhnen, daß mehrere reiche, ihm verwandte Familien dabei im Hintergrunde gestanden hätten, denen nach einem Fürstenthron gelüstet habe.)
„Possen, Herr Landvogt. Bricht Krieg aus, so erobern wir die Untertanenlande zurück. Ich stehe dafür, sie sollen ihre Empörung teuer bezahlen. Bünden kommt nie und nimmer an die Schweiz, das heißt, an Frankreich. Wir bleiben die Herren. Und wenn alles fehl schlägt, dann lieber, mit Vorbehalt unserer Rechte und Freiheiten, zu Oesterreich. Dem Volke mag's gleich sein, von wem es regiert wird; wir anderen bleiben, die wir sind. Ich spreche, wohl gemerkt! nur vom äußersten Falle. Jetzt heißt's, Hand an's Werk gelegt. Wir sind wieder Meister im Lande. Bürger Guiot (Minister-Resident der französischen Republik in Bünden.), alle unsere Revolutionshelden sind landesflüchtig – – –“
„Nicht alle, Ihre Weisheit,“ unterbrach ihn kopfschüttelnd der bedächtige Landvogt. „Es erwarten noch Tausende, noch ganze Gemeinden mit Sehnsucht die Franzosen. Aufpasser gibt's ringsum. Denken sie doch an diesen Prevost, der ungestört mit den Feinden korrespondirt.“
„Ich sage, Herr Landvogt,“ erwiderte der Magnat mit Zuversicht im Tone und Blicke. „Er hat auskorrespondiert. Ich habe schon nach Chur geschrieben. Man wird den Burschen festnehmen, und ein Beispiel statuieren. Der Prevost ist nichts anderes, als ein Spion. Nach Kriegsrecht gehört er an den Galgen, und ich möchte ihm dazu verhelfen.“
„Hier bin ich! Will Ihre Weisheit nicht lieber den Henkerdienst selbst verrichten?“ donnerte ihn unerwartet eine kräftige Stimme an. Der Schützenhauptmann war durch die offene Tür der Trinklaube eingetreten, hatte die letzten Worte gehört und stand mit drei Schritten plötzlich vor dem Staatsmann. Dieser fuhr so erschrocken im Sessel zurück, daß sein Haarzopf in die Höhe flog, und der ausstäubende Puder mit dem, dem beredten Munde entqualmten Tabacksrauche, eine gemeinschaftliche Wolke bildete. Die gewöhnliche Rotglühhitze seines Gesichtes war, ungewiß, ob aus Furcht oder Zorn, in Weißglühhitze übergegangen. Nur der Knopf an der Nasenspitze blieb standhaft veilchenfarben.
„Wie – was!“ stammelte er endlich. „Was begehren Sie, Herr? Wer sind Sie?“
„Hauptmann Prevost bin ich, und ihrer Weisheit einen weisen Rat geben will ich.“
„Herr, – Herr – aber ich verlange keinen,“ rief der Magnat, sich ermannend.
„Eben darum haben sie und ihres Gleichen das Vaterland ins Verderben gestürzt,“ entgegnete der Hauptmann. „Ihre Fraktion ist der blinde Simson, der die Säule des Hauses einreißt, um seine Feinde zu zerschmettern, und sich unter den Trümmern selbst begräbt. Das ist die ganze Weisheit der bündnischen Weisheiten von heute. Doch genug! Verzeihung, wenn ich sie störte; ich suchte einen anderen, als sie.“
Mit diesen Worten wandte er sich rasch um; verließ die Trinklaube und eilte die Treppe hinunter, wo ihn die schöne Schwester erwartete.
7. Die Rose von Disentis
„Ist er also nicht oben?“ fragte sie, und legte ihren Arm wieder in den seinigen.
„Statt seiner ein Paar Flachköpfe, die man »Weisheiten« tituliert. Begeben wir uns ins Dorf zurück,“ antwortete er mißmutig, und führte die junge Dame davon.
„Flavian, sei der Flachköpfe willen kein Brausekopf,“ mahnte die Schwester. „du könntest ja so froh und friedlich bei uns leben, wenn du dich nur um die unseligen politischen Händel weniger bekümmern würdest. Eine Partei, wie die andere, wird vom bösen Geiste der Leidenschaften besessen. Lasse beide fahren.“
„Wenn ich mich selbst fahren lassen könnte,“ seufzte er. „Heute reise ich wieder fort. Je eher, desto lieber; es ist hier nicht geheuer. Ja, liebe Sabine, ich fühle es; in dieser Luft darf ich nicht länger atmen. Ich gehe, wohin die übrigen Märtyrer gegangen sind. Warum bin ich in der Welt, wenn nicht für das Wahre und Rechte. Ich will es, denn Gott will es. Dafür leben, dafür sterben, macht Leben und Tod wertvoll.“
„So seid Ihr Männer,“ schalt Frau von Schauenstein, und tat recht böse. „Wenn Ihr nicht raufen und streiten könnt, ist Euch unwohl. Dein wildes, heißes Blut abzukühlen, Brüderchen, das sei dir Lebensaufgabe. Deine Augen werden heller schauen, wenn sie nicht mehr zorntrunken funkeln. Glaube mir's, die Welt ist und wird, was wir in uns sind und werden. Auch in der Stille des häuslichen Kreises, durch Beglücken anderer, würdest Du ein glücklicher Mann werden.“
„Glücklich, Sabine, kann ich in einem Lande nicht werden, wo mich niemand versteht, und wo ich niemanden verstehe. Lieben soll ich, wo jeder nur sich, und nichts Anderes liebt. Hätte ich nicht dich noch unterm Himmel, ich stände in einer Wüste. – Glücklich, sagst du, armes Kind, im häuslichen Kreise? Darfst du wohl selbst so sprechen? Bist du glücklich? Und wer verdiente es doch mehr zu sein, als du, liebe Seele. Ich kenne deinen wunderlichen Eheherrn. – – – Rede die Wahrheit, bist du glücklich?“
Die junge Frau schlug die Augen nieder, und äußerte, mit anfangs unsicherer Stimme: „Hörtest du mich je mein Los beklagen? Warum solche Frage heute? Ich liebe meinen Mann, wie einen Vater. Vater ist er auch dir gewesen; der ist er mir. Vergiß nie, daß wir ihm unsere bessere Erziehung verdanken; daß er uns, als verwaiste, arme Kinder, in Schutz nahm; daß er dich auf seine Kosten nach Wien schickte, und die Rechte studieren ließ; daß wir, was er getan hat – –“
„Nicht doch, Sabine,“ unterbrach sie bittend der Bruder. „Rede ganz wahr, nicht bloß halb. Was er getan, er hat es sich getan. Dich, die seine Enkelin sein könnte; dich, die noch ein unwissendes, ratloses Mädchen war, nahm der alte, reiche Herr zum Weibe, vernarrt in deine kaum aufgeblühten Reize. Du brachtest ihm, was du und ich damals nicht recht verstanden, deine Jugend, deine Schönheit, die Ansprüche auf das schönste Lebensglück zum Opfer. O, wären wir doch arm geblieben an den lieben Felsenufern des Mairaflusses. (Ein Fluß, der das vier Stunden lange, von Eisbergen und Felsen eingeengte Bregellertal durchfließt.!) Mich mußte er deinetwegen wohl mit in den Kauf nehmen; freilich für seinen Adelsstolz eine widerliche Zugabe. Ja, er gab mich in den Unterricht des weisen Nesemann (Joh. Peter Nesemann, aus dem Magdeburgischen, Professor an der höhern, damaligen Lehranstalt zu Reichenau, früher zu Haldenstein. Er starb, 80 Jahre alt, 1802 in Chur.); schickte mich nach Wien, weil er keinen Bauernburschen Schwager nennen wollte; aber ungroßmütig, und oft genug, rechnete er, was ich ihm gekostet. Wer uns Wohltaten vorrechnet, hat die Blume zerquetscht, und uns bloß den kahlen Stengel gelassen. Ich gab ihm den Stengel zurück, ich zahlte ihm seine Auslagen bar zurück, und wir sind quitt. Aber dich beklage ich, Sabine. Dich betrog er um die Bestimmung des Weibes; dich machte er am Traualtar schon zur Witwe und Dein Leben zur freudenlosen Einöde. – – –“
„Halt ein, Flavian, du bist hart, bist ungerecht. Ich bin zufrieden; mein Mann ist gutmütig, und gerechter, als du. In unserm stillen Schlosse wohnen stille Herzen. Mir blüht in meiner Abgeschiedenheit eine schönere Welt, als du im aufgewühlten Staube wilden Menschengetümmels je entdecken kannst. Siehe, Brüderchen, aber lächle nicht ungläubig; einem reinen Gemüt verklären sich, in der Vereinsamung, Himmel und Erde zum Paradiese, durch welches man gleichsam Gott wandeln sieht. Da flüstern mir, wie Engelszungen, die Blätter des Gebüsches, Seelenruhe zu. Da plaudern im Getöse des Wasserfalls wunderbare Stimmen von göttlichen Dingen, oder Dingen, die einmal gewesen sind und wieder kommen wollen. Dann rinnen oft Zeit und Ewigkeit zusammen; und die fernen Geliebten treten zu mir, und die Verstorbenen leben und lächeln mich an.“
„Wie schwärmst du wieder? Haben dich etwa Jean Paul's, oder Tieck's Phantasiesprünge begeistert?“
„Nenne das nicht Schwärmerei, Flavian. Glaube mir, gewiß, es waltet zwischen dem Unsichtbaren des geistigen Alls, und dem Sichtbaren um uns, ein geheimnisvoller Verband, ein engerer, als Dir und deiner Schulgelahrtheit ahnet. Das Irdische ist nur Zeichen und Wort des Überirdischen, das zu uns reden will. Du verwunderst dich über Vieles, was du Zufall nennst, und läßt dir's nicht träumen, daß eine verborgene, heilige Hand mit dir spielt. Ist dir unsere liebe Mutter denn noch nie sichtbar aus deiner Rose von Disentis hervorgegangen?“
„Ich glaube, liebes Kind,“ sagte der Hauptmann, indem er einen Blick voll Befremden auf das Gesicht der Schwester warf, „du bist zuletzt gar Geisterseherin geworden. Was? Rose von Disentis?“
„Nun, ich heiße so die Alpenrose, deren Blüten, zu einem Kränzchen verbunden, in den beiden Medaillons liegen, die Abt Kathomen von Disentis einst unserer Mutter geschenkt hatte. Siehe, Flavian, wenn ich des Morgens die Kette des Medaillons um meinen Nacken lege, wird mir wirklich jedesmal, als fühle ich der Mutter Geisterkuß; ich sehe ihr Bild auf dem blaßroten seidenen Grunde des Medaillons und es gewinnt Leben und Bewegung.“
Hier unterbrach sich die begeisterte Sprecherin, indem sie stehen blieb, das Medaillon aus dem Busen hervorzog und fortfuhr: Sieh doch selbst; schau her! Erblickst Du sie?
In Prevost's Mienen spielte anfangs lächelnder Spott; doch bald verrieten sie sein wachsendes Erstaunen. In der Tat erkannte er innerhalb des weißen Kranzes der Alpenrosenblüten, wie einen Schattenriß, einen weiblichen Kopf gebildet. Der Umriß, vom Zickzack der Rhododendronblättchen gezeichnet, glich einigermaßen dem Profil seiner verstorbenen Mutter.
„Seltsam! ziemlich ähnlich,“ rief er, „aber“, fügte er, schalkhaft mit den Fingern drohend, hinzu: „Sabine! Sabine! Du bist vermählt und trägst dies noch? Hast du der Mutter Wort vergessen, als sie uns das Andenken gab? Weißt du, wie sie sagte: ich empfing es am Vorabend meiner Hochzeit von Seiner Hochwürden Gnaden in Disentis. Eines der Medaillons, sprach er, bewahre zu meinem Gedächtnis, das andere gib dem, dem du mit deiner Liebe dein ganzes Leben gibst. So gab ich's Eurem Vater. So gebe ich's euch wieder und zu gleicher Bestimmung. – Wie, Sabine, und Du trägst es noch? Gabst es dem Baron nicht?“
Frau von Schauenstein schlug etwas verlegen die Augen nieder und sagte: „Er verlangte nur mein Leben, nur meine Liebe, nicht das Medaillon. Er wußte, es war mir wegen des Mutterbildes, wie dir das deine, über alles teuer. Zeigt es auch dir in der Blütenumfassung das Bild? Ich glaube, Du hast noch nicht einmal darauf geachtet. Trägst Du es noch auf der Brust? Zeige mir's.“
„Ich habe es eben nicht bei mir,“ versetzte er und unwillkürlich verfinsterte sich dabei sein Gesicht.
Die Schwester bemerkte es, und fragte, indem sie ihn forschend beobachtete: „Hast du es im Zimmer zurückgelassen? Komme, ich will es sehen und vergleichen.“
„Auch da nicht, Sabine.“
„Auch da nicht?“ wiederholte sie; blieb stehen, betrachtete ihn mit Verwunderung und Neugierde, sah ihn sich errötend abwenden, und lachte ihn laut an, indem sie rief: „Allerliebst! Also Kränzchen und Herzchen davon geflogen? Gehe, du Unartiger, mir, die dich so lieb hat, das zu verheimlichen. Augenblicklich bekenne, oder ich werde dir zeitlebens gram. Wo hast du die holde Auserwählte auf deinen Kreuz- und Querzügen in Europa gefunden? Rede doch, gewiß eine schöne Engländerin, oder gar, – habe ich's erraten? – eine niedliche Wienerin?“
Ernst, fast unwillig, nahm er die Hand der Schwester und sagte: „Komme doch; wir sind schon an den ersten Häusern von St. Moritz. Es geziemt sich nicht, auf freier Landstraße oder am Markt kund zu tun, was man sich selbst gern verheimlichen möchte.“
Schweigend gingen sie neben einander ins Dorf; doch von Zeit zu Zeit blickte Sabine schelmisch zum Bruder auf, und drückte in stummer Zärtlichkeit seinen Arm an sich. – „Aber nicht wahr, Flavian,“ flüsterte sie, „wenn wir unter uns sind, erzählst du mir das Schicksal deiner Rose. Ich errate beinahe.“
„Hm! kaum der Mühe des Erratens wert,“ erwiderte er mit verächtlich aufgeworfener Lippe.
„Und du gibst dein Wort, mir alles zu erzählen?“ fragte sie begierig.
„Es wäre eine lange Geschichte. Ihrer zu schämen zwar habe ich mich nicht; aber gestatte mir die rechte Zeit und Laune, von Sachen zu reden, an die ich nur mit Widerwillen denken mag. Frage nicht weiter.“