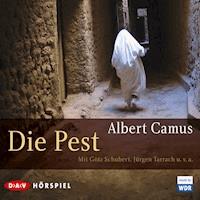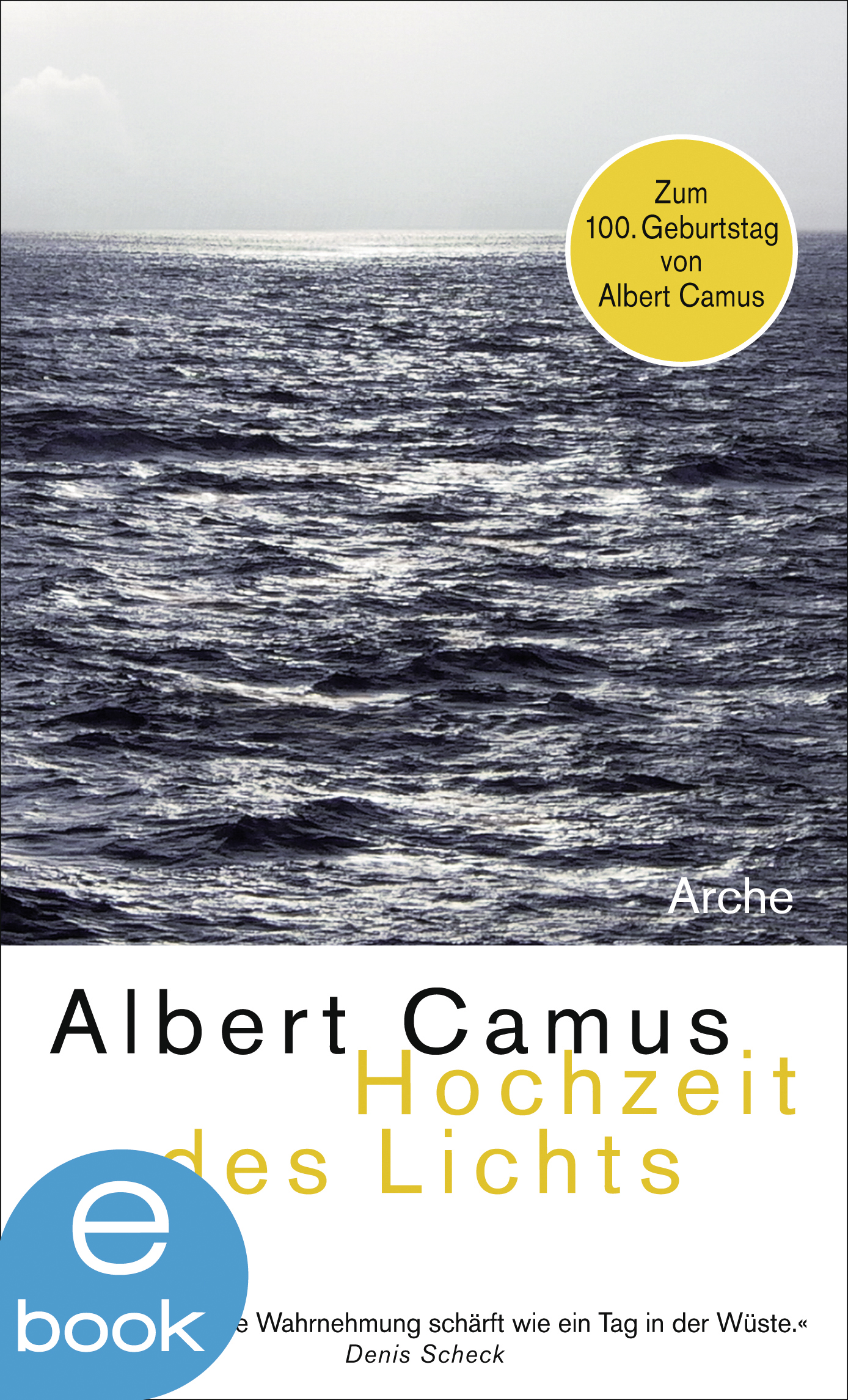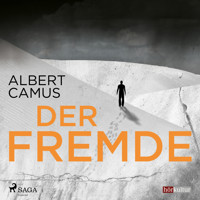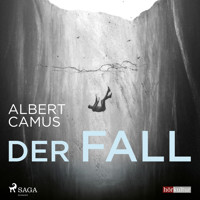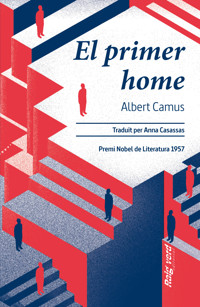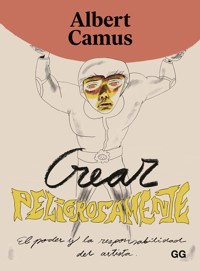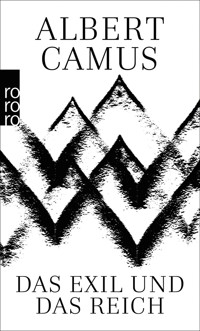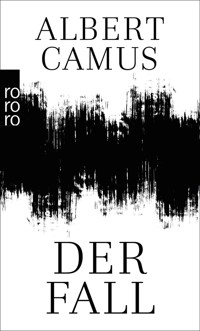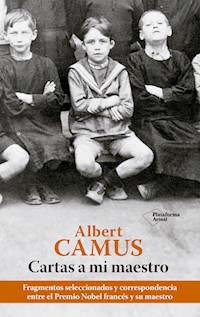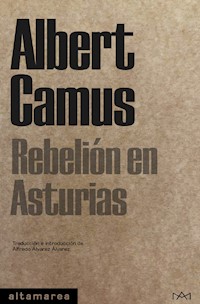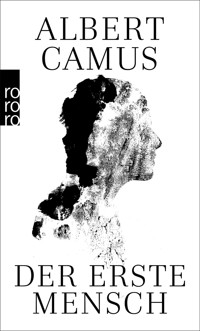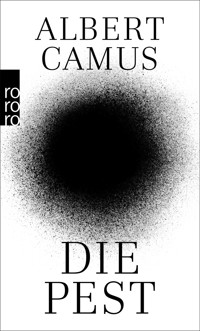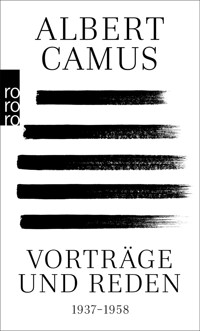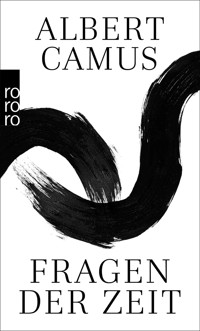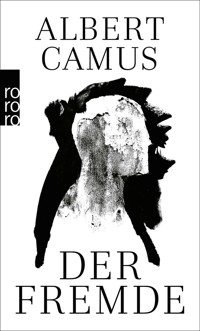
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Mir wurde klar, dass ich das Gleichgewicht des Tages zerstört hatte, die außergewöhnliche Stille eines Strandes, an dem ich glücklich gewesen war. Da habe ich noch viermal auf einen leblosen Körper geschossen, in den die Kugeln eindrangen, ohne dass man es ihm ansah. Und es war wie vier kurze Schläge, mit denen ich an das Tor des Unglücks hämmerte.» Die Geschichte eines jungen Franzosen in Algerien, den ein lächerlicher Zufall zum Mörder macht, wurde 1942 im besetzten Frankreich zu einer literarischen Sensation. Der Roman bedeutete den schriftstellerischen Durchbruch für Albert Camus und gilt heute als einer der Haupttexte des Existenzialismus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Albert Camus
Der Fremde
Roman
Übersetzt von Uli Aumüller
Über dieses Buch
«Mir wurde klar, dass ich das Gleichgewicht des Tages zerstört hatte, die außergewöhnliche Stille eines Strandes, an dem ich glücklich gewesen war. Da habe ich noch viermal auf einen leblosen Körper geschossen, in den die Kugeln eindrangen, ohne dass man es ihm ansah. Und es war wie vier kurze Schläge, mit denen ich an das Tor des Unglücks hämmerte.»
Die Geschichte eines jungen Franzosen in Algerien, den ein lächerlicher Zufall zum Mörder macht, wurde 1942 im besetzten Frankreich zu einer literarischen Sensation. Der Roman bedeutete den schriftstellerischen Durchbruch für Albert Camus und gilt heute als einer der Haupttexte des Existenzialismus.
Vita
Albert Camus, geboren am 7. November 1913 als Sohn einer Spanierin und eines Elsässers in Mondovi (Algerien), studierte von 1933 bis 1936 an der Universität Algier Philosophie. 1934 trat er der Kommunistischen Partei Algeriens bei, brach jedoch drei Jahre später mit der KP. 1940 zog er nach Paris, 1957 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Er starb am 4. Januar 1960 bei einem Autounfall.
Das Gesamtwerk von Albert Camus liegt im Rowohlt Verlag vor.
Weitere Veröffentlichungen:
Der Fall
Die Pest
Jonas oder Der Künstler bei der Arbeit
Der Mythos des Sisyphos
Der Mensch in der Revolte
Der glückliche Tod
Tagebücher 1935–1951
Tagebücher 1951–1959
Reisetagebücher
Unter dem Zeichen der Freiheit
Verteidigung der Freiheit
Der erste Mensch
Erster Teil
I
Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern, ich weiß nicht. Ich habe ein Telegramm vom Heim bekommen: «Mutter verstorben. Beisetzung morgen. Hochachtungsvoll.» Das will nichts heißen. Es war vielleicht gestern.
Das Altersheim ist in Marengo, achtzig Kilometer von Algier entfernt. Ich werde den Bus um zwei nehmen und nachmittags ankommen. Auf die Weise kann ich Totenwache halten und bin morgen Abend wieder zurück. Ich habe meinen Chef um zwei Tage Urlaub gebeten, und bei so einem Entschuldigungsgrund konnte er sie mir nicht abschlagen. Aber er sah nicht erfreut aus. Ich habe sogar gesagt: «Es ist nicht meine Schuld.» Er hat nicht geantwortet. Da habe ich gedacht, dass ich das nicht hätte sagen sollen. Ich brauchte mich ja nicht zu entschuldigen. Vielmehr hätte er mir sein Beileid aussprechen müssen. Aber das wird er wahrscheinlich übermorgen tun, wenn er mich in Trauer sieht. Vorläufig ist es ein bisschen so, als wäre Mama gar nicht tot. Nach der Beerdigung allerdings wird es eine abgeschlossene Sache sein, und alles wird einen offizielleren Anstrich bekommen haben.
Ich habe den Bus um zwei genommen. Es war sehr heiß. Ich habe im Restaurant von Céleste gegessen, wie gewöhnlich. Sie hatten alle viel Mitgefühl mit mir, und Céleste hat gesagt: «Man hat nur eine Mutter.» Als ich gegangen bin, haben sie mich zur Tür begleitet. Ich war etwas abgelenkt, weil ich noch zu Emmanuel hinaufmusste, um mir einen schwarzen Schlips und eine Trauerbinde von ihm zu borgen. Er hat vor ein paar Monaten seinen Onkel verloren.
Ich bin gelaufen, um den Bus nicht zu verpassen. Diese Hetze, dieses Laufen – wahrscheinlich war es all das, zusammen mit dem Gerüttel, dem Benzingeruch, der Spiegelung der Straße und des Himmels, weswegen ich eingenickt bin. Ich habe fast während der ganzen Fahrt geschlafen. Und als ich aufgewacht bin, war ich gegen einen Soldaten gerutscht, der mich angelächelt hat und gefragt hat, ob ich von weit her käme. Ich habe «ja» gesagt, um nicht weiterreden zu müssen.
Das Heim ist zwei Kilometer vom Dorf entfernt. Ich bin zu Fuß hingegangen. Ich wollte sofort zu Mama. Aber der Pförtner hat gesagt, ich müsste erst den Heimleiter sprechen. Da der beschäftigt war, habe ich ein wenig gewartet. Während dieser ganzen Zeit hat der Pförtner geredet, und dann habe ich den Heimleiter zu Gesicht bekommen: Er hat mich in seinem Büro empfangen. Es war ein kleiner Alter, mit einem Orden der Ehrenlegion. Er hat mich mit seinen hellen Augen angesehen. Dann hat er mir die Hand gedrückt und sie so lange festgehalten, dass ich nicht recht wusste, wie ich sie zurückziehen sollte. Er hat in einer Akte nachgelesen und hat gesagt: «Madame Meursault ist vor drei Jahren hierhergekommen. Sie waren ihr einziger Beistand.» Ich habe geglaubt, er wollte mir etwas vorwerfen, und habe angefangen, es ihm zu erklären. Aber er hat mich unterbrochen: «Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen, mein liebes Kind. Ich habe die Akte Ihrer Mutter gelesen. Sie konnten sie nicht versorgen. Sie brauchte Pflege. Ihre Einkünfte sind bescheiden. Und alles in allem war sie hier glücklicher.» Ich habe gesagt: «Ja, Monsieur le Directeur.» Er hat hinzugefügt: «Wissen Sie, sie hatte Freunde, Leute in ihrem Alter. Sie hatten gemeinsame Interessen, die aus einer anderen Zeit stammen. Sie sind jung, und mit Ihnen musste sie sich ja langweilen.»
Das stimmte. Als Mama noch zu Hause war, verbrachte sie ihre Zeit damit, mir schweigend mit dem Blick zu folgen. In den ersten Tagen im Heim weinte sie oft. Aber das war wegen der Umstellung. Nach ein paar Monaten hätte sie geweint, wenn man sie wieder aus dem Heim herausgeholt hätte. Wieder wegen der Umstellung. Das war ein wenig der Grund, weshalb ich im vergangenen Jahr fast nicht mehr hingefahren bin. Und auch, weil es mich um meinen Sonntag brachte – ganz abgesehen von der Mühe, zum Bus zu gehen, Fahrkarten zu lösen und zwei Stunden zu fahren.
Der Heimleiter hat noch weitergeredet. Aber ich hörte ihm kaum noch zu. Dann hat er gesagt: «Ich nehme an, Sie wollen Ihre Mutter sehen.» Ich bin aufgestanden, ohne etwas zu sagen, und er ist mir zur Tür vorausgegangen. Auf der Treppe hat er mir erklärt: «Wir haben sie in unsere kleine Leichenhalle gebracht. Um die anderen nicht aufzuregen. Jedes Mal, wenn ein Heimbewohner stirbt, sind die anderen zwei oder drei Tage nervös. Und das erschwert die Arbeit.» Wir sind über einen Hof gegangen, auf dem viele alte Leute waren, die in kleinen Gruppen miteinander plauderten. Sie verstummten, als wir vorbeigingen. Und hinter uns setzten die Unterhaltungen wieder ein. Wie das gedämpfte Schnattern von Sittichen. An der Tür eines kleinen Gebäudes hat der Leiter sich verabschiedet. «Ich gehe jetzt, Monsieur Meursault. Ich stehe Ihnen in meinem Büro zur Verfügung. Im Prinzip ist die Beerdigung für zehn Uhr morgens angesetzt. Wir haben gedacht, dass Sie so Totenwache bei der Verstorbenen halten können. Noch eins: Ihre Mutter hat, wie es scheint, ihren Mitbewohnern gegenüber oft den Wunsch geäußert, kirchlich beerdigt zu werden. Ich habe es übernommen, das Nötige zu veranlassen. Aber ich wollte Sie davon in Kenntnis setzen.» Ich habe ihm gedankt. Mama hatte, ohne dass sie Atheistin war, zu ihren Lebzeiten nie an die Kirche gedacht.
Ich bin hineingegangen. Es war ein sehr heller Raum, weiß gekalkt und mit einem Glasdach. Er war mit Stühlen und x-förmigen Gestellen ausstaffiert. Zwei davon, in der Mitte, trugen einen Sarg, auf dem der Deckel lag. Man sah nur glänzende, kaum angezogene Schrauben sich von den nussbraun gebeizten Brettern abheben. Neben dem Sarg saß eine arabische Krankenpflegerin im weißen Kittel und mit einem grellen Tuch um den Kopf.
In dem Moment ist der Pförtner hinter meinem Rücken hereingekommen. Er war wohl gelaufen. Er hat ein bisschen herumgestottert: «Man hat sie zugemacht, aber ich muss den Sarg nur aufschrauben, damit Sie sie sehen können.» Er näherte sich schon dem Sarg, als ich ihn zurückgehalten habe. Er hat gesagt: «Wollen Sie nicht?» Ich habe «nein» geantwortet. Er hat innegehalten, und ich war verlegen, weil ich merkte, dass ich das nicht hätte sagen sollen. Nach einer Weile hat er mich angesehen und hat gefragt: «Warum nicht?», aber ohne Vorwurf, so als wollte er sich informieren. Ich habe gesagt: «Ich weiß nicht.» Da hat er seinen weißen Schnurrbart gezwirbelt und hat, ohne mich anzusehen, erklärt: «Ich verstehe.» Er hatte schöne Augen, hellblau, und eine etwas rote Gesichtsfarbe. Er hat mir einen Stuhl gegeben und hat sich selbst etwas hinter mir hingesetzt. Die Pflegerin ist aufgestanden und zum Ausgang gegangen. Im gleichen Moment hat der Pförtner zu mir gesagt: «Das ist ein Schanker, was sie da hat.» Weil ich nicht verstand, habe ich die Krankenschwester angeschaut und habe gesehen, dass sie unter den Augen eine Binde trug, die um den ganzen Kopf ging. In Höhe der Nase war die Binde platt. Man sah nur das Weiß der Binde in ihrem Gesicht.
Als sie weg war, hat der Pförtner gesagt: «Ich lasse Sie jetzt allein.» Ich weiß nicht, was für eine Geste ich gemacht habe, aber er ist hinter mir stehen geblieben. Diese Anwesenheit hinter meinem Rücken störte mich. Der Raum war von einem schönen Spätnachmittagslicht erfüllt. Zwei Hornissen brummten gegen das Glasdach. Und ich fühlte, wie mich Müdigkeit überkam. Ich habe, ohne mich umzudrehen, zum Pförtner gesagt: «Sind Sie schon lange hier?» Prompt hat er geantwortet: «Fünf Jahre», als hätte er schon immer auf meine Frage gewartet.
Danach hat er viel geschwatzt. Er hätte schön gestaunt, wenn man ihm gesagt hätte, dass er als Pförtner im Heim von Marengo enden würde. Er wäre vierundsechzig Jahre alt und käme aus Paris. Da habe ich ihn unterbrochen: «Ach, Sie sind nicht von hier?» Dann ist mir eingefallen, dass er von Mama geredet hatte, bevor er mich zum Heimleiter brachte. Er hatte gesagt, sie müsste sehr schnell beerdigt werden, weil es im Flachland heiß wäre, besonders in dieser Gegend. In dem Zusammenhang hatte er mir mitgeteilt, dass er in Paris gelebt hätte und es ihm schwerfiele, es zu vergessen. In Paris bliebe man drei, manchmal vier Tage mit dem Toten zusammen. Hier hätte man nicht die Zeit dazu, man hätte sich noch nicht an den Gedanken gewöhnt, und schon müsste man hinter dem Leichenwagen herlaufen. Da hatte seine Frau zu ihm gesagt: «Sei still, solche Sachen darfst du dem Herrn nicht erzählen.» Der Alte war rot geworden und hatte sich entschuldigt. Ich hatte mich eingemischt und gesagt: «Ach wo. Ach wo.» Ich fand das, was er erzählte, richtig und interessant.
In der kleinen Leichenhalle hat er mir erzählt, dass er als Mittelloser in das Heim gekommen wäre. Da er sich kräftig fühlte, hätte er sich um diese Stelle als Pförtner beworben. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass er genau genommen ein Heimbewohner wäre. Er hat es verneint. Mir war schon seine Art aufgefallen, «sie», «die anderen» und, seltener, «die Alten» zu sagen, wenn er von den Heimbewohnern sprach, von denen manche nicht älter waren als er. Aber das war natürlich etwas anderes. Er war Pförtner und war ihnen bis zu einem gewissen Grad übergeordnet.
In dem Moment ist die Pflegerin eingetreten. Der Abend war jäh hereingebrochen. Sehr schnell war die Dunkelheit über dem Glasdach undurchdringlich geworden. Der Pförtner hat den Schalter gedreht, und ich war vom plötzlichen Aufspritzen des Lichts geblendet. Er hat mich eingeladen, zum Abendessen in den Speisesaal zu gehen. Aber ich hatte keinen Hunger. Er hat daraufhin angeboten, mir eine Tasse Milchkaffee zu bringen. Da ich Milchkaffee sehr gern mag, habe ich angenommen, und er ist nach einer Weile mit einem Tablett zurückgekommen. Ich habe getrunken. Dann habe ich Lust bekommen zu rauchen. Aber ich habe gezögert, weil ich nicht wusste, ob ich es vor Mama tun könnte. Ich habe nachgedacht, das machte gar nichts. Ich habe dem Pförtner eine Zigarette angeboten, und wir haben geraucht.
Irgendwann hat er gesagt: «Übrigens, die Freunde Ihrer Frau Mutter kommen auch gleich zur Totenwache. Das ist so üblich. Ich muss Stühle und schwarzen Kaffee holen.» Ich habe ihn gefragt, ob man eine der Lampen ausmachen könnte. Das Gleißen des Lichts auf den weißen Wänden ermüdete mich. Er hat gesagt, das ginge nicht. Die Anlage wäre nun einmal so: entweder alles oder nichts. Ich habe ihn nicht mehr besonders beachtet. Er ist hinausgegangen, ist wiedergekommen, hat Stühle aufgestellt. Auf einen hat er Tassen rings um eine Kaffeekanne gestapelt. Dann hat er sich mir gegenübergesetzt, auf die andere Seite von Mama. Die Pflegerin saß auch hinten, mit dem Rücken zu mir. Ich konnte nicht sehen, was sie machte. Aber der Bewegung ihrer Arme nach konnte ich vermuten, dass sie strickte. Es war mild, der Kaffee hatte mich aufgewärmt, und durch die offene Tür drang ein Duft von Nacht und von Blumen. Ich glaube, ich habe ein bisschen gedöst.
Ein Rascheln hat mich geweckt. Weil ich die Augen geschlossen hatte, ist mir das Weiß des Raums noch greller erschienen. Vor mir war nicht ein Schatten, und jeder Gegenstand, jede Kante, alle Krümmungen zeichneten sich mit einer Klarheit ab, die den Augen wehtat. In diesem Moment sind Mamas Freunde hereingekommen. Es waren insgesamt etwa zehn, und sie huschten lautlos in dieses blendende Licht. Sie haben sich gesetzt, ohne dass ein einziger Stuhl knarrte. Ich sah sie, wie ich nie jemanden gesehen habe, und keine Einzelheit in ihren Gesichtern oder an ihrer Kleidung entging mir. Dabei hörte ich sie nicht und hatte Mühe, an ihre Realität zu glauben. Fast alle Frauen trugen eine Schürze, und das Band, das ihre Taille schnürte, ließ ihren gewölbten Bauch noch mehr hervortreten. Ich hatte noch nie bemerkt, was für einen Bauch alte Frauen haben können. Die Männer waren fast alle sehr dünn und hielten Spazierstöcke in der Hand. Was mir an ihren Gesichtern auffiel, war, dass ich ihre Augen nicht sah, sondern nur einen glanzlosen Schimmer mitten in einem Faltennest. Als sie sich setzten, haben die meisten mich angesehen und verlegen mit dem Kopf genickt, die Lippen ganz von ihrem zahnlosen Mund verschluckt, ohne dass ich erkennen konnte, ob sie mich grüßten oder ob es sich um einen Tic handelte. Ich glaube eher, sie grüßten mich. In dem Moment habe ich bemerkt, dass sie mir alle gegenübersaßen, um den Pförtner herum, und mit dem Kopf wackelten. Ich habe einen Moment lang den lächerlichen Eindruck gehabt, sie wären da, um über mich zu richten.
Kurz darauf hat eine der Frauen angefangen zu weinen. Sie saß in der zweiten Reihe, von einer ihrer Mitbewohnerinnen verdeckt, und ich konnte sie schlecht sehen. Sie weinte stetig, in kurzen Schluchzern: Mir schien, sie würde nie aufhören. Die anderen sahen aus, als hörten sie sie nicht. Sie saßen zusammengesackt, trübsinnig und schweigend da. Sie sahen den Sarg an oder ihren Stock oder irgendetwas, aber sie sahen nur das an. Die Frau weinte immer noch. Ich war sehr verwundert, weil ich sie nicht kannte. Ich hätte gewünscht, sie nicht mehr zu hören. Ich wagte jedoch nicht, es ihr zu sagen. Der Pförtner hat sich zu ihr hingebeugt, hat mit ihr gesprochen, aber sie hat den Kopf geschüttelt, hat etwas gestammelt und mit derselben Stetigkeit weitergeweint. Der Pförtner ist dann auf meine Seite herübergekommen. Er hat sich neben mich gesetzt. Nach einer ganzen Weile hat er mir, ohne mich anzusehen, erklärt: «Sie war sehr eng mit Ihrer Frau Mutter befreundet. Sie sagt, es wäre ihre einzige Freundin hier gewesen, und jetzt hätte sie niemand mehr.»
Wir sind eine ganze Weile so sitzen geblieben. Die Seufzer und Schluchzer der Frau wurden seltener. Sie schniefte viel. Sie ist endlich still geworden. Ich war nicht mehr müde, aber erschöpft, und das Kreuz tat mir weh. Jetzt war es das Schweigen all dieser Leute, das mich quälte. Nur hin und wieder hörte ich ein eigentümliches Geräusch und konnte nicht herausfinden, was es war. Mit der Zeit habe ich dann erraten, dass einige der alten Leute die Innenseite ihrer Wangen einsogen und dieses sonderbare Schnalzen von sich gaben. Sie waren so sehr in Gedanken versunken, dass sie es nicht merkten. Ich hatte sogar den Eindruck, dass diese in ihrer Mitte aufgebahrte Tote ihnen nichts bedeutete. Aber ich glaube jetzt, dass das ein falscher Eindruck war.
Wir haben alle den vom Pförtner ausgeschenkten Kaffee getrunken. Was dann war, weiß ich nicht mehr. Die Nacht verging. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann die Augen aufgemacht habe und gesehen habe, dass die alten Leute in sich zusammengesunken schliefen, bis auf einen, der mich, das Kinn auf dem Rücken seiner den Stock umklammernden Hände, starr ansah, als wartete er nur auf mein Erwachen. Dann habe ich wieder geschlafen. Ich bin aufgewacht, weil mein Kreuz immer mehr schmerzte. Über dem Glasdach wurde es hell. Kurz darauf ist einer der alten Männer aufgewacht und hat viel gehustet. Er spuckte in ein großes kariertes Taschentuch, und jedes Mal war es, als wenn er den Auswurf aus sich herausrisse. Er hat die anderen geweckt, und der Pförtner hat gesagt, sie müssten gehen. Sie sind aufgestanden. Von dieser unbequemen Totenwache hatten sie Aschegesichter. Beim Hinausgehen, und zu meinem großen Erstaunen, haben mir alle die Hand gedrückt – als hätte diese Nacht, in der wir kein Wort gewechselt hatten, unsere Verbundenheit vergrößert.
Ich war erschöpft. Der Pförtner hat mich mit in seine Wohnung genommen, und ich habe mich ein bisschen frischmachen können. Ich habe noch einen Milchkaffee getrunken, der sehr gut war. Als ich hinausgegangen bin, war es heller Tag. Über den Hügeln, die Marengo vom Meer trennen, war der Himmel voller Rottöne. Und der Wind, der darüberstrich, trug einen Salzgeruch hierher. Ein schöner Tag stand bevor. Es war lange her, dass ich auf dem Land gewesen war, und ich fühlte, welchen Spaß es mir gemacht hätte, spazieren zu gehen, wenn da nicht Mama gewesen wäre.
Aber ich habe im Hof unter einer Platane gewartet. Ich atmete den Geruch der kühlen Erde ein und war nicht mehr müde. Ich habe an die Kollegen im Büro gedacht. Um diese Zeit standen sie auf, um zur Arbeit zu gehen: Für mich war das immer der schwierigste Augenblick. Ich habe noch ein wenig über diese Dinge nachgedacht, aber ich bin von einer Glocke abgelenkt worden, die im Innern der Gebäude läutete. Es hat ein Hin und Her hinter den Fenstern gegeben, dann ist alles wieder ruhig geworden. Die Sonne war am Himmel etwas höhergestiegen: Sie begann meine Füße zu wärmen. Der Pförtner ist über den Hof gekommen und hat mir gesagt, der Heimleiter wollte mich sprechen. Ich bin in sein Büro gegangen. Er hat mich eine Reihe Schriftstücke unterschreiben lassen. Ich habe gesehen, dass er schwarz gekleidet war, mit einer gestreiften Hose. Er hat den Telefonhörer in die Hand genommen und hat mich dabei angesprochen: «Die Angestellten des Bestattungsinstituts sind eben gekommen. Ich werde sie herbitten, damit sie den Sarg schließen. Wollen Sie Ihre Mutter vorher ein letztes Mal sehen?» Ich habe nein gesagt. Er hat mit leiserer Stimme ins Telefon befohlen: «Figeac, sagen Sie den Männern, sie können hingehen.»