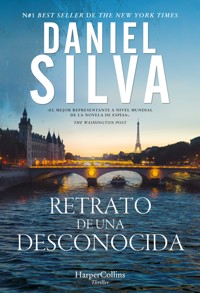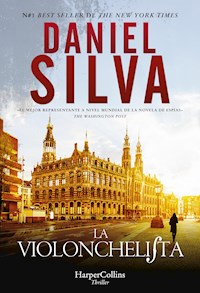11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gabriel Allon
- Sprache: Deutsch
Mord und Verrat im Vatikan – und Gabriel Allon mittendrin!
Der Papst ist tot! Gabriel Allon, legendärer Agent und inzwischen Direktor des israelischen Geheimdienstes, hält sich gerade in Venedig auf, als ihn die Nachricht erreicht. Kurze Zeit später kontaktiert ihn ein alter Freund, Luigi Donati, der Privatsekretär des verstorbenen Pontifex. Donati hegt Zweifel an der offiziellen Darstellung vom Herzinfarkt in der päpstlichen Privatkapelle. Grund dafür liefert der Umstand, dass der Schweizergardist, der in der Todesnacht Wache hielt, verschwunden ist – ebenso wie ein Brief unbekannten Inhalts, der vom Papst für Allon bestimmt war. Gabriel verspricht, seinem Freund zu helfen. Die Spuren führen ihn zu einem mysteriösen Orden von religiösen Hardlinern, der einen unheilvollen Bund mit Europas aufstrebender politischen Rechten eingegangen ist.
»Daniel Silva ist die Ausnahme von der Ausnahme: Ein Autor, dessen Bücher immer besser werden.«
The Huffington Post
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem TitelThe Order bei Harper, New York.
© by Daniel Silva Deutsche Erstausgabe © 2021 für die deutschsprachige Ausgabe by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Published by arrangement with Harper, an imprint of HarperCollins Publishers, New York
Covergestaltung von Bürosüd, München Coverabbildung von Buena Vista Images/Getty Images, www.buerosued.de unter Verwendung von: Shutterstock/kesipun
WIDMUNG
Wie immer für meine Frau Jamie
und meine Kinder Lily und Nicholas
ZITATE
Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Getümmel entstand, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: »Ich bin unschuldig an seinem Blut, sehet ihr zu!« Da antwortete das ganze Volk und sprach: »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!«
Matthäus27,24–25
Jedes Unglück, das die Juden später befiel – von der Zerstörung Jerusalems bis Auschwitz –, trug ein Echo dieses erfundenen Blutpakts aus dem Prozess in sich.
Ann Wroe, Pontius Pilatus
Man muss die Vergangenheit wissentlich ignorieren, um nicht zu erkennen, wohin dies alles führt.
Paul Krugman, New York Times
VATIKANSTADT
VORWORT
Seine Heiligkeit Papst Paul VII. trat erstmals in Die Loge auf, dem dritten Band der Gabriel-Allon-Reihe. Weitere Auftritte hatte er in Das Terrornetz und Das Attentat. Der als Pietro Lucchesi geborene ehemalige Patriarch von Venedig ist der direkte Nachfolger von Papst Johannes Paul II. In meiner fiktiven Version des Vatikans hat es die Pontifikate von Joseph Ratzinger und Jorge Mario Bergoglio, der Päpste Benedikt XVI. und Franziskus, nicht gegeben.
TEILEINS
SEDISVAKANZ
1
ROM
Der Anruf kam um 23.41 Uhr. Luigi Donati zögerte, bevor er sich meldete. Die Rufnummer, die auf seinem Telefonino angezeigt wurde, gehörte Albanese. Es gab nur einen Grund, weshalb er zu so später Stunde anrufen würde.
»Wo sind Sie, Exzellenz?«
»Außerhalb der Mauern.«
»Ah, richtig. Heute ist Donnerstag, nicht wahr?«
»Gibt es ein Problem?«
»Ich will am Telefon lieber nicht zu viel sagen. Man weiß nie, wer mithört.«
Die Nacht, in die Donati hinaustrat, war feucht und kalt. Er trug einen schwarzen Anzug mit Priesterkragen, nicht die Soutane mit violettem Besatz und Schulterkragen, die er im Amt trug, wie Geistliche seines Ranges den Apostolischen Palast nannten. Als Erzbischof diente Donati Seiner Heiligkeit Papst Paul VII. als Privatsekretär. Er war hochgewachsen und schlank, mit vollem dunklen Haar und den Zügen eines Filmstars, und hatte vor Kurzem seinen dreiundsechzigsten Geburtstag gefeiert. Auch im Alter sah er weiterhin blendend aus. Die Zeitschrift VanityFair hatte ihn vor Kurzem als »leckeren Luigi« bezeichnet. In der stets zum Lästern bereiten Welt der Kurie hatte dieser Artikel ihn in große Verlegenheit gestürzt. Weil Donati jedoch zu Recht als rücksichtslos bekannt war, hatte sich niemand getraut, ihn darauf anzusprechen. Mit Ausnahme des Heiligen Vaters, der ihn unbarmherzig aufgezogen hatte.
Ich will am Telefon lieber nicht zu viel sagen.
Donati hatte sich seit einem Jahr oder noch länger auf diesen Augenblick vorbereitet – seit dem ersten leichten Herzanfall des Papstes, den er vor dem Rest der Welt und sogar großen Teilen der Kurie geheim gehalten hatte. Aber wieso ausgerechnet heute Nacht?
Auf der Straße war es eigenartig still. Totenstill, dachte Donati plötzlich. Sie war eine von Palazzi gesäumte Seitenstraße der Via Veneto, in der Geistliche selten unterwegs waren – vor allem kein Priester aus der Gesellschaft Jesu, des intellektuell rigorosen und manchmal rebellischen Ordens, dem Donati angehörte. Sein vatikanischer Dienstwagen mit dem SCV-Kennzeichen wartete am Randstein. Der Fahrer kam aus dem Corpo della Gendarmeria, der hundertdreißig Mann starken Polizei des Vatikans. Er fuhr durch Rom nach Westen, ohne sich sonderlich zu beeilen.
Er weiß nichts …
Mit seinem Smartphone rief Donato die Webseiten der führenden italienischen Zeitungen auf. Sie wussten von nichts. Auch ihre Kollegen in London und New York schienen ahnungslos zu sein.
»Schalten Sie das Radio ein, Gianni.«
»Musik, Exzellenz?«
»Nachrichten, bitte.«
Wieder Gefasel von Saviano, der ständig geiferte, arabische und afrikanische Immigranten zerstörten das Land, als seien die Italiener nicht sehr gut imstande, es selbst zugrunde zu richten. Saviano bedrängte den Vatikan seit Monaten wegen einer Privataudienz beim Heiligen Vater. Donati, dem das nicht wenig Vergnügen bereitete, hatte sie ihm jedoch stets abgeschlagen.
»Danke, das reicht, Gianni.«
Das Radio verstummte barmherzigerweise. Donati spähte aus dem Seitenfenster seiner deutschen Luxuslimousine. So sollte ein Soldat Christi sich nicht fortbewegen. Dies war vermutlich seine letzte Fahrt durch Rom in einer Limousine mit Chauffeur. Fast zwei Jahrzehnte lang hatte er als eine Art Stabschef der römisch-katholischen Kirche gedient. Das waren unruhige Jahre gewesen – der Terroranschlag auf den Petersdom, der Skandal wegen Antiquitäten aus den Vatikanischen Museen, die Geißel sexueller Verfehlungen von Priestern –, aber Donati hatte jede Minute seiner Amtszeit genossen. Nun war mit einem Wimpernschlag alles vorbei. Er war wieder ein gewöhnlicher Priester. Er hatte sich nie einsamer gefühlt.
Die Limousine fuhr über den Tiber und bog auf die Via della Conciliazione ab, den breiten Boulevard, den Mussolini durch die Slums von Rom hatte schlagen lassen. In der Ferne ragte die zu altem Glanz restaurierte Kuppel der Basilika im Scheinwerferlicht auf. Sie folgten der Kurve von Berninis Kolonnaden zum St.-Anna-Tor, wo ein Schweizergardist sie aufs Gebiet des Stadtstaats durchwinkte. Der Mann trug seine Nachtuniform: ein taschenloses blaues Wams mit weißem Umlegekragen und bauschigen Oberärmeln, dazu ein nachtblaues Barett, einen schmalen braunen Gürtel, blaue Kniestrümpfe und schwarze, über die Knöchel reichende Schnürschuhe. Seine Augen waren trocken, seine Miene unbesorgt.
Er weiß nichts.
Der Wagen fuhr langsam die Via Sant’Anna entlang – vorbei an der Kaserne der Schweizergarde, der Kirche Sant’Anna dei Palafrenieri, der Vatikandruckerei und der Vatikanbank –, bevor er an dem Torbogen hielt, der zum Damasus-Hof führte. Donati überquerte den gepflasterten Innenhof zu Fuß, betrat den wichtigsten Aufzug der Christenheit und fuhr in den zweiten Stock des Apostolischen Palasts hinauf. Er hastete die Loggia zwischen einer Glaswand und einem Fresko entlang und bog einmal links ab, um die päpstlichen Gemächer zu erreichen.
Ein weiterer Schweizergardist, dieser in bunter Galauniform, hielt stocksteif neben der Tür Wache. Donati ging wortlos an ihm vorbei. Donnerstag, dachte er. Wieso musste es ein Donnerstag sein?
Achtzehn Jahre, sagte Donati sich, als er sich im Arbeitszimmer des Heiligen Vaters umsah, und nichts hat sich verändert. Nur das Telefon. Er hatte es endlich geschafft, den Heiligen Vater dazu zu überreden, Wojtylas Uralttelefon mit Wählscheibe durch ein modernes Tastentelefon zu ersetzen. Ansonsten war der Raum genau so, wie der Pole ihn verlassen hatte. Derselbe schlichte Schreibtisch aus Holz. Derselbe beige Sessel. Derselbe abgetretene Orientteppich. Dieselbe goldene Uhr, dasselbe Kruzifix. Sogar die Schreibgarnitur hatte Wojtyla dem Großen gehört. Trotz seiner verheißungsvoll begonnenen Amtszeit – mit dem Versprechen einer barmherzigeren, weniger repressiven Kirche – war es Pietro Lucchesi nicht vollends gelungen, aus dem langen Schatten seines Vorgängers zu treten.
Aus einem Instinkt heraus warf Donati einen Blick auf seine Armbanduhr. Es war sieben Minuten nach Mitternacht. An diesem Abend hatte der Heilige Vater sich um 20.30 Uhr in sein Arbeitszimmer zurückgezogen, um eineinhalb Stunden lang zu lesen und zu schreiben. Normalerweise blieb Donati an der Seite seines Herrn oder in seinem Büro auf demselben Korridor. Aber weil dies ein Donnerstag war – der einzige Abend der Woche, der ihm gehörte –, war er nur bis 21 Uhr geblieben.
Tun Sie mir einen Gefallen, bevor Sie gehen, Luigi …
Lucchesi hatte ihn gebeten, die schweren Vorhänge am Fenster seines Arbeitszimmers aufzuziehen. Dies war das Fenster, an dem Seine Heiligkeit an jedem Sonntagmittag den Angelus betete. Donati hatte den Wunsch seines Herrn erfüllt. Er hatte sogar die Fensterläden geöffnet, damit der Heilige Vater auf den Petersplatz hinabblicken konnte, während er Akten bearbeitete. Jetzt waren die Vorhänge fest geschlossen. Donati zog sie auf. Auch die Fensterläden waren geschlossen.
Der Schreibtisch war aufgeräumt, was sonst nicht Lucchesis Art war. Donati sah eine halb ausgetrunkene Tasse Tee mit einem Löffel auf der Untertasse, die bei seinem Weggehen nicht dagestanden hatte. Unter der altmodischen Schreibtischlampe waren mehrere Mappen mit Schriftstücken ordentlich gestapelt. Ein Bericht der Erzdiözese Philadelphia über die finanziellen Folgen des Missbrauchsskandals. Anmerkungen für die nächste Generalaudienz am Mittwoch. Der erste Entwurf einer Predigt während der bevorstehenden Brasilienreise. Notizen für eine Enzyklika zur Immigration, die Saviano und seine Mitläufer von der äußersten italienischen Rechten erzürnen würde.
Etwas fehlte jedoch.
Sie sorgen dafür, dass er ihn bekommt, nicht wahr, Luigi?
Donati sah in den Papierkorb. Der Korb war leer. Nicht das kleinste Stückchen Papier.
»Suchen Sie etwas, Exzellenz?«
Donati blickte auf und sah Kardinal Domenico Albanese, der ihn von der Tür aus beobachtete. Albanese war Kalabrier von Geburt und beruflich ein Geschöpf der Kurie. Er hatte am Heiligen Stuhl mehrere wichtige Positionen bekleidet, darunter die des Präsidenten des Päpstlichen Rats für den Interreligiösen Dialog und Archivar und Bibliothekar der Heiligen Römischen Kirche. Nichts davon rechtfertigte jedoch seine Anwesenheit in den päpstlichen Gemächern kurz nach Mitternacht. Domenico Albanese war der Camerlengo, der Kardinalkämmerer. Als solcher war er dafür verantwortlich, offiziell zu erklären, der Stuhl Petri sei vakant.
»Wo ist er?«, fragte Donati.
»Im himmlischen Königreich«, antwortete der Kardinal.
»Und der Leichnam?«
Wäre der stämmige Albanese nicht dem Ruf der Kirche gefolgt, hätte er Marmor abbauen oder in einem kalabrischen Schlachthof arbeiten können. Donati folgte ihm über den kurzen Gang ins Schlafzimmer, in dessen Halbdunkel drei weitere Kardinäle warteten: Marcel Gaubert, José Maria Navarro und Angelo Francona. Als Kardinalstaatssekretär war Gaubert der Ministerpräsident und Chefdiplomat des kleinsten Staats der Welt. Navarro war Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, deren Aufgabe es war, die Glaubens- und Sittenlehre in der ganzen katholischen Kirche zu fördern und vor Häresien zu schützen. Francona, der älteste der drei, würde als Kardinaldekan – Vorsitzender des Kardinalskollegiums – das nächste Konklave leiten.
Es war Navarro, ein Spanier aus adliger Familie, der Donati als Erster ansprach. Obwohl er seit einem Vierteljahrhundert in Rom lebte und arbeitete, sprach er Italienisch noch immer mit starkem Akzent. »Luigi, ich weiß, wie schmerzlich dies für Sie sein muss. Wir waren alle seine treuen Diener, aber Sie hat er am meisten geliebt.«
Kardinal Gaubert, ein hagerer Pariser mit Fuchsgesicht, bekräftigte diese Beruhigungspille des Spaniers nachdrücklich nickend. Das taten auch die drei Laien, die sich bescheiden im Hintergrund hielten: Dr. Octavio Gallo, der Leibarzt des Heiligen Vaters. Lorenzo Vitale, Chef des Corpo della Gendarmeria, und Oberst Alois Metzler, Kommandeur der Päpstlichen Schweizergarde. Donati schien als Letzter eingetroffen zu sein. Dabei hätte er als Privatsekretär die wichtigsten Kirchenfürsten ans Totenbett des Papstes rufen sollen. Nicht der Camerlengo. Er empfand plötzlich Gewissensbisse.
Als Donati auf die auf dem Bett liegende Gestalt hinabsah, wichen seine Schuldgefühle überwältigender Trauer – Lucchesi trug weiter seine weiße Soutane, obwohl man ihm die Slipper ausgezogen hatte und sein Scheitelkäppchen nirgends zu sehen war. Irgendjemand hatte ihm die Hände auf die Brust gelegt. Sie umklammerten seinen Rosenkranz. Seine Augen waren geschlossen, aber sein Gesichtsausdruck war friedlich, als habe er nicht leiden müssen. Tatsächlich wäre Donati nicht erstaunt gewesen, wenn Seine Heiligkeit plötzlich erwacht wäre und sich erkundigt hätte, wie er den Abend verbracht hatte.
Er trägt weiter seine weiße Soutane …
Donati hatte den Tagesplan des Heiligen Vaters vom ersten Tag an geführt. Von der abendlichen Routine wurde nur selten abgewichen. Das Abendessen fand von 19 bis 20.30 Uhr statt. Danach saß der Papst bis 22 Uhr in seinem Arbeitszimmer, bevor er sich für eine Viertelstunde zum Gebet in seine Privatkapelle zurückzog. Typischerweise war er gegen 22.30 Uhr im Bett, meistens mit einem der englischen Kriminalromane, die sein unschuldiges Vergnügen waren. Devices and Desires von P.D. James lag neben seiner Lesebrille auf dem Nachttisch. Donati schlug die angemerkte Stelle auf.
Eine Dreiviertelstunde später traf Rickards wieder am Tatort des Mordes ein …
Donati klappte den Roman zu. Seiner Schätzung nach war der Pontifex Maximus seit zwei Stunden tot, vielleicht schon länger. Ruhig fragte er: »Wer hat ihn aufgefunden? Keine der Haushaltsnonnen, hoffe ich.«
»Das war ich«, antwortete Kardinal Albanese.
»Wo war er?«
»Seine Heiligkeit hat unsere Welt in der Kapelle verlassen. Ich habe ihn dort kurz nach 22 Uhr aufgefunden. Was den Todeszeitpunkt betrifft …« Der Kardinal zuckte mit seinen breiten Schultern. »Dazu kann ich nichts sagen, Exzellenz.«
»Wieso bin ich nicht sofort benachrichtigt worden?«
»Ich habe Sie überall gesucht.«
»Sie hätten mich auf dem Handy anrufen sollen.«
»Das habe ich getan. Sogar mehrmals. Leider hat sich niemand gemeldet.«
Der Camerlengo sagte nicht die Wahrheit, vermutete Donati. »Und was hat Sie in die Kapelle geführt, Eminenz?«
»Dies beginnt an ein Verhör zu erinnern.« Albanese sah kurz zu Kardinal Navarro hinüber, bevor er sich wieder Donati zuwandte. »Seine Heiligkeit hat mich eingeladen, mit ihm zu beten. Ich habe seine Einladung angenommen.«
»Er hat Sie selbst angerufen?«
»In meiner Wohnung«, sagte der Camerlengo nickend.
»Um wie viel Uhr?«
Albanese sah theatralisch zur Decke auf, als habe er Mühe, sich an ein so triviales Detail zu erinnern. »Viertel nach neun. Vielleicht auch zwanzig nach. Er hat mich gebeten, kurz nach zehn Uhr zu kommen. Bei meinem Eintreffen …«
Donati betrachtete wieder den leblos auf seinem Bett Liegenden. »Und wie ist er hergekommen?«
»Ich habe ihn getragen.«
»Allein?«
»Seine Heiligkeit hat die Last der Kirche auf seinen Schultern getragen«, sagte Albanese, »aber im Tod war er leicht wie eine Feder. Als ich Sie nicht erreichen konnte, habe ich den Staatssekretär angerufen, der seinerseits die Kardinäle Navarro und Francona verständigt hat. Dann habe ich Dottore Gallo gerufen, der den Tod des Heiligen Vaters festgestellt hat. Tod durch Herzinfarkt. Sein zweiter, nicht wahr? Oder schon der dritte?«
Donati wandte sich an den päpstlichen Leibarzt. »Wann haben Sie den Tod festgestellt, Dottore Gallo?«
»Um dreiundzwanzig Uhr zehn, Exzellenz.«
Kardinal Albanese räusperte sich leise. »In meiner offiziellen Ankündigung habe ich den Zeitpunkt leicht angepasst. Wenn Sie’s wünschen, Luigi, kann ich sagen, dass Sie ihn aufgefunden haben.«
»Das wird nicht nötig sein.«
Donati sank neben dem Bett auf die Knie. Als Lebender war der Heilige Vater eine Elfengestalt gewesen. Im Tod wirkte er noch zierlicher. Donati erinnerte sich an den Tag, an dem das Konklave unerwartet Lucchesi, den Patriarchen von Venedig, zum 265. Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gewählt hatte. Im Zimmer der Tränen hatte er die kleinste der drei bereitgehaltenen Soutanen gewählt. Trotzdem hatte er darin ausgesehen wie ein kleiner Junge, der ein Hemd seines Vaters trägt. Als er auf den Balkon des Petersdoms getreten war, war sein Kopf kaum über der Balustrade zu sehen gewesen. Die Vaticanisti hatten ihn Pietro den Unwahrscheinlichen genannt. Die Hardliner der Kurie hatten ihn als Papst Zufällig verspottet.
Im nächsten Augenblick spürte Donati eine Hand auf seiner Schulter. Sie war bleischwer, also musste sie Albanese gehören.
»Den Ring, Exzellenz.«
Einst war es Aufgabe des Kämmerers gewesen, den Fischerring des verstorbenen Papstes in Anwesenheit des Kardinalskollegiums zu zerstören. Aber dieses Ritual war wie die drei Schläge mit einem silbernen Hammer auf die Stirn des Toten abgeschafft worden. Lucchesis Ring, den er selten getragen hatte, würde nur durch zwei tiefe Rillen quer über das Kreuz entwertet werden. Andere Traditionen wie die sofortige Versiegelung der päpstlichen Gemächer hatten sich jedoch erhalten. Selbst Donati, Lucchesis Privatsekretär, würde sie nach dem Abtransport der Leiche nicht mehr betreten können.
Weiter auf den Knien zog Donati die Nachttischschublade auf und griff nach dem schweren Goldring. Er übergab ihn Kardinal Albanese, der ihn in einen kleinen Samtbeutel fallen ließ. Ernst erklärte er dabei: »Sede vacante.«
Der Stuhl Petri war nun vakant. Die Apostolische Konstitution bestimmte, dass Kardinal Albanese während des Interregnums, das mit der Wahl des neuen Papstes endete, die Geschäfte der Heiligen Römischen Kirche führte. Als bloßer Titularbischof würde Donati dabei nichts zu sagen haben. Seit dem Tod seines Herrn war er ohne Aufgabe oder Befugnisse, nur dem Camerlengo unterstellt.
»Wann soll die Bekanntmachung erfolgen?«
»Ich habe nur auf Ihre Ankunft gewartet.«
»Dürfte ich sie rasch durchlesen?«
»Die Zeit drängt. Warten wir noch viel länger …«
»Gewiss, Eminenz.« Donati legte eine Hand auf Lucchesis Rechte. Sie war bereits kalt. »Ich wäre gern eine Minute mit ihm allein.«
»Aber nur eine Minute«, sagte der Kämmerer.
Der Raum leerte sich langsam. Kardinal Albanese verließ ihn als Letzter.
»Noch eine Frage, Eminenz.«
Der Camerlengo blieb an der Tür stehen. »Ja?«
»Wer hat die Vorhänge im Arbeitszimmer zugezogen?«
»Die Vorhänge?«
»Sie waren offen, als ich gegangen bin. Die Fensterlädchen ebenfalls.«
»Ich habe sie geschlossen, Exzellenz. Ich wollte nicht, dass jemand vom Petersplatz aus sieht, dass hier so spät nachts noch Licht brennt.«
»Ja, natürlich. Eine kluge Maßnahme, Eminenz.«
Der Camerlengo ging hinaus, ließ die Tür hinter sich offen. Donati kämpfte gegen Tränen an, als er mit seinem Herrn allein war. Trauern konnte er später. Er brachte seine Lippen dicht an Lucchesis Ohr und drückte die kalte Hand. »Sprich zu mir, alter Freund«, flüsterte er. »Erzähl mir, was heute Nacht wirklich passiert ist.«
2
JERUSALEM – VENEDIG
Es war Chiara, die dem Ministerpräsidenten im Vertrauen mitteilte, ihr Mann brauche dringend einen Erholungsurlaub. Seit Gabriel am King Saul Boulevard widerstrebend die Suite des Direktors bezogen hatte, hatte er sich kaum mal einen freien Nachmittag gegönnt und nach dem Pariser Bombenanschlag, bei dem er sich zwei Rückenwirbel angebrochen hatte, seine Reha im Büro verbracht. Trotzdem war ein Urlaub für ihn schwierig zu organisieren. Gabriel brauchte sichere Nachrichtenverbindungen und – noch wichtiger – effektiven Personenschutz. Den brauchten auch Chiara und die Zwillinge. Irene und Raphael würden bald ihren vierten Geburtstag feiern. Die Familie Allon war so gefährdet, dass sie Israel bisher noch nie verlassen hatte.
Aber wohin sollten sie reisen? Irgendein exotisches Ziel kam nicht infrage. Sie würden irgendwo in der Nähe Israels Urlaub machen müssen, damit Gabriel in dem leider wahrscheinlichen Fall einer nationalen Krise binnen Stunden zum King Saul Boulevard zurückkehren konnte. Für sie würde es keine Safari in Südafrika, keine Reise nach Australien oder auf die Galapagosinseln geben. Außerdem wollte Chiara unbedingt vermeiden, Gabriel durch einen weiteren Langstreckenflug zu ermüden. Als Direktor des Diensts musste er ohnehin häufig nach Washington fliegen, um sich mit seinen amerikanischen Partnern in Langley abzustimmen. Was er jetzt vor allem brauchte, war Ruhe.
Andererseits fiel es ihm nicht leicht, sich zu entspannen. Gabriel war ein ungeheuer begabter Mann, der kaum Hobbys hatte. Er war weder Skifahrer noch Taucher, hatte niemals Tennis oder Golf gespielt. Strände langweilten ihn, außer sie waren kalt und windig. Er segelte gern, vor allem in den schwierigen Gewässern westlich von England, oder wanderte mit dem Rucksack über wilde Hochmoore. Selbst Chiara, eine ehemalige Agentin des Diensts, konnte nicht lange mit ihm Schritt halten. Für die Kinder wäre das ganz unmöglich gewesen.
Der Trick würde daraus bestehen, für Gabriel eine Beschäftigung zu finden, die ihn morgens ein paar Stunden ablenkte, bis die Kinder angezogen waren und gefrühstückt hatten. Und was wäre, wenn es dieses Projekt in einer Stadt gäbe, die ihm längst vertraut war? Die Stadt, in der er sein Handwerk als Restaurator gelernt hatte? Die Stadt, in der Chiara und er sich kennen- und lieben gelernt hatten? Chiara war dort geboren, und ihr Vater war Oberrabbiner der dahinschwindenden jüdischen Gemeinde der Stadt. Außerdem setzte ihre Mutter ihr seit Langem zu, einmal mit den Kindern auf Besuch zu kommen. Perfekt, dachte sie. Die sprichwörtlichen zwei Fliegen mit einer Klappe.
Aber wann? Der August kam nicht infrage. Er war viel zu heiß und zu feucht, und Venedig würde voller Pauschalreisender sein, die in Selfies knipsenden Horden ihren Fremdenführern folgten, um nach ein bis zwei Stunden im Caffè Florian einen überteuerten Cappuccino zu trinken, bevor sie auf ihre Kreuzfahrtschiffe zurückkehrten. Aber wenn sie bis November warteten, würde das Wetter kühl und klar sein, und sie würden den ganzen Bezirk für sich haben. Dann konnten sie über ihre Zukunft nachdenken, ohne durch den Dienst oder den israelischen Alltag abgelenkt zu sein. Gabriel hatte dem Ministerpräsidenten erklärt, er stehe nur für eine Amtszeit zur Verfügung. Es war nicht zu früh, sich Gedanken darüber zu machen, wo sie den Rest ihres Lebens verbringen und ihre Kinder aufziehen wollten. Schließlich wurden sie beide nicht jünger, vor allem bei Gabriel fiel ihr dies auf.
Sie erzählte ihm nichts von ihrem Plan, weil er das als Aufforderung begriffen hätte, ihr eingehend zu erläutern, weshalb der Staat Israel zusammenbrechen würde, wenn er auch nur einen einzigen Tag Urlaub machte. Stattdessen legte sie mit Uzi Navot, dem stellvertretenden Direktor, heimlich die Termine fest. Die für sichere Wohnungen zuständige Hausverwaltung des Diensts besorgte ein Apartment. Die dortigen Geheimdienst- und Polizeidienststellen, mit denen Gabriel eng zusammenarbeitete, übernahmen es, für seine Sicherheit zu sorgen.
Nun brauchte sie noch ein Projekt, mit dem Gabriel ausgelastet sein würde. Ende Oktober telefonierte Chiara mit Francesco Tiepolo, dem prominentesten Restaurierungsbetrieb Venedigs.
»Ich habe genau das Richtige für ihn. Ich maile dir ein paar Fotos.«
Als Gabriel drei Wochen später nach einer besonders anstrengenden Sitzung des streitsüchtigen israelischen Kabinetts heimkam, waren die Koffer der Familie Allon gepackt.
»Du verlässt mich?«
»Nein«, sagte Chiara. »Wir machen Urlaub. Gemeinsam.«
»Ich kann unmöglich …«
»Alles ist arrangiert, Darling.«
»Weiß Uzi davon?«
Chiara nickte. »Und der Ministerpräsident.«
»Wohin reisen wir? Und wie lange?«
Sie antwortete knapp.
»Was soll ich zwei Wochen lang mit mir selbst anfangen?«
Chiara legte ihm die Fotos hin.
»Damit werde ich unmöglich fertig.«
»Du tust einfach, was du kannst.«
»Ich soll jemand anderen daran weiterarbeiten lassen?«
»Davon geht die Welt nicht unter.«
»Das weiß man nie, Chiara. Vielleicht tut sie’s doch.«
Die Wohnung befand sich im Piano nobile eines verfallenden Palazzos in Cannaregio, dem nördlichsten der sechs Stadtbezirke Venedigs. Sie bestand aus einem großen Salon, einer modern eingerichteten Küche und einer Terrasse mit Blick auf den Rio della Misericordia. In einem der drei Schlafzimmer hatten Techniker des Diensts eine sichere Verbindung zum King Saul Boulevard eingerichtet – mit einer abhörsicheren Kabine, in der Gabriel telefonieren konnte, ohne Mithörer fürchten zu müssen. Draußen auf den Fondamenta dei Ormesini hielten Carabinieri in Zivil Wache. Mit ihrer Erlaubnis trug Gabriel eine Pistole, eine 9-mm-Beretta. Das tat auch Chiara, die weit besser schoss als er.
Nach wenigen Schritten den Kai entlang erreichte man eine Stahlbrücke – die einzige in ganz Venedig –, die über den Kanal zu einem weiten Platz führte, der Campo di Ghetto Nuovo hieß. Dort gab es ein Museum, eine Buchhandlung und das Büro der jüdischen Gemeinde. Die Casa Israelitica di Riposo, ein jüdisches Altenheim, stand an der Nordseite des Platzes. Gleich daneben erinnerte ein schlichtes Basrelief an die Juden Venedigs, die im Dezember 1943 zusammengetrieben, in Konzentrationslager gebracht und später in Auschwitz ermordet worden waren. Zwei schwer bewaffnete Carabinieri bewachten das Mahnmal von einem Wachhäuschen aus. Von der Viertelmillion Menschen, die noch in der versinkenden Stadt ausharrten, brauchten nur die Juden Tag und Nacht Polizeischutz.
Die Wohngebäude, die den Platz säumten, waren die höchsten Venedigs, denn im Mittelalter hatte die Kirche ihren Bewohnern verboten, anderswo in der Stadt zu leben. In den obersten Stockwerken einiger Gebäude gab es kleine Synagogen für die Aschkenasim und die sephardischen Juden, die dort einst gelebt hatten. Die beiden funktionierenden Synagogen des Ghettos standen knapp südlich des Platzes. Beide waren getarnt, sodass nichts an ihren Zweck als jüdische Gotteshäuser erinnerte. Die Spanische Synagoge hatten Chiaras Vorfahren im Jahr 1580 gegründet. Sie war ungeheizt und wurde vom Passahfest bis zu den Hochfesten Rosch ha-Schana und Jom Kippur genutzt. Die durch einen winzigen Platz von ihr getrennte Levantinische Synagoge diente der Gemeinde im Winter.
Rabbi Jacob Zolli und seine Frau Alessia wohnten unweit der Levantinischen Synagoge in einem schmalen Häuschen, zu dem ein verschwiegener kleiner Innenhof gehörte. Wenige Stunden nach ihrer Ankunft in Venedig war die Familie Allon dort zum Abendessen eingeladen. Gabriel schaffte es, beim Essen nur viermal auf sein Smartphone zu sehen.
»Hoffentlich gibt’s kein Problem«, sagte Rabbi Zolli.
»Das Übliche«, murmelte Gabriel.
»Dann bin ich erleichtert.«
»Lieber nicht.«
Der Rabbi lachte leise. Er sah sich beifällig am Tisch um, musterte seine beiden Enkel, seine Frau und zuletzt seine Tochter. Kerzenlicht glänzte in ihren Augen. Sie waren karamellfarben mit goldenen Einsprengseln.
»Chiara hat nie strahlender ausgesehen. Du machst sie offenbar sehr glücklich.«
»Tue ich das?«
»Natürlich gibt es immer mal wieder Krisen.« Die Stimme des Rabbis klang mahnend. »Aber ich versichere dir, dass sie sich für den glücklichsten Menschen der Welt hält.«
»Nein, der bin ich.«
»Wie man hört, soll sie diese Reise hinter deinem Rücken organisiert haben.«
Gabriel runzelte die Stirn. »In der Tora steht bestimmt ein Verbot solcher Tricks.«
»Mir fällt keines ein.«
»Vermutlich war das die beste Lösung«, gestand Gabriel ein. »Sonst hätte ich wohl nie zugestimmt.«
»Wir freuen uns, dass ihr endlich mit den Kindern nach Venedig kommen konntet. Aber ihr kommt in schwierigen Zeiten.«
Rabbi Zolli senkte die Stimme. »Saviano und seine Freunde von der äußersten Rechten haben in Europa dunkle Mächte zum Leben erweckt.«
Giuseppe Saviano war der neue italienische Ministerpräsident. Er war intolerant und fremdenfeindlich, misstraute der freien Presse und hatte wenig Geduld mit Petitessen wie parlamentarischer Demokratie oder Gesetzestreue. Das galt auch für seinen engen Freund Jörg Kaufmann, den aufstrebenden Neofaschisten, der jetzt österreichischer Bundeskanzler war. In Frankreich galt es als ausgemacht, dass Cécile Leclerc, die Vorsitzende der Front Populaire, als Nächste den Élyséepalast beziehen würde. Und die deutschen Nationaldemokraten unter Führung des Neonazis und ehemaligen Skinheads Axel Brünner würden bei den vorgezogenen Bundestagswahlen im Januar voraussichtlich zweitstärkste Kraft werden. Die extreme Rechte schien überall auf dem Vormarsch zu sein.
Befördert worden war ihr Aufstieg in Westeuropa durch die Globalisierung, wirtschaftliche Unsicherheit und die sich rasch ändernden demografischen Verhältnisse. Moslems machten jetzt fünf Prozent der europäischen Bevölkerung aus. Immer mehr Europäer betrachteten den Islam als Gefahr für ihre religiöse und kulturelle Identität. Ihr Zorn und ihre Ressentiments, die bisher unterdrückt worden waren, kreisten nun wie ein Virus durchs Internet. Tätliche Angriffe auf Moslems hatten stark zugenommen. Das galt auch für Gewalt und Vandalismus, die sich gegen Juden richteten. Tatsächlich war Antisemitismus in Europa so stark verbreitet wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr.
»Unser Friedhof auf dem Lido ist letzte Woche wieder einmal verwüstet worden«, sagte Rabbi Zolli. »Umgestürzte Grabsteine, Hakenkreuze … das Übliche. Meine Gemeinde ist verängstigt. Ich versuche die Menschen zu beruhigen, aber ich habe auch Angst. Migrationsfeindliche Politiker wie Saviano haben die Flasche geschüttelt und den Korken herausgezogen. Ihre Anhänger klagen über Flüchtlinge aus dem Maghreb und aus Afrika, aber uns hassen sie am meisten. Dieser Hass hat die längste Tradition. Hier in Italien ist es salonfähig geworden, Antisemit zu sein. Man kann seine Verachtung für uns ganz öffentlich zeigen. Und die Ergebnisse fallen genau wie erwartet aus.«
»Auch dieser Sturm geht vorüber«, sagte Gabriel, ohne wirklich überzeugt zu klingen.
»Das haben deine Großeltern vermutlich auch gesagt. Genau wie die Juden von Venedig. Deine Mutter hat Auschwitz überlebt. Die hiesigen Juden hatten weniger Glück.« Der Rabbi schüttelte den Kopf. »Ich habe diesen Film schon mal gesehen, Gabriel. Ich weiß, wie er endet. Vergiss nie, dass das Undenkbare geschehen kann. Aber wir wollen uns den Abend nicht mit unersprießlichen Themen verderben. Ich möchte die Gesellschaft meiner Enkel genießen.«
Am folgenden Morgen stand Gabriel früh auf und verbrachte zwei Stunden in der abhörsicheren Kabine, um mit seinen engsten Mitarbeitern am King Saul Boulevard zu telefonieren. Danach charterte er ein Motorboot, um mit Chiara und den Kindern durch die Stadt und zu den Inseln in der Lagune zu fahren. Zum Baden war es viel zu kalt, aber die Kinder zogen auf dem Lido die Schuhe aus und liefen am Strand hinter Möwen und Seeschwalben her. Auf der Rückfahrt nach Cannaregio machten sie in der Kirche San Sebastiano in Dorsoduro halt, um Veroneses Muttergottes in der Glorie mit dem Hl. Sebastian und anderen Heiligen zu besichtigen, das Gabriel während Chiaras Schwangerschaft restauriert hatte. Später saßen Gabriel und Chiara auf einer Holzbank vor dem Altenheim Casa Israelitica di Riposo in der milden Herbstsonne, während die Kinder lärmend Fangen spielten.
»Dies ist meine liebste Bank, glaube ich«, sagte Chiara. »Hier haben wir gesessen, als du zur Vernunft gekommen bist und mich gebeten hast, dich zurückzunehmen. Erinnerst du dich, Gabriel? Das war nach dem Anschlag auf den Vatikan.«
»Ich weiß nicht, was schlimmer war. Die Panzerfäuste und Selbstmordattentäter oder die Art und Weise, wie du mich behandelt hast.«
»Das hattest du verdient, du Tölpel. Ich hätte dich nie zurücknehmen sollen.«
»Und jetzt spielen unsere Kinder hier auf dem Platz«, sagte Gabriel.
Chiara sah zum Wachhäuschen der Carabinieri hinüber. »Von bewaffneten Männern bewacht.«
Am folgenden Tag, Mittwoch, verließ Gabriel das Apartment nach seinem Telefonmarathon mit einem lackierten Holzkasten unter dem Arm und ging zur Kirche Madonna dell’Orto. Das Kirchenschiff lag im Halbdunkel, und ein Gerüst verdeckte die doppelt eingefassten Rundbögen der Seitenschiffe. Die Kirche hatte kein Querschiff, aber rückseitig eine fünfeckige Apsis mit dem Grab Jacopo Robustis, besser bekannt als Tintoretto. Dort traf Gabriel mit Francesco Tiepolo zusammen. Der Venezianer war ein Bär von einem Mann mit grau meliertem schwarzen Vollbart. Wie gewöhnlich trug er zu seiner bequemen weißen Leinenjacke einen elegant geschlungenen Kaschmirschal.
Er umarmte Gabriel strahlend. »Ich wusste, dass du zurückkommen würdest!«
»Ich bin auf Urlaub hier, Francesco. Bleiben wir also auf dem Teppich.«
Tiepolo wischte seinen Einwand mit großer Geste zur Seite. »Heute bist du auf Urlaub, aber eines Tages wirst du in Venedig sterben.« Er betrachtete das Grab. »In einer Kirche können wir dich wohl nicht beisetzen, was?«
Von 1552 bis 1569 hatte Tintoretto zehn Gemälde für diese Kirche geschaffen, darunter Mariä Tempelgang, das rechts im Kirchenschiff hing. Dieses mit 480 mal 429 Zentimetern riesige Gemälde gehörte zu seinen Meisterwerken. Die erste Phase der Restaurierung, das Abnehmen des verfärbten Firnisses, war beendet. Nun ging es darum, einzelne Partien zu ergänzen, die durch Alter und Umwelteinflüsse verloren gegangen waren. Gabriel schätzte, dass ein Restaurator für diese Monumentalaufgabe mindestens ein Jahr brauchen würde.
»Welcher arme Teufel hat den Firnis abgenommen? Hoffentlich Antonio Politi?«
»Paulina Giglio, unsere Neue. Sie hat gehofft, dir bei der Arbeit zusehen zu dürfen.«
»Du hast ihr gesagt, dass das nicht infrage kommt?«
»Laut und deutlich. Sie lässt dir ausrichten, dass du jede Figur haben kannst – nur die Maria nicht.«
Gabriel betrachtete das obere Drittel des riesigen Gemäldes. Maria, die dreijährige Tochter von Anna und Joachim, Juden aus Nazareth, stieg zögernd die fünfzehn Stufen des Jerusalemer Tempels zu dem Hohepriester hinauf. Einige Stufen darunter ruhte eine Frau in einem braunen Seidengewand. Ihren linken Arm hatte sie um ein Kind gelegt, das ein Junge oder ein Mädchen sein konnte.
»Sie«, sagte Gabriel. »Und das Kind.«
»Wirklich? Die beiden brauchen viel Arbeit.«
Gabriel lächelte traurig, ohne die Leinwand aus den Augen zu lassen. »Das ist das Mindeste, was ich für sie tun kann.«
Er blieb bis 14 Uhr in der Kirche, viel länger als ursprünglich vorgesehen. An diesem Abend ließen Chiara und er die Kinder in der Obhut ihrer Großeltern zurück, um in einem Restaurant in San Polo südwestlich des Canal Grande zu Abend zu essen. Am folgenden Tag, Donnerstag, nahm er die Kinder zu einer Gondelfahrt mit, bevor er von Mittag bis 17 Uhr an dem Tintoretto arbeitete, bevor Tiepolo die Kirche für die Nacht absperrte.
Chiara beschloss, an diesem Abend selbst zu kochen. Nach dem Essen beobachtete Gabriel das Baden genannte allabendliche Drama, bevor er sich in die abgeschirmte Kabine zurückzog, um eine kleinere Krise daheim zu bewältigen. Es war kurz vor eins, als er ins Bett kroch. Chiara las ein Buch, ohne den stumm gestellten Fernseher zu beachten. Auf dem Bildschirm war eine Live-Aufnahme des Petersdoms zu sehen. Gabriel drehte den Ton lauter und erfuhr, dass ein alter Freund gestorben war.
3
CANNAREGIO, VENEDIG
Später an diesem Morgen wurde der Leichnam Seiner Heiligkeit Papst Paul VII. in die Sala Clementina im ersten Stock des Apostolischen Palasts gebracht. Dort blieb er bis zum frühen Nachmittag, als er in feierlicher Prozession in den Petersdom überführt wurde, um zwei Tage lang öffentlich aufgebahrt zu bleiben. Vier mit Hellebarden bewaffnete Schweizergardisten hielten die Totenwache. Das vatikanische Pressekorps berichtete ausführlich darüber, dass Erzbischof Luigi Donati, der engste Mitarbeiter und Vertraute des Papstes, praktisch nicht von seiner Seite wich.
Nach kirchlicher Tradition hatten Totenmesse und Beisetzung vier bis sechs Tage nach seinem Tod stattzufinden. Kardinalkämmerer Domenico Albanese gab bekannt, die Beerdigung finde am kommenden Dienstag statt und das Konklave werde zehn Tage später beginnen. Die Vaticanisti sagten große Differenzen und schwere Auseinandersetzungen zwischen Konservativen und Reformern voraus. Eingeweihte setzten auf Kardinal José Maria Navarro, der seine Position als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre dazu genutzt hatte, sich im Kardinalskollegium eine Hausmacht zu schaffen, die kaum geringer als die des verstorbenen Papstes war.
In Venedig, wo Pietro Lucchesi als Patriarch gewirkt hatte, ordnete der Oberbürgermeister drei Tage Trauer an. Die Kirchenglocken der Stadt schwiegen, und im Markusdom fand ein mäßig besuchter Gedenkgottesdienst statt. Ansonsten ging das Leben wie gewohnt weiter. Ein kleines Hochwasser überflutete Teile von Santa Croce; ein riesiges Kreuzfahrtschiff rammte einen Kai am Canale della Giudecca. In den Bars, in denen die Einheimischen einen Espresso oder eine Grappa gegen die Herbstkühle tranken, war der Name des toten Papstes selten zu hören. Von den von Natur aus zynischen Venezianern besuchten nur wenige regelmäßig die Messe, und noch weniger lebten nach den Vorschriften der Männer im Vatikan. Die Kirchen Venedigs, die schönsten der Christenheit, waren Orte, an denen Touristen Renaissancekunst bewunderten.
Gabriel verfolgte die Ereignisse in Rom jedoch mit mehr als nur flüchtigem Interesse. Am Morgen der Beisetzung des Papstes war er schon früh in der Kirche und arbeitete bis 12.15 Uhr, als er hallende Schritte im Kirchenschiff hörte. Er klappte seine Lupenbrille hoch und spähte vorsichtig durch einen Spalt zwischen den Planen, mit denen sein Arbeitsgerüst verhängt war. General Cesare Ferrari, Kommandeur des Carabinieri-Dezernats für die Verteidigung des Kulturerbes, besser als Kunstdezernat bekannt, erwiderte seinen Blick ausdruckslos.
Der General trat ohne Aufforderung hinter die Sichtschutzplane und betrachtete die riesige Leinwand, die von zwei Halogenscheinwerfern gleißend hell beleuchtet wurde. »Eines seiner besseren Bilder, finden Sie nicht auch?«
»Er stand unter gewaltigem Druck, sich zu beweisen. Veronese war öffentlich als Nachfolger Tizians und der beste Maler Venedigs anerkannt. Der arme Tintoretto bekam weniger Aufträge als früher.«
»Dies war seine Pfarrkirche.«
»Was Sie nicht sagen!«
»Er hat gleich um die Ecke auf den Fondamenta dei Mori gewohnt.« Der General schob die Plane zur Seite, trat ins Kirchenschiff hinaus. »Hier hat früher auch ein Bellini – Madonna mit Kind – gehangen. Es wurde im Jahr 1993 gestohlen. Das Kunstdezernat sucht es seit damals.« Er sah sich nach Gabriel um. »Sie haben es nicht zufällig irgendwo gesehen?«
Gabriel lächelte. Kurz vor seiner Ernennung zum Direktor des Diensts hatte er das meistgesuchte gestohlene Gemälde der Welt aufgespürt: Caravaggios Christi Geburt mit den Heiligen Laurentius und Franziskus. Er hatte dafür gesorgt, dass das Kunstdezernat als alleiniger Entdecker dastand. Auch aus diesem Grund hatte General Ferrari sich bereit erklärt, Gabriel und seine Familie während ihres Urlaubs in Venedig Tag und Nacht bewachen zu lassen.
»Sie sollten sich hier erholen«, sagte der General.
Gabriel nahm seine Lupenbrille ab. »Das tue ich.«
»Irgendwelche Probleme?«
»Aus unerklärlichen Gründen fällt es mir schwer, den Farbton des Gewandes der Frau richtig zu treffen.«
»Ich meinte Ihre Sicherheit.«
»Meine Rückkehr nach Venedig scheint unbemerkt geblieben zu sein.«
»Nicht ganz.« Der General sah auf seine Armbanduhr. »Ich kann Sie wohl nicht dazu überreden, eine Mittagspause zu machen?«
»Ich esse nie zu Mittag, wenn ich arbeite.«
»Ja, ich weiß.« Der General schaltete die Halogenscheinwerfer aus. »Ich erinnere mich.«
Tiepolo hatte Gabriel einen Schlüssel zur Kirche gegeben. Unter dem Blick des Kommandeurs des Kunstdezernats stellte er die Alarmanlage scharf und sperrte das Portal ab. Dann gingen sie zu einer Bar ganz in der Nähe von Tintorettos altem Wohnhaus. Auf dem Fernseher über der Theke lief die Übertragung der päpstlichen Beisetzung.
»Zu Ihrer Information«, sagte der General. »Erzbischof Donati wollte Sie auf die Gästeliste setzen.«
»Wieso bin ich dann nicht eingeladen worden?«
»Der Camerlengo wollte nichts davon hören.«
»Albanese?«
Der General nickte. »Ihre Freundschaft mit Donati scheint ihm immer missfallen zu haben. Übrigens auch Ihr gutes Verhältnis zu dem Heiligen Vater.«
»Dann ist’s vermutlich besser, dass ich nicht dort bin. Ich hätte nur gestört.«
Der General runzelte die Stirn. »Sie hätten einen Ehrenplatz bekommen müssen. Ohne Sie wäre der Heilige Vater damals bei dem Terroranschlag auf den Vatikan umgekommen.«
Der Barista, ein hagerer Jüngling in Jeans und einem schwarzen T-Shirt, servierte Kaffee. Ferrari trank seinen mit reichlich Zucker. An der Hand, die den Kaffee umrührte, fehlten zwei Finger. Die hatte er als Kommandeur der Carabinieri in Neapel durch eine Briefbombe der Camorra verloren. Dieser Anschlag hatte ihn auch das rechte Auge gekostet. Sein Glasauge mit der unveränderlichen Pupille verlieh dem General einen kalten, starren Blick. Selbst Gabriel tendierte dazu, ihm auszuweichen, weil er das Gefühl hatte, ins Auge eines alles sehenden Gottes zu blicken.
Jetzt konzentrierte Ferrari sich auf den Fernseher, während die Kamera langsam über eine Verbrechergalerie aus Politikern, Monarchen und weltberühmten Prominenten hinwegglitt. Zuletzt zeigte sie Giuseppe Saviano.
»Wenigstens trägt er sein Armband nicht«, murmelte der General.
»Sie sind kein Bewunderer?«
»Saviano ist ein leidenschaftlicher Verteidiger des Budgets des Kunstdezernats. Deshalb kommen wir recht gut miteinander aus.«
»Faschisten lieben das nationale Kulturerbe.«
»Er sieht sich als Populist, nicht als Faschist.«
»Das ist erleichternd.«
Ferraris knappes Lächeln erreichte sein Glasauge nicht. »Der Aufstieg eines Mannes wie Saviano war unvermeidbar. Unser Volk hat die Geduld mit fantastischen Begriffen wie liberale Demokratie, der Europäischen Union und der westlichen Wertegemeinschaft verloren. Und warum auch nicht? Globalisierung und Automatisierung hindern die meisten jungen Italiener daran, einen guten Beruf zu ergreifen. Wollen sie anständig verdienen, gehen sie nach Großbritannien. Und bleiben sie hier …« Der General sah zu dem Jüngling hinter der Bar hinüber. »… servieren sie Touristen Kaffee.« Er senkte die Stimme. »Oder israelischen Geheimdienstlern.«
»Daran wird Saviano nicht viel ändern können.«
»Vermutlich nicht. Aber vorerst wirkt er stark und selbstbewusst.«
»Wie wär’s mit kompetent?«
»Solange er keine Migranten ins Land lässt, ist’s seinen Anhängern egal, ob er zwei und zwei zusammenzählen kann.«
»Was ist, wenn’s eine Krise gibt? Eine echte Krise. Keine, die irgendeine rechtsradikale Webseite erfunden hat.«
»Zum Beispiel?«
»Ich denke an eine weitere Finanzkrise, die das Bankensystem endgültig ruiniert.« Gabriel machte eine Pause. »Oder an etwas weit Schlimmeres.«
»Was wäre schlimmer, als erleben zu müssen, wie die Ersparnisse meines Lebens in Rauch aufgehen?«
»Wie wär’s mit einer globalen Pandemie? Mit einem neuartigen Grippevirus, dem wir Menschen hilflos ausgeliefert sind?«
»Eine Plage?«
»Lachen Sie nicht, Cesare. Das ist nur eine Frage der Zeit.«
»Und woher soll Ihre Plage kommen?«
»Sie wird an einem Ort mit schlechten hygienischen Bedingungen von Tieren auf Menschen überspringen. Zum Beispiel auf einem chinesischen Wildtiermarkt. Sie wird mit zunächst nur lokalen Erkrankungen langsam beginnen. Aber weil wir alle so vernetzt sind, wird sie sich wie ein Lauffeuer ausbreiten. Chinesische Touristen werden sie in Westeuropa einschleppen, noch bevor das Virus identifiziert ist. So ist binnen weniger Wochen womöglich die Hälfte der italienischen Bevölkerung infiziert – vielleicht sogar mehr. Was passiert dann, Cesare?«
»Erzählen Sie’s mir.«
»Das gesamte Land muss sich in Quarantäne begeben, um eine weitere Ausbreitung des Virus’ zu verhindern. Die Krankenhäuser werden so überfüllt sein, dass sie alle außer den Jüngsten und Gesündesten abweisen müssen. Jeden Tag werden Hunderte, vielleicht sogar Tausende sterben. Das Militär wird massenhafte Feuerbestattungen organisieren müssen, um weitere Ansteckungen zu verhindern, das wird …«
»Ein zweiter Holocaust.«
Gabriel nickte langsam. »Und wie, glauben Sie, wird ein unfähiger Populist wie Saviano in dieser Situation reagieren? Wird er auf medizinische Experten hören oder sich einbilden, alles besser zu wissen? Wird er seinem Volk die Wahrheit sagen oder ihm vorgaukeln, dass ein Impfstoff und lebensrettende Behandlungen demnächst zur Verfügung stehen?«
»Er wird den Chinesen und den Migranten alle Schuld zuweisen und gestärkt aus der Krise hervorgehen.« Ferrari musterte Gabriel prüfend. »Wissen Sie etwas, das Sie mir nicht verraten wollen?«
»Jeder halbwegs Vernünftige weiß, dass etwas wie die Spanische Grippe von 1919 längst überfällig ist. Ich habe meinen Ministerpräsidenten gewarnt, dass eine Pandemie die bei Weitem größte Gefahr ist, die Israel droht.«
»Ich bin froh, dass ich nur dafür zuständig bin, gestohlene Kunstwerke aufzuspüren.« Der General beobachtete, wie die Kamera über ein Meer aus roten Soutanen hinwegglitt. »Dort sitzt der nächste Pontifex.«
»Kardinal Navarro gilt als Favorit.«
»Das ist ein Gerücht.«
»Haben Sie nähere Informationen?«
General Ferrari antwortete, als sitze er bei einer Pressekonferenz vor Reportern. »Die Carabinieri versuchen nicht, die Papstwahl zu überwachen. Das tun auch keine anderen italienischen Geheim- oder Sicherheitsdienste.«
»Oh, bitte!«
Der General lachte halblaut. »Und wie steht’s mit Ihnen?«
»Die Identität des neuen Papstes braucht den Staat Israel nicht zu kümmern.«
»Wirklich nicht?«
»Was soll das heißen?«
»Das lasse ich am besten ihn erklären.« Ferrari nickte zu dem Fernseher hinüber. Die Kamera hatte Erzbischof Luigi Donati gefunden, Privatsekretär Seiner Heiligkeit Papst Paul VII. »Er lässt anfragen, ob Sie Zeit für ein Gespräch mit ihm erübrigen können.«
»Warum hat er mich nicht einfach angerufen?«
»Worüber er sprechen will, möchte er lieber nicht am Telefon sagen.«
»Hat er angedeutet, worum es geht?«
Der General schüttelte den Kopf. »Nur, dass die Sache äußerst wichtig ist. Er hofft, dass Sie Zeit haben, sich morgen mit ihm zum Mittagessen zu treffen.«
»Wo?«
»Rom.«
Gabriel gab keine Antwort.
»Der Flug dauert nur eine Stunde. Zum Abendessen sind Sie wieder in Venedig.«
»Glauben Sie?«
»Wenn ich an den Tonfall des Erzbischofs denke, habe ich meine Zweifel. Er erwartet Sie um ein Uhr im Piperno, das Sie offenbar kennen.«
»Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor.«
»Er möchte, dass Sie allein kommen. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen Ihrer Frau und Ihrer Kinder. Für die ist in Ihrer Abwesenheit gut gesorgt.«
»Abwesenheit?« Das war nicht das Wort, das Gabriel zur Beschreibung eines Tagesausflugs in die Ewige Stadt gewählt hätte.
Der General sah wieder auf den Fernsehschirm. »Sehen Sie sich diese Kirchenfürsten an – alle rot gekleidet.«
»Die Farbe symbolisiert das Blut Christi.«
Ferrari blinzelte überrascht. »Woher wissen Sie das?«
»Ich habe einen großen Teil meines Lebens damit verbracht, christliche Kunst zu restaurieren. Da ist’s ganz natürlich, dass ich die Geschichte ihrer Kirche besser kenne als die meisten Katholiken.«
»Auch besser als ich.« Ferrari zog die Augenbrauen hoch. »Auf wen tippen Sie?«
»Wie man hört, sucht Navarro schon neue Möbel für die päpstlichen Gemächer aus.«
»Ja«, sagte der General nachdenklich nickend. »Das hört man allerdings.«
4
MURANO
»Sag mir bitte, dass das nur ein Scherz ist.«
»Glaub mir, es war nicht meine Idee.«
»Ahnst du überhaupt, wie viel Mühe und Zeit es mich gekostet hat, diese Reise zu organisieren? Verdammt, ich musste sogar beim Ministerpräsidenten vorsprechen!«
»Das tut mir aufrichtig leid«, sagte Gabriel ernst.
Sie saßen im rückwärtigen Teil eines kleinen Restaurants auf der Insel. Gabriel hatte bis nach den Vorspeisen gewartet, bevor er Chiara mitteilte, er werde am kommenden Morgen nach Rom reisen. Sein Motiv war zugegebenerweise egoistisch. Dieses Fischrestaurant gehörte zu seinen Lieblingslokalen in Venedig.
»Ich bin nur einen Tag fort, Chiara.«
»Das glaubst du doch selbst nicht!«
»Nein, aber einen Versuch war’s wert.«
Chiara hob ihr Weinglas an die Lippen. Im Kerzenschein leuchtete ihr Pinot Grigio mit blassem Feuer. »Wieso warst du nicht zur Beisetzung eingeladen?«
»Kardinal Albanese konnte anscheinend auf dem ganzen Petersplatz keinen Platz für mich finden.«
»Er hat den Leichnam aufgefunden, nicht wahr?«
»In der Privatkapelle«, sagte Gabriel.
»Glaubst du, dass alles wirklich so abgelaufen ist?«
»Willst du damit andeuten, die vatikanische Pressestelle könnte Fake News verbreitet haben?«
»Luigi und du habt im Lauf der Jahre nicht wenige Falschmeldungen fabriziert.«
»Aber unsere Motive waren immer rein.«
Chiara stellte ihr Glas auf die cremeweiße Tischdecke und drehte es langsam. »Was, glaubst du, will er mit dir besprechen?«
»Jedenfalls nichts Gutes.«
»Was hat General Ferrari gesagt?«
»So wenig wie nur möglich.«
»Das sieht ihm gar nicht ähnlich.«
»Vielleicht hat er angedeutet, die Sache könnte etwas mit der Wahl des nächsten Pontifex Maximus der Heiligen Römischen Kirche zu tun haben.«
Das Weinglas drehte sich nicht mehr. »Mit dem Konklave?«
»Genauer hat er sich nicht ausgedrückt.«
Gabriel weckte sein Mobiltelefon und sah auf die Uhr. Zuletzt hatte er sich doch von seinem geliebten BlackBerry Key2 trennen müssen. Sein neues Smartphone war ein in Israel nach seinen Angaben speziell für ihn hergestelltes Solaris. Es war größer und schwerer als gewöhnliche Handys und sollte den erfahrensten Hackern der Welt – auch der amerikanischen NSA und der israelischen Einheit 8200 – widerstehen können. Außer den Führungskräften des Diensts benutzte auch Chiara ein Solaris. Dies war ihr zweites Gerät. Ihr erstes Solaris hatte Raphael vom Balkon ihrer Jerusalemer Wohnung geworfen. Trotz seiner Robustheit war das Solaris nicht dafür gebaut, einen Fall aus dem zweiten Stock mit Aufprall auf einem gepflasterten Gehsteig zu überstehen.
»Es ist schon spät«, sagte er. »Wir sollten deine Eltern retten.«
»Das hat keine Eile. Sie haben die Kinder gern um sich. Wenn es nach ihnen ginge, würden wir in Venedig bleiben.«
»Am King Saul Boulevard würde meine Abwesenheit vielleicht auffallen.«
»Dem Ministerpräsidenten auch.« Chiara schwieg einen Augenblick. »Ich muss zugeben, dass ich mich auch nicht darauf freue, wieder heimzureisen. Ich habe es genossen, dich für mich zu haben.«
»Meine Amtszeit dauert nur noch zwei Jahre.«
»Genau zwei Jahre und einen Monat.«
»War es eine schreckliche Zeit bis hierher?«
Sie verzog das Gesicht. »Ich wollte nie die Rolle der nörgelnden Ehefrau spielen. Diesen Typ kennst du, nicht wahr, Gabriel? Sie sind so nervig, diese Frauen.«
»Wir haben von Anfang an gewusst, dass es schwierig werden würde.«
»Ja«, sagte sie vage.
»Wenn du Hilfe brauchst …«
»Hilfe?«
»Ein zusätzliches Paar Hände im Haushalt.«
Sie runzelte die Stirn. »Ich komme gut allein zurecht, besten Dank. Du fehlst mir nur, das ist alles.«
»Die zwei Jahre vergehen wie im Flug.«
»Und du versprichst mir, dich nicht zu einer zweiten Amtszeit überreden zu lassen?«
»Absolut!«
Ihre Miene hellte sich auf. »Wie willst du also deinen Ruhestand verbringen?«
»Das klingt so, als sollte ich mich nach einem Platz in betreutem Wohnen umsehen.«
»Du bist nicht mehr der Jüngste, Darling.« Sie tätschelte seine Hand. Das bewirkte, dass er sich noch älter fühlte. »Na?«, fragte sie.
»Ich möchte den Rest meines Lebens darauf verwenden, dich glücklich zu machen.«
»Du tust also alles, was ich will?«
Er musterte sie prüfend. »Innerhalb eines vernünftigen Rahmens.«
Sie senkte den Kopf und zupfte an einem Faden an der Tischdecke. »Ich habe gestern mit Francesco Kaffee getrunken.«
»Das hat er nicht erwähnt.«
»Weil ich ihn darum gebeten habe.«
»Aha. Und worüber habt ihr gesprochen?«
»Über die Zukunft.«
»Woran denkt er?«
»An eine Partnerschaft.«
»Francesco und ich?«
Chiara gab keine Antwort.
»Du?«
Sie nickte. »Er möchte, dass ich komme und bei ihm arbeite. Und wenn er in ein paar Jahren in den Ruhestand geht …«
»Was?«
»Dann gehört die Firma mir.«
Gabriel erinnerte sich daran, was Tiepolo am Grab Tintorettos stehend gesagt hatte: Heute bist du auf Urlaub, aber eines Tages wirst du in Venedig sterben … Er bezweifelte, dass dieser Plan erst gestern beim Kaffee ausgeheckt worden war.
»Ein nettes jüdisches Mädchen aus dem Ghetto wird sich um die Erhaltung der Kirchenkunst Venedigs kümmern? Willst du das sagen?«
»Ziemlich bemerkenswert, nicht wahr?«
»Und was mache ich dann?«
»Du könntest deine Tage damit verbringen, durch die Gassen Venedigs zu streifen.«
»Oder?«
Sie lächelte strahlend. »Du könntest für mich arbeiten.«
Dieses Mal senkte Gabriel den Kopf. Das leuchtende Display seines Smartphones kündigte eine Nachricht vom King Saul Boulevard an. Er drehte das Gerät um. »Das könnte zu Kontroversen führen, Chiara.«
»Für mich zu arbeiten?«
»Israel in dem Augenblick zu verlassen, in dem meine Amtszeit zu Ende ist.«
»Willst du für einen Sitz in der Knesset kandidieren?«
Er verdrehte die Augen.
»Ein Buch über deine Erfolge schreiben?«
»Das überlasse ich jemand anderem.«
»Also?«
Er gab keine Antwort.
»Bleibst du in Israel, kann der Dienst dich jederzeit erreichen. Kommt eine Krise, holen sie dich wie damals Ari als Retter in der Not zurück.«
»Ari wollte zurückkommen. Ich bin anders.«
»Glaubst du? Da bin ich mir nicht so sicher. Tatsächlich wirst du ihm immer ähnlicher.«
»Was ist mit den Kindern?«, fragte er.
»Sie lieben Venedig.«
»Schule?«
»Glaub mir, wir haben ein paar sehr gute.«
»Dann werden sie Italiener.«
Sie runzelte die Stirn. »Jammerschade, was?«
Gabriel atmete langsam aus. »Hast du Francescos Bücher eingesehen?«
»Die bringe ich in Ordnung.«
»Die Sommer in der Stadt sind schrecklich.«
»Wir fahren in die Berge oder segeln auf der Adria. Du hast jahrelang nicht mehr gesegelt, Darling.«
Gabriel fiel nichts mehr ein, was er hätte einwenden können. Tatsächlich hielt er das für eine wunderbare Idee. Vor allem wäre Chiara dann in seinen beiden letzten Dienstjahren beschäftigt.
»Dann sind wir uns also einig?«, fragte sie.
»Ich denke schon, wenn du meine exorbitanten Gehaltswünsche erfüllst.«
Gabriel machte dem Ober ein Zeichen. Chiara zupfte wieder an dem losen Faden.
»Mir macht noch etwas anderes Sorgen«, sagte sie.
»Dass wir die Kinder aus ihrer gewohnten Umgebung reißen und nach Venedig verpflanzen?«
»Nein, das amtliche Bulletin des Vatikans. Luigi war immer bis zum späten Abend mit dem Papst zusammen. Und wenn Lucchesi vor dem Zubettgehen noch mal in seine Privatkapelle gegangen ist, hat Luigi ihn begleitet.«
»Korrekt.«
»Wieso hat dann Kardinal Albanese den Toten aufgefunden?«
»Das werden wir nie erfahren.« Gabriel machte eine Pause. »Außer ich esse morgen mit Luigi in Rom zu Mittag.«
»Das kannst du – unter einer Bedingung.«
»Welcher?«
»Nimm mich mit.«
»Was ist mit den Kindern?«
»Meine Eltern können sich um sie kümmern.«
»Und wer kümmert sich um deine Eltern?«
»Natürlich die Carabinieri.«
»Aber …«
»Lass dich nicht zweimal bitten, Gabriel. Ich hasse es wirklich, die nörgelnde Ehefrau zu spielen. Sie sind so nervig, diese Frauen.«
5
VENEDIG – ROM
Nach dem Frühstück lieferten sie die Kinder bei den Großeltern ab und beeilten sich, zum Bahnhof Santa Lucia zu kommen, um den Hochgeschwindigkeitszug um 8.34 Uhr nach Rom zu erreichen. Während draußen die fruchtbare Landschaft Oberitaliens vorbeizog, las Gabriel die Zeitungen, schrieb ein paar Routine-E-Mails und telefonierte mit dem King Saul Boulevard. Chiara, die einen dicken Stapel Einrichtungsmagazine durchblätterte, leckte bei jeder Seite die Kuppe ihres Zeigefingers an.
Wenn die Verteilung von Licht und Schatten genau richtig war, konnte Gabriel ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe neben sich sehen. Er musste zugeben, dass sie ein attraktives Paar waren, er in seinem eleganten dunklen Anzug mit weißem Hemd, Chiara in schwarzen Leggings und Lederjacke. Trotz seines stressreichen Jobs mit langen Arbeitszeiten – und trotz seiner vielen Verwundungen, von denen einige tödlich hätten sein können – hatte er sich nach eigener Einschätzung ziemlich gut gehalten. Ja, die Fältchen um seine jadegrünen Augen waren etwas tiefer, aber er war weiter fit wie ein Triathlet und hatte noch sein volles dunkles Haar, das nur an den Schläfen auffällig grau war. Nach seinem ersten Auftragsmord für den Dienst hatte es seine Farbe praktisch über Nacht gewechselt. Das Unternehmen hatte 1972 in der Stadt stattgefunden, die heute ihr Ziel war.
Kurz vor Florenz hielt Chiara ihm einen aufgeschlagenen Katalog unter die Nase und wollte wissen, was er von dem Sofa und dem Couchtisch hielt. Seine indifferente Reaktion trug ihm einen leicht tadelnden Blick ein. Chiara war anscheinend schon dabei, Immobilienanzeigen zu studieren, was seine Theorie bestätigte, ihre Rückkehr nach Venedig sei schon länger in Planung. Vorerst konzentrierte sie sich auf zwei Eigentumswohnungen: eine in Cannaregio, die andere in San Polo mit Blick auf den Canal Grande. Beide würden das kleine Vermögen, das Gabriel als Restaurator angehäuft hatte, erheblich vermindern, und Chiara würde von beiden aus zu Tiepolos Büro in San Marco pendeln müssen. Das Apartment in San Polo lag viel näher, nur wenige Vaporetto-Stationen entfernt. Leider kostete es jedoch auch doppelt so viel.
»Wenn wir die Narkiss Street verkaufen …«
»Die verkaufen wir nicht«, sagte Gabriel.
»Das Apartment in San Polo hat ein riesiges Zimmer mit hoher Decke, das du als Atelier benutzen könntest.«
»Damit ich den Hungerlohn, den du mir zahlst, durch private Aufträge aufbessern kann?«
»Genau.«
Gabriels Telefon piepste mit dem speziellen Ton, der dringende Nachrichten vom King Saul Boulevard anzeigte.
Chiara beobachtete unruhig, wie Gabriel den Text las. »Müssen wir nach Hause?«
»Noch nicht.«
»Was gibt’s?«
»In Berlin ist auf dem Potsdamer Platz eine Autobombe detoniert.«
»Opfer?«
»Vermutlich. Genauere Angaben fehlen noch.«
»Wer steckt hinter dem Anschlag?«
»Der IS hat die Verantwortung dafür übernommen.«
»Ist er denn imstande, einen Anschlag in Westeuropa auszuführen?«
»Hättest du mich das gestern gefragt, hätte ich Nein gesagt.«
Gabriel verfolgte die Meldungen aus Berlin, bis der Zug im Bahnhof Roma Termini einlief. Draußen war der Himmel leuchtend blau und wolkenlos. Sie gingen durch beige und sienabraune Häuserschluchten – vor allem auf Gassen und Nebenstraßen, auf denen Verfolger leichter zu entdecken waren. Als sie die Piazza Navona erreichten, waren sie sich einig, dass sie nicht beschattet wurden.
Das Ristorante Piperno lag ein kleines Stück weiter südlich an einem ruhigen kleinen Platz in Tibernähe. Chiara betrat es als Erste und bekam von dem entzückten Ober in weißer Jacke sofort den besten Tisch am Fenster. Gabriel, der drei Minuten später eintraf, nahm draußen in der milden Herbstsonne Platz. Er konnte sehen, wie Chiaras Daumen hektisch auf ihrem Smartphone herumtippten. Er zog sein eigenes Handy aus der Tasche und tippte: Was ist passiert?
Chiaras Antwort kam wenige Sekunden später: Dein Sohn hat die liebste Vase meiner Mutter zertrümmert.
Das war bestimmt die Schuld der Vase, nicht seine.
Dein Tischgenosse kommt gerade.

![Die Fälschung (Gabriel Allon 22) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a3c78f56d830648941e8541a912ece8c/w200_u90.jpg)
![Der Geheimbund (Gabriel Allon 20) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3f0442bd1f64b2b41e586c80150b3c0/w200_u90.jpg)
![Die Cellistin (Gabriel Allon 21) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bdaaa9cd283b671c252c1b0a29ef6f0/w200_u90.jpg)


![Das Vermächtnis (Gabriel Allon 19) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2dc3fc2736d865447dbf9f082ac49b4/w200_u90.jpg)