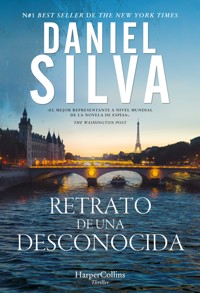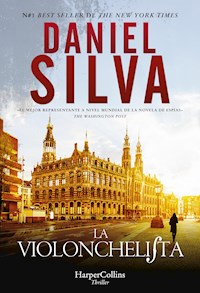Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Harper Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gabriel Allon
- Sprache: Deutsch
Actiongeladener Spionagethriller in bewährter Silva-Manier!
General Cesare Ferrari wartet mit eiligen Neuigkeiten auf Gabriel Allon: Die Carabinieri haben in der Villa eines ermordeten südafrikanischen Schifffahrtsmagnaten in Amalfi ein geheimes Gewölbe entdeckt. Dieses verbirgt einen leeren Rahmen und einen Keilrahmen, der den Maßen des wertvollsten verschwundenen Gemäldes der Welt entspricht. Allons Fähigkeiten sind gefragt, und so macht er sich auf, das fehlende Meisterwerk aufzuspüren. Schon bald wird klar, dass es sich bei diesem Diebstahl um eine Verschwörung handelt, die die Welt in einen Konflikt apokalyptischen Ausmaßes stürzen könnte. Um das Komplott zu vereiteln, muss Gabriel selbst einen gewagten Raubüberfall durchführen, bei dem Millionen von Menschenleben auf dem Spiel stehen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Silva
Der Kunstsammler
Ein Gabriel-Allon-Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch vonWulf Bergner
HarperCollins
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel The Collector bei Harper, New York.
© 2023 by Daniel Silva
Deutsche Erstausgabe
© 2024 für die deutschsprachige Ausgabe
by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Published by arrangement with
Harper, an imprint of HarperCollins Publishers, US
Covergestaltung von bürosüd, München
Coverabbildung von www.buerosued.de unter der Verwendung von Shutterstock
E-Book Produktion von GGP Media Gmbh, Pößneck
ISBN 9783749907434
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte des Autors und des Verlags bleiben davon unberührt.
Wie immer für meine Frau Jamieund meine Kinder Lily und Nicholas
Wir alle wollen Dinge, die wir nicht haben können. Ein anständiger Mensch ist, wer das akzeptiert.
John Fowles, Der Sammler
Niemals und unter keinen Bedingungen dürfen wir verzweifeln. Zu hoffen und zu handeln, das ist unsere Pflicht im Unglück.
Boris Pasternak, Doktor Schiwago
TEIL EINS
DASKONZERT
1
AMALFI
Es sei möglich, sagte Sofia Ravello später bei den Carabinieri aus, den größten Teil seiner Arbeitszeit im Haus eines Mannes zu verbringen, für ihn zu kochen und seine Wäsche zu waschen und seine Fußböden zu wischen und trotzdem absolut nichts über ihn zu wissen. Der Carabiniere, der den Namen Caruso trug, widersprach ihrer Aussage nicht, denn sogar die Frau, die seit fünfundzwanzig Jahren das Bett mit ihm teilte, erschien ihm manchmal völlig fremd. Außerdem wusste er etwas mehr über das Opfer, als er sich der Zeugin gegenüber bisher hatte anmerken lassen. Dass der Mann ermordet wurde, war praktisch nur eine Frage der Zeit gewesen.
Trotzdem bestand Caruso auf einer detaillierten Aussage, die Sofia höchst bereitwillig lieferte. Ihr Tag hatte wie immer zu grässlich früher Stunde begonnen, als um fünf Uhr morgens ihr altmodischer Radiowecker losplärrte. Weil sie am Abend zuvor bis spät gearbeitet hatte – ihr Arbeitgeber hatte einen Gast gehabt –, hatte sie sich eine zusätzliche Viertelstunde Schlaf gegönnt, bevor sie aufgestanden war. Nachdem sie mit dem Kaffeebereiter von Bialetti Kaffee gemacht hatte, hatte sie geduscht, ihre schwarze Uniform angezogen und sich dabei gefragt, wie es kam, dass sie als attraktive 24-jährige Absolventin der angesehenen Universität Bologna nicht in einem eleganten Büroturm in Mailand, sondern als Dienstmädchen eines reichen Ausländers arbeitete.
Die Antwort war, dass die italienische Wirtschaft, angeblich die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt, unter chronisch hoher Arbeitslosigkeit litt, sodass viele gut ausgebildete junge Leute ins Ausland gehen mussten, um Arbeit zu finden. Sofia war jedoch entschlossen, in ihrer Heimat Kampanien zu bleiben, auch wenn sie dafür eine Stellung annehmen musste, für die sie lächerlich überqualifiziert war. Der reiche Ausländer entlohnte sie gut – tatsächlich verdiente sie mehr als viele ihrer Kommilitonen –, und ihre Arbeit war nicht gerade anstrengend. Meist verbrachte sie einen großen Teil des Tages damit, übers blaugrüne Tyrrhenische Meer hinauszublicken oder die grandiose Gemäldesammlung ihres Arbeitgebers zu betrachten.
Ihr winziges Apartment lag in einem alten Haus in der Via delle Cartiere l im oberen Teil der Stadt Amalfi. Von dort aus führte ein nach Zitronen duftender Weg in zwanzig Minuten zu dem großspurig bezeichneten Palazzo Van Damme. Wie die meisten Strandvillen an der Amalfiküste war er von einer hohen Mauer umgeben. Das massive Tor glitt zur Seite, als Sofia den sechsstelligen Code auf einem Tastenfeld eingab. An der Haustür der Villa gab es ein weiteres Tastenfeld mit einem eigenen Code. Normalerweise ließ die Alarmanlage einen schrillen Pfiff hören, wenn sie die Haustür öffnete, aber an diesem Morgen blieb sie stumm. Allerdings dachte sie sich nicht viel dabei. Signor van Damme vergaß manchmal, die Alarmanlage scharf zu stellen, bevor er ins Bett ging.
Sofia ging direkt in die Küche und begann, Signor van Dammes Frühstück vorzubereiten, was jeden Morgen ihre erste Arbeit war: eine Kanne Kaffee, ein Kännchen aufgeschäumte Milch, eine Zuckerdose und Toast mit Butter und Erdbeerkonfitüre. Sofia stellte alles auf ein Tablett, das sie um Punkt sieben Uhr auf dem Tischchen neben seiner Schlafzimmertür abstellte. Nein, erklärte sie dem Carabiniere, sie sei nicht hineingegangen. Sie habe auch nicht angeklopft. Diesen Fehler habe sie nur einmal gemacht. Signor van Damme war ein Pedant, der auf präziser Befolgung seiner Anweisungen bestand. Überflüssiges Anklopfen war verpönt, vor allem an seiner Schlafzimmertür.
Das war nur eine der vielen Regeln und Anweisungen, die er Sofia nach dem einstündigen Vorstellungsgespräch in seinem prachtvollen Arbeitszimmer erläutert hatte. Nach eigener Aussage war er ein erfolgreicher Businessman, den er als Beezneezman aussprach. Der Palazzo, sagte er, sei seine Privatresidenz und zugleich das Nervenzentrum eines weltweit agierenden Konzerns. Deshalb brauche er einen reibungslos funktionierenden Haushalt ohne unnötigen Lärm und Störungen sowie Loyalität und Diskretion von allen, die für ihn arbeiteten. Klatsch über seine Angelegenheiten oder die Kunstschätze in der Villa war Grund für eine fristlose Entlassung.
Sofia bekam bald heraus, dass ihrem Arbeitgeber die Reederei LVD Marine Transport mit Sitz auf den Bahamas gehörte – wobei LVD ein Akronym seines Namens Lukas van Damme war. Sie wusste auch, dass er Südafrikaner war, der seine Heimat nach der Abschaffung der Apartheid verlassen hatte. Es gab eine Tochter in London, eine Ex-Frau in Toronto und eine Brasilianerin namens Serafina, die ihn von Zeit zu Zeit besuchte. Ansonsten schien er frei von menschlichen Bindungen zu sein. Seine Gemälde, die alle Zimmer und Korridore des Palazzos schmückten, waren das Einzige, woran sein Herz hing. Daher die Kameras und die Bewegungsmelder und die nervenaufreibenden wöchentlichen Tests der Alarmanlage und die strikten Regeln, was Klatsch und unerwünschte Störungen betraf.
Die Unverletzlichkeit seines Arbeitszimmers hatte oberste Priorität. Sofia durfte den Raum nur betreten, wenn Signor van Damme anwesend war. Und sie durfte seine Tür niemals öffnen, wenn sie geschlossen war. Gegen dieses Gebot hatte sie nur einmal verstoßen, allerdings nicht durch eigene Schuld. Das war vor einem halben Jahr passiert, als ein Südafrikaner hier zu Gast gewesen war. Signor van Damme hatte sie gebeten, einen Imbiss ins Büro zu bringen, und als Sofia damit gekommen war, hatte die Tür weit offen gestanden. Bei dieser Gelegenheit hatte sie die Existenz einer hinter beweglichen Bücherregalen versteckten Geheimkammer entdeckt. Ein Tresorraum, in dem Signor van Damme und sein Freund aus Südafrika sichtbar aufgeregt in ihrer seltsamen Muttersprache diskutierten.
Sofia erzählte niemandem, was sie an diesem Tag gesehen hatte – vor allem nicht Signor van Damme. Sie begann jedoch mit privaten Ermittlungen gegen ihren Arbeitgeber, die sie vor allem aus dem Inneren seiner Festung am Meer führte. Aus den durch heimliche Beobachtung der Zielperson gesammelten Indizien zog Sofia folgende Schlüsse: Lukas van Damme war nicht der erfolgreiche Geschäftsmann, als der er sich ausgab, seine Reederei machte zweifelhafte Geschäfte, sein Geld war schmutzig, er hatte Verbindungen zur italienischen Organisierten Kriminalität und war bemüht, irgendein dunkles Geheimnis in seiner Vergangenheit zu verbergen.
Weniger verdächtig erschien Sofia die Frau, die am Abend zuvor in die Villa gekommen war – eine attraktive Mittdreißigerin mit rabenschwarzem Haar, die Signor van Damme eines Nachmittags in der Terrassenbar des Hotels Santa Catarina kennengelernt hatte. Er hatte sie durch seine Gemäldesammlung geführt, was sehr selten vorkam. Danach hatten sie bei Kerzenschein auf der Terrasse mit Meeresblick diniert. Sie saßen noch bei einem Glas Wein, als Sofia und das übrige Hauspersonal die Villa um 22.30 Uhr verließen. Sofia vermutete die Frau jetzt oben in Signor van Dammes Bett.
Die Überreste ihres Dinners – Porzellan, Besteck, rötlich verfärbte Weingläser, Servietten – hatten die beiden draußen auf dem Terrassentisch zurückgelassen. Keines der Gläser wies Lippenstiftspuren auf, was Sofia ungewöhnlich fand. Das einzig Auffällige im Erdgeschoss der Villa war eine nicht geschlossene Tür. Allerdings tippte Sofia auf Signor van Damme als den Schuldigen.
Sie spülte das Geschirr, trocknete es sorgfältig ab – jeder Wasserfleck wurde scharf getadelt – und ging um Punkt acht Uhr nach oben, um das Frühstückstablett von dem Tischchen neben Signor van Dammes Schlafzimmertür zu holen. Dabei sah sie, dass es nicht angerührt war. Nicht sein übliches Verhalten, erzählte sie dem Carabiniere, aber auch nicht ganz und gar ungewöhnlich.
Aber als das Tablett um neun Uhr noch immer nicht angerührt war, fing Sofia an, sich Sorgen zu machen. Und als es ohne ein Lebenszeichen von Signor van Damme zehn Uhr wurde, verwandelte ihre Besorgnis sich in Angst um ihn. Inzwischen waren zwei weitere Hausangestellte eingetroffen: Marco Mazzetti, seit vielen Jahren als Koch im Haus, und Gaspare Bianchi, der Gärtner und Pförtner. Beide waren sich einig: Dass Signor van Damme nicht zur gewohnten Zeit aufgestanden war, sei sicher auf die attraktive junge Frau zurückzuführen, mit der er am Abend zuvor diniert habe. Deshalb rieten sie als Männer dazu, auf jeden Fall noch bis Mittag zu warten.
Und so machte Sofia Ravello, vierundzwanzig, Absolventin der Universität Bologna, sich wie jeden Tag mit Mopp und Eimer auf, um die Fußböden der Villa zu wischen – eine Arbeit, bei der sie Gelegenheit hatte, die Gemälde und anderen Kunstgegenstände von Signor van Dammes bemerkenswerter Sammlung zu kontrollieren. Tatsächlich war nichts derangiert, nichts fehlte, nichts wirkte im Geringsten verdächtig.
Nichts außer dem unberührten Tablett auf dem Tischchen neben der Schlafzimmertür.
Mittags stand es noch da. Sofias erstes Klopfen war zögerlich und blieb unbeantwortet. Ihr zweites, diesmal mit der Faust gegen das Holz, war ebenso erfolglos. Zuletzt legte sie eine Hand auf die Klinke und öffnete langsam die Tür. Die Polizei anzurufen, war überflüssig. Ihr Schrei, sagte Marco Mazzetti später, sei von Salerno bis Positano zu hören gewesen.
2
CANNAREGIO
»Wo bist du?«
»Wenn ich mich nicht irre, sitze ich mit meiner Frau auf dem Campo di Ghetto Nuovo.«
»Nicht körperlich, Darling.« Sie legte einen Finger auf seine Stirn. »Hier.«
»Ich denke nach.«
»Worüber?«
»Nichts Bestimmtes.«
»Das ist unmöglich.«
»Wie kommst du bloß auf diese Idee?«
Dies war eine besondere Fähigkeit, die Gabriel schon in frühester Jugend zur Perfektion entwickelt hatte: die Gabe, alle Gedanken und Erinnerungen abzuschalten, um ein privates Universum ohne Licht oder Geräusche oder andere Personen zu erschaffen. Dort, in der Leere seines Unterbewusstseins, stellte er Gemälde fertig, die er im Kopf hatte: glänzend in ihrer Ausführung, revolutionär in ihrer Themenwahl und gänzlich frei von dem dominierenden Einfluss seiner Mutter. Dann brauchte er nur noch aus seiner Trance zu erwachen und die Bilder rasch auf Leinwand zu übertragen, bevor sie verloren gingen. In letzter Zeit hatte er die Fähigkeit zurückgewonnen, seinen Verstand von störendem Ballast zu befreien – und damit die Gabe, befriedigende Originale zu malen. Chiaras Körper mit seinen vielen Kurven und Facetten war sein bevorzugtes Motiv.
In diesem Augenblick war er eng an seinen gepresst. Der Nachmittag war kalt geworden, und ein böiger Wind pfiff um die Randbebauung des Campo. Gabriel trug erstmals seit vielen Monaten wieder einen Wollmantel. Chiaras stylische Wildlederjacke und ihr Chenilleschal waren für dieses Wetter nicht warm genug.
»Trotzdem musst du über irgendetwas nachgedacht haben«, drängte sie.
»Ich sollte’s vermutlich nicht laut sagen. Die Alten erholen sich vielleicht nie mehr.«
Die Bank, auf der sie saßen, war nur wenige Schritte vom Eingang der Casa Israelitica di Riposo entfernt, einem Seniorenheim für die dahinschwindende jüdische Gemeinde Venedigs.
»Unsere zukünftige Adresse«, bemerkte Chiara und fuhr mit einer Zeigefingerspitze durch das silberne Haar an Gabriels Schläfen. So lang hatte er’s seit vielen Jahren nicht mehr getragen. »Für manche von uns früher als für andere.«
»Besuchst du mich?«
»Jeden Tag.«
»Und was ist mit ihnen?«
Gabriel sah zur Mitte des weiten Platzes hinüber, wo Irene und Raphael sich mit einigen anderen Kindern aus dem Sestiere eine spielerische Art Wettkampf lieferten. Die Wohngebäude hinter ihnen, die höchsten Venedigs, leuchteten im Licht der untergehenden Sonne sienabraun.
»Worum geht es um Himmels willen bei diesem Spiel?«
»Das habe ich mich auch schon gefragt.«
Eine wichtige Rolle bei diesem Wettkampf spielten ein Ball und der alte Brunnen des Campo, aber nach welchen Regeln gespielt und wie Punkte vergeben wurden, war für Unbeteiligte nicht erkennbar. Im Augenblick schien Irene einen kleinen Vorsprung zu haben, obwohl ihr Zwillingsbruder seine Mitspieler zu einem energischen Gegenangriff organisiert hatte. Der Junge hatte Gabriels Gesichtszüge und seine unnatürlich grünen Augen geerbt. Er war mathematisch außerordentlich begabt und bekam seit Kurzem Unterricht von einem Privatlehrer. Die Klimaaktivistin Irene, die befürchtete, Venedig werde bald im Meer versinken, hatte beschlossen, Raphael solle seine Fähigkeiten dafür gebrauchen, die Welt zu retten. Sie selbst hatte noch keine Berufswahl getroffen. Vorläufig hatte sie den größten Spaß daran, ihren Vater zu piesacken.
Nach einem Fehlschuss rollte der Ball auf den Eingang des Seniorenheims zu. Gabriel sprang auf, stoppte ihn und beförderte ihn mit dem linken Fuß geschickt ins Spiel zurück. Nachdem er den matten Applaus des schwer bewaffneten Carabiniere, der das Heim bewachte, mit einem Nicken quittiert hatte, wandte er sich den sieben Basreliefs des Holocaustdenkmals im Ghetto zu. Es erinnerte an die 243 venezianischen Juden – darunter 29 Bewohner des Altenheims –, die im Dezember 1943 verhaftet, in Konzentrationslagern interniert und später nach Auschwitz deportiert worden waren. Unter ihnen auch Adolfo Ottolenghi, der Oberrabbiner von Venedig, der im September 1944 ermordet worden war.
Das heutige Oberhaupt der jüdischen Gemeinde, Rabbi Jacob Zolli, stammte von sephardischen Juden ab, die im Jahr 1492 aus Andalusien vertrieben worden waren. Seine Tochter saß in diesem Augenblick auf einer Bank auf dem Campo di Ghetto Nuovo und beobachtete ihre spielenden Kinder. Wie der berühmte Schwiegersohn des Rabbis war sie eine ehemalige Agentin des israelischen Geheimdiensts. Gegenwärtig war sie Geschäftsführerin ihrer Tiepolo Restauration Company, dem prominentesten Fachbetrieb dieser Art im Veneto. Gabriel, ein Restaurator von Weltruf, leitete die Abteilung Gemälderestaurierung. Das bedeutete, dass er im Grunde genommen ein Angestellter seiner Frau war.
»Woran denkst du jetzt?«, fragte sie.
Er fragte sich, übrigens nicht zum ersten Mal, ob seine Mutter in jenem schrecklichen Herbst des Jahres 1943 bemerkt hatte, dass mehrere Tausend italienische Juden in Auschwitz angekommen waren. Wie viele Überlebende der Lager hatte sie sich geweigert, über die albtraumhafte Welt zu sprechen, in die sie gestoßen worden war. Stattdessen hatte sie ihre Erinnerungen auf mehreren Seiten Florpost niedergeschrieben und im Archiv der Gedenkstätte Jad Waschem deponiert. Von der Vergangenheit gepeinigt – und unter hartnäckigen Schuldgefühlen leidend, weil sie überlebt hatte –, war sie außerstande gewesen, ihr einziges Kind wirklich zu lieben, weil sie fürchtete, es könnte ihr genommen werden. Sie hatte ihm ihr künstlerisches Talent, ihren Berliner Akzent im Deutschen und vielleicht ein wenig von ihrem Mut vererbt. Und dann hatte sie ihn verlassen. Gabriels Erinnerungen an sie wurden von Jahr zu Jahr diffuser. Sie war eine vor einer Malerstaffelei stehende ferne Gestalt mit verbundenem linken Unterarm, die ihm ständig den Rücken zukehrte. Aus diesem Grund hatte Gabriel für kurze Zeit seine Frau und seine Kinder ignoriert: Er hatte erfolglos versucht, das Gesicht seiner Mutter zu sehen.
»Ich denke«, antwortete er mit einem Blick auf seine Uhr, »dass wir bald gehen sollten.«
»Und das Ende des Spiels verpassen? Kommt nicht infrage! Außerdem«, fügte Chiara hinzu, »beginnt das Konzert deiner Freundin erst um acht.«
Dabei handelte es sich um die jährliche festliche Gala der Venice Preservation Society, einer gemeinnützigen Gesellschaft mit Sitz in London, die sich dem Schutz und der Restaurierung der fragilen Kunstschätze und Bauwerke der Stadt verschrieben hatte. Gabriel hatte die berühmte Schweizer Geigerin Anna Rolfe, mit der er einmal eine kurze Affäre gehabt hatte, dazu bewogen, bei der Spendengala aufzutreten. Am Abend zuvor war sie Gast in dem Luxusapartment der Familie Allon im piano nobile eines Palazzos mit Blick auf den Canal Grande gewesen. Gabriel war nur froh, dass seine Frau, die wunderbares Essen gekocht und serviert hatte, wieder mit ihm sprach.
Als er zu der Bank zurückkam, sah sie mit einem Mona-Lisa-Lächeln geradeaus. »An diesem Punkt unseres Gesprächs«, sagte sie nüchtern, »musst du mich daran erinnern, dass die berühmteste Geigerin der Welt nicht mehr deine Freundin ist.«
»Das hielt ich für überflüssig.«
»Irrtum.«
»Sie ist’s nicht mehr.«
Ihr Daumennagel grub sich in seinen Handrücken. »Und du hast sie nie geliebt.«
»Niemals«, schwor Gabriel.
Chiara rieb jetzt sanft den halbmondförmigen Eindruck in seiner Haut. »Sie hat deine Kinder verhext. Irene hat mir heute Morgen anvertraut, dass sie Geige spielen lernen möchte.«
»Sie ist sehr charmant, unsere Anna.«
»Sie ist eine Chaotin.«
»Aber eine außergewöhnlich begabte.« Gabriel war nachmittags bei Annas Probe im Teatro La Fenice, dem größten Opernhaus Venedigs, gewesen. Er hatte sie noch nie so gut spielen gehört.
»Komisch«, sagte Chiara, »aber in Person ist sie nicht so hübsch wie auf den Hüllen ihrer CDs. Für Aufnahmen von älteren Frauen benutzen Fotografen spezielle Filter, glaube ich.«
»Das war deiner nicht würdig.«
»Das steht mir zu.« Chiara ließ einen dramatischen Seufzer hören. »Hat die Chaotin schon entschieden, was sie spielen will?«
»Schumanns Violinsonate Nummer 1 und das Violinkonzert in D-Dur von Brahms.«
»Das Brahms-Konzert hast du immer geliebt, vor allem den zweiten Satz.«
»Wer täte das nicht?«
»Bestimmt müssen wir uns als Zugabe wieder mal den Teufelstriller anhören.«
»Spielt sie ihn nicht, könnte’s Unruhen geben.«
Giuseppe Tartinis technisch anspruchsvolle Violinsonate in g-Moll, die Teufelstriller-Sonate, war Anna Rolfes Erkennungsmelodie.
»Eine titanische Sonate«, sagte Chiara. »Man kann sich gut vorstellen, wieso deine Freundin sich zu einem Stück dieser Art hingezogen fühlt.«
»Sie glaubt nicht an den Teufel. Übrigens glaubt sie auch Tartinis Geschichte nicht, er habe diese Sonate im Traum gehört.«
»Aber du leugnest nicht, dass sie deine Freundin ist.«
»Darüber habe ich mich ziemlich klar geäußert, denke ich.«
»Und du hast sie nie geliebt?«
»Das weißt du.«
Chiara lehnte den Kopf an Gabriels Schulter. »Und was ist mit dem Teufel?«
»Der ist nicht mein Typ.«
»Glaubst du, dass er existiert?«
»Wieso fragst du das?«
»Es könnte alles Böse auf unserer Welt erklären.«
Damit meinte sie natürlich den Krieg in der Ukraine, der nun schon seit acht Monaten wütete. Die heutigen Nachrichten waren wieder schrecklich gewesen. In Kiew waren weitere zivile Ziele von Raketen getroffen worden. In der Stadt Isjum waren Massengräber mit Hunderten von Leichen entdeckt worden.
»Männer vergewaltigen und stehlen und morden aus eigenem Antrieb«, sagte Gabriel, während er das Holocaustdenkmal betrachtete. »Und viele der schlimmsten Gräueltaten der Menschheitsgeschichte sind nicht etwa von Teufelsanbetern, sondern von Menschen mit starkem Glauben an Gott verübt worden.«
»Wie steht’s mit deinem?«
»Mit meinem Glauben?«, fragte Gabriel nur.
»Vielleicht solltest du mit meinem Vater reden.«
»Ich rede ständig mit deinem Vater.«
»Über unsere Arbeit und die Kinder und Sicherheitsmaßnahmen für Synagogen, aber nicht über Gott.«
»Nächstes Thema.«
»Worüber hast du vor ein paar Minuten nachgedacht?«
»Ich habe von deinen Fettuccine mit Pilzen geträumt.«
»Nein, im Ernst!«
Er beantwortete ihre Frage wahrheitsgemäß.
»Du weißt wirklich nicht mehr, wie sie ausgesehen hat?«
»Nur im Alter. Aber das war nicht sie.«
»Vielleicht kann ich dir einen Hinweis geben.«
Chiara stand auf, ging über den Platz und nahm Irene an der Hand. Kurze Zeit später saß die Kleine auf dem Knie ihres Vaters, schlang ihm die Arme um den Hals. »Was hast du?«, fragte sie mitfühlend, als er sich hastig eine Träne abwischte.
»Nichts«, antwortete er. »Gar nichts.«
3
SAN POLO
Als Irene ins Spiel zurückkehrte, war sie in der Wertung auf den dritten Platz zurückgefallen. Sie legte Protest dagegen ein, der jedoch wirkungslos blieb, und zog sich daraufhin an die Seitenlinie zurück, um zu beobachten, wie das Spiel in Streit und Chaos ausartete. Gabriel versuchte zu vermitteln, aber das gelang ihm nicht, weil die Konturen dieser Auseinandersetzung komplex wie der arabisch-israelische Konflikt waren. Weil er nicht gleich eine Lösung parat hatte, schlug er eine Fortsetzung des Wettkampfs am folgenden Tag vor – auch um zu vermeiden, dass die lärmende Auseinandersetzung die Heimbewohner störte. Alle Beteiligten waren einverstanden, und gegen halb fünf herrschte wieder Stille auf dem Campo di Ghetto Nuovo.
Irene und Raphael, beide mit Schulrucksäcken über einer Schulter, liefen über die hölzerne Brücke am Südrand des Platzes voraus, während Chiara und Gabriel langsamer folgten. Vor wenigen Jahrhunderten hätte ein christlicher Wachposten sie vermutlich nicht passieren lassen, weil der Abend herabsank und die Brücke nachts gesperrt sein würde. Jetzt schlenderten sie unbehelligt an Souvenirshops und beliebten Restaurants vorbei, bis sie einen kleineren Platz erreichten, an dem sich zwei Synagogen gegenüberstanden. Alessia Zolli, die Frau des Oberrabbiners, wartete am offenen Portal der Levantinischen Synagoge, die der Gemeinde im Winter diente. Die Kinder umarmten sie, als hätten sie ihre Großmutter seit vielen Monaten statt seit drei Tagen nicht mehr gesehen.
»Bitte denk daran«, sagte Chiara zu ihrer Mutter, »dass sie morgen früh um acht in der Schule sein müssen.«
»Wo ist ihre Schule denn?«, fragte Alessia verschmitzt lächelnd. »Hier in Venedig oder irgendwo drüben auf dem Festland?« Sie starrte Gabriel vorwurfsvoll an. »Dass sie sich so benimmt, ist deine Schuld.«
»Was habe ich jetzt wieder gemacht?«
»Das möchte ich lieber nicht laut sagen.« Alessia Zolli streichelte die dunkle Mähne ihrer Tochter. »Dieses arme Ding hat schon genug durchgemacht.«
»Meine Leidenszeit hat erst begonnen, fürchte ich.«
Chiara küsste die Kinder zum Abschied und machte sich mit Gabriel auf den Weg zu den Fondamenta Cannaregio. Auf ihrem Weg über den Ponte delle Guglie wurden sie sich einig, dass eine leichte Zwischenmahlzeit angezeigt sei. Erst nach dem Konzert, das bis ungefähr 22 Uhr dauern würde, sollte im Cipriani ein festliches Dinner mit dem Direktor der Venice Preservation Society und mehreren Großspendern stattfinden. Chiara hatte vor Kurzem Gebote für mehrere lukrative Projekte der Gesellschaft abgegeben. Deshalb musste sie an dem Dinner teilnehmen, auch wenn das bedeutete, dass sie die Gegenwart der ehemaligen Geliebten ihres Mannes noch länger ertragen musste.
»Wohin sollen wir gehen?«, fragte sie.
Gabriels Lieblingslokal in Venedig war das All’Arco, das aber in der Nähe des Rialto-Fischmarkts lag. Dafür reichte die Zeit nicht mehr. »Wie wär’s mit dem Adagio?«, schlug er vor.
»Ein höchst unglücklicher Name für eine Weinbar, findest du nicht auch?«
Das Adagio lag am Campo dei Frari fast am Fuß des Campanile. Gabriel bestellte zwei Gläser lombardischen Wein und einen Teller Cicchetti. Nach hiesigem Brauch hätten sie die leckeren kleinen Sandwiches stehend verzehren müssen, aber Chiara schlug vor, sich an einen der Tische im Freien zu setzen. Der Gast vor ihnen hatte ein Exemplar von Il Gazzettino liegen lassen. Es war voller Fotos von den Reichen und Prominenten, darunter auch Anna Rolfe.
»Seit Monaten mein erster Abend allein mit meinem Mann«, sagte Chiara und faltete die Zeitung zusammen, »und ich darf ihn ausgerechnet mit ihr verbringen.«
»War es wirklich nötig, meine Position bei deiner Mutter weiter zu unterminieren?«
»Meine Mutter glaubt, dass du auf dem Wasser wandelst.«
»Aber nur bei Acqua alta.«
Gabriel verschlang ein dick mit Artischockenherzen und Ricotta belegtes Cicchetto und spülte es mit einem Schluck Weißwein hinunter. Dies war heute sein zweites Glas. Wie die meisten Venezianer hatte er vormittags zum Kaffee un’ombra getrunken. In den letzten zwei Wochen war er Gast in einer Bar in Murano gewesen, wo er ein Altargemälde eines als Il Pordenone bekannten Malers aus der Venezianischen Schule restaurierte. In seiner Freizeit arbeitete er an zwei Privataufträgen, weil das karge Gehalt, das seine Frau ihm zahlte, nicht für seinen gewohnten Lebensstil ausreichte.
Chiara begutachtete die Cicchetti, konnte sich nicht zwischen Lachs und geräucherter Makrele entscheiden. Beide lagen auf cremigem Frischkäse und waren mit gehackten frischen Kräutern bestreut. Gabriel nahm ihr die Entscheidung ab, indem er sich die Makrele schnappte. Sie passte wunderbar zu dem trockenen lombardischen Wein.
»Den wollte ich«, sagte Chiara schmollend und nahm sich den Lachs. »Hast du dir schon überlegt, wie du reagieren willst, wenn dich heute Abend jemand fragt, ob du der Gabriel Allon bist?«
»Das lässt sich hoffentlich ganz vermeiden.«
»Wie?«
»Indem ich wie üblich abweisend unnahbar bin.«
»Das ist keine Option, fürchte ich, Darling. Bei diesem geselligen Anlass musst auch du gesellig sein.«
»Ich bin ein Bilderstürmer. Ich mache mir nichts aus Konventionen.«
Außerdem war er der berühmteste pensionierte Spion der Welt. Mit Billigung der italienischen Sicherheitsbehörden – und mit dem Einverständnis wichtiger Leute aus dem hiesigen kulturellen Establishment – hatte er sich in Venedig niedergelassen, aber von seiner Übersiedlung wussten nur wenige. Die meiste Zeit lebte er in der Grauzone zwischen der öffentlichen und der geheimen Welt. Er trug eine Pistole, für die er eine Genehmigung hatte, und besaß zwei gefälschte deutsche Pässe, um notfalls unter falschem Namen reisen zu können. Alle übrigen Relikte seines früheren Lebens hatte er abgelegt. Die heutige Gala würde mit allen Vor- und Nachteilen seine Coming-out-Party sein.
»Keine Sorge«, sagte er. »Ich werde sehr charmant sein.«
»Und wenn jemand fragt, woher du Anna Rolfe kennst?«
»Dann täusche ich einen Hörsturz vor und verschwinde auf die Toilette.«
»Ausgezeichnete Strategie. Aber Operationsplanung war schon immer deine Stärke.« Chiara schob ihm das letzte Cicchetto hin. »Das musst du essen. Sonst passe ich nicht in mein Kleid.«
»Giorgio?«
»Versace.«
»Wie gewagt ist’s?«
»Skandalträchtig.«
»Das ist eine Möglichkeit, Geld für unsere Projekte aufzutreiben.«
»Glaub mir, ich trage es nicht für die Förderer.«
»Du bist die Tochter eines Rabbis.«
»Mit noch immer guter Figur.«
»Das kannst du laut sagen«, sagte Gabriel und aß das letzte Cicchetto.
Vom Campo dei Frari war es ein angenehmer Zehn-Minuten-Spaziergang zu ihrem Apartment. In dem zum Elternschlafzimmer gehörenden Bad duschte Gabriel rasch, bevor er seine Erscheinung im Spiegel über dem Waschbecken begutachtete. Er fand sie befriedigend, auch wenn die runde hervortretende Narbe auf der linken Brust sein Aussehen etwas verdarb. Sie war ungefähr halb so groß wie die entsprechende Narbe unter seinem linken Schulterblatt. Seine beiden anderen Schusswunden waren so glatt verheilt wie die alte Bisswunde von einem Schäferhund in seinem linken Unterarm. Leider konnte er das von seinen beiden gebrochenen Lendenwirbeln nicht sagen.
Wegen der Aussicht auf ein zweistündiges Konzert, an das sich ein Galadiner anschließen würde, schluckte er eine prophylaktische Dosis Advil, bevor er ins Ankleidezimmer hinüberging. Dort hing sein Smoking von Brioni, den er vor Kurzem gekauft hatte, für ihn bereit. Sein Schneider hatte es nicht ungewöhnlich gefunden, dass er einen etwas weiteren Hosenbund wollte; alle seine Hosen waren dafür eingerichtet, eine verdeckte Waffe aufnehmen zu können. Am liebsten war ihm seine Beretta 92FS, eine 9-mm-Pistole, die mit vollem Magazin fast ein Kilo wog.
Als Gabriel angezogen war, steckte er die Pistole hinten in den Hosenbund. Dann drehte er sich etwas zur Seite, um sich erneut zu begutachten. Auch diesmal war er mit dem zufrieden, was er sah. Das elegant geschnittene Smokingjackett machte die Waffe unter dem Stoff unsichtbar. Und der moderne doppelte Rückenschlitz würde ihm helfen, blitzschnell zu ziehen, was er trotz seiner vielen vernarbten Wunden noch immer beherrschte.
Mit seiner Patek Philippe am Handgelenk machte er das Licht aus und ging ins Wohnzimmer hinüber, um auf das Erscheinen seiner Frau zu warten. Ja, dachte er, als er den weiten Blick über den Canal Grande genoss, ich bin der Gabriel Allon. Einst war er der Racheengel Israels gewesen. Jetzt war er Direktor der Abteilung Gemälderestaurierung der Tiepolo Restauration Company. Anna war eine Frau, die einmal seinen Weg gekreuzt hatte. Ehrlich gesagt hatte er versucht, sie zu lieben, aber das hatte er nicht gekonnt. Dann hatte er ein schönes Mädchen aus dem Ghetto kennengelernt, und dieses Mädchen hatte ihm das Leben gerettet.
Trotz des hohen Beinschlitzes war Chiaras schulterfreies schwarzes Abendkleid von Versace keineswegs skandalträchtig. Ihre High Heels von Ferragamo waren jedoch ganz entschieden ein Problem. Die Stilettos machten ihre ohnehin schon stattliche Erscheinung um begehrenswerte zehneinhalb Zentimeter größer. Als sie sich der Fotografenmeute vor dem Teatro La Fenice näherten, blickte sie kurz auf Gabriel hinab.
»Bist du dem auch wirklich gewachsen?«, fragte sie leicht angestrengt lächelnd.
»Schlimmer wird’s wohl nicht werden«, antwortete er, als das Blitzlichtgewitter ihn blendete.
Sie blieben kurz unter der blau-gelben ukrainischen Fahne stehen, die vom Säulenvordach des Opernhauses herabhing, und betraten dann das Foyer mit seinem vielsprachigen Lärm. Einige Leute sahen ihnen nach, aber auf Gabriel achtete niemand sonderlich. Zumindest vorläufig war er nur ein älterer Mann unbestimmter Nationalität mit einer schönen jungen Frau am Arm.
Chiara drückte aufmunternd seine Hand. »Das war nicht so schlimm, nicht wahr?«
»Die Nacht ist noch jung«, murmelte Gabriel und betrachtete die glänzende Gesellschaft um sie herum. Verblasste Aristokraten, Banker, Großindustrielle und einige der wichtigsten Altmeistergaleristen. Der rundliche Oliver Dimbleby, der keine gute Party ausließ, war eigens mit dem Flugzeug aus London gekommen. Im Augenblick tröstete er einen bekannten französischen Sammler, der bei dem jüngsten Fälscherskandal um Phillip Somerset und seinen Kunstfonds Masterpiece Art Ventures schrecklich hatte Federn lassen müssen.
»Wusstest du, dass er kommt?«, fragte Chiara.
»Oliver? Einer meiner Informanten in der Londoner Kunstszene hat mich vorgewarnt. Angeblich ist Oliver wild entschlossen, uns heute Abend zu meiden.«
»Und wenn er sich nicht beherrschen kann?«
»Dann stellst du dir vor, er habe Lepra, und gehst schleunigst weg.«
Ein Journalist sprach Oliver an und bat ihn um einen Kommentar – der Teufel mochte wissen, zu welchem Thema. Mehrere andere Journalisten umringten Lorena Rinaldi, die Kultusministerin der neuen italienischen Regierungskoalition. Wie ihr Ministerpräsident gehörte Rinaldo einer Partei der äußersten Rechten an, die ihre Wurzeln in der Nationalen Faschistischen Partei Benito Mussolinis hatte.
»Wenigstens trägt sie nicht ihre Armbinde«, sagte eine Männerstimme halb links hinter Gabriel. Sie gehörte Francesco Tiepolo, dem Inhaber der prominenten Restaurierungsfirma, die seinen berühmten Familiennamen trug. »Wollte Gott, sie hätte genug Anstand, um ihr fotogenes Gesicht nicht auch bei dieser Veranstaltung zu zeigen.«
»Anscheinend ist sie eine große Bewunderin von Anna Rolfe.«
»Wer ist das nicht?«
»Ich«, sagte Chiara.
Francesco grinste nur. Er war ein Bär von einem Mann, der Luciano Pavarotti fast unheimlich ähnlich sah. Noch jetzt, fünfzehn Jahre nach dem Tod des großen Tenors, hielten Touristen ihn in Venedig auf der Straße an, um ein Autogramm zu erbitten. Fühlte er sich spitzbübisch, was meistens der Fall war, tat er ihnen den Gefallen.
»Habt ihr gestern Abend das Interview gesehen, das die Ministerin im RAI gegeben hat? Sie hat versprochen, den ›Wokeismus‹ aus dem italienischen Kulturleben zu tilgen. Ich weiß echt nicht, was sie damit gemeint hat.«
»Sie vermutlich auch nicht«, sagte Gabriel. »Das war nur ein Schlagwort, das sie auf ihrer letzten Amerikareise aufgeschnappt hat.«
»Vielleicht sollten wir die Gelegenheit nutzen, ihr unsere Aufwartung zu machen.«
»Warum zum Teufel sollten wir das tun?«
»Weil Lorena Rinaldi in absehbarer Zukunft über alle großen Restaurierungsprojekte in Venedig entscheiden wird – unabhängig davon, wer die Kosten trägt.«
Im nächsten Augenblick wurde das Licht im Foyer gedimmt, während ein Glockenakkord ertönte. »Vom Gong gerettet«, sagte Gabriel und begleitete Chiara in den Saal. Sie schaffte es, ihr Missfallen zu verbergen, als sich zeigte, dass sie Ehrenplätze in der ersten Reihe hatten.
»Wundervoll«, sagte sie. »Nur schade, dass wir nicht noch näher an der Bühne dran sind.«
Gabriel nahm neben ihr Platz, rückte die Beretta in seinem Hosenbund etwas zurecht. Dann sagte er: »Bisher hat alles ganz gut geklappt, findest du nicht auch?«
»Die Nacht ist noch jung«, antwortete Chiara und drückte einen Daumennagel in seinen Handrücken.
4
CIPRIANI
Der Schumann war wundervoll, der Brahms nachdenklich schön. Aber erst Annas feurige Interpretation von Tartinis Teufelstriller riss das Publikum zu stehenden Ovationen hin. Nachdem sie noch dreimal unter großem Jubel auf die Bühne gekommen war, war das Konzert ohne weitere Zugabe zu Ende. Die meisten Zuhörer traten auf den Corte San Gaetano hinaus, aber einige Auserwählte wurden diskret zur Anlegestelle der Oper geleitet, wo mehrere elegante Motoscafi darauf warteten, sie zum Hotel Cipriani zu bringen. Niemand schien den berühmten pensionierten Spion in ihrer Mitte zu erkennen. Das galt auch für die mit einem Schreibbrett bewaffnete Hostess im Oro, dem berühmten Restaurant des Hotels.
»Ah, da habe ich Sie, Signor Allon. Tisch Nummer fünf. Signora Zolli sitzt an Tisch eins – dem Prominententisch«, fügte sie lächelnd hinzu.
»Das kommt daher, dass Signora Zolli weit bedeutender ist als ich.«
Die Hostess ließ sie passieren, und Gabriel folgte Chiara hinein. »Bitte sag mir, dass ich nicht neben ihr sitze«, murmelte Chiara.
»Neben der Ministerin? Die musste noch zu einer Bücherverbrennung, glaube ich.«
»Neben Anna, meine ich.«
»Sei trotzdem nett«, sagte Gabriel und machte sich auf die Suche nach seinem Tisch. Dort saßen schon die vier New Yorker aus seinem Wassertaxi. Sie waren Außenseiter, diese Amerikaner. Die übrigen Gäste waren mehrheitlich Briten.
Gabriel nahm seinen Platz ein und widerstand der Versuchung, die Tischkarte mit seinem Namen verschwinden zu lassen.
»Entschuldigung, aber ich habe Ihren Namen vorhin nicht mitbekommen«, sagte einer der Amerikaner, ein bulliger Rothaariger Mitte sechzig, der aussah, als äße er zu viel rotes Fleisch.
»Gabriel Allon.«
»Klingt bekannt. Was machen Sie beruflich?«
»Ich bin Konservator.«
»Wirklich? Ich habe befürchtet, ich würde hier der einzige sein.«
»Konservator«, wiederholte Gabriel, indem er die beiden letzten Silben betonte. »Ich restauriere Kunstwerke.«
»Haben Sie in letzter Zeit etwas restauriert?«
»Vor einigen Monaten habe ich an einem der Tintorettos in der Kirche der Madonna dell’Orto gearbeitet.«
»Ich glaube, ich habe dieses ganze Projekt finanziert.«
»Das glauben Sie?«
»Venedig zu retten, ist das Hobby meiner Frau. Ich finde Kunst ehrlich gesagt scheißlangweilig.«
Gabriel warf einen Blick auf die Tischkarte rechts neben seinem Platz und sah zu seiner Erleichterung, dass er neben der Erbin einer britischen Supermarktkette sitzen würde, die – so hatte die Boulevardpresse berichtet – vor Kurzem versucht haben sollte, ihren untreuen Ehemann mit einem Fleischermesser zu ermorden. Seltsamerweise trug die Karte links neben ihm keinen Namen.
Als er den Kopf hob, sah er die Erbin, eine attraktive Fünfzigerin in einem auffälligen roten Kleid, auf seinen Tisch zukommen. Ihr maskenhaft starres Botoxgesicht ließ keine Überraschung – oder sonst irgendeine Gefühlsregung – erkennen, als er sich ihr vorstellte.
»Lassen Sie mich eines festhalten«, sagte sie. »Es war nur ein Ausbeinmesser. Und die kleine Wunde musste nicht mal genäht werden.« Sie nahm lächelnd Platz. »Wie geht es Ihnen, Mr. Allon? Und was machen Sie um Himmels willen hier?«
»Er ist Konservator«, warf der Amerikaner ein. »Er hat einen der Tintorettos in der Kirche Madonna dell’Orto restauriert. Meine Frau und ich haben dafür bezahlt.«
»Und wir sind Ihnen alle sehr dankbar«, flötete die Erbin. Sie wandte sich wieder Gabriel zu. »Wen muss ich hier ermorden, um einen Beefeater mit Tonic zu bekommen?«
Gabriel wollte antworten, verstummte dann aber, als an den Nachbartischen applaudiert wurde.
»Ah, die bezaubernde Madame Rolfe«, sagte die Erbin. »Sie ist total verrückt. Zumindest sagen das die Leute.«
Gabriel kommentierte ihre Bemerkung lieber nicht.
»Ihre Mutter hat Selbstmord verübt, wissen Sie. Und ihr Vater war in einen schrecklichen Skandal wegen von den Nazis im Krieg geraubten Kunstwerken verwickelt. Danach ist Annas Leben irgendwie entgleist. Wie viele gescheiterte Ehen hat sie hinter sich? Drei? Oder waren es vier?«
»Zwei, glaube ich.«
»Den Unfall nicht zu vergessen, der ihrer Karriere fast den Rest gegeben hätte«, fuhr die Erbin unbeirrt fort. »An die Einzelheiten kann ich mich leider nicht erinnern.«
»Auf einer Wanderung in der Nähe ihrer Vila an der Costa de Prata ist sie von einem durch starke Regenfälle ausgelösten Erdrutsch erfasst worden. Ein Felsbrocken hat ihr die linke Hand zerquetscht. Sie war viele Monate lang in Behandlung, bis sie wieder spielen konnte.«
»Das klingt ganz danach, als seien Sie ein Bewunderer, Mr. Allon.«
»Das kann man wohl sagen.«
»Bitte entschuldigen Sie. Ich habe hoffentlich nichts Unpassendes gesagt.«
»Oh nein«, sagte Gabriel. »Ich hatte nie die Ehre, sie persönlich kennenzulernen.«
Wo Anna sitzen würde, war nicht gleich klar. Die acht Plätze am Promitisch waren schon vergeben. Das galt auch für alle übrigen Plätze – mit einer einzigen Ausnahme.
Nein, dachte Gabriel, während er die leere Tischkarte betrachtete. Das würde sie sich nicht trauen.
»Sieh mal an«, sagte die Erbin, als die berühmteste Geigerin der Welt auf ihren Tisch zukam. »Heute scheint Ihr Glückstag zu sein.«
»Sieht so aus«, antwortete Gabriel und stand langsam auf.
Anna drückte seine ausgestreckte Hand, als sei er ein Fremder, lächelte aber schelmisch, als sie seinen Namen wiederholte. »Doch nicht der Gabriel Allon?«, fragte sie, als sie sich setzte.
»Wie hast du das hingekriegt?«
»Ich habe mein übliches exorbitantes Honorar gegen das Recht eingetauscht, die Sitzordnung fürs heutige Galadiner nach dem Konzert bestimmen zu dürfen.« Sie bedachte einen Förderer am Nebentisch mit einem allzu strahlenden Lächeln. »Gott, wie ich diese Abende hasse! Ich frage mich, warum ich überhaupt gekommen bin.«
»Weil du der Versuchung, mir vor meiner Haustür Probleme zu bereiten, nicht widerstehen konntest.«
»Glaub mir, meine Absichten waren völlig ehrbar.«
»Waren sie das wirklich?«
»Überwiegend.« Anna betrachtete zweifelnd, was auf dem Teller lag, den ein Ober in weißem Jackett ihr serviert hatte. »Um Himmels willen, was ist das?«
»Tintenfisch«, sagte Gabriel. »Eine hiesige Spezialität.«
»Nach meinem letzten Fisch aus der Lagune war ich eine Woche lang gelähmt.«
»Er schmeckt köstlich.«
»Dann muss ich wohl mit den Wölfen heulen«, sagte Anna und kostete davon. »Wie viel Geld haben wir heute Abend eingenommen?«
»Fast zehn Millionen. Aber wenn du mit dem reichen Amerikaner mir gegenüber flirtest, sind auch zwanzig Millionen drin.«
Im Moment starrte der reiche Amerikaner mit großen Augen auf sein Handy.
»Weiß er, wer du bist?«, fragte Anna.
»Ich denke, dass er’s jetzt weiß.«
»Was er wohl denkt?«
»Wieso sitzt der pensionierte israelische Geheimdienstchef ausgerechnet neben Anna Rolfe?«
»Sollen wir’s ihm sagen?«
»Ich weiß nicht, ob er uns diese Story abnehmen würde.«
Alles hatte damit begonnen, als Gabriel den vermeintlichen Routineauftrag übernommen hatte, ein Gemälde in der Villa des unermesslich reichen Schweizer Bankiers Augustus Rolfe zu restaurieren. Das tragische Ende hatte sich einige Monate später ereignet, als Gabriel das Landhaus in Portugal verlassen hatte, in das Rolfes berühmte Tochter sich vor der schlimmen Vergangenheit ihrer Familie geflüchtet hatte. Er hatte sein Verhalten an jenem Tag stets bedauert – und die zwanzig Jahre, in denen es zwischen Anna und ihm kein einziges Telefongespräch, keine einzige E-Mail gegeben hatte. Trotz familiärer Komplikationen war er froh darüber, dass sie nun wieder ein Teil seines Lebens war.
»Du hättest mich warnen sollen«, sagte sie plötzlich.
»Wovor?«
Sie nickte zum Promitisch hinüber, an dem alle Augen auf Chiara gerichtet waren. »Wie erstaunlich schön deine Frau ist. Für mich war’s ein echter Schock, als ich sie gestern Abend kennengelernt habe.«
»Ich denke, dass ich eine vage Ähnlichkeit mit Nicola Benedetti erwähnt habe.«
»Mein lieber Freund, Nicola wünscht sich, sie sähe wie Chiara aus.« Anna seufzte. »Sie ist bestimmt in jeder Beziehung perfekt.«
»Sie kocht viel besser als du. Und vor allem übt sie nicht zu allen Tages- und Nachtzeiten auf der Geige.«
»Hat sie dir jemals wehgetan?«
Gabriel zeigte das schwache rote Mal auf seinem Handrücken vor.
»Ich hatte nie eine Chance, dich zurückzubekommen, nicht wahr?«
»Als ich Portugal verlassen habe, hast du unmissverständlich erklärt, nie wieder mit mir reden zu wollen.«
»Vermutlich sprichst du von der Lampe, die ich aus Versehen von dem Beistelltisch gestoßen habe.«
»Es war eine Porzellanvase. Und du wolltest sie mir mit deiner bemerkenswert kräftigen rechten Hand an den Kopf werfen.«
»Du kannst noch von Glück sagen. Deine Nachbarin rechts wäre mit einer weit gefährlicheren Waffe auf dich losgegangen.«
»Sie schwört, es sei nur ein Ausbeinmesser gewesen.«
»Es gibt Fotos davon.« Anna schob ihren Teller von sich weg.
»Der Tintenfisch schmeckt dir nicht?«
»Ich fliege gleich morgen früh nach London. Da will ich lieber nichts riskieren.«
»Ich dachte, du würdest noch ein paar Tage in Venedig bleiben.«
»Ich hab’s mir anders überlegt. Nächste Woche nehme ich den Mendelssohn mit Yannick Nézet-Séguin und dem Chamber Orchestra of Europe auf. Bis dahin muss ich unbedingt ein paar Tage üben.«
»Die Kinder werden enttäuscht sein, Anna. Sie vergöttern dich.«
»Und ich sie. Aber daran lässt sich nichts ändern, fürchte ich. Yannick hat gedrängt, dass ich gleich nach London kommen soll. Ich spiele mit dem Gedanken, dort eine katastrophale Affäre zu beginnen. Damit mein Name wieder in den Klatschspalten steht, in die er gehört.«
»Du wirst nur verwundet werden.«
»Aber ich werde umso besser spielen. Du kennst mich, Gabriel: Ich spiele nie gut, wenn ich glücklich bin.«
»Heute Abend warst du wundervoll, Anna.«
»Findest du?« Sie drückte seine Hand. »Warum wohl?«
5
MURANO
Es war Chiara gewesen, die Gabriel als eine Art Herausforderung vorgeschlagen hatte, eine Kopie des Liegenden Akts zu malen, Modiglianis berühmten Meisterwerk, das im Jahr 2015 bei Christie’s in New York für 170 Millionen Dollar versteigert worden war. Mit dem Erfolg seines Versuchs zufrieden hatte er ein absolut überzeugendes Pastiche von Modiglianis Original gemalt – aus etwas anderer Perspektive, mit leicht veränderter Körperhaltung des Modells –, nur um zu beweisen, dass er seinen Lebensunterhalt als Kunstfälscher verdienen könnte, wenn er das wollte. Als er am Morgen nach der Gala aufwachte, sah er beide Gemälde im Morgenlicht, das durch die auf den Canal Grande hinausführenden hohen Fenster einfiel. Es war stumpf und grau, dieses Licht, ganz ähnlich wie der Schmerz hinter Gabriels Augen. Der hatte nichts mit dem Rotwein zu tun, den er zu seinem nächtlichen Souper getrunken hatte, versicherte er sich selbst. Von Regenmorgen in Venedig bekam er immer Kopfschmerzen.
Er stand leise auf, um Chiara nicht zu wecken, und betrachtete die Spur der Verwüstung, die sie nachts beim Heimkommen hinterlassen hatten. Diese Spur aus hastig abgestreifter italienischer Abendkleidung und sonstigem Zubehör erstreckte sich von der Schlafzimmertür bis zum Bett. Eine 9-mm-Pistole 92FS der Fabbrica d’Armi Pietro Beretta. Stilettos und Lackleder-Oxfords von Salvatore Ferragamo. Ein Smoking mit Hemd von Brioni. Ein schulterfreies Abendkleid mit hohem Beinschlitz von Versace. Eine Armbanduhr von Patek Philippe. Der Liebesakt war ohne langes Vorspiel rasch vollzogen worden. Chiara hatte dabei mit schwachem Lächeln besitzergreifend auf Gabriel herabgesehen. Die Rivalin war besiegt, der Dämon vertrieben.
In der Küche löffelte Gabriel Illy in die Kaffeemaschine und las die Berichterstattung über die Gala in Il Gazzettino, während er darauf wartete, dass der Kaffee durchlief. Der Musikkritiker der Zeitung war voll des Lobes über Annas Konzert, vor allem über die Zugabe, die ihren legendären ersten Auftritt vor zwei Jahrzehnten in der Scuola Grande di San Rocco offenbar noch übertroffen hatte. Von Gabriels Anwesenheit bei dem Konzert war auf keinem der Bilder etwas zu sehen. Ein einziges Foto zeigte seine rechte Schulter mit der Hand von Chiara Zolli, der glamourösen Direktorin der Tiepolo Restauration Company.
Chiara schlief noch fest, als Gabriel mit zwei Tassen Kaffee ins Schlafzimmer zurückkam. Ihre Haltung war unverändert: Sie lag mit den Armen über dem Kopf hingegossen da. Sogar im Schlaf, dachte Gabriel, ist sie ein Kunstwerk. Er zog sanft an der Bettdecke, um ihre schweren runden Brüste freizulegen, und griff nach seinem Skizzenblock. Zehn Minuten verstrichen, bevor das Kratzen von Zeichenkohle auf Papier sie weckte.
»Musst du?«, ächzte sie.
»Ich muss.«
»Ich sehe schrecklich aus.«
»Das finde ich nicht.«
»Kaffee?«, bat sie.
»Der steht auf dem Nachttisch, aber du kannst ihn noch nicht haben.«
»Hast du kein Gemälde zu restaurieren?«
»Ich zeichne lieber dich.«
»Du bist mit deiner Arbeit in Verzug.«
»Ich bin immer zu spät dran.«
»Deswegen sollte ich dich rauswerfen.«
»Ich bin unersetzlich.«
»Wir sind hier in Italien, Darling. In diesem Land gibt es mehr Restauratoren als Kellner.«
»Und die Kellner verdienen besser.«
Chiara griff nach der Bettdecke.
»Nicht bewegen«, sagte Gabriel.
»Mir ist kalt.«
»Ja, das kann ich sehen.«
Chiara nahm wieder ihre vorige Haltung ein. »Hast du sie jemals gemalt?«
»Anna? Niemals.«
»Sie hat sich geweigert, dir Modell zu stehen?«
»Tatsächlich hat sie mich mehrmals gebeten, sie zu malen.«
»Warum hast du’s nicht getan?«
»Ich hatte Angst davor, was ich dabei entdecken könnte.«
»Du glaubst nicht wirklich, dass sie Mendelssohn-Bartholdys Violinkonzert üben muss?«
»Das kann sie im Schlaf spielen.«
»Warum hat sie’s dann so eilig, Venedig zu verlassen?«
»Das zeige ich dir in ein paar Minuten.«
»Du hast noch genau zehn Sekunden Zeit.«
Gabriel fotografierte sie mit seinem in Israel hergestellten Solaris, dem sichersten Smartphone der Welt.
»Schuft«, sagte Chiara und griff nach ihrem Kaffee.
Eine Stunde später standen sie geduscht und angezogen und in Regenjacken als Schutz vor dem Nieselregen auf dem Ponton der Vaporetto-Anlegestelle San Tomà. Chiaras Nummer 2 nach San Marco kam zuerst.
»Treffen wir uns zum Lunch?«, fragte Gabriel.
Ein vorwurfsvoller Blick durchbohrte ihn. »Das kann nicht dein Ernst sein.«
»Das kommt von der Skizze.«
»Ich überleg’s mir«, sagte sie beim Einsteigen.
»Also?«, fragte er, als das Boot ablegte.
»Vielleicht habe ich um eins Zeit.«
»Ich bringe etwas zu essen mit.«
»Nicht nötig«, sagte sie und warf ihm eine Kusshand zu.
Von der Universität her hielt eine Nummer 1 auf die Anlegestelle San Tomà zu. Gabriel fuhr damit bis zur Rialtobrücke und schlenderte durch Cannaregio zu den Fondamente Nove, wo er in der Bar Cupido rasch einen Kaffee trank, bevor er die nächste Fähre – eine Nummer 4.1 – bestieg. Auf der Fahrt nach Murano legte sie nur einmal am Westufer der Toteninsel San Michele an. Gabriel stieg an der Anlegestelle Museo aus, dem zweiten der beiden Stopps auf der Insel, und ging auf der Fondamenta Venier an den Geschäften für Muranoglas vorbei zu der Kirche Santa Maria degli Angeli.
Hier hatte schon im Jahr 1188 eine Kirche gestanden, aber der jetzige Bau mit seinem schiefen Glockenturm und dem kakifarbenen Mauerwerk stammte aus dem Jahr 1529. Im späten achtzehnten Jahrhundert hatte ein Philosoph und Abenteurer, der mit Männern wie Mozart und Voltaire verkehrte, hier regelmäßig die Messe gehört. Allerdings nicht aus Frömmigkeit, denn er war kein gläubiger Christ. Er kam nur, weil er auf flüchtige Begegnungen mit einer schönen jungen Nonne aus dem benachbarten Kloster hoffte. Obwohl dieser Mann, der Giacomo Casanova hieß, Hunderte solcher Beziehungen hatte, hielt er die Identität seiner Geliebten aus dem Kloster sorgfältig geheim. In seinen Memoiren bezeichnete er die Frau, angeblich die Tochter eines venezianischen Aristokraten, nur als M.M.
Wie sie stammten viele der Nonnen aus den reichsten Häusern Venedigs, sodass die Äbtissin nie in Geldnöten war. Trotzdem verweigerte sie die Zahlung, als ein Maler, der später als Tizian berühmt werden sollte, für sein Altargemälde mit Mariä Verkündigung fünfhundert Dukaten verlangte. Der gekränkte Künstler verkaufte das Gemälde an Isabella, die Gemahlin Karls V., und die Äbtissin engagierte Giovanni Antonio da Pordenone, genannt Il Pordenone, einen skrupellos ambitionierten Manieristen, der angeblich seinen Bruder hatte ermorden lassen, damit er ein Ersatzbild malte. Pordenone ergriff diese Gelegenheit sicher begierig, denn er hielt sich für Tizians größten künstlerischen Rivalen in Venedig.
Tizians Originalgemälde verschwand in den Napoleonischen Kriegen spurlos, aber Pordenones weniger bedeutendes Werk überlebte. Im Augenblick hing es mitten im Kirchenschiff an einem nach Maß getischlerten Holzgestell. Ein leeres schwarzes Rechteck im Hochaltar zeigte, wo das Gemälde wieder hängen würde, sobald die umfangreiche Restaurierung der alten Kirche abgeschlossen war. Auf einem hohen Gerüst arbeitend war Adrianna Zinetti damit beschäftigt, den reich verzierten Marmorrahmen von hundert Jahren Schmutz und Staub zu befreien. Sie trug eine Fleecejacke und fingerlose Handschuhe. Das Kircheninnere war kalt wie eine Krypta.
»Buongiorno, Signor Delvecchio«, trillerte sie, als Gabriel den Heizlüfter anstellte. Unter diesem falschen Namen hatte er viele Jahre seines Lebens in Venedig verbracht: Mario Delvecchio, das reservierte, launische Genie, das seine Lehrzeit in Venedig bei dem großen Umberto Conti absolviert und viele der berühmtesten Gemälde der Stadt restauriert hatte. Adrianna, die darauf spezialisiert war, Altäre und Statuen zu säubern, hatte bei mehreren wichtigen Projekten mit Mario zusammengearbeitet. Hatte sie nicht versucht, ihn zu verführen, hatte sie ihn leidenschaftlich gehasst. »Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht«, sagte sie. »Sonst bist du immer vor mir da.«
»Bin erst spät ins Bett gekommen«, antwortete er und begutachtete das Wägelchen mit seinen Malutensilien. Seit gestern Nachmittag schien sich dort nichts verändert zu haben. Trotzdem fragte er sicherheitshalber nach: »Du hast hoffentlich nichts angefasst?«
»Alles, Mario. Meine schmutzigen kleinen Finger haben alle deine kostbaren Fläschchen und Malmittel angefasst.«
»Du musst wirklich aufhören, mich so zu nennen, weißt du.«
»Ein Teil meines Ichs vermisst ihn.«
»Er dich bestimmt auch.«
»Und wenn ich deine Sachen angefasst hätte?«, fragte sie. »Wäre dann die Welt untergegangen?«
»Durchaus möglich, ja.« Er schlüpfte aus seiner Regenjacke. »Wen wollen wir hören, Signora Zinetti?«
»Amy Winehouse.«
»Wie wär’s stattdessen mit Schubert?«
»Nicht schon wieder die Streichquartette! Muss ich Der Tod und das Mädchen noch einmal hören, springe ich.«
Gabriel schob eine CD in seinen Player voller Farbspritzer – Maurizio Pollinis klassische Aufnahme der späten Schubert-Sonaten – und wickelte dann einen Wattebausch um das Ende eines Rundholzstabs. Als Nächstes tauchte er den Tupfer in eine sorgfältig hergestellte Mischung aus Aceton, Methylproxitol und Testbenzin und führte ihn mit sanft kreisenden Bewegungen über das Altargemälde. Die Lösung war eben stark genug, um den vergilbten Firnis abzutragen, ohne Pordenones Malerei zu beschädigen. Nach kurzer Zeit erreichte der Acetongeruch auch Adrianna.
»Du solltest wirklich eine Maske tragen«, sagte sie vorwurfsvoll. »In all den Jahren, in denen wir nun schon zusammenarbeiten, habe ich dich nie eine tragen gesehen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Gehirnzellen du schon abgetötet hast.«
»Abgestorbene Gehirnzellen sind mein kleinstes Problem.«
»Sag mir ein Problem, das du hast, Mario.«
»Eine Altarreinigerin, die dauernd quatscht, während ich zu arbeiten versuche.«
Gabriels Tupfer war nikotingelb geworden. Er streifte ihn ab und bereitete einen neuen vor. In vierzehntägiger Arbeit hatte er fast das ganze untere Drittel des Gemäldes gereinigt. Die Fahlstellen waren zahlreich, aber nicht katastrophal groß. Gabriel hatte den Ehrgeiz, die Restaurierung mit den letzten Retuschen in vier Monaten abzuschließen, um sich den übrigen Gemälden im Kirchenschiff widmen zu können.
Antonio Politi, ein altbewährter Mitarbeiter der Tiepolo Restauration Company, hatte bereits mit der Arbeit an einem dieser Gemälde – Maria Gloriosa mit Heiligen von Palma il Giovane – begonnen. Es war fast halb elf, als er hereingeschlendert kam.
»Buongiorno, Signor Delvecchio!«, rief er unbekümmert.
Hoch vom Gerüst war Lachen zu hören. Gabriel nahm die CD aus dem Player und schob eine CD mit Schuberts Streichquartett Nr. 14 ein. Dann zog er seine Regenjacke an und trat lächelnd in den feuchten Morgen hinaus.
6
BAR AL PONTE
Das Paket, das an einem feuchtheißen Augustmorgen des Jahres 1988 bei den Carabinieri in Neapel einging, schien harmlos zu sein, was es jedoch nicht war. Es enthielt eine kleine, aber wirkungsvolle Sprengladung, die ein Bombenbauer der Camorra, einer kriminellen Organisation in Kalabrien, präpariert hatte. Auf den Empfänger, Capitano Cesare Ferrari, waren schon mehrere Anschläge verübt worden, vor allem seit er einen der höchsten Camorra-Bosse verhaftet hatte. Trotzdem lieferte die Poststelle das Paket ungeprüft bei ihm ab. Ferrari würde die Detonation überleben, aber das rechte Auge und zwei Finger der rechten Hand verlieren. Ein Jahr später lieferte er den für den Anschlag verantwortlichen Camorrista persönlich im Gefängnis Poggioreale ab und rief ihm noch ein paar Verwünschungen nach.
Es gab Leute, die ihn für sein jetziges Kommando ungeeignet und vielleicht für etwas zu forsch hielten, aber das fand General Ferrari durchaus nicht. Forschheit, behauptete er, sei genau das, was das Kunstdezernat brauche. Das ehemalige Carabinieri-Dezernat für die Verteidigung des Kulturerbes war das Erste seiner Art gewesen – eine Polizeitruppe, die sich ausschließlich auf den Kampf gegen den lukrativen Handel mit gestohlener Kunst und Antiquitäten konzentrierte. In den beiden ersten Jahrzehnten ihrer Existenz hatte sie Tausende von Verhaftungen vorgenommen und viele berühmte Kunstwerke wieder beigebracht, aber Mitte der neunziger Jahre hatte eine Art institutioneller Lähmung eingesetzt. Ihr Personal war auf wenige Beamten kurz vor der Pensionierung geschrumpft, von denen die meisten wenig oder nichts von Kunst verstanden. Die vielen Kritiker des Dezernats behaupteten nicht ganz zu Unrecht, sie verbrächten mehr Zeit damit, sich auf ein Restaurant fürs Mittagessen zu einigen, als nach den zahlreichen Gemälden zu fahnden, die jedes Jahr in Italien gestohlen wurden und mit denen man ein Museum hätte füllen können.
Als General Ferrari das Kommando übers Kunstdezernat übernahm, entließ er binnen weniger Tage die Hälfte seines Stabs und ersetzte sie durch energische junge Offiziere, die etwas von den Objekten verstanden, die sie zu finden versuchten. Außerdem verschaffte er sich die Genehmigung, die Telefone bekannter Verbrecher abhören zu dürfen, und eröffnete Büros in den Provinzen mit den meisten Kunstdiebstählen, hauptsächlich im Süden. Vor allem konzentrierte er sich wie bei seinem Kampf gegen die Mafia auf die großen Fische, statt die kleinen Gauner zu verfolgen, die es mal mit Kunstdiebstahl versuchten. Seine neue Taktik zeitigte rasch Erfolge. Unter General Ferrari hatte das Dezernat für die Verteidigung des Kulturerbes seinen früheren Glanz zurückgewonnen. Selbst die Kunstdetektive der französischen Police Nationale gaben neidlos zu, dass ihre italienischen Kollegen die Branchenbesten waren.
Ihre Zentrale befand sich in einem reich verzierten gelb-weißen Palazzo an der Piazza di Sant’Ignazio in Rom, aber drei Beamte waren in Venedig stationiert. Wenn sie nicht nach gestohlenen Kunstwerken fahndeten, behielten sie den Direktor der Gemäldeabteilung der Tiepolo Restauration Company im Auge. In letzter Zeit war er vormittags zur Kaffeepause in die Bar al Ponte an einer der belebtesten Brücken von Murano gekommen. Als er dort ankam, sah er General Ferrari in seiner blau-goldenen Carabinieri-Uniform an einem Tisch in der hinteren Ecke der Bar sitzen.
Er lächelte Gabriel über sein Exemplar von Il Gazzettino hinweg an. »Sie sind ein Gewohnheitstier geworden.«
»Das sagt meine Frau auch«, antwortete Gabriel, als er Platz nahm.
»Sie hat bei der gestrigen Gala viel Eindruck gemacht.« Der General legte die Zeitung auf den Tisch und deutete auf ein Foto im Kulturteil. »Aber wer ist dieser unscharfe Kerl neben ihr?«
»Ein Statist.«
»So weit würde ich nicht gehen. Schließlich kann man sagen, dass Ihre Anwesenheit in Venedig nun kein Geheimnis mehr ist.«
»Ich konnte mich nicht ewig verstecken, Cesare.«
»Wie fühlt es sich an, nach so vielen Jahren wieder ein normaler Mensch zu sein?«
»Wir wollen nicht übertreiben. Normal bin ich nicht gerade.«
»Jedenfalls haben Sie interessante Freunde. Ich bedaure nur, dass ich nicht zu Signora Rolfes Konzert kommen konnte.«
»Keine Sorge, die Kultusministerin war liebenswürdig genug, vorbeizuschauen.«
»Sie haben sich anständig benommen, hoffe ich.«
»Wir haben uns gleich prächtig verstanden. Sie hat mich zu dem nächste Woche stattfindenden Festival mit Leni-Riefenstahl-Filmen eingeladen.«
General Ferrari lächelte höflich und kurz. Wie immer wirkte das sich nicht auf sein rechtes Glasauge aus. »Unsere Politik ist nichts zum Lachen, fürchte ich. Hundert Jahre nach Mussolinis Aufstieg hat das italienische Volk wieder die Faschisten an die Macht gebracht.«
»Die Fratelli d’Italia bezeichnen sich als Neofaschisten.«
»Was ist der Unterschied?«
»Bessere Uniformen.«
»Und kein Rizinusöl«, fügte der General hinzu. Dann schüttelte er den Kopf. »Wie zum Teufel konnte es dazu kommen?«
»›Die Dinge zerfallen‹«, zitierte Gabriel. »›Die Mitte kann nicht mehr halten.‹«
»Hat Vergil das geschrieben? Oder war’s Ovid?«
»David Bowie, glaube ich«, behauptete Gabriel.
Der Barista servierte ihnen zwei Tassen Kaffee und Gabriel zusätzlich ein kleines Glas Weißwein. General Ferrari sah stirnrunzelnd auf seine Armbanduhr. »Ihr Venezianer wisst wirklich, wie man lebt.«
»Von zu viel Kaffee zittern meine Hände. Ein paar Tropfen Vino bianco neutralisieren das Koffein.«
»Sie sind mir nie wie jemand vorgekommen, der zittrige Hände hat.«
»Das passiert manchmal. Besonders wenn ich den Verdacht habe, dass ein alter Freund mich um einen Gefallen angehen will.«
»Und wenn er’s täte?«
»Dann würde ich ihm sagen, dass ein Altargemälde auf mich wartet.«
»Il Pordenone? Der ist unter Ihrer Würde.«
»Aber er bezahlt die Rechnungen.«
»Und wenn ich Ihnen etwas Interessanteres anzubieten hätte?« Der General nahm den meditativen Gesichtsausdruck von Bellinis Doge Leonardo Loredan an. »Vor einigen Jahren hat es hier in Europa eine Serie spektakulärer Kunstdiebstähle gegeben. Der erste hat sich in Wien ereignet. Die Diebe haben einen unzufriedenen Wachmann im Kunsthistorischen Museum bestochen und sind mit David mit dem Haupt des Goliath von Ihrem alten Freund Caravaggio entkommen. Daran erinnern Sie sich bestimmt.«
»Entfernt«, antwortete Gabriel.
»Gleich im Monat darauf«, fuhr General Ferrari fort, »haben sie Porträt von Señora Canals aus dem Museu Picasso in Barcelona gestohlen. Eine Woche später ist Les Maisons (Fenouillet) aus dem Musée Matisse verschwunden. Und dann hat es natürlich den lehrbuchmäßigen gewaltsamen Bilderraub in der Courtauld Gallery gegeben. Auch dabei haben sie nur ein einzelnes Gemälde mitgenommen.«
»Selbstporträt mit verbundenem Ohr und Pfeife von Vincent van Gogh.«
Ferrari nickte. »Wie Sie sich denken können, haben meine Kollegen in ganz Europa mit Hochdruck nach diesen unersetzlichen Kunstwerken gefahndet – leider ohne Erfolg. Aber nun scheint eines dieser Gemälde ganz unerwartet wiederaufgetaucht zu sein.«
»Wo?«
»Ausgerechnet hier in Italien.«
»Welches?«
»Das darf ich Ihnen nicht sagen.«
»Warum nicht?«
»Das Gemälde ist gestern Nachmittag von einer anderen Einheit der Carabinieri entdeckt worden. Ist es tatsächlich das gestohlene Bild, benachrichtige ich die zuständigen Stellen und bereite seine Rückführung vor.«
»Gibt es denn Zweifel?«
»Es scheint echt zu sein«, sagte General Ferrari. »Aber wie Sie wissen, wimmelt es auf dem Kunstmarkt von hochwertigen Fälschungen. Für uns wäre es natürlich sehr peinlich, wenn wir die Wiederauffindung eines verschwundenen Meisterwerks melden, das sich als gefälscht herausstellt. Wir müssen unseren Ruf verteidigen.«
»Was hat irgendwas davon mit mir zu tun?«
»Ich frage mich, ob Sie vielleicht jemanden kennen, der uns behilflich sein könnte. Dessen weitgespannte Erfahrung von Caravaggio bis van Gogh reicht. Der zum Beispiel in ein großes Pariser Museum gehen und binnen Minuten mehrere Fälschungen identifizieren könnte.«
»Ich wüsste einen Experten«, sagte Gabriel. »Aber er ist im Augenblick sehr beschäftigt, fürchte ich.«
»Ich würde ihm raten, Zeit für diesen kleinen Auftrag zu erübrigen.«
»Ist das eine Drohung?«
»Nur eine freundliche Erinnerung daran, dass Sie in diesem Land zu Gast sind und ich der Gastgeber bin.«
In seiner Eigenschaft als Chef des Kunstdezernats hatte General Ferrari Gabriel ein permesso di soggiorno, eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, verschafft. Ihr Widerruf hätte seinen Lebensunterhalt gefährdet, von seiner Ehe ganz zu schweigen.
»Eine einfache Authentifizierung? Mehr brauchen Sie nicht?«
Ferrari zuckte mit den Schultern, ohne sich festzulegen.
»Wo ist das Gemälde jetzt?«
»In situ.«
»Wo in situ?«
»Amalfi. Fahren wir gleich los, können Sie zu einem späten Abendessen mit Chiara zurück sein.«
»Wirklich?«
»Vermutlich nicht. Vielleicht wäre es klug, eine Reisetasche mitzunehmen.«
»Mit oder ohne Waffe?«
»Mit«, sagte General Ferrari. »Nehmen Sie unbedingt Ihre Pistole mit.«
7
AMALFI

![Die Fälschung (Gabriel Allon 22) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a3c78f56d830648941e8541a912ece8c/w200_u90.jpg)
![Der Geheimbund (Gabriel Allon 20) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3f0442bd1f64b2b41e586c80150b3c0/w200_u90.jpg)
![Die Cellistin (Gabriel Allon 21) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bdaaa9cd283b671c252c1b0a29ef6f0/w200_u90.jpg)


![Das Vermächtnis (Gabriel Allon 19) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2dc3fc2736d865447dbf9f082ac49b4/w200_u90.jpg)