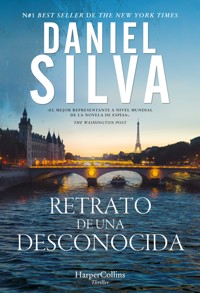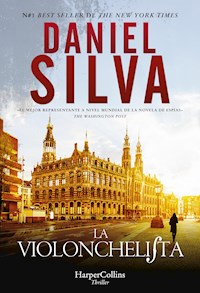12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gabriel Allon
- Sprache: Deutsch
Atemlose Spannung: Die Jagd durch Europa geht weiter!
Viktor Orlow, der ehemals reichste Mann Russlands, ist dem Tod schon unzählige Male von der Schippe gesprungen. Vor einigen Jahren hat er sich ins Exil nach London zurückgezogen, wo er nun seinen Kampf gegen die Kleptokraten, die die Kontrolle über den Kreml an sich gerissen haben, weiterführt. Doch eines Abends wird er tot in seiner Wohnung aufgefunden – vor ihm sein Telefonhörer, ein halb leeres Glas Rotwein und ein Stapel Dokumente, kontaminiert mit einem tödlichen Nervengift.
Gabriel Allon, der Orlow sein Leben verdankt, glaubt nicht an die Theorien, die der MI6 über den Tathergang aufstellt, und nimmt sich des Falles an: Es beginnt eine rasante Jagd durch Europa auf den Spuren einer russischen Untergrundorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt unwiderruflich zu spalten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Daniel Silva
Die Cellistin
Ein Gabriel-Allon-Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Wulf Bergner
HarperCollins
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem TitelThe Cellist bei Harper, New York.
© 2021 by Daniel Silva
Deutsche Erstausgabe
© 2022 für die deutschsprachige Ausgabe
by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Published by arrangement with
Harper, an imprint of HarperCollins Publishers, New York
Covergestaltung von Bürosüd, München Coverabbildung von franckreporter / iStock E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749904990
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheberinnen und Urheber und des Verlags bleiben davon unberührt.
Für die Beamten der United States Capitol Police
und Washingtons Metropolitan Police Department,
den Verteidigern unserer Demokratie am
6. Januar 2021
Und wie immer für meine Frau Jamie
und meine Kinder Lily und Nicholas
Kleptokratie [Klep|to|kra|tie]»Herrschaft der Plünderer«, »Diebesherrschaft«
In Russland ist Macht Reichtum, und Reichtum ist Macht.
Anders Åslund, Russia’s Crony Capitalism
TEILEINS
MODERATO
1
JERMYN STREET, ST. JAMES’S, LONDON
Sarah Bancroft beneidete die glücklichen Menschen, die sich einbildeten, ihr Schicksal selbst in der Hand zu haben. Für sie war das Leben nicht komplizierter als eine Fahrt mit der U-Bahn. Fahrkarte an der Sperre entwerten, an der richtigen Station aussteigen – Charing Cross statt Leicester Square. Diesen Blödsinn hatte Sarah nie geglaubt. Ja, man konnte sich vorbereiten, man konnte kämpfen, man konnte zwischen Optionen wählen, aber letzten Endes war das Leben doch ein kompliziertes Spiel aus Vorsehung und Wahrscheinlichkeit. In ihrem Arbeits- und Liebesleben hatte sie ein frappierendes Geschick für die Wahl des falschen Zeitpunkts an den Tag gelegt. Sie war immer einen Schritt zu schnell oder einen zu langsam dran, fast immer mit katastrophalen Folgen.
Auch ihr jüngster Karriereschritt schien wieder unter einem schlechten Stern zu stehen. Nachdem sie zu einer der prominentesten Museumskuratoren New Yorks aufgestiegen war, hatte sie sich dafür entschieden, nach London umzuziehen, um die Geschäftsführung von Isherwood Fine Arts, seit 1968 auf hochwertige italienische und holländische Altmeister spezialisiert, zu übernehmen. Erwartungsgemäß brach kurz nach ihrer Ankunft eine tödliche Pandemie aus. Selbst der Kunsthandel, der davon lebte, die Launen der Superreichen dieser Welt zu befriedigen, war nicht gegen das hochansteckende Virus gefeit. Praktisch über Nacht glitt der Umsatz der Galerie in einen Zustand ab, der fast einem Herzstillstand gleichkam. Klingelte das Telefon überhaupt noch, war ein Käufer oder sein Beauftragter dran, um von einem Kauf zurückzutreten. Seit der West-End-Premiere der Musical-Version von Susan … verzweifelt gesucht, behauptete Sarahs spitzzüngige Mutter, habe London kein weniger hoffnungsvolles Debüt mehr erlebt.
Isherwood Fine Arts hatte schon früher schwierige Zeiten durchgemacht – Kriege, Terroranschläge, Ölschocks, Marktzusammenbrüche, katastrophale Liebesaffären –, es aber stets irgendwie geschafft, den Sturm abzuwettern. Vor fünfzehn Jahren hatte Sarah schon einmal kurz in der Galerie gearbeitet, damals als Undercover-Agentin der Central Intelligence Agency. Die Operation war ein amerikanisch-israelisches Unternehmen unter Leitung des legendären Gabriel Allon gewesen. Mithilfe eines verschollenen Van-Gogh-Gemäldes hatte er sie mit dem Auftrag ins Gefolge des saudischen Multimilliardärs Zizi al-Bakari eingeschleust, den darin tätigen Terrorplaner aufzuspüren. Das hatte Sarahs Leben für immer verändert.
Nach diesem Unternehmen hatte sie sich mehrere Monate lang in einem sicheren Haus der Agency – eine Pferderanch im Norden Virginias – erholen müssen. Anschließend hatte sie im CIA-Zentrum für Terrorismusbekämpfung in Langley gearbeitet und auf Veranlassung Gabriels an mehreren amerikanisch-israelischen Unternehmen teilgenommen. Die britischen Nachrichtendienste wussten natürlich von ihrer Vergangenheit und ihrer Anwesenheit in London – kaum verwunderlich, weil sie gegenwärtig mit einem MI6-Offizier namens Christopher Keller zusammenlebte. Normalerweise waren solche Beziehungen strikt verboten, aber in Sarahs Fall war eine Ausnahme gemacht worden. Graham Seymour, der MI6-Generaldirektor, war ebenso ein persönlicher Freund wie Premierminister Jonathan Lancaster. Tatsächlich waren Sarah und Christopher nicht lange nach ihrer Ankunft zu einem privaten Abendessen in der Number Ten gewesen.
Mit Ausnahme von Julian Isherwood, dem Besitzer der bezaubernden Galerie, die seinen Namen trug, wussten die Protagonisten der Londoner Kunstszene von alledem nichts. Für Sarahs Kollegen und Konkurrenten war sie die schöne und brillante amerikanische Kunsthistorikerin, die in einem lange zurückliegenden trüben Winter ihre Welt aufgeheitert hatte, nur um sie für Leute wie Zizi al-Bakari, er ruhe in Frieden, schnöde sitzen zu lassen. Und nun, nach einer turbulenten Reise durch die Welt der Geheimdienste, war sie zurückgekehrt und hatte damit ihre Theorie über Vorsehung und Wahrscheinlichkeit bewiesen.
London hatte sie mit offenen Armen empfangen und nur wenige Fragen gestellt. Sie hatte kaum Zeit, ihre Angelegenheiten zu ordnen, bevor die Epidemie ausbrach. Anfang März infizierte sie sich unwissentlich auf der European Fine Art Fair in Maastricht und steckte prompt Julian und Christopher an. Julian verbrachte schreckliche zwei Wochen im University College Hospital. Sarah blieben die schlimmsten Symptome erspart, aber sie litt einen Monat lang an Fieber, Erschöpfung, Kopfschmerzen und Kurzatmigkeit, die ihr bei jedem Aufstehen zusetzte. Wenig überraschend spürte Christopher nichts, kam gänzlich ohne Symptome davon. Sarah rächte sich dafür, indem sie sich von vorne bis hinten von ihm bedienen ließ. Irgendwie überlebte ihre Beziehung.
Im Juni erwachte London aus dem Lockdown. Nach drei negativen PCR-Tests trat Christopher wieder seinen Dienst in Vauxhall Cross an, aber Sarah und Julian warteten bis zur Sonnenwende, bevor sie die Galerie wieder öffneten. Sie lag im Mason’s Yard, einem stillen gepflasterten Innenhof zwischen der Vertretung einer kleinen griechischen Reederei und einem Pub, in dem in der unschuldigen Zeit vor der Seuche hübsche Mädchen verkehrt hatten, die in Büros arbeiteten und Motorroller fuhren. Im obersten Stock lag ein prachtvoller Showroom nach dem Vorbild von Paul Rosenbergs berühmter Galerie in Paris, in der Julian als Kind viele glückliche Stunden verbracht hatte. Sarah und er teilten sich ein großes Büro im ersten Stock mit Ella, der attraktiven, aber untauglichen Vorzimmerdame. In der ersten Woche nach der Wiedereröffnung klingelte das Telefon nur dreimal. Ella ließ alle drei Anrufer auf den Anrufbeantworter sprechen. Sarah teilte ihr mit, ihre Dienste – soweit man von welchen sprechen konnte – würden nicht länger benötigt.
Einen Ersatz für sie einzustellen hatte keinen Zweck. Die Virologen warnten vor einer noch heftigeren zweiten Welle, wenn das Wetter kälter wurde, und die Londoner Geschäftswelt war bereits vor weiteren staatlich verordneten Lockdowns gewarnt worden. Unter diesen Umständen wollte Sarah keine Angestellte durchfüttern müssen. Sie beschloss, diesen Sommer zu nutzen. Sie würde ein Gemälde verkaufen, irgendein Gemälde, auch wenn es sie das Leben kostete.
Eigentlich mehr zufällig fand sie eines, während sie die katastrophal vielen unverkauften Gemälde in Julians übervollen Lagerräumen inventarisierte. Die Lautenspielerin, Öl auf Leinwand, 152 x 134 Zentimeter, anscheinend Frühbarock, ziemlich schmutzig und beschädigt. In Julians Archiv fand sich außer der Originalrechnung noch eine vergilbte Kopie der Provenienz. Der früheste bekannte Besitzer war ein Graf Soundso in Bologna, der das Gemälde im Jahr 1698 einem Angehörigen des liechtensteinischen Fürstenhauses schenkte, der es seinerseits einem Baron Soundso in Wien verkaufte, wo es bis 1962 verblieb, als ein römischer Kunsthändler das Werk kaufte, um es viele Jahre später Julian anzudrehen. Zugeschrieben worden war das Gemälde abwechselnd der Italienischen Schule, einem Schüler Caravaggios und – vielversprechender – dem Künstlerkreis um Orazio Gentileschi. Sarah hatte einen bestimmten Verdacht. Sie zeigte das Werk in Julians dreistündiger Mittagspause dem gelehrten Niles Dunham von der National Gallery. Niles erklärte sich vorläufig mit Sarahs Zuschreibung einverstanden, behielt sich aber eine technische Untersuchung mit Röntgen und IR-Reflektographie vor. Dann bot er Sarah an, ihr das Gemälde für achthunderttausend Pfund abzukaufen.
»Es ist fünf Millionen wert, wenn nicht mehr.«
»Nicht während der Schwarze Tod wütet.«
»Warten wir’s ab.«
Normalerweise wäre ein neu entdecktes Werk einer bedeutenden Künstlerin mit großem Trara auf den Markt gebracht worden – erst recht dann, wenn die Malerin wegen ihrer tragischen Biografie in letzter Zeit wieder populär geworden war. Aber wegen der allgemeinen Flaute auf dem Kunstmarkt und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Gemälde in seiner eigenen Galerie entdeckt worden war, hielt Julian einen Privatverkauf für angebracht. Er rief einige seiner zuverlässigsten Kunden an, von denen keiner auch nur Interesse zeigte. Daraufhin wandte Sarah sich diskret an einen reichen Sammler, der ein Freund eines Freundes war. Er war sofort interessiert, und man einigte sich nach mehreren Besprechungen in seinem Londoner Stadthaus auf einen fairen Preis. Sarah verlangte eine Million Pfund als Anzahlung, auch um die Kosten der aufwendigen Restaurierung zu decken, die beträchtlich sein würden. Der Sammler bat sie, an diesem Abend gegen 20 Uhr bei ihm vorbeizukommen, um den Scheck in Empfang zu nehmen.
Das alles erklärte teilweise, weshalb Sarah Bancroft an einem regnerischen Mittwochabend Ende Juli an einem Ecktisch in der Bar von Wilton’s Restaurant in der Jermyn Street saß. Die Stimmung im Raum war unsicher, das Lächeln gezwungen, das Gelächter dröhnend, aber irgendwie unecht. Julian lehnte am Ende der Theke. In seinem Anzug aus der Savile Row und mit üppigen grauen Locken wirkte er recht elegant, aber auch etwas anrüchig: ein Look, den er als würdevolle Verderbtheit bezeichnete. Er starrte in seinen Sancerre und gab vor, sich für etwas zu interessieren, das Jeremy Crabbe, bei Bonhams für Altmeister zuständig, ihm aufgeregt ins Ohr murmelte. Amelia March von ARTNews belauschte unauffällig ein Gespräch zwischen Simon Mendenhall, dem weltmännischen Chefauktionator von Christie’s, und Nicky Lovegrove, dem Kunstberater der Superreichen. Roddy Hutchinson, allgemein als skrupellosester Kunsthändler Londons bekannt, zupfte den dicken Oliver Dimbleby am Ärmel. Oliver achtete jedoch nicht auf ihn, sondern hatte nur Augen für das bildschöne ehemalige Model, das jetzt in der King Street eine erfolgreiche Galerie für moderne Kunst betrieb. Auf dem Weg hinaus spitzte sie ihre perfekten scharlachroten Lippen und warf Sarah eine Kusshand zu. Sarah trank einen Schluck von ihrem Martini mit drei Oliven und flüsterte: »Bitch.«
»Das hab ich gehört!« Zum Glück war das nur Oliver. In seinem grauen Maßanzug kam er wie ein Sperrballon an Sarahs Tisch geschwebt und setzte sich. »Was missfällt dir an der schönen Miss Watson?«
»Ihre Augen. Ihre Wangenknochen. Ihr Haar. Ihre Titten.« Sarah seufzte. »Soll ich weitermachen?«
Oliver winkte mit einer molligen kleinen Hand ab. »Du bist viel hübscher als sie, Sarah. Ich werde nie vergessen, wie ich dich zum ersten Mal über den Mason’s Yard habe gehen gesehen. Fast hätte mich der Schlag getroffen. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich mich damals ziemlich lächerlich gemacht.«
»Du hast um meine Hand angehalten. Sogar mehrmals.«
»Mein Angebot gilt weiter.«
»Ich fühle mich geschmeichelt, Ollie. Aber das kommt leider nicht infrage.«
»Bin ich zu alt?«
»Keineswegs.«
»Zu fett?«
Sie tätschelte seine rosige Wange. »Tatsächlich genau richtig.«
»Wo liegt also das Problem?«
»Ich lebe in einer Beziehung.«
Dieses Wort schien ihm fremd zu sein. Olivers Romanzen dauerten selten länger als ein bis zwei Nächte. »Redest du von diesem Kerl mit dem protzigen Bentley?«
Sarah trank einen Schluck.
»Und wie heißt dein Freund?«
»Peter Marlowe.«
»Klingt erfunden.«
Aus gutem Grund, dachte Sarah.
»Was macht er beruflich?«, wollte Oliver wissen.
»Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?«
»Meine liebe Sarah, ich kenne mehr schmutzige Geheimnisse als MI5 und MI6 zusammen.«
Sie beugte sich über den Tisch. »Er ist ein Profikiller.«
»Echt jetzt? Interessante Arbeit, was?«
Sarah lächelte. Das stimmte natürlich nicht. Christophers Zeit als Auftragsmörder lag einige Jahre zurück.
»Ist er der Grund, weshalb du nach London zurückgekommen bist?«, fasste Oliver nach.
»Einer der Gründe. Tatsächlich habt ihr mir alle schrecklich gefehlt. Sogar du, Ollie.« Sie sah auf ihr Smartphone. »Oh, verdammt! Bist du so lieb und zahlst für mich? Ich bin zu spät dran.«
»Wofür?«
»Benimm dich, Ollie.«
»Warum zum Teufel sollte ich das tun? Das ist verdammt langweilig.«
Sarah stand auf, blinzelte Julian im Vorbeigehen zu und trat auf die Jermyn Street hinaus. Plötzlich goss es wie aus Kübeln, aber sie wurde bald von einem Taxi gerettet. Sie wartete, bis sie sicher und warm auf dem Rücksitz saß, bevor sie dem Fahrer die Adresse nannte.
»Cheyne Walk, bitte. Nummer dreiundvierzig.«
2
CHEYNE WALK, CHELSEA
Wie Sarah Bancroft glaubte Wiktor Orlow, die Lebensreise werde am besten ohne Landkarte unternommen. Nach seiner Kindheit in einer ungeheizten Moskauer Wohnung, die sich drei Familien teilten, wurde er durch eine Kombination aus Glück, Durchsetzungsvermögen und Rücksichtslosigkeit, die selbst seine Apologeten als skrupellos, wenn nicht gar kriminell bezeichneten, zum Multimilliardär. Orlow machte kein Geheimnis aus der Tatsache, dass er ein Raubtier, ein Räuberbaron war. Er war sogar stolz auf diese Bezeichnungen. »Wäre ich als Engländer geboren, hätte ich mein Geld vielleicht anständig verdient«, erklärte er einem britischen Interviewer bald nach seiner Übersiedlung nach London herablassend. »Aber ich bin in Russland geboren. Und ich habe ein russisches Vermögen gemacht.«
Tatsächlich war Wiktor Orlow nicht in Russland, sondern in der Sowjetunion zur Welt gekommen. Der brillante Mathematiker hatte in Leningrad am angesehenen Physikalisch-Technologischen Institut »W. Joffe« der Akademie der Wissenschaften studiert und war anschließend im sowjetischen Atomwaffenprogramm verschwunden, in dem er ICBM-Mehrfachgefechtsköpfe entwickelte. Als er später gefragt wurde, wieso er in die KPdSU eingetreten sei, gab er freimütig zu, er habe nur Karriere machen wollen. »Ich hätte vielleicht auch ein Dissident werden können«, fügte er hinzu, »aber der Archipel Gulag ist mir nie sehr verlockend erschienen.«
Als Angehöriger einer verhätschelten Elite beobachtete Orlow den Zerfall des sowjetischen Systems als Insider und wusste, dass sein Zusammenbruch nur mehr eine Frage der Zeit war. Als schließlich das Ende kam, trat er aus der Kommunistischen Partei aus und schwor sich, reich zu werden. Binnen weniger Jahre hatte er es durch den Import von Computern und anderen Westwaren für den aufblühenden russischen Markt zu einem beachtlichen Vermögen gebracht. Mit diesem Kapital kaufte er Russlands größten Stahlkonzern aus Staatsbesitz und Rusoil, den sibirischen Ölriesen. Nun dauerte es nicht mehr lange, bis Orlow der reichste Russe war.
Im gesetzlosen postsowjetischen Russland machte Orlows Milliardenvermögen ihm viele Feinde. Er überlebte mindestens drei Attentate und hatte angeblich als Vergeltung die Liquidierung mehrerer Männer befohlen. Die größte Gefahr drohte Orlow jedoch von dem Mann, der Boris Jelzin als Präsident nachgefolgt war. Seiner Überzeugung nach hatten Wiktor Orlow und die anderen Oligarchen die wertvollsten Aktiva des Landes gestohlen, und er war entschlossen, sie ihnen wieder abzunehmen. Sowie er sich im Kreml eingerichtet hatte, zitierte der neue Präsident Orlow zu sich und verlangte zwei Dinge: seinen Stahlkonzern und Rusoil. »Und steck deine Nase nicht in die Politik«, fügte er warnend hinzu. »Sonst schneide ich sie dir ab.«
Orlow war bereit, sich von seinem Stahlkonzern zu trennen, wollte Rusoil jedoch behalten. Der Präsident war nicht erfreut. Er wies die Staatsanwaltschaft sofort an, Ermittlungen wegen Betrugs und Korruption anzustellen, die binnen einer Woche zur Ausstellung eines Haftbefehls gegen Orlow führten. Der Oligarch setzte sich klugerweise nach London ab, wo er zu einem der lautesten Kritiker des russischen Präsidenten wurde. Rusoil blieb jahrelang juristisch umkämpft, außer Reichweite Orlows oder der neuen Herren im Kreml. Letzten Endes erklärte Orlow sich bereit, auf Rusoil im Austausch gegen drei in Russland inhaftierte israelische Geheimagenten zu verzichten. Einer dieser Agenten war Gabriel Allon.
Als Lohn für seine Großzügigkeit erhielt Orlow einen britischen Reisepass und eine Privataudienz bei der Königin im Buckingham Palace. Dann machte er den ambitionierten Versuch, erneut ein Vermögen aufzubauen – diesmal jedoch unter dem wachsamen Blick der britischen Börsenaufsicht, die ihm genau auf die Finger sah. Zu seinem Imperium gehörten jetzt altehrwürdige Londoner Zeitungen wie der Independent, der Evening Standard und das Financial Journal. Außerdem hatte er’s geschafft, eine Mehrheitsbeteiligung an der investigativen Wochenzeitschrift Moskowskaja Gaseta zu erwerben. Dank Orlows finanzieller Unterstützung war die Zeitschrift wieder Russlands prominentestes unabhängiges Nachrichtenorgan und ein ständiger Dorn im Fleisch der Kremlelite.
Das alles führte dazu, dass Orlow tagaus, tagein in dem Bewusstsein lebte, dass die mächtigen Geheimdienste der Russischen Föderation den Auftrag hatten, ihn zu liquidieren. Sein neuer Mercedes-Maybach hatte Sicherheitsfeatures wie sonst nur die Limousinen von Präsidenten und Premierministern, und sein Stadthaus am historischen Cheyne Walk in Chelsea gehörte zu den am stärksten geschützten Gebäuden Londons. Draußen am Randstein parkte mit laufendem Motor ein unbeleuchteter Range Rover. In dem SUV saßen vier Personenschützer, alle ehemalige Soldaten der Eliteeinheit Special Air Service, die jetzt bei einem privaten Sicherheitsdienst in Mayfair arbeiteten. Der Mann am Steuer hob grüßend eine Hand, als Sarah hinten aus dem Taxi ausstieg. Sie wurde offenbar erwartet.
Die Nummer 43 war schmal und hoch und mit Glyzinien bewachsen. Wie ihre Nachbarn stand sie hinter einem schmiedeeisernen Zaun einige Meter von der Straße zurückgesetzt. Unter dem unzulänglichen Schutz ihres Taschenschirms hastete Sarah über den Gehsteig und zur Haustür. Als sie klingelte, erklang drinnen ein volltönender Gong, aber niemand kam, um sie einzulassen. Auch Sarahs zweiter Versuch blieb ergebnislos.
Normalerweise hätte das Dienstmädchen die Haustür öffnen sollen. Aber Wiktor, schon vor der Pandemie als Hygienefanatiker berüchtigt, hatte die Arbeitszeit des Hauspersonals stark gekürzt, um sein Ansteckungsrisiko möglichst zu verringern. Als eingefleischter Junggeselle verbrachte er die meisten Abende in seinem Arbeitszimmer im zweiten Stock, manchmal allein, oft in Gesellschaft unpassend junger Frauen. Hinter den Fenstern dort oben brannte Licht. Sarah nahm an, er telefoniere gerade. Zumindest hoffte sie das.
Sie klingelte ein drittes Mal, ohne dass jemand öffnete, und legte dann ihren Zeigefinger auf den biometrischen Scanner am Türrahmen. Wiktor hatte ihren Fingerabdruck in seinem System gespeichert – zweifellos in der Hoffnung, ihre Beziehung könnte sich nach dem Kauf des Gemäldes fortentwickeln. Ein elektronisches Piepsen signalisierte Sarah, dass der Scan akzeptiert worden war. Sie gab ihren persönlichen Code ein, der mit dem in der Galerie identisch war, und hörte das Klacken der zurückgezogenen Schlossriegel.
Sie klappte ihren Schirm zu, drückte die Klinke herunter und trat ein. Im Haus war es totenstill. Sie rief Wiktors Namen, ohne eine Antwort zu bekommen. Sie durchquerte die Diele und stieg die Marmortreppe mit dem roten Läufer in den zweiten Stock hinauf. Die Tür von Wiktors Arbeitszimmer stand halb offen. Sarah klopfte an. Keine Antwort.
Sie rief nochmals Wiktors Namen, dann betrat sie das Zimmer. Es war eine exakte Kopie des privaten Arbeitszimmers der Königin im Buckingham Palace – bis auf die HD-Videowand, über die Aktienkurse und Börsennachrichten aus aller Welt flimmerten. Wiktor saß an seinem Schreibtisch, blickte wie tief in Gedanken versunken zur Decke auf.
Er bewegte sich nicht, als Sarah an den Schreibtisch trat. Vor sich hatte er den abgenommenen Telefonhörer, ein halb leeres Glas Rotwein und einen kleinen Stapel Schriftstücke. Mund und Kinn waren mit weißem Schaum bedeckt, und auf seinem gestreiften Oberhemd hatte er Erbrochenes. Sarah konnte keine Atmung erkennen.
»Oh, Wiktor … Großer Gott!«
Bei der CIA hatte Sarah mehrmals mit Fällen zu tun gehabt, in denen Massenvernichtungswaffen eingesetzt worden waren. Sie erkannte die Symptome. Wiktor war einem Nervengift ausgesetzt gewesen.
Also wahrscheinlich auch Sarah.
Sie stürmte mit einer Hand vor dem Mund aus dem Raum und die Treppe hinunter. Das schmiedeeiserne Tor, der Klingelknopf, der biometrische Scanner, das Tastenfeld – sie alle konnten kontaminiert gewesen sein. Nervengifte wirkten extrem rasch. In ein bis zwei Minuten würde sie Bescheid wissen.
Sarah berührte einen letzten Gegenstand: die Klinke von Wiktors gepanzerter Haustür. Draußen hielt sie ihr Gesicht in den Regen und wartete auf das erste verräterische Anzeichen von Übelkeit. Einer der Personenschützer stieg aus dem Range Rover, aber Sarah warnte ihn, er solle ihr nicht zu nahe kommen. Sie angelte ihr Handy aus ihrer Umhängetasche und wählte eine der unter Favoriten gespeicherten Nummern. Am anderen Ende meldete sich sofort ein Anrufbeantworter. Typisch, dachte sie, wie du unfehlbar den falschen Zeitpunkt erwischst!
»Entschuldige, Liebster«, sagte sie ruhig. »Aber ich fürchte, ich muss vielleicht sterben.«
3
LONDON
Zu den vielen unbeantworteten Fragen im Zusammenhang mit den Ereignissen dieses Abends gehörte die Identität des Mannes, der die Notrufnummer der Metropolitan Police anrief. Der automatisch aufgezeichnete Anruf verriet, dass er Englisch mit starkem französischen Akzent gesprochen hatte. Hinzugezogene Sprachwissenschaftler tippten auf einen Südfranzosen, aber einer vermutete, er stamme von der Insel Korsika. Als er aufgefordert wurde, seinen Namen anzugeben, hatte er das Gespräch abrupt beendet. Seine Handynummer, die in ihrem Kielwasser keine Metadaten hinterlassen hatte, ließ sich nie feststellen.
Der erste Streifenwagen erreichte die angegebene Adresse – 43 Cheyne Walk in Chelsea, eine der feinsten Adressen Londons – nur vier Minuten später. Dort erwartete die Polizeibeamten ein höchst ungewöhnlicher Anblick. Wenige Schritte von der offenen Haustür des eleganten Stadthauses mit Klinkerfassade entfernt stand eine Frau auf dem Gehsteig. In der rechten Hand hielt sie ein Mobiltelefon. Mit ihrer Linken rieb sie sich hektisch das Gesicht, das sie in den strömenden Regen hielt. Von der anderen Seite des schmiedeeisernen Zauns aus beobachteten vier stämmige Männer in dunklen Anzügen sie wie eine Verrückte.
Als einer der Uniformierten sich ihr nähern wollte, rief sie ihm laut zu, er solle stehen bleiben. Dann erklärte sie ihm, der Besitzer des Hauses, der britisch-russische Investor und Verleger Wiktor Orlow, sei mit einem Nervengift – vermutlich aus russischer Produktion – ermordet worden. Die Frau fürchtete, etwas von dem Gift abbekommen zu haben, was ihr Aussehen und Benehmen erklärte. Ihrem Akzent nach war sie eine Amerikanerin, die den Wortschatz der chemischen Kriegsführung perfekt beherrschte. Die Vermutung der Polizeibeamten, sie stamme aus Sicherheitskreisen, bestätigte sich, als sie sich weigerte, ihren Namen zu nennen oder den Grund ihres Besuchs bei Mr. Orlow zu erklären.
Sieben weitere Minuten verstrichen, bevor das erste CBRN-Team in grünen Schutzanzügen das Haus betrat. Im Arbeitszimmer im zweiten Stock fanden sie den russischen Milliardär an seinem Schreibtisch sitzend vor: mit verengten Pupillen, Speichel am Kinn, Erbrochenem auf seinem Hemd – alles Anzeichen für eine Vergiftung mit einem Nervengift. Das Team versuchte nicht, ihn wiederzubeleben. Orlow schien seit über einer Stunde tot zu sein, vermutlich durch Asphyxie oder Herzstillstand nach Versagen der Atemmuskulatur. Bei ersten Messungen wurde Kontamination auf der Schreibtischplatte, am Stiel des Weinglases und am Telefonhörer entdeckt. Alle sonstigen Oberflächen, darunter die Haustür, der Klingelknopf und der biometrische Scanner, erwiesen sich als frei von Kontamination.
Daraus schlossen die Ermittler, das Nervengift müsse Orlow von einem Eindringling oder Besucher direkt beigebracht worden sein. Das Sicherheitsteam des Milliardärs sagte aus, er habe an diesem Abend zweimal Besuch gehabt – beide Male von Frauen. Eine war die Amerikanerin, die das Mordopfer aufgefunden hatte. Die andere war, wenigstens nach Ansicht der Personenschützer, eine Russin gewesen. Die Frau hatte sich nicht identifiziert, und Orlow hatte ihnen keinen Namen genannt. Beides sei normal gewesen, sagten sie aus. Orlow habe sein Privatleben immer streng abgeschottet. Er hatte die Frau an der Haustür sehr herzlich begrüßt – breites Lächeln, Küsschen rechts und Küsschen links – und nach oben in sein Arbeitszimmer mitgenommen, dessen Vorhänge er zugezogen hatte. Sie war etwa eine Viertelstunde lang geblieben und hatte das Haus dann selbstständig verlassen, was für Orlow ebenfalls nicht ungewöhnlich gewesen war.
Es war fast 22 Uhr, als ein vorläufiger erster Bericht des Chefs der Ermittler bei New Scotland Yard einging. Der Wachhabende rief sofort Polizeipräsidentin Stella McEwan an, die ihrerseits den Innenminister verständigte, der die Downing Street alarmierte. Dieser Anruf war unnötig, denn Premierminister Lancaster wusste bereits von der heraufziehenden Krise, weil MI6-Generaldirektor Graham Seymour ihn vor einer Viertelstunde informiert hatte. Der Premierminister war verständlicherweise empört, denn dies schien das zweite Mal in achtzehn Monaten zu sein, dass die Russen mitten in London ein Attentat mit einer Massenvernichtungswaffe verübt hatten. Die beiden Anschläge hatten zumindest eines gemeinsam: den Namen der Frau, die Orlows Leiche entdeckt hatte.
»Was zum Teufel hatte sie in Wiktor Orlows Haus zu suchen?«
»Sie war wegen eines Gemäldeverkaufs dort«, erklärte Seymour ihm.
»Wissen wir bestimmt, dass das alles war?«
»Premierminister?«
»Arbeitet sie etwa wieder für Allon?«
Seymour versicherte Lancaster, das sei nicht der Fall.
»Wo ist sie jetzt?«
»St. Thomas’ Hospital.«
»Ist sie kontaminiert?«
»Das wird noch untersucht. Bis dahin muss ihr Name unbedingt aus den Medien rausgehalten werden.«
Wie bei allen Vorfällen im Inland waren vor allem Seymours Konkurrenten vom MI5 für die Ermittlungen zuständig. Sie konzentrierten ihre Fahndung auf die erste von Orlows Besucherinnen. Mithilfe der zahlreichen Londoner Überwachungskameras hatte die Metropolitan Police bereits festgestellt, dass sie um 18.19 Uhr vor Orlows Haus aus einem Taxi gestiegen war. Die Auswertung weiterer Überwachungsvideos ergab, dass sie dieses Taxi vierzig Minuten früher vor Terminal 5 in Heathrow bestiegen hatte, nachdem sie mit British Airways aus Zürich angekommen war. Die Grenzpolizei identifizierte sie als Nina Antonowa, 42, eine in der Schweiz lebende Bürgerin der Russischen Föderation.
Weil Großbritannien nicht mehr darauf bestand, ankommende Fluggäste Landekarten ausfüllen zu lassen, war ihr Beruf nicht gleich bekannt. Eine einfache Internetsuche ergab jedoch, dass Nina Antonowa als Journalistin bei der Moskowskaja Gaseta arbeitete, einem kremlkritischen Wochenblatt, das niemand Geringerem als Wiktor Orlow gehörte. Nach einem gescheiterten Anschlag auf sie war sie im Jahr 2014 aus Russland geflüchtet. In ihrem Zürcher Exil hatte sie zahlreiche Fälle von Korruption im inneren Kreis des russischen Präsidenten aufgedeckt. Als selbst ernannte Dissidentin trat sie regelmäßig im Schweizer Fernsehen auf, um Ereignisse in Russland zu kommentieren.
Das war kein für eine Auftragsmörderin der Zentrale Moskau typischer Lebenslauf. Trotzdem war das angesichts der bekannten Skrupellosigkeit des Kremls nicht auszuschließen. Jedenfalls war eine polizeiliche Vernehmung angebracht – je früher, desto besser. Wie die Überwachungskameras zeigten, hatte sie Orlows Haus um 18.45 Uhr verlassen und war zu Fuß zum Hotel Cadogan in der Sloane Street gegangen. Ja, bestätigte die Rezeptionistin, eine Nina Antonowa habe am frühen Abend eingecheckt. Nein, sie sei gegenwärtig nicht in ihrem Zimmer. Sie habe das Hotel um 19.15 Uhr verlassen, anscheinend um zum Abendessen zu fahren, und sei noch nicht zurückgekehrt.
Die Überwachungskameras des Hotels hatten ihre Abfahrt aufgezeichnet. Mit ernster Miene war sie hinten in ein Taxi eingestiegen, das der Portier im Regenmantel für sie herangewinkt hatte. Der Wagen hatte sie in kein Restaurant, sondern nach Heathrow gebracht, wo sie um 21.45 Uhr an Bord einer BA-Maschine nach Amsterdam gegangen war. Ein Anruf auf ihrem Handy, dessen Nummer sie beim Einchecken angegeben hatte, blieb unbeantwortet. Daraufhin avancierte Nina Antonowa zur Hauptverdächtigen im Mordfall Wiktor Orlow.
Eine Ironie des Schicksals wollte, dass Samantha Cooke vom Konkurrenzblatt Telegraph als Erste von dem Mord an Orlow berichtete, auch wenn ihr Artikel nur wenige Einzelheiten enthielt. Am Morgen danach bestätigte Premierminister Lancaster Reportern vor der Number Ten, der Milliardär sei mit einem noch unbekannten Gift – höchstwahrscheinlich aus russischer Produktion – ermordet worden. Unerwähnt blieben die Schriftstücke auf Orlows Schreibtisch und die beiden Frauen, die ihn am Abend seiner Ermordung besucht hatten. Eine der beiden war spurlos verschwunden. Die andere lag offenbar gesund zur Beobachtung im St. Thomas’ Hospital. Wenigstens dafür war der Premierminister zutiefst dankbar.
Bei ihrer Einlieferung war sie bis auf die Haut durchnässt und zitterte vor Kälte. Das Personal der Notaufnahme erfuhr keinen Namen, sondern nur ihre Nationalität und ihr ungefähres Alter. Zwei Schwestern zogen ihr die nassen Sachen aus, versiegelten sie in einem roten Plastiksack und gaben ihr Krankenhauskleidung und eine Maske, die sie tragen musste. Ihre Pupillen reagierten normal, ihre Atemwege waren frei. Puls und Atmung waren beschleunigt. Litt sie an Schwindel? Nein. Kopfschmerzen? Ein bisschen, gab sie zu, aber das könne von dem Martini kommen, den sie am frühen Abend getrunken habe. Wo, sagte sie allerdings nicht.
Ihr Zustand ließ darauf schließen, sie habe den flüchtigen Kontakt mit einem Nervengas unbeschadet überstanden. Als Vorsichtsmaßnahme gegen eventuelle Spätfolgen erhielt sie trotzdem Infusionen von Atropin und Pralidoxim. Das Atropin bewirkte einen trockenen Mund und Sehstörungen, hatte aber sonst keine ernstlichen Nebenwirkungen.
Nach vier weiteren Stunden unter Beobachtung wurde sie in ein Zimmer in einem der oberen Stockwerke mit Blick auf die Themse gefahren. Es war fast vier Uhr, als sie endlich einschlief. Dass sie um sich schlug, erschreckte die Nachtschwestern – Muskelkrämpfe gehörten zu den Symptomen einer Vergiftung mit Nervengas –, aber die Ärmste hatte nur einen Albtraum gehabt. Zwei uniformierte Beamte der Metropolitan Police hielten gemeinsam mit einem Mann in einem dunklen Anzug und einem Hörer im Ohr vor ihrer Tür Wache. Später dementierte die Krankenhausverwaltung das beim Personal umlaufende Gerücht, dieser Mann habe zu einer Spezialeinheit für den Schutz der königlichen Familie und des Premierministers gehört.
Es war fast zehn Uhr, als die Frau aufwachte. Nach einem leichten Frühstück mit Kaffee und Toast wurde sie nochmals untersucht. Pupillenreaktion normal, Atemwege frei. Puls, Atmung und Blutdruck ebenfalls normal. Anscheinend, sagte ihr Arzt, sei sie über den sprichwörtlichen Berg.
»Heißt das, ich darf gehen?«
»Noch nicht.«
»Wann?«
»Frühestens am Nachmittag.«
Sie war sichtlich enttäuscht, akzeptierte ihr Schicksal jedoch ohne ein einziges Wort des Protests. Die Schwestern taten ihr Bestes, um ihr den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen, aber alle Versuche, mit ihr über andere Dinge als ihren Zustand ins Gespräch zu kommen, wurden geschickt abgewehrt. Oh, sie war mustergültig höflich, aber zurückhaltend und distanziert. Einen großen Teil des Tages verbrachte sie damit, im Fernsehen die Berichterstattung über den Anschlag auf den russischen Milliardär zu verfolgen. Anscheinend hatte sie irgendetwas damit zu tun, aber die Downing Street war offenbar entschlossen, ihre Rolle geheim zu halten. Das Personal war davor gewarnt worden, ein einziges Wort zu den Medien zu sagen.
Kurz nach 17 Uhr klingelte das Telefon auf ihrem Nachttisch. Am Apparat war die Number Ten – der Premierminister persönlich, wie die Telefonistin schwor, die seine Stimme gehört haben wollte. Wenige Minuten nach dem Gespräch erschien ein jungenhaft aussehender Mann, der wie ein Landgeistlicher auftrat, mit Kleidung zum Wechseln und einem Kulturbeutel mit Toilettenartikeln. Er kritzelte etwas Unleserliches ins Besucherbuch und wartete mit den Polizeibeamten auf dem Korridor, während die Frau duschte und sich anzog. Nach einer letzten Untersuchung, die sie mit fliegenden Fahnen bestand, stimmten die Ärzte ihrer Entlassung zu. Der jungenhaft aussehende Mann schnappte sich prompt das Formular und wies die Oberschwester an, die Akte der Frau aus dem Computersystem zu löschen. Im nächsten Augenblick waren die Akte und die Frau fort.
4
ST. THOMAS’ HOSPITAL, LAMBETH
Vor dem Haupteingang des Krankenhauses wartete ein silberner Bentley Continental, dessen Fahrer lässig an der Beifahrertür lehnte. Über seinem Einreiher von Richard Anderson in der Savile Row trug er einen Burberry Camden, einen kurzen Automantel. Sein Haar war von der Sonne gebleicht, seine Augen leuchteten blau. Sarah zog ihre Maske herunter und küsste ihn auf den Mund, der ständig ironisch zu lächeln schien.
»Hältst du das wirklich für klug?«, fragte Christopher.
»Sehr.« Sie fuhr mit einer Fingerspitze über das Grübchen an seinem energischen Kinn. Seine dunkle Haut war straff. Den Jahren, die er im korsischen Bergland verbracht hatte, verdankte er einen mediterranen Teint. »Du siehst zum Anbeißen gut aus.«
»Hat’s dort drinnen nichts zu essen gegeben?«
»Ich hatte nicht viel Appetit. Nicht nachdem ich Wiktor so gesehen hatte. Aber reden wir lieber von angenehmeren Dingen.«
»Zum Beispiel?«
»Was ich alles mit dir anstellen werde, wenn wir wieder zu Hause sind.«
Christopher hielt ihr lachend die Tür auf, und Sarah glitt auf den Beifahrersitz. Kurz nach ihrem Umzug nach London hatte sie vorgeschlagen, er solle den Bentley gegen einen weniger auffälligen Wagen eintauschen – vielleicht gegen einen Volvo, am liebsten einen Kombi. Von Raffleder umschmeichelt, fragte sie sich jetzt, wie sie auf diese törichte Idee gekommen war. Aus dem Bose-Audiosystem kam einer ihrer Lieblingssongs. Sie summte mit Chet Baker mit, als sie über die Westminster Bridge fuhren.
I fell in love just once, and then it had to be with you …
Der abendliche Berufsverkehr stockte immer wieder. Am anderen Themseufer verbarg ein Baugerüst den Elizabeth Tower und veränderte so die Londoner Skyline. Selbst die berühmte Turmuhr war abgedeckt. Auf der Welt stimmt nichts mehr, dachte Sarah. Um uns herum zerfällt alles.
Everything happens to me …
»Ich wusste gar nicht, dass du eine so schöne Stimme hast«, sagte Christopher.
»Ich dachte, Spione müssten gute Lügner sein.«
»Ich bin Geheimdienstoffizier. Spione sind die Leute, die wir dazu verführen, ihr Land zu verraten.«
»Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich die schlechteste Singstimme der Welt habe.«
»Unsinn.«
»Doch. Das stimmt. Als ich in Brearley in der ersten Klasse war, hat meine Lehrerin mir ins Jahreszeugnis geschrieben, ich könne nicht mal einfachste Lieder singen.«
»Du weißt ja, was die Leute von Lehrern sagen.«
»Miss Hopper«, fauchte Sarah verbittert. »Zum Glück wurde mein Vater wenig später nach London versetzt. Ich habe die American School in St. John’s Woods besucht und konnte die ganze Episode hinter mir lassen.« Sie sah aus dem Seitenfenster, begutachtete die menschenleeren Gehsteige am Birdcage Walk. »In London haben meine Mutter und ich viele lange Spaziergänge gemacht. Als wir noch miteinander geredet haben, meine ich.«
Christophers Marlboros lagen unter seinem goldenen Dunhill-Feuerzeug in der Mittelkonsole. Sarah zögerte kurz, dann zog sie eine Zigarette heraus.
»Rauchen solltest du vielleicht lieber nicht.«
»Hast du nicht gehört, dass es das Coronavirus abtötet?« Sarah betätigte das Feuerzeug und zündete sich eine Zigarette an. »Du hättest mich mal besuchen können, findest du nicht auch?«
»Der NHS untersagt alle Krankenbesuche außer bei Todkranken im Endstadium.«
»Wenn du’s unbedingt wissen willst: Ich habe mich freiwillig dafür gemeldet, vor deiner Tür Wache zu halten, aber davon wollte Graham nichts wissen. Er lässt dich übrigens herzlich grüßen.«
Christopher schaltete rechtzeitig Radio Four ein, um die Sechsuhrnachrichten zu hören. Der Mordanschlag auf Wiktor Orlow hatte es geschafft, die Pandemie als Aufmacher zu verdrängen. Der Kreml hatte bestritten, irgendetwas damit zu tun gehabt zu haben, und die britischen Geheimdienste beschuldigt, sie wollten Russland in Misskredit bringen. Wie die BBC meldeten, hatten die britischen Behörden das im Fall Orlow benutzte Nervengas noch nicht identifiziert. Auch wie es ins Haus des Milliardärs am Cheyne Walk gelangt war, war noch nicht geklärt.
»Du weißt bestimmt mehr«, vermutete Sarah.
»Viel mehr.«
»Was für ein Nervengas war das?«
»Das ist leider geheim, Darling.«
»Ich habe eine Freigabe dafür.«
Christopher lächelte. »Bei der Substanz handelt es sich um Nowitschok. Das ist …«
»Eine in den siebziger Jahren in der Sowjetunion entwickelte tödliche Waffe. Nach Auskunft der beteiligten Wissenschaftler ist es fünf- bis achtmal giftiger als VX, womit es die tödlichste jemals produzierte Waffe wäre.«
»Stimmt genau.«
»Aber wie ist das Nowitschok in Wiktors Arbeitszimmer gelangt?«
»Die Schriftstücke auf seinem Schreibtisch waren mit ultrafeinem Nowitschok-Pulver bestreut.«
»Was für Dokumente waren das?«
»Die Bilanz irgendeiner Firma.«
»Wie sind sie dorthin gekommen?«
»Ah«, sagte Christopher, »da fängt die Sache an, interessant zu werden.«
»Weißt du bestimmt«, fragte Sarah, als Christopher fertig war, »dass die Frau, die Wiktor vor mir besucht hat, wirklich Nina Antonowa war?«
»Wir haben ein in Heathrow gemachtes Foto mit Fernsehbildern aus jüngster Zeit verglichen. Die Gesichtserkennungssoftware hat bestätigt, dass es sich um dieselbe Frau handelt. Und Wiktors Personenschützer haben ausgesagt, er habe sie wie eine alte Freundin begrüßt.«
»Eine alte Freundin mit einem Stapel vergifteter Schriftstücke?«
»Will der Kreml jemanden liquidieren, ist’s normalerweise ein Geschäftsfreund oder Bekannter, der Gift in den Champagner kippt. Du brauchst nur den saudischen Kronprinzen Abdullah zu fragen.«
»Das tue ich bestimmt nicht.« Sie erreichten den Sloane Square. Die dunkle Fassade des Royal Court Theatre glitt an Sarahs Fenster vorbei. »Wie lautet also eure Theorie? Nina Antonowa, eine bekannte investigative Journalistin und überzeugte Dissidentin, ist von den russischen Diensten dafür angeworben worden, den Mann zu ermorden, der im Alleingang ihre Zeitschrift gerettet hat?«
»Habe ich ›angeworben‹ gesagt?«
»Allerdings!«
Christopher bog auf die King’s Road ab. »Vauxhall Cross und unsere Kollegen im Thames House sind übereinstimmend der Ansicht, dass Nina Antonowa eine SWR-Agentin ist, die vor Jahren die Moskowskaja Gaseta unterwandert und seither auf ihre Chance gewartet hat.«
»Wie erklärt ihr den Anschlag auf sie, der sie gezwungen hat, Russland zu verlassen?«
»Mit ausgezeichneter Arbeit der Zentrale Moskau.«
Sarah verwarf diese Theorie nicht ohne Weiteres. »Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit.«
»Welche?«
»Sie ist unter Vorspieglung falscher Tatsachen veranlasst worden, Wiktor die Schriftstücke zu übergeben. Bedenkt man die seltsamen Umstände ihrer Flucht aus London, ist das sogar die wahrscheinlichste Erklärung.«
»Daran war nichts seltsam. Sie war fort, bevor wir auch nur ihren Namen wussten.«
»Warum hat sie sich ein Hotelzimmer genommen, statt direkt zum Flughafen zu fahren? Und wieso ist sie statt nach Moskau nach Amsterdam geflogen?«
»Um diese Zeit hat’s keinen Direktflug nach Moskau gegeben. Wir vermuten, dass sie heute Morgen unter einem anderen Namen hingeflogen ist.«
»Ohnehin dürfte sie inzwischen tot sein. Mich wundert, dass sie’s lebend nach Heathrow geschafft hat.«
Christopher bog auf die Old Church Street ab und fuhr durch Kensington nach Norden weiter. »Ich dachte, CIA-Analysten seien dafür ausgebildet, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen.«
»Wenn hier jemand voreilige Schlüsse zieht, dann seid das ihr und eure Kollegen vom MI5.« Sarah betrachtete die Glut ihrer Zigarette. »Wiktors Telefonhörer war abgenommen, als ich eingetreten bin. Er muss vor seinem Tod jemanden angerufen haben.«
»Das war Nina.«
»Ach, wirklich?«
»Sie war in ihrem Zimmer im Hotel Cadogan, das sie wenige Minuten später verlassen hat.«
»Hat das GCHQ Wiktors Telefone abgehört?«
»Die britische Regierung lässt keine prominenten Zeitungsverleger abhören.«
»Wiktor Orlow war kein gewöhnlicher Verleger.«
»Genau deshalb ist er tot«, sagte Christopher.
»Worüber haben die beiden wohl geredet?«
»Ich denke, dass er ziemlich sauer auf Nina war, weil sie ihn vergiftet hatte.«
Sarah runzelte die Stirn. »Glaubst du wirklich, dass jemand wie Wiktor seine letzten Augenblicke damit vergeudet hätte, seiner Mörderin Vorwürfe zu machen?«
»Wozu hätte er sie sonst anrufen sollen, als sie sein Haus schon zwanzig Minuten verlassen hatte?«
»Um sie zu warnen, dass sie als Nächste drankommen würde.«
Christopher bog auf die Queen’s Gate Terrace ab. »Du bist ziemlich gut, muss ich sagen.«
»Für eine Kunsthändlerin«, ergänzte Sarah.
»Eine Kunsthändlerin mit schillernder Vergangenheit.«
»Das sagt der Richtige!«
Christopher parkte den Bentley vor einem cremeweißen Stadthaus im georgianischen Stil. Sarah und er bewohnten die Maisonette im Erdgeschoss und dem ersten Stock. Eigentümerin des Apartments im zweiten Stock war eine anonyme Holding auf den Cayman Islands. Fast hunderttausend britische Luxusimmobilien, viele in angesagten Londoner Vierteln wie Kensington oder Knightsbridge, gehörten anonymen Eigentümern. Nicht einmal der MI6 hatte Christophers ständig abwesenden Nachbarn identifizieren können.
Er stellte den Motor ab, zögerte dann aber, bevor er seine Tür öffnete.
»Irgendwas nicht in Ordnung?«, fragte Sarah.
»In der Küche brennt Licht.«
»Du musst es angelassen haben, als du heute Morgen aus dem Haus gegangen bist.«
»Garantiert nicht.« Christopher griff in sein Jackett und zog seine Walther PPK. »Du wartest hier. Bin gleich wieder da.«
5
NAHALAL, ISRAEL
Als Direktor des Diensts konnte Gabriel Allon fast nach Belieben über sichere Häuser verfügen. Er zog jedoch eine ethische Linie, wenn es darum ging, sich eines zu reservieren, damit seine Frau und die Zwillinge während des Lockdowns aus ihrem beengten Apartment in Jerusalem herauskamen. Auf seine Bitte hin errechnete die Hausverwaltung eine realistische Vergleichsmiete. Gabriel verdoppelte sie prompt und veranlasste, dass der Betrag von seinem Gehalt abgezogen wurde. Um den Vorgang ganz transparent zu machen, schickte er alle Unterlagen zur Genehmigung in die Kaplan Street. Der selbst wegen Korruption angeklagte Ministerpräsident fragte sich, was der ganze Aufwand sollte.
Das betreffende Anwesen war keineswegs luxuriös. Der nicht sehr große Bungalow, der sonst für Nachbesprechungen und als vorläufige Unterkunft für enttarnte Agenten diente, lag in Nahalal, einem alten Moschaw im Jesreel-Tal, ungefähr eine Stunde nördlich des King Saul Boulevards. Seine Einrichtung war spärlich, aber behaglich, und Küche und Bad waren frisch renoviert. Es gab Kühe auf der Weide, Hühner auf dem Hof, mehrere Hektar Ackerland und einen schattigen Garten unter Eukalyptusbäumen. Weil die örtliche Polizei die Siedlung zuverlässig im Auge behielt, gab es keine Sicherheitsbedenken.
Chiara und die Kinder bezogen den Bungalow Ende März und blieben auch dort, als der angenehm warme Frühling in den glutheißen Hochsommer überging. Die Nachmittage waren fast unerträglich, aber jeden Abend wehte ein kühler Wind aus Obergaliläa. Das Freibad des Moschaws blieb auf behördliche Anordnung geschlossen, und eine sommerliche Infektionswelle verhinderte, dass die Zwillinge mit anderen Kindern spielten. Aber das machte nichts, denn Irene und Raphael dachten sich komplizierte Spiele aus, in die ihre Hühner und die Ziegen des Nachbarn einbezogen wurden. Mitte Juni waren beide braun gebrannt. Chiara rieb sie dick mit UV-Blocker ein, aber irgendwie wurden sie noch dunkler.
»Genauso ist’s den Siedlern ergangen, die 1921 den Moschaw gegründet haben«, erläuterte Gabriel. »Raphael und Irene sind keine verhätschelten Städter mehr. Sie sind Kinder des Tals.«
Während der ersten Welle der Pandemie war er meist fort gewesen. In einer neuen Gulfstream und mit Koffern voller Geld war er weltweit unterwegs gewesen, um Beatmungsgeräte, PCR-Tests und Schutzkleidung für medizinisches Personal einzukaufen. Dieses Material – überwiegend Schwarzmarktkäufe – brachte er persönlich nach Israel, wo es an Krankenhäuser verteilt wurde. Als die Presse Wind von seinen Aktivitäten bekam, schlug ein einflussreicher Kolumnist der Haaretz vor, er solle nach dem Ausscheiden aus dem Dienst in die Politik gehen. Die Reaktion darauf war so günstig, dass viele Medien sich fragten, ob das ein Versuchsballon gewesen sei. Gabriel, dem die unerwünschte Aufmerksamkeit peinlich war, dementierte solche Pläne energisch, was die Medien als eindeutigen Beweis dafür ansahen, dass er nach seiner Pensionierung für die Knesset kandidieren würde. Die einzig ungeklärte Frage, behaupteten sie, sei die nach seiner Parteizugehörigkeit.
Anfang Juni war der Dienst jedoch wieder mit traditionellen Aufgaben befasst. Durch neue Erkenntnisse über Teherans Entschlossenheit, Atomwaffen zu bauen, alarmiert, legte Gabriel eine Anlage zur Urananreicherung in Natanz durch eine große Sprengladung lahm. Sechs Wochen später liquidierte ein Team des Diensts auf Bitten der Amerikaner durch ein kühnes Unternehmen mitten in Teheran einen ranghohen Al-Qaida-Führer. Gabriel informierte einen freundlich gesinnten Journalisten der New York Times über Einzelheiten des Attentats, auch um die Iraner daran zu erinnern, dass er jederzeit in ihr Land eindringen und dort zuschlagen konnte.
Trotz der vielen im Sommer laufenden Unternehmen war er oft rechtzeitig zum Abendessen in Nahalal. Chiara deckte den Tisch draußen im kühleren Garten, und Irene und Raphael erzählten fröhlich, was sie tagsüber gemacht hatten – immer das Gleiche wie am Vortag. Anschließend nahm Gabriel sie zu einem Spaziergang auf staubigen Feldwegen mit und erzählte ihnen Geschichten von seiner Kindheit in dem jungen Staat Israel.
Zur Welt gekommen war er in dem benachbarten Kibbuz Ramat David. Damals hatte es natürlich keine Computer oder Mobiltelefone gegeben; auch kein Fernsehen, das in Israel erst 1966 eingeführt worden war. Und selbst dann hatte seine Mutter keinen Fernseher im Haus geduldet, weil sie fürchtete, er könnte ihre künstlerische Arbeit beeinträchtigen. Gabriel erzählte den Kindern, wie er zu ihren Füßen gesessen hatte, wenn sie malte, und ihre Pinselstriche auf einer eigenen kleinen Leinwand imitiert hatte. Die in ihren linken Unterarm eintätowierte Häftlingsnummer erwähnte er nicht. Auch nicht die Kerzen, die in seinem Elternhaus für die in den Lagern ermordeten Angehörigen gebrannt hatten. Auch nicht die Schreie, die manchmal nachts aus anderen Häusern zu hören waren, wenn die Dämonen kamen.
Allmählich erzählte er ihnen mehr von sich – ein Hinweis hier, ein Fragment dort, Halbwahrheiten mit Ausflüchten vermengt, manchmal auch regelrechte Lügen, um sie vor den Schrecken des Lebens, das er geführt hatte, zu schützen. Ja, sagte Gabriel, er sei ein Soldat gewesen, aber kein besonders guter. Nach dem Wehrdienst habe er an der Bezalel-Akademie für Kunst und Design studiert. Um Kunstmaler zu werden. Aber nach dem Münchner Olympiaattentat im Herbst 1972 hatte Ari Schamron, den die Kinder ihren Saba nannten, ihn aufgefordert, an der Operation Zorn Gottes teilzunehmen. Er erzählte den Kindern nicht, dass er persönlich sechs an dem Anschlag beteiligte Palästinenser liquidiert hatte – möglichst mit jeweils elf Schüssen. Aber er deutete an, diese Erfahrung habe ihm die Fähigkeit geraubt, Originale zu malen, die seinen Ansprüchen genügten. Statt seine Talente verkümmern zu lassen, hatte er Italienisch gelernt und war nach Venedig gegangen, um eine Ausbildung zum Restaurator zu machen.
Aber Kinder, speziell die Kinder von Geheimdienstlern, sind nicht leicht zu täuschen, und Irene und Raphael ahnten intuitiv, dass die Lebensgeschichte ihres Vaters keineswegs vollständig war. Sie sondierten behutsam und unter Anleitung ihrer Mutter, die eine Aufklärung über einige Leichen in Gabriels Keller für überfällig hielt. Beispielsweise wussten die Kinder, dass er schon einmal verheiratet gewesen war – und dass das Gesicht seines toten Sohns in den Wolken, die Gabriel an die Wand des Kinderzimmers gemalt hatte, über sie wachte. Aber wie war das passiert? Er antwortete mit einer stark redigierten Version der Wahrheit, denn er wusste, dass er damit die Büchse der Pandora öffnete.
»Schaust du deswegen immer unters Auto, bevor wir einsteigen dürfen?«
»Ja.«
»Liebst du Dani mehr als uns?«
»Natürlich nicht. Aber wir dürfen ihn nie vergessen.«
»Wo ist Leah?«
»Sie lebt nicht weit von uns entfernt in einer Spezialklinik in Jerusalem.«
»Hat sie uns jemals gesehen?«
»Nur Raphael.«
»Warum?«
Weil es Gott in seiner unendlichen Weisheit gefallen hatte, Raphael zu einem Doppelgänger von Gabriels totem Sohn zu machen. Auch das verschwieg er den Kindern – zu ihrem Wohl ebenso wie zu seinem. Während Chiara in dieser Nacht ruhig neben ihm schlief, erlebte er im Traum nochmals den Bombenanschlag in Wien und schrak schweißnass hoch, als das Telefon auf dem Nachttisch klingelte. So war es vielleicht passend, dass der Anrufer aus London meldete, ein alter Freund sei dort ermordet worden.
Er duschte und zog sich an, ohne Licht zu machen, und stieg in seinen SUV, um zum King Saul Boulevard zu fahren. Nach einer Temperaturmessung und einem Covid-Schnelltest fuhr er mit seinem Privataufzug in sein steriles Büro im obersten Stock hinauf. Nachdem er sich angesehen hatte, wie der britische Premierminister vor der Number Ten stehend ausweichend auf Reporterfragen antwortete, rief er zwei Stunden später Graham Seymour über die abhörsichere Leitung an. Graham gab keine zusätzlichen Informationen über den Mordfall preis, teilte ihm aber mit, wer den Toten aufgefunden hatte. Gabriel reagierte mit einer Frage, die der Premierminister schon am Vorabend gestellt hatte:
»Was zum Teufel hatte sie in Wiktor Orlows Haus zu suchen?«
Wenn es einen Lichtblick in Gabriels Post-Covid-Existenz gab, war das die neue Gulfstream G550. Der erstaunlich luxuriöse Jet mit zweifelhafter Kennung setzte an diesem Nachmittag um 16.30 Uhr auf dem London City Airport auf. Der Pass, den Gabriel bei der Kontrolle vorlegte, war ein auf einen anderen Namen ausgestellter israelischer Diplomatenpass, der niemanden täuschte.
Trotzdem durfte er nach einem weiteren Covid-Schnelltest vorläufig ins Vereinigte Königreich einreisen. Eine bereitstehende Limousine der Botschaft brachte ihn zum Haus 18 Queen’s Gate Terrace in Kensington. Neben dem Klingelknopf der unteren Maisonettewohnung stand der Name Peter Marlowe. Als sein Klingeln erfolglos blieb, stieg Gabriel die schmiedeeiserne Treppe zum Eingang hinunter und zog den schlanken elektrischen Dietrich, den er immer bei sich hatte, aus der Tasche. Keines der beiden teuren Sicherheitsschlösser hielt lange stand.
Drinnen protestierte die Alarmanlage aufgeregt zirpend. Gabriel gab den korrekten achtstelligen Code ein und machte Licht in der geräumigen Designerküche. Der Stein der Arbeitsplatten kam ebenso aus Korsika wie die Flasche Rosé, die er aus dem gut gefüllten Kühlschrank der Marke Sub-Zero holte. Er entkorkte die Flasche und schaltete das auf einer Arbeitsplatte stehende Bose-Radio ein.
Die russische Regierung hat jeglichen Verdacht einer Verwicklung in Mr. Orlows Tod zurückgewiesen …
Dem BBC-Nachrichtensprecher gelang nur ein holpriger Übergang von Orlows Ermordung zu den neuesten Pandemie-Meldungen. Gabriel stellte das Radio ab und schenkte sich ein Glas Wein ein. Kurz nach 18.20 Uhr fuhr draußen endlich ein Bentley Continental vor, aus dem ein gut gekleideter Mann ausstieg. Wenig später stand er mit einer Walther PPK in den ausgestreckten Händen in der offenen Küchentür.
»Hallo, Christopher«, sagte Gabriel und hob grüßend sein Weinglas. »Steck bitte die verdammte Pistole weg, bevor einem von uns was passiert.«
6
QUEEN’S GATE TERRACE, KENSINGTON
Christopher Keller gehörte einem äußerst exklusiven Club an: der Bruderschaft von Terroristen, Auftragsmördern, Spionen, Waffenhändlern, Kunstdieben und abgefallenen Priestern, die versucht hatten, Gabriel Allon zu ermorden, und noch lebten. Christophers Motive für die Annahme dieser Herausforderung waren mehr finanziell als politisch gewesen. Damals hatte er für einen gewissen Don Antonio Orsati gearbeitet, das Oberhaupt einer auf Auftragsmorde spezialisierten korsischen Verbrecherfamilie. Im Gegensatz zu seinen vielen amateurhaften Vorgängern war Christopher ein wahrhaft würdiger Gegner gewesen, ein ehemaliger SAS-Offizier, der als Angehöriger dieser Eliteeinheit auf dem Höhepunkt der »Troubles« verdeckt in Nordirland eingesetzt gewesen war. Gabriel hatte nur überlebt, weil Christopher in einem Akt professioneller Höflichkeit darauf verzichtet hatte, abzudrücken, als sich ihm eine Möglichkeit geboten hatte. Einige Jahre später hatte Gabriel sich dafür revanchieren können, indem er Graham Seymour davon überzeugt hatte, Christopher einen Job beim MI6 zu geben.
Als Bestandteil seiner Wiedereingliederung hatte Christopher das beträchtliche Vermögen, das er in Don Orsatis Diensten angesammelt hatte, behalten dürfen. Einen Teil davon – genau gesagt acht Millionen Pfund – hatte er für die Maisonettewohnung an der Queen’s Gate Terrace ausgegeben. Bei Gabriels letztem unangemeldeten Besuch war sie weitgehend unmöbliert gewesen. Jetzt war sie sehr geschmackvoll eingerichtet, und in der Luft lag ein schwacher, aber unverkennbarer Geruch nach frischer Farbe. Offenbar hatte Christopher Sarah freie Hand gelassen und ihr unbegrenzte Mittel zur Verfügung gestellt. Gabriel, der ihre Beziehung widerstrebend gebilligt hatte, war überzeugt gewesen, sie würde nach kurzer Zeit katastrophal enden. Trotz Bedenken wegen ihrer Sicherheit hatte er sogar dafür gesorgt, dass sie in Julians Galerie arbeiten konnte. Jetzt musste er zugeben, dass sie trotz ihrer erst vor Kurzem überstandenen Lebensgefahr glücklicher wirkte als seit Jahren. Wenn irgendjemand sich ein Anrecht auf Glück verdient hat, dachte Gabriel, dann ist das Sarah Bancroft.
Jetzt saß sie barfuß und mit einem Weinglas in der Hand halb liegend in einem der großen Polstersessel im Wohnzimmer. Ihre blauen Augen fixierten Christopher, der in dem zweiten Sessel rechts neben ihr saß. Gabriel gehörte das Sofa gegenüber, auf dem er vor ihren Viren sicher war – und sie vor seinen. Sarah hatte ihn freudig überrascht, aber ohne Küsschen oder auch nur eine flüchtige Umarmung begrüßt. Das waren die Sitten der schönen neuen Covid-Welt: Jeder war ein Unberührbarer. Oder vielleicht versucht Sarah nur, mich auf Abstand zu halten, dachte Gabriel. Sie hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie ihn verzweifelt liebte, sogar noch, als sie ihn gebeten hatte, ihrer Übersiedlung von New York nach London zuzustimmen. Anscheinend war es Christopher gelungen, endlich den Bann zu brechen. Gabriel hatte den Eindruck, in einem intimen Augenblick zu stören. Aber er wollte noch ein paar Dinge aufklären, bevor er sich verabschiedete.
»Und du bist von der Zuschreibung überzeugt?«, fragte er.
»Sonst hätte ich das Gemälde nicht Wiktor angeboten. Das wäre unethisch gewesen.«
»Seit wann hat Kunsthandel etwas mit Ethik zu tun?«
»Oder Geheimdienstarbeit«, ergänzte Sarah.
»Aber italienische Altmeister sind nicht gerade deine Spezialität, stimmt’s? Wenn ich mich recht erinnere, bist du in Harvard mit einer Arbeit über die deutschen Expressionisten promoviert worden.«
»Im zarten Alter von achtundzwanzig Jahren.« Sie benutzte nur ihren Mittelfinger, um sich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht zu streichen. »Und davor habe ich, wie du recht gut weißt, meinen Master in Kunstgeschichte am Courtauld Institute hier in London gemacht.«
»Hast du eine zweite Meinung eingeholt?«
»Niles Dunham. Er hat mir auf der Stelle achthunderttausend Pfund geboten.«
»Für einen Gentileschi? Lächerlich!«
»Das habe ich ihm auch gesagt.«
»Trotzdem wärst du insgesamt besser beraten gewesen, sein Angebot anzunehmen.«
»Morgen früh rufe ich ihn als Erstes an, darauf kannst du dich verlassen.«
»Tu’s bitte nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil man nie weiß, wann man ein neu entdecktes Werk von Artemisia Gentileschi brauchen könnte.«
»Es müsste restauriert werden«, sagte Sarah.
»An welchen Restaurator denkst du?«
»Nachdem du nicht zur Verfügung stehst, habe ich gehofft, David Bull dafür gewinnen zu können.«
»Ich dachte, er sei derzeit in New York.«
»Richtig. Wir haben uns vor meiner Abreise zum Lunch getroffen. Ein reizender Mann.«
»Hast du mit ihm darüber gesprochen?«
Sarah schüttelte den Kopf.
»Wer außer Julian wusste von dem Verkauf an Wiktor?«
»Niemand.«
»Und du hast nicht zufällig im Wilton’s irgendwelche Andeutungen gemacht?«
»Als ehemalige Geheimagentin mache ich keine unüberlegten Andeutungen.«
»Und was ist mit Wiktor?«, fragte Gabriel drängend. »Hat er irgendwem erzählt, dass er dich gestern Abend bei sich erwartet hat?«
»Bei Wiktor ist alles möglich, denke ich. Aber warum fragst du das?«
Christopher antwortete an Gabriels Stelle. »Er fragt sich, ob die Russen versucht haben, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.«
»Wiktor und mich?«
»In Bezug auf die Russen hast du eine ziemlich lange Vorgeschichte«, stellte Gabriel fest. »Sie reicht bis zu unserem alten Freund Iwan Charkow zurück.«
»Hätte die Zentrale Moskau mich liquidieren wollen, hätte jemand einen Besichtigungstermin bei Isherwood Fine Arts vereinbart.«
Gabriel wandte sich an Christopher. »Und ihr wisst bestimmt, dass Nina Antonowa die kontaminierten Schriftstücke überbracht hat?«
»Wir haben nicht gesehen, wie sie die Dokumente auf Wiktors Schreibtisch gelegt hat, wenn du das meinst. Aber er hat sie von jemandem bekommen, und Nina ist die wahrscheinlichste Kandidatin.«
»Wieso hat Jonathan ihren Namen heute Morgen vor der Number Ten nicht erwähnt?«
»Nationalstolz. Wie du dir denken kannst, hat es viele rote Köpfe gegeben, als klar wurde, dass sie das Land verlassen hatte, bevor wir auch nur angefangen haben, sie zu suchen. Der Innenminister hat für morgen Vormittag zu einer Pressekonferenz eingeladen.«
»Aber was ist, wenn Sarah recht hat? Was ist, wenn Nina die Schriftstücke überbracht hat, weil sie selbst getäuscht worden ist? Und was ist, wenn Wiktor sie vor seinem Tod noch warnen konnte?«
»Sie hätte die Polizei alarmieren sollen, statt ins Ausland zu flüchten.«
»Nina traut der Polizei nicht. Als russische Journalistin tätest du das auch nicht.«
Gabriels Smartphone vibrierte, als eine Nachricht einging. Er hatte letztlich doch auf sein geliebtes BlackBerry Key2 verzichten müssen. Sein neues Gerät war ein israelisches Solaris, angeblich das sicherste Mobiltelefon der Welt. Gabriels Smartphone war seinen speziellen Bedürfnissen entsprechend modifiziert worden. Sein Handy, das größer und schwerer als normale Geräte war, konnte Lauschangriffen der raffiniertesten Hacker der Welt – auch der amerikanischen NSA oder des russischen Speziellen Nachrichtendiensts – widerstehen.
Christopher betrachtete Gabriels Handy neidisch. »Ist es so sicher, wie behauptet wird?«
»Ich könnte eine E-Mail mitten aus dem Doughnut verschicken und sicher sein, dass eure Regierung sie nicht mitlesen kann.« Als Doughnut bezeichneten die britischen GCHQ-Mitarbeiter ihre runde Zentrale in Cheltenham.
»Darf ich’s wenigstens mal in die Hand nehmen?«, fragte Christopher.
»Im Covid-Zeitalter? Denk nicht mal dran.« Als Gabriel seinen vierzehnstelligen Code eingab, erschien die Nachricht auf dem Display. Er las sie stirnrunzelnd.
»Irgendwas nicht in Ordnung?«
»Graham hat mich zum Abendessen eingeladen. Helen will anscheinend Couscous kochen.«
»Mein Beileid. Nur schade, dass ich nicht mitkommen darf.«
»Tatsächlich bist du auch eingeladen.«
»Sag Graham, dass ich ein andermal komme.«
»Er ist der Generaldirektor deines Diensts.«
»Das weiß ich«, sagte Christopher mit einem Blick zu der blonden Schönheit in dem anderen Sessel. »Aber ich habe leider ein besseres Angebot.«
7
EATON SQUARE, BELGRAVIA
Als Helen Liddell-Brown Graham Seymour auf einer Party in Cambridge kennenlernte, erzählte er ihr, sein Vater arbeite in einer sehr langweiligen Abteilung des Außenministeriums. Das glaubte sie ihm nicht, denn ihr Onkel bekleidete einen hohen Posten in derselben Abteilung, die Insider als die »Firma« bezeichnen, während der Rest der Welt sie als MI6 kannte. Sie akzeptierte Grahams Heiratsantrag unter der Bedingung, dass er sich einen anständigen Job in der City suchte. Aber ein Jahr nach ihrer Hochzeit überraschte er sie dadurch, dass er zum MI5 ging – ein Verrat, den Helen, aber auch Grahams eigener Vater, ihm nie ganz verzieh.
Sie bestrafte Graham dafür, indem sie dediziert linke Positionen einnahm. Sie demonstrierte gegen den Falklandkrieg, ging für atomare Abrüstung auf die Straße und wurde zweimal vor der südafrikanischen Botschaft am Trafalgar Square verhaftet. Graham wusste nie, welche Schrecken ihn in der Post erwarteten, wenn er abends vom Dienst heimkam. Einem Kollegen gegenüber bemerkte er einmal, wenn Helen nicht seine Frau wäre, hätte er eine Akte über sie angelegt und ihr Telefon überwachen lassen.
Falls sie’s insgeheim darauf anlegte, seine Karriere zu torpedieren, war ihre Kampagne ein kläglicher Misserfolg. Nach mehrjährigem Einsatz in Nordirland übernahm er die Leitung der MI5-Abteilung Spionageabwehr und wurde wenig später zum stellvertretenden Direktor der Operationsabteilung befördert. Er hatte die Absicht, nach seiner Pensionierung in seine Villa in Portugal überzusiedeln. Seine Lebensplanung änderte sich jedoch, als Premierminister Lancaster ihm die Schlüssel zum ehemaligen Dienst seines Vaters anbot – ein Schachzug, der die gesamte Geheimdienstwelt außer Gabriel überraschte, der dafür gesorgt hatte, dass die Umstände eintraten, die zu dem Angebot an Graham geführt hatten. Weil die in politische Streitigkeiten verwickelten Amerikaner ihren Blick nach innen richteten, waren die Beziehungen zwischen dem Dienst und MI6 sehr eng geworden. Die beiden Organisationen arbeiteten gewohnheitsmäßig zusammen, und der Austausch wichtiger Informationen zwischen Vauxhall Cross und King Saul Boulevard funktionierte weitgehend reibungslos. Gabriel und Graham betrachteten sich als Verteidiger der internationalen Nachkriegsordnung. Angesichts des gegenwärtigen Zustands der Weltpolitik war das eine zunehmend undankbare Aufgabe.
Helen Seymour hatte den Aufstieg ihres Ehemanns auf den Gipfel der britischen Nachrichtendienste bestenfalls widerstrebend akzeptiert. Auf Grahams Bitte hatte sie ihre politische Betätigung reduziert und sich von einigen ihrer radikaleren Freunde distanziert. Sie machte jeden Morgen Yoga und verbrachte ihre Nachmittage in der Küche, wo sie ihrer Leidenschaft für exotische Gerichte frönte. Bei seinem letzten Besuch im Hause Seymour hatte Gabriel entgegen der jüdischen Speisevorschriften heldenhaft einen Teller Paella gegessen. Der Couscous mit Huhn war ein seltener Triumph. Selbst Graham, der Übung darin hatte, Essen auf dem Teller herumzuschieben, als äße er es wirklich, nahm sich eine zweite Portion.
Nach dem Essen tupfte er sich mit einer Leinenserviette den Mund ab und lud Gabriel nach oben in sein Arbeitszimmer mit den wandhohen Bücherregalen ein. Durch das zum Eaton Square hin weit offene Fenster wehte frische Luft herein. Gabriel bezweifelte den Wert solcher Vorkehrungen, die seiner Meinung nach nur die Verbreitung des Virus förderten. Er sah auf den Großbildfernseher, der auf CNN eingestellt war. Eine Expertenrunde diskutierte über die nur mehr ein Vierteljahr entfernten US-Präsidentschaftswahlen.
»Wie lautet deine Voraussage?«, fragte Graham.
»Ich glaube, dass Christopher Sarah spätestens Anfang des Jahres einen Heiratsantrag machen wird.«
»Ich meinte eher die Wahlen.«
»Der Ausgang wird knapper, als die Meinungsumfragen vermuten lassen, aber er kann nicht gewinnen.«
»Wird er den Wahlausgang akzeptieren?«
»Niemals.«
»Und was dann?«
Graham trat ans Fenster und zog das Schiebefenster mühelos herunter. Dabei schien er für eine so triviale Aufgabe ungeeignet zu sein. Mit seinen markanten Zügen und der ergrauten Lockenmähne erinnerte er Gabriel an eines dieser Models in Anzeigen für goldene Füllfederhalter, sündhaft teure Armbanduhren und ähnliche Luxusartikel, die in der Pandemie aus der Mode gekommen waren. Auf weniger imposante Erscheinungen, vor allem auf Amerikaner, wirkte Graham einschüchternd.
»Wie man hört, bist du mit einer luxuriösen neuen Gulfstream angekommen«, sagte er, als er an seinen Platz zurückkehrte. »Die Registrierung gibt allerdings Rätsel auf.«
»Aus gutem Grund. Meine vielen Freunde und Bewunderer in der Islamischen Republik sind im Augenblick ziemlich wütend auf mich.«
»Das kommt davon, dass du ihre Anlage zur Urananreicherung in die Luft gesprengt hast. Ehrlich gesagt wundert mich, dass du bei deinem Arbeitspensum kurzfristig Zeit für einen Ausflug nach London gefunden hast.«
»Eine liebe Freundin ist gesundheitlich angeschlagen. Ich dachte, ich sollte ihr einen Besuch abstatten.«
»Deiner lieben Freundin fehlt nichts.«
»Leider lässt sich das von Wiktor Orlow nicht sagen.«
»Wiktor geht dich nichts an.«
»Er war mein Informant, Graham. Und wäre er weniger großzügig gewesen, wäre ich jetzt tot. Meine Frau auch.«
»Wenn ich mich recht erinnere«, sagte Graham, »habe ich Wiktor dazu überredet, seine Ölfirma gegen eure Freilassung einzutauschen. Wäre er vernünftig gewesen, hätte er unauffälliger gelebt. Stattdessen hat er die Gaseta herausgegeben und sich damit bewusst ins Fadenkreuz des Kremls gestellt. So war’s nur eine Frage der Zeit, bis ein Killer auf ihn angesetzt wurde.«
»Nina Antonowa?«
Graham verzog das Gesicht. »Vielleicht sollten wir bei passender Gelegenheit gewisse Grenzen zwischen deinem Dienst und meinem ziehen.«
»Du hältst sie nicht wirklich für eine Attentäterin der Zentrale Moskau, stimmt’s?«
»Manchmal ist zwei plus zwei tatsächlich vier.«
»Aber manchmal ist’s auch fünf.«
»Nur in Zimmer 101 des Ministeriums für Liebe, Winston.«
»Sarah hat eine interessante Theorie«, fuhr Gabriel fort. »Sie glaubt, dass Nina unter Vortäuschung falscher Tatsachen veranlasst worden ist, die kontaminierten Schriftstücke zu überbringen.«
»Und wann ist Sarah zu diesem Schluss gelangt? In den dreißig Sekunden, die sie in Wiktors Arbeitszimmer zugebracht hat?«
»Ich gebe viel auf ihren Instinkt.«
»Das überrascht mich nicht. Schließlich hast du sie selbst ausgebildet. Aber eine so gefährliche Waffe hätte die Zentrale Moskau nur jemandem anvertraut, den sie vollständig unter Kontrolle hat.«
»Wieso das?«
»Stell dir vor, was passiert wäre, wenn sie das Päckchen auf dem Flug von Zürich nach London geöffnet hätte!«
»Aber sie hat’s nicht getan. Sie hat es Wiktor überbracht. Und Wiktor, der in Bezug auf seine Sicherheit mit Recht paranoid war, hat gewartet, bis sie gegangen war, bevor er das Päckchen geöffnet hat. Was sagt dir das?«
»Dass Nina Antonowa und ihr Moskauer Führungsoffizier sich eine ziemlich raffinierte Methode ausgedacht haben, um Wiktors scharfe Sicherheitsmaßnahmen mit einem kontaminierten Päckchen zu überlisten. Wahrscheinlich feiern sie in diesem Augenblick ihren neuesten Coup.«
»Sie ist garantiert nicht in Moskau, Graham.«
»Nun, in Zürich aber auch nicht – und ihr Handy ist ausgeschaltet.«
»Was ist mit ihrer Kreditkarte?«

![Die Fälschung (Gabriel Allon 22) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a3c78f56d830648941e8541a912ece8c/w200_u90.jpg)
![Der Geheimbund (Gabriel Allon 20) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3f0442bd1f64b2b41e586c80150b3c0/w200_u90.jpg)
![Die Cellistin (Gabriel Allon 21) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bdaaa9cd283b671c252c1b0a29ef6f0/w200_u90.jpg)


![Das Vermächtnis (Gabriel Allon 19) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2dc3fc2736d865447dbf9f082ac49b4/w200_u90.jpg)