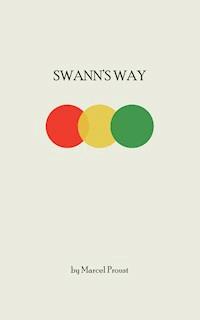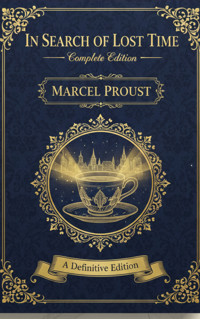23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Herbst 2019 begeisterte ein sensationeller Fund das französische Feuilleton: neun frühe, bislang vollkommen unbekannte Novellen, Skizzen und Erzählungen des jungen Marcel Proust, entstanden lange vor dessen Jahrhundertwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Aufgetaucht waren diese Texte im Nachlass des französischen Verlegers Bernard de Fallois, der in den 50er Jahren über Proust promovieren wollte und dafür Einblick erhielt in Material, das beim Tod des Autors nicht vernichtet worden war. Er gab das Vorhaben auf – und die Texte gerieten in Vergessenheit.
Ein mysteriöser Verehrer entpuppt sich als Verehrerin; ein Hauptmann erinnert sich an eine homoerotische Begegnung, ohne sie als solche zu erkennen; eine gute Fee beschert dem Helden als Ausgleich für Krankheit und Leiden künstlerische Kreativität: Proust stimmt hier sein Instrumentarium für die Abfassung seines großen Romanwerks. Aber warum hat er diese Texte nie veröffentlicht? Hatte er Angst vor dem Skandal, den die bemerkenswert offene Thematisierung von Homosexualität hätte provozieren können, wie der Herausgeber vermutet? Fest steht: in diesen Versuchen steckt bereits die ganze Zukunft von Prousts Jahrhundertepos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Marcel Proust
Der geheimnisvolle Briefschreiber
Frühe Erzählungen
Gefolgt vonAn den Quellen von Auf der Suche nach der verlorenen Zeitvon Luc Fraisse
Transkription der Texte, mit Anmerkungen und Einleitung versehen von Luc Fraisse
Aus dem Französischen von Bernd Schwibs
Suhrkamp Verlag
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Vorbemerkung
Einführung
Editorische Notiz
Pauline de S.
Der geheimnisvolle Briefschreiber
Erinnerung eines Hauptmanns
Jacques Lefelde (Der Fremde)
In der Hölle
Nach der 8. Symphonie von Beethoven
Das Bewusstsein, sie zu lieben
Das Geschenk der Feen
»So hatte er geliebt …«
An den Quellen von »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. von Luc Fraisse
Proust kannte den Soziologen Gabriel Tarde
Ein Theoretiker des Willens
Vor »Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen«
Eine der ersten Seiten von
Unterwegs zu Swann
Chronik der Familie Swann
Die männlichen Vorbilder von Gilberte
Der Käfig des Kardinals La Balue
Im Schatten junger Männerblüte
Die Geographie von Balbec: jedem seinen Platz
Die Bandzählung der
Recherche
Die Rufe in den Straßen von Paris
Der Held, »Marcel« und Proust
Sterben
Bildteil
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Vorbemerkung
des Verlegers der Éditions de Fallois
Bernard de Fallois hatte die ausdrückliche Absicht, das gesamte Archivmaterial, das er im Rahmen seiner persönlichen Arbeiten zur Genese von À la recherche du temps perdu gesammelt hatte, der Forschung zur Verfügung zu stellen.
Es ging ihm dabei nicht zuletzt darum zu vermeiden, dass es nach seinem Tod in irgendeinem Auktionssaal verstreut würde, und darum, Prousts Werk noch umfassender bekanntzumachen.
Die vorliegende Veröffentlichung entspricht mithin ganz seinem Willen.
Einführung
von Luc FraisseProfessor an der Universität Straßburg
Es kommt sicher nicht oft vor, dass Erzählungen von Marcel Proust ausgegraben werden, von denen niemand je gehört hat.
1978 veröffentlichte der Verlag Gallimard in einer Einzelausgabe den Roman L’Indifférent (Der Gleichgültige). Der Herausgeber von Prousts Correspondance, Philip Kolb, war durch Briefe auf eine Zeitschrift vom Ende des 19. Jahrhunderts aufmerksam geworden, wo der Text publiziert und dann vergessen wurde, zumindest von den Lesern, denn der Autor selbst erinnerte sich genau daran, als er sehr viel später »Eine Liebe Swanns« verfasste, den zweiten Teil des ersten Bands der Suche nach der verlorenen Zeit, Unterwegs zu Swann.
Der vorliegende Fall ist noch spezieller, handelt es sich doch um eine Reihe von Erzählungen, die zur selben Zeit wie Der Gleichgültige, der Zeit von Les Plaisirs et les Jours (Freuden und Tage), geschrieben, aber nicht veröffentlicht wurden:[1] Deren Manuskripte, Entwürfe, hatte Proust in seinen Archiven unter Verschluss gehalten und, soweit wir wissen, niemandem davon berichtet.
Was also enthalten diese Erzählungen? Warum hat er mit niemandem darüber gesprochen? Und, grundsätzlicher, warum hat er sie überhaupt geschrieben?
Auch wenn nicht alle Rätsel endgültig gelöst werden können, kommen wir ihrem Verständnis einen großen Schritt näher, wenn wir die Themen betrachten, die in ihnen verhandelt werden: in allen diesen Texten geht es um Homosexualität. Einige transponieren das Problem, das Proust umtreibt, in die weibliche Homosexualität. Bei anderen findet keine Transposition statt. Der junge Autor dieser allzu deutlichen, in dieser Zeit wohl zu skandalträchtigen Texte zog es vor, sie geheim zu halten. Doch war es ihm ein Bedürfnis gewesen, sie zu schreiben. Sie bilden, nahezu vor aller Augen, das intime Tagebuch, das der Schriftsteller niemandem anvertraute.
Was in der Epoche Prousts in seiner Familie, in der Gesellschaft, einen Skandal auslösen konnte, das war die bloße Tatsache der Homosexualität. Denn diese Erzählungen beinhalten nichts Schlüpfriges, nichts, was Voyeurismus provozieren könnte. Sie vertiefen, wie zu sehen sein wird, auf höchst variantenreiche Weise das seelische und moralische Problem der Homosexualität. Sie exponieren eine wesentlich auf das Leiden fokussierte seelische Verfassung. Sie dringen nicht in die Intimität von Proust ein; sie machen eine menschliche Erfahrung verständlich.
Die Texte stammen aus den Archiven des im Januar 2018 verstorbenen Bernard de Fallois. Einige historische Erläuterungen sind notwendig, um zu erhellen, warum sie so lange auf eine Veröffentlichung warten mussten und in welchem Kontext Proust sie geschrieben oder entworfen und sie dann endgültig den Blicken des Publikums und sogar seiner näheren Umgebung entzogen hat.
*
Lange Zeit herrschte, was Prousts literarischen Werdegang betrifft, die – heute überholte – Auffassung, es habe in seinem Leben zwei deutlich voneinander abgrenzbare Phasen gegeben: eine in den mondänen Salons verbrachte Jugend mit der Blume im Knopfloch; dann eine Reifezeit mit der besessenen Erarbeitung eines großen Werks, dessen Fertigstellung er zum Zeitpunkt seines Todes mit einundfünfzig Jahren gerade noch von fern undeutlich hatte erahnen können.
Marcel Proust, Verfasser von À la recherche du temps perdu, diesem Monument der französischen Literatur, diesem Werk des Kulturerbes. Die Zeitgenossen hatten es mit der sukzessiven Auslieferung der letzten Bände, spätestens 1927, begriffen. Doch die ganze Spannbreite des Romanzyklus zu würdigen, der zu umfangreich und zu reichhaltig war, um ihn sofort zu erfassen, blieb auf später verschoben. Wie auch immer, sein Autor war bei der Arbeit gestorben, im selben Alter wie Balzac und ein wenig aus denselben Gründen. Hatte er nicht, wie übrigens auch der Held der Suche nach der verlorenen Zeit bis zur Wiedergefundenen Zeit, unbedacht den Anfang seines körperlichen Verfalls abgewartet, bis er sich an dieses übermenschliche literarische Unternehmen machte?
Marcel Prousts Œuvre ohne die Recherche, woraus hätte das bestanden? Aus einem kleinen Jugendwerk, Les Plaisirs et les Jours, Ende des 19. Jahrhunderts erschienen und den Leser dazu einladend, die Seite zum 20. Jahrhundert umzublättern, um auf einen Schlag das literarische Genie des großen Werks erscheinen zu sehen. Aus Übersetzungen von Ruskin, nicht ohne Beziehungen zum kommenden Meisterwerk, weil zentriert auf die Kathedralen und auf das Lesen. Sonst nichts. Ein disparates Buch, ein Übersetzer und Schriftsteller.
Genau um die Mitte des 20. Jahrhunderts beginnt der Wind sich zu drehen. André Maurois veröffentlicht bei Hachette 1949 ein Buch À la recherche de Marcel Proust (Auf der Suche nach Marcel Proust), das die Atmosphäre erahnen lässt, in der sich die Entwicklung des Schriftstellers bis hin zum großen Œuvre vollzogen hat. Der Biograph entnimmt dem Briefwechsel Informationen, die nahelegen, dieser angeblich wie durch ein Wunder in letzter Minute für die Literatur Geheilte sei schon immer und ständig bestrebt gewesen zu schreiben. Maurois begegnet einem jungen Wissenschaftler, Bernard de Fallois, der gern über Proust promovieren würde, und im Kielwasser seiner eigenen Forschungen führt er ihn bei der Nichte des Schriftstellers, Suzy Mante-Proust, ein, die, wie ihr verstorbener Vater, sich dem Nachleben von Marcel Proust widmet.
Noch bevor er die Familienarchive sichtet und später die einschlägigen Auktionskataloge durchstöbert, ist Bernard de Fallois skeptisch, dass aus einer rein müßiggängerisch verbrachten Jugend heraus auf einen Schlag ein Monument der Literatur entstehen kann – auch wenn diese These zu seiner Zeit allgemein anerkannt ist. Bereits die Produktionen vor der Recherche sollten in ihrer Geltung nicht etwa geschmälert werden, sondern deuten für den, der Gespür für schöpferische Anlagen hat, eine stete Progression des literarischen Schaffens an und lassen vermuten, dass der regelmäßige Gast der mondänen Salons keineswegs Charles Swann ähnelt, sondern sich immer wieder dahingehend befragt, was er schreiben könnte.
In diesem Licht erscheinen die Schriften vor der Recherche, von Les Plaisirs et les Jours (1896) bis zur Übersetzung von La Bible d’Amiens (1904) und Sésame et les lys (1906) von John Ruskin, keineswegs als die Schlacken des großen Werks, sondern bergen vielmehr eine Fülle literarischer Experimente. Es sind Laboratorien, in denen die Texte gleichsam wie schmelzende Materie brodeln. Nun liegen ihre Entstehungsdaten zu weit auseinander, als dass man sich vorstellen könnte, der künftige Schriftsteller habe seine Forschungen, seine Fragen unterbrochen und die Wiederaufnahme Jahr für Jahr verschoben, bis sich einmal Gelegenheit dazu bot. Zwischen den bekanntgewordenen Niederschriften herrscht Leere. Eine Leere, die aber sicher nicht der Untätigkeit des Schöpfers geschuldet ist, sondern unserer Unkenntnis.
Hier nun kommen aus den Archiven der Familie Proust (sie werden der Nationalbibliothek erst 1962 übergeben) unter den Händen dieses mit den Methoden und der Beharrlichkeit eines Archivars ausgestatteten Forschers immer mehr unbekannte Papiere ans Licht. Ein großer Roman in Einzelteilen, paradoxerweise in der dritten Person erzählt, obwohl er doch an die Biographie des Autors so eng angelehnt ist, dass die Seiten sich entsprechend der Lebenschronologie der Figur, Jean Santeuil, die dem Ganzen seinen Titel gibt, ordnen lassen. Dieser wiederhergestellte große Roman erscheint 1952 bei Gallimard mit einem Vorwort von André Maurois. Briefe und Papiere im Umfeld zeigen, dass er im Wesentlichen zwischen 1895 und 1899 verfasst wurde. Weit davon entfernt, in Untätigkeit zu verfallen, hatte Proust sich also an einen großen Roman gemacht, noch bevor Les Plaisirs et les Jours erschienen war. Und er hatte offenbar ohne Unterbrechung geschrieben, denn der Roman, auf liniertem, gekennzeichnetem Papier, ist sehr umfangreich, wenn auch unvollendet.
Das ist also die Brücke zwischen Les Plaisirs et les Jours und John Ruskin. Aber da tauchen weitere Papiere, weitere Cahiers auf. Sie stehen an der Schwelle zur Recherche, um 1908 herum, und enthüllen, dass dieser Romanzyklus zur selben Zeit in Angriff genommen wurde wie ein Essay, der, polemisch, aber philosophisch wohlüberlegt argumentierend, gegen die biographische Methode von Sainte-Beuve gerichtet ist. Proust überlegt zuweilen, den Essay aus den Entwürfen herauszunehmen und separat zu veröffentlichen. Aber tatsächlich handelt es sich bei diesen Skizzen um weitaus mehr: um einen Essay und einen Roman zugleich.
Dieses hybride Objekt bringt die Klassifizierungen der Kritik in Verlegenheit – nur nicht Bernard de Fallois. Er hat bereits Les Plaisirs et les Jours, dieses vom Publikum wenig geliebte Buch von Proust, weil es nicht die Recherche ist und angeblich nur durch den Einband zusammengehalten wird, neu interpretiert als ein ganz im Gegenteil kohärentes, zwar reichhaltiges und vielfältiges, aber doch zusammenhängendes Ganzes, in dem alles notwendig ist, in dem alles in gleichem Maße das vorbereitet, was sich als seine Fortsetzung erweisen wird. So wird denn der Entdecker neuer Bücher von Proust auch nicht durch diesen in einen Roman sich wandelnden literaturtheoretischen Essay aus der Fassung gebracht, in dem sich die nach allen Regeln der Kunst vorgenommene Widerlegung Sainte-Beuves mit Betrachtungen zum Balzac-Bild der Guermantes vermischt.
Dieses durch keine voreingenommenen Leseeindrücke neugeordnete Ensemble bringt er 1954 unter dem Titel heraus, den Proust selbst zuweilen in seinen Briefen jener Zeit angedeutet hatte: Contre Sainte-Beuve. Später wird er die Paradoxie hervorheben, die darin lag, dass dieses Pamphlet von Proust gegen die biographische Kritik zu einem Zeitpunkt erschien, als das Jahrhundert sich erneut für Proust zu interessieren begann, und zwar in Hinblick auf seine Biographie! Dabei war es genau der richtige Moment, denn just in diesen Jahren setzte der Niedergang jener Richtung der Literaturgeschichte ein, die die Werke aus dem jeweiligen Umfeld ihrer Autoren (deren Milieus, Lektüren, literarischen Schulen und natürlich all der Begebenheiten und Vorfälle ihres Lebens) zu verstehen versuchte, zugunsten einer Schule, die eine Interpretation des Werks aus sich selbst heraus, aus der ihm inhärenten Struktur forderte. Was für ein Glücksfall, dafür auch noch die Bestätigung Marcel Prousts zu erhalten! Bernard de Fallois springt nicht auf den fahrenden Zug auf, zieht vielmehr aus dem Essay, den er dem Publikum vorgelegt hatte, die entscheidende Lehre. In seinen Sept conférences sur Marcel Proust stellt er die Frage: Ist das Leben von Proust denn so interessant? – und verneint sie.
Der Pionier der Proustforschung verfolgt weiter seine Aufgabe – die seine Thèse, seine Doktorarbeit, werden soll. Man ahnt: sollte die Universität sie annehmen, wäre ihr Thema Die schöpferische Entwicklung Prousts bis zur ›Recherche‹. Von dieser Thèse, die nie erschienen ist und die de Fallois vermutlich nicht weiterverfolgt hat, nachdem die beiden wichtigen Werke Prousts veröffentlicht waren und ihrem Entdecker die große Verlagswelt eröffnet hatten, waren zwei Teile ausformuliert und von der intellektuellen Entourage Bernard de Fallois’ bereits gelesen worden. Der erste Teil scheint verloren gegangen zu sein, doch bildet der zweite einen völlig eigenständigen Essay, den der Verlag Les Belles-Lettres unter dem Titel Proust avant Proust 2019 veröffentlichte. Ein gelehrter Essay, dessen Wissenschaftscharakter durch eine schwungvolle Feder vergessen gemacht wird, so wie eine Thèse idealerweise sein sollte und wie es jene sind, die zu richtigen Büchern werden und nicht veralten. Ein Essay, der in den zwei Generationen, die er im Verborgenen schlummerte, bis er uns jetzt bekanntgemacht wurde, nichts von seiner faszinierenden Originalität und Neuheit verloren hat.
Denn die Einführung in Les Plaisirs et les Jours schöpft hier aus jenen umfänglichen Archiven, deren Nuancen der Archivar wie die Register einer Orgel bedient. Wie der Sainte-Beuve-Gegner Proust, und (ein Paradox, das hier nicht verkannt werden darf) wie Sainte-Beuve im Grunde selbst, weiß er, dass die Biographie eines Autors bei der Interpretation seiner Werke nicht unberücksichtigt bleiben darf – allerdings eine innere Biographie, die die klügsten Zeitgenossen Prousts psychologische Biographie nannten, wenn man in der scheinbaren Willkürlichkeit des Erlebten die bereichernde Perspektive entstehender Strukturen wahrzunehmen weiß.
Diesen strukturellen Blick wirft Bernard de Fallois auf die in Les Plaisirs et les Jours zusammengestellten, scheinbar disparaten Stücke, um darin gegen den Strich ein und dieselbe Suche, ein und denselben schriftstellerischen Versuch auszumachen – das, was man bei einem so jungen Autor als Suche nach seiner Stimme bezeichnen könnte –, eine freilich so schwierige Suche, dass viele verschiedene Wege ausprobiert werden müssen, um einem gemeinsamen Ziel näherzukommen. Übrigens dringt der klarsichtige Kritiker so weit vor, dass er in den Jugendschriften nicht nur das identifiziert, was, wenn auch von fern, die Recherche du temps perdu ankündigt, sondern auch schriftstellerische Positionen festhält, die in der Folge nie mehr in den Schriften Prousts auszumachen sein werden, wobei dieses nie mehr, dieses ein einziges Mal weithin Auskunft gibt über die Schaffensvoraussetzungen des zu voller Reife gelangten Proust.
Und während der Essayist über diese dauerhaften Strukturen nachdenkt und zugleich ein Verzeichnis der Archive erstellt und diese ordnet, stößt er, im Umkreis von Les Plaisirs et les Jours, auf Manuskriptseiten, die in den Band von 1896 nicht aufgenommen, auch in den Zeitschriften der Epoche nicht erschienen waren, von denen aber einige in den handschriftlichen Inhaltsverzeichnissen, die er vor Augen hat, genannt sind, mit Blick auf das Buch, das Proust zunächst unter Bezug auf den Landsitz von Madame Lemaire im Département Marne, wo mehrere seiner Texte in enger Zusammenarbeit mit Reynaldo Hahn entstanden sind, »Le Château de Réveillon« nennt. Die Stücke darin verschiebt, ergänzt oder streicht er, ein wenig wie Guillaume Apollinaire 1912, als er seinen Gedichtband Alcools zusammenstellte.
Diese Prosatexte auf losen Blättern sind Erzählungen. Zur selben Zeit geschrieben wie die uns bekannten, stehen sie logischerweise in Zusammenhang mit diesen. Aber für sich gelesen, so wie es ihr Autor schließlich wollte, als eine Reihe unveröffentlichter Stücke, sprechen sie auch eine ganz eigene Sprache. Ein Teil des Essays von Bernard de Fallois behandelt genau diese Frage. Diesen Teil hat Jean-Claude Casanova in Heft 163 der Zeitschrift Commentaire im Herbst 2018 urteilssicher vorveröffentlicht unter dem Titel: »Geheimnis und Geständnis«. Denn darin besteht der entscheidende Zusammenhang. Aber welcher Zusammenhang eigentlich?
*
Die Schriften, die Proust beiseitegelegt hat, als er an der Sammlung Les Plaisirs et les Jours arbeitete, zeigen, dass aus dieser Sammlung ein viel bedeutenderes Buch hätte werden können. Doch wenn dessen junger Autor alle die hier abgedruckten Texte aufgenommen hätte, und zwar in ausgearbeiteter Form, wozu es nicht kam, wäre die Inszenierung der Homosexualität nach und nach zum Hauptthema des Werks geworden. Das hat Proust nicht gewollt, sicher wegen der Enthüllungen über ihn selbst (was sie für uns nicht mehr sind), vielleicht, weil einige Texte mehr für ihn selbst geschrieben als für andere veröffentlicht werden mussten, vielleicht aber auch, weil der Autor in seiner Zusammenstellung eine größere Vielfalt erhalten wollte; letztlich gewiss auch deshalb, weil er an der literarischen Qualität, dem literarischen Erfolg der Texte, die er am Ende verwarf, zweifelte.
Proust, dieser junge Mann und junge Schriftsteller, nähert sich der Homosexualität also unter dem Blickwinkel des Leidens und des Verfluchtseins. Seine Epoche kann dafür nicht in Gänze verantwortlich gemacht werden, steht diese Haltung doch in krassem Gegensatz zu der seines Zeitgenossen André Gide, dieses Hedonisten und Egotisten, der ein derartiges Geständnis nicht mit Proust’scher Tragik umgibt, sondern im Gegenteil mit vitalistischem Glück assoziiert. Daraus ergibt sich ein weiterer Gegensatz, nämlich der zwischen einem der Spannung zwischen Geheimnis und Geständnis ausgesetzten Proust, der sich ein vielfältiges System von Transpositionen ausdenkt, und einem Gide, dem im Gegenteil wichtig ist, ich zu sagen, und der nach einem Besuch bei Proust 1921 in seinem Tagebuch notiert: »[A]ls ich ein paar Worte über meine Memoiren sage: ›Sie können alles erzählen‹, ruft er aus, ›aber unter der Bedingung, niemals Ich zu sagen!‹ Was nicht mein Fall ist.« (André Gide, Tagebuch 1903-1922, herausgegeben von Peter Schnyder, aus dem Französischen übertragen von Maria Schäfer-Rümelin, Frankfurt am Main, Wien: Büchergilde Gutenberg, 1990, S. 671; Übersetzung leicht modifiziert; A.d.Ü.)
Proust wird mithin in einem solchen Kontext nie Ich sagen; die in der ersten Person gehaltene Erzählung des Hauptmanns käme allerdings einer direkten und persönlichen Aussage am nächsten. In diesen ausgesonderten Erzählungen wird wie nirgends sonst sichtbar, wie sich eine ganze Folge von Projektionen, von Stellvertreterdiskursen entwickelt: Das Drama spielt sich zwischen zwei Frauen ab (wobei zwar aus der Perspektive der »Unschuldigen« erzählt wird, aber die »Schuldige« bleibt im »Geheimnisvollen Briefschreiber« ebenfalls unschuldig); das Schlüsseldrama der Adoleszenz wird in ein verfrühtes Lebensende transponiert (an den Ursprung einer Apokalypse in ihrer doppelten Bedeutung als Offenbarung des Zeitenendes eines Menschen und als im griechischen Verb apocalutein enthaltenen Akt des Enthüllens); der Schmerz über das Schicksal, von dem, den man liebt, nicht wiedergeliebt zu werden, in die Welt der Musik (»Nach der 8. Symphonie von Beethoven«); oder in eine Heldin, die sich zur Krankheit verdammt weiß, aber beschließt, ihre Agonie in Sorglosigkeit zu leben (»Pauline de S.«); oder es nimmt die Form einer Eichkatze an, die immer und überall an der Seite des Leidenden bleibt, ohne Wissen aller anderen (»Das Bewusstsein, sie zu lieben«), nachdem es ein von Resignation umschattetes »Geschenk der Feen« gewesen ist …
Aber die Transposition, die eine so schwere persönliche und affektive Bürde zu tragen hat, ist nicht einfach. Der Erzähler, an den Proust das Erzählen delegiert, verheddert sich. Man wird sehen, wie in »Der geheimnisvolle Briefschreiber« die Rollen von Françoise und Christiane immer wieder verwischt und ausgetauscht werden; das Geschenk der Fee, das darin besteht, das Leiden anzunehmen, um als Gegengabe eine Fülle von Neigungen zu erhalten, wird mehr aus Resignation als aus Überzeugung akzeptiert; das geheime Tier, das sein Leben lang an der Seite dessen bleibt, der weiß, dass er dafür im Gegenzug nicht geliebt werden darf, verschafft dem Subjekt einen Trost, der das Scheitern nicht vergessen macht. Der Widerspruch bleibt unaufgelöst.
Die – im vorliegenden Fall katholische – christliche Moral lastet auf diesen Fragen so unmittelbar wie in der Folge nie mehr. Was in Les Plaisirs et les Jours in ihrer veröffentlichten Form zu lesen ist, verkürzt das religiöse Anliegen zu einer oberflächlichen Note von Mystizismus, mit dem Nimbus dekadenter Fin-de-Siècle-Melancholie. Da sind die ausgesonderten Erzählungen viel entschiedener. Christiane wird an Auszehrung darüber sterben, im Stillen vor Liebe zu ihrer Freundin Françoise gebrannt zu haben. Françoise fragt, ob dem Verlangen Christianes nachzugeben sie nicht retten würde. Ihr Beichtvater antwortet ihr, dass dies der Sterbenden (die ihm als ein Sterbender präsentiert wird) ihren Lebenssinn rauben, das Opfer ihres Lebens für ein Ideal von Reinheit sinnlos machen würde. Beide Positionen sind von Grund auf gegensätzlich: absolut betrachtet, ist keine der beiden entkräftet.
Der junge Autor dieser Erzählungen wird, einmal zum Romancier geworden, nie mehr mit solchem Nachdruck das Memento mori der klassischen Predigt formulieren. Er wird nie mehr, außer zu verbildlichen, was künstlerisches Schaffen ist, den schöpferischen Gott direkt anrufen und nach dem Warum fragen. Hier formuliert das leidende Subjekt, ausgeschlossen aus der Welt der Liebe, sein ganz persönliches Mein Reich ist nicht von dieser Welt; es fragt sich, wo für es selbst der Frieden auf Erden für die Menschen guten Willens zu finden ist. Im Dialog der Toten »In der Hölle« wird die beängstigende Nähe all dieser Fragen in die Distanz gerückt, doch die antike Patina der Unterwelt löscht die Erwartung der Hölle und der christlichen Verdammung nicht aus, die einer der Protagonisten zu beschwören sucht, indem er aufs Neue die Dichtung und die Dichter als felix culpa bezeichnet, wie es einst für die Erbsünde galt.
So übernehmen Arztfiguren, halb Adrien Proust, Vater des Schriftstellers, halb zukünftiger Docteur du Boulbon, die fiktive Gestalt aus der Recherche




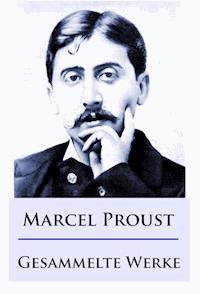

![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)