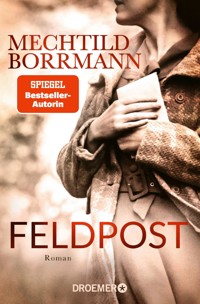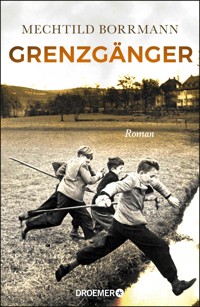9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Psychologischer Krimi und dramatische Familien-Geschichte: Bestseller-Autorin Mechtild Borrmann erzählt das Schicksal der Familie Grenko von den 1940er Jahren in Russland bis ins heutige Deutschland Moskau 1948: Der begnadete Geiger Ilja Grenko verlässt unter tosendem Applaus den Konzertsaal, in der Hand seine geliebte Stradivari. Noch vor Ort verhaften ihn Männer in Zivil, seine wertvolle Geige wird konfisziert. Unter dem Vorwand, Fluchtpläne zu hegen, wird er zu zwanzig Jahren Straflager in Sibirien verurteilt. Deutschland 2008: Sascha Grenko muss mit ansehen, wie seine Schwester Vika kaltblütig erschossen wird. Tage zuvor hatte sie ihn angerufen und um Hilfe gebeten. In ihrem Nachlass findet er Hinweise auf den Verbleib der seit Jahrzehnten verschwundenen Geige seines Großvaters Ilja Grenko. Auf der Suche nach dem Mörder seiner Schwester deckt Sascha Grenko nach und nach die Wahrheit hinter der Deportation seines Großvaters auf und erfährt, welch tödliche Macht die verschollene Geige seitdem auf die Familie Grenko ausübt. Mechtild Borrmanns Kriminalromane zeichnen sich durch ihre eindringliche, unaufgeregte Sprache ebenso aus wie durch die feinfühlige Figurenzeichnung. »Mechtild Borrmann […] erzählt sensibel und berührend von einer Zeit, in der moralische Entscheidungen oft eine ungeheure Mutprobe waren.« Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mechtild Borrmann
Der Geiger
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sascha Grenko wird Zeuge, wie seine Schwester kaltblütig erschossen wird. Tage zuvor hatte Vika ihn angerufen und um Hilfe gebeten. In ihrem Nachlass findet Sascha Hinweise über den Verbleib der wertvollen Stradivari seines Großvaters und einen alten fast unleserlichen Brief von unschätzbarem Wert. Und während sich Sascha auf die gefährliche Suche nach dem Mörder seiner Schwester macht, erfährt er, was damals in Moskau wirklich passiert ist, als sein Großvater, der berühmte Geiger Ilja Grenko, zu zwanzig Jahren Straflager verurteilt wurde, und welch tödliche Spur seine verschollene Stradivari seitdem durch seine Familie zieht ...
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Personenverzeichnis
Glossar russischer Begriffe
Für Christine, Valentine und Anganeta H.
»Nie habe ich eine Geige mit einem solchen Klang besessen. Es ist, als folge meine Seele den Tönen in tiefste Schatten und hellstes Licht.«
In die Gewehre rennen
Mein tiefstes Herz heißt Tod
Wenn das die Mörder wüssten
wären sie es müde
Christa Reinig
Kapitel 1
Mai 1948, Moskau
Der Schlussakkord von Tschaikowskys Violinkonzert in D-Dur schwebte über die Köpfe der Menschen im Parkett, hinauf zu den Rängen, dehnte sich aus zu den Gästen auf den Balkonen und löste sich endlich in der hohen Kuppel des Konzertsaales auf. Sekundenlang verharrte das Publikum still, dann brauste tosender Applaus auf. Ilja ließ seine Geige sinken und verbeugte sich zusammen mit dem Dirigenten tief vor den jubelnden Menschen. Die Orchestermusiker erhoben sich von ihren Stühlen und verneigten sich ebenfalls.
Sechs Wochen lang hatte Ilja Wassiljewitsch Grenko in den Konzertsälen Europas gespielt, war auch dort gefeiert worden, aber hier, am Tschaikowsky-Konservatorium, wo er gelernt hatte und seine Lehrer in den ersten Reihen saßen und ihm applaudierten, erfüllte ihn die Anerkennung des Publikums mit besonderem Stolz. Eine letzte Verbeugung, ein letztes Mal zog er sein Taschentuch aus der Hosentasche und wischte sich über die Stirn. Dann verließ er den Konzertsaal.
Der Geigenkoffer stand unmittelbar neben dem Bühneneingang. Er trug sein Instrument nie ungeschützt durch Gänge und Flure. Seine Kollegen belächelten diese Vorsicht, nannten sie eine Marotte, aber Ilja Grenko liebte seine Geige. Die unbedarfte Bewegung eines Kollegen, ein unvorsichtiger Bühnenarbeiter, überall lauerten Gefahren. Er verband seinen Erfolg unmittelbar mit dieser Stradivari, die seit vier Generationen im Familienbesitz der Grenkos war. Sein Ururgroßvater, der Geiger Stanislaw Sergejewitsch Grenko, hatte sie 1862 von Zar Alexander II. geschenkt bekommen. Die Geschichte um dieses Geschenk war bis zur Revolution voller Stolz weitergegeben worden. Stanislaw Sergejewitsch war des Zaren Lieblingsgeiger gewesen, und zwischen den beiden Männern hatte sich eine Freundschaft entwickelt. Der Zar hatte die Familie sogar zum Urlaub in seine Sommerresidenz eingeladen.
Alexander II. hatte die Stradivari von einer Italienreise mitgebracht und seinem Freund zum Geschenk gemacht. Stanislaw Sergejewitsch, so war es überliefert, schrieb dem Zaren später in einem Brief: »Nie habe ich eine Geige mit einem solchen Klang besessen. Es ist, als folge meine Seele den Tönen in tiefste Schatten und hellstes Licht.«
Nach seinem Tod hegten und pflegten seine Erben das Geschenk, und die Geschichte der Violine wurde gerne zum Besten gegeben. Das änderte sich mit der Revolution 1917. Die Umstände, wie die Geige in den Besitz der Grenkos gelangt war, wurde zu einem Familiengeheimnis und nur im engsten Kreis hinter vorgehaltener Hand erzählt. Man fürchtete, dass die neuen Machthaber sie beschlagnahmen oder gar – als Symbol der Zarenherrschaft – zerstören würden.
Keiner von Stanislaw Sergejewitschs Nachkommen war ein großer Musiker geworden, keiner hatte das Instrument mit jener Fertigkeit gespielt, mit der er ihm die Töne entlockt hatte. Erst Ilja war es, vier Generationen später, gelungen, die Violine wieder mit jener Leichtigkeit zu spielen, die dem Ururgroßvater zu eigen gewesen war.
Als er verschwitzt und mit dem Geigenkoffer in der Hand seine Garderobe betrat, erwarteten ihn zwei Männer in billigen Straßenanzügen. Der eine saß vor der Spiegelkommode, lässig in den alten Drehstuhl gelehnt, den linken Fuß auf das rechte Knie gelegt. Der andere, auf dem schmalen Diwan an der hinteren Wand, saß vorgebeugt, die Ellbogen auf die Oberschenkel gestützt. Er erhob sich behäbig, nahm Iljas Sommermantel, der an einem Haken neben dem Diwan hing, und sagte knapp: »Ilja Wassiljewitsch Grenko, Sie müssen uns begleiten.«
Ilja blieb reglos stehen, seine Gedanken überschlugen sich. »Das muss ein Missverständnis sein«, brachte er mit rauher Stimme hervor.
Jetzt erst bemerkte er, dass die Schubladen der Kommode offen standen und der Mann, der vor dem Spiegel gesessen hatte und nun dicht vor ihn trat, die Tasche mit den Partituren unter dem Arm hielt.
»Wenn das ein Missverständnis sein sollte«, sagte der Mann gelangweilt, »dann sind Sie ja bald wieder zurück.« Er schob Ilja Grenko auf den schmalen Flur und weiter in Richtung Hinterausgang.
Ilja brach der Schweiß aus. »Meine Frau«, stammelte er, während die Männer ihn eilig den Gang entlangdrängten, »meine Frau war im Publikum. Bitte! Kann ich ihr bitte kurz Bescheid sagen?«
Die Männer schoben ihn weiter. »Machen Sie keine Schwierigkeiten, Grenko, kommen Sie einfach mit.«
Ilja ging an verschlossenen Garderobentüren vorbei und fragte sich, warum ausgerechnet heute der Flur menschenleer war. Einer der Bühnenarbeiter kam ihnen entgegen. Spontan rief Ilja ihm zu: »Bitte informieren Sie meine Frau, dass ich verhaftet wurde.« Sofort wurde er grob weitergestoßen. Der Arbeiter hielt einen Augenblick inne, sah erst ihn und dann die beiden Männer erstaunt an. Dann senkte er den Kopf und ging eilig weiter.
Am Ende des Ganges, unmittelbar vor dem Personaleingang, befand sich die Pförtnerloge. Wassili Iwanowitsch Jarosch saß in seiner abgetragenen Pförtneruniform in dem kleinen Glaskasten und blickte erschrocken von seiner Zeitung auf.
»Man hat mich verhaftet, Wassili Iwanowitsch. Bitte geben Sie meiner Frau Bescheid«, rief Ilja, als sie die Loge passierten. Einer der Männer öffnete die Tür zur Seitenstraße und stieß ihn hinaus.
Ilja drehte sich noch einmal um, sah, wie Wassili sich erhob und ihnen nachsah.
Unsanft bugsierte man ihn auf die Rückbank eines schwarzen Autos. Erst jetzt nahm er wahr, dass er immer noch seinen Geigenkoffer mit sich trug.
»Meine Geige.« Angst machte seine Stimme spröde und leise. »Bitte, kann ich meine Geige beim Pförtner abgeben.«
Der Mann, der im Fond des Wagens Platz genommen hatte, wandte sich ihm zu.
»Was ist denn los, Ilja Wassiljewitsch?«, fragte er lächelnd. »Wenn das alles ein Missverständnis ist, bist du mitsamt deinem Geigenkasten in ein paar Stunden wieder zu Hause.« Er beugte sich zu Ilja, dem ein säuerlicher Atem entgegenschlug. »Oder hast du Grund, daran zu zweifeln?«
Ilja drehte den Kopf zur Seite, starrte zum Seitenfenster hinaus. Die Lichter Moskaus eilten vorbei, Menschen, die auf den Straßen den lauen Abend genossen. Das gleiche Bild hätte er mit seiner Frau auf dem Weg nach Hause gesehen, und doch wäre es ein anderes gewesen. Er hätte es mit anderen Augen betrachtet, er wäre Teil dieses Bildes gewesen. Wahrscheinlich hätte er es nicht einmal bewusst wahrgenommen. Nicht die Leichtigkeit der Schritte, nicht die Umarmung eines Liebespaares unter einer Laterne.
Er wusste, dass die Fahrt zur Lubjanka ging.
Er dachte daran, dass sein Lehrer Professor Meschenow noch vor wenigen Stunden beim Mittagessen zu Gast in seinem Haus gewesen war. Meschenow, der ihm in seiner Zeit als Student am Konservatorium Mentor und Vaterfigur gewesen war, hatte ihn morgens angerufen und sich mehr oder weniger selbst eingeladen. Das Gespräch während des Essens war seltsam oberflächlich gewesen, und immer wenn Ilja versucht hatte, ihm von seinen Reisen zu erzählen, von seinen Begegnungen mit anderen international bekannten Musikern, hatte Meschenow abgeblockt. Später hatte der Alte ihn gedrängt, ihm den Garten zu zeigen. »Iljuscha, ich freue mich sehr über deinen Erfolg, aber deine ständigen Reisen ins Ausland … du tust dir keinen Gefallen, verstehst du?«
Er hatte lächelnd geantwortet: »Ehrenwerter Meschenow, Sie wissen, wie unpolitisch ich bin. Mein Leben gehört der Musik und meiner kleinen Familie.«
Der Alte strich sich über den ergrauten Backenbart und wich Iljas Blick aus. »Versprich mir, in den nächsten Monaten hierzubleiben. Sag deine Reisen ab«, flüsterte er eindringlich, und dabei wanderten seine kleinen braunen Augen unruhig über die Fenster des Hauses. »Alexei Rybaltschenko ist in Zürich. Es wird behauptet, er ist im Ausland geblieben, weil er bei seiner Rückkehr eine Verhaftung gefürchtet habe. Es gibt Gerüchte, dass man Musikern, die sich häufig im Ausland aufhalten, Feindkontakte oder antisowjetische Agitation unterstellt.«
Er sprach leise, fast ein bisschen beschwörend. Ilja war schockiert. Natürlich war auch er in Paris und London auf angebliche Verhaftungswellen in seinem Land angesprochen worden. Er hatte Gespräche, die in diese Richtung gingen, immer sofort beendet. Das war feindliche Propaganda, das wusste man doch.
Er hatte es Meschenow gegenüber vorsichtig formuliert, hatte einige der ausländischen Kollegen aufgezählt, die ihn darauf angesprochen hatten, und gesagt, dass man doch wisse, dass das alles nicht stimme.
Meschenow hatte lange geschwiegen und dann gesagt: »Du warst doch in Europa. Wo spielen sie? In Paris? In London? In Amsterdam? Du wirst doch von ihnen gehört haben, von ihren Konzerten und Erfolgen? Hattest du Kontakt zu ihnen?«
Der Alte hatte ihn mit fragend hochgezogenen Augenbrauen direkt angesehen. Ilja war zusammengezuckt. Fragte Meschenow ihn tatsächlich, ob er Kontakt zu Verrätern hatte? Oder wollte er ihn auf etwas hinweisen?
Tatsächlich war er diesen russischen Kollegen weder begegnet, noch hatte er von ihnen gehört oder gelesen. Er schob den Gedanken beiseite, dachte an seine Einladung nach Wien und seinen Antrag, auf diese Reise die Familie mitzunehmen. Galina, seine Frau, wusste nichts davon. Wenn die Reiseerlaubnis kam, würde er sie damit überraschen.
Auf Meschenows Frage hatte er nicht geantwortet.
Als sie zum Haus zurückgingen, sagte der Alte noch einmal eindringlich: »Iljuscha, ich bitte dich, die Wienreise abzusagen.«
Kurze Zeit später, Meschenow hatte sich verabschiedet, war er zurück ins Wohnzimmer gegangen. Galina saß, den einjährigen Ossip auf dem Arm, in einem Sessel, und sein dreijähriger Sohn Pawel spielte ganz vertieft mit seinen Bauklötzen auf dem Teppich.
Er strich Pawel über den Blondschopf und entschied, sich in Wien vorsichtig nach den Musikern im Exil zu erkundigen.
Sie umfuhren den menschenleeren Platz vor der Lubjanka. Hier flanierte niemand. Hier hielt man sich nicht auf. »Vorplatz zur Hölle« wurde er hinter vorgehaltener Hand genannt. Schwer und monumental lag das ockerfarbene Gebäude da. Der Haupteingang war im Verhältnis geradezu klein und unscheinbar. In etlichen Fenstern brannte Licht, obwohl es bereits auf Mitternacht zuging.
Er atmete tief durch. Es würde sich aufklären. Was immer man ihm vorwarf, er würde es richtigstellen und dann nach Hause gehen.
Der Wagen fuhr an die Westseite des Gebäudes. Eine Schranke öffnete sich. Wenige Meter dahinter passierten sie ein Tor und hielten in einem Hof. Ilja fühlte sich augenblicklich völlig isoliert, es war ihm kaum begreiflich, dass er sich immer noch mitten in Moskau befand. Er umschlang seinen Geigenkoffer mit den Armen und presste ihn schützend an sich wie ein Kind.
Sie zogen ihn aus dem Wagen. Er wurde einige Stufen hinunter und dann durch einen spärlich beleuchteten Gang geführt. Hinter einer Art Tresen erhob sich ein Uniformierter. Er stellte einen Pappkarton auf die Theke und forderte ihn auf, seinen Geigenkasten, den Mantel, die Fliege, den Gürtel und seine Schnürsenkel abzugeben. Im Rücken des Beamten zogen sich Holzregale ins Dunkel, randvoll mit identischen Kartons.
»Aber …«, Ilja rang nach Luft. »Das ist ein Irrtum. Bringen Sie mich zuerst zu jemandem, der mir sagt, was man mir vorwirft. Sie können mich doch nicht, ohne mich vorher angehört zu haben …« Seine Empörung ließ ihn laut werden.
Einer der Männer, die ihn hergebracht hatten, griff mit einer Hand nach dem Violinkoffer und riss ihm dann mit der anderen die Fliege vom Hals. »Der Mantel, den Gürtel, die Uhr und die Schnürsenkel«, schnauzte er.
Ilja konnte das Zittern in seinen Händen kaum unterdrücken, während er seinen Gürtel abnahm und die Schnürsenkel aus den Schuhen zog.
Zuletzt kontrollierten sie seine Hosentaschen und legten auch das Taschentuch auf den Tresen. Er war jetzt gezwungen, seine Hose festzuhalten, um zu verhindern, dass sie ihm von der Hüfte rutschte. Sie packten ihn zu beiden Seiten an den Oberarmen und führten ihn durch eine schwere Eisentür. Er stolperte drei Stufen hinunter, und eine weitere Tür wurde geöffnet. Der pelzige Geruch feuchter Mauern, vermischt mit beißendem Uringestank und säuerlichem Schweiß, schlug ihm entgegen. Er rang nach Luft. Er hörte Stöhnen und Wimmern. Sein Herz raste, und für einen Moment glaubte er zu ersticken. Links von ihm wurde ein Riegel mit metallischem Quietschen geöffnet, eine Tür aus groben Holzbohlen schwang auf. Ilja spürte Hände in seinem Rücken, stolperte vor und fiel. Wieder das metallische Quietschen.
Er fand sich auf dem Zementboden einer Zelle wieder. Der Raum war klein und ohne Fenster, der Boden und die Wände fleckig. Über ihm hing hinter einer Gitterabdeckung eine nackte Glühbirne. In einer Ecke stand ein Eimer, der, nur notdürftig gereinigt, nach Exkrementen stank. Daneben lag eine filzige graue Decke. Kein Bett, kein Stuhl. Sollte er hier die ganze Nacht verbringen?
Automatisch sah er auf sein linkes, nacktes Handgelenk. Er dachte, dass sie seine Sachen in diesen Karton gelegt hatten und er keine Quittung besaß. Wie spät mochte es sein. Mitternacht? Vielleicht halb eins. Keine Quittung für seine Geige. Er nahm die Decke, wagte nicht, sie auseinanderzufalten, legte sie an die hintere Wand auf den Boden und setzte sich darauf. Er versuchte, gleichmäßig durch den Mund zu atmen, kämpfte gegen die Übelkeit. Wenn es ihm nicht gelang und der Gestank ihm in die Nase zog, spürte er einen Brechreiz.
Wie ein Mantra wiederholte er im Geiste: ein Irrtum. In ein paar Stunden ist der Spuk vorbei. Aber es lauerten auch andere Gedanken, schoben sich bedrohlich vor. Er hörte Meschenow sagen: »Wo spielen sie? In Paris? In London? In Amsterdam? Du wirst doch sicher von ihnen gehört haben.«
Sein Magen zog sich zusammen. Er schluckte dagegen an, wollte auf keinen Fall zu dem stinkenden Eimer. Schließlich rutschte er auf den Knien vor. Bemüht, den Behälter nicht zu berühren, stützte er sich mit den Händen an der Wand ab und erbrach sich. Minutenlang schüttelte ihn ein immer neues Würgen, bis die Magensäure in seiner Kehle brannte und nichts mehr in ihm war. Er kroch zur Decke zurück, lehnte sich an die Wand. Nein, nein, das konnte nicht sein. Tränen liefen ihm über das Gesicht.
Langsam beruhigte er sich, fanden seine Gedanken wieder in geordnete Bahnen.
Der Bühnenarbeiter oder der Pförtner hatten bestimmt Galina informiert? Sie war sicher schon auf der Suche nach ihm. Im Konservatorium war nach dem Konzert ein kleiner Umtrunk geplant gewesen, man würde ihn auf jeden Fall inzwischen vermissen. Wahrscheinlich wurden schon jetzt Telefongespräche geführt. Jeden Moment mochte die Tür aufgehen. Man würde sich wortreich entschuldigen, ihm seine Sachen aushändigen und ihn nach Hause fahren.
Er rieb den Betonstaub von den Knien und den Ärmeln seiner Smokingjacke. Den Anzug würde er gleich morgen in die Reinigung bringen. Gleich nachdem sich das Missverständnis aufgeklärt und man sich offiziell bei ihm entschuldigt hatte.
Kapitel 2
Montag, 7. Juli 2008
Sascha Grenko stand an der Fensterfront seines großzügigen Büros im achten Stock.
Es war früher Abend. Unter ihm schoben sich Autokolonnen stadtauswärts in den Feierabend, andere, von der Deutzer Brücke kommend, drängte es in Richtung Altstadt zu den Restaurants und Cafés, wo man den warmen Abend draußen genießen konnte. Hier oben war es still. Es gefiel ihm, dem Pulsieren der Stadt zuzusehen wie in einem Stummfilm, aber heute schenkte er den Bildern wenig Beachtung.
Seit drei Jahren arbeitete er für Reger, der sich mit seinem Securityunternehmen auf Personenschutz und die Beschaffung von Wirtschaftsinformationen spezialisiert hatte. Die Klienten waren Unternehmen, Rechtsanwaltskanzleien und Personen, die sich Regers Preise leisten konnten. Manchmal fragte auch die eine oder andere Staatsanwaltschaft an, allerdings nie offiziell, sondern stets über die Hintertreppe.
Reger hatte Sascha von der Straße geholt, genau genommen aus seiner Souterrainwohnung, in der er zwischen Computern, Tastaturen, Bildschirmen und einer Hantelbank gehaust hatte. Er hatte damals mehr schlecht als recht von kleinen Computerrecherchen für Journalisten gelebt, die sein Talent, auch an nichtöffentliche Informationen zu kommen, zu schätzen wussten.
Reger hatte eines Tages in der Tür gestanden und einfach gesagt: »Kommen Sie mit, ich brauche Sie.« Sie waren hierhergefahren, in diesen schicken Büroturm mit Blick auf den Rhein, und Reger hatte ihm einen festen Arbeitsplatz angeboten. Aber das war nicht das Wichtigste gewesen. Beim Anblick der technischen Ausrüstung hatte Saschas Herz einen Sprung gemacht. »Sollte etwas fehlen, besorgen Sie es sich«, hatte Reger gesagt, und damit war die Entscheidung gefallen.
Inzwischen bewohnte er eine geräumige Dreizimmerwohnung mit Dachterrasse mitten in der Altstadt von Köln, trug immer noch Jeans und T-Shirt, aber nicht mehr von der Stange. Seine Lederjacke war aus edel gealtertem Büffelleder, und die Firma stellte ihm einen BMW als Dienstwagen zur Verfügung. Ein neues Leben, fernab seiner Vergangenheit.
Der Notizzettel in Saschas linker Hand war schon ganz zerdrückt. Er zog ihn glatt. Auf dem Zettel stand »Viktoria Freimann, Pension Laiber, Hubertusgasse, München«.
Vor gut vier Stunden hatte sie angerufen. »Hier ist Viktoria Freimann«, hatte sie gesagt. »Spreche ich mit Sascha Grenko?« Er hatte sofort gewusst, wer sie war, und hatte sogar den Eindruck gehabt, er habe sie an ihrer Stimme erkannt.
Er setzte sich an seinen Schreibtisch, schaltete die beiden überdimensionalen Flachbildschirme und das Notebook aus und schob zwei Tastaturen beiseite.
Was wusste er noch von der Zeit in Kasachstan, von den Eltern und von der Reise in dieses Land, dessen Name zu Hause so ehrfürchtig und zuversichtlich ausgesprochen worden war. Die Bundesrepublik Deutschland. An Babuschka Galina erinnerte er sich gut, an ihre große, gebeugte Gestalt und die langen grauen Haare, die sie zu einem Knoten zusammengesteckt trug. Sie saß immer bescheiden am Rand, selbst auf den Fotos, die er später zusammen mit den Eltern und seiner Schwester Viktoria ansah, so als sei sie zufällig mit auf das Bild geraten. Wenn sie ihr zahnloses Lächeln zeigte, sprangen Tausende von Fältchen in ihrem gegerbten Gesicht auseinander, und die großen braunen Augen blitzten auf. Im Winter saß sie in dem grauen weiten Rock, der ihr bis zu den Knöcheln reichte, am Ofen. Sie schälte Kartoffeln, schnitt Rüben klein oder knetete in der rostgefleckten Emailleschüssel geschickt den Brotteig. Im Sommer trugen sein Vater und sein Onkel sie mit dem Stuhl hinaus in die mit Wein bewachsene Laube hinter das kleine Haus, das aus nur drei Zimmern bestand.
»Ungefähr sechzig Quadratmeter für sieben Menschen«, sagte Vater, wenn sie zusammen die Bilder betrachteten und er der Meinung war, der Sohn habe die Enge vielleicht schon vergessen. Von diesen Fotos gab es nicht viele, aber die wenigen abgegriffenen Schwarzweißaufnahmen hatte Saschas Mutter Maria, kaum dass sie im Übergangslager in Deutschland angekommen waren, sorgfältig mit Fotoecken auf Kartonseiten geklebt und in ein Ringbuch geheftet. Dieses Buch wurde immer wieder hervorgezogen und war Ausgangspunkt all der Geschichten, die das Heimweh mildern sollten.
An einen dieser Abende erinnerte er sich genau. Sie hatten im Übergangswohnheim auf ihren Stockbetten gesessen. Viktoria, die von allen nur Vika genannt wurde, lag im oberen Bett. Ihr Kopf baumelte über den Rand des Etagenbettes, und sie betrachtete die Bilder aus der Vogelperspektive, flüsterte schläfrig »Babuschka« oder »Tjotja Alja«, während er zwischen seinen Eltern auf dem unteren Bett saß und das Album auf den Knien hielt. Sie sprachen leise miteinander, denn die Halle, in der sie vorübergehend wohnten, teilten sie mit acht anderen Familien, die darauf warteten, dass man ihnen eine Wohnung zuteilte.
Der Vater strich über ein Bild, das ihn zusammen mit Djadja Pawel vor dem Haus zeigte. Babuschka Galina saß auf diesem alten Holzstuhl mit dem nachträglich angebrachten Weidengeflecht an den Seiten. Die Dorfstraße war nichts als ein gestampfter Lehmweg, auf dem große Pfützen standen. Zum ersten Mal wurde ihm bewusst, dass er die Großmutter nur auf dem Matratzenlager liegend kannte und auf diesem Stuhl. Er entsann sich ihres herben Schweißgeruchs und ihrer Wärme, in die sie ihn und Vika in kalten Winternächten mit den von der Gicht verkrüppelten Händen hineinzog, wie eine Katze, die die Jungen mit der Pfote in ihren Schutz rollt.
»Warum konnte Babuschka nicht laufen?«, fragte er.
Der Vater strich ihm über den Kopf und flüsterte: »Das erzähle ich dir, wenn du alt genug bist.«
Er nahm das Album und klappte es zu. »Schlafenszeit«, sagte er, und dann fügte er hinzu: »Du musst wissen, dass der Name Grenko in Russland lange Zeit ein großer Name war.«
Wie aufgeregt er an jenem Abend in seinem Bett gelegen hatte, ganz damit beschäftigt, sich mit kindlicher Phantasie diese geheimnisvolle Andeutung auszumalen. An Könige und große Krieger hatte er gedacht, an geheime, vergrabene Schätze.
Sascha sah auf die erloschenen Bildschirme, wanderte in Gedanken weiter zurück.
Auch an den Tag, an dem die Ausreiseerlaubnis kam, konnte er sich erinnern.
Es war ein warmer Maitag, und als er aus der Schule kam, lag ein Brief auf dem Küchentisch. Die Eltern hatten in der Vergangenheit immer wieder Ausreiseanträge gestellt, und wenn die Ablehnungen eingetroffen waren, war die Stimmung über Tage gedrückt gewesen.
Babuschka Galina sagte: »Der ist viel dicker als die, die bisher gekommen sind«, und er hatte sehnsüchtig darauf gewartet, dass die Eltern von der Arbeit heimkehrten und ihn öffneten.
In der Schule riefen sie ihm »Faschist« hinterher, weil seine Mutter eine Wolgadeutsche war. Auch einige der Lehrer nannten ihn so. Er wusste nicht, was genau damit gemeint war, nur dass es ein Schimpfwort war, aber er hörte immer auch eine Spur von Neid, wenn sie es sagten, weil es diese Möglichkeit in sich barg. Diese Möglichkeit auszuwandern. Schon in der ersten Klasse hatte er erklärt, dass er nicht lange bleiben würde, dass seine Familie bald nach Deutschland ginge, aber in der zweiten Klasse glaubte ihm das niemand mehr.
Der Vater kam an jenem Tag als Erster heim, wog den schweren Umschlag in seiner Hand, ging damit hinaus in die Laube und öffnete ihn vorsichtig mit einem Messer. Selbst das zischende Geräusch, als das Messer durch das Papier schnitt, meinte Sascha nach all den Jahren deutlich zu hören. Das Knistern der vielen Blätter, als der Vater sie auseinanderfaltete, das Poltern des fallenden Stuhls, als er aufsprang und ihn, Sascha, hochhob und herumwirbelte.
Schon eine Stunde später war es eng im Haus und in der Laube geworden. Djadja Pawel besaß ein Auto, und er war losgefahren, besorgte Wodka und Brot. Mutter und Tjotja Alja öffneten Gläser mit eingelegten Paprika, Gurken und Tomaten, schnitten Wurst in dicke Scheiben, und er selbst lief zwischen den Nachbarn und Freunden umher und konnte nur denken: Morgen in der Schule! Morgen sage ich: »Wir gehen nach Deutschland. Nein. Wir fliegen. Wir fliegen nach Deutschland.«
Vika saß auf dem Schoß von Babuschka und schlief. Sie war drei Jahre alt. Tante Alja strich ihr über die roten Pausbacken und lachte: »Sie ahnt ja nicht, was für ein Glückskind sie ist.«
Der tränenreiche Abschied von Babuschka Galina, Onkel Pawel und Tante Alja lag dünn unter der aufgeregten Neugier auf das neue Land. Die zweistündige Fahrt nach Alma-Ata, der Flughafen, die Zwischenlandung in Moskau und auch der Weiterflug, den er wohl über weite Teile verschlafen hatte, war ihm kaum noch im Gedächtnis. Aber die Landung in Hannover hatte er nicht vergessen.
Es war ein blendend heller Tag. Er erinnerte sich, dass sie sich im Flughafengebäude zusammen mit anderen Aussiedlern in einer Halle versammelt hatten, die mit taubenblauem Teppichboden ausgelegt war, und dass sie alle ihre Schuhe ausgezogen hatten. Eine Dolmetscherin erklärte verlegen lächelnd, dass das nicht nötig sei, aber niemand hatte die Schuhe wieder angezogen, es wäre ihnen wie ein Frevel vorgekommen. Später waren sie in einen blinkenden Mercedesbus gestiegen, dessen Motorengeräusche man im Innern kaum hörte. Er hatte den sauberen Asphalt der Straßen ebenfalls für Teppichboden gehalten und den Vater gefragt, ob ganz Deutschland mit diesen Teppichen ausgelegt sei.
Im Übergangslager bekamen er und Viktoria am ersten Abend je eine Tafel Schokolade geschenkt. Der Vater öffnete das Papier vorsichtig, faltete das Silberpapier auseinander, ohne es zu beschädigen. Weiße Schokolade. Er traute seinen Augen nicht. Jeder von ihnen aß an diesem Abend ein Stück. Die Süße breitete sich in seinem Mund aus, und als die Schokolade geschmolzen war, versuchte er, die cremige Flüssigkeit so lange wie möglich im Mund zu behalten.
Am nächsten Tag waren sie in einen Supermarkt gegangen. Der Leiter des Übergangslagers hatte dem Vater Geld gegeben. Sie waren durch die Gänge geirrt, und er hatte nicht gewusst, wohin er schauen sollte. Ängstlich hatte er nach der Hand des Vaters gegriffen. Die Mutter stand in der Obst- und Gemüseabteilung, strich mit ausgestrecktem Zeigefinger vorsichtig über Avocados, Papayas und Mangos und fragte immer wieder: »Ossip, was ist das … und das … und das?«
Der Vater hatte ihn an sich gedrückt und geflüstert: »Wir haben es geschafft, Saschenka. Jetzt wird alles gut.«
Aber dann war nichts gut geworden.
Das Erste, was sie ihm in der neuen Heimat auf dem Einwohnermeldeamt genommen hatten, war sein Vatersname »Ossipowitsch« gewesen. Ab jetzt hieß er nicht mehr Alexander Ossipowitsch Grenko, sondern nur noch Alexander Grenko, genannt Sascha. Nicht, dass ihn jemand bei seinem vollen Namen gerufen hätte, aber trotzdem spürte er den Verlust, und abends hatte er den Vater gefragt: »Bin ich jetzt nicht mehr dein Sohn?«
Hatte damit alles begonnen?
In den Jahren danach hatte er oft gedacht: Wenn sie mir den Namen gelassen hätten, wären mir auch die Eltern und Vika geblieben. Das war natürlich Unsinn, und inzwischen glaubte er nicht mehr an Gesetzmäßigkeiten. Das Leben war Chaos. Zumindest das seine entzog sich jeder Logik, und die Art, wie er als Kind und Jugendlicher von einer Katastrophe in die nächste gestolpert war, war mit Ursache und Wirkung nicht zu erklären.
Er hatte für sich die These entwickelt, dass die Menschen wie Planeten in einer Umlaufbahn existierten. Jede Begegnung, so stellte er sich vor, nahm Einfluss auf diesen Orbit, war wie ein Stoß, der die Bahn veränderte. Manchmal waren es nur kleine Stöße, aber manchmal eben auch harte, die dem Leben eine vollkommen andere Richtung gaben. Dabei spielte es keine Rolle, wie nahe man jemandem stand oder wie viel man mit ihm zu tun hatte. Er war vor achtzehn Jahren von einem Menschen aus seiner Bahn katapultiert worden, den er nie kennengelernt hatte. Nur die Scheinwerfer seines Autos hatte er gesehen. Mehr nicht.
Sascha fuhr sich mit beiden Händen durch das dichte braune Haar, das er kurz trug und das meist in alle Richtungen abstand. Er schob den Schreibtischsessel zurück. Sein Flug nach München ging um 19.30 Uhr. Er packte seinen Laptop, zwei T-Shirts und einen schlichten Stoffbeutel mit Zahnbürste, Zahnpasta und Deodorant in den kleinen Alukoffer, ging hinüber in Regers Büro und schrieb ihm eine kurze Notiz. Dann fuhr er zum Flughafen.
Wenige Monate nach dem tödlichen Unfall der Eltern war auch Viktoria verlorengegangen. Sie war, aber das erfuhr er erst sehr viel später, adoptiert worden, und er hatte nie wieder von ihr gehört. Es war seine Schuld gewesen. Er hatte nach Hause gewollt, hatte ohne die Eltern nicht in diesem fremden Land bleiben wollen.
Als er sich eines Morgens weigerte, in die Schule zu gehen, hatte ihm die Erzieherin gedroht: »Wenn du nicht lieb bist, schickt man euch zurück nach Kasachstan.« Er hatte seine Chance gesehen und alles darangesetzt, nicht lieb zu sein. Aber sie hatte gelogen. Stattdessen kam er in ein anderes Heim, fort von Vika. Immer wieder war er abgehauen, hatte sich tagelang rumgetrieben, immer auf der Suche nach Vika. Irgendwann hatte man ihm gesagt, dass Vika adoptiert worden sei. Da war er endgültig alleine gewesen. Tagelang hatte er sich ganz taub gefühlt vor Einsamkeit.
Er war weiterhin weggelaufen, ziellos, getrieben von der kindlichen Idee, dass er sie treffen würde, wenn er sich nur lange genug auf den Straßen aufhielte. Später, in den geschlossenen Erziehungsheimen und dann in der Jugendstrafanstalt, fand er sich ab, redete sich ein, dass Vika in einem schönen Haus bei freundlichen Leuten lebte.
Jetzt hatte sie ihn gefunden und schlicht gesagt: »Sascha, ich bin in Schwierigkeiten. Es geht um unsere Vergangenheit, und ich brauche deine Hilfe.«
Er hatte keine Sekunde gezögert. »Ich komme«, antwortete er, und erst Minuten später, als sie längst aufgelegt hatte, war ihm klargeworden, dass er sie tatsächlich wiedersehen würde. Seine kleine Schwester Viktoria.
Eine halbe Stunde später hatte er in der Pension angerufen und darum gebeten, Viktoria Freimann auszurichten, dass er um 20.40 Uhr in München landen würde.
Kapitel 3
Iljas Frau Galina Petrowna Grenko war mit ihren ein Meter achtundsiebzig eine außergewöhnlich große Frau. Ihr feingeschnittenes Gesicht mit den mongolisch hohen Wangenknochen und dem pechschwarzen Haar, das sie meist kunstvoll hochgesteckt trug, erregte überall Aufmerksamkeit. Nach dem Konzert war sie im Saal geblieben, hatte Freunde und Bekannte begrüßt, Komplimente und Grüße an ihren Mann entgegengenommen und immer wieder die Frage beantwortet, wann sie wieder auf der Theaterbühne zu sehen wäre. Die Geburt ihres zweiten Sohnes war schwierig gewesen, und man hatte ihr eine längere Spielpause zugestanden, aber in einem Monat, verriet sie, würde sie die Arbeit am Mchat-Theater wieder aufnehmen und mit den Proben zu einem neuen Stück beginnen. Sie lachte fröhlich, obwohl ihr nicht danach war. Vor dem Konzert hatte sie mit Meschenow gesprochen, und Galina war in Sorge.
Ilja lebte für seine Musik, war im Schutz des Konservatoriums aufgewachsen. Das begabte Kind, von dem man alles ferngehalten hatte. Und später hatte sie diese Rolle übernommen, hatte seine Welt vor störenden Einflüssen geschützt. Für Ilja waren Willkür oder gar Boshaftigkeit undenkbar.
Galina erinnerte sich an ihre erste Begegnung vor sieben Jahren. Auch das war hier im Tschaikowsky-Konservatorium gewesen. Ilja hatte ein Solokonzert gegeben, und sein Spiel, seine Interpretationen der einzelnen Stücke waren voll unschuldiger Lebenslust gewesen. Damals verliebte sie sich genau in diese naive Lebensfreude. Auf dem anschließenden Empfang war er fröhlich, geradezu übermütig gewesen, war auf sie zugekommen und hatte, ungeachtet ihres Begleiters, gesagt: »Sie sind wunderschön. Ich kann einfach nicht aufhören, sie anzusehen.« Dann hatte er einen der Fotografen gebeten: »Bitte, Sie müssen ein Bild von mir zusammen mit dieser Frau machen, damit ich sie für immer ansehen kann.«
Aber jetzt würde sie ihn nicht weiter schonen können. Meschenow hatte sie vor dem Konzert angesprochen. Er hatte von den Musikern im Exil gesprochen und dann Iljas Wienreise erwähnt. »Die Zeiten sind unsicher«, hatte er vorsichtig angedeutet. »Ilja sollte in den nächsten Monaten nicht reisen.« Es hatte wie eine Warnung geklungen.
Im Mchat-Theater ging das Gerücht, dass Kollegen mit Auslandskontakten verhaftet worden seien. Nach dem Empfang würde sie mit Ilja reden.
Gemeinsam mit Meschenow und einigen Freunden war sie auf dem Weg aus dem Saal, als Wassili Jarosch, der Pförtner vom Künstlereingang, eilig auf sie zukam.
»Galina Petrowna«, rief er außer Atem, »bitte warten Sie.«
Sie wusste es im selben Augenblick. Sie hörte es in der Atemlosigkeit des alten Jarosch. Sie sah es in seinen aufgeregten Armbewegungen.
»Ein großes Unglück, Galina Petrowna«, sprudelte es aus ihm heraus. »Sie haben Ilja Wassiljewitsch verhaftet, sie haben ihn geholt.«
Jenes letzte Wort, jenes »geholt«, schien sich auszubreiten wie eine Viertelstunde zuvor die letzten Klänge des Konzertes. Aber es stieg nicht auf, wie die Musik es getan hatte, es lag dumpf und bedrohlich auf ihren Schultern.
Galina spürte Kälte, sah in den Augen der Freunde den ängstlichen Rückzug, sah, wie die Ersten ihre Köpfe senkten, hörte eilig geflüsterte Verabschiedungen. Andere schüttelten ungläubig die Köpfe, sprachen von Missverständnis, einige Mutige von Skandal. Meschenow erfasste die Situation als Erster und ergriff ihren Arm. Er zog sie über den Hof, hinüber zum Schulgebäude, wo er sein Büro hatte. Kaum dass er die Tür hinter sich geschlossen hatte, schlug er die Hände vors Gesicht, atmete mehrere Male tief durch. »Das kann ich nicht glauben«, flüsterte er wie zu sich selbst. »Das wird sich aufklären. Das muss sich aufklären. Ein unglaubliches Missverständnis! Ja … etwas anderes ist nicht möglich.«
Dann wandte er sich an Galina. »Wer ist bei Ihren Kindern?«, fragte er.
Jetzt endlich erwachte Galina aus ihrer Schockstarre.
»Eine Freundin«, flüsterte sie. »Aber Sie glauben doch nicht …«
»Nein, nein«, er hielt ihr den Telefonhörer hin, »aber rufen Sie vorsichtshalber an.«
Mit zitternden Fingern wählte sie die Nummer. Das Freizeichen ertönte, so schien es ihr, hundert Mal, ehe ihre Freundin Edita sich endlich meldete.
»Galina, du musst sofort kommen.« Edita schluchzte. »Sie haben das Geschirr zerschlagen, die Bücherregale umgeschmissen, sogar die Kinderzimmer haben sie durchsucht.«
Galina unterbrach sie. »Edita, was ist mit Pawel und Ossip?«
»Sie sind hier. Pawel weint, aber den beiden ist nichts passiert. Was ist denn bloß los, Galina?«
Galina spürte, dass ihr Tränen über das Gesicht liefen.
»Sie haben Ilja verhaftet«, flüsterte sie mit erstickter Stimme, und erst jetzt, indem sie es aussprach, kam das ganze Ausmaß dieser Botschaft bei ihr an. Ihr Verstand gewann die Oberhand. Sie wischte sich die Tränen fort.
»Edita, kannst du die Kinder mit zu dir nehmen? Ich melde mich so bald wie möglich.«
Als sie auflegte, sah sie Meschenow an, der zusammengesunken hinter seinem Schreibtisch saß. Entschieden sagte sie: »Ich fahre zur Lubjanka.«
Der Alte schüttelte den Kopf. »Das hat keinen Sinn, Galina. Man wird Sie nicht vorlassen.«
Galina nickte. »Das weiß ich, aber ich habe gehört, dass man Auskünfte kaufen kann.«
Meschenow hob die Hände. »Das sollten Sie auf keinen Fall selber tun.« Er griff zum Telefon, wählte mehrere Telefonnummern, ohne jemanden zu erreichen. Schließlich zog er seine Uhr aus der Westentasche. Es war weit nach Mitternacht. Meschenow versuchte ein aufmunterndes Lächeln. »Ich werde mich kümmern. Morgen früh kann ich ihn sicher erreichen.«
Er kam um den Schreibtisch herum und tätschelte ihre Wange. »Gehen Sie zu Ihren Kindern«, sagte er. »Ich melde mich, sobald ich etwas weiß.«
»Wer ist er? Wen wollen Sie erreichen?«, fragte sie.
Meschenow schüttelte den Kopf. Dann fragte er, wie er sie bei Edita erreichen könne, und versprach noch einmal: »Ich melde mich, sobald ich etwas höre.«
Kapitel 4
Am Flughafen München mietete er einen Leihwagen und erreichte um kurz vor 22.00 Uhr die Hubertusgasse. Die Pension war schäbig. In dem schmalen Flur roch es nach erkaltetem Zigarettenrauch, über einem Tresen, der wohl als Rezeption diente, baumelte ein Fliegenfänger mit reichlich Beute.
Er betätigte einen ehemals weißen Klingelknopf, der auf dem Tisch festgeklebt war. Das schrille Läuten ertönte in einem Zimmer gegenüber, aus dem eine dürre, stark geschminkte Frau mittleren Alters erschien.
»Zimmer nur ab einer Woche«, knurrte sie ohne Begrüßung und stakste auf viel zu hohen Absätzen hinter die Theke. Dann erst nahm sie wahr, dass der Mann vor ihr ziemlich gut aussah, und lächelte.
»Wir hatten telefoniert«, sagte Sascha freundlich. »Ich habe Sie gebeten, Frau Freimann zu informieren, dass ich heute Abend ankomme … Sie ist meine Schwester.«
Dieser nachgeschobene Satz klang albern, aber er hatte das Bedürfnis, es laut auszusprechen, hätte am liebsten noch hinzugefügt, »wir haben uns fast zwanzig Jahre nicht gesehen. Das ist nicht irgendein Besuch. Das ist etwas ganz Besonders«, aber er schwieg.
»Ach Sie? Ja, ja, Ihre Schwester«, bemerkte sie ein wenig ironisch. »Die Freimann ist nicht da. Die arbeitet um diese Zeit.«
Sie fingerte mit ihren langen roten Fingernägeln einen Schlüssel aus dem Fach Nummer acht und schob ihn zusammen mit einem gepolsterten Umschlag über den Tresen. »Sie hat mir gesagt, ich soll Ihnen das geben und Sie aufs Zimmer lassen. Gegen ein Uhr ist sie zurück.«
Auf dem Kuvert stand in steiler Schrift: Sascha Grenko. Er sah auf die Uhr. »Können Sie mir sagen, wo sie arbeitet?«
In Anbetracht der Unterkunft und dieser Frau fürchtete er die Antwort.
Die hob ihre aufgemalten Augenbrauen, schob die kirschroten Lippen vor und zuckte mit den Schultern. »Sie spielt seit ein paar Tagen im Holiday Inn.«
»Spielt?«, fragte er.
»Ja. Sie spielt Klavier in der Bar.« Ihre Stimme hatte wieder diesen spöttischen Unterton. »Dafür, dass Sie ihr Bruder sind, wissen Sie aber reichlich wenig.«
Sascha nahm den Zimmerschlüssel und das Kuvert an sich und verließ kommentarlos die Pension. Im Auto gab er »Holiday Inn« in das Navigationsgerät ein, dann öffnete er den Umschlag. Er fand einen weiteren Schlüssel und einen Zettel. »Hallo Sascha, ich bin so froh, dass du so schnell kommen konntest. Der Schlüssel gehört zu einem Schließfach am Hauptbahnhof. Nimm ihn bitte an dich. Bis später, Viktoria.«
Er legte den Umschlag und den Zettel ins Handschuhfach und steckte den Schlüssel in seine Sakkotasche. Das Navigationsgerät zeigte eine Entfernung von 0,4 Kilometern zum nächsten Holiday Inn an, und er entschied, zu Fuß zu gehen.
Auf dem Weg zum Hotel griff er nach dem Schließfachschlüssel in seiner Tasche. Zum ersten Mal kam ihm der Gedanke, dass er nichts über seine Schwester wusste. Vielleicht war sie krank, oder sie hatte sich in irgendeine phantastische Geschichte hineingesteigert, jedenfalls schien ihm die Sache mit dem Schließfachschlüssel merkwürdig.