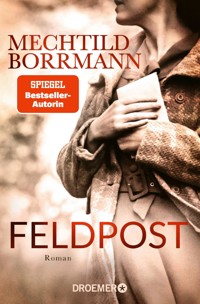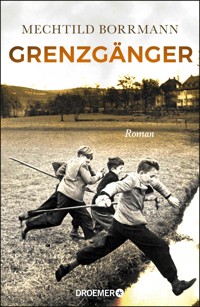
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Recht nicht Gerechtigkeit ist: Spiegel-Bestseller-Autorin Mechtild Borrmann mit ihrem Meisterwerk "Grenzgänger" rund um ein düsteres Kapitel deutscher Nachkriegs-Geschichte: Heimkinder in den 50er und 60er Jahren. Die vielfach ausgezeichnete Autorin Borrmann, die mit ihren Zeitgeschichte-Romanen "Grenzgänger" und "Trümmerkind" monatelang auf der Spiegel-Bestseller-Liste stand, erzählt mit der ihr eigenen soghaft-präzisen Sprache die Geschichte einer lebenshungrigen Frau - ein ehemaliges Heimkind - , die an Gerechtigkeit glaubt und daran verzweifelt. Die Schönings leben in einem kleinen Dorf an der deutsch-belgischen Grenze. Wie die meisten Familien hier in den 50er und 60er Jahren verdienen sich auch die Schönings mit Kaffee-Schmuggel etwas dazu. Die 17jährige Henni ist, wie viele andere Kinder, von Anfang an dabei und diejenige, die die Schmuggel-Routen über das Hohe Venn, ein tückisches Moor-Gebiet, kennt. So kann sie die Kaffee-Schmuggler, hauptsächlich Kinder, in der Nacht durch das gefährliche Moor führen. Ab 1950 übernehmen immer mehr organisierte Banden den Kaffee-Schmuggel, und Zöllner schießen auf die Menschen. Eines Nachts geschieht dann das Unfassbare: Hennis Schwester wird erschossen. Henni steckt man daraufhin 1951 in eine Besserungsanstalt. Wegen Kaffee-Schmuggels. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Die jüngeren Geschwister, die Henni anstelle der toten Mutter versorgt hatte, kommen als Heimkinder in ein kirchlich geführtes Heim. Wo der kleine Matthias an Lungenentzündung verstirbt. Auch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Spannung und Zeitgeschichte miteinander zu verknüpfen, versteht Borrmann wie keine andere deutsche Autorin. "Grenzgänger" ist ein packender wie aufwühlender Roman, eingebettet in ein düsteres Stück Zeitgeschichte - die 50er und 60er Jahre in Deutschland. "Als beeindruckende Chronistin durchdringt Mechtild Borrmann vielstimmig die Schattenwelten der deutschen Zeitgeschichte. 'Grenzgänger' handelt von der Suche nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit in einer Zeit der kleinen und großen Lügen - ein starker Roman!" Hamburger Morgenpost
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mechtild Borrmann
Grenzgänger
RomanDie Geschichte einer verlorenen deutschen Kindheit
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Wenn Recht nicht Gerechtigkeit ist: Spiegel-Bestseller-Autorin Mechtild Borrmann mit ihrem neuen Meisterwerk »Grenzgänger« rund um ein düsteres Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte: Heimkinder in den 50er und 60er Jahren.
Die Schönings leben in einem kleinen Dorf an der deutsch-belgischen Grenze. Wie die meisten Familien hier verdienen sich auch die Schönings mit Kaffee-Schmuggel etwas dazu. Die 17-jährige Henni ist, wie viele andere Kinder, von Anfang an dabei und diejenige, die die Schmuggel-Routen über das Hohe Venn, ein tückisches Moor-Gebiet, kennt. So kann sie die Kaffee-Schmuggler, hauptsächlich Kinder, in der Nacht durch das gefährliche Moor führen. Ab 1950 übernehmen immer mehr organisierte Banden den Kaffee-Schmuggel, und Zöllner schießen auf die Menschen. Eines Nachts geschieht dann das Unfassbare: Hennis Schwester wird erschossen.
Henni steckt man daraufhin 1951 in eine Besserungsanstalt. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit.
Die jüngeren Geschwister, die Henni anstelle der toten Mutter versorgt hatte, kommen in ein kirchliches Heim. Wo der kleine Matthias an Lungenentzündung verstirbt. Auch das ist nur ein Teil der Wahrheit.
Spannung und Zeitgeschichte miteinander zu verknüpfen, versteht Borrmann wie keine andere deutsche Autorin. »Grenzgänger« ist ein packender wie aufwühlender Roman, eingebettet in ein düsteres Stück Zeitgeschichte.
Inhaltsübersicht
Zitat
Motto
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Nachwort
Danksagung
Es glaubt der Mensch, sein Leben zu leiten, sich selbst zu führen, und sein Innerstes wird unwiderstehlich nach seinem Schicksale gezogen.
Johann Wolfgang von Goethe, Egmont
Die Anhörung in Sachen Matthias Schöning fand am 9. April 1970 im Amtsgericht Aachen statt.
Der Prozess gegen Henni Bernhard wurde sechs Monate später vor dem Landgericht Aachen geführt.
Prolog
Von Henriette Bernhard, geborene Schöning, soll hier die Rede sein. Von ihrem Mut und Übermut, von ihrem Glück und Unglück, von ihrer Schuld und Unschuld und dem Bedürfnis, das Richtige zu tun.
Als Kind war sie ein rechter Wildfang, eine, die ohne Angst schien und ständig ihre Grenzen auslotete. Sie war die, die am äußersten Rand des Steilhanges balancierte und auch dann nicht zurücktrat, wenn sich unter ihren Füßen Steine lösten und dreißig Meter in die Tiefe stürzten. Die, die auf Händen den Schulhof überqueren konnte, die, die sich stundenlang im Hohen Venn herumtrieb und mit traumwandlerischer Sicherheit begehbare Wege durch das Hochmoor fand.
Ihr Lachen ist im Gedächtnis geblieben. Ein Lachen, so voll und satt, dass es jeden Raum ausfüllte und das die Lehrerin gleich im ersten Schuljahr schmutzig nannte, weil es immer ein wenig abfällig klang. Aber das war es nicht.
Jahre später, als das Gehör empfindsam für Nuancen war, konnten die, die sie gut kannten, es heraushören: die Verzweiflung und den gleichzeitigen Lebenshunger. Diese beiden Gewichte in ihr, die sie ihr Leben lang mit der Präzision einer Apothekerwaage austarieren und halten musste.
Lange hat sie die Balance gehalten, indem sie jedem Gramm Lebensfreude das doppelte Gewicht zusprach. Zum Schluss hat auch das nicht gereicht.
Der Versuch, sie zu erfassen, ihr Leben chronologisch und wahrheitsgemäß zu rekonstruieren, hat sich als unmögliches Unterfangen herausgestellt. Manchmal mit dem Bedürfnis, ihr kein Unrecht zuzufügen, oft aber auch, um sich selbst ins rechte Licht zu rücken, haben die Zeugen ihre Erinnerungen sortiert. Eine lässliche Sünde, die wohl jeder im Laufe seines Lebens begeht, aber in diesem Fall sind die Lücken und weit auseinanderliegenden Wahrheiten schmerzlich. Wie soll man ihr gerecht werden, wenn man eingestehen muss, dass es die eine Wahrheit über sie nicht gibt, nie gegeben hat?
Auch in den Polizeiakten findet sie sich nicht, dort am wenigsten.
Wenn man nur sagen könnte, womit alles angefangen hat. Wenn man sagen könnte: An dem Tag, da sind die Dinge aus dem Ruder gelaufen! Aber so einfach ist das nicht.
Kapitel 1
Velda, Herbst 1970
Am Mittwoch war wieder ein Verhandlungstag. Urteilsverkündung soll in zwei Wochen sein. »Im Namen des Volkes«, wird der Richter sagen und dann Recht sprechen.
Die Zeitungen verfolgen den Prozess mit großer Aufmerksamkeit. Die Tageszeitung hat von »erwiesener Schuld« und »eindeutigen Beweisen« gesprochen, und eine überregionale Tageszeitung schreibt: »Die Lügen der Henriette B.« Weiter unten war noch zu lesen, dass Henriette – die von allen nur Henni genannt wurde – schon mit siebzehn Jahren straffällig geworden sei und später immer wieder mit Polizei und Gericht zu tun hatte.
Auf dem Gasherd kocht das Wasser im Kessel. Elsa Brennecke stützt ihre Hände auf den Küchentisch, schiebt den Oberkörper vor und steht auf. »Ja, ja! So einfach machen die sich das. Legen sich die Dinge zurecht. Hier ein bisschen was verschweigen, da ein bisschen was dazutun, und fertig ist die neue Wahrheit.«
Der Mischlingshund Sam liegt unterm Tisch, hebt kurz den Kopf, lauscht und legt ihn wieder zurück auf die Vorderpfoten. Elsas linkes Bein ist etwas kürzer. Ein Umstand, den ihre Eltern in ihrer Kindheit ignoriert hatten. Sie zog das Bein leicht nach, und der Vater hatte gesagt: »Das wächst sich aus.« Als sie später immer deutlicher hinkte und über Schmerzen klagte, wurde endlich ein Arzt aufgesucht. Aber da war es bereits zu spät. Da stand ihr Becken schon schief, und die Wirbelsäule hatte das mit einer Krümmung zur Seite ausgeglichen. Seither trägt sie unter ihrem linken Straßenschuh eine Erhöhung. Einen Klumpschuh. Der erleichtert ihr das Gehen, aber der Schaden ist da, und von Jahr zu Jahr machen die Hüfte und der Rücken mehr Probleme.
In ihren ausgetretenen, grau karierten Hausschuhen humpelt sie zum Herd. Auf dem Kühlschrank steht die Isolierkanne, die sie sich vor drei Jahren gegönnt hat. Seither kocht sie morgens eine ganze Kanne Kaffee, und der bleibt bis zum Nachmittag heiß. Sie stellt den Porzellanfilter mit der Filtertüte auf die Kanne, löffelt Kaffeepulver hinein und gießt kochendes Wasser darüber. Der Duft breitet sich aus, füllt die bescheidene Küche.
Den Tisch mit der grau-weiß melierten Resopalplatte, den Kühlschrank und auch den Elektroherd hatten sie sich im Laufe der Jahre neu angeschafft. Der Heinz hatte sie trotz ihrer ungleichen Beine genommen und war ihr ein guter Ehemann gewesen. Im Sägewerk war er angestellt gewesen, und sie hatte mit dem Stück Land hinterm Haus etwas dazuverdient. Der große Garten gab mehr her, als sie brauchten. Jeden Samstag verkaufte sie auf dem Wochenmarkt in Monschau Obst und Gemüse. Den Verdienst hatte sie abends gezählt, die Summe in ein kleines Heft eingetragen und das Geld in die Blechdose mit der Schneelandschaft auf dem Deckel gesteckt. »Aachener Printen« stand auf der Seite, und im Scherz hatte Heinz manchmal gefragt: »Wie viele Printen sind denn drin?«
Sie hatten sich viele Kinder gewünscht, aber daraus war nichts geworden. Nach zwei Fehlgeburten im sechsten Monat stand fest, dass ihr schiefes Becken die Leibesfrucht nicht hielt. Der Heinz hatte sie trotzdem nicht verlassen. Sie waren zufrieden gewesen, aber dann war ihr vor sieben Jahren – mit nur dreiunddreißig Jahren – der Heinz gestorben. Einfach so! Tage zuvor hatte er über Schmerzen in der Brust geklagt.
»Du solltest damit zum Arzt gehen«, hatte sie gemahnt, doch er hatte bloß geantwortet: »Ist von alleine gekommen, wird auch von alleine wieder gehen.« So war er gewesen, ihr Heinz. Bei der Arbeit im Sägewerk war er eines Morgens umgefallen, einfach so. Als man ihr endlich Bescheid gesagt hatte und sie am Nachmittag im Krankenhaus ankam, lag er schon aufgebahrt in der Krankenhauskapelle. Sie hatte sein Gesicht gestreichelt und es einfach nicht glauben können. Das konnte doch nicht ihr Heinz sein, der immer ein kräftiges und gesundes Mannsbild gewesen war.
»Du kannst mich doch nicht alleine lassen«, hatte sie ihm zugeflüstert, aber das hatte er getan und sie mit gerade mal dreißig Jahren zur Witwe gemacht. Erst vier Tage später, als die Dorfbewohner ihr auf dem Friedhof mit festem Händedruck ihre Anteilnahme aussprachen, hatte sie erkannt, dass die mitleidigen Blicken nicht nur ihrem Verlust galten, sondern auch ihrer absehbaren Zukunft. Sie war keine Schönheit, ging hinkend durchs Leben und konnte keine Kinder bekommen. In den Tagen danach hatte sie viel geweint. Um Heinz und um sich. Um Heinz, weil er ihr fehlte, um sich, weil sie erst dreißig Jahre alt war und ahnte, dass sie von nun an ein Leben als Witwe Brennecke führen würde.
Sie stellt den Filter ins Spülbecken, nimmt einen Becher aus dem Schrank und schenkt sich ein. Dann steckt sie den Verschluss auf die Isolierkanne, schraubt ihn fest und dreht die Kanne kurz auf den Kopf, um zu überprüfen, ob sie auch richtig schließt.
Das Spülbecken aus Steingut, der Küchenschrank aus Eiche mit den gewölbten Türen und den Glasschütten für Zucker, Mehl und Salz stammten noch von ihren Eltern. Auch die Eckbank mit der fadenscheinigen blauen Sitzpolsterung war schon immer da gewesen. Auf eine Spüle aus Edelstahl hatten sie zuletzt gespart. So eine hätte sie gerne gehabt, aber Heinz’ Beerdigung war teuer gewesen und hatte die Ersparnisse aufgezehrt.
In den Jahren danach war nichts mehr übrig geblieben, was sie hätte sparen können. Nach Heinz’ Tod hatte sie als Verkäuferin in einem Schreibwarengeschäft in Monschau gearbeitet, aber das lange Stehen hatte ihr solche Schmerzen bereitet, dass sie kündigen musste. Mit der kleinen Witwenrente und dem Verkauf auf dem Wochenmarkt kommt sie jetzt gerade so über die Runden.
In den letzten Wochen hat sie ihren Garten vernachlässigt, weil sie an allen Verhandlungstagen nach Aachen gefahren ist. Die Kanne hatte ihr da gute Dienste geleistet. Morgens um sieben musste sie los. Fünfzehn Minuten zu Fuß bis zur Bushaltestelle, dann mit dem ersten Bus zum Monschauer Bahnhof, mit der Bahn bis Aachen und dort noch einmal eine Viertelstunde zu Fuß bis zum Landgericht. Ein weiter Weg, aber sie hatte nicht einen Prozesstag versäumt, und wenn die Beamten Henni durch den Nebeneingang zur Anklagebank brachten, hatte sie ihr jedes Mal zugenickt. Ein kurzes Nicken. Ein kleines Zeichen, das sagen sollte: Nicht den Mut verlieren!
Einmal hatte sie einen Platz ganz nah bei der Anklagebank erwischt. Da hatte Henni sich zu ihr umgedreht und geflüstert: »Elsa, du musst doch nicht ständig diesen weiten Weg auf dich nehmen.«
»Doch«, hatte sie geantwortet, »doch Henni, das muss ich!« Das hätte ich schon vor zwanzig Jahren tun sollen, war ihre Antwort in Gedanken weitergegangen, aber gesagt hatte sie das nicht.
Hennis Mann Georg saß immer schon im Zuschauerraum, wenn sie ankam. Er wirkte um Jahre gealtert.
Elsa humpelt zum Tisch zurück und setzt sich. Sie streift ihren rechten Pantoffel ab und fährt mit dem Fuß sanft über Sams Fell. Sie spricht zu dem Hund, wie sie es seit Jahren tut. Sam ist ein guter Zuhörer.
»Der Georg, der tut mir leid. Der versteht die Welt nicht mehr. ›Warum verteidigt sie sich denn nicht?‹, hat er mich gefragt. Aber was soll man da antworten? Nicht mal auf die Fragen des Richters hat sie reagiert. Und die Leute, die nehmen ihr das übel.«
In der Pause hatte Elsa sie auf dem Flur reden hören.
»Wenn sie unschuldig wäre, dann würde sie sich ja wohl verteidigen«, hatte eine Frau gesagt.
»Ach, was wissen Sie denn schon«, hatte Elsa sie zurechtgewiesen, »gar nichts wissen Sie!«
Sie nimmt einen Schluck Kaffee. »Die Leute denken so, Sam«, sagt sie leise zu ihrem Hund. »Da kann man nichts machen.«
Mit ihrem Anwalt Dr. Grüner hatte Henni wohl auch nicht gesprochen. Der Mann machte an den Verhandlungstagen einen überforderten, geradezu hilflosen Eindruck. Hennis Schweigen und dann auch noch diese Zeugen mit ihren ganz eigenen Erinnerungen … Die Teilwahrheiten, die Erinnerungslücken und die kleinen Ausschmückungen, mit denen sie sich interessant machten. »Hörensagen« war der einzige Einspruch, den Dr. Grüner immer wieder machte. Zu Anfang rief er sein: »Einspruch! Hörensagen!« noch mit lauter Stimme, aber von Verhandlungstag zu Verhandlungstag wurde der Einspruch kraftloser.
Wenn die Zeugen sprachen, saß Henni mit hocherhobenem Kopf da, manchmal mit einem leisen Staunen im Blick. Kein Groll. Keine Empörung. Sie saß da wie eine Zuschauerin in einer Theateraufführung.
Elsa zieht ihren rechten Hausschuh wieder an und hinkt mit dem Becher zum Fenster. »Wenn nicht ein Wunder geschieht, dann werden sie Henni verurteilen«, flüstert sie zum Fenster hinaus.
Die Leute im Dorf hatten es schon getan. Wenn sie freitags im Lebensmittelladen bei Marion Pfaff ihre Besorgungen machte, wurde davon gesprochen. Eine, die hier aufgewachsen war, hatte so was getan. Das passte nicht in ihre beschauliche, kleine Welt. Die Marion hielt mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg und sagte jedem, der es hören wollte: »Anfällig für Dummheiten war die ja schon als Kind, und dann, als junges Mädchen … Na ja, man weiß ja, wo die anschließend war. Schlechte Gesellschaft, da weiß man doch, wo so was hinführt!« Das hatte etwas Beruhigendes. Das sagte, dass dieses Dorf so eine nicht hervorgebracht hatte.
Elsa sieht zu Sam. »Verlogenes Pack, alle miteinander. Erst haben sie sie gut gebrauchen können, haben an ihrem Wagemut und ihrer Unerschrockenheit gut verdient. Und dann … Dass sie nicht genug gekriegt hätte, haben sie später behauptet, dabei wussten sie alle, warum sie immer wieder über das Plateau gegangen ist.«
Und davon würde sie Jürgen Loose erzählen. Von der Henni, die im Gericht nicht sichtbar war. Der junge Mann hatte jeden Tag im Gericht gesessen und war wie sie nachmittags zu Fuß zurück zum Bahnhof gegangen. Auf dem Weg hatte er sie angesprochen. »Jürgen Loose«, hatte er sich vorgestellt und gefragt, ob sie eine Bekannte von Henriette Bernhard sei. Sie war wortlos weitergegangen, und er war neben ihr geblieben und hatte geredet. Dass er Jurastudent sei mit Schwerpunkt Strafrecht und dass er den Prozess zu Studienzwecken besuche. Dass der Verteidiger keine gute Figur mache, es aber mit seiner Mandantin auch nicht leicht habe. Er sprach von Verteidigungsstrategie und lauter juristischem Zeug. Angeberisch hatte er geklungen.
»Frau Bernhard ist ja wirklich keine einfache Person. Ich meine, sie lässt ihren Anwalt im Regen stehen. Wieso sagt sie nicht, warum sie es getan hat? Wahrscheinlich könnte er mildernde Umstände geltend machen.«
Da war Elsa böse geworden. »Aha! Und woher wissen Sie so genau, dass sie es getan hat?«
Der Loose hatte einen roten Kopf bekommen und verlegen gestammelt: »Ehrlich gesagt, ich habe da inzwischen auch meine Zweifel.«
Dieses Zugeständnis hatte aufrichtig geklungen, und sie war stehen geblieben. »Woher soll ich wissen, dass Sie nicht von einer dieser Zeitungen sind?«
Aus seiner Umhängetasche kramte er einen Studentenausweis hervor und reichte ihn ihr. Einundzwanzig Jahre war er alt. Seither waren sie den Weg vom Landgericht zum Bahnhof gemeinsam gegangen. Seine angeberischen Fachausdrücke hatte er bald weggepackt, und Elsa meinte, dahinter einen jungen Mann zu erkennen, der sich aufrichtig für die Wahrheit interessierte.
Gestern hatte sie die Einladung ausgesprochen, und heute Nachmittag würde Jürgen Loose sie besuchen. Vielleicht war das eine Dummheit, aber im Prozess wurde ein Bild von Henni gezeichnet, das mit der wahren Henni nichts gemein hatte. Sie würde ihm erzählen, wie Henni wirklich war oder, besser, wie sie gewesen war.
Elsa blickt über ihren großen Garten. Das Laub der Obstbäume hat einen braungelben Teppich auf die Wiese gelegt. Im Gemüsegarten hat sie die abgeernteten Beete schon umgegraben. Der Rosenkohl und der Grünkohl stehen noch. Damit muss sie noch warten, die brauchen Frost. Aber die letzten beiden Kartoffelreihen sollte sie ausgraben, bevor die Nächte kalt werden.
Sie sieht über die Beete und die Straße hinweg, betrachtet die Ruine schräg gegenüber. Die graue Fassade mit den hohläugigen Fenstern ohne Glas und den großflächigen Rußspuren darüber, die bis zum eingefallenen Dach reichen. Die Haustür ist mit Brettern vernagelt. An der Straße steht jetzt ein »Betreten verboten«-Schild. Das Gelände ist verwildert, das Unkraut hat sich unter der Buchenhecke bis zur Straße ausgesät. Das Haus und der Garten sind schon seit Langem in diesem erbärmlichen Zustand, nicht erst seit dem Feuer. Hennis Vater hatte sich zuletzt um nichts mehr gekümmert.
Elsa stellt den leeren Becher in den Spülstein. »Komm, Sam. Das Wetter bleibt trocken, und die Kartoffeln müssen aus der Erde. Bis der junge Mann kommt, ist noch Zeit.«
Augenblicklich steht der Hund neben ihr und wedelt freudig mit dem Schwanz.
Kapitel 2
Velda, 1945
Henni Schöning war zwölf, als der Krieg endlich vorbei war. Velda war lange verschont geblieben, nur im Frühjahr 1940, als Belgien besetzt wurde, rückte er für kurze Zeit nah heran. Für einige Tage hörte man das Grollen der Flugzeuge, die das Dorf überflogen. Dann kehrte wieder Ruhe ein.
Henni besuchte die Dorfschule und gehörte ohne Anstrengung zu den Klassenbesten. Ihr fielen die Dinge zu, und der neue Lehrer, der im Herbst 1945 Fräulein Guster ablöste, rügte sie am letzten Schultag in der sechsten Klasse, weil sie am Tag zuvor wieder mal geschwänzt hatte. Zu jener Zeit hörte man ihr unvergleichliches Lachen, das sie wie eine frische Windböe über den kleinen Schulhof schickte, nur noch selten.
Der Lehrer sagte: »Henni, du hast so viele Gaben, aber du weißt sie nicht zu schätzen. Es ist eine Schande, wie du deine Talente vergeudest!«
Sekundenlang saß sie mit gesenktem Kopf da. Sie, die als vorlaut galt, die auf alles immer sofort eine Antwort hatte, blieb ganz still. Dann sprang sie auf und lief hinaus. Niemand sollte sie weinen sehen.
Hennis Eltern waren einfache Leute. Ihr Vater, Herbert Schöning, arbeitete als Uhrmachermeister bei Juwelier Franzen in Monschau. Er war ein schmächtiger, gottesfürchtiger Mann, der seine Kinder mit Strenge erzog. Bis Anfang 1943 stufte das Militär ihn als untauglich ein, aber dann wurden seine ruhigen Hände, die es gewohnt waren, Millimeterarbeit zu verrichten, gebraucht. Nach einem sechswöchigen Lehrgang wurde er einem Bombenentschärfungskommando zugeteilt.
Seine Frau Maria blieb mit den vier Kindern Henni, Johanna, Matthias und Fried zurück, und dann kam im Winter 1944 der Krieg mit Macht in die Eifel. Die Ardennenoffensive mit den Schlachten im Hürtgenwald wollte kein Ende nehmen. Dörfer wurden geräumt, gerieten in Stellungskämpfe und wurden völlig zerstört. Es gab Hunderte ziviler Opfer. Nach der Zerstörung der Bahnstation und einiger Wohnhäuser am Südende von Velda wurde die Evakuierung angeordnet, und die Dörfler machten sich mit Handwagen und Ochsenkarren auf den Weg. Maria Schöning und fünf weitere Familien waren geblieben. Gerlinde Kopisch, die mit dem fünfjährigen Wilhelm und der neunjährigen Magdalena einige Häuser weiter wohnte, hatte keinen Keller. Die beiden Frauen verbrachten mit ihren Kindern Tage und Nächte in dem kleinen Vorratskeller des Schöning-Hauses.
Das schlichte Fachwerkhaus lag am Nordende des Dorfes. Es hatte drei Zimmer, eine Wohnküche und ein hölzernes Klohäuschen neben dem Hühnerstall. Garten und Haus waren von einer hohen Buchenhecke umgeben. Tag und Nacht donnerten Kampfflugzeuge über das Dorf hinweg, und das Stakkato der Artillerie hallte über die Hügel und schien von allen Seiten zu kommen. Die beiden Frauen saßen dann mit den Kindern in dem kleinen Vorratskeller zwischen Kartoffelkiste und dem Regal mit Einmachgläsern, und die Gläser zitterten diesen klirrenden Ton über ihre Köpfe hinweg, wann immer das Brodeln des Krieges das Haus erschütterte. Sie pressten ihre Kinder an sich und beteten inständig, dass sie verschont blieben. Nur die elfjährige Henni setzte sich ein Stück abseits und sagte mit tröstlicher Gewissheit in der Stimme: »Mama, uns passiert nichts. Ich weiß das!«
Als die Schlachten endlich geschlagen waren, hatten die ersten stillen Nächte etwas Unheimliches. Die beiden Frauen misstrauten der Ruhe, und in der Sorge, das Donnern und Grollen könnte wieder einsetzen, während sie und die Kinder schliefen, wachten sie noch nächtelang in der Küche. Dann kamen die fremden Soldaten, und nach und nach kehrten auch die Dorfbewohner zurück. Wie durch ein Wunder war das Dorf bis auf die Bahnstation und fünf Häuser verschont geblieben.
Werner Kopisch kehrte als Erster heim. Maria lebte noch einige Wochen in Ungewissheit, aber dann wurde auch Herbert Schöning aus englischer Kriegsgefangenschaft entlassen. »Wir haben Glück im Unglück gehabt«, sagte sie zu ihren Kindern, »vergesst das nie!«
In fast allen Häusern im Dorf herrschte Trauer um gefallene oder vermisste Ehemänner, Brüder oder Söhne, und es war ungewiss, wie es unter der Besatzung weitergehen würde. Aber es war endlich Frieden.
Maria Schöning, sieben Jahre jünger als ihr Mann, war bei einer Tante in Gerolstein aufgewachsen. Mit sechzehn ging sie als Haushaltshilfe bei Juwelier Franzen in Stellung, wo Herbert Schöning in der Werkstatt arbeitete. Maria war siebzehn, als er um ihre Hand anhielt. Es war keine Liebesheirat gewesen, aber sie waren sich zugetan, und über die Jahre war daraus ein vertrauensvolles Miteinander geworden. In den ersten Jahren hatten sie in Monschau in einer Zweizimmerwohnung gewohnt. Dann starb Herberts Vater, der schon seit einigen Jahren Witwer gewesen war, und Herbert erbte das kleine Haus in Velda. Als sie 1935 umzogen, war Henni zwei Jahre alt und Maria mit den Zwillingen Matthias und Johanna schwanger. Der Nachzügler Fried war fünf Jahre später zur Welt gekommen.
In den ersten Tagen nach der Rückkehr ihres Mannes aus der Kriegsgefangenschaft war Maria ganz mit ihrer Freude darüber beschäftigt, ihre Familie wieder vollständig zu wissen. Sie nahm es zunächst nicht wahr, aber bald musste sie sich eingestehen, dass ihr Mann sich verändert hatte.
Erst Wochen später erzählte er ihr, dass es schon wenige Tage nach seiner Gefangennahme begonnen hatte. Er war morgens aufgewacht und hatte am ganzen Körper gezittert, als sei diese unglaubliche Anspannung, mit der er seine Angst monatelang beherrscht hatte, plötzlich aus seinem Körper gewichen. Arme und Beine hatten unkontrolliert vibriert, und er war von Weinkrämpfen geschüttelt worden. Ein Kontrollverlust, der erst Stunden später nach und nach abebbte. Noch Tage danach hatte er auf seiner Pritsche gelegen, weil sein Herz immer wieder den Rhythmus verlor und einfach nicht zur Ruhe kam. Dann war es endlich vorbei gewesen. Nur das Zittern in seinen Händen, das war geblieben.
Herbert Schöning war jetzt ein Uhrmachermeister, der seine Hände nicht ruhig halten konnte. Er versuchte es, kehrte an seinen alten Arbeitsplatz bei Juwelier Franzen in Monschau zurück, stemmte sich mit Macht gegen das Zittern und bandagierte seine Handgelenke, bis sie schmerzten, weil er meinte, die Unruhe ginge von dort aus. Er nähte sich lederne Manschetten, die Gelenke und Handflächen fest umschlossen. Nichts half. Juwelier Franzen zeigte zunächst Verständnis, aber nach einigen Wochen musste er ihn entlassen.
»Herbert, es tut mir leid, und ich sehe ja, wie du dich bemühst. Aber du brauchst eine Stunde für eine Reparatur, die du früher in fünf Minuten erledigt hast. Vielleicht solltest du dich erst einmal richtig erholen.«
»Sind nur die Nerven, Herr Franzen, das geht sicher bald vorbei«, hatte Schöning einzuwenden versucht.
Franzen war an der Tür stehen geblieben. »Wenn es vorbei ist, kannst du gerne wiederkommen.«
Drei Wochen war er zu Hause geblieben. Maria hatte ihm Tee aus Melisse und Johanniskraut gekocht, aber sobald er sich an eine Arbeit machte, die Präzision verlangte, war das Zittern wieder da.
»Ich werde es nicht mehr los«, hatte er zu Maria gesagt. »Wenn ich konzentriert arbeite, ist plötzlich diese Angst da. Diese Angst, dass ich den kleinsten Fehler mit meinem Leben bezahlen werde.« Er hatte sich mit den Knöcheln gegen die Schläfe geschlagen. »Ich weiß, dass das nicht stimmt! Hier oben weiß ich es. Aber meine Hände … meine Hände wissen das nicht.«
Er fand eine Anstellung als Hilfsarbeiter in einer Baufirma, war der schweren körperlichen Arbeit aber nicht gewachsen.
»Schöning, das ist keine Arbeit für Sie. Das halten Sie nicht lange durch«, hatte der Maurer, dem er zuarbeitete, schon am zweiten Tag gesagt. Nach vierzehn Tagen musste er einsehen, dass der Mann recht hatte. Er hatte nicht die Kraft, sich einen Zementsack mit Schwung auf die Schultern zu hieven, wie die anderen es taten.
Kurz danach hatte es dann begonnen.
Die Schönings waren gläubige Katholiken, weshalb die Familie regelmäßig die Sonntagsgottesdienste besuchte, aber jetzt wandte Herbert Schöning sich ganz seinem Glauben zu. Er ging täglich in die Kirche und verbrachte dort Stunden im Gebet. Zu Hause las er in der Bibel, schien seine Frau und die Kinder kaum noch wahrzunehmen und bemühte sich auch nicht um eine neue Arbeit. Oft saß er einfach am Küchentisch und starrte vor sich hin. Henni verstand nicht, was vor sich ging, und Maria musste sie immer wieder ermahnen, geduldig zu sein. »Dein Vater braucht Zeit«, sagte sie, wenn Henni schimpfte und meinte, dass er doch wenigstens bei der Gartenarbeit helfen könne.
Zum Eklat kam es Ende Oktober 1945. Es war bereits bitterkalt. Velda bekam von der Besatzungsverwaltung die Genehmigung, das Totholz aus dem zwei Kilometer entfernten Wald zu holen, damit sie den Winter über heizen konnten. Maria machte sich mit ihren Kindern und der schweren Holzschubkarre auf den Weg. Eine zehn Meter lange Tanne und eine acht Meter hohe, mit Granatsplittern gespickte Fichte, die mitsamt dem Wurzelwerk umgefallen waren, wurden ihnen zugeteilt. Sie mussten die Bäume entasten, den Stamm und die Äste in Stücke teilen und sie dann mit der Schubkarre nach Hause transportieren. Mit einer Bügelsäge und einem Fuchsschwanz sägten sie die Äste ab und brachten sie mühselig auf Maß. Anschließend schoben sie das Holz mit der Schubkarre über Stock und Stein bis zur Straße und dann den weiten Weg nach Hause. Schon am ersten Abend hatten sie aufgeplatzte Blasen an den Händen.
Auch die Kopischs mühten sich mit ihrem Holz ab. Werner Kopisch kam Maria immer wieder zu Hilfe, wenn die stumpfe Bügelsäge sich so im Holz verkantet hatte, dass es weder ein Vor noch ein Zurück gab.
Sie hätten sich wohl noch tagelang so quälen müssen, wäre nicht Bauer Kämper, der sein Holz mit seinen beiden erwachsenen Söhnen schon nach Hause gebracht hatte, am dritten Tag mit seinem Pferdewagen gekommen. Er hatte eine Zweimann-Schrotsäge dabei, schob Maria und die Kinder beiseite und machte sich an die Arbeit. Zusammen mit Kopisch sägte er deren Holz und das der Schönings in lange Stücke.
»Werft es auf den Pferdewagen. Ich schieb das bei mir über die Kreissäge und bring es euch vorbei«, sagte er knapp.
Als sie fertig waren und Maria sich bei Kämper und Kopisch bedankte, fuhr Kämper sich mit seiner schwieligen Hand durchs Gesicht. »Schon gut, Maria, hab ich gerne gemacht. Aber deinem Mann kannst du ausrichten, dass er ein fauler Hund ist und seine Beterei keine warme Stube macht!«
Maria senkte beschämt den Blick, doch für Henni hatte Kämpers Bemerkung etwas Befreiendes. Endlich hatte einer gesagt, was sie seit Wochen dachte.
Zu Hause verlor Maria kein Wort darüber. Am Abendbrottisch holte Herbert Schöning – wie er es inzwischen vor jeder Mahlzeit tat – die Bibel hervor und begann daraus vorzulesen. Die dünne Kartoffelsuppe, die Maria bereits auf die Teller verteilt hatte, drohte endgültig kalt zu werden. Da nahm der kleine Fried seinen Löffel auf und begann zu essen, ohne das erlösende Amen und das Kreuzzeichen abzuwarten. Der Vater sah auf, nahm ihm den Löffel aus der Hand und sagte: »Du gehst auf der Stelle ins Bett.«
Maria versuchte einen schwachen Einwand. »Aber Herbert, das kannst du nicht tun.«
Noch bevor er antworten konnte, nahm Henni ihren Löffel und reichte ihn Fried. Mit unterdrücktem Zorn in der Stimme sagte sie: »Wir essen jetzt! Die Suppe wird kalt, und wir sind hungrig von der Arbeit. Du hast ja nicht gearbeitet.«
Sekundenlang war es totenstill. Henni sah ihren Vater herausfordernd an. Herbert Schöning holte aus und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Hennis Wange brannte. Sie schluckte ihre Tränen, senkte kurz den Kopf, hob ihn dann wieder und stieß trotzig hervor: »Bauer Kämper hat gesagt, wir sollen dir ausrichten, dass man mit Beten keine Stube warm kriegt.«
Herbert Schöning stand auf und verließ ohne ein weiteres Wort das Haus.
Später würde Henni sagen, dass es dieser Abend gewesen sei. Dass sich an diesem Abend alles verändert habe. »Es war nicht der Streit und auch nicht die Ohrfeige. Aber als er Stunden später heimkam und lediglich sagte: ›Ich habe für dich gebetet‹, da wusste ich, dass wir auf ihn nicht mehr zählen konnten.«
Vielleicht hatte auch Maria Schöning es an diesem Abend verstanden, vielleicht auch erst in den Wochen danach, aber im Januar 1946 suchte sie sich Arbeit. Sie fand eine Anstellung als Aushilfe in der Gaststätte »Zum Eifelblick« in Monschau. Mit der Arbeit hielt sie die Familie über Wasser. Der Wirt zeigte sich großzügig. Zusätzlich zu ihrem Wochenlohn durfte sie regelmäßig das übrig gebliebene Essen vom Vortag mitnehmen, was einem zusätzlichen Verdienst gleichkam.
Immer öfter nahm Maria Henni zur Unterstützung mit in die Gaststätte. Sie verließen um sechs Uhr morgens das Haus. Die Zwillinge Johanna und Matthias sorgten dafür, dass sie und Fried pünktlich in die Schule kamen, denn der Vater war bereits in der Frühmesse. Maria hätte ihrer Tochter gern die letzten anderthalb Schuljahre gelassen, aber ohne Henni konnte sie bis zum Mittag die anfallenden Arbeiten in Gaststube und Küche kaum schaffen.
In diesem ersten Nachkriegswinter stapften sie in der Dunkelheit durch den Schnee, hatten nasse Füße und waren völlig durchgefroren, wenn sie Monschau erreichten. Sie heizten den Ofen in der Küche an, spülten das Geschirr und die Töpfe vom Vorabend, putzten Küche und Gaststube, schälten Kartoffeln und Gemüse. Nach getaner Arbeit traten sie den beschwerlichen Weg zurück an.
Herbert Schöning war kaum noch zu Hause. Er übernahm gegen ein kleines Entgelt die Aufgaben eines Küsters, bereitete die Kirche für die Gottesdienste vor, kümmerte sich um die Kerzen und den Blumenschmuck, räumte die Wege im Kirchhof und läutete die Glocken.
Das Familienleben entspannte sich. Der Vater saß jetzt nicht mehr stundenlang am Küchentisch und stierte vor sich hin, und seit der Auseinandersetzung mit Henni las er vor den Mahlzeiten nicht mehr aus der Bibel vor. Wie früher sprachen sie gemeinsam ein kurzes Dankgebet, und Maria und Henni nahmen hin, dass sie dafür verantwortlich waren.
Aber dann kam der April 1947.
Kapitel 3
Lüttich, Frühjahr 1970
Es war einer dieser Tage, die zwischen Winter und Frühjahr liegen und sich nicht entscheiden. Das Licht versprach Frühling, aber die Luft hielt noch an der winterlichen Kälte fest. Thomas Reuter packte die Kohlestifte, Kreiden und seine Staffelei zusammen. Heute hatte er nur zwei Porträts von Marktbesuchern angefertigt, aber die Kohlezeichnung der St.-Bartholomäus-Kirche und das Landschaftsaquarell – ein Tal in der Wallonie – hatten Käufer gefunden. Mit sechshundert belgischen Franc Umsatz war das kein guter Tag. Hier, auf dem sonntäglichen La Batte, zwischen den Marktständen am Quai de Maestricht, war sein Stammplatz. Mit dem Anfertigen von Porträts machte er die besten Umsätze, aber heute hatte er nach dem zweiten Bild das Schild mit der Aufschrift »Porträt in 15 Minuten für 170 BF« abgehängt. Er war unzufrieden. Die beiden Zeichnungen waren nicht gut geworden, weil er unkonzentriert war, mit den Gedanken immerzu bei diesem Anruf vom Vorabend.
»Es wird eine Anhörung geben, Thomas, eine gerichtliche Anhörung. Am neunten April. Wir brauchen dich als Zeugen. Du musst kommen und aussagen«, hatte Fried gesagt.
Drei Sätze. Und alles, was er jahrelang so weit wie möglich von sich ferngehalten hatte, war wieder da gewesen.
Am liebsten hätte er in den Hörer gerufen: »Bitte, Fried, ich will von alldem nichts mehr wissen. Ich ertrage es nicht. Lass mir mein kleines, einfaches Leben. Lass mir meinen mühsam erkämpften Abstand.«
Er lud die Staffelei, die Mappe mit den Bildern und die Schatulle mit den Malutensilien auf den Fahrradanhänger, den er aus Brettern und Rädern von einem Kinderfahrrad zusammengebaut hatte.
Seit neun Jahren wohnte er im Stadtteil Outremeuse in der Rue de la Commune in einem alten Backsteinhaus. Die Maas wurde hier zweiarmig, und Outremeuse war eine Insel mitten in der Stadt. Die kleine Wohnung lag im zweiten Stock. Eine Kammer, in der er schlief, ein schmales Bad und ein Zimmer, aus dem er eine Art Atelier mit Küchenecke gemacht hatte. Die hohen Decken und die beiden großen Fenster, die nach Westen und Süden gingen, sorgten für gleichbleibend gutes Tageslicht. Die Miete konnte er sich auch leisten. Jedenfalls meistens. In den Wintermonaten gingen die Geschäfte nicht so gut, und wenn er knapp bei Kasse war, drückte seine Vermieterin, die im Erdgeschoss wohnte, schon mal ein Auge zu. »Na ja, im Sommer geht es sicher wieder besser«, sagte sie dann, und manchmal nahm sie sogar ein Bild anstelle von Bargeld. Hier war er zur Ruhe gekommen, hatte einen Platz gefunden, an dem er sich sicher fühlte.
Er radelte über die Pont Maghin. Am Abend zuvor war er dabei gewesen, anhand einer alten Skizze eine großformatige Kreidezeichnung der Burg Franchimont anzufertigen. Es war schon spät, und als das Telefon auf der Fensterbank klingelte, durchzuckte ihn das erste Läuten wie ein Stromschlag. Er hatte mit der Kreide in der Hand unbeweglich vor der Staffelei gestanden und gewartet. Er bekam selten Anrufe und um diese Zeit eigentlich nie. Sechs Mal ließ er es klingeln, darauf hoffend, dass es gleich aufhören würde. Dann nahm den Hörer ab, und Fried sagte ohne Einleitung: »Henni hat es geschafft. Es wird wegen Matthias eine Anhörung im Amtsgericht Aachen geben. Du musst kommen und aussagen.«
Er brachte kein Wort heraus, und Fried hatte längst aufgelegt, als er immer noch mit dem Hörer in der Hand am Fenster stand.
Unfähig, sich zu bewegen, lauschte er dem gleichmäßig sich wiederholenden Ton des Telefons, der anzeigte, dass am anderen Ende niemand mehr war, und in seinem Kopf tat sich wieder dieses Loch auf, das er so gut kannte. Dieses Loch, in das jeder Gedanke hineinfiel, lange bevor er ihn zu fassen bekam.
Er legte den Hörer auf die Gabel und ging im Zimmer mehrere Male auf und ab. Dann hielt er es nicht mehr aus, nahm seinen Parka und rannte den Hausflur hinunter, immer drei Stufen auf einmal nehmend. Er musste raus, musste durch die nachtstille Stadt laufen und spüren, dass er frei war. Dass er gehen konnte, wohin er wollte. Aber die alten Bilder blieben nicht zurück, verfolgten ihn durch die Straßen. Kinderbilder, von denen er gemeint hatte, dass er sie längst aus seinem Gedächtnis gelöscht hatte.
Die Stadt schlief. Die Häuser standen lückenlos aneinandergereiht, trugen die Wärme des Tages noch in sich und schützten ihn auf seinem nächtlichen Streifzug durch das Viertel. Er kannte sich aus in den schmalen Straßen und Gassen, wusste schon von Weitem, dass es die kleine Schneiderei war, in der jetzt noch Licht brannte, und dass das einzige Auto, das ihm um diese Zeit entgegenkam, der Lieferwagen des Gemüsehändlers aus der Rue de la Commune war. Wie immer hatte auch Jean-Paul sein Café in der Rue de la Loi noch geöffnet, obwohl er schon seit Stunden keine Gäste mehr hatte. In manchen Nächten ging Thomas hinein und spielte mit dem Alten, der nie zu schlafen schien, eine Partie Backgammon. Heute nicht. Heute hob er die Hand zu einem kurzen Gruß und ging mit großen Schritten vorbei. Er musste in Bewegung bleiben. Er lief den Bildern davon und brachte doch keinen Meter zwischen sich und die Vergangenheit.
Mit vier Jahren war er in das katholische Kinderheim gekommen. Die ersten Jahre dort waren wie ausgelöscht, aber in dieser Zeit hatten sie ihm beigebracht, dass er das Allerletzte war. Ein dummer Nichtsnutz, den seine Mutter weggegeben hatte, weil sie ihn nicht ertragen konnte. Eine Mutter, die eine Sünderin gewesen war, denn es gab keinen Vater. Selbst so eine hatte nichts von ihm wissen wollen.
Gleich zu Schulbeginn zeigte sich, dass stimmte, was sie behauptet hatten: Er war dumm. Die ersten Schuljahre waren eine einzige Katastrophe. Nicht dass er im Unterricht nicht mitgekommen wäre. Er konnte im Rechnen folgen, konnte schreiben und lesen, aber wenn er an die Tafel musste oder eine Arbeit geschrieben wurde, war seine Angst, einen Fehler zu machen, so groß, dass er kein Wort heraus- und keines zu Papier brachte. Nach dem dritten Jahr waren sich die Schwestern und die Lehrer einig, dass für ihn nur die Sonderschule in Betracht kam.
Er schlug sich mit dem Handballen gegen die Stirn. Er musste diese Bilder loswerden, durfte diesen Stimmen, die in ihm aufstiegen, keinen Platz geben.
»Du bist dumm, Thomas. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man weiß, wo du herkommst. Trotzdem geben wir uns Mühe, auch aus einem wie dir einen halbwegs anständigen Menschen zu machen. Das ist nicht leicht für uns, das kannst du mir glauben.«
Genau das hatte Schwester Angelika immer wieder gesagt. Und er hatte es geglaubt.
Nach dem Unterricht verbrachte er jeden Nachmittag – manchmal alleine, manchmal mit wechselnden anderen Kindern – im Speisesaal. Immer saß eine der Schwestern mit einem Stickrahmen am Kopfende des Tisches und stach mit feiner Nadel in das Leinen, während er zu lernen versuchte. Hunderte von Nachmittagen. Die Zeit waberte durch den Saal und wollte nicht vergehen. Die Stille ängstigte ihn. Nein, nicht die Stille. Die Geräusche! Das Knarzen seines Stuhls. Ein Räuspern. Das Umblättern einer Buchseite. Alles hallte wider, echote durch den Saal und zog die Stunden ins Endlose. Er ersehnte und fürchtete den Ton der Handglocke, die die Schwester läutete, um das Ende der Lernzeit zu verkünden. Er fürchtete ihn, weil er anschließend zu Schwester Angelika ins Büro musste. Nach ihrem »Herein« ließ sie ihn minutenlang vor ihrem Schreibtisch stehen, während sie Schriftliches erledigte. Unter dem schwarzen Schleier trug sie das weiße, gestärkte Kopfgebinde, das Stirn, Wangen und Kinn fest umschloss und in einem großen Kragen über Schultern und Brust auf dem schwarzen Kleid auslief. Eine große, dürre Frau mit eingeschnürtem, unbeweglichem Gesicht. Wenn sie endlich aufsah, lag in ihrem Blick diese Verachtung, die ihn schrumpfen ließ. Sein Mund wurde trocken, und sobald sie anfing, ihn abzufragen, tat sich dieses Loch in seinem Kopf auf, durch das alles, was er sich hatte merken wollen, wieder herausfiel. »Antworte!«, verlangte sie immer wieder, aber da war selbst ihre Frage schon durch das Loch gefallen. Manchmal schüttelte sie nur enttäuscht den Kopf und schickte ihn fort, an anderen Tagen jedoch schlug sie ihn mit dem hölzernen Lineal auf Rücken und Po und rief dabei immer wieder: »Denk nach! Denk nach!« Wenn sie endlich aufhörte und er weinend dastand, sagte sie fast sanft: »Ich habe das nicht gerne getan, Thomas, das kannst du mir glauben. Aber ich kann nicht hinnehmen, dass du dir nicht die geringste Mühe gibst. Verstehst du das?«
Dann wischte er sich mit dem Handrücken die Augen und flüsterte: »Ja, Schwester Angelika, das verstehe ich.«