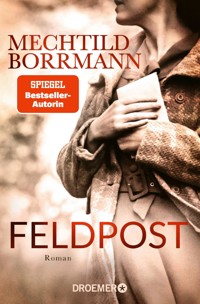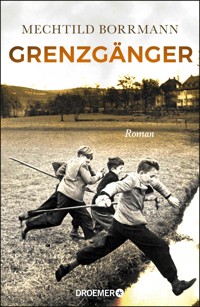9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hamburg 1946/47 - Steineklopfen, Altmetallsuchen, Schwarzhandel. Der 14jährige Hanno Dietz kämpft mit seiner Familie im zerstörten Hamburg der Nachkriegsjahre ums Überleben. Viele Monate ist es bitterkalt, Deutschland erlebt den Jahrhundertwinter 1946/47. Eines Tages entdeckt Hanno in den Trümmern eine nackte Tote - und etwas abseits einen etwa dreijährigen Jungen. Der Kleine wächst bei den Dietzens in Hamburg auf. Monatelang spricht der Junge kein Wort. Und auch Hanno erzählt niemandem von seiner grauenhaften Entdeckung. Doch das Bild der toten Frau inmitten der Trümmer verfolgt ihn in seinen Träumen. Erst viele Jahre später wird das einstige Trümmerkind durch Zufall einem Verbrechen auf die Spur kommen, das auf fatale Weise mit der Geschichte seiner Familie verknüpft ist … In ihrem neuen Roman "Trümmerkind" beschreibt die mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnete Bestseller-Autorin Mechtild Borrmann das Leben eines Findelkinds in der Nachkriegszeit und im vom Krieg zerstörten Hamburg von 1946 / 1947. Spannung und historisches Zeitgeschehen miteinander zu verknüpfen, versteht Borrmann, die auch für den renommierten Friedrich-Glauser-Preis nominiert war, wie keine andere deutsche Autorin. Dies stellt sie mit ihren Bestsellern "Wer das Schweigen bricht", "Der Geiger", "Die andere Hälfte der Hoffnung" und ihrem neuen Roman "Trümmerkind" , mit dem sie monatelang unter den Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste stand, eindrucksvoll unter Beweis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Mechtild Borrmann
Trümmerkind
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Hamburg im Winter 1946/47: Die Bombenangriffe auf Hamburg im Jahr 1943 überlebten der vierzehnjährige Hanno Dietz mit seiner Mutter und der kleinen Schwester nur knapp. Sie flohen und kehrten erst im August 1945 wieder ins völlig zerstörte Hamburg zurück. Steineklopfen, in Trümmern nach Altmetall suchen und der Schwarzmarkt lassen die Familie überleben. In einem der Trümmerkeller entdeckt Hanno eine tote Frau. Zurück auf der Straße sammelt er einen kleinen herumirrenden Jungen auf, der erstaunlich gut gekleidet ist. Das Kind spricht kein Wort. Auf ihre Vermisstenanzeigen meldet sich niemand. Und so wächst der Junge, den sie Joost nennen, bei den Dietz auf.Jahre später kommt Joost durch Zufall einem grauenhaften Verbrechen (den Trümmermorden) auf die Spur, das auf fatale Weise mit seiner Familiengeschichte verknüpft ist.
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Danksagung
Kapitel 1
Hamburg, Januar 1947
Erstes wässrig violettes Licht zeigte sich am Horizont, schob sich über Schuttberge, fiel in Bombenkrater und zeichnete die Konturen der Trümmerlandschaft nach. Er kam jetzt schneller voran, konnte sehen, wohin er seine Füße auf dem unebenen Gelände setzen musste. Die Kälte biss ihm in Gesicht und Lunge, drang durch die Jacke, die seine Mutter aus einer alten Armeedecke genäht hatte, und zog von unten durch die dünnen Schuhsohlen und die löchrigen Strümpfe. Dampfend stieg sein Atem auf, während er sich jetzt sicher und mit geübtem Blick über die Trümmer von Hammerbrook bewegte. In dem Strick, der die zu weite Hose auf den Hüftknochen hielt, steckte der Hammer, mit dem er Rohre, Schellen und Scharniere von Wänden und Mauerbrocken löste. Seine Schwester Wiebke blieb auf der geräumten Straße immer auf seiner Höhe und zog den Handwagen.
Für ihn war der Handwagen der wertvollste Familienbesitz. Damit hatte er schon so manchen Schatz, den er in den Trümmern geborgen hatte, abtransportiert. Er suchte nach allem, was auf dem Schwarzmarkt Geld brachte, aber heute brauchte er dringend Brennholz. Im letzten Winter hatte es in den Ruinen noch Balken, Türen und Fensterrahmen gegeben, und damit hatten sie die kalten Tage überstanden, aber in diesem Jahr war kaum noch was zu finden. Bis in den Dezember waren Kohlezüge gefahren, und er hatte sich mit einigen anderen Jungen auf die offenen Loren gewagt. Draußen, wo die Gleise einen Bogen machten, wurden die Züge langsamer. Dann musste es schnell und Hand in Hand gehen. Über die Kuppeln auf die Loren. Das Rauf und Runter war gefährlich, aber wenn man Angst hatte, unter den Zug zu geraten, war man verloren.
»Wenn du drüber nachdenkst, ist es schon passiert«, hatte Peter gewarnt, und wenn die Mutter zu Hause Fragen stellte, behauptete Hanno, nur einer von den Sammlern zu sein, die neben den Gleisen herliefen.
Jetzt waren die Gleise vereist, die Züge fuhren nur noch selten, und die Tommys hatten die Bewachung verdoppelt. An Kohlen war kaum ranzukommen.
Das kleine Zimmer, das er zusammen mit seiner Mutter und der Schwester in ihrem ausgebombten Haus in der Ritterstraße bewohnte, kühlte schnell aus. Wenn sie an einem Tag nicht wenigstens abends ein bis zwei Stunden heizen konnten, war es in der Nacht im Zimmer genauso kalt wie draußen. Vor drei Tagen erst war die alte Frau Schöning, der er immer von den Kohlen abgegeben hatte, in ihrer Notunterkunft erfroren.
Die Lebensmittel, die ihnen auf Karte zugeteilt waren, reichten nicht, um satt zu werden. Die Mutter ging Steine klopfen, aber dass sie alle drei ab und an halbwegs satt wurden, dafür sorgte er mit seinen Fundstücken, die er auf dem Schwarzmarkt eintauschte. Vor zwei Tagen hatte er ein Etui mit einem hochwertigen Füller und einem Tintenfässchen gefunden. Zehn englische Zigaretten hatte ein Tommy ihm dafür gegeben, und die hatten ihm zwei Kilo Kartoffeln und eine Rübe eingebracht.
Er blickte zurück zur Straße. Wiebke ging jetzt neben dem Handwagen auf und ab und schlug mit den verschränkten Armen rhythmisch an ihren Oberkörper.
Als Hamburg im Sommer 1943 in Flammen gestanden hatte und sie aus dem Bunker herausgekrochen waren, in dem sie beinahe erstickt waren, waren ihnen nur die Kleider am Leib geblieben. Stunden zuvor war das Haus über dem Bunker getroffen worden. Der Putz war von den Bunkerwänden gefallen, der Mörtelstaub brannte in Augen und Lunge und machte aus allen vierundzwanzig Frauen, Kindern und Alten, mit denen sie dort ausgeharrt hatten, graue Zementfiguren. Zementgesichter, die schrien, beteten oder weinten. Es dauerte Stunden, den Eingang von innen freizuräumen, und es war schon Tag, als sie endlich, einer nach dem anderen, durch dieses Loch herauskriechen konnten. Draußen hatte er seinen Augen nicht getraut. Überall Feuer, kein Haus weit und breit, keine Straße erkennbar, nur Flammen und Mauergerippe, die in einen schwarzen Himmel ragten. Die Sonne war hinter den aufsteigenden Rußwolken nur zu erahnen. Ein lichtloser Tag, feuerheiß. Und zwischen den Trümmern all die Toten. Verkohlte Körper. Von der Hitze geschrumpft und unkenntlich gemacht.
Wie lange sie dort gestanden hatten, wo einst eine Straße gewesen war, ohne zu begreifen, was sie sahen, wusste er nicht mehr. Aber dass die Kröger umherlief und das Vaterunser schreiend betete, der alte Vogler unaufhörlich von der Strafe Gottes faselte und Frau Weiser am Eingang des Bunkers mit ihrer toten zweijährigen Tochter im Arm sitzen blieb, den Oberkörper hin- und herwiegte und in einer Art Singsang immer wieder sagte: »Sie schläft … es geht ihr gut … sie schläft …«, daran erinnerte er sich genau. Und dass in ihm nichts war. Kein Gefühl, kein Gedanke. Nur dieses staunende Nichtbegreifen, das ihn lähmte.
Irgendwann packte die Mutter ihn am Arm und schüttelte ihn, wie sie es tat, wenn sie böse auf ihn war. »Hanno! Hanno, hör mir zu«, schrie sie ihn an. Er hörte sie wie aus weiter Ferne, und erst als sie ihn ohrfeigte, kam er zu sich. Die Starre in seinen Gliedern löste sich, und nachdem er einige Schritte getan hatte, spürte er unerträglichen Durst und konnte wieder denken. Und sein erster Gedanke war: »Warum hat der Führer das zugelassen?«
Die Mutter nahm seinen Arm mit festem Griff.
»Wir müssen hier weg, hörst du. Wir gehen zu Onkel Wilhelm nach Pinneberg.« Sie weinte. Die Tränen malten Linien in ihr Zementgesicht, wie Risse in Beton.
Irgendjemand brachte Wasser. Er hatte getrunken, als könne er nicht nur den Durst, sondern auch die letzten Stunden auslöschen.
Wiebke mussten sie das Wasser einflößen. Sie stand nur da, gab keinen Ton von sich und reagierte auf nichts. Sie war sechs, tat keinen Schritt, und als sie sich auf den Weg machten, musste die Mutter sie tragen.
An ihrem Haus machten sie noch einmal kurz halt. Das Dach und das obere Stockwerk gab es nicht mehr. Und da sah er ihn. Wie ausgestellt stand der Handwagen auf einem Türsturz in den Trümmern. Hanno war über die noch heißen Schuttberge gestiegen und hatte ihn geholt. Auf dem Weg nach Pinneberg zog er Wiebke darin hinter sich her. Hunderte verließen, wie sie, die Stadt. Ein stiller, nicht enden wollender Zug, in dem man hin und wieder ein Kind weinen hörte, aber niemand zu sprechen schien.
Nach Mitternacht waren sie in Pinneberg angekommen. Onkel Wilhelm bewohnte mit Tante Margret ein geräumiges Haus mit Garten am Stadtrand. Er machte vom ersten Tag an deutlich, dass sie nicht willkommen waren, sagte, dass er auch nicht auf Rosen gebettet sei, und wenn er zu Hause war, gingen sie alle auf Zehenspitzen. Die Tante war freundlich. Sie widersprach ihrem Mann zwar nicht, aber in der Küche sagte sie tröstend: »Er meint es nicht so. Ihr dürft euch das nicht zu Herzen nehmen.«
Seine Mutter fand eine Anstellung in einer Fabrik und trug mit ihrem Verdienst zum Lebensunterhalt bei, was den Onkel etwas gnädiger stimmte. Aber als der Krieg verloren war, wurde er in seiner Verbitterung darüber unerträglich. Dass Hitler Selbstmord begangen hatte, hielt er für eine Lüge. Außerdem ließ er keine Gelegenheit aus, sich über Wiebke lustig zu machen. Seit der Nacht in dem Bunker stotterte sie und nässte nachts ein. Dass sie erst denken und dann reden solle, schimpfte er. Dass das ganze Haus nach Pisse stinke und ihr Gestammel unerträglich sei. Die Mutter legte sich dann mit ihm an, und sie verließen regelmäßig hungrig den Esstisch. Sie wollten so schnell wie möglich nach Hause, aber es hieß, Hamburg sei gesperrt.
Im August 1945 kam die Nachricht, dass die Sperrung für Hamburger aufgehoben sei. Am nächsten Tag war Onkel Wilhelm außer Haus, und Tante Margret belud den Handwagen mit Decken, eingemachtem Gemüse, einem Sack Kartoffeln, Zwiebeln, zwei Töpfen, etwas Geschirr und Besteck. Sie wollten schon los, als die Tante die Nähmaschine aus dem Haus schob. »Wenn wir sie vorsichtig obendrauf legen und die Kinder sie festhalten, passt die noch. Ich kann da sowieso nicht mit umgehen.« Die Mutter wollte sie erst nicht annehmen. »Wenn der Wilhelm das bemerkt«, wandte sie ein, aber die Tante schüttelte den Kopf. »Das lass mal meine Sorge sein. Du kannst sie bedienen und wirst sie gut gebrauchen können.«
Obwohl Hamburg völlig zerstört war und sie drei Tage und Nächte ohne Dach über dem Kopf am Straßenrand kampierten, waren sie guter Dinge gewesen. Sie hatten sogar wieder miteinander gescherzt und gelacht. Zuerst räumten sie den Kellereingang unter ihrem Haus frei. Dort wollten sie fürs Erste wohnen, aber Wiebke war nicht zu bewegen, den Keller zu betreten. Sie weinte, und auch die Versicherung der Mutter, dass keine Bomben fallen und sie nicht verschüttet würden, half nicht.
Also hatten sie die Schuttberge darüber weggeräumt und im Parterre ein halbwegs bewohnbares Zimmer freigelegt. Hanno besorgte in den Ruinen eine Tür, und den leeren Fensterrahmen füllten sie mit Pappe. Während die Mutter mit Wiebke zum Steineklopfen ging, trieb er sich von nun an in den Trümmern herum, immer auf der Suche nach Brauchbarem. Anfang September grub er einen Ofen aus den Schuttbergen aus, und dabei lernte er Peter Kampe kennen. Der war siebzehn, schlug sich seit dem Feuersturm alleine durch und half ihm, den schweren Ofen auf den Handkarren zu laden. Peter war sehr an dem Handwagen interessiert gewesen, den Hanno inzwischen mit Streben und schweren Bohlen vergrößert und stabilisiert hatte. Er bot eine ganze Stange Zigaretten dafür, aber Hanno blieb stur. Dann schlug Peter vor, sich zusammenzutun, und von dem Tag an arbeiteten sie Hand in Hand.
Es war verboten, sich in bestimmten Trümmergegenden aufzuhalten, überall standen Verbotsschilder, und die Tommys fuhren mit ihren Jeeps die Sperrgebiete ab. Aber Peter kannte Verstecke und Schleichwege und hatte beste Kontakte zum Schwarzmarkt. Von ihm lernte Hanno, wie man sich dort bewegte und richtig verhandelte und mit welchen Händlern man besser keine Geschäfte machte. Morgens zogen sie los, gruben nach allem, was von Wert war. Am späten Nachmittag gingen sie mit ihrer Beute zum Neumarkt, tauschten Bestecke, Töpfe, Wasserhähne, Waschbecken, Tisch- und Bettwäsche gegen Zigaretten oder Reichsmark und brachten Blei, Metalle und Kabel in den Hinterhof von Alfred Körner, der es korrekt wog, aber nur in Reichsmark bezahlte.
Über ein Jahr hatten sie so zusammengearbeitet, bis zum vergangenen Oktober. Da war Peter bei einer Razzia auf dem Neumarkt geschnappt worden. Weil es nicht das erste Mal war, hatte er einen Monat Arrest bekommen. Anfang November hätte er zurück sein müssen. Aber er kam nicht. Peter hatte schon vor seiner Verhaftung davon gesprochen, dass er sich verändern wollte. »Weg aus Hamburg«, hatte er gesagt, »in den Trümmern ist nichts mehr zu holen. Am besten weg aus Deutschland. Nach Amerika.« Vielleicht hatte Peter es wahr gemacht. Zuzutrauen war es ihm. Nur dass er sich nicht verabschiedet hatte, das nahm Hanno ihm übel.
Noch ganz mit diesen Gedanken beschäftigt, kämpfte er sich durch die Januarkälte und blickte immer wieder zur Straße, auf der Wiebke mit dem Handwagen war. Dann sah er ihn. Zwischen den Trümmerbergen zeigte sich ein Kellereingang. Halb verschüttet, aber zugänglich. »Na also«, flüsterte er zufrieden. Vorsichtig stieg er die Stufen hinunter, auf jeden Schritt bedacht. Die Angeln einer Tür hingen noch im Mauerwerk, und er machte sich gleich an die Arbeit, schlug sie mit präzisen Schlägen heraus, ohne sie zu beschädigen. Dabei lauschte er nach jedem Schlag, ob die Erschütterung das Geröll über ihm in Bewegung brachte. Alles blieb still. Zusammen mit den Fensterbeschlägen, die er am Tag zuvor gefunden hatte, konnte er auf dem Schwarzmarkt am Hansaplatz vielleicht fünf bis acht Amis bekommen und für die Zigaretten ein Brot eintauschen. Aber daran sollte er nicht denken. Nicht ans Essen, denn das lenkte seine Aufmerksamkeit auf den Hunger, der in seinem Magen schmerzte.
Spärliches Licht fiel vom Eingang in den Keller, und er ging vorsichtig tiefer hinein.
Ein kleines Holzregal an der linken Wand. Brennholz! Die beiden Seitenwände waren über eineinhalb Meter lang, dazwischen vier Regalböden. Vorsichtig schlug er die Holzbohlen auseinander, achtete darauf, dass die langen Nägel keinen Schaden nahmen. Die Bretter stellte er an die Wand, die Nägel steckte er in die Jackentasche.
Inzwischen hatten sich seine Augen an das spärliche Licht gewöhnt. Er trat in den hinteren Teil des Raumes. Da lag etwas Großes. Es schimmerte weißlich. Was war das? Zwei, drei Schritte vor, dann blieb er abrupt stehen. Er stand lange da und starrte den nackten Körper an. An Marmor dachte er, an leuchtend weißen Marmor mit graublauen Linien, und daran, dass sie eine schöne Frau gewesen war.
Wie betäubt ging er rückwärts in Richtung Eingang. Seine Augen mussten sich an das Tageslicht gewöhnen. Neben ihm blinkte etwas. Er bückte sich, steckte den kleinen Gegenstand ganz automatisch in die Jackentasche. Er stolperte hinaus, wollte nur fort, hinunter zur Straße. Dann fiel ihm das Holz wieder ein. Er wankte zurück. Wie ein Taucher nahm er am Kellereingang einen tiefen Atemzug, ließ sich noch einmal in das Halbdunkel hinab, schulterte die Bretter und trug sie hinaus. Draußen beruhigte er sich langsam. Er hatte schon viele Tote gesehen. Ein Toter erschreckte ihn nicht, aber diese Frau war anders. Anders tot.
Über den Trümmern, so schien es ihm, während er die Bretter zur Straße trug, lag jetzt eine unnatürliche Helligkeit und Stille. Ein erschrecktes Innehalten. Kein Vogelruf, keine vom kalten Wind getragenen fernen Geräusche. Nur seine stolpernden Schritte und das Klappern der Nägel und Türangeln in seiner Jackentasche.
Wiebke stand auf der Anckelmannstraße, die Arme um ihren dürren Oberkörper geschlungen, trat sie frierend von einem Bein auf das andere und wich seinem Blick aus.
Erst als er die Bretter auf den Handwagen legte, sah er ihn. Der Junge stand hinter Wiebke und war vielleicht drei oder vier Jahre alt. Er trug eine lange Hose, festes Schuhwerk, einen grünen Mantel aus dicker, gefilzter Wolle und eine graue Strickmütze. Gute, warme Kleidung, aber Hanno sah, dass er steif war vor Kälte.
Wiebke sah verlegen zu Boden und stotterte: »Ich hab ihn gefunden. Hanno, er ist ganz allein.« Hanno brauchte einen Moment, bis er verstand, was sie damit sagen wollte. Er schüttelte den Kopf. »Nein, Wiebke. Sieh ihn dir doch an. So sieht keiner aus, der alleine ist. Da wird schon jemand kommen und ihn abholen. Wir gehen.«
Wiebke rührte sich nicht von der Stelle. »Bitte, Hanno. Wir können ihn doch nicht hierlassen«, quengelte sie, »hier ist doch niemand.« Er wollte nur fort, wollte sich nicht mit der Schwester streiten, und vor allem wollte er nicht ausgerechnet jetzt und hier von den Tommys erwischt werden.
Außerdem musste er das Holz nach Hause schaffen. Die Mutter brauchte es dringend. Er ging mit der Handkarre los. Der Kleine lief an Wiebkes Hand, konnte aber kaum Schritt halten. Schon nach kurzer Zeit blieb Wiebke mit dem Kind zurück. Hanno musste warten, und sie kamen nur langsam voran.
»Da siehst du es. Der hält uns nur auf«, schimpfte Hanno, und weil Wiebke wieder mal den Tränen nah war, nahm er den Jungen kurzerhand auf den Arm und überließ seiner Schwester den Handwagen. Das kleine Gesicht war rot gefroren und unbeweglich, und Hanno merkte sofort, warum der Junge kaum laufen konnte. Er hatte eingenässt, und die Hose war steif gefroren. Hanno öffnete seinen zu weiten Mantel und steckte das Kind mit unter den Stoff. Er fragte ihn nach seinem Namen. »Na komm, du wirst doch wissen, wie du heißt? Wo sind denn deine Eltern?« Der Kleine blieb stumm, sein Blick starr. Und während er ihn durch die Kälte trug, meinte Hanno, dass von dem Jungen die gleiche erschreckte Stille ausging, die er auf dem Weg über das Trümmerfeld wahrgenommen hatte.
Kapitel 2
Köln, August 1992
Die letzten Gäste sind gegangen. Thomas und ihre Kollegin Irene haben noch geholfen, die gröbsten Spuren des Festes zu beseitigen, und sich dann auch verabschiedet. Eine gelungene Feier. Dabei hatte es zunächst nicht danach ausgesehen. Die Hitze des Tages lag wie eine feuchtwarme Decke auf Garten und Terrasse, und es wollte keine rechte Stimmung aufkommen, aber als gegen neun Uhr ein Gewitter niederging, hatte sich das schlagartig geändert. Auf der Terrasse, wurde bis nach Mitternacht getanzt und getrunken, und sie war in Sorge gewesen, dass die Nachbarn sich beschweren könnten.
Anna stellt die Spülmaschine an und verstaut die verpackten Reste des Buffets im Kühlschrank. Die Uhr am Herd zeigt halb drei. Mit einem letzten Glas Rotwein geht sie um den offenen Küchenblock herum und setzt sich an den neuen ovalen Esstisch. Die dünne, über drei Meter lange Kirschholzplatte ruht auf zwei gläsernen Säulen und beherrscht schwebend den Raum. Diese Leichtigkeit hatte ihr gefallen.
Sie streicht mit der Hand in einem weiten Bogen über das polierte Holz. Der Tisch war teuer gewesen, eigentlich zu teuer. Vor drei Tagen, rechtzeitig zur Feier ihres vierzigsten Geburtstags, hatten sie ihn geliefert. Vierzig! Die Zahl war ihr wie eine Hürde vorgekommen. Und dahinter – das hatte sie sich fest vorgenommen – sollte sich einiges ändern. Warum sie sich darauf versteift hatte, dass es als Erstes ein neuer Esstisch sein musste und der alte, den sie von ihrer Mutter übernommen hatte, wegmusste, konnte sie nicht genau erklären. Aber das alte Möbelstück, an dem sie schon als Kind gesessen hatte, war mit all seinen Kerben, Brandmalen und Flecken wie ein Symbol gewesen. Ein Symbol für alles Schwere. Ein Klotz am Bein. Die über Jahrzehnte angesammelten Schäden hatten sich tief ins Holz gegraben, hielten jeder Überarbeitung stand. Anna hatte auf dieser Tischplatte lesen können wie in einem Buch. Das Abrutschen eines Messers, die zerdrückten Blaubeeren, die Rotweinränder, wenn die Mutter sich betrunken und mit ungeschickter Hand nachgeschenkt hatte, die Flecken von achtlos hingestellten, zu heißen Töpfen und die schwarzbraunen Narben der vergessenen Zigaretten. Und es war der Tisch, an dem sie die mütterlichen Regeln gelernt hatte. Ohne Fleiß kein Preis. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das Leben ist kein Spielplatz.
Als Jugendliche, wenn sie nach Meinung der Mutter Geld für Unnützes ausgegeben hatte, war sie ihr zuvorgekommen, hatte sich die Ohren zugehalten und gerufen: »Ja ja, ich weiß. Spare in der Zeit …«
Wie sehr sie inzwischen selbst nach diesen Regeln lebte, hatte sie erst in den letzten Monaten erkannt.
Als Lehrerin hatte sie ein gutes und gesichertes Einkommen, ging überaus sparsam mit Geld um und investierte einen großen Teil in ihre Zukunftssicherung. Wenn aber etwas Unvorhergesehenes passierte, stieg diese Angst in ihr auf, die sich in letzter Zeit immer wieder bis zur Panik steigerte. Ein großer grauer Hund, der sie unvermittelt ansprang. Dann rang sie nach Atem und meinte, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Eine grundlose, existenzielle Angst, die sie sich nicht erklären konnte, von der sie manchmal dachte, dass es nicht ihre war.
Sie tunkt den Finger in den Wein, fährt über den dünnen Glasrand und lauscht dem sphärischen Klang. Dass Thomas gekommen war, hatte sie gefreut. Ihre Ehe war vor fünf Jahren geschieden worden. Sie waren nicht im Bösen auseinandergegangen, aber der Kontakt war abgebrochen, und erst in den letzten Monaten trafen sie sich wieder regelmäßig. Ihre Ehe war an ihrer Kinderlosigkeit gescheitert. Als feststand, dass sie keine Kinder haben würden, hatten sie sich beide in die Arbeit gestürzt und nur noch nebeneinanderher gelebt. Sie widmete sich ganz ihren kleinen Schülern, und Thomas machte als Partner in einer angesehenen Kanzlei Karriere. Die letzten Jahre ihrer Ehe nannten sie beide »Zettelehe«. Sie sahen sich kaum, und morgens wie abends lagen diese Nachrichten auf dem Tisch, die immer mit »Kuss« geendet hatten. Geküsst hatten sie sich da schon lange nicht mehr.
Sie sollte ins Bett gehen, aber Thomas hat beim Aufräumen vom Gut Anquist gesprochen, und seither hat ihre Müdigkeit einer diffusen Unruhe Platz gemacht.
»Ich habe einen Klienten, der auf Rückgabe seines Eigentums in Sachsen klagt. Was ist denn mit dem Gutshof deines Großvaters in der Uckermark? Will deine Mutter da keine Ansprüche stellen?«
Sie hatte gelacht und den Kopf geschüttelt. »Bestimmt nicht. Du weißt doch, dass für meine Mutter schon die Erwähnung des Namens ein Tabubruch ist.«
Thomas sprach von offenen Vermögensfragen, und wie es seine Art war, führte er alle Argumente für und gegen eine Rückforderung ins Feld. Sein Resümee lautete: »Wenn deine Mutter es nicht zurückhaben will, könnte sie wahrscheinlich eine Entschädigung bekommen. Sie hat doch nur diese kleine Rente.«
Anna nimmt einen Schluck Wein.
Vor vier Jahren hat die Mutter die Kneipe in der Niehler Straße in Nippes verkauft und den Erlös in eine Wohnung in Ehrenfeld investiert. Als selbständige Wirtin muss sie mit einer kleinen Rente klarkommen, die Anna monatlich aufstockt. Wie hoch auch immer so eine Entschädigung ausfallen könnte, es wäre doch unvernünftig, sich nicht darum zu bemühen.
Anna geht um den Küchenblock herum und spült das Weinglas aus. Thomas hat angeboten, sich zu informieren. »Ich bin sowieso mit dem Thema beschäftigt. Wenn du willst, erkundige ich mich mal, was aus dem Gut geworden ist. Ganz unverbindlich.« Sie war unsicher gewesen, stimmte dann aber zu. Schaden konnte es nicht, und mit ihrer Mutter müsste sie ja erst sprechen, wenn sich etwas Konkretes ergab.
Dieses Gespräch mit Thomas hatte ganz beiläufig, zwischen klapperndem Geschirr beim Aufräumen stattgefunden. Erst seit Thomas und Irene gegangen sind, spürt sie dieses Unbehagen. Vielleicht war es voreilig gewesen. Die Mutter sprach nie über ihre Zeit in der Uckermark, und Anna kannte nur einige wenige Eckdaten.
Dass sie auf Gut Anquist von Forstwirtschaft und Pferdezucht gelebt hatten und nach dem Krieg alle Großgrundbesitzer in der sowjetischen Besatzungszone enteignet wurden. Der Großvater war 1946 mit der Mutter in die englische Besatzungszone geflohen und später mit einem Schiff nach Südafrika emigriert.
Mehr hatte die Mutter darüber nicht erzählt, nur über die Zeit in Johannisburg sprach sie manchmal. Der Großvater kam mit dem Land, den Leuten und dem Klima nicht zurecht. Er kränkelte, kaum dass sie angekommen waren.
Die Mutter arbeitete in einer Importfirma als Schreibkraft, wo sie Norbert Meerbaum kennenlernte. Er war Handelsvertreter und ebenfalls nach dem Krieg aus Deutschland gekommen. Eines Tages stand er mit einem Blumenstrauß vor ihrem Schreibtisch und lud sie ein, ihn auf ein Fest zu begleiten. Von diesem Abend erzählte sie gerne. »Es war das Erntefest der Plantagenbesitzer, und es wurde im Ballsaal eines vornehmen Hotels gefeiert«, schwärmte sie. »Er war ein stattlicher Mann und großartiger Tänzer. Wir waren DAS Paar des Abends, die anderen Gäste drehten sich nach uns um.« Ein Jahr später machte er ihr auf der Terrasse dieses Hotels einen Heiratsantrag.
Die ersten Jahre mit Norbert Meerbaum waren wohl eine glückliche Zeit gewesen, davon zeugten diverse Fotos und auch die Stimme der Mutter, wenn sie davon sprach. 1952 war sie – Anna – geboren worden und kurz darauf der Großvater gestorben. Als ihrem Vater eine gutbezahlte Anstellung als Pharmavertreter in Deutschland angeboten wurde, waren sie zurückgekehrt.
»Ein großer Fehler«, sagte die Mutter, wenn sie an diesem Punkt ihrer Erzählung ankam, und um ihren Mund zeigte sich diese Linie aus Bedauern und Verachtung.
Sie lebten in Köln, und der Vater war ständig unterwegs gewesen. Die Wohnung lag in der Niehler Straße über der Kneipe Dönekes, in der die Mutter bald Stammgast war. Anna konnte sich gut an die lautstarken Streitereien ihrer Eltern erinnern. Die Vertreterreisen ihres Vaters waren immer länger geworden, und als sie acht war, kam er nicht mehr zurück. Von da an trank die Mutter von morgens bis abends, und Anna hatte geweint und geschrien, wenn sie die Mutter auf dem Küchenfußboden oder im Bad zwischen Wanne und Toilette fand und sie kein Lebenszeichen von sich gab. Wochenlang ging das so.
Und dann, von einem Tag auf den anderen, war es vorbei. Die Mutter fing sich, arbeitete als Kellnerin im Dönekes und übernahm zwei Jahre später den Pachtvertrag für das Lokal. Nicht dass sie nicht mehr trank, aber von nun an gemäßigt und nie wieder bis zum Umfallen. Als verlassene Frau, die alleine ein Lokal betrieb, hatte sie es in den sechziger Jahren nicht leicht gehabt. Sie war hübsch, und es kursierten anzügliche Gerüchte. Aber sie setzte sich darüber hinweg, hatte die Männer an der Theke gut im Griff, und die üble Nachrede war nach und nach verstummt. 1965 hatten sie noch einmal von Norbert Meerbaum gehört. Der Brief kam aus Antwerpen, und er bat höflich und knapp um die Scheidung.
Diesen Brief des Vaters hat sie noch. Die Mutter hatte ihn damals vorgelesen, zerrissen und in den Mülleimer geworfen. Weil der Vater sie – sein kleines Engelchen – in dem Brief nicht mal erwähnte, hatte sie gedacht, die Mutter habe diesen Teil unterschlagen. Heimlich sammelte sie die Schnipsel aus dem Müll und klebte sie sorgfältig auf ein Blatt. Aber die Mutter hatte nichts ausgelassen, er hatte tatsächlich kein Wort über sie verloren.
Der alte Schmerz kriecht in ihr hoch, und für einen Moment fragt sie sich erstaunt, warum sie dieses Zeugnis seiner Missachtung immer noch aufbewahrt.
Im Bett liegt sie lange wach, hat das Fenster weit geöffnet und wartet darauf, dass sich die kühle Nachtluft endlich auch im Zimmer breitmacht. Vielleicht soll sie Thomas bitten, die Dinge ruhen zu lassen, denn spätestens wenn Aussicht auf eine Entschädigung besteht, muss sie mit ihrer Mutter sprechen. Und an den Streit möchte sie gar nicht denken.
Auf der anderen Seite ist da diese Neugier. Sie weiß so wenig über ihre Familie. Zumindest kann sie in die Uckermark fahren und sich das Gut einmal ansehen. Davon braucht die Mutter ja nichts zu erfahren. Sie spürt, wie sich bei diesem letzten Gedanken ihre Brust verengt. Und dann ist es wieder da. Das Herzklopfen. Der wankende Boden. Der große graue Hund der Angst.
Kapitel 3
Uckermark, April 1945
Diese ersten warmen Frühlingstage, wenn der Morgentau dampfend aus den Feldern stieg und alles Warten ein Ende hatte, waren ihm immer die liebsten gewesen. Aber jetzt hatte er keinen Blick dafür. Heinrich Anquist stand auf dem schmalen Balkon im ersten Stock des Gutshauses und blickte mit einem Fernglas die lange Auffahrt hinunter zur Chaussee. Seit drei Tagen ging das so. Mannschaftswagen, Fußtruppen, Versorgungswagen und manchmal Panzer. Sie zogen sich zurück. Es war die Rede von einer neuen Verteidigungslinie weiter westlich, aber sie kamen kaum vorwärts. Flüchtlingstrecks verstopften die Straßen. Seit Tagen hörte man das Rattern der Stalinorgeln, das über die Seen und stillen Hügel wehte und beständig näher kam. Wochenlang war Gut Anquist Durchgangslager für Flüchtlinge gewesen. Die Remise und Scheune hatte kaum noch Platz geboten, vor vier Tagen aber waren sie endlich alle aufgebrochen. Er war froh darüber. Länger hätten sie die vielen Menschen nicht versorgen können. Die Lebensmittelvorräte und das Pferdefutter gingen zur Neige.
Heinrich Anquist hatte seine Hausangestellten und die polnischen Kriegsgefangenen ebenfalls aufgefordert, zu packen und mit den Flüchtlingen zu ziehen. Zwei Pferde und zwei Wagen hatte er ihnen überlassen. Die alte Wilhelmine, die seit vierzig Jahren die Küche führte und vor einigen Monaten ihre verwaiste Nichte Almuth aus Berlin hergeholt hatte, war geblieben. Und auch Josef, der hier aufgewachsen war und das Gut nur verließ, um die Milchkannen zur Molkerei zu fahren, wollte nicht fort. Josef war als Kind an Kinderlähmung erkrankt und hatte ein steifes Bein zurückbehalten. Für ihn war es ein schrecklicher Makel, dass er mit seinen zwanzig Jahren nicht Soldat werden konnte. »Ich lauf doch nicht weg vor dem Feind«, hatte er trotzig erklärt, und alles Zureden hatte nicht geholfen.
Jetzt waren sie nur noch eine kleine Gemeinschaft. Außer Wilhelmine, Josef und Almuth waren Anquists Tochter Clara und seine Schwiegertochter Isabell mit den Kindern Margareta und Konrad auf dem Gut. Er hätte es lieber gesehen, wenn sie mit den anderen fortgegangen wären, aber sein Sohn Ferdinand hatte vor einer Woche telegrafiert und seine Heimkehr angekündigt. »Sind auf dem Rückzug. Stopp. Bin in wenigen Tagen zu Hause. Stopp.«
Isabell wollte auf ihn warten. »Ich gehe nicht ohne ihn«, hatte sie gesagt. »Er muss doch jeden Moment hier sein.«
»Die Russen auch«, schimpfte Clara, »du musst an deine Kinder denken.«
Aber Isabell ließ nicht mit sich reden. »Er wird vor den Russen hier sein, und er wird wissen, was dann zu tun ist.« Das war ihr letztes Wort gewesen.
Gestern hatten sie eilig das Tafelsilber, wertvolle Bilder, Meißner Porzellan und hochwertige Kleidung in Koffer und Truhen gepackt und im Wald am See vergraben. Den Familienschmuck, Bargeld und wichtige Papiere hatte er in eine Metallkiste gelegt und unter einer Betonplatte hinter den Pferdeställen versteckt. Davon wussten nur er und Clara. Anschließend verbrannte er das Führerportät und sein Parteibuch.
In die Partei war er 1939 eingetreten. Seine Pferdezucht genoss einen ausgezeichneten Ruf, und das Militär war sein bester Kunde. Aber dann hatten sie ihm erklärt, dass er nur als Parteimitglied auf weitere Geschäfte hoffen konnte. Er hatte nicht groß darüber nachgedacht. Politik interessierte ihn nicht. Ein kleines Zugeständnis, hatte er damals gedacht, aber dieser einen Konzession waren weitere gefolgt.
Es war gut für ihn gelaufen, er hatte in all den Jahren profitiert, sogar Land zugekauft. Erst mit dem Russlandfeldzug waren ihm Zweifel gekommen. Aber da war es längst zu spät gewesen. Sein Sohn Ferdinand war Offizier des Heeres und brachte auf seinen Heimaturlauben Nachrichten aus dem Osten mit, die er kaum glauben konnte. Niedergebrannte Dörfer. Erschießungen von Zivilisten. Sogar von Frauen und Kindern hatte er gesprochen.
Und in der kommenden Nacht oder spätestens morgen würden die Russen auf dem Gut stehen.
Er hörte, wie sich die schwere Zimmertür des Herrenzimmers öffnete und jemand am Durchgang zum Balkon stehen blieb.
»Vater?« Clara Anquist sprach mit fester Stimme. »Wir sind so weit.«
Anquist ließ das Fernglas sinken und drehte sich zu ihr um. »Lasst die Kühe auf den Wiesen, aber bringt die tragenden Stuten noch in den Stall. Mit irgendwas müssen wir ja anfangen, wenn das alles hier vorbei ist.«
Als er es ausgesprochen hatte und Claras betroffenen Blick sah, schluckte er verlegen. Was redete er da? Aber er konnte nicht leugnen, dass es diese Hoffnung in ihm gab. Irgendwie musste es auch in einem besetzten Land weitergehen, und eine funktionierende Landwirtschaft wurde immer gebraucht. Er legte das Fernglas beiseite und trat ins Zimmer.
Es war verabredet, dass sie sich für die kommenden Tage in der Hütte am See verstecken würden, bis sich die Lage beruhigt hatte und die Front über sie hinweggezogen war. Das kleine Holzhaus lag verborgen in einem Waldstück. Sie benutzten es seit Jahren nicht mehr. Der Weg dorthin war zugewuchert. Josef und Clara hatten am Tag zuvor den Bootssteg zerschlagen, der einzig sichtbare Hinweis, dass der Ort von Menschen genutzt wurde. Als seine Frau Johanna noch lebte, waren sie abends nach getaner Arbeit regelmäßig mit den Kindern am Steg gewesen. Sie fuhren mit dem Ruderboot auf den See, die Kinder lernten schwimmen und im Winter Schlittschuhlaufen. Aber das war in einer anderen Zeit gewesen, in einem anderen Leben.
»Proviant, Decken, Kleidung und Petroleumlampen sind jetzt in der Hütte. Die beiden Gewehre sind noch im Versteck«, sagte Clara. »Der Proviant wird für etwa eine Woche reichen.«
»Gut.« Er zeigte zum Balkon. »In der Nacht, aber spätestens morgen werden sie hier sein. Wir werden uns am Abend auf den Weg machen.«
Er tätschelte ihre Wange. Clara hatte schon mit zwanzig, nach dem Tod ihrer Mutter, alle Pflichten einer Hausherrin übernommen. Sie war schön, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Es war wohl ihr Stolz, mit dem sie die Blicke der Männer auf sich zog. Das strohblonde Haar, die gerade Nase und die blauen Augen waren ein mütterliches Erbe. Dass sie großgewachsen und kräftig war, sich am liebsten bei den Pferden aufhielt und körperliche Arbeit nicht scheute, hatte sie von ihm. Er hätte sie gerne verheiratet gesehen, aber sie wartete auf den »Richtigen«, wie sie es ausdrückte. Eine Zeitlang war er zuversichtlich gewesen. Sie hatte sich für Magnus Ambacher interessiert, einen Freund seines Sohnes. Er kam aus Berlin und war, wie Ferdinand, in Templin im Joachimsthalschen Gymnasium zur Schule gegangen. Ferdinand war Wochenschüler im Internat und verbrachte die Wochenenden zu Hause. Seinen Freund Magnus brachte er regelmäßig mit, aber als die Schulzeit vorbei war und Magnus zum Medizinstudium nach Berlin zurückkehrte, hatte sich die Verbindung nach und nach gelöst.
Clara hatte alles getan, um sich die Enttäuschung nicht anmerken zu lassen, aber er wusste, dass sie immer noch darunter litt. Inzwischen war sie Mitte zwanzig, und wenn das Thema Ehe zur Sprache kam, war ihre Antwort: »Wir werden sehen. Wenn der Krieg vorbei ist, werden wir weitersehen.«
Als seine Tochter gegangen war, trat er zurück auf den Balkon. In wenigen Tagen würde der ganze Wahnsinn ein Ende haben, und bis dahin wollte er die Frauen in Sicherheit wissen. Den Russen eilte ein schrecklicher Ruf voraus. Von Plünderungen und Vergewaltigungen war die Rede. Er nahm sein Fernglas wieder auf und blickte über das Land hinter der Chaussee. Von dort würden sie kommen. Keine Sekunde dachte er daran, dass er sie nicht alle im Blick haben könnte, dass sie nicht in einer geraden Linie vorrückten.
Ein unverzeihlicher Fehler, den er erst erkannte, als die beiden Hunde im Hof wild zu kläffen begannen. Dann folgten Schüsse, und die Tiere waren still. »Zu spät!« Nichts anderes konnte er denken, nur dieses »zu spät, zu spät« hämmerte in seinem Kopf.
Die Frauen und Kinder waren noch im Haus. Er lief den Flur entlang zu den Fenstern nach Süden, hörte, wie unten Gewehrkolben gegen das Portal geschlagen wurden. Er rief: »Clara! Isabell!«, bekam aber keine Antwort. Dann lief er in Isabells Zimmer, das nach Westen ging, und schob die Gardine zur Seite. Da sah er sie. Sie rannten über die Felder auf den Wald zu. Die siebenjährige Margareta lief an Josefs Hand, und Clara trug den kleinen Konrad.
»Gott sei Dank«, flüsterte er erleichtert. Unten barst das Holz des Portals, und gleich darauf hörte er die Soldaten in der Eingangshalle. Die Schritte schwerer Stiefel. Es wurde gerufen, Glas und Porzellan zerbrach, Holz splitterte. Dann Schreie. Wilhelmine! Ihre Nichte Almuth hatte er bei den anderen gesehen, aber Wilhelmine war nicht dabei gewesen. Er lief zur Treppe, wollte hinunter zur Küche. Wieder fielen Schüsse. Wilhelmine schrie nicht mehr. Er stand an der Treppe und sah hinunter. Die Männer bemerkten ihn nicht, trugen Lebensmittelvorräte in die Halle. Kartoffeln, Speck, Mehl. Heinrich Anquist stieg mit hocherhobenem Haupt die breite Treppe hinunter, darauf gefasst, dass ihn gleich eine Kugel treffen würde. Er war schon auf halber Höhe, als sie ihn entdeckten. Zwei der Soldaten stürmten ihm entgegen, packten ihn und stießen ihn die restlichen Stufen hinunter. Er verlor das Gleichgewicht und fiel auf den Mosaikfußboden der Halle.
Einer der Männer ging neben ihm in die Hocke, packte sein schütteres graues Haar und zog seinen Kopf hoch. Er sprach gebrochen Deutsch, nannte ihn ein Nazischwein und fragte: »Wo deine Leute? Wo deine Leute!«
Heinrich Anquist blickte in die dunklen Augen. »So also endet es«, dachte er und sagte: »Hier sind keine Leute mehr.« Fast hätte er gelächelt vor Erleichterung darüber, dass es die Wahrheit war.
Er sah den Zorn in den Augen des anderen, hörte das ängstliche Wiehern der Stuten, die draußen auf dem Hof zusammengetrieben wurden. »Nicht die tragenden Stuten«, dachte er, »womit soll Ferdinand denn neu anfangen, wenn …«
»Faschist«, spuckte der Rotarmist verächtlich aus. Heinrich Anquist spürte noch, wie sein Kopf mit Wucht auf dem Steinfußboden aufschlug. Dann war es dunkel.
Kapitel 4
Hamburg, Januar 1947
Agnes Dietz saß an diesem 28. Januar im Mantel an ihrer Nähmaschine und versuchte, ein dunkelblaues Kleid aus feinem Taft zu ändern. Ihr Mantel stammte noch aus den guten Jahren. Damals war sie an Hüften und Busen rundlich gewesen, aber jetzt war er zu weit, und die Ärmelenden behinderten jeden Handgriff. Wenn Hanno und Wiebke nicht bald mit etwas Brennbarem nach Hause kamen, würde das Kleid nicht pünktlich fertig werden. Schon am Abend zuvor hatte sie daran gearbeitet, aber die Arbeit zog sich hin, weil die Kälte ihre Finger steif und unbeweglich machte und der glatte Stoff immer wieder unter den fühllosen Händen wegrutschte. Ihre Haut war rauh, am Kragen des Kleides war sie hängengeblieben und hatte dabei ein Fädchen gezogen.
Sie stand auf, ging umher, rieb die Hände, hielt sie vors Gesicht und hauchte hinein, bis das Blut wieder zirkulierte. In den letzten Monaten hatte sich herumgesprochen, dass sie eine Nähmaschine besaß und geschickt damit war. Beim Steineklopfen war sie Magda begegnet, die mit ihren drei Kindern in einer der Nissenhütten an der Auenstraße wohnte, einer Notunterkunft aus Wellblech, wie sie zu Hunderten in der Stadt aufgestellt worden waren. Magda machte bei Major Gardner in Rotherbaum die Wäsche. Einige der Frauen hatten sie beschimpft, weil sie aus dem Osten kam und für »den Feind« arbeitete, aber Magda ließ sich nichts gefallen.
»Der Krieg ist vorbei, und ich muss drei hungrige Mäuler stopfen«, wehrte sie sich, und Agnes hatte ihr zugenickt.
Magda hatte ihr vor einigen Tagen diesen Nähauftrag besorgt. Das Kleid gehörte Frau Gardner, und Agnes sollte es ändern und am Nachmittag in Rotherbaum, in der Heimhuder Straße abliefern. Schon am Abend zuvor, beim Auftrennen der alten Nähte, war alles schiefgegangen. Bei dem Versuch, die Fäden im Ganzen zu ziehen, damit sie sie anschließend wiederverwenden konnte, waren sie unter ihren steifen Fingern gerissen. Sie hatte aus ihrem Unterrock den schwarzen Saumfaden gezogen, um weiterzuarbeiten. Aber wenn Hanno und Wiebke nicht bald Brennholz brachten und es im Zimmer wenigstens für kurze Zeit warm war, dann würde sie mit dem Kleid nicht rechtzeitig fertig sein. Dabei wollte sie doch eine pünktliche und gute Arbeit abliefern, um vielleicht weitere Aufträge zu bekommen. Magda hatte gesagt, dass die Gardner sehr anspruchsvoll sei, sich aber auch nicht lumpen ließ, wenn sie zufrieden war.
Es war schon fast zwölf, als sie Hanno und Wiebke endlich draußen hörte und zur Tür lief.
»Habt ihr …?« Sie stockte.
»Aber … wer ist das denn?«
Hanno hatte den Kleinen neben Wiebke abgestellt, und die versuchte eine Erklärung. Wie immer, wenn sie aufgeregt war, kam sie kaum über die erste Silbe hinaus. Hanno kam ihr zu Hilfe. »Der war allein. Hat bei den Trümmern an der Anckelmannstraße gestanden.« Und um das Thema fürs Erste zu beenden, fügte er eilig an: »Wir haben Holz.«
Er ging ins Zimmer, holte das Beil, das Peter ihm geschenkt hatte, und machte sich daran, die Bretter auf ein passendes Maß zu schlagen. Agnes Dietz betrachtete den kleinen Jungen. »Aber ihr könnt doch nicht einfach ein Kind hier anschleppen. Seht ihn euch doch an. Der gehört doch zu jemandem.«
Hanno schüttelte den Kopf. »Da war aber niemand, ehrlich. Da war weit und breit kein Mensch.«
Agnes hob den Jungen hoch und sprach ihn an. »Na komm. Wir gehen erst mal rein und heizen. Dann sehen wir weiter.«
Der Kleine reagierte nicht auf ihre Ansprache, war steif vor Kälte und schien völlig apathisch. Sie setzte ihn aufs Bett, befühlte seine Händchen, zog ihm die Schuhe und die steif gefrorene Hose und Unterhose aus. Dann betrachtete sie die Füße und Beine. Erfrierungen konnte sie nicht entdecken und sagte: »Ist nicht so schlimm. Das wird wieder.«
Sie schlug das Oberbett zurück und packte den Kleinen darunter. Hanno kam mit dem zerkleinerten Holz und feuerte den Ofen an. Der Raum war kaum zwölf Quadratmeter groß. Links vom Ofen lagen die Matratzen mit dem Oberbett und den beiden Armeedecken, die Hanno zusammen mit Peter organisiert hatte. Das Feldbett, das zusammengeklappt an der Wand lehnte, war aus einem Luftschutzbunker. In der Zinkwanne wuschen sie die Wäsche, außerdem diente sie als Badewanne. Rechts vom Ofen stand der Tisch mit den drei Beinen. Das vierte Bein hatten sie durch ein Brett ersetzt. Auch die zwei Stühle und den Hocker hatten Hanno und Peter aus den Trümmern geborgen und repariert. Neben dem Eingang stand der Küchenschrank ohne Türen. Der war nach der Bombardierung noch dort gewesen und hatte die herabstürzenden Trümmer überstanden. Im unteren Teil lagen einige Kleidungsstücke und Handtücher und im Fach darüber die beiden Töpfe und das Geschirr aus Pinneberg.
Obenauf stand die leere Konservendose. Die nahm Wiebke mit zur Schule. Mittags bekamen die Kinder dort einen halben Liter Suppe, aber seit Weihnachten war die Schule geschlossen, und damit fiel auch die mittägliche Suppe für Wiebke aus.
Im letzten Sommer hatten Peter und Hanno eine Glasscheibe und Kitt besorgt und die Pappen in der Fensteröffnung entfernt. In der Zeit waren auch die Strommasten in der Straße wieder aufgestellt worden, und sie hatten stundenweise Strom. Für die Glühbirne hatten sie ein kleines Vermögen bezahlt.