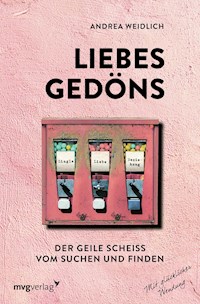Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mvg Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Entschuldigung, wo geht's denn hier zum Glück? Für alle, die sich das oft fragen, gibt es gute Neuigkeiten: Es befindet sich gleich nach dem inneren Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt rechts. Da wartet es auf uns, in der Hoffnung, dass wir erkennen, dass es die ganze Zeit schon da war. Sogar mitten im Alltagswahnsinn, bei lästigem Liebeskummer oder dem bösen Wetter. Und während wir eben noch ratlos im Regen standen, tropft uns die Wahrheit direkt ins Herz: Die Einzigen, die zwischen uns und dem Glück stehen, sind wir selbst. Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an das echte Leben. Herrlich unkonventionell zeigt es uns, warum wir aufhören sollten andere zu glorifizieren, wie wir unser Glück erkennen und es endlich selbst in die Hand nehmen – genau so, wie wir sind. Denn irgendwann bemerken wir, es gibt nur zwei Zeiten: jetzt oder nie.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchvorderseite
ANDREA WEIDLICH
DER GEILE SCHEISS VOM GLÜCKLICHSEIN
Titelseite
ANDREA WEIDLICH
DER GEILE SCHEISS VOM GLÜCKLICHSEIN
WIE MAN DAS GLÜCK NICHT SUCHT UND TROTZDEM FINDET
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/ abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Originalausgabe
14. Auflage 2025
© 2019 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Desirée Šimeg, Stadtbergen
Umschlaggestaltung: Isabella Dorsch, München
Abbildungen Umschlag und Innenteil: www.guschbaby.com
Layout und Satz: inpunkt[w]o, Haiger (www.inpunktwo.de)
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-7474-0053-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96121-380-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
INHALT
1. RUNDE NULL:WIE ALLES BEGANN
2. DER GEILE SCHEISS VOM GLÜCKLICHSEIN
3. GEH MIR NICHT AM HASHTAG
4. ALLES AUSSER IRDISCH
5. DIEGO-HERBERT UND DAS GLÜCK
6. IM OPFERLAND
7. KREISVERKEHRT
8. AM ENDE PARIS
9. SINGLE, KANN MAN DAS HEILEN?
10. PRINZENROLLE
11. GOLDEN GIRLS UND DIE GANZ GROSSE LIEBE
12. DER BÖSE STEIN
13. GRAPEFRUIT BALLETT
14. GLÜCK GEHABT
15. DIE ZAHNPASTATHEORIE
16. DAS SCHWEIGEN DER MÄNNER
17. WENN SICH DER MÜLL VON SELBST RAUSTRÄGT
18. ES HAT SICH AUSGE-YOLO-T
19. DIE LILA LÖSUNG
20. SCHMETTERLINGE IM SCHLAUCH
21. WARUM VERLIEBTSEIN EINE ENTSCHEIDUNG IST
22. MHHMM, BOB
23. AMOR FATI
24. AUF DEM WEG IST EIN ZIEL
25. REISE NACH VERBLÖDISTAN
26. HERZLICH WILLKOMMEN IM FALSCHEN FILM
27. GIBT ES DIE REALITÄT WIRKLICH?
28. DA HAB ICH DOCH DIE WAHL, NUSS
29. VÖGEL DESSELBEN GEFIEDERS
30. NULL IST WENIG
31. DER ROTE PUNKT
32. MARGARINEN-TSUNAMI
33. AHA IST EIN ERLEBNIS
ÜBER DIE AUTORIN
Für meine Eltern, meine Familie, die mich von klein auf Schreiben gesehen und immer darin bestärkt haben,
meine Freundin Samira, die gar nicht mehr aufhören konnte zu weinen, als sie von diesem Buch erfahren hat (vor Freude, falls sich jemand fragt),
für das Mädchen, das uns schrieb, dass sie durch uns die Motivation fand, endlich aus dem Krankenhaus zu kommen,
für die Krankenschwester, die ihr unseren Podcast empfohlen hat,
für jede und jeden da draußen, all die wundervollen Menschen, die uns täglich schreiben und uns mit Liebe überhäufen –
hier ist ein wenig Liebe für euch zurück.
Und natürlich für Anna, dein Herz, deinen Halt und deine schöne Seele.
Euch allen von Herzen:
Danke.
1.
RUNDE NULL: WIE ALLES BEGANN
Als kleines Mädchen war ich überzeugt davon, geheime Superkräfte zu besitzen. Ich erinnere mich, wie ich auf der Rückbank im Auto meiner Eltern saß, zum Fenster hinaus starrte und mir plötzlich durch den Kopf schoss: »Meine Gedanken sind geheim! Keiner kann sie sehen, schmecken, riechen oder fühlen. Niemand weiß Bescheid. Ich kann denken, was ich möchte, wann ich möchte und wie ich möchte. Das ist meine geheime Superkraft!«
Würde man mich heute dazu befragen, ich würde dem kleinen Mädchen immer noch Recht geben. Unsere Gedanken sind frei und manchmal auch geheim. Wenn wir sie für uns behalten, kann sie niemand zerstören. Im Kopf zaubern wir kleine und große Episoden, bunte Abenteuer und atemberaubende Szenen, die nur darauf warten, zum Leben erweckt zu werden. Wir schreiben gedanklich Geschichten über uns, das Leben und den Menschen, der wir sein wollen. Vielleicht haben wir unser Glück also nicht nur in der Hand, sondern auch im Kopf, und können von da aus weit mehr ins Leben rufen, als wir je zu träumen wagen.
Was wäre, wenn alles, was wir sehen, doch nur eine Illusion und alles, was wir träumen, die Wahrheit ist? Im Kindesalter verschwimmen die Grenzen.
Das Mädchen von damals malte sich die buntesten Gedanken aus, formte sie zu Worten und daraus zu Geschichten. Es gab keinen Unterschied zwischen dem sonnigen Tag an Deck und den aufregenden Erlebnissen in meinem Geist. All das, was ich erleben wollte, entstand in meinem Kopf und wurde auf dem Papier zum Leben erweckt. Meine Eltern besaßen damals ein kleines Boot, auf dem wir die Hälfte des Sommers barfuß und glücklich, eingecremt mit Lichtschutzfaktor 5 und trotzdem ohne Sonnenbrand, verbrachten. Entlang der weiten Küste Kroatiens steuerten wir, begleitet vom lauten Zirpen der Zikaden, aus kleinen, malerischen Häfen direkt hinaus aufs offene Meer, weiter zu den entlegenen Buchten Dalmatiens, wo wir uns das Salz auf die Haut und nicht mal aus den Haaren spülten. Es brauchte nicht viel mehr als ein paar Badehosen (Bikinitops waren nicht nötig), mein aufblasbares Krokodil, saftige Gurken und Tomaten vom Markt, Stifte und jede Menge Papier. Sobald ich aus dem Wasser kam, tappte ich auch schon mit meinen nassen Füßen die kleine Holzstiege im Boot hinunter und schnappte mir Stift und Block. Da saß ich oft stundenlang in meiner kleinen Kajüte und schrieb. Ich schrieb für niemanden außer mich selbst. Es gab kein Ziel, keinen Anfang und kein Ende. Wenn ich schrieb, war ich glücklich. Und so ist es immer noch.
Wer jetzt verzweifelt nach einem Stift sucht, um endlich dieses beschissene Glück zu finden, oder ungefähr so große Lust darauf hat, wie sich astreines Japanisch in einem Crashkurs in die Synapsen zu klopfen, kann ich schon mal beruhigen: Es gibt gar nicht sonderlich viel zu tun. Keiner muss hier schreiben (außer ihr wollt, dann macht es bitte!). Es geht eher darum, sich nach ein paar Runden im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung geiler Scheiß zu gönnen. Man kann sich nämlich für sein Glück entscheiden. Genau mit diesem Thema beschäftigen wir uns in unserem Podcast »gusch, baby«. Da unterhalten Anna und ich uns über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Anna ist meine Cousine und gemeinsam befassen wir uns wöchentlich damit, wie man das Glück nicht sucht und trotzdem findet. Und darum geht es auch in diesem Buch. Dazu muss man übrigens alles andere als perfekt sein. Glaubt es uns, denn wir sind es nicht.
In fünfhundert Metern die linke Ausfahrt im Kreisverkehr nehmen, danach dem Straßenverlauf folgen. Der geile Scheiß vom Glücklichsein befindet sich direkt hinter der etwas trüben, vom Schmutz des Fahrtwinds beschlagenen Scheibe. Reinigen wir sie ein bisschen für bessere Sicht. Und das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.
Im Herzen: Sonne Im Regen: Schirm.
(guschbaby)
2.
DER GEILE SCHEISS VOM GLÜCKLICHSEIN
»In einer Welt, in der wir alles sein können, sollten wir vor allem glücklich sein.«
Mit dem Glück ist es so eine Sache. Wir jagen ihm hinterher, wir machen uns auf die Suche, wir bleiben stehen, wir stolpern und manchmal stürzen wir auch. Dann stehen wir wieder auf, mit wundem, aufgeschürftem Herzen, hoffend, dass uns das Glück endlich findet und, verdammt noch mal, auch bleibt. Beinahe zornig rufen wir ihm zu: »Komm und bleib für immer!«
Glücklich sollte man sein. Man liest es überall. Aber, da brennt sie förmlich auf den Lippen, die unerbittliche Frage: »Ja, wie denn nur?«
Wie sieht es denn aus, das Glück? Hat es schon jemand gesehen? Wie fühlt es sich an? Zerbrechlich oder fest? Zaghaft oder wild? Ist es leise oder laut? Wie ist es denn und wo bleibt es nur?
Höchste Zeit das herauszufinden.
3.
GEH MIR NICHT AM HASHTAG
Und? Hast du ihn schon, den blauen Haken, hast du heute schon »geinfluenced«? Falls nicht, stell dein Leben bitte ordentlich infrage. Eventuell lebst du in einer Parallelwelt, von der noch nicht geklärt ist, ob du überhaupt am Leben bist. Man ist nämlich sehr glücklich auf Instagräääm. Vor allem aber sehr natürlich und hauptsächlich im Urlaub. Und die ganze Welt sieht aufgeregt zu, beim nächsten Klick der Instastory. Wie bei einem Unfall, bei dem man nicht wegschauen kann. Also schauen wir hin, wie damals bei Reich und Schön oder als Barbapapa lief. Auf Instagram verbiegen wir uns gerne und werfen ein paar Filter drüber. Denn wir stehen verdammt noch mal glücklich da: an glücklichen Orten, in glücklichen Schuhen, vor glücklichen Kindern. Deshalb zaubern wir mal eben im Handumdrehen eine vegane, achtstöckige Geburtstagstorte in blassrosa Marzipanglasur und beweisen der Welt, dass wir auf die Kokosblütenzuckerseite des Lebens gefallen sind. Auf jeden Fall stehen wir da, wo man gerne steht. Nicht im Büro oder in der Schlange im Supermarkt. Nicht vor vollgekackten Windeln oder dem Scheidungsrichter. Man hat jetzt schließlich Insta-Husbands. Das sind die neuen Kens und das hält ewig.
Und manchmal – ganz heimlich – lassen wir das alles hinter uns. Dann essen wir den verdammten Kuchen, gehen raus und sehen uns den Regenbogen an. Vielleicht auch einfach mal ganz ohne Filter vor der Linse. Man sieht eben einfach mehr.
Wer nicht weiß, was ein Hashtag oder dieser verdammte blaue Haken ist, dem möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren. Es besteht noch Hoffnung auf ein echtes Leben! Eines, in dem wir nicht gefangen sind, uns nicht ständig mit anderen vergleichen und nicht versuchen, noch glücklicher, noch schöner oder noch erfolgreicher zu sein. Zwischen den hohen Kerkermauern der sozialen Medien bekennen wir uns vielleicht dazu, hin und wieder diese verdammt miesen Tage zu haben, die sich leider nicht durch Contouring wegblenden oder verwischen lassen. Vielleicht gestehen wir uns sogar zu, auch mal traurig zu sein, nicht weiterzuwissen, so einige Fehler gemacht zu haben und immer noch zu machen, jemanden zu vermissen – manchmal sogar uns selbst, weil wir nicht mehr wissen, wer das sein soll.
Es ist schon ein großer Druck, die perfekte Version seiner selbst zu sein. Wann haben wir denn damit begonnen, uns und der Instagram-Welt Vollkommenheit vorzugaukeln, obwohl sich doch alles so unvollkommen anfühlt? Braucht uns die Welt perfekt, wenn sie es doch selbst nicht ist? Überlegt sich die Amsel auf dem Ast vor unserem Fenster, ob ihr linker Flügel heute genügend glänzt, oder zwitschert sie einfach vor sich hin? Haben wir etwa einen Vogel oder sollten wir mehr wie einer sein? Den Vogel jedenfalls kümmert es nicht. Die Amsel fragt sich nicht, warum der Specht so laut klopft und sie nicht, oder warum ihr der edle rote Fleck am Bauch nicht vergönnt ist. Würde die Amsel anfangen, sich diesen Fleck auf den Bauch zu malen, wir würden sie für verrückt erklären. Vielleicht braucht es uns, genau wie die Amsel oder den Specht, in unserer ehrlichsten Version: ungeschminkt, ohne Filter, echt und genau so, wie wir gedacht sind. An guten wie an schlechten Tagen, an denen wir am liebsten davonlaufen wollen oder das Glück in weiter Ferne scheint. Was, wenn es mit offenen Armen auf uns wartet und uns zuruft: »Ich bin hier. Genau hier!«
Kann mal wer den Filter abstellen? Das Glück will sich zeigen.
4.
ALLES AUSSER IRDISCH
Ich verrate es euch nur ungern, aber Menschen sind komisch. Also, so richtig! Es gibt tatsächlich keine Gattung auf dieser Welt, die es schafft, sich so konsequent selbst im Weg zu stehen wie wir. Man nehme nur all die Kriege oder die Zerstörung unserer eigenen Umwelt. Mischen wir noch ein paar selbst inszenierte Dramen, die Flucht vor unseren Gefühlen und sämtliche Ängste wie Bindungsangst, Versagensangst, Verlustangst (die Angstpalette ist bunter als jeder Malkasten) dazu und vermengen wir sie mit all den Beschränkungen, die wir uns selbst auferlegen. Mit großer Sorge blicken wir in unsere Zukunft und verpassen dabei das Hier und Jetzt. Wir beschweren uns über dies und das – oder über alles – und in Wahrheit steht unserem Glück rein gar nichts im Weg, außer wir uns selbst.
Selbstsabotage scheint unser allerliebstes Hobby zu sein. Manchmal frage ich mich, ob uns ab und zu jemand von außen betrachtet und dann sehr verstört ist. Vielleicht Außerirdische oder, sehr viel banaler, ein paar Goldfische, Kaulquappen oder gutmütige Golden Retriever, die sich alle die Haare raufen (außer Goldfische und Kaulquappen, die haben keine) und sich fragen, was wir da tun. Eventuell schütteln sie auch wild den Kopf, weil – ich habe es bereits erwähnt – wir Menschen sehr komisch sind. Nicht auf eine erheiternde Weise, sondern eher auf diese sehr schräge, seltsame Art, die man als Außenstehender schwer nachvollziehen kann. Manchmal tue ich mir damit sogar als quasi Innenstehende schwer.
Wir haben alles und doch ist nichts genug. Wir beklagen uns in Bausch und Bogen. Das Leben ist hart – vor allem zu uns.
Aber vielleicht geht es uns manchmal einfach zu gut und wir fühlen uns deshalb so schlecht dabei.
Solltet ihr euch an dieser Stelle über das »Wir«, also die Verallgemeinerung im großem Stil beschweren, bitten wir um Nachsicht. Das »Wir« dient zur Vereinfachung eines allgemeinen Phänomens, bei dem sich der eine mehr, der andere weniger betroffen oder zugehörig fühlt. Solltet ihr euch so ganz und gar nicht angesprochen, ja sogar übel auf den Schlips getreten fühlen, dann gratulieren und warnen wir euch zugleich. Einerseits freuen wir uns für euch, wenn ihr bereits rundum glücklich seid und mit Selbstsabotage so gar nichts am Hut habt. Andererseits warnen wir euch, nicht in die größten aller Selbstsabotagefallen zu tappen, nämlich die Ach-beimir-ist-das-ganz-anders-Verdrängung oder die Nein-so-bin-ich-garnicht-Heiligsprechung. Damit wollen wir uns vielleicht aber selbst versichern, etwas ganz Besonderes zu sein und ganz sicher nichts mit der breiten Masse gemein zu haben. Okay, das verstehen wir. In Wahrheit sind wir alle etwas ganz Besonderes – und das meinen wir ganz ohne Sarkasmus –, aber alleine das macht uns eben wieder zu einer recht kongruenten Einheit. Sollten wir nicht gerade deswegen zusammenhalten, statt ständig gegeneinander zu sein? Vielleicht sollten wir beginnen, alle am selben Strang zu ziehen – dem Glücksstrang sozusagen. Wir finden, wir sollten!
Anna und ich sind uns diesbezüglich einig. Anna ist, wie bereits erwähnt, meine Cousine. Sie redet gerne, was einmal mehr demonstriert, dass sich genetisch oft dieselben Dinge innerhalb einer Familie durchsetzen, auch wenn man das gerne mal abstreitet. In diesem Fall ist es aber durchaus schlüssig und auch hilf-reich, da wir gemeinsam jede Woche einen Podcast aufnehmen. Für alle, die nicht wissen, was ein Podcast ist: Bitte augenblicklich googeln und mindestens fünfundvierzig Minuten wöchentlich reinhören. In unseren,1 versteht sich, weil der sehr glücklich macht. Man erspart sich dann das Fernsehen, Beten oder lästige Aufschreiben von Glaubenssätzen. Amen.
Eventuell auch nicht. Erfreulicherweise gibt es ja verschiedene Wege zum Glück und jeder darf seine ganz persönliche Auswahl treffen.
Anna und ich sind jedenfalls davon überzeugt, dass uns alle die eine oder andere Frage des Lebens beschäftigt und wir schon deshalb irgendwie alle im selben Boot sitzen. Gehen wir mal davon aus, dass Herr Huber von nebenan, Frau Meier aus dem Büro und selbst die Geißens auf ihrer Jacht vor Mallorca in Wahrheit ganz ähnlich ticken wie wir und alle ihre kleinen und großen Probleme haben (die Geißens im Übrigen wahrscheinlich größere als Frau Meier und Herr Huber). Wenn wir das erkannt haben, liegt der Gedanke nahe, dass wir genau genommen auch alle denselben Wunsch teilen, nämlich einfach nur glücklich zu sein. Würden wir die Theorie etwas erweitern, käme noch der Wunsch hinzu, zu lieben und geliebt zu werden, was allerdings auch wieder in die Kategorie »Glücklichsein« fällt. Bleiben wir also der Einfachheit halber beim Glück und widmen wir uns ein wenig später der Liebe, sozusagen als Baustein oder Molekül des Glücks.
Jetzt ist das Glück ja schon von seiner Definition her gar keine klare Sache. Da kann es nämlich einerseits ein sehr oder relativ günstiges Ereignis sein, das einem einfach mal so zufällt. Oder es handelt sich um einen Zustand des Seins, der uns erfüllt. Wenn wir hier von Glück sprechen, dann immer von Letzterem. Wir sind davon überzeugt, dass das Glück nicht etwa passiv ist, sondern dass wir es selbst gestalten können, wenn wir es wollen oder zumindest probieren. Es wäre ja sonst so, als müssten wir immer darauf hoffen, irgendwann glücklich zu sein, und könnten nichts dafür (oder auch dagegen) tun. Das wäre unserer Meinung nach doch ziemlich verkehrt. Wir gehen also davon aus, dass Menschen die Gabe besitzen, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen, aber auch die Fähigkeit haben, es mit Füßen zu treten. Der aufmerksame Leser vermutet bereits, worin wir geübter sind.
Das Glück lieber in die Hand nehmen, statt es mit Füßen zu treten.
5.
DIEGO-HERBERT UND DAS GLÜCK
Man sollte glauben, das mit dem Glück sei eine große Sache. Dass es nicht ganz so groß sein kann, erklärt sich aber schon daran, dass Anna es letztens auf dem Rücksitz ihrer Uber-Fahrt gefunden hat. Dabei behauptet sie felsenfest, niemals ein Gespräch mit Uber-Fahrern zu beginnen. Wirklich niemals. Unerklärlicherweise findet sie sich trotzdem immer in tiefgreifenden Lebensfragen fremder Menschen wieder, in diesem Fall im kosmischen Fragenkatalog von Diego-Herbert. Möglicherweise war das nicht exakt sein Name. Aber als Anna mir die Geschichte erzählte, war sie überzeugt davon, dass er ein Herbert sein musste. Alles in ihm und an seiner Lebenseinstellung schrie förmlich Herbert. (Nichts gegen Herberts!) Da der Name aber so gar nicht zu ihrer Beschreibung eines südländischen Schnauzbartträgers mit übertrieben exponierter Brustbehaarung passte, einigten wir uns auf einen selbst kreierten, interkulturellen Doppelnamen – nämlich: Diego-Herbert.
Falls nun jemand aufgrund dieser Geschichte vorhat, seinen ersten Sohn, womöglich auch seinen zweiten oder gar dritten, so zu nennen, wären wir gerne darüber informiert. Wir wären dann immerhin namensgebende Tanten und hätten diesen jungen Geschöpfen das Glück sozusagen bereits in die Wiege gelegt. Das halten wir für eine schöne Sache und würden dann gerne gratulieren. Also, sagt uns Bescheid, sollten ein paar Diego-Herberts das Licht der Welt erblicken. Und an alle Diego-Herberts: Verklagt uns nicht – eure Eltern wollten es so.
Beim Einladen ihres Koffers fragte Diego-Herbert, aufmerksam wie er war, woher Anna denn gereist käme. »Berlin«, antwortete sie knapp, da sie eigentlich vorhatte, während der Fahrt ein paar E-Mails und Social-Media-Nachrichten zu beantworten. Doch Diego-Herbert stand der Sinn nach einer gepflegten Konversation über die verpasste Chance seines Lebens und er ließ sich keineswegs beirren.
»Berlin!«, rief er entzückt. »Ich habe früher mal in Deutschland gelebt.«
Das war er, der Beginn einer Konversation, aus der Anna so schnell nicht wieder rauskam. »Mhm.« Anna blickte nach wie vor auf den leuchtenden Bildschirm ihres Mobiltelefons, hoffend, sie könne der Konversation entkommen. Doch der Stolz in seiner Stimme ließ wenig Raum für Hoffnung.
»Das war eine schöne Zeit«, fuhr er fort. »Meine Familie und ich haben da gleich neben einem Gutshof in der Nähe von Heidelberg gelebt.«
Und so fand sich Anna mitten in Diego-Herberts Lebensgeschichte wieder. Es war an der Zeit, den Kopf zu heben, sich zu ergeben und einfach nur zu lauschen.
Diego-Herbert wohnte mit seiner Familie gleich neben dem Besitzer des Gutshofs, der gleichzeitig auch ihr Vermieter war. Sein Name war Olaf. Diego-Herbert schätzte ihn auf etwa Mitte siebzig. Er war ein sehr freundlicher, aber auch zurückhaltender Mann, der den Hof ganz alleine bewirtschaftete. Da Diego-Herbert jeden Tag am Hof vorbeispazierte, kamen die beiden eines Tages ins Gespräch und Diego-Herbert bot Olaf an, ihm zu helfen, ein paar Dinge auf dem Hof zu verrichten. Schon nach kurzer Zeit einigten sich die beiden darauf, dass Diego-Herbert von nun an, selbstverständlich gegen Bezahlung, für Olaf arbeiten würde, und darüber hinaus noch zur Hälfte des Mietpreises mit seiner Familie im Nebenhaus des Gutes wohnen durfte.
Das Verhältnis der beiden Männer wuchs schon innerhalb kürzester Zeit über das eines Arbeitsverhältnisses hinaus. Es entstand eine tiefe Freundschaft. Endlich war auch für Olaf das Glück eingekehrt. Er, der zuvor ganz alleine auf dem Hof gelebt hatte, durfte erleben, wie sich Kinderlachen in den Gängen, gemeinsame Abendessen mit Freunden und die damit einhergehende Wärme und Verbundenheit in seinem Herzen anfühlten. Er blühte auf. Er hatte wieder Freude am Leben. Diego-Herbert ging es ähnlich. Die beiden Männer hatten eine gute Zeit.
Doch Mariah, Diego-Herberts Frau, konnte das Glück in Heidelberg nicht finden. Nicht auf dem Land, nicht auf dem Hof und nicht ohne ihre Familie. Sie hatte Heimweh und wollte zurück nach Wien, wo sie den Rest ihrer Familie zurückgelassen hatte. Damit machte sie Olafs und am Ende auch Diego-Herberts Glück einen gehörigen Strich durch die Rechnung.
Diego-Herbert war innerlich zerrissen. Er musste wählen. Irgendwo zwischen Olafs und Mariahs Glück befände sich seines, so dachte er, und er war sich sicher, er müsse sich entscheiden. Er musste wählen und das fiel ihm ganz und gar nicht leicht. Als er sich letztlich dazu entschloss, mit seiner Frau und seinen Kindern nach Wien zu ziehen, fühlte er einen tiefen Schmerz, gepaart mit der Gewissheit, dass er sein Glück in Heidelberg zurückließ, und das nicht etwa nur kurz, sondern auf unbestimmte Zeit. Sein Glück wäre nun für immer in Deutschland und er in Wien – so dachte er zumindest, und während er Anna seine Geschichte erzählte, sah sie ihm an, wie traurig er war, so ganz ohne sein Glück.
»Olaf war ganz alleine«, erzählte er mit gepresster Stimme. »Er war reich, aber auch alt und sehr einsam, und er hatte niemanden, mit dem er sein Geld teilen konnte. Er wollte, dass wir den Hof und alles, was er besaß, eines Tages übernehmen. Er wollte, dass wir bleiben. Tja, man hat eben nur ein Mal im Leben Glück.« Die Wehmut packte ihn und Anna fuhr erschrocken hoch.
»Aber nein!«, rief sie. Nicht laut, aber doch merklich kräftiger und auch sehr viel wacher als noch beim Einstieg in diese vermeintliche Unglücksfahrt. Sie konnte es nicht fassen, was sie da gerade aus Diego-Herberts Mund vernommen hatte. »Man hat doch nicht nur ein Mal im Leben Glück!«
»Doch«, erwiderte Diego-Herbert mit trauriger Stimme. »Es war meine Chance und sie kommt nie wieder.«
Wie so oft im Leben passieren Dinge nicht umsonst. Vielleicht war es kein Zufall, dass Anna an diesem Abend ausgerechnet in Diego-Herberts Wagen gelandet war. Denn dass seine Schlussfolgerung nicht ganz stimmen kann, darin sind Anna und ich uns einig. Und wir haben dafür sogar mehrere, durchaus berechtigte Gründe. Was wäre denn beispielsweise, wenn man im zarten Alter von fünf Jahren eventuell mal Glück gehabt hätte? Kehrt das Glück danach nie wieder zurück? Man hätte bereits mit fünf Jahren sein gesamtes Glückspensum verpasst oder verbraucht? So kann das Leben doch nicht gemeint sein. Wäre es tatsächlich sein Glück gewesen, auf dem Gutshof bei Olaf zu bleiben? Hätte ihn das Leben auf dem Gutshof mit oder gar ohne Olaf tatsächlich glücklich gemacht? Oder wäre vielleicht seine Ehe zerbrochen, weil Mariah nicht auf dem Land leben wollte, oder die Abgase des Traktors hätten sich später auf seine empfindliche Lunge geschlagen und Diego-Herbert wäre sehr reich, aber am Ende möglicherweise sehr krank geworden? Eventuell wären seine Kinder in einem naheliegenden Fluss beim Spielen beinahe ums Leben gekommen und das ganze Geld wäre für endlose Therapiesitzungen der daraufhin notwendigen Angstbewältigung vor Wildflüssen draufgegangen? Und vor allem: Hat Diego-Herbert die seit mehreren Jahrzehnten überbrachte Vermutung berücksichtigt, dass Geld alleine womöglich gar nicht glücklich macht? Was hätte das ganze Geld genutzt, wenn er nach der Scheidung alleine in Heidelberg auf diesem riesigen Haufen Geld gesessen hätte, ohne Frau und Kinder – denn sie wären vermutlich gemeinsam mit ihrer Mutter nach Wien gegangen.
Diego-Herbert, wir fordern dich dazu auf, das alles noch mal gründlich zu überlegen! Vielleicht hast du hier einen klitzekleinen, aber doch entscheidenden Denkfehler gemacht, der dich inmitten deines gesamten Glückspotenzials eben genau dieses kostet. Ein hoher Preis!
Ein ebenso riskantes Unterfangen ist es, sein Glück von anderen Menschen abhängig zu machen. Das trifft natürlich sowohl auf Diego-Herbert als auch auf Olaf zu – im weiteren Sinne aber auch auf Mariah und die Kinder. An dieser Stelle werden einige Leser die Ellenbogen entrüstet in die Seiten stemmen. Denn, natürlich, wir haben es schon oft gehört oder zumindest mal gelesen: Kein Mensch ist eine Insel. Selbstverständlich möchte Diego-Herbert seine Frau und Kinder gerne an seiner Seite haben, im besten Fall auch Olaf gleich dazu. Wir kennen alle das Gefühl, einen oder mehrere Menschen im Leben nicht missen zu wollen. Das ist verständlich und durchaus legitim. Riskant wird es unserer Meinung nach dann, wenn wir beginnen, diese Menschen für unser eigenes Glück verantwortlich zu machen. »Wenn Olaf nicht mehr da ist, darf ich nicht mehr glücklich sein.« So ähnlich lauteten wohl seine Gedanken. Ganz schön trüb, oder? Das würde ja bedeuten, Olaf hätte Diego-Herberts Glück in seinen Händen. Ließe er es los oder fallen, es wäre vorbei und das ganze Glück mit einem Mal zerbrochen. Wir alle hatten vermutlich schon mal das Gefühl, dass nichts mehr im Leben Sinn ergibt, wenn ein bestimmter Mensch plötzlich nicht mehr da ist. Nicht nur wenn jemand gestorben ist, sondern auch wenn sich jemand einfach nur aus dem Staub gemacht hat – was interessanterweise sogar eine ganze Spur schmerzhafter sein kann. Man denkt dann nämlich, man wäre selbst dafür verantwortlich. Wir sprechen vom kleinen Tod, auch Trennung genannt. Plötzlich schwebt eine dunkle Wolke über uns und ein grauer Schleier legt sich uns eng um den Lebensmantel, schnürt uns fest die Kehle zu und lässt uns mit der dringenden Vermutung alleine, kein einziger positiver Lebensstrahl würde sich je wieder den Weg in unser tristes Leben bahnen. Bis wir dann, nach einiger, leider oftmals wirklich verdammt langer Zeit darauf kommen, dass sich die Welt in der Zwischenzeit einfach weitergedreht hat, die andere Person vielleicht doch nicht so perfekt war und wir sie daher von dem hohen Podest getrost wieder zurück auf den Boden der Realität setzen könnten und es dann auch endlich tun.
»Zurücksetzen« passt in diesem Zusammenhang ganz gut, denn auf gewisse Art wird das innere Betriebssystem neu gestartet und ein paar verloren geglaubte Apps wie Zuversicht, Lebensfreude oder Begeisterung für das eigene Spiel des Lebens erscheinen wieder auf dem Bildschirm. Ob es Diego-Herbert mit Olaf so ergangen ist und ob er den kleinen Tod einer Trennung erlebt hat, ob es ihm auch oder vielleicht sogar nur um die Chance auf Reichtum gegangen ist – wir werden es wohl nie erfahren. Die Tatsache, dass er Annas Frage, ob er und Olaf heute noch Kontakt hätten, mit Nein beantwortete, lässt allerdings vermuten, dass die Liebe nicht unendlich war und es doch auch um Eitelkeit oder verletzten Stolz gegangen sein muss. Was dann auch wieder an die bekannten Gefühlswelten eines Beziehungsendes erinnert.
Sollte Geld ausschlaggebend für das Empfinden eines dauerhaften Verlusts des eigenen Glücks gewesen sein, so können wir Diego-Herbert beruhigen. Die Liste prominenter verlorener Seelen, denen es in Sachen Reichtum an nichts gemangelt hat, ist so lang wie das Leben selbst. Es mag kitschig klingen, aber wer das Glück nicht in sich selbst findet, dem wird es auch nicht auf Geldscheinen entgegen rutschen. Natürlich kann so eine eigene Insel, ein Haus, ein Garten (gerne auch mit einer Hängematte) und ganz generell ein Leben ohne Geldsorgen durchaus seinen Reiz haben und sehr befriedigend sein, das wollen wir gar nicht bestreiten. Hockt man aber auf dieser Insel und pickt sich ein paar Dinge heraus, die einem missfallen könnten – und darin sind wir Menschen sehr einfallsreich –, kann einem schon mal die missratene Kokosnuss, die einem unverhofft auf den Schädel fällt, so sehr aufs Gemüt schlagen, dass man sein ganzes Glück am Ende doch wieder infrage stellt. Es scheint, als hätten wir Menschen genau das perfektioniert: die Fähigkeit, uns auf das zu konzentrieren, was uns gar nicht glücklich macht. So geht es also nicht! Aber wie geht es denn dann? Dazu kommen wir noch. Ungeduld, ihr Lieben, ist eine dieser hinderlichen menschlichen Eigenschaften, die sich so gerne zwischen uns und unser Glück stellen.
6.
IM OPFERLAND
Es gibt tatsächlich Menschen (und gar nicht mal so wenige) die denken, das Leben spiele ihnen übelst mit. Wenn eine dunkle Wolke beharrlich über dem eigenen Haupt schwebt, gelangt man nach dem Verlassen der Ortstafel »Zuversicht« und dem beschwerlichen Weg »Zum Leid« ins mürrische Hochgebirge. Hinter den sieben Lamentierbergen, nach dem fernen Ort »Klagen«, ist es dann endlich in Sicht: das »Opferland«. Im Grunde waren wir alle schon mal da, oder kennen zumindest jemanden, der sich in diesem tiefen Jammertal niedergelassen oder es sich dort – zumindest für eine Zeit – gemütlich gemacht hat.
Im Opferland tragen alle Menschen riesige Hüte aus Wut und Zorn, die so groß sind, dass sie ihnen immerzu die Sicht versperren. Die Krempe tief ins Gesicht gezogen, laufen alle Bürger blind durchs Leben und wundern sich, warum sie sich überall stoßen. Das wiederum macht sie noch zorniger, sodass ihre Hüte noch größer und schwerer werden und die wütenden Hutträger stets aus dem Gleichgewicht geraten. Das ist der Grund, warum Menschen im Opferland eher wanken als gehen – und das nicht mal aufrecht, sondern stets vom Leid gebückt. Sie stürzen häufig und brechen nicht selten unter der Last ihrer riesigen Wuthüte zusammen.
Die Bevölkerung hat es wahrlich nicht leicht im Opferland und die Dunkelheit schlägt allen aufs Gemüt. Das liegt aber nicht etwa am schlechten Wetter, sondern an den gigantischen Hutkrempen, die das helle Sonnenlicht zuverlässig von allen Hutträgern fernhalten. Sie laufen im Schatten ihrer selbst. Dazu muss man allerdings wissen, dass Opferlandbürger ihre Hüte selbst gar nicht sehen können. Sonst würden sie diese nämlich einfach abnehmen und sich nicht unentwegt beschweren, dass irgendetwas nicht stimmt. Und es stimmt tatsächlich etwas ganz und gar nicht. Könnten sie doch nur – zumindest hin und wieder – ihren Wuthut ablegen, der ihnen nicht nur die Sicht, sondern auch den Weg erschwert! Aber wie sollten sie das tun, wenn sie ihn gar nicht sehen? Ganz schön verzwickt!
So kommt es, dass ein Opferlandbewohner dem anderen sein Leid klagt, aber keiner so recht zuhört, weil jeder mehr mit seinem eigenen Elend beschäftigt ist. Dabei zieht ein lautes, kollektives Jammern durch das Land, das nur nachts für ein paar Stunden verstummt, wenn alle vor Erschöpfung eingeschlafen sind. Zorn und Klagen sind eben sehr ermüdend.
DAS PAULA-PROBLEM
»Kannst du schlafen?«, schrieb Paula über WhatsApp.
Ich verstand die Frage nicht.
»Weiß ich noch nicht«, antwortete ich, da ich noch nicht schlief. Hätte ich bereits geschlafen, hätte ich ihre Nachricht schließlich nicht lesen können. Opferlandbürgern mangelt es oft an Logik. Eigentlich klar, weil Leid auch nicht ganz logisch, sondern ganz oft eben einfach hausgemacht ist.
»Ich kann nämlich nicht schlafen«, textete Paula mich weiter zu und ich verfluchte die zwei blauen Haken, an denen ich wohl nicht mehr vorbeikam. Vermutlich wäre es eher unrealistisch gewesen, wäre ich noch in derselben Sekunde eingeschlafen und hätte alle weiteren Nachrichten erst am nächsten Morgen beantwortet. Also, Pech für mich.
Es war klar, dass es hier nicht etwa um mein Wohlbefinden, sondern um das meiner Freundin Paula ging, und dass sie mit ihrem Satz eine Reaktion (»Echt? Warum denn nicht, du Arme?«) einforderte, auch wenn mich die Antwort in dem Moment nicht so brennend interessierte. Man muss dazu sagen, Paula ist keine gute Freundin, eher eine Bekannte und mehr so eine, deren Nachrichten man gerne mal wegwischt, weil sie einen im Handumdrehen in eine ungewollte, dreistündige Unterhaltung verstrickt, deren Inhalt sich in einem einfachen Satz zusammenfassen ließe: Das Leben ist schrecklich!
»Es ist schrecklich«, schrieb sie prompt. Was sonst … Ich fand es schrecklich, wie vorhersehbar diese Konversation ihren Lauf nahm.
»Was ist denn los?«, schrieb ich, weil das als höflicher und mitfühlender Mensch, der ich in dem Moment war und generell zu häufig in meinem Leben bin, die einzig zulässige Antwortmöglichkeit war.
»Vielleicht möchtest du noch eine Nacht darüber schlafen und schauen, ob es morgen noch genauso schlimm ist, bevor wir jedes Detail in seinen kleinsten Bestandteil exzerpieren, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass das Leben schrecklich ist, was wir im Grunde ohnehin schon wissen, weil du es gerade geschrieben hast.« Ich wollte das schreiben. Ehrlich.
Und dann noch: »Bist du dir absolut sicher, dass du das dir und mir wirklich antun möchtest? Wollen wir uns jetzt zwei bis drei Stunden im Kreis drehen, bis uns beiden schwindlig ist und wir absolut nirgends angekommen sind?«
Am allerliebsten hätte ich allerdings geschrieben: »Es tut mir leid, aber es interessiert mich einfach nicht.« Oder nein, besser noch: »Es tut mir nicht leid, aber es interessiert mich einfach nicht.«
Warum wollen wir nur immer so höflich sein? Warum wollte ich das in dem Moment? Ich sage es euch. Es gibt ein eigenes Syndrom dafür. Da hat sich jemand tatsächlich die Mühe gegeben, diese Tatsache in einen schicken Begriff zu verpacken und uns alarmierend realitätsnah vor unser demaskiertes geistiges Auge zu werfen: das Brave-Mädchen-Syndrom. Hört sich gut an, meint ihr? Nein! Brave Mädchen ziehen Opferlandbürger nämlich magnetisch an und werden schließlich selbst zu einem. Sie lauschen dem endlosen Leid der Wuthutträger, stehen wacker an ihrer Seite, begleiten sie geduldig durch jedes selbst gemachte Elend und helfen ihnen auf, wenn sie ins Jammertal gefallen sind und nicht wieder aufstehen wollen. Immer und immer wieder. Brave Mädchen suchen einen Ausweg aus dem Opferland und übersehen dabei, dass sie selbst schon längst in dessen Labyrinth gefangen sind. Hinzu kommt, dass Opferlandbürger gar nicht auswandern möchten. Sie fühlen sich durchaus wohl im Land des ewigen Leidens. Wie auch meine Bekannte Paula.
Ich sah sie tippen. Paula schreibt … Paula schreibt … Paula schrieb immer noch.
Ich stellte mich auf einen handgetippten, eher langatmigen Roman ein und zwar nicht von der Bestsellersorte, sondern eher von jener, die man in Supermärkten kauft und mit denen man den Kamin anheizt oder die man zum Fensterputzen verwendet.
Doch es kam noch schlimmer. Während ich die Punkte beobachtete und mich währenddessen fragte, wie ich aus der Nummer halbwegs elegant rauskommen könnte, fing mein Handy in meinen Händen an zu vibrieren. Paula rief an. Da stand ihr Name, in monströsen Lettern direkt auf meinem Bildschirm. Ich fing an zu zittern und es lag nicht an der Vibration. Konnte ich das Klingeln ignorieren? Konnte ich so tun, als wären mein Handy und ich aus unbekannten Gründen nicht mehr auffindbar? Eventuell auf unbestimmte Zeit? Ihr vermutet es bereits: Ich konnte nicht. Ich war ein braves Mädchen.
»Du weißt nicht, was mir heute passiert ist!«, ertönte Paulas um einen Tick zu hohe und einen weiteren zu schrille Stimme am anderen Ende der Leitung. Sie war aufgebracht, wer hätte das gedacht. Bevor ich noch einen tiefen Atemzug holen oder auch nur antworten konnte, ging es schon weiter.
»Alles! Einfach alles! Und nichts Gutes!«
Gespräche mit Paula sind wie holprige Zugfahrten, bei denen der Zug mit hoher Geschwindigkeit auf den Gleisen rattert und man von dem monotonen Geräusch sehr müde wird, während sich in unregelmäßigen Abständen ein unangenehmes Quietschen auf den Gleisen unterschiebt, das einen darin hindert, wirklich einzuschlafen. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Zugfahrten. Da sieht man aus dem Fenster, beobachtet die Landschaft und entwickelt diese gewisse innere Ruhe, weil man weiß, dass es noch ewig dauert, bis man ans Ziel gelangt und es deshalb sinnvoller ist, die Reise einfach zu genießen. Ich versuchte, auch Paulas Anruf wie eine solche Zugfahrt zu sehen und mich innerlich zu entspannen. Schließlich musste ich mich keineswegs einbringen, weil Paula ganz von alleine redete. Eine Sprachnachricht hätte es im Grunde auch getan. Ich hätte mein Handy auch einfach beiseite legen und währenddessen ein spannendes Buch lesen können. Nach jeder zehnten Seite hätte ich ein murmelndes »Mhm« und »Ahh« und jede fünfzehnte ein ergriffenes »Wirklich?!« einwerfen können und wäre fein raus gewesen. Natürlich tat ich das nicht. Ich war schließlich ein braves Mädchen. Ich hörte ihr zu.
»Stell dir vor. Heute in der Früh ist Manfred zu mir gekommen und meinte, es täte ihm leid, aber wir hätten die nächsten drei Monate Urlaubssperre. Ich meine dreeeeiiii Monateeee! Und überhaupt, was soll denn das?! Bin ich etwa dafür verantwortlich, dass die Umsätze nicht so laufen, wie sie sollten? Ja, wohl wirklich nicht! Was kann ich