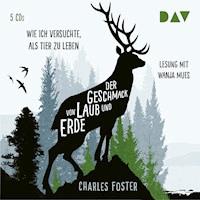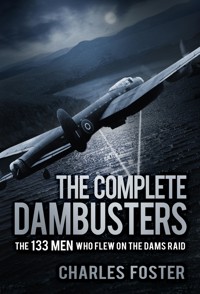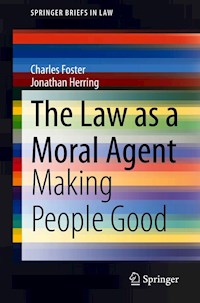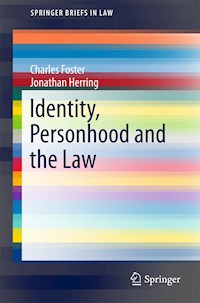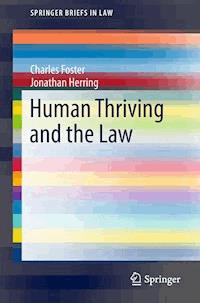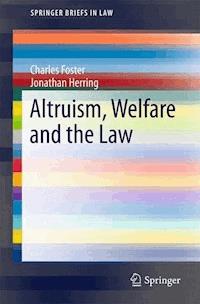9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Was fühlt ein Tier, wie lebt es und wie nimmt es seine Umwelt wahr? Um das herauszufinden, tritt Charles Foster ein faszinierendes Experiment an. Er schlüpft in die Rolle von fünf verschiedenen Tierarten: Dachs, Otter, Fuchs, Rothirsch und Mauersegler. Er haust in einem Bau unter der Erde, schnappt mit den Zähnen nach Fischen in einem Fluss und durchstöbert Mülltonnen auf der Suche nach Nahrung. Er schärft seine Sinne, wird zum nachtaktiven Lebewesen, beschreibt wie ein Weinkenner die unterschiedlichen »Terroirs« von Würmern und wie sich der Duft der Erde in den verschiedenen Jahreszeiten verändert. In die scharfsinnige und witzige Schilderung seiner skurrilen Erfahrungen lässt er wissenswerte Fakten einfließen und stellt sie in den Kontext philosophischer Themen. Letztendlich geht es dabei auch um die eine Frage: Was es bedeutet, Mensch zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Englischen von Gerlinde Schermer-Rauwolf und Robert A. Weiß, Kollektiv Druck-Reif
ISBN 978-3-492-95876-9
Januar 2017
© Charles Foster, 2016
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Being a Beast« bei Profile Books Ltd, London, 2016.
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2017
Redaktion: Regina Carstensen, München
Der Verlag dankt für die freundliche Genehmigung zum Abdruck des Zitates zu Beginn aus: »Tiere essen« von Jonathan Safran Foer; aus dem amerikanischen Englisch von Isabel Bogdan, Ingo Herzke und Brigitte Jakobeit; © 2010, Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Köln/Germany; Titel der Originalausgabe:»Eating Animals«; © Jonathan Safran Foer, 2009
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaasbuchgestaltung.de mit einer Illustration von Peter Dyer.
Vorlagen © iStock
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Für meinen Vater,
der nie ohne ein totgefahrenes Tier in der Plastiktüte nach Hause kam,
der mir das Formalin und die Glasaugen bezahlte
und den ich liebe und ehre
Zu fragen: »Was ist ein Tier?« – man könnte hinzufügen: einem Kind eine Geschichte über einen Hund vorzulesen oderTierrechte zu unterstützen –, rührt unweigerlich daran, woher wir das Verständnis beziehen, dass wir Menschen sind und keine Tiere. Es führt zu der Frage: »Was ist ein Mensch?«
Jonathan Safran Foer, Tiere essen
Vorbemerkung des Autors
Ich wollte wissen, wie es ist, ein Wildtier zu sein.
Möglicherweise kann man das erfahren. Die Neurowissenschaften helfen uns dabei, und ein bisschen Philosophie und eine Menge Lyrik von John Clare tun das Ihre dazu. Aber vor allem muss man den Stammbaum der Evolution gefährlich weit hinunterklettern, bis in ein Loch in einem walisischen Hügel und unter die Steine eines Flusses in Devon, man muss etwas über Schwerelosigkeit lernen, über die Gestalt des Windes, über Langeweile, Mulch in der Nase und das Zittern und Knacken sterbender Wesen.
Im Allgemeinen hieß Schreiben über die Natur, dass Menschen, die wie Kolonialherren durch die Welt stolzierten, schilderten, was sie aus 1,80 Meter Höhe sahen, oder dass Menschen so taten, als würden Tiere Kleider tragen. Dieses Buch ist ein Versuch, die Welt aus dem Blickwinkel unbekleideter walisischer Dachse, Londoner Füchse, Otter im Exmoor, von Mauerseglern aus Oxford und Rothirschen in Schottland und Südwestengland wahrzunehmen; zu lernen, wie es sich anfühlt, sich schlurfend oder gleitend durch Landschaften zu bewegen, die vor allem von Gerüchen und Geräuschen und weniger von visuellen Eindrücken geprägt sind. Es war der Versuch eines literarischen Schamanismus, und es hat sagenhaften Spaß gemacht.
Wenn wir einen Wald betreten, teilen wir die sensorischen Reize, die er bietet (Licht, Farbe, Geruch, Klang etc.), mit allen anderen Geschöpfen, die sich dort aufhalten. Aber würde auch nur eines von ihnen diesen Wald anhand unserer Beschreibungen wiedererkennen? Jedes Lebewesen erschafft in seinem Gehirn eine andere Welt. Es lebt in dieser Welt. Wir sind von Millionen unterschiedlicher Welten umgeben. Sie zu erforschen ist eine aufregende neurowissenschaftliche und literarische Herausforderung.
In den Neurowissenschaften hat es in letzter Zeit beträchtliche Fortschritte gegeben. Wir wissen oder können aufgrund der Arbeiten über ähnliche Spezies intelligent schlussfolgern, was in der Nase und den für den Geruchssinn zuständigen Gehirnregionen eines Dachses vorgeht, wenn er durch den Wald streift. Aber das literarische Abenteuer steckt noch in den Anfängen. Es ist eine Sache zu beschreiben, welche Hirnregionen eines Dachses in einem Kernspintomografen aufleuchten, wenn er eine Nacktschnecke riecht. Eine völlig andere ist es jedoch, das Bild eines ganzen Waldes zu malen, wie er sich dem Dachs darstellt.
Traditionelle Naturschilderungen kranken an zwei Fehlern: Anthropozentrismus und Anthropomorphismus. Die Anthropozentristen beschreiben die Natur, wie Menschen sie wahrnehmen. Da sie Bücher für Menschen schreiben, mag das in kommerzieller Hinsicht recht clever sein. Aber es ist ziemlich langweilig. Für die Anthropomorphisten sind Tiere einfach Menschen in anderer Gestalt: Sie stecken sie in echte (etwa Beatrix Potter) oder metaphorische Kleider (so Henry Williamson) und statten sie mit menschlichen Sinnesorganen aus.
Ich habe versucht, beide Fehler zu vermeiden, und natürlich ist es mir misslungen.
Wenn ich eine Landschaft beschreibe, wie ein Dachs, ein Fuchs, ein Otter, ein Rothirsch oder ein Mauersegler sie wahrnimmt, bediene ich mich zweier Methoden. Erstens vertiefe ich mich in die relevante physiologische Literatur und finde heraus, was man aus dem Labor über die Funktionsweise dieser Tiere weiß. Zweitens tauche ich in ihre Welt ein. Wenn ich ein Dachs bin, hause ich unter der Erde und esse Regenwürmer. Wenn ich ein Otter bin, versuche ich, im Wasser mit den Zähnen Fische zu fangen.
Bei der Beschreibung der physiologischen Erkenntnisse muss man die Aufgabe meistern, nicht langweilig zu sein oder in einen unverständlichen Fachjargon zu verfallen. Bei der Beschreibung, wie es ist, Regenwürmer zu essen, gilt es zu vermeiden, dass man als schrullig und lächerlich abgetan wird.
Die den Tieren zur Verfügung stehenden Sinnesorgane geben ihnen eine viel, viel größere Farbpalette an die Hand, mit der sie das Bild des Landes malen, als sie irgendein menschlicher Künstler je besaß. Dass die Tiere so eng mit dem Land verbunden sind, verleiht ihnen eine weitaus größere Autorität, als selbst ein Farmer sie beanspruchen kann, dessen Vorfahren hier schon seit dem Neolithikum die Scholle bestellen.
Das Buch ist anhand der vier klassischen Elemente aufgebaut, jedes wird durch ein, die Erde durch zwei Tiere repräsentiert: Für die Erde buddeln sich Dachse durch den Untergrund, und der Rothirsch galoppiert darüber hinweg; der Stadtfuchs, der helles Licht kennt, steht für das Feuer; der Otter für das Wasser; und für die Luft der Mauersegler, dieser ultimative Himmelsbewohner, der auf seinen Schwingen schläft, sich nachts von thermischen Strömungen in die Höhe schrauben lässt und kaum je landet. Hinter dieser Aufteilung steht die Vorstellung, dass etwas Alchemistisches passiert, wenn man die vier Elemente im richtigen Verhältnis mischt.
Kapitel 1 gibt einen Einblick in die Probleme meines Herangehens. Es versucht, einige davon durch Vorwegnahme aus der Welt zu schaffen. Wenn Sie keine Probleme sehen, überblättern Sie das Kapitel, und begeben Sie sich ohne Umweg in den Dachsbau von Kapitel 2.
Kapitel 2 handelt von Dachsen. Es spielt in den Black Mountains von Wales, wo ich viele Wochen zu verschiedenen Jahreszeiten verbracht habe. Ich habe etwa anderthalb Monate unter dem Erdboden gehaust, teils in Wales und teils anderswo, allerdings über mehrere Jahre verteilt. Das Kapitel verdichtet diese Aufenthalte auf wenige Wochen und eine Rückkehr und bildet eine Collage aus all diesen Zeitabschnitten.
Es ist ein langes Kapitel, denn es führt in viele Themen und wissenschaftliche Fragen ein, die für die folgenden Kapitel relevant sind – zum Beispiel geht es um die Vorstellung, dass eine Landschaft eher durch Geruchseindrücke als durch visuelle Wahrnehmung konstruiert sein kann. Wegen dieser Ausführungen sind andere Kapitel kürzer, als sie es sonst wären.
Kapitel 3 befasst sich mit Fischottern. Sie sind Wanderer, die weite Strecken zurücklegen, und so sind sie in einem weit größeren Gebiet »daheim« als die anderen Säugetiere in diesem Buch. Sie schlängeln sich die Furchen des Landes entlang; wer ihre Wege kennt, der weiß, wie sich die Erde aufgefaltet hat. Und sie leben in verdünnten Lösungen dieser Erde. Wie auch wir, obwohl wir es normalerweise nicht so sehen. Ihre und unsere Vorfahren kamen aus dem Wasser, und die Otter kehrten später wieder dorthin zurück. Allerdings nicht ganz. Was mir den Zugang zu ihnen leichter macht als zu Fischen.
Dieses Kapitel spielt im Exmoor, wo ich einen großen Teil des Jahres verbringe. Es erstreckt sich über ein weites Gebiet, wie es Ottern entspricht, aber die Ausgangspunkte bilden East Lyn River und Badgworthy Water sowie deren Zuflüsse aus dem Hochmoor und die Nordküste von Devon, in die sich der East Lyn River ergießt.
Kapitel 4 betrachtet den Stadtmenschen mit Nase, Ohren und Augen eines Fuchses.
Es ist im Londoner East End angesiedelt, wo ich viele Jahre gelebt habe. In dieser Zeit streunte ich nachts durch die Straßen und hielt Ausschau nach Fuchsfamilien.
In Kapitel 5 bin ich wieder im Exmoor und in den westlichen Highlands von Schottland, diesmal bei den Rothirschen.
Wir sehen sie vom Auto aus und glauben, wir würden sie besser kennen als die krabbelnden, wühlenden Wesen. Unsere Mythologie unterstützt diese anmaßende Vorstellung und widerspricht ihr zugleich. Gehörnte Götter wandeln anmutig durch unser Unbewusstes. Sie sind groß und sichtbar, aber dennoch Götter und stehlen sich davon, wenn sie uns bemerken.
Viel Zeit meines Lebens habe ich damit zugebracht, dass ich versuchte, Rothirsche zu töten. Dieses Kapitel ist eine andere Art von Jagd – es ist der Versuch, in den Kopf des Hirsches einzudringen anstatt aus zweihundert Meter Entfernung in sein Herz.
Kapitel 6 beschäftigt sich mit Mauerseglern, und der Handlungsort ist die Luft zwischen Oxford und Zentralafrika.
Mauersegler sind mehr als jedes andere Tier Geschöpfe der Lüfte und so schwerelos wie eine mikroskopisch kleine Qualle.
Ich bin von Mauerseglern besessen, seit ich ein kleines Kind war. Wenn ich in meinem Arbeitszimmer in Oxford am Schreibtisch saß, scharrte ein Pärchen in seinem Nest knapp einen Meter über meinem Kopf. Die kreischenden Sommerpartys in unserer Straße wurden genau auf meiner Augenhöhe gefeiert. Ich folgte den Mauerseglern quer durch Europa bis ins westliche Afrika.
Das Kapitel beginnt mit einer Reihe von Fakten, die viele verständlicherweise für umstritten und tendenziös halten. Ja, ich weiß, die Belege für viele dieser Annahmen werden sehr kontrovers diskutiert. Aber haben Sie Geduld mit mir, und lassen Sie uns sehen, wie weit wir damit kommen.
Indem ich mir die Mauersegler vornahm, habe ich mein Scheitern vorprogrammiert. Es war ziemlich dumm. Sie lassen sich nicht ansatzweise in Worte fassen. Man möge es mir als mildernden Umstand für meine Art von Annäherungsversuchen in diesem Kapitel anrechnen.
Im Epilog blicke ich auf meine Reisen in diese fünf Welten zurück. Waren sie vergebliche Liebesmüh? Habe ich etwas anderes beschrieben als das, was sich nur in meinem Kopf abspielte?
Ich hatte darauf gehofft, ein Buch zu schreiben, in dem nichts oder nur wenig von meiner eigenen Person aufscheint. Diese Hoffnung war naiv. Es wurde (viel zu sehr) ein Buch über meine Rückkehr zur Natur, mein Bekenntnis zu meiner vormals ungekannten Wildheit und meine Klage über den Verlust dieser Wildheit. Tut mir leid.
Oxford, Oktober 2015
Zum Tier werden
Ich bin ein Mensch. Jedenfalls insofern, als meine beiden Eltern Menschen waren.
Das hat gewisse Konsequenzen. Beispielsweise kann ich keine Nachkommen mit einer Füchsin zeugen. Damit muss ich mich abfinden.
Aber Artengrenzen sind, wenn nicht illusionär, so doch zumindest vage und manchmal auch durchlässig. Das kann Ihnen jeder Evolutionsbiologe und jeder Schamane bestätigen.
Es ist kaum dreißig Millionen Jahre her – gerade einmal ein sachter Lidschlag in der Existenz unseres Planeten, auf dem sich vor 3,4 Milliarden Jahren Leben entwickelt hat –, dass die Dachse und ich gemeinsame Vorfahren hatten. Gehen wir noch läppische vierzig Millionen Jahre weiter zurück, teile ich meine Ahnentafel nicht nur mit Dachsen, sondern auch mit Silbermöwen.
Alle Tiere, mit denen ich mich in diesem Buch beschäftige, gehören zu unserer näheren Verwandtschaft. Das ist eine Tatsache. Wenn uns unsere Gefühle etwas anderes sagen, liegt das daran, dass sie von Biologie keine Ahnung haben. Hier ist Umerziehung gefragt.
Im Buch Genesis finden sich zwei Schöpfungsgeschichten. Wenn man sie strikt historisch betrachten will, sind sie völlig unvereinbar miteinander. In der ersten Version wird der Mensch als Letztes erschaffen. In der zweiten zuerst. Beide Darstellungen geben jedoch aufschlussreiche Hinweise auf unsere Verwandtschaftsbeziehungen zu den Tieren.
Nach der ersten Schöpfungsgeschichte ist der Mensch zusammen mit allen landlebenden Tieren am sechsten Tag erschaffen worden. Es verbindet uns also einiges durch unsere Herkunft. Wir haben denselben Geburtstag.
Im zweiten Schöpfungsbericht wurden die Tiere eigens geschaffen, um Adam Gesellschaft zu leisten. Allein zu sein tat ihm nicht gut. Doch Gottes Strategie ging nicht auf: Die Gesellschaft der Tiere genügte Adam nicht. Also erschuf Gott Eva, was Adam sehr freute. »Endlich!«, seufzte er. Diesen Seufzer haben wir alle schon einmal ausgestoßen oder hoffen, es eines Tages zu tun. Es gibt Einsamkeit, die eine Katze nicht lindern kann. Allerdings bedeutet das nicht, dass Gottes Plan völlig fehlgeschlagen wäre – dass Tiere als Gefährten des Menschen nicht taugen. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Der Markt für Hundekekse ist riesig.
Adam gab allen Säugetieren und Vögeln Namen – und stellte damit eine Verbindung zu ihnen her, die in die Tiefen seiner und ihrer Existenz reichte. Seine allerersten Worte waren ihre Namen. [Auch wenn sich die ersten überlieferten Worte Adams in Genesis 2,23 finden, heißt es in Genesis 2,19–20: »Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde; und genau so wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes …«] Wir werden geprägt durch das, was wir sagen, und wie wir Dinge bezeichnen. Also wurde Adam durch seine Interaktion mit den Tieren geprägt. Diese Interaktion und diese Prägung unseres Bewusstseins ist schlicht ein historischer Fakt. Als Spezies sind wir mit Tieren als unseren Kindergärtnern aufgewachsen. Sie brachten uns das Laufen bei, gaben uns Halt, wenn wir, Hand in Huf, dahinwackelten. Und die Bezeichnungen – mit denen Herrschaft einherging – prägten die Tiere ebenfalls. Auch diese Prägung ist eine offensichtliche Tatsache, mit oftmals verheerenden Folgen (zumindest für die Tiere). Mit den Tieren haben wir nicht nur die genetische Herkunft und einen hohen Anteil an DNA gemeinsam, uns verbindet zudem die Geschichte. Wir waren alle auf derselben Schule. So ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass wir einige sprachliche Gemeinsamkeiten haben.
Ein Mensch, der mit seinem Hund redet, weiß um die Durchlässigkeit der Artengrenzen. Er hat den ersten und entscheidendsten Schritt auf dem Weg zum Schamanen getan.
Bis in die jüngste Vergangenheit genügte es den Menschen nicht, Doktor Dolittles zu sein. Ja, sie sprachen zu den Tieren, und die Tiere sprachen zu ihnen. Aber das reichte nicht. Es wurde der Intimität der Beziehung zwischen Mensch und Tier nicht gerecht. Und man konnte zu wenig damit anfangen. Denn manchmal wollten die Tiere ihre kostbaren und überlebenswichtigen Geheimnisse nicht preisgeben, etwa wohin die Herde zog, wenn der Regen ausblieb, oder warum die Vögel das Marschland am Nordende des Sees verlassen hatten. Um diese Informationen zu erlangen, musste man die Realität der gemeinsamen Abstammung auf ekstatische Weise heraufbeschwören. Man musste zum Rhythmus der Trommel um ein Feuer tanzen, bis man so dehydriert war, dass einem das Blut aus den geplatzten Nasenkapillaren schoss, oder singend in einem eiskalten Fluss stehen, bis man spürte, dass einem die Seele wie Erbrochenes in die Kehle stieg, oder Fliegenpilze essen und sich selbst beim Fliegen über das Blätterdach des Waldes zusehen. Dann konnte man die dünne Membran durchstoßen, die diese Welt von anderen Welten und die eigene Spezies von anderen Spezies trennt. Während man sich mühsam zur erleuchtenden Erkenntnis hindurchquälte, umhüllte einen die Membran wie einst die Fruchtblase im Mutterleib. Und man ging als Wolf oder Gnu daraus hervor.
Diese Transformationen sind Gegenstand der frühesten Kunst des Menschen. Im Jungpaläolithikum, als das im Lauf der Evolution entstandene Neuronengestrüpp erstmals von menschlichem Bewusstsein erhellt zu sein schien, kroch der Mensch in kalte Höhlen und begann Therianthropen zu zeichnen – Mischwesen aus Mensch und Tier: Menschen mit Tierköpfen oder Hufen, Tiere mit Menschenhänden und Speeren.
Sogar in den urbanisierten und reglementierten Kulturen Ägyptens und Griechenlands beherrschten Therianthropen die Religion. Die griechischen Götter verwandelten sich ständig in Tiere, um die Sterblichen auszuspähen; die religiöse Kunst Ägyptens ist eine Collage aus menschlichen und tierischen Körperteilen. Und im Hinduismus setzt sich diese Tradition unverkennbar fort. Während ich diese Zeilen schreibe, blickt mich das Abbild des elefantenköpfigen Gottes Ganesha an. Für Millionen Menschen sind die einzigen anbetungswürdigen Götter diejenigen mit einer zwitterhaften Natur: Wesen, die zwischen den Welten pendeln können. Und die Welten werden durch menschliche und tierische Formen repräsentiert. Anscheinend gibt es ein uraltes und tief empfundenes Bedürfnis, die Welt der Menschen und die der Tiere zu vereinen.
Kinder, die noch urtümlicher sind als die Erwachsenen, wissen um dieses Bedürfnis. Sie verkleiden sich als Hunde. Sie malen sich die Gesichter an, damit sie wie Tiger aussehen. Sie nehmen Teddybären mit ins Bett und möchten in ihrem Zimmer Hamster halten. Bevor sie einschlafen, lassen sie sich von ihren Eltern Geschichten über Tiere vorlesen, die wie Menschen sprechen und angezogen sind. Peter Hase und Jemima Pratschel-Watschel sind die neuen schamanischen Therianthropen.
Bei mir war das nicht anders. Ich sehnte mich verzweifelt danach, Tieren nahe zu sein. Teilweise rührte dies daher, dass ich davon überzeugt war, sie wüssten etwas, was ich nicht wusste, was ich aber aus irgendwelchen Gründen unbedingt wissen sollte.
Es gab da eine Amsel in unserem Garten, deren gelb-schwarze Augen so wissend aussahen. Das machte mich ganz verrückt. Sie protzte mit ihrem Wissen, und ich war so ahnungslos. Das Blinzeln dieser Augen war für mich wie ein flüchtiger Blick auf eine zerknitterte Piratenschatzkarte. Ich konnte sehen, dass ein Kreuz eingezeichnet war und eine Stelle markierte. Kein Zweifel: Was da vergraben lag, musste etwas Atemberaubendes sein, das mein Leben verändern würde, wenn ich es fand. Aber ich kam beim besten Willen nicht dahinter, wo dieses Kreuz zu finden war.
Ich probierte alles aus, was mir und jedem, den ich fragte, nur einfiel. Ich hatte buchstäblich »einen Vogel«. Stunden über Stunden saß ich in der örtlichen Bücherei, las jeden Absatz, in dem Amseln erwähnt wurden, und machte mir dazu Notizen in einem Schulheft. Ich kartografierte die Nester in der Umgebung (vor allem in vorstädtischen Ligustergehölzen) und suchte sie täglich auf, ausgerüstet mit einem Hocker, um mich draufzustellen und hineinzuspähen. Sämtliche Vorkommnisse hielt ich minutiös in einem zweckentfremdeten Ausgabenbuch fest. In meinem Zimmer hatte ich eine Schublade voller Amseleierschalen. Morgens schnupperte ich daran, weil ich in den Kopf eines Nestlings vordringen wollte, damit ich an diesem Tag etwas amselartiger aufwuchs, und abends, weil ich hoffte, in meinen Träumen als Amsel geboren zu werden. Ich besaß mehrere getrocknete Amselzungen, die ich überfahrenen Tieren mit der Pinzette entfernt und auf Wattebäusche in Streichholzschachteln gelegt hatte. Tierpräparation war meine zweite große Leidenschaft: Über meinem Bett kreisten, an Drähten von der Decke hängend, Amseln mit ausgebreiteten Flügeln; einige ihrer Artgenossen lugten ziemlich deformiert von Sitzstangen aus Sperrholz herab. Neben meinem Bett bewahrte ich ein in Formalin eingelegtes Amselhirn auf. Immer wieder drehte ich das Glas hin und her, versuchte, mich in dieses Hirn hineinzudenken, und hielt es oft noch in der Hand, wenn ich einschlief.
Aber es funktionierte nicht. Die Amsel entzog sich mir ein ums andere Mal. Ihre verlockende Rätselhaftigkeit ist eines der großen Vermächtnisse meiner Kindheit. Hätte ich auch nur einen Moment lang geglaubt, ich hätte das Mysterium gelöst, wäre das eine Katastrophe gewesen. Womöglich wäre ich dann Ölarbeiter oder Banker oder Zuhälter geworden. Wer in jungen Jahren zu der Überzeugung gelangt, etwas vollkommen beherrschen oder geistig durchdringen zu können, wird später ein Monster. Diese geheimnisvollen Amseln halten mein Ego auch heute noch im Zaum und beglücken mich mit der Erkenntnis, wie unzugänglich alle Geschöpfe sind – und vielleicht besonders der Mensch.
Was aber nicht heißt, dass wir es nicht besser machen können als ich damals mit den Amseln. O ja, das geht durchaus.
Für mich steht völlig außer Frage, dass durch Schamanismus eine echte Verwandlung möglich ist. Tatsächlich habe ich es selbst erlebt: Ich könnte Ihnen dazu eine Geschichte über eine Rabenkrähe erzählen, aber davon ein andermal mehr. Allerdings ist diese Methode beschwerlich und für mich auch schlicht zu beängstigend, als dass ich sie regelmäßig anwenden würde. Und was dabei herauskommt, ist so bizarr, dass es die meisten wenig ansprechend finden. Es mag eine Menge Gründe dafür geben, warum man ein Buch über das Dasein als Dachs liest, das jemand geschrieben hat, der in seinem Wohnzimmer halluzinogene Drogen genommen und geglaubt hat, sich in einen Dachs zu verwandeln. Aber das Bedürfnis, mehr über Dachse oder Laubwälder zu erfahren, steht dabei wohl nicht im Vordergrund.
Ebenso verhält es sich mit dem Quasischamanismus von J. A. Baker, von dessen gefeiertem Werk »Der Wanderfalke« man sagen könnte, es leiste für eine Spezies das, was ich hier für fünf versuche. Baker folgte seinen Wanderfalken bis zu dem Punkt, da er mit ihnen eins wurde. Sein ausdrückliches Ziel war es, sich selbst aufzulösen. »Wohin er (der Wanderfalke) diesen Winter auch gehen mag, ich werde ihm folgen. Ich werde die Furcht und Freude seines Jagens teilen, und auch die Langeweile. Ich werde ihm folgen, bis meine bedrohliche Menschengestalt das wirbelnde Kaleidoskop, das die Sehgrube seiner glänzenden Augen füllt, nicht mehr in Angst verdunkeln lässt. Mein heidnischer Kopf soll im Winterlandboden versinken, auf dass er rein werde.«
Wenn man Baker Glauben schenken kann, hat es funktioniert. Er ertappte sich dabei, wie er unbewusst die Bewegungen eines Falken nachahmte, und seine Pronomina wechseln von »ich« zu »wir«: »In diesen Tagen im Freien leben wir dasselbe rauschhafte, angsterfüllte Leben.«
Niemand bewundert Baker mehr als ich. Aber sein Weg ist nicht der meine. Er kann es nicht sein: Ich bin nicht so tief verzweifelt und unglücklich wie er und teile weder seine Sehnsucht nach Selbstauflösung noch seine Überzeugung, dass eine genickbrechende und Jungtiere ausweidende ruchlose Natur eine Moral verkörpert, die besser ist als alles, was der Mensch ersinnen oder woran er sich orientieren kann. Zudem ist die Selbstauflösung als literarisches Mittel eine ziemlich heikle Angelegenheit. Wenn J. A. Baker wirklich verschwindet, wer erzählt dann die Geschichte? Und wenn nicht, warum sollten wir die Geschichte dann ernst nehmen? Wie Robert Macfarlane bemerkte, versuchte Baker, dem Problem mit der Entwicklung einer neuen Sprache beizukommen: Flügellose Substantive stürzen und gleiten, erdhöhlenbewohnende Verben trudeln am Rand der Atmosphäre, Adverbien benehmen sich abscheulich. Ich liebe diese Fremdartigkeit, aber sie lehrt mich mehr über Sprache als über Wanderfalken. Und stets bleibt die Frage: Wer spricht hier? Ein Wanderfalke, der in Cambridge studiert hat? Oder ein zum Wanderfalken mutierter Baker? Weil wir das nie genau wissen, funktioniert die Methode nicht so recht. Es liegt in der Natur der Dichtkunst, dass sie ihren Urheber nie ganz offenbart.
Sieht man von schamanischer Transformation ab, wird immer eine Grenze zwischen mir und meinen Tieren bestehen bleiben. Also bekennt man sich am besten gleich dazu und versucht, den Grenzverlauf möglichst exakt zu beschreiben – und sei es nur um der Stimmigkeit willen. Es mag ziemlich prosaisch wirken, wenn man von jeder Passage des vorliegenden Buchs sagen kann: »Hier schreibt Charles Foster über ein Tier« anstelle von: »Das könnte die mystische Äußerung eines Dachsmenschen sein«, aber es schafft doch weitaus mehr Klarheit.
Meine Vorgehensweise besteht daher schlicht darin, mich so nahe wie möglich an die Grenze vorzuwagen und mit allem, was mir an Hilfsmitteln zur Verfügung steht, ins unbekannte Terrain hinüberzuspähen. Dieser Prozess unterscheidet sich grundlegend von reiner Beobachtung. Der klassische Beobachter hockt mit seinem Fernglas in einem Versteck und schert sich nicht um Anaximanders schwindelerregende Frage: »Was sieht ein Falke?«, ganz zu schweigen von der modernen, weiter gefassten neurobiologischen Variante dieser Frage: »Welche Art von Welt konstruiert ein Falke, indem sein Gehirn die Reize seiner Sinnesrezeptoren verarbeitet und sie vor dem Hintergrund seiner genetischen Prägung und individueller Erfahrung interpretiert?« Diese Fragen stelle ich mir.
An zwei Punkten kommen wir der Grenze erstaunlich nahe. Dort habe ich meine Beobachtungsstationen eingerichtet. Und diese Punkte heißen Physiologie und Landschaft.
Physiologie: Aufgrund unserer engen evolutionären Verwandtschaft bin ich, zumindest im Hinblick auf die Reihe von Sinnesrezeptoren, mit denen wir alle ausgestattet sind, den meisten Tieren in diesem Buch ziemlich nahe. Und wenn nicht, lassen sich die Unterschiede für gewöhnlich beschreiben und (annähernd) messen.
Beispielsweise benutzen sowohl Säugetiere wie ich als auch Vögel Golgi-Sehnenorgane, Ruffini-Körperchen und Muskelspindeln, um die räumliche Lage ihrer verschiedenen Körperteile zu bestimmen, und freie Nervenenden, die uns »Scheußlich!« oder »Heiß!« zuschreien. Die Art und Weise, wie ich diese sensorischen Rohdaten sammle und übertrage, ist der der meisten Säugetiere und Vögel sehr ähnlich.
Wenn wir die Verteilung und die Dichte der verschiedenen Rezeptortypen betrachten, können wir herausfinden, welche Art von Input das Gehirn in welchem Umfang erhält. Sehen wir uns den Austernfischer an, der seinen Schnabel phallusartig in den Sand stößt, wenn er nach Pierwürmern sucht. Seine Schnabelränder besitzen eine große Anzahl von Merkel-Zellen, Herbst-Körperchen, Grandry’schen Körperchen, Ruffini-Körperchen und freien Nervenenden. Bei seinem Gestocher sendet er Stoßwellen im feuchten Sand aus, und sein Netzwerk aus Rezeptoren liest wie ein Sonar aus den zurückgeworfenen Signalen Unregelmäßigkeiten heraus, die auf die Anwesenheit eines Wurms hindeuten können. Manche Rezeptoren nehmen sogar feinste Vibrationen wahr und erkennen es, wenn die Härchen des Wurms an der Wand seiner Wohnröhre kratzen. Was dem in der menschlichen Erlebenswelt am nächsten kommt, ist Sex. Ein sehr stichhaltiges Argument gegen Vorhautbeschneidung lautet, dass man dadurch weniger von einem Austernfischer hat. Denn beim Mann hat das Innere der Penisvorhaut eine ähnlich hohe Konzentration an Merkel-Zellen und anderen Rezeptoren, die beim Geschlechtsverkehr massiv stimuliert werden (die Eichel hingegen hat kaum etwas anderes als freie Nervenenden, die durch jahrzehntelange Selbstbefleckung und das Tragen zu enger Hosen oft regelrecht abgenutzt sind). Was die bloße Intensität des Signals betrifft, ist die Jagd der Watvögel auf Gezeitenwürmer eine wahre Wonne. Es ist, als würde man im Zustand höchster Erregung durch die Lebensmittelgänge des Supermarkts schlendern – und schier einen Orgasmus bekommen, wenn man endlich das gewünschte Frühstücksmüsli erblickt.
Nur ist es nicht so. Weil all das im Zentralnervensystem passiert. Wird die Großhirnrinde zerstört, hat sogar der wollüstigste Pornodarsteller nie wieder einen Orgasmus. Es stimmt nicht, dass Männer das Hirn in der Hose haben. Sogar beim hirnlosesten Triebtäter findet Sex immer nur im Kopf statt. Und ein Austernfischer hat eben immer nur Pierwürmer im Kopf.
Das ist mein Problem: die merkwürdige Umwandlung eines Reizimpulses in eine Handlung oder eine Wahrnehmung. Das Universum, in dem ich lebe, habe ich in meinem Kopf erschaffen. Es ist ein absolutes Unikat. Der Vorgang, Vertrautheit herzustellen, bedeutet, dass man besser darin wird, jemanden in dieses Universum einzuladen, damit er oder sie sich darin umsehen kann. Das Gefühl der Einsamkeit ist das vernichtende Eingeständnis, dass, auch wenn man noch so gut darin wird, Leute in sein Universum einzuladen, niemand sonderlich viel darin vorfinden wird.
Trotzdem müssen wir es weiter versuchen. Wenn wir bei den Menschen aufgeben, werden wir elende Misanthropen. Wenn wir bei der Natur aufgeben, werden wir elende Umgehungsstraßenbauer oder Dachsjäger oder selbstbezogene Stadtmenschen.
Wir können etwas dagegen tun. Ich habe eine Menge Bücher über Physiologie gelesen und versucht, somatotopische Bilder von meinen Tieren zu malen – Bilder, auf denen die Teile des Körpers in der Größe dargestellt sind, die der Größe der zugehörigen Hirnregionen entspricht. Menschen bekommen dann riesige Hände, Gesichter und Genitalien, aber einen spindeldürren, kümmerlichen Torso. Mäuse wiederum haben gewaltige Schneidezähne, wie die eines Säbelzahntigers in den schlimmsten Albträumen eines Höhlenmenschen, große Füße und Schnurrhaare wie Wasserschläuche.
Bei somatotopischen Bildern ist allerdings Vorsicht geboten: Sie verraten uns nichts darüber, auf welche Art und Weise die Reize verarbeitet werden und welche Reaktionen daraus folgen. Wir erfahren nur, dass eine Menge Hardware an die Schnurrhaare gekoppelt ist – nicht, dass eine Maus in einer Welt lebt, die sie hauptsächlich mit ihren Schnurrhaaren wahrnimmt. Dennoch sind diese Bilder ein guter Einstieg.
Wir können behutsame Parallelen dazu ziehen, wie wir selbst in bestimmten Situationen reagieren.
Sicher, letztlich kommt es auf die Reizverarbeitung an, doch wenn ein Fuchs und ich auf ein Stück Stacheldraht treten, gibt es guten Grund zu der Annahme, dass wir beide etwas Ähnliches »erleben«. Die Anführungszeichen sind hier wichtig, was den Fuchs betrifft; darauf werde ich noch eingehen. Fürs Erste will ich damit nur sagen, dass die Schmerzrezeptoren im Fuß des Fuchses und in meinem Fuß auf mehr oder weniger identische Weise anspringen und elektronische Impulse auf mehr oder weniger identischen Bahnen ans periphere und ans zentrale Nervensystem schicken, wo das Gehirn sie verarbeitet und in beiden Fällen Befehle an unsere Muskeln schickt mit dem Inhalt: »Nehmt den Fuß von diesem Draht« – sofern das nicht bereits durch einen Reflex geschehen ist. Die Verarbeitung im Gehirn impft uns beiden, dem Fuchs und mir, die Erkenntnis ein: »Tritt nicht auf Stacheldraht, das ist unangenehm«; dies wird zu einer Erfahrung, die wir tatsächlich beide gemacht haben. Sie ist uns auf die neurologisch gleiche Weise zuteilgeworden: Wir wissen beide, wie es sich anfühlt, auf Stacheldraht zu treten, was andere Menschen und Tiere, deren Fuß noch nie Bekanntschaft mit Stacheldraht gemacht hat, nicht wissen. Ich gehe davon aus, dass es viele neurologische Prozesse gibt, von denen man mit gewissem Recht behaupten kann, dass sie bei mir und einem Tier gleich ablaufen. Wenn ein Wind durch das Tal weht, in dem wir beide uns aufhalten, empfinden wir das beide ähnlich. Es kann (und wird) jedoch für jeden von uns etwas anderes bedeuten: Für den Fuchs ist es vielleicht ein Indikator, dass im Wald neben den Ahornbäumen wahrscheinlich Hasen äsen; für mich lautet die primäre Botschaft womöglich, dass es kälter wird und ich eine Lage mehr anziehen muss. Was allerdings nicht heißt, dass wir nicht beide das Gleiche gespürt hätten. Denn das haben wir. Und die Unterschiede in der Bedeutung können wir uns durch Beobachtung herleiten.
Wir Menschen neigen dazu, unsere sensorischen Fähigkeiten kleinzureden und davon auszugehen, alle Wildtiere seien in diesen unzivilisierten Dingen besser als wir. Vermutlich liegt das daran, dass wir unser trostlos unsinnliches Städterdasein vor uns selbst rechtfertigen wollen (»Ich muss in einem Haus mit Zentralheizung wohnen und mir mein Essen in Dosen besorgen, weil ich nie auf einem Baum leben und Eichhörnchen fangen könnte«) und dass wir unsere vermeintliche kognitive Überlegenheit gegenüber Tieren herauskehren wollen (»Sie haben einen feineren Gehör- und Geruchssinn als ich, weil ich mich über solche elementaren Stammhirnfunktionen hinausentwickelt habe. Ich brauche keinen Geruchssinn: Ich kann stattdessen denken, und das ist weitaus nützlicher«). In Wirklichkeit stehen wir aber gar nicht so schlecht da. Kleine Kinder können oft Geräusche mit einer Frequenz von mehr als zwanzigtausend Hertz hören. Da liegen sie nicht allzu weit hinter dem Hund zurück (üblicherweise vierzigtausend Hertz), sind viel besser als die Krickente (maximal zweitausend Hertz) und die meisten Fische (im Allgemeinen kaum über fünfhundert Hertz). Und in den tiefen Frequenzbereichen schneiden wir besser ab als die meisten kleinen Säugetiere. Was ein guter Grund ist – sofern es noch eines weiteren Grundes bedarf –, nicht in Nachtklubs zu gehen. Sogar unser Geruchssinn, den wir normalerweise für schwer zivilisationsgeschädigt halten, ist (bei den meisten Menschen) erstaunlich unversehrt. Und nützlich. Drei Viertel aller Leute können aus drei T-Shirts das eine herausfinden, das sie selbst getragen haben. Mehr als die Hälfte erkennt dieses T-Shirt sogar unter zehn vorgelegten Teilen. Ob es uns gefällt oder nicht, wir sind sensorisch multimodale Tiere, denen durchaus zuzutrauen ist, dass sie einiges von dem mitbekommen, was ihren Cousins in Wald und Flur durch Licht, Luft und Schall zugetragen wird.
Außerdem verfügen wir über eine Reihe von Vorteilen. Da wäre etwa der kognitive Vorteil, der uns hilft, unsere Wahrnehmungsfähigkeit und unsere physiologischen Unterschiede gegenüber Tieren zu berücksichtigen. Das wiederum ermöglicht uns zu beschreiben, in welcher Hinsicht wir uns unterscheiden beziehungsweise ähneln. Aber es gibt noch mehr Gründe, warum ein Mensch die bessere Wahl für das Schreiben dieses Buchs ist, als es beispielsweise ein Erdmännchen wäre. Physiologisch betrachtet, sind wir Menschen gute Generalisten – eine Folge unserer Allesfressernatur. Ein Erdmännchen wäre zu sehr olfaktorisch orientiert, um einen glaubwürdigen Autor abzugeben. Zudem haben wir die Perspektive. Als meine Vorfahrin in der ostafrikanischen Savanne sich zum ersten Mal auf die Hinterbeine stellte, war das nicht nur eine Reise, die sie ein paar Dutzend Zentimeter weiter brachte. Ihr eröffnete sich eine neue Welt. Von einem Moment auf den anderen wurde sie zu einem Geschöpf, dessen Welt nicht mehr durch das hochgewachsene Gras und den verkrusteten Erdboden begrenzt war, sondern sich bis zum fernen Horizont und zu den Sternen erstreckte. Plötzlich wurde die Schöpfungsgeschichte wahr: Meine Vorfahrin besaß die visuelle Herrschaft über alles, was da kreuchte und fleuchte. Sie sah Tiere anders als die Tiere sie: Sie schauten zu ihr auf, und sie schaute gezwungenermaßen auf sie herab. Dabei sah sie ihre Spuren und wie sich ihre Wege im Busch kreuzten, was die Tiere so nicht erkennen konnten. Sie sah ihre Rücken, die Umstände und Gegebenheiten, die ihr Leben bestimmten. In mancherlei Hinsicht konnte sie die Tiere deutlicher sehen als die Tiere sich selbst. Das war schlicht eine Folge der Bipedie. Und der massive Zuwachs ihrer kognitiven Fähigkeiten (unabhängig davon, ob sich diese damals oder erst später entwickelten) trieb diese Entwicklung exponentiell voran.
Ausgefeilte kognitive Techniken ermöglichen uns (zu Hause in unserer gemütlichen Höhle, nicht draußen in der bedrohlichen Welt der Pfeile, Hörner und Hufe, wo man normalerweise nur eine einzige Chance bekommt) die Generierung und Prüfung zahlreicher Hypothesen mit einer Vielzahl an Variablen darüber, was die Gnus nächste Woche tun werden. Das erfordert nicht wenig an Programmierleistung und Hardwarekapazität. Aber wir machen es die ganze Zeit – es heißt »Denken«. Das bedeutet, dass der jagende Mensch wahrscheinlich eine genauere Vorstellung davon hat, was die Gnus nächsten Dienstag tun werden, als die Gnus selbst. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass ein erfolgreicher Speerwurf den Anscheinsbeweis dafür liefert, dass der Jäger das Tier besser kennt als es sich selbst. Und meine Vorfahren waren enorm erfolgreiche Jäger.
Mit den kognitiven Fähigkeiten (allerdings nicht allein durch die Rohdatenverarbeitung) kommt die Theory of Mind ins Spiel, das Vermögen, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen, und zwar wahrscheinlich nicht auf dem Weg rationaler Analyse wie bei der Frage: »Was werden die Gnus nächste Woche tun?« Bei Frauen ist die Theory of Mind ausgeprägter als bei Männern, was sie zu freundlicheren Menschen macht – die weniger dazu neigen, Kriege vom Zaun zu brechen oder egozentrische Monologe am Esstisch zu führen.
Es spricht nichts dafür, die Theory of Mind darauf zu reduzieren, dass man die Überlegung anstellt: »Wie fühlt es sich an, in jemandes Haut zu stecken?« Denn ebenso gut kann man sich fragen: »Wie fühlt es sich an, in jemandes Fell, Gefieder oder Schuppenpanzer zu stecken?« Allgemein gesagt, bezeichnet sie die Fähigkeit zu erfassen, wie Dinge miteinander vernetzt sind, die auch den Tauchstuhl hervorgebracht und die Scheiterhaufen der Hexenjäger im Mittelalter hat brennen lassen. Es ist wenig verwunderlich, dass die Kirche mehr Hexen als Hexenmeister verbrannt hat oder dass Hexen häufiger nachgesagt wurde, sie hätten vertrauten Umgang mit Tieren und könnten ohne Weiteres in deren Haut – oder Fell – schlüpfen. Eine hoch entwickelte Theory of Mind führt in letzter Konsequenz zu schamanischer Transformation. Wenn man sich in den Kopf einer anderen Spezies hineindenken kann, vermag man sich auch in ihren Körper hineinzuversetzen, und am Ende sieht man Federn an seinen Armen sprießen oder Klauen aus den Händen wachsen.
Da die Schamanen in Jägerkulturen eine wesentliche Rolle beim Aufspüren und Töten von Tieren spielen, führt dies zu einem inneren Konflikt, der nur durch echte Trauer und aufwendige Rituale gelöst werden kann. Alle zivilisierten Jäger, die durch die gleiche Theory of Mind, die uns mit unseren Kindern mitfühlen lässt, an ihre Beute gebunden sind, betrauern deren Tod. Dies nicht zu tun ist gefährlich, besagt eine alte Weisheit, und die alte Weisheit stimmt. Der Planet, wenn nicht seine gehörnten Götter, wird die Umweltzerstörung, wie wir sie derzeit betreiben, streng ahnden.
Ich habe mein Gewehr an den Nagel gehängt und halte mich jetzt lieber an Tofu, doch es gab eine Zeit, als ich schwer bewaffnet durch Wälder und über Berge kroch. Während ich das hier tippe, blicken afrikanische Antilopen vorwurfsvoll auf meinen Laptop herab. Alljährlich im Oktober nahm ich einen Zug nach Norden und pirschte mich in den schottischen Northwest Highlands an Rotwild heran. Ich war von einer genozidalen Leidenschaft für Rehe in Somerset und Wildgeflügel in den Salzmarschen von Kent besessen. Wenn ich Hasen nachstellte, fungierte meine Frau als Gewehrauflage. Als meine Tochter zehn Jahre alt war, kaufte ich ihr eine Schrotflinte Kaliber 36. Ich ging mit Beagles auf Drückjagd, ritt neben Foxhounds und Hetzhunden und schrieb eine monatliche Kolumne in der Shooting Times. Mein Name findet sich in goldgeprägten Jagdbüchern, die in hübschen Landsitzen ausliegen. Auf einem Foto sieht man mich lächelnd neben Unmengen toter Ringeltauben in Lincolnshire stehen. Ganze Nächte habe ich mit dem Angeln von Lachsforellen in Kintyre zugebracht, und ich beherrsche noch immer die Wurftechnik des Spey Casting, die ich erlernte, als ich am oberen Dee Jagd auf Atlantischen Lachs machte. Ich singe im Pub Jagdlieder wie »Dido, Bendigo«, und zwar in dem Tonfall, wie ich es von der Rydal Hound Show her kenne, wo ich es zum ersten Mal gehört habe. Und noch immer gehe ich zur Game Fair und streichle wollüstig über Gewehrschäfte aus Walnussholz.
All das ist mir peinlich, und vieles davon bereue ich. Meine Seele ist dadurch abgestumpft und schwielig geworden, und viele dieser Schwielen sind erst nach langer Zeit wieder verschwunden. Aber ich habe auch viel gelernt. Ich habe gelernt, zu kriechen und still und reglos zu verharren. Ich lag in Argyllshire drei Stunden lang in einem Bach, während mir das Wasser beim Kragen hinein- und bei der Hose herauslief. Ich saß in einem Wald in Bulgarien und schaute den Bremsen dabei zu, wie sie sich darum drängelten, welche mich als Nächste in die Hand stechen durfte. In einem Fluss in Namibia beobachtete ich, wie sich die Blutegel von meinen Fußknöcheln in Richtung Unterleib hinaufschlängelten. So manchen Tag in den Marschen habe ich knapp über dem Boden, auf Augenhöhe von Stockenten, begonnen. Ich weiß, wie die Schatten zweier Ahornzweige im Winter im Küstenflachland der Somerset Levels tanzen und warum die Aale den Fluss Isle verlassen und durchs Feuchtgebiet zu einem Drainagekanal bei Isle Abbots wandern, und ich kann zwei Rehböcke, die in der Nähe von Ilminster leben, anhand des unterschiedlichen Geruchs ihrer Losung voneinander unterscheiden.
Es hat mir meine Sinne zurückgegeben: Ein Mann, der ein Gewehr trägt, sieht, hört, riecht und erahnt viel mehr als einer, der mit einem Vogelbestimmungsbuch und einem Fernglas ausgerüstet ist. Es ist, als würde der Tod oder der mögliche Tod eines Tiers tief in uns einen Schalter aus grauer Vorzeit umlegen. Nur wenn der Tod in der Luft liegt, fühlen wir uns wirklich lebendig. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass in der Zeit, bevor wir mit Hochgeschwindigkeitswaffen auf harmlose Pflanzenfresser losgingen, das Jagen häufig mit erheblicher Gefahr für Leib und Leben des Jägers einherging und daher jede Nervenzelle auf Hochtouren arbeiten musste, um das physische Überleben des Jägers zu sichern. Ein anderer Grund könnte sein, dass der Tod unsere einzige über jeden Zweifel erhabene Gemeinsamkeit mit Tieren ist; vielleicht ist das erste, berauschende Resultat dieser vollkommenen Wechselseitigkeit, dass wir die Welt wahrnehmen können, wie es unsere Beute tut. Manchmal fühlt es sich an, als hätte man zwei Nervensysteme im Körper, die ekstatisch parallel pulsieren – das eigene und das des angepirschten Hirsches.
Beim Jagen wird das Rad der Evolution und der Entwicklungsgeschichte zurückgedreht: Wir erhalten die Sinne unserer Vorfahren zurück, und das sind die Sinne unserer Kinder. Wenn man es Kindern erlaubt, sind sie alle ständig auf der Jagd. Die meinen sind unentwegt damit beschäftigt, irgendwelche Fährten zu verfolgen, Dinge zu beschnuppern oder Steine umzudrehen, und erweisen sich als regelrechte Hellseher beim Aufstöbern der gesuchten Tiere. Mein ältester Sohn ist jetzt acht und hat bei uns den Spitznamen »Kleiner Krötenfänger-Tommy«. Wenn wir ihn zu einem Feld bringen, wo er bisher noch nie war, schaut er sich einen Moment lang um und marschiert dann schnurstracks – vielleicht zweihundert Meter weit – zu einem Stein, den er aufhebt. Und darunter sitzt eine Kröte. Wenn man ihn fragt, wie er das macht, sagt er: »Ich weiß es einfach.« Vor ein paar Tausend Jahren wäre er mit dieser Gabe entweder ein Märtyrer geworden oder dick und reich und angesehen und hätte sich alle Ehefrauen nehmen können, die er wollte. Falls dieses Talent auf genetischer Veranlagung beruht, wäre das Merkmal nachdrücklich selektiert worden. Was hierbei zweifellos der Fall ist. Die Gabe schlummert auch in so manchem Versicherungsmathematiker. Sie wurde durch die natürliche Selektion so stark gefördert, wie dies für die Fähigkeit, Bilanzen zu lesen, niemals der Fall war oder je der Fall sein wird. Und sie kann sogar bei den unglückseligsten Büromenschen wiederbelebt werden.
Wir sind Jäger. Wir können genauso Dinge aus der Welt der Tiere jagen, wie wir einst Jagd auf ihre Pelze gemacht haben – und zwar mit exakt denselben Fähigkeiten.
Allerdings ist unsere glorreiche kognitive Gabe bei dieser Jagd nicht immer hilfreich. Sie bringt es beispielsweise mit sich, dass ich sowohl Langeweile als auch Interesse in einer Art und Weise empfinde, die dem Fuchs vermutlich fremd ist.
Füchse liegen tagsüber gern draußen, für gewöhnlich zusammengerollt an einem geschützten Platz, in einem Zustand zwischen Dösen und Wachheit. Für mein Fuchs-Kapitel habe ich das ebenfalls getan. Meine Füchse waren in der Innenstadt zu Hause, also legte ich mich ohne Essen und Trinken im Londoner Stadtteil Bow in einen Hinterhof, entleerte Blase und Darm dort, wo ich war, wartete auf die Nacht und verhielt mich gegenüber den menschlichen Wesen in den Reihenhäusern ringsum feindselig – was mir nicht schwerfiel.
Es war ein nutzbringender Tag: Er lehrte mich etwas über das Leben als Fuchs. Doch das meiste, was mir durch den Kopf ging, waren keine Fuchsgedanken. Mich faszinierte der Anblick der Ameisen, deren Leben sich direkt vor meinen Augen abspielte, während ich bäuchlings auf den Steinplatten lag. Unablässig kreisten meine Gedanken darum, welche Beziehungen sie untereinander unterhielten und wie sie wohl kommunizierten. Das tun Füchse vermutlich nicht. Ich fragte mich, ob ich Kurkuma aus dem indischen Kartoffel-Curry-Gericht herausroch, dessen Duft über den Zaun herüberwehte; ein Fuchs würde wohl einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass es in diesem Haus Essen gab, und sich vornehmen, später vielleicht die Mülltonne zu durchsuchen. Außerdem langweilte ich mich – ich sehnte mich geradezu nach Zerstreuung, und dabei wäre mir fast alles willkommen gewesen: ein Buch, ein Gespräch, eine Intrige.
Auch Tiere können sich langweilen. Zumindest relativ: Ein auf den Rücksitz eines Autos verbannter Hund würde lieber draußen herumtollen und Hasen nachjagen. Aber ich bezweifle, dass der Stress vollkommener Ereignislosigkeit für sie genauso enervierend ist wie für mich. Vielleicht kennen sie solchen Stress auch gar nicht. Vielleicht ist in ihrer Wahrnehmung ständig die Möglichkeit präsent, dass sie sterben, sich paaren oder etwas zu fressen finden könnten, was ihrem Dasein an den langen durchwachten Tagen Würze verleiht. Während ich in London E3 in meinem eigenen Kot lag, erschienen mir diese Möglichkeiten mal mehr, mal weniger realistisch, und das war die Hölle.
Um die Frage des Bewusstseins habe ich mich bis jetzt gedrückt. Was natürlich daran liegt, dass ich – wie alle anderen auch – keine Ahnung habe, wie ich damit umgehen soll. Bei so gut wie jedem Buch über tierische Wahrnehmung scheinen sich die Worte des amerikanischen Philosophen Thomas Nagel als Motto geradezu aufzudrängen: »Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?« Das ist ein ironisch gemeintes Zitat, denn Nagel wollte damit auf die unüberwindlichen Probleme hinweisen, die das Schreiben von Büchern mit sich bringt, in denen vermeintliche Wahrheiten über das Bewusstsein nichtmenschlicher Wesen formuliert werden. Erstens: Oftmals wissen wir schlichtweg nicht, ob eine bestimmte Spezies ein Bewusstsein hat (oder ob bestimmte Angehörige einer bestimmten Spezies ein Bewusstsein haben – könnte es nicht sprechende, selbstreflexive Tiere und zugleich nichtsprechende Tiere geben, wie in den »Chroniken von Narnia«?). Und zweitens (was Nagels Hauptargument war): Man kann nicht sagen, Bewusstsein »ist wie« etwas. Daher verbietet sich ein Erforschen durch Vergleiche, und das Ergründen mithilfe von Metaphern ist schwierig.
Bewusstsein bedeutet Subjektivität: mein Gefühl, dass es einen Charles Foster gibt, der etwas anderes als andere Wesen ist. Und auch etwas anderes als mein Körper. Der Charles Foster, von dessen Existenz ich ziemlich fest überzeugt bin, bin ich, und zwar auf eine Art und Weise, wie das für meinen Körper nicht gilt. Eine Menge Zellen, die derzeit meinen Körper ausmachen, haben letzte Woche noch nicht existiert und werden nächste Woche tot sein, und trotzdem sage ich heute, Charles Foster ist letzte Woche auf einen Berg in Somerset gestiegen und wird nächste Woche in Athen sein. Wenn ich das sage, meine ich im Grunde, dass es ein essenzielles Ich gibt, das in meinem Körper wohnt. Es klingt verdächtig danach, als würde ich von meiner Seele sprechen.
Niemand hat auch nur die leiseste Ahnung von den Ursprüngen des Bewusstseins. Nach Ansicht der Reduktionisten ist es ein Artefakt meiner neurologischen Hardware – eine Art Substanz, die mein Gehirn absondert. Aber es hat noch niemand überzeugend darlegen können, wie es überhaupt zu seiner Entstehung kam oder warum es danach durch die natürliche Selektion begünstigt wurde.
Wir finden den Fingerabdruck des Bewusstseins in der Urgeschichte des Menschen: Allem Anschein nach ist es irgendwann im Jungpaläolithikum entstanden, wie die damals explosionsartige Verbreitung von Symbolik zeigt – von Dingen, die uns entgegenschreien: »Ich und nicht du.«
Ende der Leseprobe