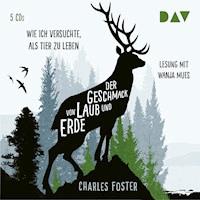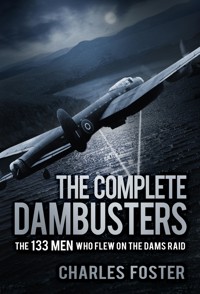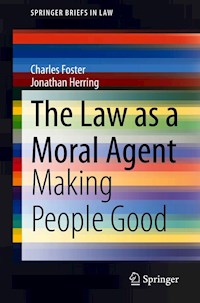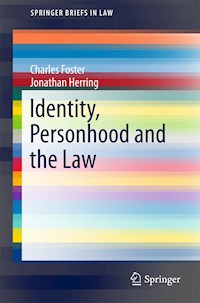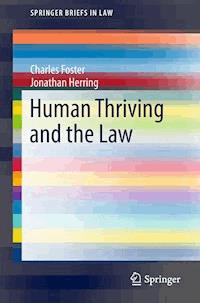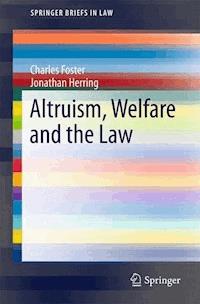14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spannender Selbstversuch und faszinierende Zeitreise in die Vergangenheit – »Überwältigend!« The Observer Leben wie unsere Vorfahren: Charles Foster, vielgereister Abenteurer und Philosoph, will ergründen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Dazu lässt er sich auf ein außergewöhnliches Experiment ein und erprobt drei Phasen der Menschwerdung. Er beginnt seinen Selbstversuch zusammen mit seinem Sohn in einem Wald in Derbyshire, wo er in die Welt der Jäger und Sammler eintaucht, die untrennbar mit der nicht-menschlichen Welt verknüpft war. Die beiden bauen sich einen Unterschlupf, jagen und schärfen ihre Sinne; machen körperliche, mentale und spirituelle Erfahrungen. Fosters Zeitreise führt ihn dann zu den Anfängen der Sesshaftigkeit: zu den ersten Siedlern, die Tiere zähmten, Pflanzen züchteten und deren Lebensweise zunehmend durch feste Bauten, Mauern, Zäune und eine wachsende Entfremdung von der Natur bestimmt wurde. Und schließlich in die Aufklärung, in der rationales Denken regierte, die Dinge ihre Seele verloren hatten und Mensch und Natur komplett voneinander getrennt existierten. »Ein wunderbares, wildes, spektakuläres Buch. Wenn man es gelesen hat, fühlt man sich noch mal mehr als Mensch.« Literary Review Dieses exzentrische Experiment, erhellend und witzig zugleich, führt in Moore und Bauernhöfe, Flechtwerkhütten, Schlachthöfe und Höhlen, an Strände, in mittelalterliche Speisesäle, zu verlassenen Städten des Nahen Ostens und Schamanen-Karawanen. Fosters Naturbeschreibungen, sein detailliertes anthropologisches und historisches Wissen und seine philosophischen Gedankengänge erhellen, regen zum Nachdenken an und werfen existenzielle Fragen auf. – Eine experimentelle und spannende Reise in die Vergangenheit: durch 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Das Buch wurde schon vor Erscheinen ausgezeichnet als »A New Statesman Essential Non-Fiction Book 2021«. »Foster ist ein fantastischer Autor und ein fesselnder Begleiter bei der Lektüre dieses außergewöhnlichen, total verrückten Buchs.« The Observer »Kontrovers und dennoch absolut einleuchtend« Nature
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.malik.de
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Jagen, sammeln, sesshaft werden« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gern vergleichbare Bücher.
Für meinen geliebten Vater und meine geliebte Mutter.
Hoffentlich finden wir eine gemeinsame Sprache, damit wir uns über das großartige Abenteuer unterhalten können, Mensch zu sein.
Ich suche das Gesicht nur, das ich hatte
Vor Erschaffung der Welt.
W. B. Yeats[1]
Aus dem Englischen von Gerlinde Schermer-Rauwolf und Robert A. Weiß, Kollektiv Druck-Reif
© Charles Foster, 2021
Illustrationen: © Geoff Taylor, 2021
Titel der englischen Originalausgabe: »Being a Human.
Adventures in 40,000 Years of Consciousness«, Profile Books, London 2021
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Antje Steinhäuser, München
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Covermotiv: akg-images (»Südamerikanischer Urwald«, Farblithographie, 1911. Aus der Serie: Adolf Lehmanns geographische Charakterbilder); Adobe Stock; Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Stimmen zum Buch
»Überwältigend!« The Observer
»Ein wunderbares, wildes, spektakuläres Buch. Wenn man es gelesen hat, fühlt man sich noch mal mehr als Mensch.« Literary Review
»Kontrovers und dennoch absolut einleuchtend.« Nature
»Fosters mutige und fantasievolle Erkundung […] ist genau das, was wir brauchen.« Times Literary Supplement
»Foster ist selbstironisch, feministisch, und er hat großen Respekt vor dem, was die Natur uns lehren kann.« Irish Times
»Foster ist ein fantastischer Autor und ein fesselnder Begleiter bei der Lektüre dieses außergewöhnlichen, total verrückten Buchs.« The Observer
»Foster ist ein wunderbarer Stilist und sein kraftvolles Buch eine bemerkenswerte Leistung.« Publishers Weekly
»[Charles Fosters neues Buch] ist eine brillante und originelle Entdeckungsreise in unsere wunderbare, zerbrechliche Natur.« David G. Haskell, Autor von »Das verborgene Leben des Waldes«
»Charles Foster hat ein Buch von enormer Intelligenz geschaffen. […] Er nähert sich dem Verständnis dessen, wie die Reise der Menschheit verlief, von einer neuen Warte. Seine Entdeckungen und die metaphorische Kraft seiner Sprache sind überwältigend.« Carl Safina, Autor von »Die Intelligenz der Tiere«
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorbemerkung des Autors
Teil 1: Jungpaläolithikum
Winter
Frühling
Sommer
Herbst
Teil 2: Neolithikum
Winter
Frühling
Sommer
Herbst
Teil 3: Aufklärung
Epilog
Dank
Lektürevorschläge
Anmerkungen
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Vorbemerkung des Autors
Nur wenige von uns haben eine Vorstellung davon, was für Geschöpfe wir sind.
Aber wenn wir nicht wissen, was wir sind, wie können wir dann wissen, wie wir handeln sollen? Wie können wir wissen, was uns wirklich glücklich macht, was uns weiterbringt? Dieses Buch ist mein Versuch herauszufinden, was Menschen sind. Das ist mir ein dringendes Anliegen, denn egal, was meine Kinder behaupten – ich bin ein Mensch.
Und wenn ich wüsste, woher ich komme, so meine Überlegung, könnte ich vielleicht etwas klarer erkennen, wer ich bin.
Ich kann nicht in der ganzen Menschheitsgeschichte zu Hause sein. Es gelingt mir nicht einmal in meiner eigenen Zeit. Also habe ich versucht, in drei bedeutsamen Epochen heimisch und mit den Gefühlen, den Orten und den Gedanken vertraut zu werden, die für sie charakteristisch waren. Es war ein ausgedehntes Experiment, sowohl gedanklich als auch in der Praxis, und es fand in Wäldern, auf dem Wasser, in Moorlandschaften, Schulen und Schlachthöfen, in Flechtwerkhütten und Krankenhäusern, auf Flüssen, Friedhöfen und Bauernhöfen, in Höhlen, Küchen, Krähenkörpern und Museen, an Stränden, in Laboratorien, mittelalterlichen Speisesälen und baskischen Kneipen, bei Fuchsjagden, in Tempeln, in verlassenen Städten des Nahen Ostens und bei Schamanen-Karawanen statt.
Die erste dieser Zeiten ist das frühe Jungpaläolithikum, also die jüngere Altsteinzeit (vor etwa 35 000 – 40 000 Jahren), als das »moderne Verhalten«, auch »kulturelle Modernität« genannt, entstand. Der Begriff ist allerdings problematisch. Wie wir noch sehen werden, unterscheidet sich das Verhalten der heutigen Menschen (auch wenn sie nicht denken oder empfinden) grundlegend von dem der Jäger und Sammler im frühen Jungpaläolithikum. Was »modernes Verhalten« ausmacht und wo es sich entwickelte, ist heftig umstritten, für meine Zwecke ist diese Debatte jedoch unerheblich[2].
Jäger und Sammler waren Nomaden – und die wenigen, die überlebt haben, sind es teils noch heute –, aufs Innigste, in ehrfürchtiger und oft ekstatischer Weise mit dem Land und vielen Geschöpfen verbunden. Sie lebten lang und relativ verschont von Krankheiten, auch gibt es kaum Hinweise auf zwischenmenschliche Gewalt. Für die meisten war Sesshaftigkeit keine Alternative, aber selbst wenn sie diese Option gehabt hätten, wäre sie nicht sonderlich attraktiv gewesen. Warum soll man sein Leben lang an trockenem Zwieback nagen, wenn man sich an einem riesigen, saftigen und überaus abwechslungsreichen Büfett bedienen kann?
Es war unüblich, mehr als eine Feuersteinklinge und einen Beutel aus dem Hodensack eines Rentiers zu haben. Wenn man so viel über die Vergänglichkeit der Dinge wusste wie jene Menschen, waren Besitzansprüche lächerlich: Die Welt ist kein Ort, den man besitzen kann, und sie fanden damals (anders als wir), dass sich Menschen nicht im Widerspruch zur Beschaffenheit der Welt verhalten sollten.
Es war eine Zeit der Muße. Man kann nicht Tag und Nacht jagen oder sammeln. Daher, denke ich, war es eine Zeit der Besinnung, der Geschichten und der Versuche, sich Dinge zu erklären. Die älteste von Menschen geschaffene Kunst auf den Höhlenwänden in Südeuropa zählt zum Besten, was es je gab. Sie ist die anspielungsreichste und zugleich die am wenigsten konkrete.
Auf den Einwand, das sei die romantische Verklärung des edlen Wilden, entgegne ich vorerst nur, dass »romantisch« in meinen Augen kein Schimpfwort ist. Ganz im Gegenteil. Romantiker berücksichtigen bei ihrer Konstruktion der Welt einfach mehr Daten als ihre Gegenspieler.
Die zweite Periode ist das Neolithikum, die Jungsteinzeit, von der man allgemein annimmt, dass sie etwa vor 10 000 – 12 000 Jahren begonnen hat und bis zum Beginn der Bronzezeit – vor circa 5300 Jahren – dauerte. Die Chronologie ist strittig, und die Übergänge zwischen den einzelnen Phasen variieren je nach Region erheblich; und natürlich sind die verschiedenen Epochen nicht klar voneinander getrennt.[3]
Einige Jäger und Sammler lebten eine gewisse Zeit des Jahres sesshaft und zogen ansonsten weiter umher. Zweifellos begannen sie, lange bevor sie systematisch Ackerbau betrieben, das Land zu bewirtschaften – vielleicht indem sie Bäume pflanzten, deren Früchte sie gern aßen. Aber schließlich wurde die Aufspaltung sehr konkret. Die Nomaden hörten auf herumzuziehen. Ihre geografische Welt wurde kleiner. Sie mussten nicht mehr so ungeheuer viele Arten kennen und sich ihnen gegenüber entsprechend verhalten. Es reichte – und irgendwann musste es reichen –, wenn sie gerade mal die Kuh (einen gezähmten und abgestumpften Auerochsen[4]) auf der Wiese hinter der Hütte und eine spezielle Art von Gras mit großen Samen kannten. Und dann dauerte es nicht lang – nur ein paar Tausend Jahre –, bis alles, einschließlich der Menschen, gezähmt und abgestumpft war. Auch das Verhältnis zur Natur hatte sich gewandelt, es war nicht mehr von allumfassender Ehrfurcht und Abhängigkeit geprägt, stattdessen kontrollierte man ein paar Quadratmeter und ein paar Arten.
Doch auch wenn die Neolithiker in ihrer Überheblichkeit meinten, die Kontrolle zu haben, war die Wirklichkeit eine andere. Denn zunehmend gerieten die Menschen unter Kontrolle. Sie mussten in ihren Siedlungen bleiben, weil sie ja die Ernte einbringen mussten. Sesshaftigkeit ging mit Politik, Hierarchien und menschengemachten Gesetzen einher. Die Lebenserwartung verkürzte sich. Seuchen grassierten. Durch das anstrengende Mahlen und Heben verformten sich ihre Knochen. Die Sklavenhalter von Schweinen und Schnitter des Getreides wurden selbst versklavt und dahingemäht. Der Kreislauf der Jahreszeiten, der sie einst angetrieben hatte, hielt sie nun auf ihrer Scholle fest, und das Gesetz von Angebot und Nachfrage machte sie nicht reich, sondern tyrannisierte sie. Muße gab es keine mehr. Am Ende holt die Hybris jeden ein: Fragen Sie nur irgendeinen Griechen. Die großen Erzählungen des Jungpaläolithikums wurden kodifiziert und in das von Priestern kontrollierte Korsett der Geschichten von Stonehenge gezwängt. Doch Kodifizierung und Einengung ersticken den Geist. Die Gedanken wurden ebenso eingezäunt wie die Schafe. Wir sehen diese Beschränktheit in der Kunst, die im Neolithikum unbeholfener und weniger nuanciert und plastisch ist als zuvor im Jungpaläolithikum. Im Neolithikum fingen wir an, langweilig und armselig zu werden.
Die letzte Epoche, in der wir uns trotz eines gewissen beherzten Widerstands immer noch befinden, wird ironischerweise als Aufklärung bezeichnet. In der Aufklärung wurde die im Neolithikum begonnene Revolution fortgeführt und systematisiert, das im Neolithikum zwischen Mensch und Natur eingeleitete Scheidungsverfahren abgeschlossen. Die Schriften von Descartes waren der Scheidungsbeschluss, Rechtskraft erlangte das Scheidungsurteil durch die Unterschrift von Kant. Die Folge war eine systematische Entseelung des Universums. Bis dahin war alles (und ja, sogar in den abrahamitischen monotheistischen Religionen) in gewisser Weise beseelt gewesen. Aristoteles hatte auf dieser Sicht bestanden, die orthodoxe Kirche hatte sie keinen Moment infrage gestellt, Thomas von Aquin hatte sie für die Katholiken kanonisiert, die Kabbalisten hatten sie katalogisiert und die Sufis getanzt.
Doch die Aufklärung sprach der nicht-menschlichen Welt jegliche Seele ab. Nun war das Universum eine Maschine, die nicht von einem Körpern innewohnenden Wesenskern, sondern von Naturgesetzen regiert wurde. Und Gesetze sind so viel uninteressanter als Wesenskerne.
Aber da der Beginn der Aufklärung eine Revolution in den christlichen Köpfen auslöste, durften die Menschen ihre Seele noch eine Weile behalten. Jedoch nicht lange: Schon bald waren auch wir nur noch Räderwerke in einer Maschine. Die Parole »Stürmt die Maschinen« zeigt ein sehr genaues Verständnis von dem, was seit dem 17. Jahrhundert passiert ist.[5]
Darwin hätte die Katastrophe vielleicht ein bisschen abmildern können. Er hat uns daran erinnert, dass wir Teil der Natur sind – die zentrale Erkenntnis des Jungpaläolithikums. Richtig gehandhabt hätte das eine entsprechende Demut erzeugen können. Doch dieser Teil von Darwins Botschaft wurde weitgehend in einen zynischen und gefährlichen Reduktionismus umgedeutet. Man verstand ihn (fälschlicherweise) so, als seien die Menschen nichts als »Rädchen im Getriebe«: als existiere nichts außer Materie, sodass nichts bedeutsam sei. Das führte nicht nur zu einem geringen Selbstwertgefühl, es war auch die Handlungsanweisung für mutwillige Umweltzerstörung. Mochte es auch falsch sein, etwas zu töten, das eine Seele hatte, so war es doch offensichtlich nichts Unmoralisches, eine Maschine zu zertrümmern.
Folgte man dieser Logik, konnte man den Menschen als Homo economicus betrachten (was bestens zur darwinistischen Feststellung passte, dass Wettbewerb der Treibstoff für den Motor der Welt sei). Dabei war der Mensch doch seit Langem und immer wieder ein Homo deus gewesen. Bei archäologischen Funden ist einer der deutlichsten Indikatoren für kulturell moderne Menschen (und ganz gewiss der nachdrücklichste und bestimmendste) deren Religion. Wenn Sie bei Ihrer Ausgrabung auf eindeutige Hinweise für religiöse Praktiken stoßen, haben Sie es mit Relikten sich modern verhaltender Menschen zu tun.[6]
Doch nun gab es keinen Gott mehr, nur noch Materie. Und auch wir bestanden nur noch aus Materie. Die Natur war – so wie wir – blutrünstig und brutal, konnte aber wie ein Zirkuslöwe sehr nützlich sein, falls es gelang, sie zu zähmen. In dieser Welt zählte nur noch der wirtschaftliche Wert. Statt der komplexen, uralten, herzzerreißend schönen natürlichen Gemeinschaften gab es nun natürliche Ressourcen. Inzwischen ist diese Betrachtungsweise selbst im Diskurs von Naturschützern so geläufig geworden, dass wir uns nicht mehr daran stören. Warum soll uraltes Weideland erhalten werden? Wir hören folgende Antwort: Weil man seinen Wert in Dollar bemessen kann.
Da sich der Reduktionismus der Aufklärung mit seinen Metastasen so tief in die lebenswichtigen Organe unserer Kultur gefressen hat, liegt die größte Hoffnung für uns wahrscheinlich in der Aufklärung selbst. Denn in ihrem ursprünglichen Manifest waren Skepsis und rigorose Empirie zentrale Punkte. In den Zitadellen der heutigen Aufklärung – etwa den Büros der Versicherungsmathematiker oder den meisten biologischen Forschungslaboren – ist beides nicht vorhanden. Aber Skepsis und Empirie können und müssen uns helfen, uns wieder verzaubern zu lassen. Wenn wir alles hinlänglich skeptisch betrachten und empirisch untersuchen (sei es ein Stern, ein Baby oder ein Plastikbecher), werden wir erkennen, dass es verblüffend, rätselhaft und aufregend eigenartig ist und sich all unseren Kategorien entzieht – und eine sowohl poetische als auch mathematische und emotionale und auch physische Reaktion erfordert. Richtig eingesetzt enthüllen Skepsis und Empirie das schwindelerregende Wunder der Welt – ein Wunder, das all unsere Ressourcen, unsere gesamten intellektuellen und sensorischen und, ja, auch spirituellen Fähigkeiten erfordert, um es zu erforschen.
Es handelt sich hier also nicht um ein anti-aufklärerisches Traktat, im Gegenteil. Es ist ein Plädoyer dafür, gründlich und ernsthaft im Sinne der Aufklärung zu handeln, so wie es im 18. Jahrhundert ihrer eigentlichen Zielsetzung entsprach. Es ist also der Versuch, die Aufklärung aus den Klauen ihrer selbst ernannten Hohepriester – der wissenschaftlichen Fundamentalisten – zu befreien und furchtlos und unvoreingenommen die Welt der Natur und die der Menschen in den Blick zu nehmen. Geschieht das, dann verbindet sie sich mit Niels Bohr (der bewiesen hat, dass Unbestimmtheit kein Versagen der Wissenschaft ist, sondern Teil des Stoffs, aus dem das Universum besteht), Werner Heisenberg (der wusste, dass wissenschaftliche Objektivität unmöglich ist, weil die Beziehung zwischen Beobachter und dem Beobachteten jede Beobachtung beeinflusst) und den schamanischen Malern des Jungpaläolithikums (die genau wie Darwin wussten, dass die Grenze zwischen Menschen und Nicht-Menschen fließend ist) zu einem lebendigen wissenschaftlichen Mystizismus. Wenn sich die Wissenschaft mit ihrem real existierenden Forschungsgegenstand richtig auseinandersetzt, anstatt nur neurotisch die eigenen Annahmen zu bestätigen, wird sie zu einer epischen und mystischen Berufung, denn alles Existierende ist episch und das Reale geheimnisvoll.
Materiell gesehen sind wir reicher denn je und haben viel materielles Ungemach aus der Welt geschafft. Dennoch ist da dieses ontologische Unwohlsein. Wir spüren, dass wir bedeutsame Wesen sind, haben aber nicht die Mittel, diese Bedeutsamkeit zu beschreiben. Die meisten von uns lehnen einen krassen Fundamentalismus ab – sowohl den religiösen als auch den säkularen –, der uns auf die Frage »Warum lebe ich?« mit einfachen und billigen Antworten abspeist. Kein Jäger des Jungpaläolithikums hätte beim Blick in den Himmel die Götter herabgewürdigt, indem er sich einbildete, man könnte sie in das enge Korsett eines konservativen Protestantismus pressen.
Wir sind geradezu lächerlich schlecht an unser gegenwärtiges Leben angepasst. Bei einem einzigen Frühstück essen wir so viel Zucker wie ein Mann im Jungpaläolithikum in einem Jahr, und dann wundern wir uns über Diabetes oder dass unsere Herzkranzgefäße verstopfen und wir vor lauter unverbrauchter Energie verspannt sind. Wir gehen in einem Jahr nicht weiter als ein Jäger im Jungpaläolithikum an einem Tag und wundern uns über unsere schlaffen Körper. Gehirne, die auf ständige Wachsamkeit gegenüber Wölfen ausgelegt sind, beschäftigen wir mit Fernsehen und wundern uns dann über ein nagendes Gefühl der Unzufriedenheit. Wir lassen uns bereitwillig von selbstsüchtigen Soziopathen regieren, die im Wald nicht einen Tag überleben würden, und fragen uns, warum unsere Gesellschaften in solch erbärmlichem Zustand sind und unser Selbstwertgefühl so gering ist. Wir, die wir in Familien und Gemeinschaften von maximal 150 Menschen am besten funktionieren, entscheiden uns für ein Leben in riesigen Konglomeraten und sind befremdet ob unserer Entfremdung. Unsere Verdauung ist auf Bio-Beeren, Bio-Elch und Bio-Pilze ausgelegt, und dann sind wir erstaunt, wenn sie bei Pestiziden und Herbiziden rebelliert? Wir sind Warmblüter und fragen uns, warum unser ganzer Stoffwechsel verrücktspielt, wenn wir die Thermoregulation unseren Gebäuden überlassen? Als Geschöpfe der Wildnis sind wir für den ständigen ekstatischen Austausch mit Himmel und Erde, Bäumen und Göttern geschaffen und wundern uns, dass uns ein Leben, in dem wir zu bloßen Maschinen erklärt werden und das wir in zentral beheizten, elektrisch beleuchteten Gewächshäusern verbringen, suboptimal erscheint? Unsere Gehirne sind – und zwar mit ziemlichem Aufwand – auf das Zusammenspiel von Beziehungen hin angelegt und ausgebaut worden. Natürlich sind wir in einer ökonomischen Struktur unglücklich, die auf der Annahme gründet, wir seien abgeschottete Inseln, die nichts miteinander zu tun hätten und nicht ineinander übergehen sollten. Wir sind Menschen, die Geschichten brauchen wie die Luft zum Atmen – deren einzige verbliebene Erzählung jedoch die trostlose und erniedrigende Dialektik des freien Markts ist.
Die obigen Beobachtungen über den Zustand der Welt sind trivial. Weniger trivial ist, was sie mit den letzten 40 000 Jahren der Menschheitsgeschichte zu tun haben.
Dieses Buch schildert eine Reise. Sie führt in die Vergangenheit und ist der Versuch, herauszufinden, was Menschen sind: Was ist das Selbst? Und was hat die Vergangenheit mit dem zu tun, was wir jetzt sind? Es ist der Versuch eines Mannes, diese Verbindung tatsächlich zu spüren, und erzählt die Geschichte, wie ich versuchte, mich in einen Jäger und Sammler, in einen Bauern und in einen reduktionistischen Aufklärer zu verwandeln – all das in dem verzweifelten Bemühen herauszufinden, was ich bin, wie ich leben sollte und welche Form Bewusstsein annimmt, wenn es in einen menschlichen Körper gepresst wird.
Ich glaube, es war die Sache wert. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht.
Wissenschaftliche Bücher über die Vergangenheit beginnen mit Fakten: Ich fange mit Gefühlen an – mit Gefühlen, die entstehen, wenn ich mich so tief, wie ich nur kann, in eine Epoche versenke, oder in einen Wald, eine Idee, einen Fluss.
Schließlich konnten die Menschen in der Vorgeschichte und in der Aufklärung solche Dinge spüren, und wir werden ein besseres Verständnis von diesen Epochen haben, wenn wir uns genauer vorstellen können, um was für Gefühle es sich handelte.
Nichts ist je nur von historischem Interesse, und schon gar nicht das Studium der uns prägenden Jahre. Wobei diese Perioden nicht vorbei sind, sie bestimmen weiterhin über uns. Mir scheint, ich komme mit meinen explizit jungpaläolithischen Freunden am besten aus – mit denen, die nicht wissen, wo sie aufhören und wo der Garten anfängt –, aber die meisten von uns haben, zumindest in den frühen Morgenstunden, ebenfalls Reflexe aus dem Jungpaläolithikum. Unsere Abgestumpftheit und unser Verlangen nach Abgrenzung, Herrschaft und Kontrolle stammen aus dem Neolithikum und verderben uns und alles, was wir berühren. Doch sind unsere neolithischen Anteile nicht alle schlecht. Aus dieser Zeit stammt auch unser Bedürfnis, die Erde zu hegen und zu pflegen. Nur Neolithiker kaufen Vogeltränken und Hunde.
Dieses Buch ist kein Ratgeber. Sie werden darin weder Rezepte für Rentierfrikassee noch Schnittmuster für Beinlinge aus Vogelfellen oder eine Anleitung finden, wie man Feuer in Zunderpilzen transportiert, einen Beilkopf aus Feuerstein an einem Schaft befestigt oder einen Menhir aufrichtet. Auch ist es keine Darstellung eines systematischen Versuchs, das Leben anderer Epochen nachzustellen. Für solche Zwecke gibt es eine Menge anderer Bücher und Websites.
Ich bin weder Archäologe noch Anthropologe, aber ich habe mich bemüht, die Fakten richtig darzustellen (oder sie zumindest nicht zu verfälschen) und den wissenschaftlichen Konsens, wo er besteht, nicht verzerrt wiederzugeben. Einige führende Vertreter der prähistorischen Archäologie und Anthropologie haben sich großzügigerweise mit mir zusammengesetzt, geduldig meine Fragen beantwortet und versucht, Dinge richtigzustellen. Sie werden in der Danksagung aufgeführt. Falls es ihnen nicht gelungen ist, meine Irrtümer auszuräumen, liegt das einzig und allein in meiner Verantwortung. Allerdings gilt es zu bedenken, dass es sehr oft keine »richtige« Antwort auf Fragen zur Vorgeschichte der Menschheit gibt. Vieles bleibt Ansichtssache, und ich habe festgestellt, dass diese Ansichten häufig ebenso sehr vom Temperament oder der persönlichen Geschichte ihrer Protagonisten diktiert waren wie von den konkreten Ausgrabungsfunden. Das trifft natürlich auf die meisten akademischen Fachgebiete zu, ist in der prähistorischen Archäologie aber vielleicht noch deutlicher sichtbar.
Die Gespräche im Kapitel »Aufklärung« sind ausgewählt und zusammengestellt aus vielen, die ich mit vielen Menschen im Verlauf vieler Jahre geführt habe. Man wird den Professor, den Shakespeareaner oder den Physiologen vergeblich in den Kreuzgängen von Oxford suchen. Sie sind dort nicht – oder besser gesagt, sie sind überall. Wie auch Steve, der Pädo, und seine schlachtenden Kumpel, der christliche, neo-neolithische Bauer Giles und der kapitalistische Master der Meute.
An verschiedenen Stellen im Buch treffen wir auf zwei Charaktere aus dem Jungpaläolithikum: einen Mann, den ich X nenne, und seinen Sohn. Ich wurde gefragt, ob sie real sind. Ob ich ihnen wirklich im Wald begegnet bin und sie später tatsächlich immer wieder aufgetaucht sind und trockene, aber wortlose Kommentare abgegeben haben – quasi als wertende Stimme der urwüchsigen, von den Kompromissen der letzten 40 000 Jahre unverdorbenen, frisch in die Welt getretenen Menschen. Oder ob ich sie nur erfunden habe? Worauf ich antworte: Erstens, ich bin mir nicht sicher. Und zweitens: Verflucht, immer dieses Schwarz-Weiß-Denken!
Das Kapitel über das Jungpaläolithikum ist sehr viel länger als das über das Neolithikum, das wiederum um etliches länger als das Kapitel »Aufklärung« ist. Die Diskrepanz ist Absicht. Menschen haben viel länger im Jungpaläolithikum gelebt als im Neolithikum und viel länger im Neolithikum als während der Aufklärung; der jeweilige Beitrag dieser Epochen zu der Art von Tier, das wir heute sind, steht (meiner Meinung nach) ungefähr im Verhältnis zu der in der jeweiligen Periode verbrachten Zeit. Gemessen an der tatsächlichen Länge dieser Epochen ist das neolithische Kapitel sogar noch viel länger, als es sein sollte, und das Kapitel über die Aufklärung ist viel, viel, viel zu lang. Wenn wir davon ausgehen, dass das Jungpaläolithikum vor 40 000 Jahren anfing (und wir das Mesolithikum dazuzählen, was für diesen Zweck vernünftig erscheint), das Neolithikum vor 10 000 Jahren begann und bis vor 5300 Jahren andauerte und die bis heute währende Epoche der Aufklärung vor 300 Jahren startete, dann müsste das Kapitel über das Jungpaläolithikum 86 Prozent des Buches ausmachen, das Kapitel über das Neolithikum etwa 13 Prozent und das über die Aufklärung 0,86 Prozent. Und wenn das Kapitel über die Aufklärung dabei wie eine bloße Coda aussieht, dann deshalb, weil sie das ist. Ich wollte das Hirngespinst der Aufklärung, dass sie der Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte sei, nicht weiter beflügeln.
Es gibt noch andere historische Epochen außer den dreien, die ich hier untersuche. Einige von ihnen sind wirklich ziemlich wichtig. Aber immerhin befasse ich mich mit 35 000 von 40 000 Jahren, ich lasse also nur 5000 Jahre aus – etwa 13 Prozent der Zeit, in der sich der Mensch modern verhalten hat. Aus rein persönlichen Gründen hätte ich liebend gern die außergewöhnliche Zeit um das 5. Jahrhundert v.u.Z. näher erforscht, als mit der Verschriftlichung der jüdischen Tora die Geburtsstunde der großen monotheistischen Religionen schlug und der Mensch die meisten der zeitlosen Fragen der Philosophie formulierte und das Fundament der Naturwissenschaft legte. Doch sosehr mich die Errungenschaften dieser Ära auch beeindrucken, bin ich trotzdem nicht davon überzeugt, dass sie genauso prägend war wie die drei von mir ausgewählten Epochen. Zwar änderte sich damals die Art und Weise, wie wir uns selbst beschreiben, aber wir selbst haben uns nicht substanziell verändert.
Die Kapitel »Jungpaläolithikum« und »Neolithikum« wurden in Jahreszeiten unterteilt, im Gegensatz zur »Aufklärung«. Die Aufklärung kennt keine Jahreszeiten. Jahreszeiten finden in der Natur statt.
Ich bin mir der Ironie bewusst, dass ich ein Buch in menschlicher Sprache verfasse, das den Wert all dessen, was in menschlicher Sprache gesagt oder geschrieben wurde, infrage stellt. Keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll – ich kann nur zugeben, dass es mir peinlich ist.
Und da ich häufig über die Gegenwart von Toten spreche: Sehen Sie darin keine Aufforderung, Kontakt zu den Toten zu suchen. Bitte tun Sie das nicht: Es ist ungeheuer gefährlich.
In dem Buch kritisiere ich oft bitter, wie sich Menschen verhalten und verhalten haben, aber das liegt daran, dass ich Menschen im Grunde für wunderbar halte. Alle. Unser Verhalten ist oft genau deshalb so beschämend, weil unsere wahre Natur wunderbar ist und jedes Leben enorm bedeutend – und wir dem bei Weitem nicht gerecht werden. Wir würdigen uns selbst herab. Wenn ich mich kritisch äußere, dann gehe ich hoffentlich nie über ein Konstatieren und Bedauern dieser Selbst-Herabwürdigung hinaus. Ich hoffe, dass ich nicht den Eindruck mache, wütend zu sein. Ich bin viel eher traurig als wütend – traurig darüber, was möglich gewesen wäre. Aber weitaus aufgeregter als traurig bin ich darüber, was vielleicht noch möglich ist.
Ich untersuche hier nicht, was getan werden muss. Weder bin ich Prophet noch ein Weiser und auch kein Psychiater oder Soziologe. Aber eine fundamentale Freundlichkeit, ein Erwachen und alte Geschichten werden dabei eine Rolle spielen. Jeder Mensch ist eine Scheherazade: Wir sterben jeden Morgen, wenn wir keine gute Geschichte zu erzählen haben, und alle guten Geschichten sind alt. Letztendlich lässt mich die Hybris erschaudern, mit der ich zu bestimmen versuche, was den Menschen ausmacht. Aber zweifellos muss jeder und jede von uns doch den Versuch unternehmen, zumindest für sich selbst zu entscheiden, was er oder sie ist und was wir alle sind.
Teil 1: Jungpaläolithikum
Winter
»[…] ich versuche immer das zu tun, was die Verstorbenen mir sagen […] Wer sind dann die Geister, wir oder unsere Toten?«
Sarah Moss, Geisterwand[7]
»Die größte Lebensgefahr droht aus der Tatsache, dass die menschliche Nahrung ausschließlich aus Seelen besteht. All die Lebewesen, die wir töten und essen müssen, all die, die wir erschlagen und vernichten müssen, um Kleidung herzustellen, haben Seelen, Seelen, die nicht mit dem Körper erlöschen, die daher (versöhnt) werden müssen, damit sie sich nicht an uns dafür rächen, dass wir ihnen ihre Körper fortnehmen.«
Igulikik, ein Inuit-Jäger, gegenüber Knud Rasmussen[8]
Laut Berichten aus ihren Regionen in Amerika, Europa, Afrika und Asien sind die indigenen Völker fast einhellig der Meinung, dass es verboten sei, die heiligen Geschichten im Sommer oder bei Tageslicht zu erzählen, außer zu bestimmten besonderen Anlässen.
Alwyn Rees und Brinley Rees, Celtic Heritage: Ancient Tradition in Ireland and Wales[9]
Auf einem schottischen Berg habe ich erstmals ein lebendes Säugetier gegessen.
Ein paar Tage zuvor stand ich in einem viktorianischen Gerichtssaal im Herzen Londons, trug Pferdehaarperücke, einen steifen Kläppchenkragen, gestärktes Beffchen und eine schwarze Robe und debattierte darüber, wie viel ein geschädigter Uterus wert sei. Danach saß ich im rumpelnden Nachtzug nach Schottland, trank Chianti, wurde an einem Bahnhof in den Highlands ausgespien, per Landrover in ein großes Herrenhaus kutschiert und gezwungen, auf das Bild eines angreifenden Russen zu schießen, ehe man mich, in einen Tweedanzug gekleidet, an einem Berg in die Freiheit entließ.
Sechs Stunden lang stapfte und schlich ich umher und suchte die Gegend ab. Endlich entdeckte ich einen Hirsch, der groß genug war, und befand: »Der gehört mir.« Er stand in einer Bodensenke gleich unterhalb des Gipfels, und es war höllisch schwierig, sich anzupirschen. Der Wind prallte an den Felsen ab, und ich hoffte, hoch genug zu sein, sodass mein Geruch nicht zu ihm hinunterwehte. Ich kroch einen Bachlauf hinauf, wobei mir das Wasser am Kragen hinein- und bei den Socken hinauslief, und lag mehrere Stunden hinter einem Stein auf der Lauer. Näher kam ich allerdings nicht heran. Wenn sich der Hirsch nicht bewegte, hatte ich keine Chance, einen tödlichen Schuss abzugeben.
Ein Rabe verriet mich. Er stieß herunter, erblickte mich und krächzte. Da wusste der Hirsch, dass etwas nicht stimmte, schnupperte nervös und setzte bereits zum Sprung an, um das Weite zu suchen. Jetzt oder nie. Ich hob den Kopf, legte den Sicherungshebel um und drückte ab. Die Kugel traf ihn im Brustkorb.
Das genügte. Hustend stolperte er Richtung Meer, kam jedoch nicht mehr weit.
Der Pirschjäger Jimmy und ich entdeckten ihn zuckend im Heidekraut. Seine Hirnströme waren tot, und sein Herz hatte aufgehört zu schlagen, aber in den meisten seiner Körperzellen war noch Leben. Jimmy zückte ein Messer, bohrte es dem Hirsch in den Bauch und riss die Bauchdecke auf. Wie heiße Schlangen quollen die dampfenden Eingeweide hervor. Jimmy hackte ein Stück Leber ab und reichte es mir.
»Jetzt schmeckt es am besten«, meinte er.
Was erwartete er von mir? Nachdem Jimmy sich ebenfalls ein Stück abgeschnitten und begonnen hatte, darauf herumzukauen, tat ich es ihm gleich. Mein Stück hatte an der einen Seite, die gegen das Zwerchfell gedrückt hatte, eine elegant gewölbte Oberfläche. Tausende Male pro Tag hatte es ein Blasebalg mit der salzigen Luft der Outer Isles nach unten gepresst. Jetzt bewegte es sich wie eine Schnecke, und das Ende einer Röhre schob sich über meine Zunge, und Blut spritzte mir in den Mund.
»Gut, was?«, fragte Jimmy.
»Klasse«, sagte ich und versuchte, mich nicht zu übergeben.
Als wir zum Haus zurückkehrten, hatte ich immer noch Blut im Gesicht. Ich badete, zog mich um und ging zum Dinner. Es gab an jenem Abend sehr edlen Burgunder, und anschließend sang eine schöne Frau zu Klavierbegleitung Schubert-Lieder.
In der darauffolgenden Woche war ich wieder im Gericht und dachte laut darüber nach, welche Relevanz ein Fall aus dem 18. Jahrhundert für einen Kinderarzt im 20. Jahrhundert hatte. Zugleich war ich wie betäubt von der Dissonanz meiner unterschiedlichen Lebensweisen, ich fragte mich, was ich bin, woher ich komme und was zum Teufel ich mit den Antworten auf diese Fragen eigentlich anfangen sollte, wie auch immer sie lauten mochten.
Und dann verfolgte ich die Sache natürlich jahrelang nicht weiter. Die Dissonanz wurde zu einem lästigen, aber nicht sonderlich störenden Tinnitus. Ich fuhr damit fort, zu reisen, zu töten, mich fortzupflanzen, zu salbadern und zu versuchen, andere zu überzeugen, was mir gefährlicherweise manchmal sogar bei mir selbst gelang. Das geschäftige Summen machte es möglich, den Tinnitus zu ignorieren, außer in den frühen Morgenstunden oder in den wenigen beängstigenden Momenten, wenn ich allein war. Doch dann schwoll diese Sache ohne ersichtlichen Anlass an, bis mir fast der Kopf zu platzen drohte, und da wusste ich, dass ich etwas unternehmen musste.
Und zwar musste ich so weit zu den Anfängen meiner Geschichte (und Ihrer Geschichte) zurückgehen, wie ich nur konnte – ich musste den Schritt wagen, die Familie kennenzulernen und die Mächte zu spüren, die mich geformt haben. Aber dabei gibt es Grenzen. Unser Anfang war ein mathematisches Erdbeben, das zu einer Explosion führte – einer Explosion, die zu keiner Zeit stattgefunden hat, denn die Zeit hatte noch gar nicht begonnen, und die zudem nirgendwo geschehen ist, weil der Raum noch gar nicht erfunden war. Wollte man dort anfangen, würde man verrückt werden.
Es wäre auch albern, bei unserer Geschichte einzusteigen, als unsere Vorfahren noch Schwämme im Meer vor dem heutigen Madagaskar waren, oder Spitzmäuse, die zwischen den Beinen des Triceratops herumwuselten, den wir aus dem Londoner Naturkundemuseum kennen. Aber es wäre vielleicht keine so schlechte Idee, vor 40 000 Jahren einzusteigen, als Menschen, deren Körper und Gehirne so neuzeitlich waren wie Ihres und meins (nur besser), in Höhlen und Unterschlüpfen in Derbyshire lebten.
Damals war es kalt. Die Landschaft bestand aus öder, windgepeitschter Tundra, nicht aus dichtem Waldland; das entwickelte sich erst, nachdem das letzte Eis verschwunden war. Die Männer trugen Bärte und langes Haar, das ihnen über die Schulter fiel, doch ihre Körper waren so wenig behaart wie meiner, wenngleich abgehärteter. Ihre Kleidung war aus sorgfältig zugeschnittenen Tierhäuten gefertigt, sie aßen sonntags Braten, liebten ihre Kinder und wollten am Leben bleiben.
Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen ihnen und uns. Sie hatten kein so aufdringliches, tyrannisches Selbstempfinden wie wir. Sofern sie über eine Art von Sprache verfügten (was der Fall war – aber dazu später mehr), verunstalteten sie nicht jeden Satz mit »ich«, »mir« und »meins«.
In der Nähe des Bauernhofs meiner Freundin Sarah im Peak District gibt es einen Wald. Ich glaube, dass damals – als es nur harte Gräser und hie und da ein paar kleine, kümmerliche Bäume gab – einer dieser Männer mit seinem Sohn hier lebte. Ich traue mich nicht, diesem Mann einen modernen Namen zu geben. Daher nenne ich ihn X. Wenn ich ihn finde und ihm in die Augen sehen kann, weiß ich, was ich bin.
Eines Tages werde ich vielleicht seinen Namen kennen.
Tom und ich nehmen einen Zug, um 250 Kilometer und 40 000 Jahre weit zu reisen. Wir steigen in Derby um, wo wir Tee trinken, Karten spielen und einer Speerspitze aus Feuerstein den letzten Schliff geben.
»Völlig unverantwortlich«, hatte eine stark parfümierte Frau in der Woche zuvor gesagt. »Pflege du ruhig deine Vorliebe für Dreck und deine perversen Ideen über Höhlenmenschen als Philosophenkönige, aber zwing nicht den armen Tom mitzukommen.«
»Hast du den Wetterbericht gesehen?«, fragte mich ein Mann mit kleinen geröteten Augen, der glaubt, was in den Zeitungen steht, und der vorhat, die Totenwache für seine Frau in einem Flughafenhotel abzuhalten. »Klingt mir nach einem Fall fürs Jugendamt.« Seinem Stirnrunzeln und seinem Lebenslauf nach zu schließen meinte er das durchaus ernst.
Tom ist dreizehn und versteht nicht, was das ganze Theater soll. Wir haben schon davor in Erdlöchern gelebt. Jetzt gehen wir in einen Wald, den wir bestens kennen, bauen uns dort einen Unterschlupf, töten das eine oder andere Getier und starren bis Weihnachten in offenes Feuer. Dann nehmen wir den Zug zurück, um rechtzeitig für all die üblichen Dinge zu Hause zu sein.
Seine Lehrer zeigten sich verständnisvoll: »Interessante Zeit, das Jungpaläolithikum. Versuch in Mathe nicht den Anschluss zu verlieren, ja?« Anders seine Mutter: »Weißt du, wie sehr er jetzt schon hintendran ist?«
Wir kennen jeden Witz, der jemals über Mammuts gerissen worden ist. Unsere Gesichtsmuskeln sind müde vom gezwungenen Lächeln.
An einem winzigen Provinzbahnhof wartet das Taxi, das uns zum Moor hinauffahren soll. Ein Plastikhund wackelt auf dem Armaturenbrett.
»Haben Sie einen Hund?«, frage ich den Fahrer.
»Nein«, erwidert er. Sonst nichts.
Schweigsam fahren wir ein, zwei Kilometer, ehe Tom sagt: »Können wir bitte anhalten?« Das tun wir, woraufhin Tom mit einem schwarzen Müllsack hinausspringt und einen toten Fuchs in den Sack steckt, so wie ich es in seinem Alter getan habe. Dann steigt er wieder ein und legt den Sicherheitsgurt an.
»Danke«, sagt er. »Und entschuldigen Sie.«
»Kein Problem«, meint der Fahrer. »Pass nur auf, dass sein Darminhalt nicht auf dem Teppich landet.« Er hat die professionelle Abgeklärtheit eines Priesters bei der Beichte.
Wir legen noch zwei weitere Zwischenstopps ein, diesmal wegen toter Kaninchen. Ihre Augäpfel liegen eingesunken in den Höhlen und sind mit einem Film überzogen, als würden sie etwas betrachten, was in ihrem Inneren geschieht – als wären Gras fressen und Kopulieren langweilig im Vergleich zu dem, was sich jetzt dort abspielt.
Das Taxi schlängelt sich das Tal hinauf, vorbei an Fish-’n’-Chips-Buden, verlassenen Mühlen und Menhiren. Kunststofffenster sind von blinkender Festbeleuchtung umrahmt. Um unsere Füße wird heiße, nach Diesel stinkende Luft hereingeblasen, und der Moschusgeruch des Fuchses nimmt zu und wabert durch den Wagen. Gackernde Betrunkene torkeln auf die Straße. Kommentarlos macht der Fahrer einen Bogen um sie.
Die Straßenlaternen kapitulieren, die Dunkelheit ist mächtiger als sie. Wir tauchen in den Tunnel ein, den die Scheinwerfer in die Nacht bohren, und als die Steigung zunimmt, fahren wir Richtung Himmel. Dann flacht die Straße zum Moor hin ab – oder dem, was man hier Moor nennt: Felder mit dünnem Gras, übersät von Schafknochen und umrandet mit Bruchsteinmauern, von Männern gebaut, die in den Ecken der Felder begraben liegen. Hier weht immer Wind. Er prallt von den Mauern ab wie ein Squashball, sodass er einem immer aus allen Richtungen gleichzeitig entgegenbläst.
Vor einer Lücke in einer der Mauern setzt uns das Taxi ab. Wir werfen unsere Rucksäcke und die überfahrenen Tiere an den Straßenrand.
»Dann noch viel Spaß«, sagt der Fahrer ohne ein Lächeln, während ich bezahle.
Durch die Fenster des Farmhauses, das gleich unten am Fahrweg steht, sehe ich das Flimmern von Sarahs Fernseher. Schafe erstarren im Schein der Taschenlampe: Wolken aus nasser Wolle, von Algen grün. Wir können unseren Atem sehen.
Wir klopfen an die Tür und, weil sich nichts rührt, auch ans Fenster. Anscheinend ist Sarah im Pub fünf Kilometer talabwärts. Heute ist Curry-Abend, und eine Band aus Sheffield spielt Bluegrass. Auf dem Bildschirm droht ein narzisstischer Psychopath damit, ein kleines Land zu vernichten. Ein Kochbuch liegt aufgeschlagen auf dem Sofa neben dem Fernseher, und eine Katze reibt sich an einem Behälter mit Kombucha. Die Orangen in der Obstschale stammen aus Israel, das brennende Licht wiederum vom Wind der letzten Woche. In der Küche hängt ein Moorhuhn ab, bis es zart genug ist. Wir sehen nach, ob sich die Tür öffnen lässt, und stellen uns vor, wie wir den Kühlschrank plündern und uns vielleicht vors Kaminfeuer setzen. Aber es ist abgeschlossen.
Wie wir gehört haben, ist von Norden her ein Unwetter im Anzug, ein bedrohlicher Sturm in Orkanstärke, also versuchen wir hastig einen Unterstand zu finden, ehe er uns erwischt wie ein wütender Hund. Durch das Tor; den Hang runter; nicht in den Minenschacht zur Linken fallen; am Hasenbaum vorbei; immer gebückt laufen, sonst stechen einem die Dornen in die Augen; noch mal pissen, bevor wir in den Wald eintauchen; hörst du, wie der Fasan in der Eberesche loskreischt? (Dich holen wir uns noch, mein Freund.) Mach dir wegen der Stacheln keine Sorgen um deine Jacke, Tom; halte nur immer den Kopf unten. Gebückt unter den langen, tief hängenden Ast eines alten Weißdorns neben einer halb verfallenen Mauer. Weg hier, ihr Schafe, das ist jetzt unser Platz. Verschwindet und nehmt eure Zecken mit.
Der Sturm kommt und fällt uns an. Er knurrt nicht einmal als Vorwarnung. Plötzlich ist er unter dem Baum, schnappt und fletscht die Zähne, nichts als Haare und Geifer. Wir hatten eigentlich vor, eine Plane an einem Baum festzubinden, um uns ein Zelt zu bauen, bis wir eine authentischere Unterkunft errichtet haben, aber die hätte der rasende Sturmhund einfach weggefetzt. Also kauern wir uns möglichst nah an der Mauer auf den Boden und wickeln uns in die Plane, bis wir das Ärgste überstanden haben.
Allzu schlimm wird es nicht, aber alle Bemühungen zu schlafen sind vergeblich, solange der Sturmhund durch den Wald tobt. Ein paar Stunden lang stöbert er noch herum und versucht uns zu kriegen. Er ohrfeigt uns ein Weilchen mit seinen Pfoten, dann hebt er frustriert ein Bein über uns, ehe er weiterzieht, um zu sehen, was Nottingham zu bieten hat.
Als er verschwindet, seufzt der Wald auf, er schüttelt sich und atmet wieder. Eine nasse Eule erjagt Beute. Dachse trampeln durchs Gebüsch und saugen Regenwürmer ein wie Spaghetti. Ein Schaf hustet. Man sieht keine Sterne. Von der Erde steigt Kälte auf, kriecht in unsere Kleider. Wir denken an Feuer und Tee und Wein. Mit der Kälte schleicht sich der Schlaf heran. Wir sind eins mit der Erde.
Als ich aufwache, ist der Fuchs mein Kopfkissen. Da draußen ist es blau und weiß und strahlend hell, wir sind in einem Wald, fühlen uns pudelwohl und können jetzt beginnen.
Was wir beginnen, sind wir selbst. Damit meine ich uns als moderne Menschen.
Hier die vorherrschende Theorie der etablierten Anthropologie: Die menschliche Evolution hat ihren Ursprung in Afrika. Es gab mehrere Prototypen, die teilweise nebeneinander existierten. Dank der natürlichen Selektion hatten sie alle einen harten Praxistest durchlaufen. Vor etwa 200 000 Jahren tauchen wir in der Fossilgeschichte auf, also Lebewesen, die anatomisch und physiologisch mehr oder weniger mit uns identisch sind. Ihre Gehirne hatten die gleiche Größe wie unsere oder waren vielleicht sogar einen Tick größer. Denn um Beziehungen herzustellen, was aufwendig, anstrengend und überaus nutzbringend ist, benötigt man ein großes Gehirn. Auf Beziehungen verstanden sie sich besser als wir, deshalb waren sie auf leistungsfähige neurologische Hardware angewiesen. Sie stolzierten auf zwei langen, kräftigen Beinen durch die Steppe und blickten mit ihrem nach vorn gerichteten Augenpaar auf Horizonte, die ihren nicht aufrecht gehenden Vorfahren wegen des hohen Grases verborgen geblieben waren.
So schauten sie auf die Welt hinab, im wortwörtlichen und später auch im übertragenen Sinn; sie sahen die Welt zu ihren Füßen, gesegnet und verflucht durch eine Perspektive, die nichts und niemand zuvor je hatte; ihre Nasen hoben sich aus dem Staub und wurden dem Sehsinn untergeordnet; nun hatten sie ihre geschickten Hände mit den gegenüberstellbaren Daumen frei, um Werkzeuge zu fertigen, Zeichen zu geben, mit Knüppeln zuzuschlagen oder sachte zu streicheln – aber so konnten sie nie mehr Sinneseindrücke vom Boden aufsaugen.
Anatomie und Physiologie sind jedoch nicht alles. 150 000 Jahre lang unterschieden sich diese Menschen in einem entscheidenden Punkt sehr von uns: Sie verhielten sich nicht – um den unter Archäologen ebenso beliebten wie verhassten Begriff zu verwenden – »kulturell modern«. Wahrscheinlich kannten sie noch keine Körperbemalung, statteten ihre Verstorbenen nicht mit Grabbeigaben aus, stellten keine Schneide- oder Knochenwerkzeuge her, angelten nicht, transportierten Ressourcen nicht über größere Entfernungen, arbeiteten nicht mit anderen zusammen, außer mit engen Verwandten, und waren vermutlich nicht organisiert genug, um große Tiere zu jagen.
Dann geschah etwas Gewaltiges. Die Geschwindigkeit, mit der es geschah, und in welchem Ausmaß es sich in Afrika abspielte, ist umstritten. Nicht jedoch das Ereignis an sich.
Gehen Sie in ein gutes Museum und suchen Sie die Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Dort werden Sie auf eine Menge Feuersteine stoßen. Fangen Sie ganz am Anfang an und gehen Sie chronologisch weiter bis zur Jetztzeit. Betrachten Sie die Artefakte genau. Die ersten paar Minuten Ihres Rundgangs werden ziemlich langweilig sein. Sie bekommen nur ödes Zeug zu sehen: klobige, unspezifische Werkzeuge und Bilder von behaarten Leuten, die Aas braten. Alles verweist unmittelbar und unbarmherzig auf das Materielle. Was auch immer da hinter Glas ausgestellt ist, erzählt uns, dass die Menschen nichts als Klumpen aus Fleisch, Knochen und Knorpel sind.
Wenn Sie in einem wirklich guten Museum sind, gehen Sie dann um eine Ecke, wo die Beschriftungen »Jungpaläolithikum« oder »Jüngere Altsteinzeit« lauten, und Ihr Herz wird schneller schlagen. Denn hier begegnen Sie – aus einer Distanz von 40 000 Jahren – der Familie. Sie erkennen sie an einer explosionsartigen Zunahme an Symbolik. Steine und Knochen sind so bearbeitet, dass sie Wölfe, Bären und Menschen repräsentieren; es muss die Geburtsstunde der Metapher gewesen sein. Eine Sturzflut an Möglichkeiten brach über den Menschen herein. Ein Knochen konnte ein Wolf sein und war trotzdem noch ein Knochen. Wenn so etwas möglich war, war dann alles möglich? Die zuvor rein chemische Welt hatte sich in etwas Alchimistisches verwandelt. Nur weil etwas nach den Gesetzen der Optik und der Physiologie der Sehorgane unsichtbar war, bedeutete das nicht, dass es nicht existierte.
Nun verhielt sich auch die Zeit anders. Sie schien nicht mehr das normale Medium zu sein, in dem der Mensch dahintreibt, und zweifellos gab es eine bis dahin undenkbare Revolte gegen die Tyrannei der Zeit oder zumindest gegen die Vorstellung, dass ein Augenblick sich einfach vor den nächsten setzt. Die Toten existierten fort. Verstorbene Menschen salbte man mit Ocker und schickte sie mit Nahrung, Waffen und Gegenständen, die eine rein emotionale oder ästhetische Bedeutung hatten, auf ihre Reise. Getötete Tiere wurden besänftigt. Und da ein Knochen ein Wolf sein konnte, konnten auch die Toten auf ihrer Reise und gleichzeitig am Lagerfeuer anwesend sein, um zu trösten, zu beraten, zu tadeln oder zu necken.
Die Welt war weitaus komplexer und resonanter als zuvor.
Tom und ich sind jetzt hoffentlich in dieser Welt oder finden einen Zugang zu ihr. Hier irgendwo ist X, bereit uns zu helfen.
Diese neue Komplexität forderte mehr und gab mehr. Man benötigt ein Prisma, um zu zeigen, dass weißes Licht keineswegs weiß ist, sondern sich aus vielen Farben zusammensetzt. Und dies war das neue prismatische Zeitalter. Was früher als ein einziger Arbeitsgang betrachtet worden war – sagen wir, einen Bären aufschlitzen –, gliederte sich jetzt in viele Schritte: den Bären häuten, das Fell trocknen, die Sehnen herausschneiden, um damit Schnüre herzustellen, den Oberschenkelknochen in eine Hyäne verwandeln, den toten Bären ungefährlich und idealerweise wohlgesinnt machen. So sehen wir zum ersten Mal sorgfältig ausgetüftelte Werkzeugsätze mit speziellen Werkzeugen für spezielle Zwecke. Handeln und Denken vollzogen sich mit einer neuen Präzision. Man benutzte Klingen, um exakt nach einem im Voraus festgelegten Plan durch Gelenke und Organe zu schneiden, die man vormals nur mit einem stumpfen Faustkeil hatte zerquetschen und zersplittern können.
Wenn man die Führung einer Feuersteinklinge durch einen Bärenkorpus im Voraus plant und andere mögliche Schnittwege verwirft, bedeutet das, dass man auf einer Art virtuellem Reißbrett Möglichkeiten ersonnen und bewertet hat. Anders ausgedrückt: Der Mensch begann abstrakt zu denken. Er bewegte sich einen Schritt weg von der konkreten Welt aus Stein und Knochen hin zu einem anderen Tätigkeitsfeld – einem Ort, der wie das Reich der Toten für das bloße Auge unsichtbar, aber trotzdem real war, und der sich im Sichtbaren manifestierte, wenn man Stein behaute oder Knochen schnitzte.
Das Abstrahieren brachte immense Vorteile mit sich. So konnten etwa die verschiedenen Strategien, wie man einen Bären tötet, in aller Ruhe im Geist durchgespielt werden, ohne dass man riskieren musste, sie an einem realen Bären in einer Höhle auszuprobieren – wo man nur eine einzige Chance hatte, es richtig zu machen. Doch ohne die Vorstellung von einem »Ich« konnte es nicht funktioniert haben. Ein »Ich« musste der Hauptdarsteller in dem imaginären Drama sein: Ein »Ich« musste den Speer werfen und den Krallen ausweichen. Und zu dieser Vorstellung gehört, dass man sich selbst betrachtet und sich selbst gegenüber sein Selbst beschreibt.
Es gibt einen Begriff, der wörtlich »außerhalb von sich selbst stehen« bedeutet: Ek-stase. Die Wortherkunft ist bemerkenswert. Muss man außerhalb von sich selbst geraten, um die lustvollsten Empfindungen zu haben? Tja, meiner Erfahrung nach schon. Selbstsüchtige Kerle sind miese Kerle. Muss man eine gewisse Distanz haben, um sich selbst richtig sehen zu können? Nochmals ja. Doch sich selbst richtig zu sehen führt keineswegs zu lustvollen Empfindungen. Aber vielleicht waren die griechischen Selbstbetrachter, die den Begriff Ekstase erfunden haben, ja nettere Menschen als ich.
In den knöchernen Figuren des Jungpaläolithikums, die wir aus den Museen kennen, hat diese Ek-stase – die Selbstbetrachtung – Gestalt angenommen. Erstmals tauchen menschliche Gesichter auf. Sie sind die beredtsten Kunstwerke überhaupt, sie schreien geradezu heraus: »Das bin ich«, oder: »Das bist du, und ich unterscheide mich von dir.«
Was folgt aus alldem? In erster Linie: Geschichten. Sie und ich sind Darsteller. Und zwar solche, die nicht bloß mit den Händen in den Taschen herumstehen. Das können sie gar nicht. Sie handeln zwanghaft, und ihre Handlungen hängen miteinander zusammen und erzeugen eine Geschichte. Aus kleinen, lokal begrenzten Geschichten entstehen größere Erzählungen. Wenn man miterlebt, wie andere Menschen einem Felssturz, den Zähnen eines Löwen oder einem rasenden Mercedes zum Opfer fallen, kann einen nur jahrelange harte Konditionierung davon abhalten, eine Geschichte zu erzählen, die einem selbst und der eigenen Auslöschung etwas Sinnhaftes verleiht.
Aus dem »Ich« ging das »Du« hervor. Der Weg war geebnet für die menschliche Variante der Theory of Mind, also für unsere Spielarten der Liebe, der Empathie und der Habgier. Das alte Bedürfnis zu töten wurde umgeformt und bekam nun einen moralischen Anstrich. Aus der leisen quälenden Ahnung, dass es unter manchen Umständen verwerflich war zu töten, wurde ein gellender Schrei.[10] Das Selbstempfinden ist der Ursprung aller Gesetze, aller Ethik, allen Sadismus, aller Liebe und allen Krieges.
Sobald es ein »Ich« gab, bestand die Existenz nicht mehr nur aus einer Kette von Ereignissen. So blieb es ungefähr für die nächsten 45 000 Jahre, und dann sagte man uns (worauf wir noch eingehen werden), dass es gar keine Geschichten gab, sondern lediglich Ereignisse – dass selbst wir nur Ereignisse waren, chemische Ereignisse und ihre logischen Folgen. Manche Leute glaubten das sogar. Menschliches Bewusstsein offenbarte sich erstmals durch Symbolik: durch Dinge, die andere Dinge bezeichneten. Heute sagt man uns, dass nichts irgendetwas bezeichnet. Nichts ist bedeutsam.
Möglicherweise ist die »Ich«-Revolution nicht auf einmal auf alle Menschen herabgekommen, als eine einzige große Welle der Selbst-Erschaffung und der Selbst-Erkenntnis. Sie kann viele Male ausgebrochen sein, an vielen verschiedenen Lagerfeuern und im Lauf vieler Tausender Jahre. Aber wann und wo auch immer sie geschah: Sie machte dich.
Merkwürdig, dass X und sein Sohn überhaupt hier sind. Dies war der äußerste Rand der Welt, der Rand des Eises, eine Gegend voller gefährlicher Tiere, mit pfeifenden Schneegestöbern und heulendem Wind. Sie mussten einen guten Grund gehabt haben, ihre Heimat in Frankreich zu verlassen. Vielleicht hatten sie ihrer Familie erzählt, sie würden auf Mammutjagd gehen, aber damit das irgendwie glaubwürdig war, hätten sie mit einer Reihe anderer hier ankommen müssen, und davon habe ich nichts gesehen.[11] In seiner alten Heimat wäre X Teil einer etwa fünfzehnköpfigen Jäger- oder Nahrungssuchergruppe gewesen, hätte einer Sippe von ungefähr einhundertfünfzig Menschen angehört und wäre mit einem Netzwerk von rund fünfhundert Personen (mit derselben Sprache wie er) verbunden gewesen. Die meisten dieser fünfhundert sah er nur gelegentlich. Sie waren ferne flackernde Lichtpunkte, eine Rauchsäule, eine eiternde Wunde von einem Feuersteinspeer in der Flanke eines Rentiers oder (wenn sie von Hunger oder Wölfen heimgesucht worden waren) am Himmel kreisende Milane oder Raben. Ihre selbst beigebrachten Gesichtsnarben zeigten andere Muster, sie hatten andere Methoden, wie sie Umhänge zusammenrollten, sich beim Defäkieren hinhockten, Pfade markierten, Würste füllten, kopulierten und über Himmelskonstellationen nachdachten. Zu Kämpfen mit X’ Sippe kam es selten. Wozu auch? Es war genug für alle da, und Kämpfen brachte Schmerz. Doch manchmal wehte ihr andersartiger Geruch in X’ Tal (auch wenn sie selbst nie auftauchten), dann griff X nach seinem Messer und rüttelte seinen Sohn wach.
Ich vermute ja, dass X und sein Sohn eigentlich deshalb hier waren, weil da neuerdings so ein leises Kribbeln in X’ Kopf war: Er hörte ein verhaltenes Wispern. Das Kribbeln schien eine Bedeutung zu haben, aber X konnte dem nicht näher nachgehen, solange er unter dem Druck familiärer Verpflichtungen stand – solange Kinder unterrichtet, Anordnungen der Frauen befolgt und Großeltern gefüttert werden mussten.
Letzten Endes musste X allein sein, um die kribbelnde Stelle zu befühlen und der Stimme zu lauschen. Allein zu sein bedeutete, bei und mit sich selbst zu sein. Da er aber nur zusammen mit seinem Sohn er selbst war, brachen sie zu zweit in die Kälte auf. Als er am Lagerfeuer saß, vernahm er die Stimme. »Ich, ich, ich«, sagte sie, und während er zuhörte, wurde sie immer lauter, übertönte das Heulen des Windes und das Rauschen des Waldes und brachte seinen Kopf und seine Welt zum Platzen.
An diesem Morgen stehe ich außerhalb meiner selbst, wie meine Vorfahren, die so schicksalhaft aus sich heraustraten. Ich bin daran gewöhnt, und es ist mir eine Last. Für sie jedoch war jenes erste Mal eine Neuerschaffung des Universums.
Ich sehe ein heruntergekommenes, ängstliches, stolzes, großes, bärtiges Tier in einer alten Tweedjacke, das eins dieser griechischen komboloi – Kettchen mit Sorgenperlen, die der Beruhigung dienen – und die gesammelten Gedichte von Thomas Hardy in der Tasche hat und das nicht im Dezember in einem Wald in Derbyshire lebt, sondern in der Vergangenheit und in der Zukunft: in virtuellen Realitäten, die sein despotisches Gehirn heraufbeschworen hat. Diesem Tier gefällt der Gedanke, dass es Abstraktionen als Werkzeuge benutzt, doch in Wirklichkeit ist es deren Werkzeug.
Aber Tom ist im Wald, und er ist ganz im Jetzt. Er klettert auf einen Baum und fällt herunter und hat in Echtzeit ehrliche, echte Schmerzen am Ellbogen. Er buddelt nach Wühlmäusen, wie es Hunde tun, mit den Händen scharrend schleudert er die Erde zwischen den Beinen heraus. Er leckt sich Erde vom Finger und sagt, sie schmeckt nach Maulwurf. Als sich das Sonnenlicht im Bogen seiner Pisse bricht, lacht er auf. Er versucht, ein Rotkehlchen zu hypnotisieren, und ehe ich ihn stoppen kann, erlegt er mit seinem Speer beinahe ein Schaf. Er schlürft Wasser aus dem Teich, streichelt Käfer, bewahrt einen Ohrwurm in einer Flasche auf, denkt sich nett gemeinte Spitznamen für Vögel und Bäume aus, dreht eine Stunde lang einen Stein in seinen Händen und befeuchtet ihn mit Spucke, um den Geruch von Farnen aus dem Karbon freizusetzen.
Er hat die große Gabe der Legasthenie. Ich nicht. Er ist sprachlich ein Versager und daher ein Ass in Sachen Sinnlichkeit und Seinshaftigkeit. Wenn er in einen Wald geht, sieht er einen Baum. Wenn ich in einem Wald bin, strömen Photonen von einem Baum und treffen auf meine Netzhaut. So weit, so gut. Doch dann fließen Datenströme über meinen Sehnerv in mein Hirn, und ab da wird es schwierig. Denn ich übersetze diese Daten beinahe automatisch in Dinge, die rein gar nichts mit einem Baum zu tun haben: Erinnerungsfragmente von Gedichten über Bäume, biologische Fakten über Bäume und so weiter. Wenn ich sage: »Das ist ein Baum!«, dann lüge ich oder mache mir etwas vor. Das ist kein Baum. Ich habe noch nie einen Baum gesehen. Tatsächlich habe ich noch nie (zumindest seit Jahrzehnten nicht) irgendetwas gesehen. Und ich wette, Sie auch nicht. Einmal habe ich einen erwachsenen Menschen kennengelernt, der wirklich Bäume sehen konnte, was mich so erregte und verängstigte, dass ich mich geradewegs Richtung Flughafen davonmachte und mein Gepäck und meine Freundin in einem Bergkloster zurückließ. Ich bin in meinen eigenen Kopf eingesperrt. Ich bin vollkommen selbstbezüglich bis hin zur Selbstüberhöhung. Was gefährlich, aber auch langweilig ist. Ich würde gern mal einen Baum sehen. Nach dem, was ich gehört habe, sind Bäume weitaus interessanter, farbenfroher und charismatischer als meine Gedanken über sie.
Tom hat schon eine Menge Bäume gesehen. Hoffentlich hilft er mir, das auch mal hinzukriegen.
X besaß einen kleinen Stamm an Wörtern, als er seine Sippe verließ und hierherkam. Es waren simple, kurze Gebrauchswörter – eher grobe Faustkeile als scharfe Messer oder spitze Nadeln. Wenn er im Winter mit seinem Sohn allein war und auf das Eis und auf seine Hände starrte, lagen die Wörter unbenutzt in seinem Kopf herum. Dabei setzten sie Patina an. Sie wurden überwuchert von den langsam wachsenden Flechten verknüpfter Vorstellungen und begannen, komplex zu werden und in der Frequenz von quakenden Fröschen oder dem Zittern des Grases mitzuschwingen. Dann vermehrten sie sich. Und als im Frühling der Schnee schmolz und X zu der tropfenden Sandsteinhöhle zurückkehrte, in der seine Familie auf ihn wartete, da brachen die Wörter aus ihm hervor und verbreiteten sich in der ganzen Sippe.
»Geht’s hier eigentlich noch um irgendwas anderes als nur darum, im Wald herumzugammeln, Dad?«, will Tom wissen.
Eine sehr gute Frage.
»Es ist einfach so was wie Camping, oder?«, fährt er fort. »Nur ohne Klo.«
»Und ohne Zelt. Und ohne Essen«, ergänze ich und versuche mir einzureden, dass das stimmt.
Wir gammeln tatsächlich nur herum. Das ist besser als nicht herumzugammeln, aber wir leben nicht wirklich wie Jäger und Sammler. Kälte und Schmutz gehören zu meinem normalen Alltag. Der wesentliche Unterschied ist jedoch, dass Jäger und Sammler so leben mussten. Wir nicht. Für uns gibt es eine Menge Alternativen, wobei wir auf unserer Suche nach Sinneseindrücken aber vielleicht besser darauf verzichten. Zu wissen, dass wir Bohnen und Chips im Dorfladen und in wenigen Stunden in Oxford ein Bett und ein Dach über dem Kopf haben können, würde das Ganze zu einem Schwindel machen.
Doch in gewisser Weise sind auch wir den Launen der Wildnis unterworfen, so wie Jäger und Sammler damals und noch heute. Ein alter Freund von mir wurde vor ein paar Monaten von einem Elektrischen Sturm – einer gefährlichen Herzrhythmusstörung – dahingerafft. Er hatte keine Chance. Das unterscheidet sich nicht allzu sehr von einem Blitzschlag. Einen anderen Freund brachte das unkontrollierte Wachstum von Darmzellen mit einem Bein ins Grab, doch er überlebte – ohne seinen Dickdarm, ohne seinen Glauben an die Güte der Götter und ohne Haare. Das kommt einem Beinahe-Zusammenprall mit dem lokalen Wolfsrudel ziemlich nahe. Und das unkontrollierte Wachstum der Neurosen in meinem Kopf – die jedem künftigen Tagebucheintrag den Stempel »Konditional« aufdrücken – ähnelt doch sehr der Erkenntnis eines Höhlenmenschen, dass er auf dieser windgepeitschten Ebene festsitzt, was immer sie mit ihm anstellen mag; dass er sich mit dem abfinden muss, was er hat, und, falls das nicht reicht, selbst mit größtem Geschick nicht mehr daraus machen kann.
Wie es ist, von einem Tag zum nächsten und von der Hand in den Mund zu leben, ist mir nicht gänzlich fremd. Ich bin durch Wüsten gewandert, wo ich ziemlich elend umgekommen wäre, wenn ich nicht das nächstgelegene Wasserloch gefunden hätte oder dieses ausgetrocknet gewesen wäre. Ein regelmäßiges Einkommen hatte ich nie. Auch bin ich über Meere gesegelt, die mich verschlingen wollten, oder habe solche durchschwommen. Wenn man unvorhergesehene Ereignisse einmal erschnuppert hat, riecht man sie immer. Hier im Wald ist ein solches Ereignis.
Und X ist ebenfalls da. Gestern Abend hat er unten an einer Mauer geschnuppert, wo sich der säuerliche Rülpser eines Rehs verfangen hatte. Ich höre ihn nie herumschleichen. Anscheinend trägt er Schuhe aus weichem Rentier-Leder, gegerbt mit dem Urin seiner Frau, sie verursachen keine Trittgeräusche auf Sarahs Feld. Und er schleicht wohl auch auf Zehenspitzen um die Zweige auf dem Waldboden herum. Doch gestern Abend ist der Junge gestolpert und hingefallen und hat dabei geflucht.
Die Idee ist, den Beginn des modernen menschlichen Verhaltens mitzuerleben. Den ersten »Ich«-Rausch zu spüren, nachdem Subjektivität injiziert worden ist; das erste Aufflackern von Bewusstsein und die erste Detonation von Geschichten zu beobachten und unter der Lawine exponentiell wachsender Möglichkeiten begraben zu werden.
Ein ziemlich großes Ding für einen krankhaft verkopften Mann, einen Jungen, ein Katapult und eine Tüte mit Cornish Pasty.
Wenn wir es richtig machen wollen, müssen wir das Bewusstsein verlieren: unsere Festplatten löschen und darauf hoffen, dass wir neu gestartet – nein, überhaupt gestartet – werden können.
Dann will ich versuchen, die schöne neue Welt, die wir mit unseren jungfräulichen Augen, Nasen, Ohren und Seelen wahrnehmen, zu beschreiben.
Eine knifflige Angelegenheit. Denn neben den Fleischpasteten und dem Katapult nehmen wir auch uns selbst mit in den Wald – Bewusstseinskerne, die von Erinnerungen und Charakterzügen verkrustet sind: Ichs, die sich in Selbstdeutungen ergehen und dabei eine Menge tief verwurzelter Sprache benutzen.[12]
Vor ein paar Jahren sprang ich (recht verwegen, wie ich fand) auf ein Podium, um eine Vorlesung zu halten, fiel jedoch hin und kugelte mir die Schulter aus. Es war ziemlich schmerzhaft.
Man fuhr mich ins Krankenhaus und versuchte, die Schulter wieder einzurenken. Dabei verabreichte man mir MEOPA, ein Sauerstoff-Lachgas-Gemisch, das gebärenden Frauen bekannt sein dürfte. Es zerbrach mich in zwei Teile. Der eine Teil erhob sich aus meinem Körper und schaute auf den Körper herab, wie er schwitzte und schrie, und auf den Krankenpfleger, der versuchte, vorsichtig meine Schulter ins Gelenk zurückzubugsieren. »Ich« konnte die deformierte Schulter, die Pigmentflecken oben auf meiner Glatze und den sauber gezogenen Scheitel des Pflegers sehen. Mochte der Körper auch Schmerzen haben, das wahre »Ich« – das beobachtende – hatte keine. Allerdings wusste es, dass der Körper litt, was es bedauerte, und es wünschte, die Schmerzen mögen verschwinden – aber auf eine eher distanzierte Art, etwa wie man einen Wirbelsturm in Mosambik bedauert. Soweit ich das sagen kann, hatte das ätherische »Ich« all »meine« typischen Wesensmerkmale. Das Jammern des Körpers war ihm peinlich, und es empfand Mitleid mit dem Pfleger, der sich ausgerechnet am Ende seiner Schicht noch mit so einem Fall herumschlagen musste. Das »Ich« vermisste seine Familie und fragte sich, ob die Erkältung seiner Tochter abgeklungen war und ob ihre Mutter in dieser Nacht endlich wieder ein Auge zutun würde. Obwohl es keinen Körper hatte, empfand es dennoch Gelüste, es freute sich darauf, einen Berg hinaufzugehen und Porridge zu essen. Dann drehte der Pfleger den Arm allzu heftig, der Körper schrie auf und sackte nach vorn, der Schlauch fiel aus dem Mund, und ich und mein Körper wurden allmählich wieder eins.
Ähnliches, aber nicht ganz so Dramatisches spielte sich unter dem Einfluss medizinischer Opiate ab. Ich bekam sie in beträchtlichen Dosen, nachdem ich mir an Klippen und im Meer die Knochen zu Brei geschlagen hatte. Zwar ließen die Opiate das »Ich« nicht wie eine Rauchsäule aufsteigen; es blieb diesmal drinnen. Aber seine Interessen waren nicht dieselben wie die des Körpers. Auch scherte es sich nicht sonderlich um das Kreischen der Neuronen, obwohl es sie durchaus hörte. Morphin bewirkt, dass einen nichts mehr kümmert.[13] Dasselbe tun auch die endogenen Opioide, die unser Körper ausschüttet, wenn uns ein Ziegelstein auf den Fuß fällt. Ist das Gehirn entsprechend trainiert, kann es sozusagen dafür sorgen, dass wir uns nicht sorgen.
Was hat dieser interessante Abend in einem Oxforder Krankenhaus mit den Anfängen des menschlichen Bewusstseins zu tun? Nur eins: Er legt die Vermutung nahe, dass das, was auch immer das »Ich« ist, sich in einer Art und Weise zu bewegen vermag, die uns unbegreiflich ist. Wenn ich in einem Krankenhaus über dem Mittelscheitel eines Pflegers schweben kann, dann kann ich vielleicht auch durch Wände gehen, durch sie hindurchsehen, eine Feuerbestattung überleben, mir den Gürtel des Orion umschnallen oder – prosaischer – die Kontrolle über den Körper eines Elchs erlangen.
Denken Sie an die Höhlenmalereien im jungpaläolithischen Europa. Meistens stellen sie Tiere dar, und ihre Ausführung ist oft verblüffend. Die Künstler wussten, wie Auerochsen stehen, wie erschreckte Rehe den Kopf in den Nacken werfen, wie die Gedärme eines Bisons beim Ausweiden herausquellen. Sie waren großartige Naturalisten, aber diese Wände sind keine reinen Bestiarien. Zwischen den naturalistisch wiedergegebenen Tieren galoppieren Ungetüme: Therianthropen (Mischwesen aus Mensch und Tier) und Schimären, die sich aus Bestandteilen verschiedener Tiere zusammensetzen. Die Künstler nutzten die natürliche Beschaffenheit des Felsens, um ihren Tieren Leben einzuhauchen. So wird eine Ausbuchtung zu einem Kopf oder einem Muskel. Man hat beinahe den Eindruck, als würde das Tier aus einer Welt hinter dieser steinernen Wand in die Höhle eindringen.
In all diesen Darstellungen laufen die Tiere nie über einen Boden. Tatsächlich haben sie nie irgendeinen realen räumlichen Kontext, abgesehen von der Höhlenwand. Man sieht sie nie vor einem Berg oder einem Baum oder beim Durchqueren eines Flusses. Sie scheinen zu schweben.