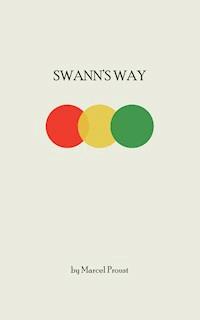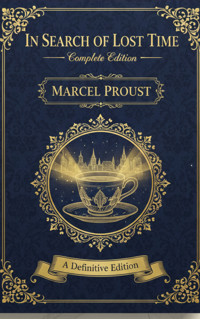14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Manesse Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Die «Recherche» en miniature
Zum 150. Geburtstag des großen französischen Romanciers am 10.7.2021 erscheint hier ein Destillat von Prousts siebenbändigem Hauptwerk in Neuausgabe. Darin begegnet man bereits den Guermantes und Verdurins, Albertine und vielen anderen bekannten Figuren aus dem Proust-Kosmos, oft in überraschender Beleuchtung und reizvoller Akzentuierung. Bei «Der gewendete Tag» handelt es sich um ein Mosaik aus neunzehn Prosastücken, die von 1912 bis 1923 in Zeitschriften erschienen und «Die Suche nach der verlorenen Zeit» eindrucksvoll vorbereiten und ergänzen. In der kongenialen Übersetzung von Christina Viragh und Hanno Helbling bietet dieser spezielle Band Kennern wie Entdeckern einen komprimierten Proust.
«Keine schönere Einladung zur Lektüre Prousts scheint denkbar als diese von ihm selbst ausgewählten Begegnungen eines vielschichtigen Bewusstseins mit einer unendlich genau erfassten Wirklichkeit.» Karlheinz Stierle, NZZ
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wer hat Angst vor Marcel Proust? Dieser repräsentative Auswahlband lädt zur Entdeckung eines imposanten Œuvres ein. Der hier versammelten Prosastücke, die auf die vielbändige «Recherche» hinführen, sind durch Vorabdrucke gleichsam vom Meister selbst autorisiert. Man begegnet darin den Guermantes und Verdurins, Albertine und anderen Figuren aus dem Proust-Kosmos in überraschender Beleuchtung und reizvoller Akzentuierung. In der kongenialen Übersetzung Christina Viraghs und Hanno Helblings bietet der Band Kennern wie Entdeckern einen komprimierten Proust, ein exquisit funkelndes Mosaik aus neunzehn Erzählungen.
Eine «Recherche en miniature» für Liebhaber Prousts und alle, die dessen famoses Werk kennenlernen wollen.
«Keine schönere Einladung zur Lektüre Prousts scheint denkbar als diese von ihm selbst ausgewählten Begegnungen eines vielschichtigen Bewusstseins mit einer unendlich genau erfassten Wirklichkeit.» Karlheinz Stierle, NZZ
«Experten bieten sich damit Einblicke in den Entstehungsprozess des Werks, Anfänger bekommen einen ersten Zugang in Prousts Welt.» Jörg Magenau
«Erstaunlich klar liefern diese famosen Erzählstücke Eindrücke von der komplizierten seelischen Lage eines bürgerlichen Schriftstellers zur Jahrhundertwende.» Ulf Heise
Marcel Proust
DER GEWENDETE TAG
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit in den Vorabdrucken
Herausgegeben und aus dem Französischen übersetzt von Christina Viragh und Hanno Helbling
Nachwort von Christina Viragh
Durchgesehene Neuausgabe
MANESSE VERLAG
Vorwort
Über etwas mehr als zehn Jahre hinweg, vom 21. März 1912 bis zum 1. Januar 1923, sind in verschiedenen Zeitschriften die neunzehn hier übersetzten Texte von Marcel Proust erschienen, die auf die Publikation des Romans A la recherche du temps perdu (1913–1927) vorausweisen. Das Verhältnis dieser Texte zu den entsprechenden Stellen in der Recherche schwankt. Die frühesten vier Skizzen, die Proust 1912/13 in Le Figaro veröffentlicht hat, stehen zum größeren Teil mit dem ersten Band, Du côté de chez Swann, nur in loser Verbindung. In anderen Fällen handelt es sich um eigentliche Vorabdrucke, in denen bald Ausschnitte aus dem Band, dessen Erscheinen bevorstand, einander folgen, bald ein größeres Kapitel für sich allein, unter Umständen lange vor seiner Publikation im Rahmen der Recherche – wie vor allem der Abschnitt über Venedig –, vorgelegt wird. Man sieht es den Texten nicht an, ob Proust sie für den vorläufigen Abdruck gekürzt oder sie nachher, für das Buch, noch erweitert hat. Aber der Textkommentar in den Editions de la Pléiade (1987–1989) gibt darüber Auskunft. Gelegentlich findet sich in der frühen Version eine Episode oder eine Figur noch nicht an der Stelle, die sie später einnehmen wird. Auch Namen können sich ändern; am 1. November 1922 (wenige Wochen vor dem Tod des Verfassers) heißt Albertine noch oder wieder, wie in früheren Entwürfen, Gisèle. Kleinere stilistische Unterschiede finden sich durchwegs.
Unser Buch erhebt keine wissenschaftlichen Ansprüche. Wir weisen nur am Ende jedes Textes auf den entsprechenden Abschnitt in der Recherche hin und überlassen es den Lesern, sich mit einzelnen Abweichungen zu beschäftigen, soweit das auf Grund einer Übersetzung möglich und sinnvoll ist; für die philologische Arbeit könnte eine französische Ausgabe der Vorabdrucke von Nutzen sein. Uns ging es darum, deutschsprachigen Lesern eine Auswahl aus Prousts großem Werk zu bieten, die sie auch auf das Ganze einstimmen mag. Diese Auswahl selber zu treffen wagten wir nicht. Warum auch sollten wir eine Verantwortung übernehmen, die der Autor schon wahrgenommen hat? Wie er sie wahrnahm, kann möglicherweise zu seinem Verständnis des eigenen Werks etwas aussagen. Freilich spielen auch Zufälle mit. Die Ereignisse, Themen, Personen der Recherche kommen nicht gleichmäßig alle zur Geltung. Von Swanns Geschichte mit Odette hört man nicht viel; Le Temps retrouvé, der erst fünf Jahre nach dem Tod des Verfassers erschienene Schlussteil, fehlt ganz. Eine Ahnung davon, was La recherche du temps perdu ist, wird vielleicht trotzdem geweckt.
Außer den hier mitgeteilten Textstücken sind in den Œuvres libres vom November 1921 und vom Februar 1923 unter den Titeln Jalousie und Précaution inutile große Auszüge aus Sodome et Gomorrhe und La Prisonnière erschienen, insgesamt etwa dreihundert Seiten, denen nach der Vorstellung Prousts ein dritter Teil, aus Albertine disparue, folgen sollte. Offenbar wollte er so aus der Recherche einen Albertine-Roman herauslösen; der Plan stieß aber bei Gaston Gallimard, seinem Verleger, auf energischen Widerstand. Die Übersetzung dieser Texte bleibt einem weiteren Band vorbehalten.
Da sich in keinem uns bekannten Verzeichnis alle von Proust veranlassten Vorabdrucke aufgeführt finden, können wir uns für die Vollständigkeit unserer Publikation nicht verbürgen, hoffen sie aber dank der freundlichen Hilfe von Luzius Keller, Sibylla Laemmel und Peter Schnyder erreicht zu haben.
H. H.
Vorfrühling
Letzthin las ich im Zusammenhang mit diesem vergleichsweise milden Winter – der heute zu Ende geht –, es habe in früheren Jahrhunderten Winter gegeben, da schon im Februar der Weißdorn blühte. Mein Herz klopfte heftig bei diesem Namen, dem Namen meiner ersten Liebe zu einer Blume.
Noch heute bin ich, wenn ich sie betrachte, wieder gleich alt und gleich gestimmt wie damals, als ich sie zum ersten Mal sah. Erblicke ich in weiter Entfernung ihre weiße Gaze in einer Hecke, schon wird das Kind wiedergeboren, das ich damals war. So wird der schwache und nackte Eindruck, den andere Blumen auf mich machen, beim Anblick von Weißdorn durch weit zurückliegende, jüngere Eindrücke verstärkt, die ihn begleiten wie die frischen Stimmen von unsichtbaren Chorsängern, die bei gewissen Galavorstellungen die verbrauchte Stimme eines alten Tenors unterstützen und auffüllen müssen, während er eine seiner alten Weisen singt. Wenn ich also gedankenverloren stehen bleibe und den Weißdorn betrachte, so ist eben nicht nur mein Gesichtssinn, sondern es sind auch mein Erinnerungsvermögen und meine ganze Aufmerksamkeit im Spiel. Ich versuche herauszufinden, welche Tiefe das ist, von der sich die Blütenblätter abzuheben scheinen und die der Blume gleichsam eine Vergangenheit, eine Seele verleiht; warum ich da Kirchenlieder und vergangenen Mondschein zu erkennen meine.
*
Weißdorn sah ich – oder bemerkte ich – zum ersten Mal in der Marienandacht. Nicht zu trennen von den Mysterien, an deren Feier sie teilnahmen wie die Gebete, standen die Zweige auf dem Altar, wo sie sich, waagrecht aneinandergefügt, zwischen die Kerzen und geweihten Gefäße streckten, in festlicher Aufmachung und noch verschönt durch die Festons1 ihres Blattwerks, das mit kleinen weißen Knospen übersät war wie eine Hochzeitsschleppe. Weiter oben waren die Blüten offen und hielten das sie ganz umnebelnde Bukett ihrer Staubgefäße, eine letzte, flüchtige Zier, so nachlässig fest, dass ich beim Versuch, in meinem Inneren die Bewegung ihres Blühens zu mimen, unbewusst das stürmische Gebaren eines lebhaften und unachtsamen jungen Mädchens annahm. Als ich vor dem Weggehen beim Altar niederkniete, kam mir, wie ich wieder aufstand, von den Blüten ein bittersüßer Mandelgeruch entgegen. Trotz der schweigenden Reglosigkeit der Zweige war dieser an- und abschwellende Geruch wie das Summen ihres intensiven Lebens, von dem der Altar vibrierte wie eine ländliche Hecke, die von lebenden Fühlern besucht wird; sie kamen einem beim Anblick fast roter Staubgefäße in den Sinn, die noch den frühlingshaften Überschwang, das Aufreizende von Insekten, jetzt allerdings in Gestalt von Blumen, zu haben schienen.
An jenen Abenden ließ uns mein Vater nach der Marienandacht, wenn das Wetter schön war und der Mond schien, statt dass wir gleich nach Hause gingen, über den Kreuzweg einen langen Spaziergang machen, den meine Mutter in ihrer Unfähigkeit, sich zu orientieren und sich auf dem Weg auszukennen, als strategische Großtat betrachtete. Wir kamen über die Allee zurück, die zum Bahnhof führte und wo sich die hübschesten Villen der Gemeinde befanden. In jedem Gärtchen verstreute der Mondschein wie Hubert Robert2 seine zerbrochenen Marmorstufen, Fontänen, halb offenen Gittertore. Sein Licht hatte das Telegraphenamt zerstört. Es blieb nur noch eine abgebrochene Säule, allerdings so schön wie eine unvergängliche Ruine. Von der Stille, die nichts verschluckte, hoben sich hie und da unverwischt Geräusche ab, die von sehr weit her kamen, kaum wahrnehmbar, aber so «bis ins Letzte» ausgefeilt, dass sie diesen Ferne-Effekt nur ihrem pianissimo zu verdanken schienen: wie jene ganz gedämpften, vom Orchester des Conservatoire so schön gespielten Stücke, von denen man keine Note verpasste und die doch in weiter Entfernung vom Konzertsaal zu erklingen schienen, während die langjährigen Abonnenten entzückt die Ohren spitzten, als hätten sie auf den fernen Vormarsch einer Armee gehorcht, die noch nicht in die Rue de Trévise eingebogen wäre. Ich schleppte mich dahin, fiel fast um vor Schlaftrunkenheit, der Lindengeruch, der in der Luft lag, erschien mir wie eine Belohnung, die man nur um den Preis allergrößter Mühen erhält und die das nicht wert ist. Auf einmal hieß uns mein Vater stehen bleiben, und er fragte meine Mutter: «Wo sind wir?» Erschöpft vom Marschieren, aber stolz auf ihn, gestand sie ihm zärtlich, dass sie keine Ahnung habe. Er zuckte die Achseln und lachte. Und dann zeigte er uns, als hätte er sie zusammen mit dem Schlüssel aus seiner Jackentasche hervorgeholt, unsere kleine Garten-Hintertür, die vor uns stand und mit ihrem Stück Straße gekommen war, um uns am Ende jener unbekannten Wege zu erwarten. Meine Mutter sagte bewundernd zu ihm: «Du bist großartig!»
Von dem Augenblick an brauchte ich keinen einzigen Schritt mehr zu machen, der Boden lief für mich in diesem Garten, in dem meine Handlungen schon so lange nicht mehr von bewusster Aufmerksamkeit begleitet waren: Die Gewohnheit nahm mich in die Arme und trug mich ins Bett wie ein kleines Kind.
*
Eines Sonntags nach dem Mittagessen stieg ich zusammen mit meinen Eltern einen kleinen Weg hinauf, der zu den Feldern führte und der jetzt auf einmal von Weißdornduft nur so summte. Die Hecke bildete gleichsam eine Reihe von Kapellen, die unter den ausgestreuten, zu Altären gehäuften Blüten verschwand; darunter legte die Sonne Vierecke aus Helligkeit auf den Boden, als käme sie durch ein Kirchenfenster; der Duft verbreitete sich so sahnig, so in seiner Form eingegrenzt, als hätte ich mich vor dem Altar der Jungfrau Maria befunden, und die ebenso geschmückten Blüten hielten nachlässig ihr schimmerndes Bukett aus Staubgefäßen, zarte, strahlende Äderung im Flamboyantstil3, wie jene, die in der Kirche das Geländer des Lettners4 oder die Fensterkreuze durchscheinend machte und die sich weißfleischig wie die Erdbeerblume entfaltete. Wie naiv und bäuerlich schienen im Vergleich die Heckenrosen, die an diesem heißen Sonntagnachmittag in der prallen Sonne neben ihnen den ländlichen Weg hinaufstiegen, in der schlichten Seide ihrer rötlichen Bluse, die von einem Windhauch unordentlich wird.
Aber ich konnte noch so lange vor dem Weißdorn stehen bleiben, um seinen unsichtbaren und beständigen Duft einzuatmen, ihn meinem Denken vorlegen, das nichts damit anzufangen wusste, ihn verlieren und wiederfinden, mich mit dem Rhythmus vereinigen, der die Blumen mit jugendlicher Fröhlichkeit und in Abständen hinwarf, die unerwartet waren wie bestimmte musikalische Intervalle – er verströmte unbeschränkt und unerschöpflich denselben Zauber, den er mich aber nicht weiter ausloten ließ als eine jener Melodien, die man hundertmal hintereinander abspielt, ohne tiefer in ihr Geheimnis einzudringen. Ich wandte mich einen Augenblick ab, um dann mit frischeren Kräften zu den Blumen zurückzukehren. Ich ging verstreuten Mohnblumen, faul zurückgebliebenen Kornblumen bis auf den Abhang nach, der hinter der Hecke steil zu den Feldern aufstieg und den sie da und dort verzierten, so wie auf der Bordüre einer Tapisserie das ländliche Motiv spärlich aufscheint, das sich dann auf dem Bild völlig durchsetzt; selten, vereinzelt wie allein stehende Häuser, die schon von der Nähe eines Dorfes künden, verhießen sie mir die riesige Weite, wo der Weizen wogt, wo sich Wolken kräuseln, und der Anblick einer einzigen Mohnblume, die hoch über ihrem Seilwerk den roten Wimpel hisste und ihn über der öligen schwarzen Boje dem Wind preisgab, ließ mir das Herz höherschlagen, wie dem Reisenden, der auf einem Schwemmland eine erste trocken liegende Barke erblickt, die neu geteert wird, und da schon ausruft: «Das Meer!»
Dann ging ich zum Weißdorn zurück wie zu jenen Meisterwerken, die man besser zu sehen meint, nachdem man sie einen Augenblick nicht angeschaut hat. Ich empfand eine Freude wie dann, wenn man ein Werk seines Lieblingsmalers sieht, das anders ist als die anderen, oder wenn man vor ein Bild geführt wird, das man bisher als Bleistiftskizze gekannt hat, oder wenn ein uns nur vom Klavier her bekanntes Stück in den Farben des Orchesters eingekleidet erscheint, als mein Großvater mich rief, auf die Hecke eines Parks zeigte, an der wir entlanggingen, und sagte: «Du magst doch den Weißdorn so gern. Schau dir einmal diesen rosaroten an! Hübsch, nicht wahr!» Es war tatsächlich Weißdorn, aber rosaroter und noch schöner als der weiße. Auch er war für ein Fest geschmückt – für eines jener einzigen wahren Feste, nämlich der kirchlichen, die nicht wie die weltlichen von einer zufälligen Laune auf einen beliebigen Tag festgelegt werden, der nicht eigens ihnen geweiht ist und auch nichts wesentlich Festliches hat –, aber mit noch reicherem Schmuck, da die eng übereinander am Zweig steckenden Blüten, die wie Pompons an einem Rokoko-Bischofsstab keinen Platz undekoriert ließen, farbig und also, gemäß der in unserem Dorf herrschenden Ästhetik, von höherer Qualität sein mussten, betrachtete man die Preisskala im «Geschäft» am Platz oder beim Lebensmittelhändler, wo die teureren Biskuits die rosaroten waren.
Und diese Blüten hatten eben eine solche Färbung gewählt, wie von etwas Essbarem oder von einer zarten Verschönerung an einer großen Fest-Toilette, eine Färbung, die Kindern am eindeutigsten schön vorkommt, weil sie ihnen den Grund für ihre Überlegenheit präsentiert und so in ihren Augen immer etwas Lebhafteres und Natürlicheres als die anderen Färbungen hat, auch dann noch, wenn sie begriffen haben, dass sie nicht für ihr Schleckmaul gedacht ist und nicht von der Schneiderin ausgewählt wurde. Und ja, ich hatte – wie vor dem weißen Weißdorn, aber noch bezauberter – gespürt, dass die Absicht, festlich zu sein, nicht künstlich, durch einen von Menschen erdachten Kunstgriff in den Blüten aufschien, sondern dass es spontaner Ausdruck der Natur war, die, naiv wie eine den Altar schmückende Ladenfrau, den Strauch mit diesen süßlich getönten und provinziell aufgeputzten Rosetten überladen hatte. Oben an den Zweigen drängten sich wie jene in Spitzenpapier gehüllten Rosentöpfe, die an einem großen Fest auf den Altären ihre schlanken Raketen strahlen ließen, unzählige blasser gefärbte Knospen, die beim Aufgehen wie rosa Marmorschalen rote Früchte auf ihrem Grund enthüllten und noch mehr als die Blüten das besondere und unwiderstehliche Wesen dieses Weißdorns verrieten, der überall, wo er Knospen trieb, wo er blühen würde, das nur in Rosarot tun konnte. Eingefügt in die Hecke und von ihr doch so verschieden wie ein festlich gekleidetes junges Mädchen inmitten von nachlässig angezogenen Leuten, die zu Hause bleiben, schon völlig bereit für die Marienandacht, schon fast Teil davon, so strahlte und lächelte in seiner frischen rosa Toilette katholisch und hinreißend der Strauch.
*
Nachdem in jenem Jahr meine Eltern die Rückkehr nach Paris etwas früher als sonst angesetzt hatten und ich am Morgen des Abfahrtstages für den Photographen frisiert und mit einem Hut, den ich noch nie getragen hatte, und einer wattierten Samtjacke ausstaffiert worden war, fand mich meine Mutter nach langem Suchen in Tränen aufgelöst auf diesem steilen kleinen Weg, wo ich dem Weißdorn Adieu sagte und dabei die stacheligen Zweige umarmte – wie eine Tragödienprinzessin, der die unnütze Aufmachung beschwerlich ist, undankbar gegenüber der lästigen Hand, die all diese Knoten gemacht und mir das Haar in die Stirn drapiert hatte –, während ich auf den herausgerissenen Lockenwickeln und meinem neuen Hut herumtrampelte. Meine Mutter war von meinen Tränen gar nicht gerührt, sie konnte aber einen Schrei nicht unterdrücken, als sie die zerbeulte Kopfbedeckung und das am Boden liegende Samtjäckchen sah. Ich hörte sie nicht. «Ach, mein armer, lieber Weißdorn», sagte ich schluchzend, «du bist nicht so, du bist nicht böse und willst, dass ich weggehe. Du hast noch nie gemacht, dass ich traurig bin! Ich habe dich deshalb für immer gern.» Und ich trocknete meine Tränen und versprach ihm, dass ich, wenn ich groß wäre, das sinnlose Leben der anderen Menschen nicht nachahmen würde, sondern an Frühlingstagen sogar in Paris, statt Besuche zu machen und mir albernes Zeug anzuhören, aufbrechen würde – aufs Land zum ersten Weißdorn.
Sonnenstrahl auf dem Balkon
Eben habe ich den Vorhang aufgemacht: Die Sonne hat auf dem Balkon ihre weichen Kissen verteilt. Ich werde nicht ausgehen; diese Strahlen versprechen mir nicht das Glück; warum fühlte ich mich bei ihrem Anblick sogleich von einer Hoffnung umschmeichelt – einer Hoffnung auf nichts, Hoffnung ohne jeden Gegenstand und doch, im Reinzustand, einer zarten, zärtlichen Hoffnung?
*
Als ich zwölf Jahre alt war, spielte ich auf den Champs-Elysées mit einem Mädchen, das ich liebte, das ich nie mehr wiedergesehen habe, das heute eine verheiratete Frau und Mutter ist, deren Namen ich letzthin unter den Abonnenten des «Figaro» fand. Da ich aber ihre Eltern nicht kannte, gab es keinen anderen Ort, wo ich sie treffen konnte, und sie kam nicht jeden Tag, denn da waren Lektionen, Katechismen, Nachmittagseinladungen, Kinderveranstaltungen, Einkäufe mit ihrer Mutter, ein ganzes unbekanntes Leben, voll von schmerzlichem Charme, da es das ihre war und mich von ihr trennte. Wenn ich wusste, dass sie nicht kam, musste meine Erzieherin mit mir zu dem Haus pilgern, wo meine kleine Freundin mit ihren Eltern wohnte. Und ich war so verliebt, dass ich, wenn ihr alter Hausmeister herauskam, um einen Hund spazieren zu führen, erbleichte und vergeblich mein Herzklopfen zu unterdrücken versuchte. Ihre Eltern wirkten noch heftiger auf mich. Ihre Existenz trug etwas Übernatürliches in die Welt hinein, und als ich erfuhr, dass es in Paris eine Straße gab, in der man hin und wieder den Vater meiner Freundin auf dem Weg zum Zahnarzt sehen konnte, da kam mir diese Straße so wunderbar vor wie einem Bauern ein Weg, von dem er gehört hätte, dass dort Feen erscheinen, und ich postierte mich in der Straße für lange Stunden.
Zu Hause kannte ich nur ein Vergnügen, nämlich mithilfe von Tricks zu erreichen, dass ihr Vor- oder Nachname oder mindestens der Name der Straße, in der sie wohnte, ausgesprochen wurde; gewiss, ich wiederholte sie mir fortwährend im Kopf, aber ich musste auch ihren köstlichen Klang hören, musste mir diese Musik vorspielen lassen, da mir ihre stumme Lektüre nicht genügte; doch meinen Eltern fehlte völlig dieser zusätzliche und momentane Sinn, den die Liebe verleiht und der mir erlaubte, in allem, was das kleine Mädchen umgab, Lust und Geheimnis zu sehen, und so fanden sie meine Konversation unerklärlich monoton. Sie befürchteten, ich würde später zu einem Blödian und – da ich mich krumm zu halten versuchte, um auszusehen wie der Vater meiner Freundin – zu einem Buckligen, was noch schlimmer schien.
Manchmal war die Stunde, da sie gewöhnlich auf die Champs-Elysées kam, schon verstrichen, und sie war noch nicht da. Ich war verzweifelt, doch da traf mich wie eine Kugel, abgefeuert zwischen dem Kasperletheater und den Holzpferden, die verspätete, aber glückselige Erscheinung des violetten Federbusches ihrer Erzieherin mitten ins Herz. Wir spielten. Wir hörten zwischendurch nur auf, um zur Händlerin zu gehen, wo meine Freundin eine Lutschstange und Früchte kaufte. Da sie die Naturgeschichte mochte, wählte sie am liebsten solche mit einem Wurm.
Ich betrachtete mit Bewunderung die leuchtenden und gefangenen Achatkugeln in einer separaten Holzschale; sie schienen mir wertvoll, weil sie lächelnd und blond waren wie junge Mädchen und weil sie fünfzig Centimes das Stück kosteten.
Die Erzieherin meiner Freundin trug einen Gummimantel. Leider Gottes weigerten sich meine Eltern trotz inständiger Bitten, der meinen auch einen solchen Mantel zu kaufen, und es gab auch keinen violetten Federbusch. Unglücklicherweise fürchtete diese Erzieherin die Feuchtigkeit sehr – ihretwegen. Wenn das Wetter, und war es auch Januar, stabil schön blieb, dann wusste ich, dass ich meine Freundin sehen würde; und wenn ich am Morgen, da ich meine Mutter begrüßen ging, über dem Klavier eine Staubsäule frei stehen sah und unter dem Fenster eine Drehorgel «En Revenant de la Revue»5 spielen hörte und also wusste, dass der Winter bis zum Abend den unverhofften und strahlenden Besuch eines Frühlingstags erhalten hatte; wenn ich über die ganze Länge der Straße von der Sonne losgelöste Balkone wie goldene Wolken vor den Häusern schweben sah, dann war ich glücklich! An anderen Tagen jedoch war das Wetter unsicher, meine Eltern hatten gesagt, es könnte sich noch bessern, es genügte ein Sonnenstrahl, aber wahrscheinlich würde es doch eher regnen. Und wenn es regnete, wozu dann auf die Champs-Elysées gehen? So befragte ich seit dem Mittagessen ängstlich den unsicheren und bewölkten Nachmittagshimmel. Es blieb dunkel. Vor dem Fenster war der Balkon grau.
Doch da, auf einmal erblickte ich auf dem trübseligen Stein – nicht eine weniger matte Farbe, sondern fühlte etwas wie ein Bemühen um eine weniger matte Farbe, das Pulsieren eines zögernden Strahls, der sein Licht freilassen möchte. Einen Augenblick später war der Balkon bleich und reflektierend wie Wasser am Morgen, und das Gitterwerk seines Eisengeländers widerspiegelte sich tausendfach. Ein Windstoß trieb die Spiegelungen auseinander, der Stein hatte sich verdunkelt, doch als wären sie jetzt zahmer, kamen sie wieder; er wurde von Neuem allmählich weiß, und wie eines jener gehaltenen Crescendos, die in der Musik am Ende einer Ouvertüre eine einzige Note schnell über alle Zwischenstufen hinweg zum stärksten Fortissimo führen, so erreichte er vor meinen Augen jenes ungetrübte und beständige Gold der schönen Tage, von dem sich das geschmiedete Sims des Geländers schwarz abhob wie eine launische Vegetation, mit einer Feinheit in der Zeichnung der geringsten Einzelheiten, die ein darauf ausgerichtetes Bewusstsein, eine künstlerische Befriedigung zu verraten schien, und mit einem solchen Relief, einer solchen Samtigkeit in der Ruhe seiner dunklen und glücklichen Masse, dass diese großen, blättrigen Spiegelungen auf dem Sonnensee zu wissen schienen, dass sie ein Unterpfand der Ruhe und des Glücks waren.
Augenblicks-Efeu, flüchtige Wandflora! die farbloseste, die traurigste, die untergeordnetste neben vielen anderen, die das Fenster schmücken oder an der Wand hochklettern können; für mich die liebste seit dem Tag, da sie auf dem Balkon erschienen war wie der tatsächliche Schatten der Gegenwart meiner Freundin, die vielleicht schon auf den Champs-Elysées war und bei meinem Eintreffen sofort sagen würde: «Fangen wir gleich zu spielen an, du bist in meinem Lager»; zerbrechlich, von einem Windhauch weggeblasen, aber auch in Zusammenhang nicht mit der Jahreszeit, sondern mit der Stunde, Versprechen eines augenblicklichen Glücks, das der Tag verweigert oder vollziehen wird, und so des augenblicklichen Glücks par excellence, des Glücks der Liebe; weicher, wärmer auf dem Stein als selbst das Moos; lebhaft, sodass ihr ein Sonnenstrahl genügt, um geboren zu werden und Freude aufgehen zu lassen, sogar mitten im Winter, wenn jede andere Vegetation verschwunden ist, wenn die schöne grüne Haut, die die Stämme der alten Bäume umgibt, vom Schnee versteckt ist und auf jenem, der den Balkon deckt, die plötzlich erscheinende Sonne Goldfäden ineinanderschlingt und schwarze Reflexe stickt.
*
Dann kommt der Tag, da uns das Leben keine Freuden mehr bringt. Sie werden uns jedoch vom Licht, das sie in sich aufgenommen hat, wieder zurückgegeben, vom Sonnenlicht, das wir mit der Zeit zu etwas Menschlichem gemacht haben und das für uns nichts anderes mehr ist als eine Erinnerung an das Glück; es lässt uns die Freuden im gegenwärtigen Augenblick, da es scheint, und im vergangenen, an den es erinnert, zugleich genießen, oder vielmehr lässt es sie zwischen den beiden Augenblicken, außerhalb der Zeit, wirklich zu immerwährenden Freuden werden. Die Dichter, die einen paradiesischen Ort beschwören möchten, stellen ihn oft deshalb so langweilig dar, weil sie, statt sich anhand ihres eigenen Lebens daran zu erinnern, welche bestimmten Dinge etwas Paradiesisches hatten, den Ort in strahlendes Licht tauchen und unbekannte Düfte wehen lassen. Es gibt für uns nur solche paradiesische Strahlen und Düfte, die unser Gedächtnis einst registriert hat; sie lassen uns die leichte Instrumentierung hören, mit der unsere damalige Empfindungsfähigkeit sie angereichert hat; eine Empfindungsfähigkeit, die uns origineller scheint, heute, da die oft unmerklichen, aber unaufhörlichen Veränderungen unseres Denkens und unserer Nerven uns so sehr von ihr entfernt haben. Nur sie gibt es – und nicht irgendwelche dummen Strahlen und neuen Düfte, die noch nichts vom Leben wissen –, nur sie vermögen uns ein wenig von der einstigen Luft wiederzubringen, die wir nicht mehr atmen werden, nur sie vermögen uns die einzigen wahren Paradiese, die verlorenen Paradiese! nahezubringen. Und vielleicht habe ich vorhin wegen der kleinen, soeben erwähnten «Kinderszene» in den Sonnenstrahlen, die sich auf dem Balkon niedergelassen hatten und auf die diese Szene ihre Seele übertragen hatte, etwas Sonderliches, Melancholisches und Zärtliches gesehen wie in einem Satz von Schumann6.
Die Dorfkirche
Der bewundernswerte Autor des wahren «Génie du Christianisme» – ich meine Maurice Barrès7 – wird für seinen Aufruf zugunsten der Dorfkirchen jetzt bestimmt ein starkes Echo finden; es ist ja der Augenblick, da viele von uns mit der ihren wieder Kontakt aufnehmen. Und auch für jene, die ihre Ferien nicht an dem Ort verbringen werden, wo sie aufgewachsen sind, wird die Jahreszeit mit ihren Reminiszenzen die Zeit wieder aufleben lassen, da sie sich jedes Jahr am Fuß ihrer Kirche erholten.
Den Turm unserer Kirche erkannte man schon von Weitem, er schrieb seine unvergessliche Gestalt in den Horizont ein. Wenn mein Vater von dem Zug aus, mit dem wir von Paris kamen, ihn erblickte, wie er über alle Furchen des Himmels hinwegflitzte und seinen kleinen eisernen Hahn in alle Richtungen rennen ließ, sagte er zu uns: «Nehmt eure Decken, wir sind bald da.» Und auf einem der größten Spaziergänge, die wir um das Städtchen machten, zeigte er uns an einem Ort, wo der enge Weg in ein riesiges Plateau mündet, in der Entfernung die zarte Spitze unseres Kirchturms, der allein aufragte, aber so dünn war, so rosarot, dass er von einem Fingernagel in den Himmel geritzt schien, in der Absicht, diese Landschaft, dieses reine Natur-Tableau mit einer kleinen Andeutung von Kunst, wenigstens mit einem Hinweis auf das Menschliche zu versehen.
Wenn man näher kam und die Überreste des quadratischen, halb zerstörten Turmes sah, der neben ihm noch stand, war man vor allem vom rötlichen, dunklen Ton des Steins überrascht; und an einem dunstigen Herbstmorgen erschien er über dem gewittrigen Violett der Weinberge wie eine purpurne Ruine, fast in der Farbe des Wilden Weins.
Von dort gesehen war es erst eine frei stehende Kirche, Zusammenfassung der Stadt, von der und für die sie aus der Ferne sprach, dann, aus der Nähe, überragte sie in hohem, dunklem Umhang, mitten auf den Feldern dem Wind trotzend, wie eine Hirtin ihre Schafe, die grauen, wolligen Rücken der versammelten Häuser.
Wie gut konnte ich sie sehen, unsere Kirche! Die Vertraute; in der Straße, wo ihr Hauptportal war, eingeschoben zwischen das Haus, in dem der Apotheker wohnte, und die Lebensmittelhandlung; schlichte Bürgerin unseres Städtchens, die, so schien es, ihre Hausnummer hätte haben können, wenn die Häuser in diesem einfachen Kantonshauptort nummeriert gewesen wären, und wo der Briefträger hätte eintreten können, wenn er seine Runde machte, kurz bevor er zum Apotheker ging, nachdem er eben beim Lebensmittelhändler gewesen war – und doch gab es zwischen ihr und allem, was nicht sie war, eine Trennlinie, die ich im Geist einfach nicht überschreiten konnte. Da mochten die Fuchsien des Nachbarn noch lange die schlechte Gewohnheit haben, ihre Stiele gesenkten Kopfes in alle Richtungen laufen zu lassen, während die Blüten, waren sie groß genug, nichts Eiligeres tun konnten, als ihre gedunsenen, violetten Wangen an der dunklen Kirchenfassade zu kühlen, sie wurden dadurch nicht geheiligt, und wenn meine Augen zwischen ihnen und dem geschwärzten Stein, an den sie sich lehnten, keinen Zwischenraum sahen, so schuf mein Geist da einen Abgrund.
Ihr altes Portal, narbig wie ein Schaumlöffel, war verzogen und an den Ecken stark abgeschliffen (ebenso das Weihwasserbecken, zu dem es führte), als hätte die zarte Berührung durch die Umhänge der Bäuerinnen, die in die Kirche kamen, und durch ihre schüchtern ins Weihwasser getauchten Finger nach jahrhundertelanger Wiederholung eine zerstörerische Kraft annehmen, den Stein verbiegen und schrammen können wie das Karrenrad den Grenzstein, gegen den es täglich stößt. Die Grabsteine, unter denen der edle Staub der großen, gebildeten Äbte des Klosters, die hier begraben waren, eine Art spirituelle Pflasterung bildete, waren ihrerseits auch nicht mehr ein regloses, hartes Material, denn die Zeit hatte sie weich gemacht und sie wie Honig aus ihren Vierecken herausfließen, über ihre Eingrenzung in einem goldenen Strom heraustreten lassen, auf dem eine gotische Blumen-Majuskel mitdriftete, während sie andernorts innerhalb ihrer Grenzen geschrumpft waren und die elliptische lateinische Inschrift noch mehr zusammengezogen und so die Anordnung dieser Abkürzungen um eine weitere Laune bereichert hatten, da zwei Buchstaben eines Wortes nun noch näher beisammenstanden; während sich die anderen übermäßig auseinandergezogen hatten.
Das Farbenspiel ihrer Glasfenster war nie so stark wie an den Tagen, da sich die Sonne nicht zeigte, sodass es draußen wohl grau sein mochte, in der Kirche aber mit Sicherheit schönes Wetter war. Ich sehe wieder eines vor mir, das in seiner ganzen Größe von einer einzigen Person besetzt war, einer Art Spielkartenkönig, der dort oben zwischen Himmel und Erde lebte, und ein anderes, auf dem ein Berg aus rosa Schnee, zu dessen Füßen eine Schlacht im Gang war, direkt auf das Glas gefroren schien, auf dem seine wirren Graupen Bläschen warfen wie auf einem Glas, das noch flockige Einschlüsse hätte, Flocken, die aber von einer Morgendämmerung beleuchtet würden (bestimmt von derselben, die den Altaraufsatz in so frischen Tönen rötlich färbte, dass sie eher nur für den Augenblick und von einer flüchtigen Helle dort aufgetragen schienen als in Farben, die für immer am Stein haften); und alle waren so antik, dass man ihr silbernes Alter da und dort im Staub der Jahrhunderte glitzern und das Geflecht ihrer sanften Glas-Tapisserie bis auf den Faden durchscheinen sah. In der Sakristei hingen zwei Hautelisse-Tapisserien mit der Krönung Esthers8, denen die Farben im Verfließen einen zusätzlichen Ausdruck, ein zusätzliches Relief und eine zusätzliche Beleuchtung verliehen hatten; ein bisschen Rosarot umschwebte Esthers Lippen jenseits der Zeichnung ihrer Konturen, das Gelb ihres Kleides entfaltete sich so sahnig, so üppig, dass es irgendwie kompakt wurde und sich heftig von der abgetönten Atmosphäre und dem Grün der Bäume abhob, das in den unteren Teilen des seidenen, wollenen Bildes leuchtend geblieben, oben hingegen ausgebleicht war, und es ließ über den dunklen Stämmen die hohen Äste blasser erscheinen, vergilbend, golden und gleichsam halb ausgelöscht von der plötzlichen, schrägen Beleuchtung durch eine unsichtbare Sonne.
All diese alten Dinge hatten für mich die Kirche schließlich zu etwas ganz anderem werden lassen als das übrige Dorf, zu einem Bau, der gewissermaßen in einem vierdimensionalen Raum stand – als vierte Dimension die Zeit – und sein Schiff über die Jahrhunderte hinweg entfaltete, von Joch zu Joch, von Kapelle zu Kapelle nicht nur ein paar Meter hinter sich bringend und niederringend, sondern scheinbar auch aufeinanderfolgende Epochen, aus denen er siegreich hervorging; das rohe, wilde elfte Jahrhundert ließ er in der Dicke seiner Wände verschwinden, wo es, seine schweren Bögen verstopft und blind gemacht durch grobe Blöcke, nur noch in der tiefen Kerbe erschien, die die Turmtreppe neben dem Portal einschnitt, und auch dort war es von anmutigen gotischen Arkaden verstellt, die sich kokett vordrängten, so wie sich große Schwestern lächelnd vor einen ungehobelten, mürrischen, unordentlich gekleideten kleinen Bruder stellen, um ihn vor Fremden zu verstecken; und er hob in den Himmel über dem Platz seinen Turm, der auf Saint-Louis9 hinuntergeschaut hatte und ihn noch zu sehen schien.
Aus seinen Fenstern, die je zwei und zwei übereinanderlagen – mit jenen richtigen und originellen Proportionen in den Abständen, die nicht nur dem menschlichen Gesicht Schönheit und Würde verleihen –, ließ der Turm von Zeit zu Zeit Schwärme von Krähen fallen, die einen Augenblick krächzend kreisten, als wären die alten Steine, die sie herumtollen ließen, anscheinend ohne sie zu sehen, auf einmal unbewohnbar geworden und hätten die Essenz einer ungeheuren Aufregung abgesondert, womit sie die Krähen heimsuchten und von sich stießen. Dann, nachdem sie auf dem violetten Samt der Abendluft in alle Richtungen Striche gezogen hatten, beruhigten sie sich plötzlich und ließen sich wieder vom Turm einsaugen, der sich von unheilvoll in gnädig zurückverwandelt hatte, saßen da und dort, anscheinend ohne sich zu rühren, vielleicht aber nach Insekten schnappend, auf den Türmchen oben wie Möwen, die sich mit der Reglosigkeit des Fischers auf den Wellenkämmen halten.
Oft, wenn ich auf der Rückkehr vom Spaziergang am Kirchturm vorbeikam und die sanfte Spannung, die inbrünstige Neigung seiner steinernen Hänge betrachtete, die sich immer näher zueinander in die Höhe hoben wie Hände im Gebet, vereinte ich mich so sehr mit dem Überschwang der Turmspitze, dass sich mein Blick mit ihr zusammen in die Höhe schwang; und gleichzeitig lächelte ich den alten, abgenutzten Steinen freundlich zu, die von der untergehenden Sonne nur noch ganz oben beleuchtet waren und die vom Moment an, da sie in diese besonnte Zone eintraten und vom Licht weich wurden, auf einmal noch viel weiter hinaufgezogen schienen, viel entfernter, wie ein Lied, das «mit Kopfstimme» eine Oktave höher wiederholt wird.
Das andere Portal, auf dieser Seite, war völlig von Efeu überwachsen, und um in diesem Block aus Grünpflanzen eine Kirche zu erkennen, musste man sich schon anstrengen, was übrigens bewirkte, dass ich die Kirche als Idee noch genauer fasste (wie es bei einer Übersetzung geschehen kann, in der man einen Gedanken um so mehr vertieft, als man ihn aus seiner gewohnten Form löst), um in der Wölbung eines Efeubüschels jene eines Fensters zu erkennen und in einer Ausbuchtung der Pflanzen das Vorspringen eines Kapitells. Dann aber kam ein bisschen Wind; die Blätter brandeten gegeneinander, und die Pflanzenfassade schien fröstelnd die welligen, zärtlich berührten, wegstrebenden Pfeiler zu umarmen.
Es war der Turm unserer Kirche, der allen Beschäftigungen, allen Stunden, allen Ansichten der Stadt die Gestalt, die Krönung, die Weihe verlieh. Aus meinem Zimmer konnte ich nur seinen untersten Teil sehen, der mit Schiefer abgedeckt war; wenn ich ihn aber an einem heißen Sommer-Sonntagmorgen, noch vom Bett aus, glühen sah wie eine schwarze Sonne, sagte ich «Schon neun Uhr!» zu mir, «schnell aufstehen, es ist Zeit für die Messen»; und ich wusste genau, welche Farbe die Sonne auf dem Platz hatte, welchen Schatten die Markise des Ladens dort warf, wusste von der Hitze und dem Staub des Marktes.
Wenn man nach der Messe zum Kirchendiener hineinschaute, um ihm zu sagen, er solle eine größere Brioche bringen als sonst, da Freunde von uns das schöne Wetter ausnützten und zum Frühstück kamen, hatte man den Kirchturm vor sich, der, selbst golden gebacken wie eine noch größere, geweihte Brioche, die Schuppen und Rinnen gummiartig von der Sonne, seine scharfe Spitze in den blauen Himmel stach. Abends hingegen, wenn ich vom Spaziergang zurückkam, war er in der Neige des Tages so sanft, dass er wie ein braunes Samtkissen auf den bleich gewordenen Himmel gelegt und aufgedrückt schien, und der Himmel hatte dem Druck nachgegeben und sich etwas eingebuchtet und war zurückgeflossen, ihm über die Ränder; und die Rufe der Vögel, die um ihn herumflogen, schienen die Stille noch zu vergrößern, seine Spitze noch weiter hinaufzutreiben und ihm etwas Unaussprechliches zu verleihen.
Sogar wenn man hinter der Kirche zu tun hatte, dort, wo man sie gar nicht sah, schien alles auf den da und dort zwischen den Häusern aufragenden Turm hin geordnet, der vielleicht noch ergreifender war, wenn er so ohne Kirche aufschien. Und ja, es gibt manche andere Türme, die auf diese Art gesehen schöner sind, und meine Erinnerung bewahrt Turm-Vignetten auf, die über künstlerisch ganz anders beschaffene Dächer hinaufragen.
Ich werde jene seltsame normannische Stadt und die zwei reizenden Herrschaftshäuser aus dem achtzehnten Jahrhundert nie vergessen, die mir in vielfacher Hinsicht teuer und verehrungswürdig sind und zwischen denen man den gotischen Turm einer Kirche, die sie verstecken, aufragen sieht, schaut man von dem schönen Garten, der von der Außentreppe zum Fluss hinunterführt, auf ihn, wie er ihre Fassaden oben fortzusetzen und abzuschließen scheint, aber auf so andere Art, so kostbar, so geringelt, so rosa, so poliert, dass er ganz offensichtlich genauso wenig zu ihnen gehört wie zu schönen, einheitlichen Strandkieseln die zwischen ihnen steckende purpurrote und gezackte Spitze einer zur Turmform gedrehten, emailschimmernden Muschelschale.
Sogar in Paris, in einem der hässlichsten Viertel der Stadt, kenne ich ein Fenster, wo man jenseits eines Vordergrunds aus dem Dächerhaufen mehrerer Straßen eine violette Glocke sieht, die manchmal rötlich, manchmal auch – auf den edleren «Abzügen», die die Atmosphäre von ihnen herstellt – in einem von Asche freigesiebten Schwarz erscheint und die nichts anderes ist als die Kuppel von Saint-Augustin, die dieser Ansicht von Paris den Charakter gewisser Rom-Veduten von Piranesi10 verleiht. Doch keine dieser kleinen Gravüren, wie geschmackvoll mein Gedächtnis sie auch ausgeführt haben mochte, beherrscht einen ganzen, tiefen Teil meines Lebens wie die Erinnerung an unseren Kirchturm, an seine Aspekte in den Straßen hinter der Kirche. Sah man ihn um fünf Uhr, wenn man in der Post die Briefe holen ging, einige Häuser weiter vorn zur Linken, wo er plötzlich seinen einsamen Gipfel über die Dachfirste hob; oder sah man ihn, während man weiter weg, bis zum Bahnhof ging, in der Schräge mit Wirbeln und neuen Oberflächen erscheinen wie einen festen Körper, den man in einem unbekannten Moment seiner Umlaufbahn überrascht, er war es doch immer, zu dem man zurückkommen musste, immer zu ihm, der alles dominierte, der die Häuser mit seiner unerwarteten Zinne um sich scharte, erhoben vor mir wie der Finger Gottes, dessen Leib wohl in der Menge der Menschen verborgen sein mochte, ohne dass ich ihn deswegen mit ihr verwechselte.
Und noch heute, wenn mir in einer großen Provinzstadt oder in einem Viertel von Paris, das ich nicht gut kenne, ein Passant den Weg erklärt und mir in der Entfernung einen Hospital-Wachtturm, einen Kloster-Glockenturm zeigt, der die Spitze seiner kirchlichen Haube an der Straßenecke in die Höhe hebt, wo ich abbiegen muss, kann der Passant, falls er sich umdreht, um festzustellen, ob ich mich nicht verlaufe, zu seinem Erstaunen sehen, wie ich, sobald mein Gedächtnis den Türmen auch nur eine dunkle Ähnlichkeit mit der fernen teuren Gestalt abgewinnt, den begonnenen Spaziergang oder das zu Erledigende vergesse und vor dem Turm stehend mich zu erinnern versuche, während ich in mir Festland spüre, das, dem Vergessen wieder abgerungen, allmählich trocknet und sich konsolidiert; und da werde ich wohl noch ängstlicher als eben, da ich ihn um Auskunft bat, wieder nach dem Weg suchen, ich biege aus einer Straße ab … aber dieses Mal … in meinem Herzen …
Osterferien
Die Romanciers, die nach Tagen und Jahren zählen, sind Dummköpfe. Für eine Uhr mögen die Tage gleich sein, nicht aber für einen Menschen. Es gibt gebirgige, mühsame Tage, die zu überwinden man eine Ewigkeit braucht, und Abhang-Tage, über die man mit vollem Schwung und singend hinunterläuft. Vor allem die etwas nervösen Naturen besitzen, wie Automobile, verschiedene Gänge, um die Tage hinter sich zu bringen.
Dann gibt es Tage außer der Reihe, die, dazwischengeschaltet, aus einer anderen Jahreszeit, einer anderen Gegend der Welt kommen. Man ist in Paris, es ist Winter, und doch hat man im Halbschlaf das Gefühl, da beginne ein sizilianischer Frühlingsmorgen. Dem ersten Rumpeln der Tramway hören wir an, dass sie nicht im Regen verkommt, sondern nach der Bläue aufbricht; unzählige für verschiedene Instrumente subtil komponierte Volksmusik-Themen, vom Horn des Brunnenflickers bis zum Flageolett des Ziegenhirten, leichte Orchestrierung der morgendlichen Aura, eine Art «Ouvertüre zu einem Festtag». Und beim ersten Sonnenstrahl, der uns erreicht, beginnen wir wie der Memnon-Koloss zu singen.11 Es braucht nicht einmal einen Wetterumschlag, um in unserer Sensibilität, unserer inneren Musikalität plötzlich eine Änderung der Tonart herbeizuführen. Namen, die Namen von Ländern, die Namen von Städten – gleich jenen wissenschaftlichen Apparaturen, mit denen man Phänomene hervorbringen kann, die in der Natur selten und unregelmäßig auftreten – bringen uns Dunst, Sonne, Gischt.
Oft hebt sich eine Reihe von Tagen, die von außen gesehen nicht anders sind als die anderen, von diesen so deutlich ab wie eine Melodie von einer ganz anderen. Die Ereignisse erzählen heißt die Oper nur über das Libretto vermitteln; schriebe ich jedoch einen Roman, würde ich versuchen, die Musik eines jeden Tages herauszuarbeiten.
Ich erinnere mich, wie in einem Jahr – ich war noch ein Kind – mein Vater beschloss, wir würden die Osterferien in Florenz verbringen. Ein Name ist etwas Großes, ganz etwas anderes als ein Wort. Im Lauf eines Lebens werden die Namen allmählich zu Wörtern; wir entdecken, dass es zwischen einer Stadt namens Quimperlé und einer Stadt namens Vannes, zwischen einem Herrn namens Joinville und einem Herrn namens Vallombreuse vielleicht gar nicht so viele Unterschiede gibt wie zwischen ihren Namen. Doch lange zuvor führen uns die Namen irre; die Wörter präsentieren ein klares gewöhnliches kleines Bild von den Dingen, wie jene Bilder, die in der Schule an der Wand hängen, um uns als Exempel für eine Hobelbank, ein Schaf, einen Hut zu dienen, Dinge, die man sich je nach Sorte immer gleich vorstellt. Der Name jedoch macht uns glauben, die Stadt, die er bezeichnet, sei eine Person, und zwischen ihr und jeder anderen sei ein Abgrund.
Das Bild, das er von ihr zeichnet, ist zwangsläufig vereinfacht. Ein Name ist nicht sehr ausgedehnt; viel Raum und Zeit können wir da nicht hineinpferchen; ein einziges Denkmal, immer um die gleiche Tageszeit gesehen; höchstens, dass mein Florenz-Bild in zwei Abteilungen aufgeteilt war wie jene Bilder von Ghirlandaio12, die den gleichen Protagonisten in zwei verschiedenen Momenten der Handlung zeigen; auf dem einen stand ich unter einem Stein-Baldachin und schaute durch einen Vorhang aus schrägem, zunehmendem und geschichtetem Sonnenlicht hindurch auf die Gemälde von Santa Maria dei Fiori; auf dem anderen überquerte ich, um zum Mittagessen zurück zu sein, den ganz mit Osterglocken, Narzissen und Anemonen vollgestellten Ponte Vecchio.
Doch das Bild, das die Namen von den Städten zeichnen, entnehmen sie vor allem sich selbst, ihrem eigenen hellen oder dunklen Klang; und sie tauchen es völlig darin ein; wie auf jenen einfarbig roten oder blauen Plakaten, auf denen die Boote, die Kirche, die Fußgänger, die Straße gleicherweise rot oder blau sind, so scheinen uns die unbedeutendsten Häuser von Vitré vom Schatten seines Accent aigu13 verdunkelt; und von allen Florentiner Häusern dachte ich, sie müssten duften wie Blütenkelche, vielleicht wegen Santa Maria dei Fiori. Hätte ich auf meine eigenen Gedanken besser achtgegeben, wäre es mir bewusst geworden, dass ich jedes Mal, wenn ich mir «nach Florenz fahren», «in Florenz sein» sagte, überhaupt nicht eine Stadt sah, sondern etwas so anderes als alles, was ich kannte, etwas so anderes, wie es für eine Menschheit, die ihr ganzes Leben an Winter-Spätnachmittagen verbracht hätte, jenes wunderbare Unbekannte sein könnte: ein Frühlingsmorgen.
Zweifellos ist es eine Aufgabe der Begabten, den Gefühlen, die von der Literatur mit konventionellem Pomp umgeben werden, ihren wahrhaftigen und natürlichen Ausdruck zurückzugeben; in «L’Annonce faite à Marie» von Paul Claudel14 bewundere ich nicht zuletzt – jene allerdings, die angesichts erhabener Giebelfelder in Verzückung geraten, werden die Feinheit des Vierblatts nicht zu schätzen wissen –, dass die Waldarbeiter am Weihnachtsabend nicht sagen: «Weihnacht, der Erlöser ist da»; sondern: «Kiki, il fait froué»15; und als Violaine das Kind wieder zum Leben erweckt hat: «Quoi qui gnia, mon trésor.»16 In dem großartigen Werk des Dichters Francis Jammes17 würde ich noch viele solche Beispiele finden. Umgekehrt aber kann es die Funktion der Literatur sein, in jenen Fällen einen genaueren Ausdruck zu finden, wo wir unsere Gefühle zu dunkel manifestieren, die Gefühle, die uns beherrschen, ohne dass wir uns über sie im Klaren wären. Die köstliche Erwartung, die mich im Hinblick auf Florenz erfüllte, drückte ich nur dadurch aus, dass ich meine Toilette ein Dutzend Mal unterbrach, um mit geschlossenen Beinen herumzuhüpfen und so laut wie möglich «Le Père la Victoire»18 zu singen; und doch war diese Erwartung nicht ungleich jener von Gläubigen, die sich auf der Schwelle zum Paradies wissen.
Der Winter schien noch einmal zu kommen; mein Vater sagte, die Temperatur sei für den Aufbruch nicht gerade günstig. Es war der Augenblick, da wir in anderen Jahren nach einer kleinen Stadt in der Beauce reisten, zu den sich färbenden Veilchen und den wiederangezündeten Feuern. Doch dieses Jahr hatte die Sehnsucht nach Ferien in Florenz die Erinnerung an die Ferien in der Nähe von Chartres gelöscht. Unsere Aufmerksamkeit ist in jedem Augenblick unseres Lebens viel mehr auf das gerichtet, was wir ersehnen, als auf das, was wirklich vor uns ist. Analysierte man die Reize, die auf die Augen und den Geruchssinn eines Menschen einwirken, der an einem brennend heißen Junitag zum Mittagessen nach Hause geht, so fände man viel weniger den Staub der Straßen, die er durchquert, weniger die blendenden Schilder der Geschäfte, an denen er vorbeikommt, als vielmehr die Gerüche, die ihn jetzt gleich umgeben werden – den Geruch der Obstschale mit Kirschen und Aprikosen, den Geruch des Apfelweins, des Gruyère-Käses – aufgehoben im sahnigen, polierten, durchsichtig-kühlen Helldunkel des Esszimmers, das die Gerüche durchziehen wie zarte Adern das Innere eines Achats, während die Messerbänke aus prismatischem Glas Regenbogenfragmente flimmern lassen oder da und dort Pfauenfeder-Augen hintupfen. So sah ich Florenz, den Ponte Vecchio in der Sonne und die großen Mengen feilgebotener Blumen vor mir, während ich in einer Kälte, wie sie im Januar nicht geherrscht hatte, über den Boulevard des Italiens ging, wo in der wassergleich flüssig-eiskalten Luft die Kastanien – pünktliche Gäste in vollständiger Aufmachung, unbeirrt vom schlechten Wetter – trotz allem damit begannen, aus eisigen Blöcken das unwiderstehliche Grün herauszurunden und zu feilen, wobei die lebensfeindliche Kälte zwar ungelegen kam, sie aber nicht zu bremsen vermochte.
Zu Hause las ich dann Werke über Florenz, die damals noch nicht aus der Feder Henri Ghéons und Valery Larbauds stammten, denn die «N. R. F.» ruhte noch für einige Jahre in der Zukunft.19 Doch war ich von den Büchern weniger ergriffen als von den Reiseführern, und von den Reiseführern weniger als vom Fahrplan. In der Tat war ich ganz verwirrt beim Gedanken, dass dieses Florenz, das ich in meiner Vorstellung so nahe, aber unzugänglich vor mir sah, irgendwie, indirekt, über Umwege, «über den Landweg» erreichbar sein könnte. Ich war außer mir vor Freude, als mein Vater, zwar unter Klagen über das kalte Wetter, den besten Zug zu suchen begann und es mir bewusst wurde, dass wir nach dem Mittagessen nur in die rauchige Höhle, das verglaste Laboratorium des Bahnhofs eindringen und den magischen Wagen, der die Transmutation um uns herum vollziehen würde, besteigen mussten, um am nächsten Morgen am Fuß der Hügel von Fiesole in der Stadt der Lilien20 zu erwachen: «Also», fügte mein Vater hinzu, «ihr könntet am 29. in Florenz sein oder sogar schon am Ostermorgen», womit er dieses Florenz nicht nur aus dem abstrakten Raum, sondern auch aus der imaginären Zeit hervortreten ließ, in der wir nicht nur eine einzige, sondern mehrere simultane Ferienreisen ansiedeln, während er sie einer bestimmten Woche meines Lebens zuordnete (einer mit dem Montag beginnenden Woche), da mir die Wäscherin die weiße Weste bringen sollte, die ich mit Tinte bekleckst hatte, eine gewöhnliche, aber wirkliche Woche, da sie nicht auf doppelte Art Verwendung fand. Und ich fühlte, dass ich anhand der ergreifendsten aller Geometrien auf die Ebene meines Lebens die Kuppeln und Türme der Blumenstadt würde zeichnen müssen.
Und das letzte Stadium der Fröhlichkeit erreichte ich schließlich, als ich meinen Vater sagen hörte: «Abends ist es am Arno-Ufer bestimmt noch kalt, du solltest deinen Winter-Überzieher und das dicke Jackett für alle Fälle mit einpacken.»
Denn erst da hatte ich das Gefühl, dass ich es war, der am Tag vor Ostern in dieser Stadt, wo ich mir lauter Renaissance-Menschen vorstellte, umherspazieren würde, dass ich es war, der Kirchen betreten würde, wo wir beim Anblick der Hintergründe auf den Bildern Fra Angelicos den Eindruck haben, der strahlende Nachmittag sei mit uns über die Schwelle getreten und habe seinen blauen Himmel in den Schatten und in die Kühle mitgebracht. Da hatte ich, was mir bis dahin unmöglich erschienen war, wirklich das Gefühl, in den Namen «Florenz» einzudringen; durch eine allerhöchste und meine Kräfte übersteigende Gymnastik warf ich die Luft meines gegenwärtigen Zimmers – das schon nicht mehr meines war – wie einen leer gewordenen Panzer ab und ersetzte sie durch gleich viele Anteile Florentiner Luft, jene nicht zu benennende, besondere Atmosphäre, wie man sie im Traum einatmet, und die für mich im Namen «Florenz» beschlossen war; ich fühlte, wie sich in mir eine wunderbare Desinkarnation vollzog; dazu kam ein Unbehagen, das man verspürt, wenn man sich eben eine Halsentzündung zugezogen hat; am Abend lag ich mit Fieber im Bett, der Arzt verbot mir zu reisen, und mein Vorhaben wurde zunichte.
Nicht ganz allerdings; denn in der nächsten Fastenzeit war es die Erinnerung daran, die den Tagen ihren Charakter verlieh, sie harmonisch machte. Als ich eines Tages hörte, wie eine Dame sagte: «Ich habe den Pelzmantel wieder anziehen müssen; das Wetter ist wirklich nicht nach der Jahreszeit, man würde nicht glauben, dass schon so bald Ostern ist; man könnte meinen, wir hätten wieder Winter», gaben mir diese Worte ganz plötzlich ein Frühlingsgefühl. Da war wieder die Melodie, die ein Jahr zuvor die gleichen Wochen verzaubert hatte, deren Reminiszenz die diesjährigen zu sein schienen; müsste ich ein musikalisches Äquivalent für sie finden, würde ich sagen, dass sie zart, duftend und zerbrechlich war wie das Rekonvaleszenz- und Rosenthema im «Fervaal»von d’Indy21.
Die Träume, mit denen wir die Namen ausstatten, bleiben so lange intakt, wie wir diese Namen hermetisch geschlossen halten, solange wir nicht reisen; sobald wir sie auch nur ein wenig öffnen, sobald wir in der Stadt angekommen sind, bricht die erste vorbeifahrende Tramway in sie ein, und diese Erinnerung ist von nun an untrennbar verbunden mit der Fassade von Santa Maria Novella.
Im Vorjahr hatte ich den Verdacht gehabt, dass der Ostertag nicht anders war als die anderen Tage, dass er nicht wusste, dass er Ostern hieß, und im Wind, der wehte, hatte ich eine Weichheit wiederzuerkennen geglaubt, die ich schon einmal gespürt hatte, die unveränderliche Materie, die vertraute Feuchtigkeit, das unwissend Flüssige der alten Tage. Aber ich konnte nicht verhindern, dass die Erinnerung an meine vorjährigen Pläne der Osterwoche etwas Florentinisches und Florenz etwas Österliches verlieh. Die Osterwoche war noch weit weg, doch in der Reihe von Tagen, die sich vor mir erstreckte, hoben sich die heiligen Tage deutlicher ab, ein Strahl fiel auf sie wie auf bestimmte Häuser eines entfernten Dorfes, das man in einem Licht-Schatten-Spiel erblickt; sie zogen das ganze Licht auf sich. Wie die bretonische Stadt, die zu gewissen Zeiten aus dem Abgrund, der sie verschlungen hat, aufsteigt, wurde Florenz für mich wiedergeboren. Alle beklagten sich über das schlechte Wetter und die Kälte. Mich aber in meiner Rekonvaleszenten-Mattigkeit ließ die Sonne, die bestimmt über den Feldern von Fiesole schien, blinzeln und lächeln. Nicht nur die Glocken waren aus Italien zurückgekehrt, sondern Italien selbst. Meinen getreuen Händen fehlte es nicht an Blumen zu Ehren der Reise, die ich nicht unternommen hatte. Denn seit es um die Platanen und Kastanien des Boulevards wieder kalt geworden war, öffneten sich in der eisigen Luft, die sie umgab, wie in einer Schale reinen Wassers die Narzissen, die Osterglocken, die Hyazinthen und die Anemonen des Ponte Vecchio.
Balbec
Meine Mutter, die mich mit meiner Großmutter nach Balbec schickte und allein in Paris zurückblieb, konnte sich denken, wie verzweifelt ich war, sie verlassen zu müssen; sie beschloss deshalb, uns lange im Voraus auf dem Bahnsteig Adieu zu sagen und nicht bis zu dem Augenblick der Abfahrt zu warten, da eine Trennung, die zuvor von Geschäftigkeit und Vorbereitungen verhüllt und noch nicht endgültig besiegelt ist, auf einmal, wenn sie nicht mehr zu vermeiden ist, unerträglich scheint, ganz konzentriert in einem ungeheuren Moment höchster, ohnmächtiger Klarsicht. Sie kam mit uns zum Bahnhof, zu dem tragischen und zauberhaften Ort, wo man die Hoffnung, gleich wieder nach Hause gehen zu können, aufgeben muss, wo sich aber auch ein Wunder ereignen sollte, durch das die Orte, an denen ich bald leben würde, genau die wären, die bisher nur in meinem Kopf existiert hatten. Übrigens machte es den Anblick von Balbec nicht weniger begehrenswert, dass man ihn um den Preis eines Leidens erkaufen musste, das im Gegenteil die Wirklichkeit des kommenden Erlebens symbolisierte, ein Erleben, das durch kein gleichwertiges Schauspiel, durch keine stereoskopische Ansicht – die mich nicht daran gehindert hätten, daheim zu schlafen – ersetzt werden konnte. Ich fühlte schon, dass die Liebenden und die Vergnügten nicht dieselben sind und dass die Sache, welche immer sie war, die ich lieben würde, stets am Ende einer schmerzhaften Suche stehen werde, bei der ich mein Vergnügen diesem höchsten Gut opfern müsse, statt es darin zu suchen.
Bestimmt würde man heute diese Reise im Automobil machen und dabei meinen, so sei sie angenehmer und echter, weil man die verschiedenen Abstufungen, in denen sich die Erdoberfläche verändert, näher verfolgen kann. Aber das besondere Vergnügen am Reisen besteht nicht darin, dass man unterwegs aussteigen und Rast machen kann, wenn man müde ist, sondern darin, dass man den Unterschied zwischen Abreise und Ankunft nicht etwa so unmerklich, sondern so tiefgreifend wie möglich macht, dass man ihn ganz und unangetastet bewahrt, so wie er in uns drinnen war, als unsere Phantasie uns von dem Ort, wo wir lebten, mitten in den ersehnten Ort trug, in einem Sprung, der uns nicht deshalb zauberhaft schien, weil er eine Distanz zurücklegte, sondern weil er zwei verschiedene Individualitäten der Erde verband, weil er uns von einem Namen zu einem anderen führte; ein Unterschied, schematisiert durch jene geheimnisvolle Operation (besser als durch einen wirklichen Spaziergang, bei dem man ankommen kann, wo man will, und es deshalb keine richtige Ankunft gibt), die an den besonderen Orten vollzogen wird, an den Bahnhöfen, die kaum zur Stadt gehören und ihre Persönlichkeit doch wesentlich enthalten, so wie sie auch auf einer Aufschrift ihren Namen tragen, verrauchte Laboratorien, stinkende Höhlen, wo man aber des Mysteriums teilhaftig wird, große verglaste Werkstätten, wie jene, die ich an dem Tag betrat, um den Zug nach Balbec zu suchen, und die über der ausgeweideten Stadt einen jener riesigen, rohen und tragischen Himmel entfaltete, ähnlich den beinahe pariserisch-modernen Himmeln Mantegnas oder Veroneses, unter denen sich nur ein schrecklicher und feierlicher Akt vollziehen konnte, wie eine Abreise im Zug oder die Aufrichtung des Kreuzes.
Wie wir erfuhren, war die Kirche von Balbec in Balbec-le-Vieux, ziemlich weit von Balbec-Plage entfernt, wo wir wohnen sollten. Wir machten aus, dass ich sie allein besichtigen würde. Ich würde dann meine Großmutter in dem kleinen Vorortzug treffen, der nach Balbec-Plage fuhr, und mit ihr zusammen im Hotel ankommen.
Das Meer, von dem ich gedacht hatte, es strecke sich zu Füßen der Kirche aus, war mehr als fünf Meilen entfernt, und der Turm neben der Kuppel, den ich mir – weil ich gelesen hatte, er selbst sei eine schroffe normannische Klippe, wo sich Körner ansammelten, wo Vögel kreisten – immer so vorgestellt hatte, dass seine Basis von der Gischt hoher Wellen besprüht war, stand auf einem Platz, auf dem sich zwei Tramway-Linien kreuzten, einem Café gegenüber, das in goldenen Lettern die Aufschrift «Billard» trug, und vor einem Hintergrund aus Häusern, zwischen deren Schornsteinen kein einziger Mast zu sehen war. Und die Kirche – die zusammen mit dem Café, dem Fußgänger, den ich nach dem Weg fragte, dem Bahnhof, wohin ich zurückgehen würde, in meine Aufmerksamkeit eindrang – war eins mit allem Übrigen, schien ein Zufall, ein Produkt dieses Spätnachmittags, an dem ihre weiche, aufgeblasene Kuppel vor dem Himmel wie eine Frucht schien, deren Haut im selben Licht, in das die Schornsteine der Häuser getaucht waren, schmelzend und rosa-golden reifte. Ich aber wollte nur noch an die ewige Bedeutung der Skulpturen denken, als ich die Apostel erkannte, deren Abgüsse ich im Musée du Trocadéro gesehen hatte und die mich beidseits der Jungfrau vor der tiefen Portalöffnung erwarteten, als wollten sie mir die Honneurs machen. Die Miene sanft und wohlmeinend, den Rücken gekrümmt, schienen sie mit einer Willkommensgeste vorzutreten und ein Halleluja zu singen auf den schönen Tag. Doch dann sah man, dass ihr Ausdruck unveränderlich war und nur anders wurde, wenn man den Standort wechselte, so wie wenn man um einen toten Hund herumgeht. Und ich sagte mir: «Hier ist es, das ist die Kirche von Balbec. Dieser Ort, der offenbar von seinem Ruhm weiß, ist der einzige, der die Kirche von Balbec besitzt. Was ich bis jetzt gesehen habe, waren Photographien dieser Kirche und in einem Museum Abgüsse von diesen so berühmten Aposteln und der Jungfrau am Portal. Das hier ist jetzt die Kirche selbst, ist die Statue selbst, sie sind es, die Einzigartigen: Das ist sehr viel mehr.»
Vielleicht war es auch weniger. Wie ein junger Mann, der am Examen oder beim Duell das Datum, nach dem man ihn fragt, oder die Kugel, die er abschießt, eine Kleinigkeit findet im Verhältnis zu den Reserven an Wissen oder an Mut, die er unter Beweis stellen wollte, so war mein Vorstellungsvermögen, das die Statue der Jungfrau außerhalb der verfügbaren Reproduktionen und unerreichbar für die Zufälle, von denen jene bedroht waren, stehen sah – intakt, wenn man jene zerriss oder zerbrach, ideal, von universaler Gültigkeit –, so war es jetzt erstaunt, die Statue, die es schon so viele Male geformt hatte, auf ihre eigene steinerne Erscheinung reduziert zu finden, die bezogen auf meine Reichweite einen Platz einnahm, wo sie ein Wahlplakat und die Spitze meines Stocks als Rivalen hatte, an den Domplatz gefesselt, nicht zu trennen von der Mündung der Hauptstraße, ausgesetzt den Blicken des Cafés und des Omnibus-Büros, beleuchtet von der Hälfte eines Strahls der untergehenden Sonne – und bald, in ein paar Stunden, von der Gaslaterne –, wobei die Niederlassung des Comptoir d’Escompte22 die andere Hälfte erhielt und beide zur gleichen Zeit von den Gerüchen aus der Küche der Konditorei erreicht wurden, unterworfen der Tyrannei des Partikulären, so sehr, dass sie, die berühmte Jungfrau, die ich bis dahin mit allgemeiner Existenz und unberührbarer Schönheit versehen hatte, sie, die Jungfrau von Balbec, die Einzigartige (was leider auch bedeutete: die Einzige) – dass sie, hätte ich meinen Namen auf diesen Stein schreiben wollen, mit ihrem ebenso wie die Nachbarhäuser russbeschmutzten Körper allen ihren herbeigereisten Bewunderern die Spur meiner Kreide und der Buchstaben meines Namens gezeigt und nicht abzuschütteln vermocht hätte, und sie nun war es, das unsterbliche, lang ersehnte Kunstwerk, das ich auf diese Art verwandelt fand, zusammen mit der Kirche selbst, verwandelt in eine kleine Alte aus Stein, deren Höhe ich ausmessen und deren Runzeln ich zählen konnte. Es war Zeit, ich musste zum Bahnhof zurückgehen. Ich schrieb meine Enttäuschung den besonderen Umständen zu, meiner schlechten Gestimmtheit, meiner Müdigkeit, meiner Unfähigkeit, richtig zu schauen, und versuchte mich mit dem Gedanken zu trösten, dass es für mich intakte Städte noch gab, dass ich vielleicht bald wie durch einen Perlenvorhang durch das frische Tröpfeln von Quimperlé gehen würde, durch den grünlich-rosa Widerschein, in den Pont-Aven getaucht war; sobald ich aber Balbec betreten hatte, schien es, als hätte ich einen Namen geöffnet, der hermetisch geschlossen bleiben müsste, und als hätten eine Tramway, ein Café, Leute auf dem Platz, die Zweigstelle des Comptoir d’Escompte den Eingang benützt, den ich ihnen unvorsichtigerweise geboten hatte, und die Bilder verjagt, die darin wohnten, und als hätten sie sich – unwiderstehlich gestoßen von einem äußeren Druck, einer pneumatischen Kraft – in die Silben hineingedrängt, die sich wieder geschlossen und ihnen erlaubt hätten, das Portal der persischen Kirche zu umrahmen, und die sie von nun an enthielten.
Ich traf meine Großmutter in dem Vorortzug. Meine Enttäuschung beschäftigte mich immer weniger, je näher der Ort rückte, an den sich mein Körper würde gewöhnen müssen. Mit einem letzten Gedanken versuchte ich mir den Direktor des Hotels von Balbec vorzustellen, für den ich noch nicht existierte und dem ich mich in einer vornehmeren Gesellschaft hätte präsentieren wollen als in der meiner Großmutter, die von ihm bestimmt eine Ermäßigung verlangen würde. Seine – wenn auch erst vage umrissene – Überheblichkeit schien mir gewiss. Wir waren noch nicht in Balbec-Plage; das Bähnchen hielt bei allen vorangehenden Stationen, deren Namen (Criqueville, Equemauville, Couliville) mir an sich fremd vorkamen, während sie, läse man sie in einem Buch, einen gewissen Zusammenhang mit den Namen bestimmter Orte in der Nähe von Combray hätten. Aber für das Ohr eines Musikers mögen zwei Motive, die zum Teil mit den gleichen Noten komponiert sind, überhaupt nicht ähnlich sein, wenn sie harmonisch anders gefärbt und anders orchestriert sind. Und genauso wenig ließen mich diese tristen Namen aus Sand, aus zu leerem, durchwehtem Raum, an Roussainville, an Martinville denken, an diese Namen, die ich so oft bei Tisch, im «Speisezimmer», von meiner Großtante hatte nennen hören und die sich deshalb einen dunklen Charme zugelegt hatten, in den vielleicht Extrakte von Marmeladengeschmack, vom Geruch des Holzfeuers und des Papiers eines Buchs von Bergotte23, von der Sandsteinfarbe des gegenüberliegenden Hauses hineingemischt waren, Namen, die noch heute, wenn sie vom Grund meiner Erinnerung wie Gasbläschen aufsteigen, ihre Eigenart bewahren, inmitten übereinandergelagerter Schichten ganz anderer Umgebungen, die sie durchqueren müssen, um an die Oberfläche zu gelangen.




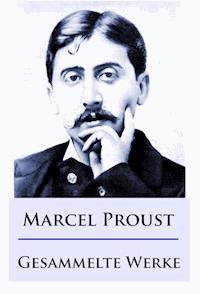

![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)