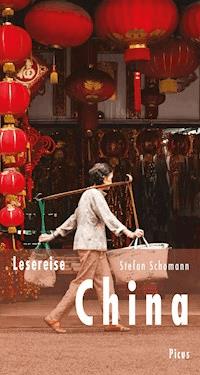7,99 €
7,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
China im Spiegel eines dramatischen Schicksals
Schanghai 1938: Der Wiener Jude Robert Sokal hat das von den Nazis beherrschte Europa in letzter Minute verlassen und kommt mit seinen Eltern als Flüchtling in den Moloch am anderen Ende der Welt. Inmitten der exotischen Gangsterstadt trifft Robert auf Julie, eine christlich getaufte Chinesin und Tochter aus gutem Hause. Allen Widerständen und Barrieren zum Trotz werden die beiden ein Paar, und eine wunderbare Liebesgeschichte nimmt ihren Lauf …
Ein ergreifendes Memoir, das Gefühl und Geschichte vereint!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2010
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Autor
Prolog
I - ALTE WELT
Die Sokal’schen Farben
Das kaiserliche Schwert
Copyright
Der Autor
Stefan Schomann, geboren 1962, studierte Germanistik in München und Berlin. Seit 1988 arbeitet er als freier Journalist und schreibt vor allem für GEO, Stern, DIE ZEIT und die Frankfurter Rundschau. Er lebt mit seiner chinesischen Lebensgefährtin in Berlin und Peking.
Robert und Julie Sokal leben heute in einer Seniorenresidenz auf Long Island. Gefragt, in welcher Phase ihres Lebens sie sich am innigsten geliebt hätten, antworteten sie übereinstimmend: »Jetzt.« Noch heute nimmt Professor Robert Sokal, über die Jahre mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet, schreibend und forschend am wissenschaftlichen Leben teil.
Prolog
Wenn den Bewohnern von Ningpo etwas ausgesprochen Seltenes und Kostbares begegnet, eine kapitale Rarität, dann nennen sie das einen »großen gelben Fisch«. Gemeint ist ein begehrter und entsprechend teurer Vertreter aus der Familie der Adlerfische. Zwar gehen gewöhnliche Exemplare davon den Fischern ab und zu ins Netz, ein wirkliches Prachtstück aber zappelt nur selten darin.
Die Liebesgeschichte zwischen Julie Chenchu Yang, Tochter einer angesehenen Familie aus Ningpo, und Robert Reuven Sokal, einem jungen jüdischen Flüchtling aus Wien, ist so ein großer gelber Fisch. Ein faszinierender Einzelfall, eine Romanze gegen alle Wahrscheinlichkeit und Erfahrung. Nicht von ungefähr ereignet sie sich mitten im 20. Jahrhundert, zu einer Zeit, in der das Unerhörte vorherrscht, und in einer fernen Stadt, in der Ausnahmen die Regel sind: in Schanghai. Rund 18 000 jüdische Emigranten, vorwiegend aus Deutschland und Österreich, finden dort Ende der Dreißigerjahre Zuflucht. Sie haben sich diesen Ort nicht ausgesucht; er wäre wohl sogar die letzte Wahl für sie gewesen, wenn sie denn eine gehabt hätten. Ein Moloch am anderen Ende der Welt, Gangsterstadt und Sündenpfuhl, geprägt von einem mörderischen Klima und einer kaum begreiflichen Kultur. Ein Ort auch, an dem bereits Krieg herrscht. Aber als sich nach dem so genannten Anschluss Österreichs und den Novemberpogromen beinah alle in Frage kommenden Staaten hinter bürokratischen Barrikaden verschanzen, bleibt als letzter Ausweg nur die ferne Hafenstadt im Jangtse-Delta. Zu viele und zu verschiedene Mächte rivalisieren dort um die Vorherrschaft, so dass es keine Zentralgewalt gibt, die ein Visum verlangt. Eine Laune der Geschichte: Hätten stattdessen Panama oder Dschibuti freie Einreise gewährt, so wären die Flüchtlinge eben dort gestrandet. Kaum einer von ihnen hatte sich bis dahin je mit China befasst. Und selbst während ihres fast zehn Jahre währenden Zwangsaufenthalts bleibt der Kontakt auf das Nötigste beschränkt. Bestenfalls kommt es zum Austausch von Missverständnissen. Chinas wahre Mauer, die Sprache, zu überwinden gelingt nur wenigen. Viele essen nicht ein einziges Mal chinesisch und pflegen mit den Einheimischen kaum Umgang. Geschweige denn, dass sie sich in einen oder eine von ihnen verlieben. Von den 18 000 heiraten vielleicht zehn einen chinesischen Partner. Während heute kaum ein westlicher Junggeselle in Schanghai lange allein bleibt, scheint eine solche Verbindung für die mittellosen, verstörten, sich in diesem Provisorium nur widerwillig einrichtenden Emigranten schlicht abwegig. Eine flüchtige Liebschaft vielleicht, ein Techtelmechtel mit einer Tänzerin aus einem Nachtklub, das mag gelegentlich vorkommen. Doch an eine ernsthafte Verbindung, eine Ehe gar mit einer Asiatin, einem Asiaten, daran ist kaum zu denken.
Robert Sokal wagt es gleichwohl. Der aufstrebende, wissbegierige Biologiestudent verliebt sich an der Universität in eine hübsche junge Chinesin. Eine tastende, unverhoffte und kuriose Romanze nimmt ihren Lauf. Sehr zum Unbehagen beider Familien, die darin, gelinde gesagt, nur eine Mesalliance sehen können. Julies Eltern fürchten, ihre Tochter an einen »Bettelstudenten« und »Barbaren« zu verlieren; Roberts Eltern erscheint seine Verbindung mit einer »Asiatin« als skandalöser Irrweg. Doch hartnäckig halten beide aneinander fest, an ihrer stillen, stolzen, ja verwegenen Liebe, die ihnen wohl niemand aus ihrer Umgebung zugetraut hat. Es ist, rein äußerlich betrachtet, keine leidenschaftliche Liebesgeschichte, was auch an den asiatischen Gepflogenheiten, der jugendlichen Scheu und am nüchternen Naturell der beiden angehenden Naturwissenschaftler liegen mag. Die Umstände aber lassen ihre Liebe dennoch zum Abenteuer werden, und trotz dieser Umstände, den gewaltsamen, weltumspannenden Umwälzungen jener Zeit, wird sie ein Leben lang halten. Obwohl die beiden erst um die zwanzig sind, als sie einander kennenlernen, haben sie zu diesem Zeitpunkt schon so viel erlebt, dass es für ein ganzes Menschenleben reichen würde. So ist ihre Geschichte zugleich die zweier Familien, zweier Kulturen, zweier Kontinente.
Die mitteleuropäischen Flüchtlinge fühlen sich in Schanghai entwurzelt. Robert aber findet Halt in der Welt der Bücher: Lernen, Wissen, Forschen - das spielt in seinem Fall eine existenzielle Rolle. Zu Hause in Wien ein eher unauffälliger Schüler, kommt seine Hochbegabung nun in China zum Vorschein. Die Welt ist aus den Fugen, doch solange er herausragende Leistungen erbringt, bleiben ihm die ärgsten Zumutungen erspart. Wissenschaft wird zur Ersatzheimat. Schanghai 1943, das scheint freilich kein geeignetes Sprungbrett für eine Forscherkarriere zu sein. Die Universitäten sind von der westlichen Welt völlig, aber auch vom übrigen China weitgehend abgeschnitten. Und doch entwickelt Robert Sokal sich schließlich zu einem der bedeutendsten Biologen der Gegenwart. Einer der raren Vertreter seiner Zunft, die wissenschaftliches Neuland erschlossen haben - wohl gerade weil er von Beginn an zu selbstständigem Denken gezwungen war. So lässt sich seine Geschichte auch als eine Hommage an den Typus des Autodidakten lesen, als eine Fallstudie über die Wonnen der Wissbegier.
Schanghai bildet schon damals einen Hot Spot kultureller Vielfalt und einen Knotenpunkt globaler Handelsströme. Erst recht in diesen wilden, wütenden Dreißigerjahren, als es sich so kosmopolitisch darstellt wie kaum eine zweite Stadt der Erde: ein Sammelsurium von Menschen verschiedenster Nation und Herkunft, ein dreckiges Weltwunder. Protzig und halbseiden, abgefeimt und kannibalisch, lasterhaft und seelenlos. Seine Wolkenkratzer ragen höher auf als in Europa, seine Banken zählen zu den größten der Welt, und seine Pferderennen, sein Symphonieorchester oder seine Grand Hotels brauchen keinen Vergleich mit ihren westlichen Pendants zu scheuen. In der gleichen Stadt aber leben eine Million chinesischer Flüchtlinge, krepieren jährlich Tausende auf den Straßen, und ein Viertel aller Kinder stirbt noch im Säuglingsalter. The Shanghai mind - dieser schillernde Begriff bezeichnet ein geschärftes Bewusstsein jenseits von Gut und Böse. Recht oder Unrecht, Wahrheit oder Lüge, derlei moralische Währungen besitzen hier keine Gültigkeit. Und doch findet sich Unschuld inmitten aller Liederlichkeit, gewährt diese Stadt Asyl noch mitten im Kampf.
Schanghai, diese Weltstadt wider Willen, wirkt wie ein Prisma, das die Konflikte der Zeit anders bricht, als wir sie zu sehen gewohnt sind. Wie ein Logenplatz liegt sie inmitten der pazifischen Kriegsarena. Wobei uns das ganze Ausmaß der Zeitenwende, die sich damals in Ostasien vollzogen hat, wohl erst heute bewusst wird.
Wie anders, wie viel solider und gemütlicher, scheint dagegen das Wien der Dreißigerjahre, die glorreiche Kapitale der ehemaligen Donaumonarchie, eine über Jahrhunderte gewachsene und gefestigte Kulturstadt im Herzen Europas. Und doch war auch diese Welt dem Untergang geweiht. Hier nimmt unsere Geschichte ihren Anfang.
I
ALTE WELT
Lesen ist die höchste aller Freuden. Nur über Geschichte zu lesen, stimmt uns eher zornig als vergnügt. Man möchte schier wahnsinnig werden, wenn man etwa liest, wie ein guter Mann erschossen wird oder wie eine Regierung in die Hände von Eunuchen und Diktatoren fällt. Aber indem wir diese Verzweiflung empfinden, verspüren wir zugleich eine ästhetische Wirkung.
Die Sokal’schen Farben
Es war niemand zu Hause, nur ich. Die Glocke läutete - ich hielt den Atem an und spähte durchs Guckloch. Es kamen öfter SA-Leute, um die Mietsparteien zu kontrollieren. Doch es stand nur ein Bettler vor der Tür, und so öffnete ich nicht, sondern schlich zurück ins Zimmer. Da läutete es abermals, und ich äugte noch einmal nach draußen. Irgendetwas stimmte nicht mit dieser Gestalt. Und plötzlich wurde mir klar, dass das mein Vater war. Kahl geschoren, ohne Brille, übel zugerichtet. Mehrere Zähne waren ihm ausgeschlagen worden, er wirkte ganz verwahrlost und versehrt, und ein zerlumpter Mantel umhüllte ihn bis zu den Knöcheln. Wer weiß, wo er den herhatte; er war ja schon im Sommer inhaftiert worden. Natürlich ließ ich ihn nun sofort herein, aber was sich danach zwischen uns abspielte, daran kann ich mich kaum mehr erinnern. Doch ich sehe mich noch heute durch das Guckloch spähen.
Sokal ist eine seltene Variante von Sokol. In beiden Fällen handelt es sich um dasselbe Tier, einen Falken nämlich. So heißt er in den meisten slawischen Sprachen. Es gibt auch eine gleichnamige Kleinstadt, keine hundert Kilometer nördlich von Lemberg. Von dort müssen die Vorfahren dieser Leute zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach Lemberg gezogen sein. Die meisten Sokals sind Juden.
Mein Vater, Siegfried Sokal, wurde 1892 in Lemberg als zweites von vier Kindern geboren: Ludwig, Siegfried, Cornel und schließlich Rela, das war der Kosename für Aurelia. In den meisten jüdischen Familien findet sich bekanntlich ein Rabbiner unter den Vorfahren, so wie jeder russische Emigrant mindestens einen Großfürsten zum Onkel hat. Wir aber haben ausschließlich Farbenhändler hervorgebracht. Bereits der Vater meines Vaters, ja sogar schon dessen Vater, waren beide in derselben Branche gewesen, ebenso wie später sein Bruder Cornel, wenngleich der keine glückliche Hand damit hatte. Mit vierzehn lief mein Vater von zu Hause fort, heimlich unterstützt von seiner Großmutter, die ihm ein Zweiguldenstück in den Strumpf steckte. In Wien fand er eine Anstellung in einer Farbenhandlung und legte dort auch seine Gesellenprüfung ab.
1910 wurde er in die k. u. k.-Armee eingezogen. Gerade als er seine Pflichtjahre abgeleistet hatte, brach der Krieg aus, so dass er im Ganzen gut sieben Jahre Soldat war, zum Schluss als Zahlmeister seiner Kompanie. Er diente an der italienischen Front und überstand dort die Isonzoschlachten. Er war ein treuer Patriot, wenngleich nicht unbedingt ein Monarchist. Den Kaiser aber liebte er, wie fast alle österreichischen Juden. In späteren Jahren wählte er dann sozialdemokratisch. Als er aus dem Krieg nach Wien zurückkam, erlangte er seinen Meisterbrief und eröffnete schließlich ein Geschäft im X. Bezirk, in Favoriten: Farben-Sokal am Antonsplatz.
Meine Mutter, Klara Rathner, wurde 1893 geboren. Sie wuchs im galizischen Jablonow auf, einem kleinen Ort in der Nähe von Kolomea, wo ihr Vater Isidor der Direktor einer Baron-Hirsch-Schule war. Dieser jüdische Baron hatte seinen Reichtum dem Bau etlicher Eisenbahnlinien zu verdanken, darunter dem Orient-Express. Die von ihm gegründeten Schulen sollten dazu beitragen, die jüdische Bevölkerung der weniger entwickelten Landstriche zu assimilierten Bürgern zu erziehen. Infolgedessen war Jiddisch dort verboten, die Kinder sollten die jeweilige Landessprache lernen. Obwohl Isidor eigentlich Isaak hieß und natürlich Jiddisch sprach, sowohl seines Umfelds wegen als auch, um sich mit den Eltern der Schüler zu verständigen, war es in seinem Hause verpönt. Weshalb es dann auch bei uns nie gesprochen wurde. Als ich mich später in Schanghai mehr ins Jiddische vertiefte, missfiel das meiner Mutter sehr. Für sie war das ein Jargon. Das wenige Jiddisch, das ich kann, habe ich also ausgerechnet in China erlernt.
Isidor und seine Frau Jeanette hatten ebenfalls vier Kinder: Manja, Frieda, Klara und Salo. Jedes von ihnen war an einem anderen Ort zur Welt gekommen, jeweils nach einer weiteren Beförderung des Vaters. Denn es gab etliche solcher Baron-Hirsch-Schulen in der Donaumonarchie, und Isidor wurde alle paar Jahre versetzt. Bis der russische Einfall in Galizien die Familie 1917 nach Wien vertrieb. Aus Angst vor den Russen legten sie fast die gesamte Strecke, also annähernd tausend Kilometer, zu Fuß zurück. Anfangs hatten sie sich noch auf einem Hügel bei Jablonow im Wald versteckt. Doch als sie ihr Städtchen in Flammen aufgehen sahen, wussten sie, dass es kein Zurück mehr gab.
Beamte galten in dieser Familie als das männliche Ideal. Für seine erste Tochter, Manja, hatte der Vater einen Bahnbeamten als Bräutigam auserkoren, einen Ingenieur Ölberg, der dann in den Dreißigerjahren Bahnhofsvorsteher von Kolomea wurde. Für die zweite, Frieda, den angehenden Juristen Lonio Lagstein. Nur meine Mutter fiel aus dem Rahmen. Es hatte wohl etliche Kandidaten gegeben, sogar einen Verlobten, aber daraus war nichts geworden. Sie war schon Ende zwanzig, als sie, auf Vermittlung einer gemeinsamen Freundin hin, meinen Vater kennenlernte, den sie 1922 heiratete. Einen Kaufmann! Das war höchst problematisch für die Familie. Doch von den vier Geschwistern erging es ihr nachher am besten, zumindest, so lange noch normale Verhältnisse bestanden.
In ihren ersten Wiener Jahren arbeitete sie als Bürokraft bei der Phönix-Versicherung. Etliche ihrer Verwandten hatten dort Posten inne, so auch ihr Schwager Lonio, der später sogar meinen Vater dazu brachte, eine Lebensversicherung bei der Phönix abzuschließen. Er hieß eigentlich Samuel, auf Hebräisch Schmuel, auf Jiddisch Schmil, und dann kam noch als polnische Koseform die Endung -onio dran, Schmilonio. Woraus schließlich Lonio wurde. Kaum jemand aus unserer Familie wurde im Übrigen so gerufen, wie es in den Papieren stand: Meine Cousine Felicia firmierte als Fela, Manja stand für Amalia, und Onkel Salo hieß eigentlich Alexander.
Nach ihrer Heirat führte meine Mutter das gepflegte Leben einer Wiener Dame. Sie war als Kind blond gewesen, später mit Hilfe von Wasserstoffperoxyd, und sie hörte es gerne, wenn man sie mit einem Filmstar verglich. Sie ging viel ins Kaffeehaus, besuchte Theater, Operette und Volksoper, und als sie einmal in der Gesellschaftsspalte der Zeitung erwähnt wurde, wenn auch an letzter Stelle, da glaubte sie, es geschafft zu haben:
»Der Jägerball war ein Stelldichein der schönsten Frauen und Mädchen, und der Saal bot mit seinem immergrünen Kleide ein berauschendes Bild. Die Logen waren besetzt mit hohen gesellschaftlichen Persönlichkeiten. Man sah Frau Bundeskanzler in weißem Satin, ferner Prinzessin Elvira von Bayern in perlenbestickter Toilette, Gräfin Waldberg in Schwarz. Die Gemahlin des Schweizer Gesandten kam in fließender Seide, ihr Töchterchen dagegen als echte Aargauerin. Die Damen Frau Kommerzialrat Köckeis, Sortriades, Klara Sokal erschienen in eleganten blauen Dirndln.«
Ich kam am 13. Januar 1926 zur Welt, als erstes und einziges Kind. In unseren Kreisen waren Einzelkinder damals die Regel. In jenen Jahren wohnten wir noch in der Nähe des Geschäfts, wo der Vater mittlerweile auch eine Farbenerzeugung aufgebaut hatte; Fabrik wäre ein zu hoch gegriffenes Wort dafür. Aus dem einen Geschäft wurden bald zwei und schließlich drei: eines am Antonsplatz, eines in der nahen Inzersdorfer Straße und das dritte in der Erdbergstraße im III. Bezirk, zwischen Donaukanal und Schlachthof. Jedes Geschäft hatte einen Lehrling und einen Gesellen, insgesamt beschäftigte Farben-Sokal ein Dutzend Mitarbeiter. Wie das Stammhaus, so lagen auch die Filialen in klassischen Arbeiterbezirken, da dort die Maler und Anstreicher wohnten. Zudem renovierte die Arbeiterschaft ihre Wohnungen eigenhändig, während Leute aus bürgerlichen Kreisen einen Handwerker damit beauftragten. Die Sokal’schen Farben waren von hoher Qualität, mein Vater hatte zahlreiche Stammkunden. Er fand an seiner Arbeit sehr viel Freude, ganz abgesehen davon, dass sie auch finanziell einträglich war.
So ein Geschäft war damals zugleich eine halbe Drogerie. Da gab es Pinsel, Besen und Bürsten zu kaufen, aber auch Putzmittel, Parfums und feine Seifen. Wandfarben, Öllacke und Beizen standen chromatisch geordnet in großen Stellagen. Bei der Arbeit trug der Vater immer einen Kittel über dem Anzug. Die Mutter schickte ihm öfter jüdische Freundinnen vorbei, doch wenn er dann nach Hause kam, beklagte er sich meist, dass sich mit denen kein Geschäft machen ließe. Er stellte auch nur ein einziges Mal einen jüdischen Lehrbuben ein, mit dem es jedoch prompt Probleme gab. Mein Vater war sicher kein Antisemit, aber in dieser Hinsicht hegte er gewisse Vorbehalte. Er selbst nahm nie einen Pinsel in die Hand; wenn es bei uns etwas anzustreichen gab, beauftragte er einen seiner Kunden oder einen Angestellten damit.
Mein Vater war knapp 1,70 Meter groß und vollschlank, hatte ein rundes Gesicht und trug eine Brille. Sein Haar war in jüngeren Jahren schwarz und mit Hilfe von Brillantine, die er natürlich auch in seinen Läden führte, nach hinten gekämmt. Auf manchen Fotos zeigt er fast asiatische Züge. Auch ein Porträt seines Vaters lässt einen tatarischen Einschlag erkennen. Es dürfte also irgendwann ein Eurasier am Stammbaum der Sokals mitgewirkt haben.
Die Mutter war etwas kleiner als der Vater. Sie nannte ihn Fritz, er sie Klara oder Klärchen, und mich riefen sie Berti. Bis zu meinem achten Lebensjahr schlief ich in einem großen Gitterbett aus Messing. Schon als ich klein war, pflegte sich Großmutter Jeanette, die Direktorengattin, zu mir an diesen goldenen Käfig zu setzen und lange Gedichte von Schiller und Goethe auswendig zu rezitieren. Das Lied von der Glocke, den Ring des Polykrates, den Zauberlehrling. Sie hatte einen leichten östlichen Akzent. Ein Sprachforscher hätte wohl auch bei ihrer Tochter Klara noch einen anderen Zungenschlag herausgehört; die Muttersprache der Kinder war vermutlich Polnisch gewesen. Gelegentlich unterhielten sich meine Eltern auch untereinander auf Polnisch, obwohl mein Vater das sehr ungern tat. Sie benutzten es nur dann, wenn sie nicht wollten, dass ich etwas verstünde - weshalb ich bis heute ein paar Hundert Worte Polnisch kann. Mein Vater sprach und schrieb noch fließender Deutsch als meine Mutter, überaus korrekt und orthographisch fehlerfrei.
Durch den Zustrom der Flüchtlinge war die jüdische Bevölkerung Wiens damals auf über 200 000 angewachsen; in den Zwanzigerjahren ging ihre Zahl wieder etwas zurück. Grob gerechnet war jeder zehnte Wiener ein Jude. Auch die Eltern meines Vaters waren noch während des Ersten Weltkriegs nach Wien geflohen. Mein Großvater hieß Rubin Sokal; ihm zum Gedenken wurde ich Robert genannt, der deutschen Entsprechung dazu. Später habe ich noch das hebräische Äquivalent Reuven als zweiten Vornamen angenommen.Die Großmutter hieß zufällig genauso wie meine spätere Frau, Julie Sokal. Während ich beide Großmütter noch in lebhafter Erinnerung habe, waren die Großväter schon vor meiner Geburt gestorben.
Als ich vier Jahre alt war, bestand die Mutter darauf, in einen besseren Bezirk umzusiedeln. Von da an wohnten wir auf der Wieden, in einem umgebauten Südbahnhotel in der Favoritenstraße. Als ich das Haus das erste Mal sah, war es funkelnd erleuchtet und machte mit dem Aufzug, der Portiersloge, dem Teppich und den Palmenkübeln in der Eingangshalle einen fast mondänen Eindruck. Wir bezogen eine geräumige Wohnung im Mezzanin. Während ich in der Regel in meinem Zimmer aß, wurden gute Freunde und Verwandte im Speisezimmer bewirtet. Uns weniger nahestehende Gäste wurden ins Herrenzimmer gebeten. Der Salon war für heutige Begriffe ein beinah nutzloser Raum. Die vergoldeten Barockmöbel waren abgedeckt und wurden nur zu besonderen Anlässen gelüftet. Am Plafond hingen kristallene Lüster, an den Wänden verschnörkelte Armleuchter. Daneben gab es noch drei Kabinette: die Schlafzimmer für die Eltern, für mich und für das Dienstmädchen. Hinzu kamen ein Badezimmer, ein Klosett, eine Küche, ein Vorzimmer mit Antiquitäten sowie ein langer Gang, auf dem ich manchmal Fußball spielte. Wie Tausende anderer jüdischer Mütter auch träumte meine davon, dass ich Arzt werden sollte. Ich würde dann die Wohnung übernehmen und darin zugleich meine Praxis einrichten, während sie sich eine kleinere Unterkunft in der Nähe suchen wollten.
Sie war auch der unerschütterlichen Überzeugung, ich sei meinem Alter voraus. Deshalb lag ihr daran, mich möglichst früh auf die Schule zu schicken; nicht umsonst kam sie selbst aus einem Direktorenhaus. Als Jännerkind musste ich eine besondere Aufnahmeprüfung ablegen, um vorzeitig eingeschult werden zu können. Der Schulrat gab mir ein paar elementare Rechenaufgaben zu lösen und stellte so heikle Fragen wie »Welche Farbe hat das Gras?«. Ich bestand die Prüfung glänzend. Die Volksschule verlief dann ohne nennenswerte Ereignisse. Bis auf den ersten Tag, an dem die Mutter und das Dienstmädchen mich eskortierten und ich prompt Reißaus nahm. In heller Aufregung wandte die Mutter sich schließlich an einen Polizisten. Der fing mich auch tatsächlich ein und drohte, mich zu arretieren, falls ich noch einmal davonliefe. So fügte ich mich denn, und seither habe ich nie wieder die Schule geschwänzt.
Ich konnte überhaupt ein ziemlich aufsässiger Bub sein. Wenn mir etwas nicht passte, sperrte ich mich ins Klosett ein. So dass der Vater eines Tages den Schlosser holen und die Tür so umbauen ließ, dass man den Hebel auch von außen umlegen konnte. Ansonsten war er gutherzig und schlug mich nur ein einziges Mal, als ich im Trotz eine Uhr beschädigt hatte. Zu Uhren pflegte er ein fast obsessives Verhältnis, er war überhaupt sehr genau und präzis. So trug er stets zwei Taschenuhren bei sich, um die Zeit vergleichen zu können - es hätte ja eine um eine Minute nachgehen können. Er schwor sein Leben lang auf Omega, meine Mutter ließ er aber auch eine Schaffhausen tragen.
Von ihr bekam ich dagegen öfter »Petsch«, wie das bei uns zu Hause auf Jiddisch hieß. Meist auch nicht unverdient. Doch einmal, als ich sechs Jahre alt war, widerfuhr mir schreiendes Unrecht. Da spielte ich im nahen Draschepark. Die Gouvernante tratschte mit einer Freundin und beachtete mich nicht. Es gab dort einen Automaten, wo man Vogelfutter kaufen konnte. Ich hatte ein Portemonnaie voller Kleingeld dabei, alles in allem vielleicht zwei Schillinge. Zuerst wollte ich einfach nur die Tauben füttern, warf zehn Groschen ein, schüttete das Futter auf den Boden, und die Tauben machten sich auch sehr erfreut darüber her. Dann kaufte ich ein weiteres Päckchen und begann mich mehr und mehr für diese Maschine zu interessieren. Was würde geschehen, wenn ich zwei Geldstücke hintereinander einwürfe? Würde ich eines zurückbekommen oder gleich zwei Päckchen erhalten? Also warf ich zwanzig Groschen ein und probierte danach noch alle möglichen Kombinationen aus. Zum Schluss hatte ich keine Münzen mehr, dafür einen ganzen Stoß Vogelfutter.
Das war mein erster Schritt in die Wissenschaft. Ich hatte ein Experiment angestellt: Wie würde dieses System sich verhalten? Zu Hause aber herrschte blankes Entsetzen über meine Handlungsweise, und sie wurde auch in der ganzen Verwandtschaft erörtert. Ich war ein Verschwender, ein Spieler! Sie hätten es noch verstanden, wenn ich mir Schokolade gekauft hätte. Aber Vogelfutter! Hinzu kam, dass man mit Geld grundsätzlich nicht spielte. Besonders mein Vater war ein erklärter Gegner des Glücksspiels. Zum einen, weil sein Vater ein großer Kartenspieler gewesen war, weshalb das Geschäft in Lemberg wohl auch nie sonderlich gut ging. Zum anderen hatte er selbst als Lehrling einmal seine Ersparnisse beim Spiel verloren, was ihm dann wahrhaftig eine Lehre war. Meine Mutter traf sich gern mit Freundinnen zum Rummy, und obwohl sie dabei nie um Geld spielten, sondern lediglich zum Zeitvertreib, sah mein Vater selbst das höchst ungern.
Er war ein ausgezeichneter Arithmetiker und konnte rasch im Kopf rechnen, das rührte noch von seiner Zeit als Zahlmeister beim Militär her. Einmal steigerte ich mich in eine Krise hinein, weil der Lehrer am nächsten Tag das große Einmaleins prüfen wollte. Vor lauter Panik weinte ich sogar. Erst bearbeiteten mich die Mutter und das Stubenmädchen, und sowie der Vater nach Hause kam, schickten sie ihn zu mir. Nicht einmal sein Nachtmahl bekam er zuvor. Am goldenen Gitterbett trichterte er mir dann die Multiplikationstabellen ein. Am nächsten Tag fragte der Lehrer nur: »Wie viel ist neun mal sieben?« Mehr geschah nicht, und ich habe auch nicht versagt.
Wir besaßen ein Grammophon und allerhand Opernplatten, vor allem Verdi und Rossini. Aus einem Nagel und einem Fleischbrett hatte ich mir außerdem einen eigenen Phonographen angefertigt, auf dem ich munter Schellackplatten drehte. Einige Arien konnte ich mitsingen: Oh, wie so trügerisch sind Weiberherzen! Und schon dachte meine Mutter, ich sei eines dieser jüdischen Musikgenies, ein zweiter Rubinstein. Sie schaffte einen eleganten Flügel von Lauberger & Gloss an, aus Nussbaumholz gefertigt und mit einer Wiener Mechanik versehen. Ich musste Klavierstunden nehmen, doch schon nach wenigen Wochen streikte ich und ließ mich weder durch gutes Zureden noch durch Einschüchterungsversuche dazu bewegen, meine pianistische Laufbahn wieder aufzunehmen. Danach wurde auf dem Flügel kaum je wieder gespielt, er schmückte nur fortan das Herrenzimmer.
Bald nach dem Umzug in die Favoritenstraße kauften meine Eltern das erste Radio; später bekam ich sogar einen eigenen Empfänger. Dieser sogenannte Detektorapparat stand am Kopfende meines Bettes und war technisch kaum ausgereifter als mein Phonograph. Er bestand aus einer mit Kupferdraht umwickelten Spule, einem Quarzkristall und einem dünnen Draht, fast so fein wie das Schnurrbarthaar einer Katze. Brachte man ihn mit dem Kristall in Berührung, konnte man in den Kopfhörern mit etwas Glück der Stimme von Radio Wien lauschen.
Im IV. Bezirk gab es etliche Stadtpalais aus der Zeit Maria Theresias, doch die Mehrzahl der Leute kam aus bürgerlichen Verhältnissen. Ich kannte zum Beispiel niemanden, der einen Wagen hatte. Als in der Sommerfrische einmal der Vater eines Mitschülers mit dem Auto vorfuhr, war das ein großes Ereignis. Alles in allem unterschied sich meine Kindheit kaum von der nichtjüdischer Bürgerkinder. Wir fühlten uns selbstverständlich als Österreicher, besonders mein Vater, nachdem er dem Staat sieben Jahre lang treu gedient hatte. Religiös waren wir nicht sonderlich, damals schon gar nicht. Meine Eltern gingen einmal im Jahr in die Synagoge: zum Versöhnungsfest, dem Jom Kippur. Tante Frieda und Onkel Lonio waren etwas frommer als wir, weshalb wir die Feiertage gewöhnlich bei ihnen verbrachten. Da Religion Pflichtfach war, nahm ich am mosaischen Unterricht teil und besuchte auch öfter die Synagoge in der Humboldtgasse, ohne dass dies tiefere Spuren hinterlassen hätte.
Die Sommer verbrachte ich in privaten Kinderheimen. Einmal waren wir in einem Schlössel in Reichenau am Semmering untergebracht. Der Heimleiter hieß sinnigerweise Grünwald, das Palais lag im idyllischen Höllental. Als Teil eines bunten Abends führten wir im dortigen Filmtheater ein Schattenspiel auf. Es handelte von einem menschenfressenden Fürsten im Fernen Osten, der zu guter Letzt unschädlich gemacht werden konnte. Ich gab den Erzähler und hatte unter anderem folgendes Couplet zu singen:
In dem Lande der ChinesenBin ich gar noch nie gewesen.Erstens ist der Weg zu weitUnd zweitens hab ich keine Zeit.
Das war mein erster Kontakt mit China.
Das kaiserliche Schwert
Chenchu bedeutet Perle, kostbare Perle sogar. Ein naheliegender Name in der amphibischen Landschaft der Yung-Mündung mit ihrem Labyrinth aus Flüssen, Seen und Kanälen und einer alteingesessenen Perlenindustrie. Dort kam ich am 10. Juni 1924 zur Welt. Zumindest glaubte ich das fünfzig Jahre lang, bis ich mit Robert eines Abends in einem zweitklassigen China-Restaurant in Michigan saß. Dort hing eine Tabelle, welche die chinesischen Mondjahre den um ein paar Wochen verschobenen Sonnenjahren des westlichen Kalenders gegenüberstellte. Da erst kamen wir dahinter, dass ich, in einem Jahr des Schweins geboren, eindeutig dem Jahrgang 1923 angehöre. Das Ganze lässt sich nur durch meine jugendliche Aufgeregtheit erklären, die damals, als ich die für unsere Heirat erforderlichen Papiere beibringen und dafür auch mein Geburtsdatum umrechnen musste, von mir Besitz ergriffen hatte. So dass ausgerechnet ich, zu deren Stärken Mathematik immer gezählt hatte, mich um ein Jahr zu meinen Gunsten irrte.
Ich stamme aus Ningpo, einer von Wasser umgebenen, von Wasser durchdrungenen und dank des Wassers florierenden Stadt. Ihr Name bedeutet »besänftigte Wellen«. Als sie ihn im 14. Jahrhundert von Kaiser Tschu Yün-Tschang, dem Begründer der Ming-Dynastie, erhielt, war es bereits ihr dritter oder vierter Name. Die früheren hatten sich nicht bewährt, die Stadt war mehrfach vom Wasser fortgeschwemmt worden. Mal war es als Taifun vom Himmel gekommen, mal als Hochwasser aus den Flüssen,
Dieses Buch ist 2008 als Hardcover unter dem Titel Letzte Zuflucht Schanghai im Wilhelm Heyne Verlag erschienen.
Taschenbucherstausgabe 10/2009
Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur,
München - Zürich
Umschlagfoto: Privatbesitz Robert und Julie Sokal
Innenillustrationen: Doris Detre
Lektorat: Berrit Bartlet
eISBN : 978-3-641-03836-6
www.heyne.de
Leseprobe
www.randomhouse.de