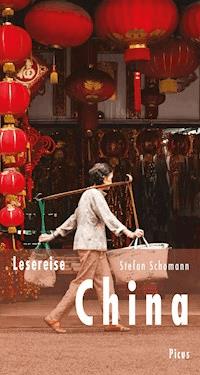19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vom Hilfswerk für verwundete Soldaten zur bedeutendsten humanitären Organisation der Welt
Unter dem Eindruck des Leidens verwundeter Soldaten auf dem Schlachtfeld von Solferino wurde 1863 in Genf eine zivile Hilfsorganisation gegründet mit dem Ziel, Verwundeten künftig besser zu helfen. Ihr Kennzeichen: das rote Kreuz auf weißem Grund. Noch im selben Jahr bildete sich in Deutschland eine erste freiwillige Hilfsgesellschaft unter diesem Zeichen.
In seinem Buch, das auf die reichen Zeugnisse in den Archiven des Internationalen und des Deutschen Roten Kreuzes zurückgreifen kann, schildert Stefan Schomann die Geschichte des deutschen Zweigs der Organisation und ihrer engagierten Mitarbeiter durch die Zeiten der Weltkriege und der deutschen Teilung hindurch bis in die Gegenwart. Er erzählt von selbstlosen Heldentaten und von politischem Missbrauch, von medizinischem Fortschritt und von den Herausforderungen, denen sich das Rote Kreuz im 21. Jahrhundert gegenüber sieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
STEFAN SCHOMANN
Im Zeichen der Menschlichkeit
Geschichte und Gegenwart des Deutschen Roten Kreuzes
Deutsche Verlags-Anstalt
Die Abbildung zeigt Utensilien und Dokumente Henry Dunants, die im Museum in Heiden aufbewahrt werden.
© J. F. Müller / DRK
Inhalt
PROLOG
KAPITEL 1 »Im Interesse der Wahrheit«
KAPITEL 2 »Angriffe auf Leib und Leben«
KAPITEL 3 »Rotes Kreuz auf weißem Grund«
KAPITEL 4 »Hilfsbereit zu jeder Stund‘«
KAPITEL 5 »Im Taumel des Krieges«
KAPITEL 6 »Wohlfahrt und Wehrkraft«
KAPITEL 7 »Im Würgegriff der Diktatur«
KAPITEL 8 »Der kalte Frieden«
KAPITEL 9 »Im Schatten der Mauer«
KAPITEL 10 »Zurück in die Zukunft«
Dank
Bildnachweis
Farbbildteil
»Kriegerheil«: Ein fast idyllisches Lazarett im Deutschen Krieg von 1866; ein rares Fotodokument des zeitgenössischen Sanitätsdienstes.
© DRK
»Das Große Los«: In den fünfziger Jahren bringt die Kinderluftbrücke elftausend Berliner Kinder zur Erholung nach Westdeutschland.
© Rotkreuzmuseum Berlin
Vor dem Dom von Castiglione erinnert ein Denkmal an die »heldenmütigen Frauen«, die sich gemeinsam mit Henry Dunant der unzähligen Opfer der Schlacht von Solferino annahmen.
© J. F. Müller / DRK
PROLOG
Ungeheuer ist viel. Doch nichts ungeheurer als der Mensch.
SOPHOKLES, ANTIGONE
Dies ist die Geschichte einer höchst unwahrscheinlichen Institution. Keiner der fünf ehrenwerten Herren, die vor 150 Jahren in einem Genfer Patrizierhaus zusammenkamen, um über die Gründung von Hilfsgesellschaften für verwundete Soldaten zu beraten, konnte ahnen, wohin die Reise gehen würde. Auch Henry Dunant nicht, der Weitblickendste unter ihnen, eine Ausnahmeerscheinung auf dem schmalen Grat zwischen Visionär und Phantast.
Doch die Bewegung wuchs und gewann mit jedem Krieg und jeder Katastrophe an Gewicht; heute gelten das Rote Kreuz und der Rote Halbmond als die bedeutendste humanitäre Organisation der Welt. Das Deutsche Rote Kreuz war von Beginn an maßgeblich an dieser Mobilmachung der Menschlichkeit beteiligt. Zugleich aber spielte es aufgrund der unheilvollen deutschen Geschichte eine problematische Rolle. Tugend, Tüchtigkeit und Täuschung lagen manchmal beunruhigend nah beieinander.
Angefangen mit Dunants Erinnerung an Solferino hat die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung einen großen Schatz an Selbstzeugnissen, Tagebüchern und Augenzeugenberichten hervorgebracht. Sie bilden das Herzstück dieses Buches. Ein Kaleidoskop der Weltgeschichte, gesehen mit den Augen der Helfer. Es sind Berichte aus vorderster Front, von Schauplätzen historischer Ereignisse – erzählt von Menschen, für die der Ausnahmezustand der Normalfall war und ist.
Henry Dunant im Alter von etwa 35 Jahren: Geschäftsmann, Philanthrop und Schriftsteller. Ein nahezu unbekanntes Porträt aus dem Besitz der Familie.
© Société Henry Dunant, Genf
KAPITEL 1 »Im Interesse der Wahrheit«
Die Reisen des Henry Dunant
Der Einsatz für die Humanität ist die Demokratie des Guten.
HENRY DUNANT
Zwischen Kirche und Kanonen: Die erste Adresse des Roten Kreuzes, die Wohnung Henry Dunants in der kleinen Genfer Rue du Puits-Saint-Pierre, im Petersbrunnensträßchen also, sie könnte symbolträchtiger kaum sein. Gegenüber erhebt sich die Kathedrale Saint-Pierre, der Petersdom des Calvinismus. Wenige Schritte weiter lauern unter den Arkaden des Zeughauses fünf blank gewienerte Kanonen. Nebenan, im altehrwürdigen Rathaus, wurde im August des Jahres 1864 die Genfer Konvention unterzeichnet, die Grundlage des modernen Völkerrechts und die Initialzündung für die weltweite Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Zwölf Staaten einigten sich damals auf diesen Kodex »zur Linderung des Loses der im Felddienst verwundeten Militärpersonen«. Heute haben fast zweihundert Staaten das Abkommen ratifiziert.
In kaum einem anderen Land, in kaum einer anderen Stadt hätte diese Initiative entstehen können. Auch wenn im Folgenden das Rote Kreuz in Deutschland im Mittelpunkt stehen soll – die entscheidende Neuerung der Bewegung war ihre Internationalität. Heute haben in Genf zwei Dutzend Weltorganisationen ihren Sitz, von den Pfadfindern über den Lutherischen Weltbund bis zur Fernmeldeunion. Sie alle haben sich dem Geist von Genf verschrieben, der mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz eine erste Ausprägung fand, die viele andere sich zum Vorbild nahmen. Sogar die zeitgleich gegründete Kommunistische Internationale zog es mit Macht nach Genf. Um Verwechslungen zu vermeiden, bezeichnete sich die Hilfsorganisation schließlich explizit als »Rotes Kreuz«. Bis dahin war sie meist einfach als »die internationale Gesellschaft« oder noch einfacher als »die Internationale« geläufig – es gab noch kaum andere. Die Signalfarbe Rot beanspruchen indes beide Bewegungen bis heute für sich.
Gustave Moynier, nimmermüder Präsident des Komitees, hielt im Juli 1870 ein schwungvolles Plädoyer in eigener Sache: »Was das eigentlich Internationale der Rotkreuzgesellschaften ausmacht, ist dieser Geist der Menschenliebe, der sie herbeieilen läßt, wo immer Blut auf einem Schlachtfeld fließt. Sie sind ein lebender Protest gegen diesen rohen Patriotismus, der jedes Mitgefühl erstickt; sie arbeiten darauf hin, diese Barrieren aus dem Weg zu räumen, die vom Fanatismus und der Barbarei geschaffen wurden.« (Anmerkung des Autors: Bei Zitaten aus historischen Quellen wurde die damals gebräuchliche Rechtschreibung beibehalten.) Nur zwei Wochen später begann der Deutsch-Französische Krieg, in dem der »rohe Patriotismus« fröhliche Urständ feierte, das Rote Kreuz zugleich aber seine erste ganz große Bewährungsprobe erlebte. Nicht von ungefähr wurde Moynier später, noch über die Genfer Konvention hinaus, einer der Väter des Völkerrechts, indem er die Haager Landkriegsordnung vorbereitete.
Bis heute wird Internationalität immer wieder als Patentrezept für Probleme aller Art betrachtet, auch wenn sie sich oft genug nur als deren Erweiterung erwiesen hat. Dennoch darf die Schaffung des Roten Kreuzes als ein Glücksfall der Geschichte bezeichnet werden. Es war die Ära der großen Weltausstellungen, der Hochindustrialisierung und des Imperialismus – der erste Durchlauf der Globalisierung, damals noch mit Europa als Zentrum. Genf wiederum lag in der Mitte Europas. Neben der Lage spielte aber auch die Sprache eine wichtige Rolle. Genf sprach Französisch, die Sprache der gebildeten Welt und der Diplomatie. Doch es gehörte eben nicht zu Frankreich, einer Großmacht, die sofort polarisiert hätte, sondern zur Schweiz, einem kleinen, aber potenten Land, das bereits in sich international war. Die Genfer Konferenzen kamen ohne Dolmetscher aus – die teilnehmenden Ärzte, Pastoren, Minister und Militärs beherrschten ganz selbstverständlich die »Lingua franca« des 19. Jahrhunderts. Zudem war Genf der rechte Ort für Utopien. Jean-Jacques Rousseau hatte hier mit seinem Gesellschaftsvertrag die Bedeutung des Gemeinwohls, der Menschenrechte und der Volksherrschaft eingeklagt. »Der eingeborene Widerwille, einen Mitmenschen leiden zu sehen«, galt ihm als Urgrund aller Humanität. Und schon 1830 hatte Jean-Jacques de Sellon in Genf eine der ersten Friedensvereinigungen der Welt begründet. Der Traum der Aufklärung, der Fortschritt der Menschheit durch Vernunft, war Mitte des 19. Jahrhunderts noch ungebrochen.
Heute ist die Altstadt von Genf mit Gedenktafeln nur so gekachelt. Etliche davon erinnern an die ersten Protagonisten, die Gründungsväter des Roten Kreuzes. Da ist die hübsche, bescheidene Villa von Guillaume-Henri Dufour. Dort das etwas klobige Haus Gustave Moyniers, in dem auch Théodore Maunoir als Mieter gewohnt hat. Hier die Avenue Appia, dort Dunants Stützpunkt zwischen Kirche und Kanonen. Einige Treppen tiefer, im Palais de l’Athénée, fand im Oktober 1863 eine internationale Konferenz statt, aus der das Rote Kreuz hervorging. Ein paar Straßenzüge dieser Stadt haben die Weltgeschichte nachhaltiger beeinflusst als manche Königshäuser.
Hier kommt Jean-Henri Dunant am 8. Mai 1828 zur Welt, als erstes von fünf Kindern. Die Eltern sind hugenottischer Herkunft und unterhalten sowohl verwandtschaftliche wie auch geschäftliche Beziehungen nach Frankreich. Vater Jean-Jacques führt in Marseille eine Handelsgesellschaft und ist weit in der Welt herumgekommen: Venedig, London, Lissabon. Die unstete Lebensführung hat Jean-Henri von ihm. Mutter Anne-Antoinette ist dagegen ausgesprochen standorttreu, eine stille, etwas ängstliche Person. Als Ausweis von Weltläufigkeit genügt es ihr, sich der Mode der Anglophilie folgend »Nancy« zu nennen. Später wird auch ihr ältester Sohn der englischen Schreibweise »Henry« den Vorzug geben. Während es Jean-Jacques immer wieder nach Marseille zieht, hütet Nancy Haus und Kinder. Je länger ihr Mann fernbleibt, desto häufiger kränkelt sie. Je mehr sie kränkelt, desto länger bleibt er weg. Schließlich lässt sie fast jeden dritten Tag den Arzt rufen. Dieser beständige Hunger nach Fürsorge muss die Kinder zwangsläufig geprägt haben. Der Älteste gründet später ein Hilfswerk, der Jüngste wird Sozialmediziner.
Eine Familienreise nach Marseille bietet dem achtjährigen Jean-Henri Anlass zu erster literarischer Betätigung: Er führt ein Tagebuch. Das Schreiben und das Reisen werden zeitlebens Passionen, ja Obsessionen für ihn bleiben. Im Rahmen seiner Verpflichtungen als Vormund besucht der Vater das Zuchthaus von Toulon. Eine ungewöhnliche Attraktion für einen Urlaub am Mittelmeer. Doch die Agenda der Familie Dunant folgt nicht touristischen, sondern moralischen Gesichtspunkten. Beständige Wohltätigkeit entspricht ihrem christlichen Selbstverständnis und gehört in ihren Kreisen auch einfach dazu.
Auf »La Monnaie«, dem Landsitz der Dunants oberhalb des heutigen Bahnhofs, verlebt Jean-Henri viele glückliche Tage. Mit prächtigem Blick auf den See und den dahinter aufragenden Montblanc »sowie die Sonnenuntergänge über diesen Gletschern, die den Königen von Sardinien gehörten«. Denn Savoyen, die Alpenregion südlich des Genfer Sees, ist damals noch Teil des Königreichs Sardinien-Piemont. Es wird eine schicksalshafte Rolle in seinem Leben spielen. Mit zwölf Jahren tritt er dann ins Collège Calvin ein. Vom Reformator selbst begründet, besteht die Lehranstalt bis heute; ein erhabener Renaissancebau, der vor Stolz und Standfestigkeit nur so strotzt. Die Mittagspause verbringt der Junge oft bei einer Tante im nahen Petersbrunnensträßchen. Das Haus hat eine kuriose Vorgeschichte: Die Familie hatte es einst erworben, um Jean-Henris Großvater nahe zu sein. Der saß zu dieser Zeit im Gefängnis, nachdem er bei Spekulationsgeschäften sein Vermögen verloren hatte. Verhaftet worden war er auf Betreiben seines Hauptgläubigers – des eigenen Bruders. Als den Enkel später ein ähnliches Schicksal ereilt, erleben die Eltern ein bitteres Déjà-vu.
1842 erscheint sein Name zum ersten Mal im Journal de Genève: Der Schüler Jean-Henri Dunant hat eine Auszeichnung in Religionslehre erhalten. Sie wird in einem feierlichen Akt in der Kathedrale überreicht. Diese Kirche auf dem höchsten Punkt des Altstadthügels bewahrt die Genfer Geschichte wie ein Zeitspeicher. Vor allem katholisch geprägte Besucher dürfte sie in Erstaunen versetzen. Denn sie ist leer. Nackt und kahl wie ein Rohbau. Kein Altar, keine Figuren, nicht einmal ein Kreuz. Dabei muss sie, als gotische Kathedrale, einst reich ausgeschmückt gewesen sein. Im Zuge der protestantischen Kulturrevolution aber haben die Bilderstürmer unerbittlich gewütet. Nur das Wort sollte hier gelten und herrschen.
Die hugenottischen Glaubensflüchtlinge waren überdurchschnittlich gebildet und wirtschaftlich erfolgreich; viele entstammten dem französischen Adel. Über halb Europa verstreut, unterhielten sie ein verzweigtes Emigrantennetzwerk. Dieses spezifische Milieu hat nicht nur die Gründer des Internationalen Komitees geprägt, sondern auch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein alle seine Mitglieder.
Das Collège Calvin ist für seine hohen Anforderungen berüchtigt; auch Jean-Henri verlässt es schließlich vorzeitig. Gleichzeitig nimmt er erste gesellschaftliche Verpflichtungen wahr und übt sich in wohlgefälligen Werken. Sonntags liest er Straftätern in der Gefängniskapelle aus der Bibel und aus Reiseberichten vor, die zeitlebens seine Lieblingslektüre bilden werden. Bei jemandem wie Gustave Moynier, seinem späteren Weggefährten und Gegenspieler, kann man sich eine derart verwegene Freizeitbeschäftigung kaum vorstellen. Die beiden kennen sich aus der Schule, haben wegen des Altersunterschieds von zwei Jahren jedoch damals keinen näheren Kontakt.
Mit neunzehn schließt sich Dunant der Genfer Evangelischen Gesellschaft an, einer sektenartigen Freikirche, die eine spirituelle Erneuerung der Reformation propagiert. Schon hier fällt er durch seine Beflissenheit auf, bewährt sich als Animateur und macht sich für eine internationale Ausrichtung stark. 1853 erhält die Gesellschaft berühmten Besuch aus Amerika: Harriet Beecher Stowe, die Verfasserin von Onkel Toms Hütte. Ihr Roman über das traurige Los der Sklaven rüttelt die westliche Welt auf und trägt in der Folge zur Abschaffung der Sklaverei bei. Fortan hat Dunant sie als leuchtendes Beispiel vor Augen, dass Unmenschlichkeit durch Bücher bekämpft werden kann.
»Der eloquente Herr Dunant«
Mitte des 19. Jahrhunderts formieren sich europaweit eine Vielzahl von Erweckungsbewegungen und Enthaltsamkeitsvereinen. Aus der Genfer Evangelischen Gesellschaft erwächst der Christliche Verein Junger Männer (CVJM), den Dunant mitbegründet. Die jungen Leute organisieren sich selbst, weder Eltern noch Pastoren nehmen Einfluss. Die erste Weltkonferenz in Paris ruft dann 1855 ein »Zentrales Internationales Komitee« ins Leben. Von der föderalen Struktur bis hinein in die Wortwahl werden sich manche Muster bei der Gründung des Roten Kreuzes wiederholen, nicht zuletzt die Entscheidung für den Standort Genf. Freilich wird auch das Muster des Zerwürfnisses wiederkehren: Nachdem er vor allem mit Maximilien Perrot anfangs ein treffliches Gespann bildet, entzweit sich Dunant bald mit seinen Mitstreitern vom CVJM. »Ich mußte ihn mäßigen«, berichtet Perrot. »Schade, daß es ihm an Urteilskraft fehlt! Sonst könnte er ein Juwel für die Union sein, er entfaltet eine erstaunliche Energie.«
Diese Einschätzung könnte ebenso gut von Gustave Moynier stammen; auch beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz sollte Dunants Übereifer mit der Ordnungsliebe und der Methodik ernsterer Gemüter kollidieren. »Beten wir für ihn, denn er wird in dieser Welt Schwierigkeiten bekommen« – mit diesem Satz sollte Perrot sich noch als Prophet erweisen. Gleichwohl werden sich einige Kontakte aus dieser Zeit über Jahrzehnte hinweg bewähren. Dass etwa an der Rotkreuzbewegung von Anfang an auch Amerikaner beteiligt sind, verdankt sich Dunants Verbindungen aus dem CVJM und der Anti-Sklaverei-Bewegung. Auch die Pastoren Hahn und Wagner, die württembergischen Delegierten auf der Konferenz von 1863, lernt er über die Arbeit im Männerverein kennen.
Die wenigen Porträts aus jenen Jahren zeigen Dunant als einen jungen Mann aus gutem Hause, unbesorgt und selbstzufrieden, ein wenig dandyhaft wirkend. Stets comme il faut gekleidet, mit Uhrkette, Querbinder und buschigem Backenbart. Weggefährten bescheinigen ihm Liebenswürdigkeit, Sendungsbewusstsein und soziale Begabung. Manchmal wirke er allerdings auch etwas aufdringlich und eigenmächtig, »der eloquente Herr Dunant«.
Mit Anfang zwanzig tritt er in das Bankhaus »Lullin & Sautter« ein, wobei seine Tätigkeit dort mehr Beschäftigung als Beruf ist. 1853 wechselt er zu einer Tochterfirma, die im Norden Algeriens Landnutzungsrechte erwerben und helvetische Siedler dafür gewinnen soll. Kaufleute, Kapitalgesellschaften, Missionare und Militärs, alle wollen in der neuen Kolonie das große Geschäft machen. Die ganze Dynamik ist den Luftschlössern der New Economy nicht unähnlich. Einige Akteure bringen es zu Macht und Reichtum, viele aber erleiden Schiffbruch. Dunants Engagement in Nordafrika fällt genau in diese Umbruchszeit.
Von Beginn an fühlt er sich in der fremdartigen Umgebung wohl: »Ich bin lebhaft an diesem Kolonisationswerk interessiert und hoffe, bald in dieses Land zurückzukehren.« Die Siedler müssen indes erfahren, dass die Zustände in Algerien nicht so rosig sind, wie die Versprechungen der Agenten es ihnen Glauben machten. Es kommt zu Spannungen mit den Einheimischen, Missernten und Krankheiten machen ihnen zu schaffen. Henry Dunant, wie er sich mittlerweile schreibt, veröffentlicht daraufhin »im Interesse der Wahrheit« zwei Berichte im Journal de Genève, in denen er kritischen Behauptungen über das Projekt entgegentritt. Außerdem erwähnt er noch, er habe in Sétif einen jungen Mann aus Schwaben kennengelernt, »dessen Charakter und Leumund vollstes Vertrauen verdienen«.
Hier taucht zum ersten Mal eine Bezugsperson aus Deutschland auf. Jener Henri Nick aus dem Allgäu betätigt sich in Sétif als Getreidegroßhändler und führt zudem eine kleine Bank. Befeuert durch Dunant, wird er später einer der ersten deutschen Rotkreuzmitarbeiter. Beide sind Mitte zwanzig, protestantischen Glaubens und erfüllt von Pioniergeist. Heute würden sie sich wohl als »Expats« titulieren, als junge Fachkräfte, die im Ausland ihre Karriere starten, dabei aber mehrmals im Jahr nach Hause kommen. Bei den römischen Ruinen von Mons wollen sie eine Mühle errichten und Getreide verarbeiten. Sie gründen die Aktiengesellschaft von Mons-Djémila, beantragen eine Konzession für fünfzig Hektar und beginnen mit dem Bau, als hätten sie die Landrechte schon in der Tasche. Nick soll die Erschließung voranbringen, Dunant das Kapital und die Genehmigungen beschaffen. Ein typisches Start-up-Unternehmen jener Jahre – mehr auf Verheißung denn auf Erfahrung gegründet.
Krieg und Wahrheit
Der Zeitpunkt könnte ungünstiger nicht sein. Die internationale Konjunktur bricht dramatisch ein, als im Sommer 1853 ein Krieg beginnt, der ganz Europa nachhaltig erschüttert. Seinen Ausgang nimmt er im sogenannten Heiligen Land. Die russisch-orthodoxe Kirche will mehr Einfluss auf die dortigen Gotteshäuser nehmen, was sowohl der Türkei wie auch Frankreich widerstrebt. Tatsächlich aber geht es vor allem um den Zugang zum Mittelmeer. Das Zarenreich sieht sich einer bunt gemischten Allianz gegenüber, zu der neben dem Osmanischen Reich, England und Frankreich auch noch das Königreich Sardinien stößt. Hinzu kommen etwa zehntausend deutsche Söldner.
Es ist ein Krieg mit deutlich verbesserten, will heißen tödlicheren Gewehren, mit Dampfschiffen und Sprenggranaten, Schreibtelegrafen und Seekabeln, Reportern und Fotografen – der erste moderne Krieg mithin, im Grunde bereits ein früher Weltkrieg, erstrecken sich die Kampfhandlungen doch von der Walachei bis nach Kamtschatka. Die Schätzungen über die Zahl der Opfer schwanken zwischen 150000 und 500000. Einigkeit besteht jedoch darüber, dass ungleich mehr Soldaten durch Hunger, Seuchen und die katastrophale medizinische Versorgung umgekommen sind als im Gefecht. Die neuartige Kampfweise des Stellungskrieges bedingt, dass Massen von Männern monatelang in provisorischen Quartieren und auf engstem Raum leben müssen. Typhus, Skorbut und Cholera wüten in beiden Lagern.
Der Krimkrieg forderte etwa 165000 Tote. Fast zwei Drittel davon starben durch Krankheiten und Seuchen, durch Hunger und Kälte.
© DRK
Zum ersten Mal begleiten Kriegsberichterstatter moderner Prägung das Geschehen. Vor allem englische Korrespondenten setzen Maßstäbe. Auf russischer Seite lassen die Sewastopoler Erzählungen eines jungen Offiziers aufhorchen: »Sie sehen hier entsetzliche Szenen, sehen den Krieg nicht in seiner schönen und glänzenden Form, mit wehenden Fahnen und Generälen auf tänzelnden Pferden, sondern in seiner wirklichen Gestalt mit Blut, Qualen und Tod.« Der noch unbekannte Autor, Leo Tolstoi, bewährt sich als teilnehmender Beobachter. »Der Held meiner Erzählung, den ich mit allen Kräften meiner Seele liebe, ist – die Wahrheit.« Tolstoi und Dunant haben mehr gemein als nur den Rauschebart im Alter. Beide Männer sind im selben Jahr geboren und gestorben, beide kommen aus der Oberschicht und engagieren sich für Bedürftige, beide führen im Alter ein Eremitenleben mit einer Neigung zum politischen Spiritismus. Vor allem aber haben sie das gleiche monumentale Lebensthema: Krieg und Frieden.
Zum berühmtesten Helden des Krimkriegs avanciert eine Krankenschwester: Florence Nightingale, »die Lady mit der Lampe«. Die Szene, wie sie, selbst krank und erschöpft, mit einem Öllicht durch die Säle geht, um nach den zahllosen Patienten zu sehen, prägt sich ins kollektive Gedächtnis ein. Ihr selbstloser Einsatz hat den Boden für den Aufbau des Roten Kreuzes mitbereitet. Gustave Moynier hat sich auf einem Kongress in London mit ihrer Arbeit vertraut gemacht. Und Dunant bezeichnet sie später gar als »Heilige«. Weniger bekannt ist dagegen seine zweite Kronzeugin aus dem Krimkrieg: Prinzessin Charlotte von Württemberg, Gemahlin des russischen Großfürsten Michael. An der Spitze von über dreihundert Pflegerinnen umsorgt sie unermüdlich Verwundete. Dunant hat sie später selbst getroffen, sie hat ihn in seinem Sinnen und Trachten bestärkt und ist zu einer wichtigen Mittlerin des Roten Kreuzes in Russland geworden.
Männer leiden, Frauen helfen – eine archetypische Szene aus dem Krimkrieg, der Florence Nightingale berühmt machte.
© DRK
So reichen denn die Wurzeln der Rotkreuzbewegung noch etwas weiter zurück als nur bis Solferino. Der Krieg am Schwarzen Meer gerät zu einer Generalprobe, bei der die Staaten Europas auf einer abgelegenen Außenbühne jene Manöver einüben, die sie bald darauf auch im Stammhaus durchexerzieren werden. Hätte Dunant – Jahrgang 1828 –einer anderen europäischen Nation angehört, er wäre ziemlich sicher eingezogen worden. Als Schweizer bleibt ihm dies erspart.
Ende 1856 aber, beim Konflikt um Neuchâtel (Neuenburg), soll auch er mobilisiert werden. Die Juraregion besitzt zugleich den Status eines Schweizer Kantons und den eines preußischen Fürstentums. Wenngleich Berlins Hoheitsansprüche nur mehr pro forma bestehen, drängen örtliche Royalisten auf Loslösung von der Eidgenossenschaft. Ihr Putsch schlägt fehl, fünfhundert Aufrührer werden gefangen gesetzt. Preußen reagiert und plant den Marsch auf Bern, die Schweiz macht daraufhin mobil. Als Dunant einberufen werden soll, schützt er eine Krankheit vor und bricht schließlich erneut nach Nordafrika auf, um weiteren Schwierigkeiten zu entgehen. Moynier hingegen nimmt als einfacher Füsilier an der »Neuenburgkampagne« teil, unter dem Oberbefehl von General Dufour. Mit Müh und Not kann der Krieg dann doch noch abgewendet werden.
Anleitung für die Löwenjagd
Die Ära des Kolonialismus ist die große Zeit der Forschungsreisenden. Auch Henry Dunant liebäugelt mit dieser Rolle, könnte er so doch seiner Leidenschaft fürs Reisen und fürs Schreiben frönen. Der Bericht über die Herrschaft von Tunis (das spätere Tunesien), den er nach seiner Ankunft in Angriff nimmt, soll sein Gesellenstück werden. Das Land ist von der kolonialen Modernisierung noch nicht betroffen und kommt so den romantischen Vorstellungen des Orientalismus, wie er zu dieser Zeit Mode wird, entgegen. Ein Jahr später wird etwa Gustave Flaubert in Tunis für seinen Roman Salambo recherchieren.
Da Dunant sich in Nordafrika eine Existenz aufbauen will, verwundert es nicht, dass er Tunesien vorteilhaft schildert: mit einem äußerst bekömmlichen Klima, einem weisen Herrscher und den besten Datteln der Welt. Neugierig beschreibt er das Leben bei Hofe und gibt allerlei Empfehlungen für seine zukünftigen Leser – vom Couscous-Rezept bis zur Löwenjagd. Tunis erscheint ihm wie ein zweites Genf, modern, geschäftig, mannigfaltig, belebt auch durch zwölftausend Europäer, die sogar eine italienische Oper unterhalten. Der Sklaverei widmet er ein eigenes Kapitel, in dem er die aufgeklärte Haltung des Beys von Tunis mit der schonungslosen Ausbeutung der Farbigen in den Vereinigten Staaten konfrontiert. »Schande über Amerika!«
So wie viele Europäer erlebt Dunant in der Fremde eine ungekannte Freiheit; störende Konventionen fallen weg. Die Tragik seines späteren Ruins besteht nicht zuletzt darin, dass damit auch der Traum von einem Leben in zwei Welten zerstört wird. Der würdige Fes, den er auf allen Altersporträts trägt, ist ein lang nachhallendes Echo seiner Liebe zum Orient. 1857 lässt er den Bericht in kleiner Auflage drucken. Das Buch ist mit dem Vermerk »unverkäuflich« versehen. Als vermögender Privatier will sein Autor sich nicht in die Niederungen des Handels begeben; es soll keine Ware, sondern eine Gabe sein. Im Journal de Genève erscheinen gleich zwei Besprechungen: »Ein ausnehmend schöner Band« … »Herr Dunant hat das Zeug zum Schriftsteller.« Durch dieses Werk kann er sich als werdender Kenner des Orients profilieren. Und es eröffnet ihm die Möglichkeit, seiner dritten großen Leidenschaft zu frönen: Er hebt eine Gesellschaft aus der Taufe. Die »Société de Géographie de Genève« bildet ein perfektes Forum für seine Ambitionen und bringt ihm zudem wertvolle Kontakte ein. Vier der späteren fünf Gründer des Internationalen Komitees sind dort Mitglied.
Kurz darauf bringt Dunant eine Huldigung an Napoleon III. heraus, den Kaiser der Franzosen und Neffen Bonapartes. Hintergrund sind seine Algeriengeschäfte. Durch den Tod seiner Tante haben er und seine Geschwister mittlerweile eine beträchtliche Erbschaft gemacht, zu der auch das Haus im Petersbrunnensträßchen gehört. Er bezieht dort eine Wohnung, nimmt eine hohe Hypothek auf und gründet eine Aktiengesellschaft, deren Kapital sich schließlich auf eine Million Franken beläuft. Palmen, Kamele und Berberaffen zieren die Anteilsscheine, die wie Illustrationen zu seinem Tunesienbuch anmuten. Der Erfolgsdruck wächst, die Kosten laufen aus dem Ruder. In der Hoffnung, seine Chancen zu verbessern, erwirbt Dunant sogar die französische Staatsbürgerschaft. Außerdem stiftet er einem Pariser Waisenhaus 40000 Franken, wohl auch, um dem französischen Staat seine Loyalität zu beweisen. Für jemanden, der geschäftlich derart in Bedrängnis ist, bedeutet das eine fahrlässige Ausgabe.
Am Ende entschließt er sich zu einer verwegenen Aktion – er will den Kaiser sprechen. Ein Machtwort von höchster Stelle könnte die Kolonialverwaltung auf Trab bringen. Die eilig verfasste Huldigungsschrift soll sein Gastgeschenk werden. Dunant stellt sich darin als hundertfünfzigprozentiger Franzose und Bonapartist dar. Er propagiert die Fortführung des Heiligen Römischen Reiches unter französischer Hoheit, mit Napoleon III. als messianischem Führer. In schwindelerregender Unbekümmertheit springt er von Nebukadnezar zu Karl dem Großen und von König Salomon zu Kaiser Konstantin. Selbst wenn diese historische Mission dem Kaiser schmeicheln sollte, tut Dunant sich damit keinen Gefallen, geriert er sich doch offenkundig als Sektierer und Phantast, der von Politik rein gar nichts versteht.
Unter normalen Umständen hätte er wohl versucht, eine Audienz in Paris zu erwirken. Aber genau zu dieser Zeit zieht Napoleon in einen Krieg gegen Österreich. Was Dunant auf die Idee eines zweiten Gastgeschenks bringt: Er will der französischen Armee Getreidelieferungen aus Mons-Djémila offerieren. In Anbetracht des Krieges ein durchaus vernünftiger Gedanke, der seine überstürzte Italienreise fundierter erscheinen lässt, als er selbst sie später dargestellt hat. Mitte Juni 1859 macht Dunant sich auf den Weg: Erst mit der Eilkutsche, dann in einem gemieteten Cabriolet – einer zweirädrigen, halboffenen Kutsche – versucht er, den Kaiser einzuholen. Es wird eine schicksalshafte Reise nach Italien.
Fratelli d’Italia
Die Lombardei ist damals seit anderthalb Jahrhunderten österreichisch. Doch diese Epoche neigt sich dem Ende zu, jenes Europa der Dynastien, in dem die Verbindungen der Fürstenhäuser wichtiger waren als die Nationalität der Untertanen. Spätestens mit den Aufständen des Jahres 1848 wird der Nationalismus zur mächtigsten politischen Kraft. In einem Geheimbündnis sind Napoleon und Camillo Benso von Cavour, Premierminister von Sardinien unter König Viktor Emanuel II., übereingekommen, das Habsburgerreich zu einem Krieg zu provozieren, um auf diese Weise die Einigung Italiens zu erzwingen. Als Gegenleistung soll Frankreich Nizza und Savoyen erhalten. Napoleon III. will sich um jeden Preis Renommee verschaffen, besitzt er doch als Abkömmling eines Usurpators noch weniger Legitimität als sein Onkel. Eine Schlappe für Österreich würde, in Verbindung mit den Gebietsgewinnen, Frankreichs Glorie mehren, und die seinige dazu.
Aufgrund ihrer Lage ist die Schweiz Nachbar aller drei Konfliktparteien – und durchaus selbst Akteur. Ein Regiment der französischen Fremdenlegion ist rein schweizerisch besetzt. Und als sich die Bewohner von Perugia, das zum Vatikanstaat gehört, dem Unabhängigkeitskampf anschließen, richtet die päpstliche Schweizer Garde dort ein Blutbad an. Die Schlüsselrolle aber spielt Savoyen, das seit jeher auch Schweizer Einflussgebiet gewesen ist. Als der Kuhhandel zwischen Cavour und Napoleon schließlich herauskommt, stehen die Eidgenossen kurz davor, in Savoyen einzumarschieren. General Dufour hat bereits den Oberbefehl für den Ernstfall erhalten. Es fehlte nicht viel, und Lehrer und Schüler wären als Feinde aneinandergeraten. Denn während seiner Jugend im Exil hat der spätere französische Kaiser an der Schweizerischen Militärschule in Thun unter Dufour eine Ausbildung zum Artilleriehauptmann absolviert.
Auch nördlich der Alpen verfolgt man den Krieg gespannt. Die Sympathien für Italien werden von der Furcht vor einem Wiedererstarken Frankreichs in Schach gehalten. Immer mehr Politiker und Militärs rufen dazu auf, »den Rhein am Po zu verteidigen«. Der Deutsche Bund steht kurz vor dem Kriegseintritt, wodurch Frankreich eine zweite Front droht. Doch »die unerwartet kurze Dauer des Feldzuges vereitelte die Aussicht auf Beteiligung für unsere Armee«, rekapituliert Generalfeldmarschall von Moltke wenig später, sichtlich enttäuscht.
Ende April 1859 überschreiten österreichische Truppen die Grenze zum Piemont. Nach kleineren Gefechten kommt es am 4. Juni bei Magenta westlich von Mailand zur ersten großen Schlacht. Die Österreicher unterliegen und weichen bis an den Mincio zurück, der im Südosten des Gardasees entspringt. Franzosen und Italiener sammeln sich weiter westlich am Ufer des Chiese. Zwischen den beiden Heeren liegen dreißig Kilometer Niemandsland.
»Mein lieber, einziger Engel«: Beinahe täglich schreibt Franz Joseph an seine Frau Elisabeth in Schönbrunn. Ihre Beschwerden nehmen ihn zusätzlich in Anspruch – der Kreislauf, die Nerven, die Schwiegermutter. Halbherzig übernimmt sie die Schirmherrschaft eines Hilfsvereins und richtet ein Spital für Verwundete ein. Auch schickt sie dem Kaiser modernen Lesestoff wie die Illustrierte Über Land und Meer, die später noch eine Rolle spielen wird. Das Vorgehen der Österreicher ist von ständigem Hü und Hott geprägt, unerklärliches Zaudern und überstürzter Tatendrang wechseln einander ab. Auch Napoleon macht trotz seiner Ausbildung beim Schweizer Militär keine glückliche Figur, und nur die Unentschlossenheit des Gegners bewahrt ihn vor einem Fiasko. Mit dem italienischen Oberkommando ist er ebenso zerstritten wie dieses untereinander. Die allgemeine Konfusion betrifft auch die Sanitätsabteilungen. Ein Großteil des medizinischen Materials der französischen Armee ist in Genua geblieben. Manche Regimenter haben überhaupt keine Ärzte, andere noch nicht einmal Krankenpfleger, so dass Militärmusiker für sie einspringen müssen.
Im Ganzen bietet sich das Bild dreier Armeen, deren ärgster Feind die eigene Führung ist. Bei den Italienern ist die Zahl der Desertionen am höchsten, die der Verluste folglich am geringsten. Auch die Österreicher sehen sich mit etlichen Tausend Fahnenflüchtigen konfrontiert, überwiegend Italiener in ihren Diensten. Einer von ihnen wird unversehens eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Roten Kreuzes spielen – als Dunants Kutscher, der ihn durchs Kampfgebiet fährt. Wäre der Schweizer einige Wochen früher angereist und hätte beispielsweise versucht, nach der Schlacht von Magenta bei Napoleon vorzusprechen, so wäre die Hilfsorganisation wohl nie entstanden. Zwar ist auch hier die Zahl der Opfer hoch – rund 15000 Tote und Verwundete –, doch in Solferino wird sie dreimal höher liegen. Vor allem aber können die Verwundeten mit der Eisenbahn evakuiert werden, und mit Mailand liegt eine Großstadt in der Nähe, die über Krankenhäuser und Vorräte verfügt. Dunant hätte dort sicher ebenfalls geholfen – aber die Not wäre geringer gewesen, und er hätte vermutlich auch keine »Erinnerung an Magenta« veröffentlicht.
Feindberührung
Von kleineren Konflikten abgesehen, hat Europa bis dahin vier Jahrzehnte lang keinen Krieg mehr erlebt. Magenta und Solferino werden daher auch zu Laboratorien der Chirurgie, die sich mit neuartigen Verwundungen konfrontiert sieht. Mehrere Schweizer Ärzte eilen nach Italien, um zu helfen. Darunter Louis Appia, einer der späteren Begründer des Internationalen Komitees. Selbst piemontesischer Herkunft, stellt er sich einem Turiner Frauenverein zur Versorgung von Verwundeten zur Verfügung. Innerhalb weniger Wochen sieht er dabei über zehntausend verletzte Soldaten. Auch Hermann Demme, einen angesehenen Arzt aus Bern, zieht es an diesen »großartigen militär-chirurgischen Schauplatz«, der ihn in seiner Auffassung bestärkt, dass die Lehrbücher umgeschrieben werden müssen: »In den letzten Feldzügen waren die Schusswunden derart in den Vordergrund getreten, dass Verletzungen durch blanke Waffen kaum mehr in Betracht kamen.« Auch wenn noch herkömmliche Vorderladergewehre und Kanonen zum Einsatz kommen, so sind sie doch erheblich verbessert worden, was Reichweite und Treffsicherheit angeht – sofern man dies als Verbesserung anzusehen gewillt ist. Die Franzosen erproben bereits Salvengeschütze, Vorläufer der Maschinengewehre. Zur gleichen Zeit kommen Granaten auf; der Begriff verdankt sich denn auch dem italienischen Wort für Granatapfel. Außerdem erfolgt über Solferino die erste Luftaufklärung der Geschichte. Im unübersichtlichen Hügelland sind alle Beteiligten brennend an den Manövern des Feindes interessiert. Der französische Starfotograf Nadar soll mit einem Ballon aufsteigen, um die österreichischen Stellungen auszukundschaften. Doch der Versuch erbringt nicht viel, und so herrscht auf beiden Seiten Unklarheit über die Position und die Stärke des Gegners, ja selbst über die der eigenen Truppen. Niemand ahnt, dass der Feind nur wenige Kilometer entfernt biwakiert.
Am 23. Juni eröffnet Napoleon seinem Verbündeten Viktor Emanuel, dass er seine Truppen wegen der drohenden preußischen Mobilmachung wohl bald zurückziehen muss. Hätten die Österreicher in ihren Stellungen ausgeharrt, womöglich hätte die Schlacht von Solferino gar nicht mehr stattgefunden. So aber wird sie zu einer der blutigsten des 19. Jahrhunderts. Noch hat Henry Dunant nicht die leiseste Vorstellung von seiner künftigen Mission, doch er hätte sich keinen geeigneteren Konflikt aussuchen können, um aller Welt die Dringlichkeit flankierender humanitärer Maßnahmen vor Augen zu führen.
Der 24. Juni 1859 ist nicht nur einer der längsten, sondern auch einer der heißesten Tage des Jahres. Die Sonne heizt die Ebene auf wie ein Backblech, weshalb die Truppen meist nachts marschieren. Die Franzosen wollen zum Mincio vorstoßen, wo sie die Österreicher verschanzt glauben. Diese wiederum haben sich entschlossen, den Feind am Chiese zu stellen, wo sie ihn immer noch vermuten. Die ersten Einheiten prallen am Morgen gegen halb fünf aufeinander. Binnen weniger Stunden formt sich eine fast dreißig Kilometer lange Front. Insgesamt stehen einander rund 300000 Mann und 25000 Pferde gegenüber, auch wenn letztlich nicht alle Einheiten eingreifen. Die Operation im Morgengrauen verläuft unkoordiniert, viele Soldaten sind schlaftrunken. Mit unfreiwilliger Komik bezeugt dies auch ein Ausspruch Napoleons: »Unerwarteterweise sehe ich 100000 Österreicher auf mich losrücken.« Kettenrauchend verfolgt er das infernalische Getümmel; und auch wenn er sich um demonstrative Abgebrühtheit bemüht, kommt ihm am Ende buchstäblich das Kotzen.
Italiener und Franzosen setzen kampferprobte Einheiten aus dem Krimkrieg ein, dazu Legionäre aus ganz Europa. Aufseiten der Franzosen sind die Zuaven besonders gefürchtet, Berber aus Algerien, die mit ihren roten Pluderhosen und den Quasten am Fes einen exotischen Anblick bieten. Sie stammen just aus jener Region im Atlasgebirge, in der Dunant sein Glück machen will. Auch Österreich bietet Soldaten all seiner Länder auf. Und so tobt zwischen Chiese und Mincio eine zweite Völkerschlacht.
Wie nähert man sich einem Schauplatz, an dem vor anderthalb Jahrhunderten eine Katastrophe stattgefunden hat? Meist werden bedeutende Schlachten in der Nähe unbedeutender Orte geschlagen, an denen sich weder vorher noch nachher viel begeben hat. Nur an diesem einen Tag war alles anders – in Solferino wurde Geschichte erzwungen.
Es ist sicher nicht die schlechteste Methode, mit Menschen zu sprechen, die sich das damalige Geschehen in geduldiger Kleinarbeit erschlossen haben. Menschen wie Luigi Lonardi, der etliche Jahre lang Bürgermeister von Solferino war. Ein ehemaliger Kunstlehrer, ein politischer Quereinsteiger, der Ende der neunziger Jahre ins Amt kam. Es war die Zeit der »Mani pulite«, der sauberen Hände, die in Italien einen Neuanfang in Politik und Verwaltung zuwege bringen sollten. Während die meisten Solferino-Forscher vornehmlich Texte als Quellen heranziehen, hat Lonardi sich als Augenmensch vor allem für die Bilder jener Zeit interessiert und Kupferstiche, Lithographien und Ansichtskarten zusammengetragen. Unter den zahllosen Ausgaben, die Dunants folgenreiche Erinnerung an Solferino weltweit erlebt hat, ist die von ihm besorgte Edition die am schönsten illustrierte.
Feldherrnperspektive: Napoleon III. verfolgt das Kampfgeschehen rund um den Burghügel von Solferino.
© ullstein bild
Lonardi lebt am Fuß des Burghügels von Solferino. Anders als im Norden verebben die Alpen im Süden nicht allmählich, sondern gehen unvermittelt in die Po-Ebene über. Nur hie und da schwingen sich ein paar Moränenhügel auf. Der Gletscher, der den Gardasee schuf, deponierte hier sein Geschiebe. Von der mittelalterlichen Burg sind nur mehr Mauern, Wirtschaftsgebäude und eine trutzige Kirche erhalten. Feierlich wie Kerzen ragen dahinter Zypressen auf. Schwalben flitzen um die Häuser, Oleander flockt über die Mauern. Doch wenn Lonardi zu erzählen beginnt, bricht die Idylle. Er weiß genau, wo Napoleons Gefechtsstand war, welche Artillerie von welchem Hügel feuerte und wo sich später all die Maler und Zeichner postierten, um die Schlacht in ihren Bildern fortleben zu lassen.
Bei seinen Recherchen ist er nur auf zwei Fälle gestoßen, bei denen Zivilpersonen ums Leben kamen. Dennoch bedeutet der Krieg damals für die Bevölkerung eine Heimsuchung. Die drei riesigen Armeen beschlagnahmen alles, was sie an Vorräten, Nutztieren und Transportmitteln finden. Auf beiden Seiten haben Ärzte und Pfleger mit den Verwundeten von Magenta noch alle Hände voll zu tun. Bei den Franzosen ist derart wenig Verbandszeug verfügbar, dass selbst des Kaisers Tischdecken zerschnitten werden. Ein plastisches Bild vermittelt der Bericht von Pawel Oszelda, eines polnischen Arztes in österreichischen Diensten. Sein Ulanenregiment kommt direkt in Solferino zum Einsatz und richtet in der Kirche am Burghof einen Verbandsplatz ein: »Wir ließen alles heraustragen und mit Stroh füllen. Am Anfang, da drängte sich jeder, damit er etwas zu tun bekam. Gegen drei Uhr aber füllten sich auch noch der Vorplatz und der Kirchgarten. Auf zehn Ärzte kamen mehr als zweitausend Verwundete.«
Am Nachmittag betreut Oszelda ganz allein die Verletzten im Burghof, aus Angst vor den feindlichen Kugeln wagt sich sonst niemand mehr hinaus. Als die Franzosen schließlich zum Sturm ansetzen, muss auch er den versprengten Resten seines Regiments hinterherhasten. An die tausend Verwundete bleiben zurück und erwarten den hereinstürmenden Feind. »Der Rückzug aus Solferino wird mir im Leben unvergeßlich bleiben«, bekennt der junge Arzt. Hätte die Genfer Konvention damals schon bestanden und hätte auf dem Kirchlein eine Rotkreuzfahne geweht, um es als Feldlazarett auszuweisen, die Arbeit des Pawel Oszelda wäre zwar immer noch riskant, aber doch erheblich sicherer gewesen. Vor allem hätte er dann fortfahren können, zu operieren.
Mit der Erstürmung des Burghügels durch die französische Armee war die Schlacht von Solferino entschieden.
© DRK
Souvenirs aus Solferino: Kugeln, Münzen, Instrumente, die teilweise auf dem Schlachtfeld selbst gefunden wurden.
© J. F. Müller / DRK
Der Kaiser von Österreich dirigiert seine Divisionen vom nahen Cavriana aus, wo er in der Villa Mirra standesgemäßes Quartier genommen hat. Mit ihren Mosaikfußböden, Marmorsäulen und Arkaden vermittelt sie bis heute eine Ahnung von der einstigen Grandezza Italiens. In den Zedern dröhnen die Zikaden. Natürlich kennt Lonardi auch den letzten Befehlsstand Seiner Majestät. Eine Lindenallee führt hinauf zu diesem betörend schönen Ort, den eine romanische Kapelle krönt. Die langen Hügelreihen schimmern im Abendlicht, seidig glänzen Federwolken im hohen Blau des Himmels. Von hier hat sich Franz Joseph und seinen Generälen der klassische Feldherrenblick geboten. Am Ende muss die österreichische Armee sich geschlagen über den Mincio zurückziehen. Napoleon rückt in Cavriana ein, quartiert sich in ebenjener Villa Mirra ein und legt sich schließlich in das Bett, in dem sein Kontrahent tags zuvor noch genächtigt hat. Nicht ohne vorher ein Telegramm an die Kaiserin aufzugeben: »Grande bataille! Grande victoire!«
Zum Jahrestag der Schlacht lebt das Kriegsgeschehen hier wieder auf. Doch die seinerzeit beteiligten Menschenmassen lassen sich unmöglich nachstellen. Selbst Kostümfilme und Historienschinken müssen sich mit einigen Hundert Komparsen begnügen. Die Zahl der damals eingesetzten Soldaten aber entspricht dem Fassungsvermögen der vier größten deutschen Fußballstadien, zum Bersten voll mit Männern. Von der alljährlichen Reanimation in San Martino würde man daher zunächst nur Mummenschanz mit Platzpatronen erwarten. Doch gerade weil hier eine sehr italienische Mischung aus Pathos und Volksbelustigung geboten wird, lässt sich im Rückschluss etwas von der Erbarmungslosigkeit des realen Geschehens erahnen.
San Martino war die Front der italienischen Truppen. Zum Jahrestag nehmen zweihundert Mitwirkende und einige Tausend Zuschauer an einem Abhang Aufstellung. Eine Blaskapelle intoniert die Nationalhymne, die während des Unabhängigkeitskrieges entstand. Unter dumpfen Trommelschlägen rücken die Regimenter mit wehenden Fahnen heran. Sie tragen lange Flinten mit Ladestöcken und Bajonetten, dazu lederne Tornister und Feldflaschen. Garantiert unverwechselbar sind die Bersaglieri mit ihren mächtigen Federbüschen. Die Österreicher ziehen in blütenweißen Jacken, kornblumenblauen Hosen und Husarenhelmen in die Schlacht. Die Kaiserliche Garde nimmt in den Farben der Trikolore Aufstellung. Publikumslieblinge sind die verwegenen Zuaven mit ihren goldbetressten Jacken und den roten Puffhosen.
Dann bebt die Luft und dröhnt die Erde. Kanonen feuern, die Truppen formieren sich, die Kavallerie prescht mit gezückten Säbeln heran. Attacke! Kürassiere und Tirailleure, Freischärler und Cacciatori delle Alpi – sie alle werfen sich mit Ingrimm auf den Feind. Es kracht und qualmt in einem fort; mittendrin erwarten die Pferde seelenruhig das nächste Kommando. Wohl eine Stunde lang tobt so auf historischem Felde die Schlacht. Am Ende triumphiert Italien, und ein Geschwader roter, weißer und grüner Luftballons entschwebt in Richtung Solferino. Danach sind die Tavernen voll und die Krieger ermattet. Alle haben sie mitgesiegt.
Der Tag danach
Zur wohl berühmtesten Passage aus Dunants Erinnerung an Solferino gerät jene, in der er den Morgen nach der blutigen Schlacht heraufbeschwört. »Die Sonne des 25. Juni beleuchtet eines der schrecklichsten Schauspiele, das sich erdenken läßt. Das Schlachtfeld ist bedeckt mit Leichen von Menschen und Pferden. In den Straßen, Gräben und Wiesen liegen überall Tote. Die Dörfer sind gezeichnet von den Verwüstungen. Die Einwohner haben sich zwanzig Stunden im Keller verborgen; jetzt kommen sie hervor. Ihr verstörtes Aussehen zeugt von den Ängsten, die sie ausgestanden haben.« Tausende von Schwerverletzten sind auf dem Schlachtfeld verblieben, auf das die Sonne unbarmherzig herunterbrennt. Viele verbluten, krepieren elendig in der Hitze. Über den Feldern hängt jener abstoßende, mit nichts zu vergleichende Geruch, wie nur Kadaver ihn verbreiten. Diebe und Leichenfledderer nehmen Gefallenen und Schwerverletzten Tornister, Waffen und Kleidung ab. Jeder ist sich selbst der Nächste. Auf den Straßen herrscht heilloses Chaos. »Da war eine Confusion von Blessierten, Flüchtlingen, Wägen und Pferden«, berichtet der geschlagene Kaiser Franz Joseph von den Turbulenzen des Rückzugs. Ein paar Tage später stattet er einem Veroneser Krankenhaus einen Besuch ab, »wo dreißig Offiziere liegen, einige amputiert. Sie werden vortrefflich behandelt. Auch die Schwestern leisten außerordentlich gute Dienste. Wenn wir nur mehr bekommen könnten.«
Wie schon während des Krimkriegs, verfolgen auch hier Korrespondenten das Geschehen. Darunter Henry Jarvis Raymond, Mitbegründer der New York Times. Am Tag nach der Schlacht berichtet er aus Castiglione: »Die Hauptstraße war voll von Fuhrwerken, Ochsen und Soldaten. Eine Prozession von Verwundeten zog zu einer Kirche, die in ein Krankenlager umgewandelt worden war. Es war der schauerlichste Zug, dem ich je begegnet bin. Einige Gesichter waren von Säbelhieben zerschnitten. Vielen waren die Arme zerschmettert worden, Hunderte trugen die Hände verbunden. Diese Prozession währte von zehn Uhr morgens bis nach Einbruch der Dunkelheit.«
Von Brescia her kommend, trifft auch Dunant am Morgen nach der Schlacht, also am 25. Juni 1859, in Castiglione ein. Das belegen seine Aufzeichnungen und die Überlieferung der Familie Pastorio, in deren Palazzo er damals logiert hat. Sein Kutscher hat ihn zu einem der wenigen Häuser gebracht, die ihm für einen solch vornehmen Herrn geeignet scheinen. In den Tagen zuvor hat die Adelsfamilie ihr Domizil französischen Offizieren zur Verfügung gestellt. Darunter ein gewisser Alphonse Mennessier, Kapitän der Kaiserlichen Garde, dessen Bruder vor Kurzem bei Magenta gefallen ist. Am Morgen des 24. Juni hat er sich eilig von ihnen verabschiedet und ist nicht mehr zurückgekehrt.
Doch schon tags darauf steht ein neuer Gast ins Haus. Er fällt durch seinen hellen Tropenanzug auf. Der durchaus gerechtfertigt ist angesichts der afrikanischen Hitze, die seit Tagen über der Po-Ebene brütet, der aber wohl zugleich seine koloniale Kompetenz betonen soll. Wäre Dunant in Pozzolengo oder Montichiari abgestiegen, er wäre wohl geblieben, was er war – ein kleiner Irrläufer in einem großen Krieg. So aber konnte er Geschichte schreiben.
Der Palast gehört noch immer der Familie. Die derzeitige Hausherrin ist Kunsthistorikerin, ihr Mann lehrt Judaistik in Berlin. Ihre Bibliothek umfasst 30000 Bücher. Dunants Zimmer ist bis heute fast unverändert geblieben, mit Diwan und Kommode im Empire-Stil, Betschemel und illusionistischer Deckenbemalung. Vom schmalen Balkon aus geht der Blick direkt auf den Domplatz. Der damals mit Versehrten, Sterbenden und Toten übersät gewesen sein muss.
Bis zu diesem Moment, bis zum ungläubigen Blick über das Heer der Leidtragenden, hat Dunant noch den Plan gehegt, beim Kaiser im nahen Cavriana vorzusprechen. Doch nun beginnt sich eine Wandlung zu vollziehen, die den Rest seines Lebens bestimmen wird. Nur zehn Ärzte sind verfügbar, am nächsten Tag gar nur mehr sechs, darunter ein Cousin der Pastorios. Dunant versucht, »gemeinsam mit einigen hiesigen Frauen die Ärzte notdürftig zu ersetzen«. Die meisten sind einfache Landfrauen, doch auch seine beiden Gastgeberinnen packen mit an. Am Domplatz erinnert heute ein Standbild an die »Donne eroiche« von Castiglione, denen das Rote Kreuz seinen ersten Schlachtruf verdankt: »Tutti fratelli!« Sie sind alle Brüder. Im Gefecht zählt die Uniform, nicht der Mensch. Im Lazarett kehrt sich die Perspektive wieder um.
Die Kirche ist in aller Eile zum Behelfskrankenhaus umfunktioniert worden. Die Szenerie gleicht jener, die Pawel Oszelda tags zuvor in Solferino erlebt hat: Die Bänke sind hinausgetragen worden, der Boden ist mit Stroh aufgeschüttet. Dunant verbindet Wunden, besorgt Wäsche, verteilt Suppe. »Bei vielen braucht es nur einen Schluck Wasser, ein Lächeln, ein tröstendes Wort, das ihre Gedanken auf den Erlöser lenkt – und schon erwarten diese Männer tapfer und in Frieden den Moment des Dahinscheidens.«
Als Nothelfer in Castiglione zählt er selbst zur Basis, wie heute die vielen freiwilligen Helfer des Roten Kreuzes. Anschaulich beschreibt er die Energie, die Menschen in einer solchen Grenzsituation zuwächst: »Der sittliche Gedanke, daß das menschliche Leben wertvoll sei, der Wunsch, die Qualen so vieler Unglücklicher zu lindern, die unablässige Aktivität, all dies ruft eine neue, äußerste Tatkraft hervor.« Im selben Atemzug aber gesteht er seine Überforderung ein: »Jedes Gefühl erlischt angesichts dieser Tragödie. Völlig gleichgültig geht man an Leichen vorbei.« Diese Gleichzeitigkeit von Euphorie und Abstumpfung werden Rettungshelfer aus vergleichbaren Situationen bestätigen. Es ist die notwendigerweise widersprüchliche Reaktion des menschlichen Bewusstseins auf die Konfrontation mit massenhaftem Leid.
Nichts war gefährlicher, als die Schlacht zu überleben. Die damalige Medizin lässt sich mit der heutigen in keiner Weise vergleichen. Die Bedeutung der Antisepsis etwa wird allenfalls erahnt, aber kaum praktiziert. Wegen der Gefahr des Wundbrands sind Amputationen an der Tagesordnung. Da es jedoch noch kaum Schmerz- und Narkosemittel gibt, müssen die Betroffenen den Eingriff bei vollem Bewusstsein erleiden. Zwar experimentieren die Ärzte bereits mit Chloroform, Lachgas oder auch mit dem Pfeilgift Curare, haben diese Mittel aber noch nicht hinreichend unter Kontrolle. Nur einen Stoff gibt es, der zwar nicht den Schmerz, so doch die Panik und Verzweiflung der Verwundeten wenigstens etwas zu lindern vermag: Tabak. »Viele hatten bei der Operation die Pfeife im Mund, und mehrere rauchten noch in dem Augenblick, als sie starben.«
Das Solferino-Prinzip
Am Montag schickt Dunant seinen Kutscher nach Brescia, um Vorräte, Tabak und Verbandszeug zu kaufen. Am Abend besinnt er sich dann doch auf die Audienz beim französischen Kaiser. Als er seine Erlebnisse drei Jahre später zu Papier bringt, erwähnt er diesen eigentlichen Zweck seiner Mission mit keinem Wort. Stattdessen führt er sich als »einfachen Touristen« ein – als hätte er die Schönheiten Oberitaliens ausgerechnet während des Krieges besichtigen wollen. Auch der Abstecher zum Hauptquartier erfolgt scheinbar zufällig: »Gegen sechs Uhr fahre ich aus, um die Frische des Abends zu genießen …« Auf halbem Wege lässt er in Solferino halten. »Ich habe diese Schauplätze in Augenschein genommen. Der Anblick hat mich krank gemacht.« In Cavriana wird er schon am Tor der Villa Mirra abgewiesen. Woraufhin er sich umgehend nach dem Aufenthaltsort von Marschall Mac-Mahon erkundigt, dem militärischen Oberbefehlshaber in Algerien. Die nun folgende nächtliche Irrfahrt auf der Suche nach dem General könnte auch aus Tolstois Krieg und Frieden stammen. Sie nähern sich gefährlich dem Mincio und damit den feindlichen Linien, so dass der Kutscher es mit der Angst zu tun bekommt: »Er wurde bei dem Gedanken, so nahe am Feinde zu sein, von einer derartigen Furcht ergriffen, daß ich gezwungen war, ihm die Zügel aus der Hand zu nehmen.« Der Warnschuss eines französischen Postens erschreckt sie bis ins Mark, und als dann auch noch ein versprengter Österreicher den offenen Wagen beschießt, ist wohl nicht nur der Kutscher mit seinen Nerven am Ende.
Patrice de Mac-Mahon empfängt den Gast am nächsten Morgen. Dunant berichtet von den verheerenden Zuständen in Castiglione und setzt sich dafür ein, gefangene österreichische Ärzte zur Unterstützung heranzuziehen. Vermutlich bringt er dann auch seine Mühle und die Getreidelieferungen zur Sprache. Gegen zehn Uhr hält er wieder vor der Villa Mirra, wo er diesmal zumindest bis zum Adjutanten vordringt. Er überreicht ihm seine Huldigungsschrift, an eine Audienz aber ist nach wie vor nicht zu denken. Ob Napoleon das Traktat tatsächlich gelesen hat, ist ungewiss, doch ein Routinebillett seiner Eingabestelle, das ein Bote wenig später überbringt, lässt Dunant daran glauben. Zurück in Castiglione, nimmt dieser sich einen weiteren Tag lang der Verwundeten an. »Ihre Gesichter sind schwarz von Fliegen; ihre Blicke schweifen nach allen Seiten, ohne eine Antwort zu erhalten. Bei einigen bilden Mantel, Hemd, Fleisch und Blut eine schauervolle Mischung. ›Lassen Sie mich nicht sterben!‹ rufen manche und ergreifen mit außerordentlicher Kraft meine Hand; sobald aber die letzte Anspannung erschlafft, brechen sie tot zusammen.« Für andere schreibt er Briefe an deren Angehörige, als Lebenszeichen oder letzten Gruß.
Noch immer fehlt es in Castiglione an fast allem. Erschüttert wendet Dunant sich an die Comtesse de Gasparin in Genf, die er aus seinen religiösen Zirkeln kennt: »Seit drei Tagen sehe ich inmitten unerhörten Leids, wie alle Viertelstunde eine Seele die Welt verläßt. Verzeihen Sie, Madame, aber ich schreibe Ihnen unter Tränen; ich kann nicht fortfahren. Man ruft mich wieder.«
Sein Notschrei wird veröffentlicht: im Journal de Genève (unter »Vermischtes«) sowie in der Pariser Wochenzeitung L’Illustration. Und schließlich machen sich drei Theologiestudenten und ein Pastor mit Hilfsgütern auf in die Lombardei. Ermutigt durch Louis Appia, helfen sie in den Lazaretten aus und verteilen Zucker, Zitronen, Pastillen. Aber auch calvinistische Schriften – was im katholischen Italien als Missionierung angesehen wird. Am Ende landen sie als Spione im Gefängnis. Auch helfen will gelernt sein. Schon diese erste Mission zeigt, dass gute Absichten allein noch lange nicht zum Ziel führen und dass die Hilfsmannschaften zwangsläufig in die politische und kulturelle Landschaft eines Krisengebiets hineingezogen werden.
Unterdessen fährt Dunant zurück nach Brescia. Auch dort sind Klöster und Kirchen in Lazarette umgewandelt worden. »Ich finde einige meiner Verwundeten wieder. Sie werden jetzt besser gepflegt, aber ihre Prüfungen sind noch nicht zu Ende.« Und dann folgt, auf vier Seiten, die Beschreibung einer Beinamputation, die einem die Haare zu Berge stehen lässt. Insgesamt bleibt er drei Wochen im Kriegsgebiet. Er scheint eine natürliche Autorität als Helfer zu besitzen. Demonstrativ nimmt er sich vor allem der Österreicher an, damit diese nicht vernachlässigt werden. Wesentliche Elemente der Rotkreuzarbeit sind in seinem Einsatz bereits vorgeformt: die Pflege der Verwundeten durch Freiwillige, ungeachtet von Rang und Nationalität, die Neutralität des Sanitätspersonals, die menschenwürdige Behandlung von Gefangenen, die Suche nach Vermissten und die Korrespondenz mit den Angehörigen. Auch Spendenaufrufe und Öffentlichkeitsarbeit gehören schon dazu. Henry Dunants entscheidende Leistung als Vordenker wird es dann, aus dieser intuitiven Praxis eine exemplarische Angelegenheit zu machen und das Prinzip von Solferino auf Kriege aller Art zu übertragen.
Sein Brief an die Comtesse de Gasparin wird in der Literatur gelegentlich zitiert. Doch bezeichnenderweise ohne die Nachschrift, die er noch angefügt hat. Denn sie berührt ein Thema, das in humanitären Angelegenheiten stets heikel war und ist: Es geht ums Geld. »Ich habe um die tausend Francs für Hemden, Zigarren und Arznei ausgegeben. Falls ein Komitee willens wäre, sie mir zu erstatten, wäre ich damit einverstanden; sonst würde ich es eben selbst übernehmen.« Ist das den Biographen vielleicht peinlich? Wirft es einen Schatten auf die Lichtgestalt? Der gute Mensch von Solferino, die Verkörperung des Edelmuts – er hält die Hand auf. Betrachtet man diese Äußerung jedoch im Licht seiner Biographie, kann man sie durchaus als gesunden Reflex der Selbsterhaltung ansehen, der ihm später abhandenkommt. Aus kaufmännischer Sicht war die Aktion ein Fehlschlag. Er hat keine Audienz bei Napoleon erlangt, geschweige denn seine Kolonialgeschäfte vorangebracht. Er hat allen Grund, sein Budget zusammenzuhalten. Wirklich wichtig daran ist jedoch, dass ebendieser Brief wenig später die Keimzelle seiner Erinnerung an Solferino bilden wird.
Heute pilgern alljährlich Tausende von Rotkreuzhelfern nach Castiglione, um den Jahrestag der Schlacht zu begehen. Und damit auch den Jahrestag jener Idee, die wenig später den Namen und das Zeichen des Roten Kreuzes tragen sollte. Sie kommen aus Düsseldorf und Rosenheim, aus Rom und Cesenatico, aus Kärnten und Korea. Höhepunkt des Programms ist der Fackelzug von Solferino nach Castiglione. Die meisten Teilnehmer, darunter viele Jugendgruppen, übernachten in einer Zeltstadt. Auf dem Parkplatz gibt sich eine Armada von Rotkreuzfahrzeugen ein Stelldichein. Die Stimmung ist ausgelassen, halb Sommerfest, halb Ferienlager. Trotzdem vermittelt diese Zusammenkunft eine Ahnung davon, wie es in einem Ernstfall zugehen würde. Die Regie hat denn auch Roberto Antonini, Leiter des Katastrophenschutzes beim Italienischen Roten Kreuz. Das Camp verfügt über hallenartige Druckluftzelte mit Stockbetten, fahrbare Generatoren, Ventilatoren mit Sprühnebel, einen Küchenwagen, eine Kommunikationszentrale und einsatzbereite Ambulanzen. Das Wichtigste, meint Antonini, sei es, für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.
Historische Krankenkarre im Rotkreuzmuseum von Castiglione.
© J. F. Müller / DRK
Bei Einbruch der Dunkelheit setzt sich der Konvoi am Burgberg von Solferino in Bewegung. Hochrufe und Trommeln schallen durch die sonst so stillen Gassen. Rot ist die vorherrschende Farbe; nur die italienischen Rotkreuzschwestern setzen mit ihren himmelblauen Kostümen einen farbigen Kontrast. Acht Kilometer lang geht es nun durch leicht gewelltes Hügelland. Langsam erlischt das Himmelslicht, bis nur noch das Lauffeuer der Fackeln zu sehen ist. Seit zwanzig Jahren wird diese Prozession veranstaltet. Eine der Initiatorinnen ist Maria Grazia Baccolo. Sie leitet das Rotkreuzmuseum in Castiglione, das den Weg der Institution von den Anfängen bis in die Gegenwart nachzeichnet. Was auf den ersten Blick wirkt wie die Instrumente eines Folterknechts, entpuppt sich als Besteckkasten eines Feldchirurgen: Skalpelle, Sonden, Gefäßklemmen, Säge. Mit solchen Instrumenten arbeitete Pawel Oszelda im Kugelhagel von Solferino. Das Souterrain beherbergt eine ungewöhnliche Oldtimersammlung: Pferdebahren und Krankenkarren in verschiedensten Ausführungen, mit mannshohen Rädern und ausgetüftelter Mechanik, um Stöße abzufedern. Bis heute verwenden Notfallhelfer fahrbare Tragen, denen die gleichen Bauprinzipien zugrunde liegen. Das Museum verkörpert auch selbst ein Stück Rotkreuzgeschichte: Es wurde 1959 vom damaligen Bürgermeister begründet, der kurz zuvor aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt war, als einer der letzten Italiener. Nur aufgrund einer Postkarte des Suchdienstes vom Roten Kreuz wussten Angehörige und Behörden um seinen Verbleib und konnten schließlich seine Freilassung erwirken. Zum hundertsten Jahrestag der Schlacht rief er dann das Museum ins Leben.
Wenn Häuser ein Gedächtnis haben, so erleben die Gassen des Städtchens jetzt ein Déjà-vu. Wieder ist die Hauptstraße vollgepfropft mit Menschen, wieder zieht eine endlose Prozession vorbei, doch diesmal heiter und gelöst. Auf der Zielgeraden passiert der Zug grüßend das Museum, bevor er schließlich vor der gravitätischen Kulisse des Doms endet, gleich neben dem Palazzo Pastorio, in dem der Gast aus Genf damals logierte. Aus dem spontanen Samaritertum eines Einzelnen ist eine Weltorganisation entstanden, vom gleichen Geist getragen.
Für Rotkreuzmitglieder aus aller Welt wird Solferino am 24. Juni, dem Jahrestag der Schlacht, zum Pilgerziel.
© J. F. Müller / DRK
Die Blumen der Erinnerung
Nach 1859 müssen Europas Landkarten neu gezeichnet werden. Österreich tritt die Lombardei ab, und zwei Jahre später ist Cavour schließlich am Ziel: Er wird der erste Premierminister des Königreichs Italien. Auch Napoleons Rechnung geht zunächst auf, der militärische Erfolg verschafft ihm innenpolitischen Rückhalt. Paris wird zur Metropole des Zweiten Kaiserreichs umgebaut und erhält dabei einen Boulevard de Magenta und eine Place de Solférino. Die Donaumonarchie blendet ihr Nationalitätenproblem trotz dieser Niederlage weiter aus. Das Festhalten an der Idee des Imperiums wird Franz Joseph auch persönlich noch teuer bezahlen müssen: Sein Bruder Maximilian wird in Mexiko hingerichtet, seine geliebte Frau Elisabeth ausgerechnet in Genf von einem italienischen Anarchisten erstochen. Als schließlich ein bosnischer Partisan den Thronfolger erschießt, zettelt Österreich einen Weltkrieg an. Von Solferino führt ein langer Weg bis Sarajewo.
Laut Clausewitz ist der Krieg die Fortsetzung des politischen Verkehrs mit anderen Mitteln. Im folgenden Jahrzehnt greifen Europas Regierungen immer häufiger zu diesen anderen Mitteln. Der Krieg in Italien bewirkt eine spürbare Militarisierung des öffentlichen Lebens; Pathos und Propaganda bestimmen den Zeitgeist. Seinen sichtbarsten Ausdruck findet er in den großen Schlachtenpanoramen. Diese Riesenrundgemälde sind die Imax-Kinos der Belle Époque. In eigens dafür errichteten Rotunden verherrlichen sie patriotische Sternstunden. »Die französischen Siege bringen unablässig militärische Gemälde hervor«, berichtet Charles Baudelaire nach dem italienischen Feldzug. Selbst er, der feinsinnige Ästhet, kann sich der »brutalen und gewaltigen Magie« der Schlachtenpanoramen kaum entziehen. Mit Unterstützung Napoleons produziert Jean-Charles Langlois ein zweitausend Quadratmeter großes Rundbild von Solferino, das an den Champs-Élysées aufgebaut wird. Gut hunderttausend Besucher bestaunen es pro Jahr. Wenn es eine Geschichte gibt, die den Widersinn der modernen Kriege versinnbildlicht, dann ist es das Schicksal dieses Malers und seiner Gemälde. Langlois ist als junger Offizier bei Waterloo verwundet worden und hat sich danach ganz auf militärische Sujets verlegt. 1871 werden während der Belagerung von Paris mehrere seiner Panoramen zerstört. Die übrigen gelangen in seine normannische Heimat, wo sie dann 1944 bei Rückzugsgefechten der Wehrmacht in Flammen aufgehen.
Die beiden eindrucksvollsten Mahnmale aber entstehen in Solferino und San Martino. Am Fuße jenes Hügels, auf dem die Schlacht alljährlich nachgestellt wird, führt ein Kiesweg zu einem alten Bethaus. Es verfügt über alles, was eine Kapelle braucht – Sitzbänke, Weihwasserbecken und einen kleinen Altar mit großem Kruzifix. Das übrige Inventar aber ist denkbar ungewöhnlich: Von der Krypta bis zur Decke sind die Wände mit den Knochen von Gefallenen bedeckt. In der Gruft liegen die Gebeine von 2619 Soldaten, in der Apsis prangen 1413 Totenschädel; ähnlich viele sind es im Beinhaus von Solferino. Bleich und hohläugig lagern sie in riesigen Apothekerregalen, manche unversehrt, andere mit geborstenen Hirnschalen. Der Tod, der große Demokrat, kennt weder Freund noch Feind.
Elf Jahre nach der Schlacht wurden Tausende von Skeletten aus Friedhöfen, Feldern und Massengräbern exhumiert. Einer dieser Schädel muss jenem Kapitän Mennessier gehört haben, der einen Tag vor Henry Dunant im Palazzo Pastorio logiert hatte. Denn nachdem er gefallen war, entspann sich eine bewegende Korrespondenz zwischen den beiden Schwestern und Mennessiers Eltern in Metz. Sie bestanden darauf, dass auch die Gebeine ihres Sohnes in die Gedenkstätte überführt würden. Im Stillen hofften sie, dass dabei noch persönliche Gegenstände zutage kommen könnten, ein Knopf seines Waffenrocks vielleicht oder ein Medaillon. Es sind herzzerreißende Briefe zwischen einem Elternpaar, das sich in tiefer Trauer verzehrt, und den »chères et bonnes Demoiselles«, deren taktvolles Mitgefühl ihnen Halt bietet. Ohne dass beide Seiten einander je begegnen, entwickelt sich über Jahrzehnte hinweg eine sehr persönliche Verbindung. »Ich verbringe mein Leben damit, die Blumen der Erinnerung auszustreuen«, bekennt der achtzigjährige Vater noch in seinem letzten Brief.
Die Namen der gefallenen Österreicher in der Kapelle lesen sich wie ein Querschnitt durch den Vielvölkerstaat der Donaumonarchie: Wenzl Matejka, Lajos Molnár, Anton Haberzettel, Daniel Vlaisavlevic, Antonio Dezente. Jeder dieser Männer kam an einem anderen Ort zur Welt, jeder zu einer anderen Zeit. Gestorben sind sie alle am selben Tag und am selben Fleck. Dieses Kolosseum des Schreckens bildet den makaberen Schlusspunkt der Schlacht. Wohl nur ein Volk von der expressiven Frömmigkeit der Italiener konnte ein solches Arrangement ersinnen. Die Düsternis der römischen Katakomben, die Inbrunst der mittelalterlichen Märtyrerverehrung, der Todeskult des Barock und das Pathos des Nationalstaats, das alles vereint sich hier zu einer Apotheose der Trauer. Die beiden Beinhäuser gerieten so drastisch und so explizit, wie kein modernes Mahnmal es mehr zu sein wagte.