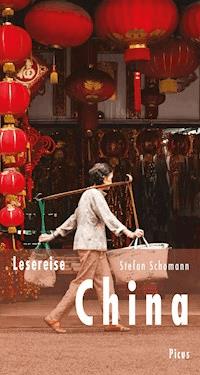24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sie sind Lebensadern und Geheimnisträger, Grenzscheiden und Handelswege, Wasserreservoire und Kraftorte. Sie bringen Fruchtbarkeit wie Zerstörung, wecken namenloses Unbehagen wie zehrende Sehnsucht. Auch wenn die meisten Flüsse heute bekannt, schiff- oder paddelbar sind: Die Faszination für sie und ihre Geschichten ist ungebrochen. Stefan Schomann ist jahrelang auf und an Flüssen gereist, von mächtigen Strömen wie dem Amazonas bis zur beschaulichen Hase im Emsland. Er taucht in die Quelle der Sorgue, raftet im Himalaja, erkundet die Karsthöhlen, die die Reka gegraben hat, begleitet einen Seenotretter im südafrikanischen Pondoland und einen Vogelflüsterer am chinesischen Nu Jiang. Er frönt einigen der letzten Urlandschaften der Erde, durchstreift jedoch auch mythologische Gefilde und widmet sich den Flüssen des Paradieses ebenso wie denen des Totenreichs. Seine Erzählungen mäandern und strömen. Er sucht das Wesen des Wassers zu ergründen und sondiert weltweit Beispiele für einen zeitgemäßen Umgang mit Natur. Voller Neugier verweilt er bei den Menschen, die an den Ufern leben. Und so bekommt man größte Lust, es ihm gleichzutun und fortzureisen an den nächsten Fluss – oder in weite Ferne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Stefan Schomann
Vom Wesen der Flüsse
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Stefan Schomann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Stefan Schomann
Stefan Schomann, 1962 in München geboren, arbeitet als freier Schriftsteller. Seine Reportagen, Portraits und Feuilletons erscheinen u. a. in GEO, Stern, ZEIT und der FR. Seine Bücher behandeln China, die Geschichte des Roten Kreuzes und zuletzt das Reisen zu Pferd. Auf der Suche nach den wilden Pferden (2021) lobte die FAS als »das wohl außergewöhnlichste Buch, das je über Pferde geschrieben wurde«. 2019 wurde er dafür mit dem »Eisernen Gustav« ausgezeichnet. Schomann ist Kulturbotschafter der chinesischen Geschichtenerzähler und Ehrenbürger des Dorfes Ma Jie. Er lebt in Berlin und Peking.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Sie sind Lebensadern und Geheimnisträger, Grenzscheiden und Handelswege, Wasserreservoire und Kraftorte. Sie bringen Fruchtbarkeit wie Zerstörung, wecken namenloses Unbehagen wie zehrende Sehnsucht. Auch wenn die meisten Flüsse heute bekannt, schiff- oder paddelbar sind: Die Faszination für sie und ihre Geschichten ist ungebrochen.
Stefan Schomann ist jahrelang auf und an Flüssen gereist, von mächtigen Strömen wie dem Amazonas bis zur beschaulichen Hase im Emsland. Er taucht in die Quelle der Sorgue, raftet im Himalaja, erkundet die Karsthöhlen, die die Reka gegraben hat, begleitet einen Seenotretter im südafrikanischen Pondoland und einen Vogelflüsterer am chinesischen Nu Jiang. Er frönt einigen der letzten Urlandschaften der Erde, durchstreift jedoch auch mythologische Gefilde und widmet sich den Flüssen des Paradieses ebenso wie denen des Totenreichs.
Seine Erzählungen mäandern und strömen. Er sucht das Wesen des Wassers zu ergründen und sondiert weltweit Beispiele für einen zeitgemäßen Umgang mit Natur. Voller Neugier verweilt er bei den Menschen, die an den Ufern leben. Und so bekommt man größte Lust, es ihm gleichzutun und fortzureisen an den nächsten Fluss – oder in weite Ferne.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Lisa Neuhalfen
Covermotiv: Moody skies over glacial outflow river, Iceland, Skogar
© mauritius images / Blickwinkel / Alamy / Alamy Stock Photos
Lektorat Angelika Winnen
Gestaltung Dorothea Roll
ISBN978-3-462-31325-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Förderhinweis
Mottos
Wasser, das zum Wasser geht
Aufspringen, Kreisen, Wälzen …
Der Mississippi
Die Hase
Die Flüsse von Pondoland
Nu Jiang & Co.
Die Sorgue
Nachschrift
Der Colorado
Der San Juan
Die Düssel
Die Lena
Die Trishuli
Der Amazonas
Die Loisach
Andante Cantabile
Accelerando
Larghetto
Allegretto Agitato
Andante Con Moto
Andante Maestoso
Ad Libitum
Der Hudson
Der Ubangi
Die Spree
Die Reka
Sirenengesang
Danksagung
Die Arbeit an diesem Buch wurde durch das Programm »Neustart Kultur« gefördert.
»Flüsse und Ströme fließen dahin. …
So müßte man lieben: treu und flüchtig.«
Albert Camus, Bordtagebuch
»Noch dünkt die Welt mir schön, und das Aug entflieht
Verlangend nach den Reizen der Erde mir.«
Friedrich Hölderlin, Der Neckar
Wasser, das zum Wasser geht
Anstelle eines Vorwortes
Manchmal sieht man im tibetischen Hochland einen Mönch am Ufer eines Flusses stehen. Von weitem hat es den Anschein, als ob er angelte. Doch er senkt an einer Schnur eine Art Tafel ins Wasser, lässt sie ein Stück davontreiben und holt sie dann wieder ein, um sie erneut davontreiben zu lassen. An der Unterseite der Tafel sind Stechformen befestigt, die sonst dazu dienen, das Bildnis Buddhas in Lehmziegel einzuprägen.
Andere wiederum benutzen Druckstöcke der heiligen Schriften und stempeln damit das Wasser. Auch sie stehen über Stunden am Ufer, versenken die Tafeln in die Fluten und sich in die Zeit. So erwerben sie spirituelle Verdienste. Dazu findet man allerorten wassergetriebene Gebetsmühlen, die, indem sie sich drehen, ein Mantra in die Welt setzen, nicht anders als ihre landgestützten Entsprechungen. Die Flüsse tragen diese Lobpreisung hinaus ins Land bis ins unendlich ferne Meer. Noch sind sie schmal und seicht, und ihre heimischen Namen dürften außerhalb des tibetischen Sprachraums nur wenigen ein Begriff sein: Senge Tsangpo, Yarlung Tsangpo, Dza Chu, Dri Chu, Ma Chu. Als Indus, Brahmaputra, Mekong, Jangtsekiang und Huang He aber kennt sie alle Welt.
Flüsse sind Trägermedien, sie speichern und übermitteln Informationen. Das kann mit traditionellen Mitteln geschehen wie im Fall der frommen Mühlen. Oder wie beim Fischervolk der Gbanzili an den Ufern des Ubangi, das, wie wir sehen werden, die »Hüter des Flusses« mit Tänzen und Gesängen so lange herbeiruft, bis sie erscheinen. Oder etwa mit einer Flaschenpost. Oder mit eimerweiser Farbe und schwimmenden Korkstückchen, mit deren Hilfe man im 19. Jahrhundert versuchte, Flüssen wie der Reka auf die Schliche zu kommen, die unter dem slowenischen Karstplateau abtauchen und erst kurz vor der Adria wieder zum Vorschein kommen. Es kann aber genauso mit moderner Technik geschehen. Bei einem denkwürdigen Abendessen in den Ruinen der Kraftwerksstadt Prypjat erzählten mir drei Hydrobiologen, dass ihre Sonden wenige Stunden nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Fluss Prypjat und kurz darauf auch im Dnjepr erhöhte Radioaktivität anzeigten. Am nächsten Tag flogen sie mit einem Hubschrauber von Kiew aus ein, um die Verseuchung der Gewässer zu überprüfen. Zu diesem Zeitpunkt war noch nichts von dem Unfall nach außen gedrungen; erst zwei Tage später brachte die Prawda eine unscheinbare Meldung, dass es bei einem Brand im Kraftwerk zwei Tote gegeben hätte. Sie aber wussten es besser.
Der Fluss als Herold. Das wäre ein erster Wesenszug, einer von etwa einem halben Dutzend, die in diesem Buch eine tragende Rolle spielen. Natürlich gäbe es mehr, doch sie alle zu behandeln wäre weder möglich noch wünschenswert. Leonardo da Vinci plante ein Leben lang ein Werk über die Sprache des Wassers, doch bei den Plänen ist es dann auch geblieben. Der 2023 erschienene UNESCO-Report über »Flusskultur« in aller Welt umfasst neunhundert Seiten, und dennoch lernt man diese langgezogenen Großlandschaften darin nicht wirklich kennen. Das Thema geht zwangsläufig gegen unendlich, und es lässt sich weder mit den Mitteln der Wissenschaft noch mit denen der Poesie auch nur annähernd ausschöpfen.
Ich bin vor allem jenen Eigenarten von Fließgewässern nachgegangen, die meinen Neigungen entsprechen. Das beginnt mit ihrer immensen geographischen Bedeutung. Flüsse gehören zu den prägenden Zügen in der Physiognomie einer Landschaft. Sie durchziehen jeden bewohnten Kontinent, und selbst die Antarktis kennt saisonale Schmelzwasser. Ihre geschichtsbildende Kraft manifestierte sich am Nil, im Zweistromland und am Indus ebenso wie am Jangtsekiang und am Hoang He. In dieser Phase der frühen Hochkulturen waren Gewässer und Kultur fast Synonyme. Der Fluss als eine elementare Geländeform also. Der Fluss als Lebensgrundlage. Der Fluss als Schöpfer.
Zugleich haftet ihnen stets etwas Unsolides, Asoziales an, sie bilden eine nie ganz geheure Alternative zum Festland, stehen für das große Andere, die nomadische Verheißung. Zudem sind sie eingeschworene Anarchisten; die einzige Macht, der sie gehorchen, ist die Gravitation. Von Land aus erscheinen sie als Hindernis, vom Wasser aus als Weg. Einerseits erschweren oder unterbinden sie den Kontakt der Menschen untereinander – die Klage, »das Wasser war viel zu tief«, schallt durch die Jahrhunderte. Andererseits dienen sie als Handels- und Kulturrouten erster Ordnung. In manchen Regionen stellten sie lange die einzigen Fernverbindungen dar; im Amazonastiefland, im Kongobecken sowie in weiten Teilen Sibiriens und des subarktischen Kanada sind sie es bis heute.
Eine weitere, damit zusammenhängende Funktion ist die der Verortung. Eine eigene Disziplin, die Hydronymie, befasst sich mit der Herleitung von Gewässernamen. Oft bilden sie die ältesten Namen in der Region überhaupt, und vielfach entstammen sie Idiomen, von denen sonst kaum etwas übriggeblieben ist, auch ihre Sprecher nicht. Doch deren klangvolle Wortschöpfungen – Tunguska, Athabasca, Niagara, Guadalquivir, Mamberamo, Iguaçu – erwiesen sich als unzerstörbar. Riesige Staatsgebilde in Afrika bezogen ihre Namen von Flüssen, zwei vom Niger, zwei vom Kongo, aber auch kleinere wie Gambia und Senegal. Indien und selbst Indonesien leiten sich vom Indus ab. In Südamerika zeugen etwa Paraguay (»Wasser, das zum Wasser geht«) und Uruguay (»Fluss des bunten Vogels«) davon. In Nordamerika gaben Flüsse zahlreichen Bundesstaaten und Provinzen ihre Namen, von Minnesota (»Trübes Wasser«) bis Ohio (»Großer Fluss«) und von Yukon über Saskatchewan bis Québec. Im kleinteiligen Europa kam das dagegen kaum je vor, allenfalls als Beiname. So fungiert das vielgerühmte Österreich laut Bundeshymne als das Land am Strome, zuvor war es als Donaumonarchie geläufig. Oft dienen Flüsse als Adresszusatz für Städte in Verwechslungsgefahr, etwa Frankfurt an der Oder, Marburg an der Drau, Rothenburg ob der Tauber, Kirchheim unter Teck oder Verden an der Aller, obwohl es gar kein zweites Verden gibt, nur Verdun. Davon dann allerdings mehrere: Verdun-sur-Meuse, Verdun-sur-Garonne, Verdun-sur-le-Doubs. Der Fluss als Pate; getauft wird nun einmal mit Wasser.
Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Flüsse Identität stiften und der Selbstvergewisserung dienen können, lieferte China in den achtziger Jahren, als es seine beste, freieste Zeit erlebte. Eine kulturphilosophische Fernsehserie mit dem Titel Fluss-Elegie sorgte damals für landesweite Diskussionen. Der immer mehr versandende, immer mehr ins Hintertreffen geratende Huang He, oft als Wiege der chinesischen Zivilisation betrachtet, geriet zur zentralen Metapher für die Notwendigkeit einer geistigen und politischen Erneuerung.
Die nächste Eigenart wäre der Fluss als strategische Barriere. In den Geographischen Grundlagen der Weltgeschichte bemerkt Hegel: »Denn Ströme und Meere sind nicht als dirimierend (trennend) zu betrachten, sondern als vereinend.« Nun ist nicht jeder in Dialektik geschult, und als eingefleischte Fußgänger erleben wir Fließgewässer sehr wohl als skandalöse Hindernisse. Coronados Mannen irrten wochenlang am Grand Canyon entlang und mussten schließlich unverrichteter Dinge kehrtmachen, woraufhin die Conquista Nordamerikas für anderthalb Jahrhunderte zum Erliegen kam. Und die Wolga hielt die Reiterheere der Mongolen, denen weder westliche noch chinesische Truppen Paroli zu bieten vermochten, ein halbes Jahr lang in Schach, bis sie zufror und ihnen so den Weg nach Europa eröffnete.
Wer einen solch übermächtigen Gegner bezwingt, den kann nichts mehr aufhalten. So überschritt Cäsar den Rubikon, so geriet Leutzes Washington Crossing the Delaware zum berühmtesten Gemälde der Vereinigten Staaten, so besiegelte die Vereinigung sowjetischer und amerikanischer Truppen an der Elbe die Niederlage Deutschlands. Flüsse haben das Schicksal ganzer Imperien entschieden. Alexanders Rückzug entlang des Indus geriet ebenso zum Fiasko wie der Napoleons über die Beresina. Die Nibelungen marschierten mit dreizehntausend Mann die Donau abwärts bis zum Hof des Hunnenkönigs Etzel. Nur »der Pfaffe schwamm nach Kräften: er hoffte zu entgehn«. Und kam als Einziger mit dem Leben davon. Für andere erwies sich General Wasser als Verbündeter. Nachdem Hannibals Armee handstreichartig die Rhone überquert hatte, trieb sie mit ihren Elefanten und ihrer Kavallerie die römischen Fußtruppen in die reißende Trebbia. Im Ersten Weltkrieg brachte das »Wunder an der Marne« den deutschen Vormarsch auf Paris zum Stillstand. Zwei Jahrzehnte später fand Japans Invasion in Südostasien im Nu Jiang ihren Meister.
Seen sind sesshaft, Flüsse nomadisch. Reine Bewegungsenergie; der Wasserkreislauf als Perpetuum mobile. In diesem Buch folge ich einigen von ihnen, in Schiffen und Booten, zu Fuß, per Fahrrad, auch mal im Auto oder zu Pferd. Dabei handelt es sich um Reisen entlang von Reisen, um Erzählungen von Erzählungen: jeder Bach eine Geschichte, jeder Fluss ein Roman, jeder Strom ein Epos. Vom Wasser haben wir’s gelernt. Warum aber muss der, dem das Wandern niemals einfiel, ein schlechter Müller sein? Warum ist es nicht des Maurers oder des Metzgers Lust? Weil sie, die Müller, ohnehin an Wasserläufen leben? Weil ihre Mühlen, klipp, klapp, an rauschenden Bächen rattern, Metronome verflossener Zeitläufte? Oder vielleicht einfach nur, weil Wilhelm Müller, der Verfasser der Wanderschaft, seine Freude an diesem Kalauer hatte?
Der Fluss als Fluchthelfer. Von allen Funktionen liegt dieser heillos romantische Wesenszug mir wohl am nächsten; so gesehen sind sämtliche Geschichten in diesem Band Eskapaden. Flüsse infizieren uns mit Fernweh – und bieten sich zugleich als Kur dagegen an, als Mittel gegen unersättlichen Weltenhunger. Jeder von ihnen unternimmt selbst eine Reise, und jeder kann einen roman fleuve davon erzählen.
Es besteht eine besondere Beziehung und Wesensverwandtschaft zur Literatur, allein schon über den Erzähl-, Schreib- und Lesefluss. Unsterblich jene inständige Anrufung Chateaubriands, der sich im Schlusssatz seines Romans über die Natchez wünscht, sein Bericht vermöchte dahinzuströmen wie die Fluten des Mississippi: »Puisse mon récit avoir coulé comme tes flots, ô Meschasebé!«
Ob nun Der stille Don, Die Brücke über die Drina, Die Liebe in den Zeiten der Cholera oder Frauen vor Flußlandschaft – die literarischen Beispiele für Hydrophilie sind Legion. Nicht wenige Autorinnen und Autoren nutzten Flüsse zudem als Inspirationsquellen. So schipperte der junge Simenon einige Jahre lang auf einem Hausboot über Gewässer aller Art, teilweise mit seiner Frau und dem Hausmädchen. Zunächst wohl aus finanziellen Gründen, doch auch, weil jedes Städtchen, das er anlief, ihm Stoff für Kriminalromane bot, die er bald buchstäblich wie am Fließband schrieb. »Ich wollte Frankreich entdecken, doch nicht von der Straße oder der Eisenbahn aus. Ich wollte die Kehrseite der Medaille sehen. Wenn man vom Fluss her kommt, stellt sich eine Kleinstadt anders dar als von der Straße. Dann entdeckt man ihr wirkliches, ihr ältestes Gesicht.« Bewaffnet mit einem Bleistift, durchstreifte er ein paar Stunden lang die Gassen, kehrte dann zurück zum Boot, klappte den Deckel der beiden Kochplatten herunter und postierte darauf seine Schreibmaschine. »Am Ufer der Ems schrieb ich meinen ersten Maigret.« Das Boot trug den eigenwilligen Namen Ostrogoth, Ostgote, ein Nachhall der Völkerwanderung. Innerhalb von drei Jahren entstanden darauf fast dreißig Romane. Das war kein Schreibfluss mehr, das war ein Schwall.
Petrarca ließ sich an der Quelle der Sorgue nieder, der »Königin aller Bäche«, und er wurde nicht müde, sie zu besingen. Thoreau bekannte unumwunden: »Ohne Seen und Flüsse würde ich verdorren. Ich weiß sehr wohl, dass mein Körper ihren Wassern entsprungen ist.« Joseph Conrad gelangte auf dem Kongo nicht nur bis ins Herz der Finsternis, sondern auch zu literarischem Weltruhm. Und als Graham Swift einmal gefragt wurde, was er denn sein wollte, wenn er nicht Schriftsteller wäre, antwortete er: »Ich wäre gern für einen Flussabschnitt verantwortlich, wäre gern Flusswart.«
Den einen bringen sie Leben, den anderen den Tod. Georg Heym ertrank in der Havel, Michael Holzach ausgerechnet in der Emscher. Virginia Woolf, ein Wasserwesen par excellence, ging aus freien Stücken in den Ouse, mit schweren Steinen in den Taschen.
A way a lone a last a loved a long the / riverrun – so endet, so beginnt, so strömt und zirkuliert es, in James Joyce’s Finnegans Wake nämlich, diesem Redeschwall zweier Waschweiber an der Liffey, die der Bewusstseinsstrom bis in ozeanische Gefilde schwemmt, tell me all, tell me now. Tausende von Flussnamen sollen in diesen Hypertext verwoben sein.
George Orwell und B. Traven entlehnten ihre Pseudonyme Wasserläufen, Lenin benannte sich nach Sibiriens mächtigstem Strom, nur Vilém Flusser hieß immer schon so. Mark Twain bezog nicht nur seinen Künstlernamen aus der Lotsensprache, er schuf mit Huckleberry Finn auch das Urbild des Stromers, der fluiden Existenz. Selbst der Neanderthaler verdankt, wie wir sehen werden, seinen Namen einem literarischen Pseudonym, das ihn davor bewahrt hat, als schnöder Düsselthaler in die Vorgeschichte einzugehen.
Von Beginn an war Wasser auch eines der bevorzugten Motive der Malerei und der Fotografie. Es ist das romantische Element schlechthin, seiner hypnotischen Wirkung wie seiner Symbolkraft wegen. Wahlweise repräsentiert es das Leben, die Zeit, die Seele, die Freiheit, die Bewegung. Quellen stehen für »die wollüstigen Ursprünge«, wie Novalis sagte, »das Urflüssige«. Nicht nur metaphorisch schrieb er der Natur ein Bewusstsein zu; entsprechend versteht er Kunst als »die sich selbst betrachtende Natur«. Kein Wunder, dass Romantik und Fotografie sich dann in gemeinsamer Hydrophilie begegneten. Wasser ist selbst ein lichtempfindliches, protofotografisches Medium. Weshalb wäre der Geist Gottes sonst über den Wassern geschwebt, wenn nicht, um sich darin zu spiegeln? Sie erzeugen ein Ebenbild, können es aber auch jederzeit wieder verschwimmen lassen. Das erste fotografische Panorama der Welt entstand 1848, ein anderthalb Meter langer Bilderbogen von drei Meilen Flussfront des Ohio. Und an einem Aussichtspunkt auf der Bastei hoch über dem Elbtal erinnert eine historische Felsritzung an den Wegbereiter der Naturfotografie in Deutschland. Sie ist in feierlichem Latein gehalten, übersetzt lautet sie: »Hermann Krone malte hier 1853 als Erster mit Licht.«
Der Künstler Mario Reis gestaltet seit vier Jahrzehnten »Naturaquarelle«, und er gestaltet sie gemeinsam mit Flussläufen, »interaktiv«, wie er sagt. Dazu spannt er quadratische Leinwände in ihnen auf und lässt das Wasser mehrere Tage darüber- und hindurchlaufen. Pigmente, Sedimente und organisches Material lagern sich darauf ab, parallel wirken Parameter wie Zeit, Strömung und Licht auf sie ein. Bis zu vierzig solch elementarer Bilder vereinigt er dann zu einem großformatigen Mosaik. Die Grundidee kam ihm ausgerechnet an den Ufern der Seine, der Fluss-Ikone der Impressionisten. Tausendfach ist sie gemalt worden – auf seinen Bildern malt sie sich nun selbst. »Das Wasser gibt dem Tuch einen Teil von seinem Wesen«, meint Reis. So entstehen abstrakte Aquarelle, »die aber realistischer nicht sein könnten, denn es ist tatsächlich der jeweilige Fluss in seiner Substanz«. Wieder die Heroldfunktion, nur dass das Wasser hier in eigener Sache tätig wird. »Ich nutze die Strömung wie einen Pinsel. Der Fluss ist Subjekt und Objekt meiner Malereien zugleich.«
Die ästhetischen und die therapeutischen Qualitäten von Wasserläufen sind voneinander nicht zu trennen. Betrachten wir sie also gemeinsam: der Fluss als Sensation. Wasser, Süßwasser zumindest, beglückt uns per se; hier lässt sich’s leben. Eine schöne Landschaft, so würde es wohl Christian Ihrenberger ausdrücken, der an der oberen Loisach für die Wildbäche zuständig ist, eine schöne Landschaft ist eine, die uns taugt. Die unseren evolutionären Bedürfnissen entspricht, die wie für uns geschaffen scheint. Kein Geräusch vermittelt so sehr die Essenz des Lebens wie das Plätschern eines Springbrunnens. So erzeugt Wasser auch seelische Energie. An den Gestaden der türkisfarbenen Soča in den Julischen Alpen verläuft ein »Energieweg«, auf dem gestresste Besucher sich beim Schauen aufs Wasser wieder aufladen. Flüsse entschleunigen uns, weil sich die Zeit in ihnen löst. »Man kann kaum begreifen, warum ein Kahnführer je sterben sollte«, befand Stevenson. Immer vorausgesetzt, dass der Fluss schwingt. It don’t mean a thing if it ain’t got that swing. Je stärker er begradigt wurde, desto mehr verkümmern seine Heilkräfte. Ein Kanal entfaltet allenfalls noch homöopathische Wirkung.
Von diesen segensreichen, lebensspendenden Kräften der Flüsse wird hier mehr die Rede sein als von ihren fatalen und zerstörerischen. Wobei beide Seiten für die Altvorderen zusammenfielen, bei ihnen waren Faszination und Furcht noch ungeschieden, weshalb sie der Natur den sprichwörtlichen Heidenrespekt entgegenbrachten, wussten sie darin doch stets übernatürliche Mächte am Werk. Im Altertum hatten, quer durch Europa, alle großen Flüsse ihre Gottheiten, bei kleineren mochten auch Halbgottheiten genügen. Es dürfte einfacher sein, jene wenigen Gewässer aufzuzählen, die nicht als heilig oder wenigstens beseelt galten, in denen nicht zumindest eine Nymphe oder ein kleiner Wasserhold hausten. Vom Heiligen zur Heilung brauchte es nur mehr einen kurzen Schritt – der sensationelle Fund römischer Münzen in der Fontaine de Vaucluse legt ebenso beredtes Zeugnis davon ab wie die Hortfunde in den Höhlen der Reka.
Womit wir beim Fluss als Subjekt, als Persönlichkeit wären. Jacob Grimm hat in seiner 1835 erschienenen Deutschen Mythologie, einem wahren Jahrhundertbuch, zusammengetragen, was von den vorchristlichen Naturreligionen noch überliefert war. »Vor den neuen göttern bestand ein alter naturdienst.« Diese Verehrung der Elemente sei, so Grimm, »der letzte, kaum austilgbare heidnische überrest; nach dem zerfall der götter treten die nakten stoffe wieder vor«, an erster Stelle »das lautere, rinnende, quellende und versiegende wasser«. Dieser animistischen Praxis kann der Göttinger Freigeist seinen Beifall nicht versagen: »Solch ein cultus ist einfacher, freier und würdiger als das dumpfe niederknien vor bildern und götzen.« Neben den Friesen hatten sich die Slawen sowie die baltischen Stämme als besonders resistent gegen die christliche Gehirnwäsche erwiesen, darunter auch die Prußen, die Altpreußen also. Grimm berichtet: »den Christen wurde von den Samländern und Preußen der zugang zu den hainen und quellen verwehrt, um dieselben vor entweihung zu schützen. gebet, opfer und gericht wurde an der quelle gehalten.« Als ein deutscher Siedler Mitte des 17. Jahrhunderts eine Mühle am heiligen Fluss Võhandu im heutigen Estland errichtet, zürnen ihm, wo nicht die Götter, so zumindest die Bauern. Sie brennen die Mühle ab und reißen ihre Grundpfähle aus dem Wasser, bedeutet sie doch »eine entweihung des heiligen baches, der keine hemmung in sich leide«.
Nicht totzukriegen, dieser »letzte, kaum austilgbare überrest« … So wie die Flüsse des slowenischen und dinarischen Karstes über weite Strecken unterirdisch verlaufen und bis zu sieben verschiedene Namen tragen, da man keine Verbindung zwischen den einzelnen Abschnitten sah, so gehen auch in der Geistes- und Kulturgeschichte Strömungen bisweilen gänzlich in den Untergrund, um dann sehr viel später und an unvermuteter Stelle wieder zutage zu treten. Scheinbar längst verflossene Vorstellungen von einer beseelten Natur feiern heute fröhliche Urständ. Doch diese Bestrebungen gehen weder von neuheidnischen Schwärmern noch von sektiererischen Ökofuzzis aus – nein, die drögen Juristen sind es, die ihnen ein Comeback bescheren. Begriffe wie »Tiefenökologie«, »Erdfürsorge«, »natürliche Mitwelt« und »ökologischer Rechtsstaat« machen die Runde. Kann und soll der Natur eine eigene Rechtspersönlichkeit zuerkannt werden, um sie aus ihrer Schutzlosigkeit zu befreien und die Gesellschaft zu veranlassen, vorsichtiger und respektvoller mit ihr umzugehen? Dabei handelt es sich um die jüngsten Ausläufer einer weltweiten Bewegung, die in den siebziger Jahren in Kalifornien ihren Ausgang nahm und häufig an die Belange indigener Völker gekoppelt war und ist, denen Natur seit jeher als beseelt gilt. Nun sollen auch in modernen Gesellschaften Fürsprecher in ihrem Namen Beschwerde führen können. Als dynamische Systeme eignen sich Flüsse für solcherart »Naturdienst« besser als Berge, Höhlen oder Seen. Zu einem besonders fundierten Exempel geriet der Whanganui in Neuseeland, dem 2017 der Status einer juristischen Person zugesprochen wurde, woraufhin er zwei Flusswächter zugeteilt bekam, einen von den Maori und einen von der Regierung.
Klaus Bosselmann, der an der Universität von Auckland Umweltrecht lehrt, war maßgeblich an diesem Prozess beteiligt. Dabei geht es um eine juristische Neubewertung der Natur, überhaupt um eine Erneuerung herkömmlicher Denkweisen: »Ich halte die Pflicht zur Erhaltung und Wiederherstellung der Integrität von Ökosystemen für eine Grundnorm des Rechts insgesamt, analog den Menschenrechten.« Ein zentraler Punkt dabei sei die Anerkennung des Eigenwertes der Natur, so auch im Falle der Flüsse. »Die Maori verstehen darunter die Lebenskraft (mauri) und Würde (mana) des Flusses, was verlangt, dass Menschen sich als Teil des Flusses begreifen.« Dies bringt auch die Formel ko te awa ko au zum Ausdruck – der Fluss ist in mir, und ich bin im Fluss. Beste Hegel’sche Schule also: Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend. Sie verhalten sich reziprok. Solche Wechselbeziehungen generieren Energie, gewähren gar Erfüllung.
Bei den Naturrechten handelt es sich um eine schicke, wenngleich etwas abstrakte Idee, die auf uralten Überzeugungen fußt und sich auf die Suche nach einer zeitgemäßen Ausformung begeben hat. Die Liste der Musterfälle wird von Jahr zu Jahr länger. In Indien ist dem Ganges und der Jamuna ein solcher Status zugesprochen worden, in Ecuador den Tälern von Intag und Vilcabamba, in Kolumbien dem Atrato, in Kanada dem Magpie, in Bangladesch dem Turag. Als vorerst prominentester Fall kam 2024 der Rio Marañón hinzu, einer der Hauptquellflüsse des Amazonas. Und warum sollte man nicht eines Tages auch den Golfstrom als Rechtssubjekt auffassen? Vereinzelt wurde das Prinzip schon auf Seen oder Küstenabschnitte angewandt, kürzlich kam, als erstes Beispiel in Europa, die Lagune Mar Menor in der Region Murcia hinzu. Durch Vorbilder aus Lateinamerika wurde hier Entwicklungshilfe von Süd nach Nord geleistet. Vielleicht ist es am Ende gar nicht so wichtig, ob ein Grundgesetz sich, wie im Falle Ecuadors, auf »Pachamama« beruft oder auf »komplexe Ökosysteme«. Mittlerweile haben annähernd dreißig Staaten solche Eigenrechte der Natur in ihren Rechtsordnungen verankert, dazu einzelne Städte oder Provinzen sowie die Räte etlicher indigener Völker. Hierzulande läuft ein Volksbegehren, das die Rechte der Flüsse in die Bayerische Verfassung eingeschrieben wissen will. Die Loisach soll dabei als Präzedenzfall dienen.
Während ihnen also höchste Instanzen Persönlichkeit attestierten, lässt sich das Geschlecht der Flüsse nicht eindeutig bestimmen. In einigen Sprachen firmieren sie durchweg weiblich, in anderen männlich oder sächlich, im Deutschen mal so und mal so. Wir sollten uns damit abfinden, dass wir es mit launischen Hermaphroditen zu tun haben.
Sonst aber ist Wasser fortwährend unterwegs mit sich selbst, auf sich selbst und zu sich selbst. Der Fluss sei sein Guru gewesen, bekennt Megh Ale, einer der Pioniere des Wildwasserfahrens in Nepal … Bäche seien wie Freunde, meint Christian Ihrenberger … Ellen Meloy, die so manche Saison im Desolation Canyon zubrachte, dem entlegensten Abschnitt des ohnehin schon entlegenen Green River in Utah, war durchdrungen von den »stillen Extasen« dieser Urlandschaft … Isabella Bird brachte 1896 nach ihrer Fahrt durch die Schluchten des Jangtse ein Hoch auf die Schöpfung aus: »Es war ein einziger Rausch, eine einzige Herrlichkeit.« … Der slowenische Schriftsteller Feri Lainšček erklärte mir bei einem Spaziergang an der Mur, der Fluss sei seine Couch. Passanten schauten ihn manchmal schräg an, wenn er mit ihm spreche. »Aber die Mur ist das gewohnt.« … Und Kapitän Orval Roberts, der während seines Berufslebens mehr Zeit auf dem Mississippi verbracht hat als an Land, gelangte dabei zu der Weisheit letztem Schluss, zur Tautologie also: »Ein Fluss ist ein Fluss.« And that’s the he and the she of it.
Aufspringen, Kreisen, Wälzen, Wallungen, Umgehung, Aufsprung, Überschwemmung, Auftauchen, Beugung, Hebung, Höhlung, Verzehrung, Erschütterung, Einstürzen, Abfließen, Ungestüm, Rückstaue, Aufpralle, Abriebe, Wellengänge, Bespülungen, Strudeln, Rückfälle, Zögerlichkeiten, Brausen, Ausschütten, Aufbäumen, Untertauchen, Schlängeln, Gießen; Säuseln, Dröhnen; Aufstauen, Auflehnen, Zufluss und Abfluss, Einsturz, Erschütterungen; Untiefen, Höhlen in den Ufern, Taumeln, Abgründe, Rückströme, Aufruhr, stürmische Stürze, Ausgleichungen, Ausgeglichenheit, Mitreißen von Felsen, Aufprallen, Strudel, Unterwirbeln oberflächlichen Wellengangs, Zögerlichkeiten, Einbrüche, Teilungen, Öffnungen, Schnelligkeit, Nachdruck, Wut, Ungestüm, Wettlauf, Beugung, Zermischung, Umwälzung, Kippung, Schleudern, Verfall der Dämme, Eintrübungen.
Leonardo da Vinci (aus: Anna Maria Brizio (Hg.), Scritti scelti di Leonardo, Turin 1952. Übersetzt von Tobias Roth)
Der Mississippi
Der vergessene Riese – Im Frachter von St. Louis bis New Orleans
»Man sollte versuchen, soweit irgend möglich ein Stück menschliches Treibholz zu sein.«
Jonathan Raban, Mississippi
Das soll ein Schiff sein? Diese schwankende, stampfende, grün-weiße Pagode, zwanzig Meter hoch und gar nicht sehr viel länger, mit einem Prellbock vorne dran, der im Wasser wühlt, als wolle er sich drin verkriechen? Ohne ihre Ladung sieht die Betty Lynn bemitleidenswert unvollständig aus, ein halber Zentaur. Kapitän Orval Roberts scheint der Anblick denn auch etwas peinlich zu sein. »Sehn wir zu, dass wir wegkommen«, murmelt er und schnippt mit den Fingern. Er ist ein leiser Kapitän. Einer, der sich in vierzig Dienstjahren das Recht auf gewisse Verschrobenheiten erworben hat. Einen Monat lang wird die nach einer populären Schauspielerin benannte Betty Lynn ihm und seiner achtköpfigen Crew lauschige Insel sein und schwimmendes Gefängnis, werden sie, ohne je an Land zu gehen, zwischen St. Louis und New Orleans hin- und herfahren. Auf dem großen launischen Mississippi.
Gäste werden als Erstes in die gute Stube geführt: in den Maschinenraum. Wenn das Schiff ablegt, wird er zur lackierten Hölle, entfesseln sechstausend Pferdestärken einen Geräuschorkan. Die öl- und dieselgesättigte Luft erhitzt sich im Sommer auf sechzig Grad. Hier ist Chucks Reich. Er betritt es nur mit Gehörschutz, der ihn vor dem schlimmsten Lärm bewahrt. Sein kräftiger, untersetzter Körper wirkt dennoch wie ein Panzer. Zu Hause schreit er die ersten Tage und schläft unruhig, aufgeschreckt durch die ohrenbetäubende Stille.
Ein Floß aus Lastkähnen muss zusammengestellt und mit der Betty Lynn vertäut werden. Das allein dauert vierundzwanzig Stunden. Aus der Luft sieht das Ganze schließlich wie eine Tafel Schokolade aus, die von einer eisernen Faust den Fluss hinabgeschoben wird.
Kleinere Schiffe schaffen die schwimmenden Container herbei. Einige werden an der Schleuse Nr. 27 etwas oberhalb von St. Louis abgeholt, der letzten vor der Mündung. Während zahlreiche Schleusen und Dämme den Oberlauf des Mississippi an die Kandare nehmen, hat der Unterlauf auf den verbleibenden tausend Meilen Freigang. Nr. 27 reguliert einen Kanal, der eine Kette von Stromschnellen umgeht. Diese kurze, weithin unbekannte Rinne ist eine der beladensten Schifffahrtsstraßen der Erde. Hier schippern bis zu achtzig Millionen Tonnen Fracht jährlich hindurch, etwa so viel wie durch den Nord-Ostsee-Kanal. Vor allem Weizen, Mais und Sojabohnen aus den Agrarwüsten des Mittleren Westens, die für Ägypten, China oder Deutschland bestimmt sind. Eine Armada von Schubverbänden befördert sie auf dem längsten Fließband der Welt nach New Orleans. Der amerikanische Kulturhistoriker Richard White prägte für solche hochgradig domestizierten Flüsse den Begriff der »organischen Maschine«.
Die übrigen Lastkähne kommen in East St. Louis dazu. Hier ragt eines jener Betonsilos auf, welche die Ufer prägen wie Burgruinen den Rhein. Eine unablässige Karawane von Vierzigtonnern und Güterzügen kippt den Erntesegen in die Auffangtanks, wo er sortiert, getrocknet und zwischengelagert wird. Ein gewaltiger Ausleger streckt sich den Schiffen entgegen und speit mit seinem Rüssel binnen einer Stunde Weizen für zwei Millionen Brotlaibe in jeden Kahn.
Der Fluss trennt hier nicht nur den Westen vom Osten, die Staaten Missouri und Illinois, er trennt auch zwei Welten. East St. Louis, das Aschenputtel am gegenüberliegenden Ufer, inmitten lärmender Industriekomplexe und eines Wirrwarrs kaum mehr benutzter Bahngleise gelegen, verzeichnet eine der höchsten Mordraten der USA. »Das Einzige, was es dort gibt, ist Ärger«, schnaubt Orval. Am gegenüberliegenden Ufer dagegen präsentiert sich St. Louis mit stolzgeschwellter Brust, mit glitzernden Hotels, Bürotürmen und der stählernen Parabel des Gateway Arch. Die Wohngebiete wuchern dreißig Kilometer weit nach Westen, anstatt den einen Kilometer nach Osten, über den Fluss hinweg, zu wagen. Die Stadt will gar nicht wissen, was hinter ihrem Rücken vor sich geht. Der Mississippi schleicht denn auch wie ein geprügelter Hund um sie herum.
Seit den dreißiger Jahren wurde er in faustischem Streben massiv begradigt, aufgestaut und eingedeicht, wurde seiner natürlichen Überflutungsflächen beraubt. Wenn dann aber eine große Flut kommt, wie zuletzt 1993 und 2011, wirkt sie umso verheerender. Freilich würde es auch ohne jede Regulierung zu starken Überschwemmungen kommen. »Denn«, resümiert Orval und späht über seine Brille hinweg, wobei er immer wie Walter Matthau aussieht, »denn«, meint er und legt all seine Erfahrung in diesen Satz, »ein Fluss ist ein Fluss«.
Ohne Unterlass wird die restliche Fracht der Betty Lynn zusammengeschoben. Wenn es dunkelt, wirft Orval die Karbid-Scheinwerfer an. In einsamen Nächten macht er sich auch mal einen Spaß daraus, Zugvögel zu blenden. Aber nur ganz kurz. Matrosen in durchgeschwitzten T-Shirts zerren Stahltrossen über das Vorderdeck und winden sie um die Poller. Es sind junge, unverheiratete Männer aus den Kleinstädten des Südens, mit Armen wie Schenkeln.
Gegenüber schimmert der Gateway Arch, diese Apotheose des Aufbruchs, doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue. Er markiert den Nullpunkt des »Wilden Westens«. Eine perfekte Form, kühn und keusch am Fluss aufragend, das Welt- neben dem Naturwunder. So sieht Amerika sich gerne: eine Gesellschaft furchtloser Pioniere, die es entschlossen mit dem Unbekannten aufnimmt. Das war die große Zeit des Mississippi als wichtigster Verkehrsader des Kontinents. Heute gibt es, abgesehen von einigen wenigen Raddampfern für teure Nostalgiefahrten, keinerlei Passagierverkehr mehr. Sport- und Fischerboote tummeln sich überwiegend auf dem Oberlauf, südlich von St. Louis scheint es einfach zu weit von einem Ort zum anderen. Die Ufer sind leer, der Fluss aber voll, wie ferngesteuert folgt ein Schubverband dem anderen. Befriedigt drückt Orval zwei Hebel nach vorn, die Motoren erzittern. Eine wogende Kielwasserschleppe entfaltend, reiht die Betty Lynn sich ein.
Kaum hat sie die Stadt hinter sich gelassen, beginnt das grüne Spalier, das den Fluss mit wenigen Unterbrechungen bis Louisiana säumt. Eine meditative Monotonie prägt die Tage. Weder romantisch noch bedrohlich, vermittelt sie eine Vorstellung von der Geräumigkeit dieses Kontinents. Die wenigen Städte und Dörfer, in respektvoller Entfernung errichtet, bleiben verborgen, verraten sich nur nachts durch ihre Lichtschilder. Umgekehrt ist vom Land aus kaum an den Mississippi heranzukommen – dort gibt es ja nichts.
Nur alle paar Stunden rauscht das Schiff unter einer Brücke durch. »Wer eine kennt«, meint Orval, »der kennt sie alle.« Die einzige Abwechslung bieten die anderen Schiffe. Die Kapitäne stehen über Sprechfunk miteinander in Verbindung. Oft rufen sie sich schon, wenn noch drei, vier Biegungen zwischen ihnen liegen. Sie tauschen sich über den Zustand der Fahrrinne aus und gleiten auf einem trägen Strom kollegialer Konversation aneinander vorbei:
»Hey, Phil, was hast du da für braune Schlacke geladen?«
»Das ist Dinosaurierscheiße.«
»Red keinen Stuss.«
»Noch nie Dinosaurierscheiße gesehen? In Wisconsin sind sie ganz wild auf das Zeug.«
»In Wisconsin hab ich ’ne Cousine.«
»Ich hab eine in Oklahoma.«
»Da ist ja Wisconsin noch besser. Aber jetzt sag mal, is’ das Stahlwolle? Oder Klärschlamm, oder was?«
»Ich werd’s dir verraten.«
»Also?«
»Es ist Dinosaurierscheiße.«
Das Küchenradio wird vom Dröhnen der Motoren übertönt. Dorothys weißer Salon im Wassergeschoss ist Vorratskammer, Küche, Büfett und Speisesaal zugleich. Beköstigt wird morgens und nachmittags um fünf, mittags um elf, jeweils zum Schichtwechsel. Es soll den Jungs an nichts fehlen: Zu jeder Tageszeit stehen volle Fleischtöpfe bereit, dazu opulentes Beiwerk, eine Dressing-Orgel mit den appetitlichsten Registern und eine sich wundersam erneuernde Kollektion von Keksen und Kuchen, mit denen Dorothy die Männer zähmt. So viel diese auch verputzen, sie weist stets darauf hin, dass noch mehr da sei. Das Essen ist das wichtigste Ritual an Bord, strukturiert es doch den trägen Strom der Zeit. Wenn es Hühnchen gibt, weiß jeder, dass wieder Sonntag ist.
In ruhigen Gewässern weit jenseits der fünfzig angelangt, steuert Dorothy einen geraden Kurs. Von untadeligem Ruf und mütterlicher Strenge, ist sie Ernährerin, Maskottchen und auch Kummerkasten ihrer Jungs. Mit übereinandergeschlagenen Beinen thront sie, immer etwas abgerückt, auf ihrem Küchenhocker und sieht zu, wie es ihnen schmeckt. Sie ist der Küchenkapitän.
Meist hat sie die Vorhänge vor die Luken gezogen. Denn sie mag ihn nicht besonders, den verrückten alten Kerl, auch wenn sie seit vierzehn Jahren auf dem Mississippi lebt. Erst neulich hat sie wieder ein Demovideo gesehen, was alles so passieren kann. Verhakt sich einer der Kähne an einer Sandbank, dann reißen die Taue wie Schnürsenkel, und wenn da ein Matrose an Deck ist, hauen sie ihn mitten entzwei. Oder wenn einer bei der täglichen Prüfung der Trossen und Ballasttanks von einem Brecher gepackt wird und unter das Floß gerät – grässlich. Oder der Maschinist der Ecechiel, der im Winter eine defekte Pumpe ans Tageslicht hievte und dabei ausglitt. Die Pumpe hing noch an der Reling, die Leiche tauchte erst im Frühjahr auf.
Kaffee, Dorothy! Was wäre ein Kapitän, schnipp, ohne Kaffee? Orval tigert herein und nascht von den Brownies. Sein Vize Bob hat ihn abgelöst. Die Mannschaft schmatzt, knackt Sellerie. »Eat it or work« – über diesen Spruch ist Dorothy erhaben. Bei ihr haben die Jungs noch jedes Mal ein paar Pfund zugelegt.
Von wegen Southern Comfort: Da Alkohol strikt untersagt ist, ebenso wie politische und missionarische Aktivitäten, trinken alle Eistee und Limonade. Sie halten sich am Essen schadlos, stellen herausfordernde Kreationen zusammen: Hamburger mit Ahornsirup, Schokotorte an Kartoffelpüree, Truthahn mit gerösteten Marshmallows. Am Ende wischen sie sich die Lippen und klopfen die üblichen Sprüche. »Danke, Dorothy, war wieder prima. Und was wir dir schon immer mal sagen wollten: Du bist die bestaussehende Frau auf dem Schiff. Ehrlich. Also dann, man sieht sich.«
Cape Giradeau zieht vorbei, und Chuck, der empfindsame Einzelgänger, der Maschinist mit den Maulwurfshänden, Chuck wird melancholisch. Tochter Cheryl geht hier aufs College. Die Familie ist der Anker seines Lebens. So sehr auch daran gerüttelt wurde, er hat gehalten. Viele Flussschiffer sind mehrfach geschieden, weil die Ehen im steten Wechsel von vier Wochen Dienst und zwei Wochen Privatleben erodierten. Täglich versenkt Chuck sich in die gerahmten Porträts auf dem Schreibtisch, denkt an Cheryls bevorstehende Kieferoperation oder an seine Frau, die gerade wie besessen den Sonntagsstaat ihrer Baptistengemeinde zusammennäht.
Anstelle der Stadt ist nur die kilometerlange Mauer zu sehen, hinter der sich Cape Giradeau seit fünfzig Jahren verbarrikadiert. Separatismus und Wehrhaftigkeit sprechen daraus, aber auch puritanische Abscheu vor dieser unreinlichen, ungezogenen Natur. Zum Fluss hin hat man das Grau mit aufgemalten Wahrzeichen kaschiert: Kirchlein und Stadtvillen, Indianerhäuptling und Raddampfer. Nicht sehr überzeugend. Bereits einige Meilen stromab passiert die Betty Lynn einen Schiffsfriedhof, auf dem die letzten Zeugen der Dampfschiffära zerfallen. Und was den Häuptling angeht, so verläuft eben hier der Trail of Tears, auf dem mehrere tausend Cherokee ums Leben kamen, als man sie aus Georgia und anderen Staaten des Südostens vertrieb, um sie weit westlich des Mississippi anzusiedeln.
Chuck genießt die Elemente. Nach der Ablösung sitzt er an Deck, die Füße auf der Reling, späht mit dem Fernglas nach Wildgänsen und Seidenreihern. Er badet im Zwielicht, wenn das Wasser hier silbern wie Wellblech glänzt, dort bronze- und apricotfarben. Er vertieft sich in die Metamorphosen der Wellen, die mal dünn dahinkrabbeln, als ob ein Strick hindurchgezogen würde, dann schmatzend am Rumpf lecken, dann wieder wie in einem Whirlpool strudeln oder als pilzförmige Schilde tückische Strömungen anzeigen.
Die Freizeit an Bord ist kaum der Rede wert. Kein Pokerspiel, kein Gitarrenblues; eine Zigarettenpause ist das Äußerste an Romantik, was Huck Finns Nachfahren zuwege bringen. Den Fernsehraum besuchen sie nur sporadisch, die Arbeit macht müde, und sechs Stunden später müssen sie wieder raus. Die Zweierkabinen wirken hell und ordentlich, neben der Schiffsbibel ruhen Westernromane und Busenwunder im Nachtkästchen. Johnny, zweiunddreißig, war vorher Lkw-Fahrer, aber hier verdient er mehr und gibt weniger aus. Was übrigbleibt, steckt er in die Clubs von Memphis, seine beiden Rottweiler und seine derzeit elfteilige Waffensammlung. Johnny ist der einzige Schwarze an Bord. Die Cargofirmen würden eben nur wenige einstellen, meint er achselzuckend. Orval erklärt es damit, dass sie erfahrungsgemäß nicht lange dabeiblieben. Sie kämen mit der Einsamkeit und Monotonie nicht klar. »Ja, wenn man nach acht Stunden nach Hause könnte, dann wär’s der ideale Job.«
Täglich wird der Fluss breiter und das Klima schwüler. Hinter der nächsten Biegung liegt die übernächste. Wie ein Reptil aus einer unbekannten Schöpfungsmythologie windet er sich durchs Land, Kraftstrom und Arbeitstier, Lebenslauf und Scheidelinie. Rote und grüne Lichter, Bojen und Tafeln markieren die Fahrrinne. »Jede Sandbank, jede Navigationsmarke besitzt einen Namen.« Orval, in Strumpfsocken zwischen »Transsylvania« und »Arcadia« hindurchsteuernd, hat den Fluss als Film im Kopf, denkt immer drei Meilen voraus. Stromauf vereinigen die Schubverbände bis zu vierzig Kähne, ein Drittel davon leer. Die übrigen transportieren Schrott und Kies, vor allem aber Benzin, Dünger und Chemikalien aus den Industrie-Imperien des Südens. »Hallo, Meister«, meldet sich die Jesus Navigator, »was läuft denn so?« – »Ah, nicht viel, nicht viel.«
Für Memphis steht Dorothy sogar nachts auf. Zu hübsch glitzert die Pyramide, türmen sich die Hochhäuser, selbst die Trutzburg des Gefängnisses scheint ihr anheimelnd. Endlich wieder Menschenwerk, nach zwei Tagen im spinatgrünen Tunnel. Auf Mud Island ist dem Mississippi ein Vergnügungspark gewidmet worden: Ein meilenlanges, begehbares Modell aus Ziegeln und Beton soll ihn der Nation näherbringen. Schulklassen lernen beim Durchwaten, dass er über dreißig Bundesstaaten entwässert, dass seine Quelle erst 1832 entdeckt worden ist, dass der Bürgerkrieg sich auch an den Flusszöllen der Südstaaten entzündet hat. Statt in den Golf von Mexiko mündet das Rinnsal schließlich in einen Swimmingpool. Trotz Pressehymnen klagen die Betreiber über das verhaltene Besucherinteresse. Immer nur Elvis – dabei ist der Fluss doch auch ein Weltstar.
Als Ferde Grofé in den zwanziger Jahren seine Mississippi Suite komponierte, reihte er vier Bilder zu einem Großmythos aneinander: »Father of the Waters«, in Anlehnung an den indianischen Ehrentitel des Stromes, dann »Huckleberry Finn«, »Old Creole Days« und schließlich »Mardi Gras«. Seine »Reise in Tönen« geriet plakativ und effektvoll, großsprecherisch amerikanisch, eine Moldau in XXL. Geschrieben von einem Künstler mit einem echt kreolischen Namen. Ferde, der sich ursprünglich Ferdie nannte, als Kurzform für Ferdinand Rudolph von Grofé, war der Sohn deutschstämmiger Einwanderer, seine Mutter hatte am Leipziger Konservatorium studiert. Beflügelt vom Publikumserfolg, ließ er etliche weitere Tongemälde von Amerikas Naturwundern folgen, die meisten viersätzige Mini-Symphonien. Darin rauscht, sprudelt, stürzt und strömt es ganz gewaltig: Grand Canyon Suite, Hudson River Suite, Yellowstone Suite, Niagara Falls Suite.
Um seiner Frau einen Brief zu schreiben, ist Chuck den halben Kilometer bis zum Bug des Floßes gewandert. Briefe gehören zu den Ritualen ihrer Ehe, »E-Mails wären lieblos«. Nur Wind und Wellen sind zu hören, und das Knirschen der Taue. Der Fluss ist jetzt breiter als der Starnberger See, sein schaumiges Karamell undurchdringlich. Berufstaucher hier spüren eine Leiche eher, als dass sie sie sehen. Einmal hat Chuck eine Probe entnommen. Nach zwei Tagen war das Wasser kristallklar, die Flasche zu einem Viertel mit Sand gefüllt. In der Wasseraufbereitung der Städte – von St. Louis bis New Orleans schöpfen alle aus dem Mississippi – müssen Berge von Schlacke anfallen.
Per Funk angefordert, kommt abends ein Versorgungsboot längsseits, ohne dass die Betty Lynn deshalb ihre Fahrt verlangsamen würde. Diese schwimmenden Kramläden bieten Rasierklingen und Zigaretten feil. Im Zeitungsständer stecken zwei Illustrierte, drei Anglermagazine und acht mit nackten Mädels. Mit Chucks Brief betraut, braust das Boot wieder zurück.
Immer stärker mäandert der Fluss, lässt Orval die Ruder swingen. Die engen Schleifen fordern volle Konzentration, er muss die Strömung einbeziehen und mehrfach zurücksetzen, um die Kurve zu kriegen. Schon Mark Twain hat solche Manöver in seiner autobiographischen Erzählung Leben auf dem Mississippi eingehend beschrieben. Er rekapituliert darin seine Zeit als Flusslotse, der er bekanntlich auch sein Pseudonym verdankt: Mit »mark twain«, zwei Faden Wassertiefe, zeigten die Lotsen den Schiffern an, dass sie mehr als nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel hatten. Zeitlebens kam ihn Heimweh nach diesen Jahren an, so dass er schließlich seine Villa im fernen Hartford einem Flussdampfer nachempfand, um noch zu Hause unterwegs zu sein. Wobei er umgekehrt oft schon an Bord fast bis zum Stillstand entschleunigt worden war: »Eine Zeitlang fuhr ich auf einem so langsamen Schiff, daß wir vergaßen, in welchem Jahr wir den Hafen verlassen hatten. Fährboote verloren einträgliche Fahrten, weil die Passagiere starben, während sie auf uns warteten. Die John J. Roe war so ein so langsames Schiff, daß es, als sie dann in der Schleife von New Madrid sank, fünf Jahre dauerte, bis die Eigentümer Nachricht davon erhielten.«
Nachts konnte es damals kreuzgefährlich werden, heute zeigt das Radar den Gegenverkehr schon lange im Voraus an. Zur Geisterstunde glimmt Götterdämmerung am Horizont: ein grell beleuchtetes Atomkraftwerk mit einer Dornenkrone aus blitzenden Warnlichtern. Kaum ist die Betty Lynn wieder ins Dunkel eingetaucht, erscheint eine weitere Vision. Wie auf einem Gemälde von William Turner zieht lautlos eine mehrstöckige, golden leuchtende Schmuckschatulle vorbei. An ihrem Heck rinnt das Wasser als sprühender Schleier vom Schaufelrad. Es ist die Delta Queen, der einzige verbliebene historische Mississippidampfer. Nachts bewahrt sie noch etwas vom Zauber der Kerzenboote Tom Sawyers. Selbst die Crew der Betty Lynn gerät einen Moment lang ins Träumen: Das ist ein Schiff! Sein Überleben verdankt es einer Namensvetterin, Betty Blake, einer engagierten Mitarbeiterin der Reederei, die die 1927 in Dienst gestellte Königin des Deltas mehrfach vor der Stilllegung bewahrte.
Am Morgen grüßen die Kanonen von Vicksburg herüber. Hier residieren die wahren Herren des Mississippi: das Corps of Engineers. Diese alte Militärinstitution kontrolliert die großen Wasserstraßen Amerikas. Das Herzstück der Anlage bildet die hydraulische Versuchsanstalt, die in den dreißiger Jahren erbaut wurde, wobei entsprechende europäische Einrichtungen Pate standen, insbesondere die in Dresden und am Walchensee. Wird irgendwo eine Schleuse oder ein Unterwasserdeich geplant, testen die Ingenieure hier vorab die Bedingungen. In riesigen Hallen bauen sie das Gelände im Maßstab 1:100 nach, simulieren Hoch- und Niedrigwasser, Strömungen und Langzeitfolgen. Ferngesteuerte Betty Lynns gondeln hindurch. Allein diese experimentelle Abteilung hat anderthalbtausend Mitarbeiter. Es ist der größte Wasserspielplatz der Welt.
Die Jungs schrubben das Deck, umschwirrt von Moskitos im Kaliber von Libellen. Verwunschene Wälder voller Lianen und Luftwurzeln flankieren die Ufer. Doch dann taucht Baton Rouge auf, die Hauptstadt Louisianas. Auf den hundert Meilen von hier bis New Orleans stehen die Industriekomplexe nun Schulter an Schulter, ragen die Minarette der Raffinerien empor, schieben sich Ozeanriesen an die Verladekais. Ein Sprung aus dem präkambrischen Ursumpf in eine ebenso menschenleere Science-Fiction-Welt. Mittendrin umringt ein Quartett weißer Villen einen Ziegelschornstein. Bis 1999 befand sich hier, feinmaschig eingezäunt, eine der letzten Leprakolonien Amerikas. Inzwischen ist sie als Drive-in-Museum öffentlich zugänglich.
Nach fünf Tagen hat die Betty Lynn ihren Wendepunkt im Delta erreicht. Das Floß wird von Schleppschiffen aufgelöst, die Kähne mit einem Saugrüssel entleert, das Getreide von einer der größten Siloanlagen der Welt auf Ozeanschiffe verteilt. Schon stellen emsige Zuträger einen neuen Schubverband für St. Louis zusammen.
Der Fluss aber nimmt ein klägliches Ende, wird gedemütigt und verseucht, bevor er draußen bei Meile 0,0 gegen unendlich geht. Wenn er könnte, wie er wollte, würde er sich schon früher einen anderen Weg bahnen, ein Stelldichein mit dem Atchafalaya suchen, einem westlich abzweigenden Seitenarm. Dann säße der ganze Korridor von Baton Rouge bis New Orleans auf dem Trockenen. Würde dieser Schlupfweg dem Hauptstrom indes gänzlich verwehrt, würde er das halbe Delta überschwemmen. Seit über hundert Jahren hat man ihn deshalb kanalisiert und umgeleitet. Beim großen Hochwasser 1973 hätte das Corps of Engineers den Fluss jedoch beinah verloren, so sehr drängte er zum Atchafalaya hinüber. Zwar versicherten die Behörden, dass dies nie wieder passieren könne. Aber zwanzig Jahre später hätte er sich erneut fast verselbstständigt. Und so resümiert Orval: »Dem Burschen ist nicht zu trauen. Je mehr man ihn zwingt, desto härter schlägt er zurück.« Ruhig blickt er mit seinen aquamarinblauen Augen auf die Dächer von New Orleans, die zwei Meter unter ihm liegen: »Wenn der einmal wirklich Ärger macht, dann« – schnipp! –, »dann gute Nacht.«
Die Hase
Paddeln für Godot – Eine Kahnpartie durch die Norddeutsche Tiefebene
»Das Beste aber ist das Wasser.«
Pindar, Erste Olympische Ode
Flüsse sind seltsame Wesen. Sie wälzen sich unentwegt in ihrem Bett, nach links, nach rechts, ohne Rast und Ruh. Sie bewegen sich leise, aber eindringlich: Flüsse flüstern. Sogar nachts! Sie können Berge versetzen. Sie schweifen ab und wissen doch genau, wo’s langgeht. Sie sind so anders. Flüsse bestehen naturgemäß aus Flüssigkeit. Ein sehr geselliges Element. Einmal in Bewegung, strebt Wasser dorthin, wo noch mehr Wasser ist.
Wir Menschen übergehen sie. Eine flüchtige Promenade am Ufer, ein Blick von der Brücke, kurz hineingespuckt – das war’s.
War’s das? Regt sich da nicht noch etwas? Ein hypnotischer Drang, die uralte Sehnsucht, eins mit dem Wasser zu werden und ihm zu folgen, fort von der Schwerkraft festen Landes? In sein Geflüster einzustimmen, sich in seinem Rhythmus zu wiegen?
Es muss ja nicht gleich der Sambesi sein. Oder der Mekong. Die gebärden sich wie wilde Hengste, wir aber sind ungeübte Greenhorns. Wir wollen das Schicksal nicht herausfordern. Wir wollen lieber auf einem zutraulichen Pony beginnen. Sagen wir: auf der Hase.
Die Hase (früher auch Haase) entspringt im Teutoburger Wald und mündet nach hundertsiebzig Kilometern überwiegend in die Ems. Sie mag ein kleines, subalternes Flüsschen scheinen, doch ist sie geographisch eine Rarität. Zum einen zweigt ein Teil von ihr früh zur Weser und also ganz woandershin ab. Diese Gabelung, in der Fachsprache Bifurkation geheißen, macht sie dem Orinoco ebenbürtig. Zum anderen speist sie ein Binnendelta, womit sie zu Niedersachsens Okawango avanciert: Lange vor ihrer Einmündung in die Ems fächert sie sich dort in Bäche, Arme und Kanäle auf und durchtränkt das sumpfige, »quakige« Land, weshalb der einzige halbwegs trockene Fleck darin Quakenbrück geheißen wurde. Ein schmuckes Städtchen, altdeutsch, einst Mitglied der Hanse. Ein Kaufmanns- und Handwerkerort, Friedrich Ebert lernte dort eine Zeitlang als Sattler. Von Quakenbrück dauert die Kanu- oder Kajakfahrt bis zur Mündung drei Tage, von Löningen zwei und von Haselünne einen, wobei der letzte Abschnitt der abwechslungsreichste ist.
Eine jede Flussfahrt bringt heilsame Monotonie. Die Uferböschung zensiert den Horizont. Das Auge sieht viel Grün, es schaut aufs Wasser und dann und wann in eine Wolke. Reinster Impressionismus. Die Menschen, an denen man vorübergleitet, haben Zeit: Schäfer, Angler, Spaziergänger, an den Wochenenden auch allerhand Bootsvolk. Kichernde Cliquen, tatendurstige Väter mit Söhnen, Familien mit kleinen, in bunten Schwimmwesten steckenden Kindern. Man begegnet sich öfter, mal rasten die einen, mal die anderen. Profis mischen sich selten darunter, denen ist das Flüsschen zu brav.
Vor lauter Binnendelta weiß die Hase selbst nicht mehr, wie sie läuft, deshalb befahren die Boote zunächst den »Essener Kanal«, der dann irgendwann als »Große Hase« und später wieder schlicht als »Hase« tituliert wird. Die Debütantenschar merkt davon ohnehin nichts, sie ist angestrengt am Paddeln. Hier scheint die Reichweite der Arme zu kurz, dort sind die Gewichte falsch verteilt, das Kajak schlingert wie ein Sautrog. Doch hat man den Bogen einmal raus, geht’s flott dahin – für eine Weile wenigstens, solange etwas Strömung da ist, solange die Hände, die Arme, der Rücken noch locker sind. Doch oh weh! Bald nämlich bekommt der Wasserwanderer Partien seines Körpers zu spüren, von deren Existenz er bislang gar nichts ahnte. Seine erste Lektion ist also physischer Natur: Er wird sich seiner höchstpersönlichen Anatomie bewusst.
Die zweite erhält er in Physik. Leidenschaftlich wird herumexperimentiert, was sich mit Paddel, Arm und Boot alles an Hebel-, Beschleunigungs- und Bremswirkungen erzielen lässt. En passant begegnen einem die merkwürdigsten aquatischen Phänomene, man möchte Strudelforscher oder Strömungsspezialist werden, Böschungsbauer oder Brückenkonstrukteur.
Die dritte Lektion gibt es in Biologie. Wie heißen nur all diese Wasserpflanzen, was springen da für Fische, was treiben die Libellen im Tandemflug, und welch klagende Rufe tönen dort aus dem Schilf? Kleines wird groß, Großes ungeheuerlich. Ein gleitender Reiher wirkt archaisch wie ein Flugsaurier, der sandige Uferabbruch gerät zur romantischen Klippe. Als nach Stunden ungestörten Vagabundierens die ersten Häuser von Löningen auftauchen, erscheinen sie als Trutzburgen der Sesshaftigkeit.
Es geht ins Emsland. Wo alle Frauen Ulla heißen. Eine dünn besiedelte Region, geradlinig, agrarisch, rau und zart zugleich. Auch sehr deutsch – reinlich, ruhig und angeheimelt –, mit einer leichten Neigung zum Absurden. Als Samuel Beckett für die deutsche Fassung von Warten auf Godot nach dem Inbegriff ländlicher Abgeschiedenheit suchte, fand er ihn hier: »Und wir gehen ins Emsland. Ich wollte schon immer durchs Emsland wandern.« Im Emsland gibt es Platz. Das mittlerweile stillgelegte Kernkraftwerk gleichen Namens, die ebenfalls stillgelegte Teststrecke des Transrapid und die keineswegs stillliegenden Luftwaffengeschwader wären sonst nicht hier. Hindernisse bestehen keine, es handelt sich um plattes Land.
Die Gestade der Hase sind von Beschaulichkeit gesäumt. Damwild hinter Maschendraht, lauthals schnatternde Enten, schmucke Pferde auf weitläufiger Weide. Schmale Auwälder. Mais und Kartoffeln, Kartoffeln und Mais. Viele Radfahrer, die das Land auf schönen, schattigen Wegen erkunden. Die Fahrt bringt kleine Überraschungen: ein aufgescheuchtes Liebespaar im Ufergras, Reservisten volle Pulle auf Schlauchbootmanöver, ein Lama hinterm Zaun. Vor Haselünne liegt in der weiten Beuge eines Haseknies ein apartes Biotop, der Wacholderhain. Eine Landschaft mit mediterraner Skyline, mal offene Heide, dann wieder labyrinthisch dicht, gestaffelt wie zum Gruppenfoto. Die buschige, fahle, geheimnisvolle Vegetation erinnert an Bilder von Max Ernst. Durch jahrhundertelange Weidewirtschaft entstanden, steht sie mitsamt ihren Schafen und Rindern unter Naturschutz. Hier und da spenden alte Huteeichen Schatten.
Dem Wacholder verdankt Haselünne seine kulinarische Spezialität: Branntwein. Die Schornsteine der großen Kornbrennereien sind auch vom Fluss aus nicht zu übersehen. Dieses Gewerbe verleiht dem Bausparkassenidyll einen leicht übermütigen Einschlag. Doch nur einen ganz leichten. Wie schon erwähnt befinden wir uns im Emsland, hier sind die Leute freundlich, aber strikt. Eines der wichtigsten Werkzeuge der Selbstverwirklichung ist die Heckenschere. Ihr unerbittliches Schnappschnapp hallt weithin über die Parzellen.
Abends in Haselünne hat man die Wahl: Da gibt es die Hasetor-Lichtspiele, ein bezauberndes Provinzkino mit Tischbeleuchtung und -bedienung. Oder man geht in den Garten der Costa Smeralda, wo ein Vollblutkoch die heißhungrig begehrten Kohlehydrate in denkbar schönster Form zubereitet. Oder im August aufs Schützenfest – das Kajak liegt stets um die Ecke. Wie mobil man doch als Bootsbesitzer ist! Man kann überall an- und jederzeit wieder ablegen, kann außer im Naturschutzgebiet an tausend lauschigen Plätzchen campieren. Und dann statt der häuslichen Katzenwäsche ein nächtliches Flussbad nehmen, mit der Milchstraße als Baldachin über dem Kopf.
Hinter Haselünne verliert der Fluss seinen letzten Schwung, verläuft gewunden wie ein Darm. Ab jetzt ist alles Handarbeit. Jede der zahllosen Biegungen hält neue Ausblicke und Arrangements bereit: Sandbänke … Steilufer … Buchenwälder … Wiesen … Haarnadelkurven. Es geht durch Modelleisenbahn-Land: schindelgedeckte Mühlen, eiserne Brücken, Backsteinhäuschen, feiertags Dampflokverkehr. Im reizenden Dorfe Bokeloh stärkt die Schankwirtschaft Giese einkehrende Wasserwanderer mit Schinkenplatte oder köstlichem Kuchen. Nach drei Tagen ist das Paddeln in Fleisch und Bein übergegangen. Spätestens dann naht allerdings auch das Ende der Tour. Die erste Möwe kündigt maritimere Gefilde an. Im rechten Winkel überantwortet die Hase ihre Wasser nun der Ems, genauer: dem Dortmund-Ems-Kanal. Schwere Schiffe ziehen stromab, die Ems muss arbeiten. Der Bootsanleger drüben rechts, das ist die verabredete Haltestelle. Hübsch hier. Und da vorne? Ein Stück weiter? Lag da nicht Simenon mit der Ostrogoth und schrieb seinen ersten Maigret?
Stopp! STOPP! Kommt zurück! Wollt ihr etwa bis Holland paddeln? Dahin, wo noch mehr Wasser ist? In die Nordsee, ins Ijsselmeer? Warum nicht gleich zum Umzimvubu?
Ja, warum nicht gleich?
Die Flüsse von Pondoland
Entlang der Wilden Küste – Vom Umtamvuna bis zum Umzimvubu
»Doch als wir den Fluss erreichten, mußten wir anhalten. Man konnte ihn jetzt unmöglich passieren, da er so breit war wie die Seine am Königlichen Garten zu Paris.«
François Levaillant, Reisen in das Innere von Afrika
Und dann muss Hubert auch noch eine Geschlechtsumwandlung über sich ergehen lassen. Als hätten sich ihm, respektive ihr, Huberta also, auf ihrer dreijährigen Wanderschaft durch Südafrika nicht genug Zumutungen in den Weg gestellt: stinkende Städte, blasierte Zoologen, sensationslüsterne Paparazzi, und einmal sogar eine ausgewachsene Lokomotive, Zumutungen, die buchstäblich auf keine Kuhhaut gehen. Denn ihresgleichen ist im Afrikaans als Seekoei geläufig, in der Sprache der Xhosa als Umzimvubu und auf Lateinisch als Hippopotamus amphibius, vulgo Flusspferd.
Huberta, wie wir sie fortan ansprechen wollen, auch wenn es uns kein gutes Omen zu sein scheint, Großwild nach dem Schutzheiligen der Jägerschaft zu benennen, Huberta machte sich Ende der zwanziger Jahre ebenso bedächtig wie unbeirrbar auf eine weite Reise. Meist entlang der Küste, mit gelegentlichen Abschweifungen ins Hinterland. Was ihr dabei zupasskam, war der Umstand, dass sich von den Drakensbergen her zahlreiche kleine Flüsse in den Indischen Ozean ergießen, alle fünf bis zehn Kilometer, nur ein größerer Spaziergang also für eine junge, unternehmungslustige Dickhäuterin. Manche münden in ein sogenanntes Ästuar, einen mit Hilfe ihrer sandigen Fracht von ihnen selbst geschaffenen Strandsee, in dem Süß- und Salzwasser einander durchdringen. Diese Lagunen sind ebenfalls bewährtes Flusspferdhabitat, so kannte Huberta es aus dem heimischen St.-Lucia-See, selbst ein riesiges Ästuar. Von dort war sie auf die Walz gegangen. Über die Gründe dafür ist reichlich spekuliert worden. Doch warum sollte ihresgleichen nicht auch in die Welt hinausziehen? Wohlan, Huberta, auf ins Abenteuer!