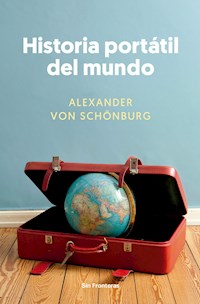11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Natürlich wollen wir alle die Welt retten, nur ist das im Detail leider etwas freudlos. Lokale Produkte aus dem Bioladen schmecken zwar besser als Industrieware und Plastiktüten sind schon aus ästhetischen Gründen eine Zumutung. Wenn man aber konsequent klimaneutral sein will, bedeutet das eine radikale Lebensumstellung, was schnell zur neuen Öko-Religion wird, mit der man vor allem den Mitmenschen auf den Geist geht. Alexander von Schönburg ist dennoch überzeugt: Es muss möglich sein, angenehm und doch halbwegs ressourcenschonend zu leben. Er beschreibt seinen Versuch, ein gesundes und ökologisch-korrektes Leben zu führen und zeigt, welche Schwierigkeiten und Widersprüche ihm dabei begegnen – herrlich selbstironisch und sehr wahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Vom Glück, smaragdgrün zu sein
1 Essen
2 Autofahren
3 Reisen
4 Klamotten
5 Elektronik
6 Wohnen
7 Müll & Plastik
8 Tierliebe
9 Sport
10 Frische Luft
Letzte Dinge
Glossar
Motto
I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself what a wonderful world
I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself what a wonderful world
The colors of the rainbow so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands saying how do you do
They’re really saying I love you
I hear babies crying, I watch them grow
They’ll learn much more than I’ll never know
And I think to myself what a wonderful world
Yes I think to myself what a wonderful world
»What A Wonderful World«, Text von Bob Thiele
(1968 auf einer Single von Louis Armstrong veröffentlicht).
Vom Glück, smaragdgrün zu sein
Nach zwei Versuchen, als ernsthafter Autor wahrgenommen zu werden, ist es nun wieder Zeit, mich auf meine eigentliche Berufung zu besinnen. Und die ist, ob ich es will oder nicht, nun einmal die des arbiter elegantiarum, als Autorität in Fragen des guten Geschmacks. Ich hatte schon einmal eine ähnliche Phase vorübergehender Klarsicht. Sie wurde herbeigeführt durch meinen ehemaligen Chef, Florian Illies, er verantwortete damals die Berliner Seiten der FAZ, ich war sein untergeordneter Redakteur. Eines Tages, ich hatte mir durch mehrere gewichtige Beiträge einen gewissen Respekt im Kollegenkreis erobert, nahm er mich mit der Bitte zur Seite, ich möge ihm kurz Gehör schenken, es gebe da eine Frage, die ihn beschäftige. Mir leuchtete das völlig ein, schließlich hielt ich mich für gelehrt und weise, ich war mir sicher, es könne sich nur um ein philosophisch delikates und zugleich geistig herausforderndes Problem handeln. Florians Frage lautete: »Alexander, kann man eigentlich rote Socken mit einem blauen Anzug tragen?«
Da die Klimakrise für so viel Verunsicherung sorgt, kann ich mir nicht mehr erlauben, auf Gebieten wie Geschichte und Tugendlehre zu dilettieren, sondern muss mich einer dringlichen Stilfrage annehmen, nämlich, wie man auf lebens- und freudebejahende Weise grün sein kann. Ich behaupte sogar, dass sich ökologisch verantwortungsbewusstes Leben überhaupt nur durchsetzen wird, wenn es Steigerung von Lebenslust verheißt und nicht mit Verboten und als Selbstkasteiung daherkommt. Es ist dringend an der Zeit, den Klimaneutralitätsmahnern für ihren Dienst, das allgemeine Aufrütteln, zu danken und ihr endzeitliches Narrativ durch das zu ersetzen, was in fortschrittlichen Kreisen utopischer Pragmatismus und in noch fortschrittlicheren Kreisen »Hedonistic Sustainability« genannt wird. Es kann Lust und Spaß bedeuten, verantwortungsbewusst mit Natur und Mitgeschöpfen umzugehen und nicht mehr jeden Quatsch der Konsum- und Unterhaltungsgüterindustrie mitzumachen.
Leugner der Umweltkatastrophe, ich glaube, darauf können wir uns einigen, sind Idioten. Wir Menschen betreiben Raubbau an der Natur. Das zu leugnen ist dumm. Übereinkunft besteht auch darüber, dass die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur seit der Industriellen Revolution zugenommen haben. Und dass seit Mitte des 20. Jahrhunderts, ab dem Beginn des Massenkonsum-Zeitalters, die Folgen verheerender wurden – auch weil neue Länder dazukamen, die ihr Stück vom Wohlstandskuchen abhaben wollen. Es lässt sich auch schwerlich leugnen, dass der Kohlendioxidausstoß dadurch dramatisch angestiegen ist – jeder kennt die Grafik, deren Kurve so aussieht wie ein Hockeyschläger. Dass wir der Welt Schaden zufügen, ist völlig offensichtlich. Das mag manchen Menschen egal sein, aber dass es so ist, steht fest. Mir ist es nicht egal. Angeblich gab es in den vergangenen 450 Millionen Jahren nur fünf Perioden mit ähnlich rapidem Artensterben. Das letzte Mal, als so viele Pflanzen und Tiere ausstarben, hatte vorher gerade ein Asteroid eingeschlagen.
Dazu kommt das Bevölkerungswachstum. Beckenbauer hatte ja völlig recht, als er (in einem anderen Zusammenhang) sagte, dass sich der Herrgott über jedes seiner Menschenkinder freut, aber allein in Kaiser Franz’ Lebenszeit hat sich die Zahl der Bewohner auf diesem Planeten verdreifacht. Von allen Menschen auf der Erde leben jetzt schon mehr als die Hälfte in Städten, in ein paar Jahren werden zwei Drittel der Weltbevölkerung Stadtmenschen sein und wie Stadtmenschen konsumieren. Klimatisieren, heizen, Auto fahren, fliegen, shoppen … dass dies auf Dauer ungemütlich werden könnte, liegt auf der Hand.
»Vergiftet die Flüsse! Fackelt den Urwald ab! Zerstört die Atmosphäre! – Niemand, der einigermaßen bei Trost ist, fordert derlei«, las ich neulich in einem Kommentar eines NZZ-Redakteurs mit dem sinnigen Namen Christoph G. Schmutz. »Der Planet«, schreibt Herr Schmutz, »ist der sprichwörtliche Ast, auf dem alle Menschen sitzen. Und jedermann möchte auf einem gesunden, starken, grünen Ast sitzen. Daran zu sägen, ergibt keinen Sinn.« Die Frage ist nur, wie der Ast grün und stark zu halten ist. Darüber gehen die Meinungen auseinander. »Verzicht!«, rufen die Klimaaktivisten. Aber heißt das dann nicht, dass wir einfach so weitermachen wie bisher, nur alles eben ein bisschen teurer und dafür mit Biosiegel? Wir subventionieren Autos mit Stromantrieb und geben erst Ruhe, wenn jeder Winkel des Landes mit Aufladestationen für E-Autos ausgerüstet ist, ohne uns vorher wirklich Gedanken gemacht zu haben, ob wir nicht eher auf völlig neue Formen der Mobilität setzen müssten und unter welchen Umständen eigentlich die benötigten Rohstoffe zutage gefördert werden sollen (und wie lange sie überhaupt reichen und wo all der Strom für sie herkommen soll). Als effektive Klimaschutzpolitik gilt, höhere Steuern aufs Fliegen zu erheben, aber ja nicht so hoch, dass die Leute sich keine Familienurlaube mehr leisten können. Das Benzin wird teurer, aber bitte nicht so teuer, dass man die Leute ganz vom Fahren abhält. Wir machen eigentlich alles so weiter wie bisher, nur halt einen Hauch grüner, teurer und mit schlechtem Gewissen.
Kann das wirklich schon die Antwort sein?
Ich habe mich für dieses Buch auf die redliche Suche nach Möglichkeiten begeben, wie man ein umweltbewussteres Leben führen kann. Ich glaube nämlich, ein solches Leben kann, im wahrsten Sinne des Wortes, befriedigend sein. Die Verringerung der eigenen zerstörerischen Wirkung auf Umwelt und Klima kann sogar zu einer praktischen, ethischen Übung werden. Für die alten Griechen war Selbstzügelung – Sophrosyne – die wichtigste menschliche Übung überhaupt. Es ist ja im Übrigen so, dass die Gefahren ungleich verteilt sind. Wenn die Warner richtig liegen, stehen wir vor einer großen Gefahr und es besteht dringend Handlungsbedarf. Wenn die Klimakrisen-Skeptiker Recht haben, ist das alles bloß Hysterie. Das Risiko, eher den Warnern Gehör zu schenken, ist verhältnismäßig gering. Schlimmstenfalls sind wir am Ende auf Übertreibungen reingefallen, haben aber unseren sinnlos-übermäßigen Konsum ein wenig in den Griff bekommen, gehen nicht mehr ganz so gedankenlos mit unserer Umwelt und unseren natürlichen Ressourcen um und haben vielleicht sogar bei manchen Zukunftstechnologien die Nase vorn.
Ich bin jedenfalls fest entschlossen, bei der Rettung der Welt mitzumachen. Aber möglichst nicht auf eine Art und Weise, mit der ich meine Zeit und Energie mit gewissensbetäubenden Alibimaßnahmen verschwende, sondern so, dass es tatsächlich einen Unterschied macht. Für die Welt. Und mich selbst. Ich möchte gern grün leben, ökologisch korrekt, klimaneutral, nachhaltig und umweltbewusst.
Ich habe nur bei den ersten Versuchen festgestellt, dass das im Detail manchmal sehr freudlos ist. Die natürliche Pulver-Zahncreme zum Beispiel, die ich mir gestern zusammen mit der Rosshaar-Holzzahnbürste besorgt habe, ist nicht so toll. Sie schäumt nicht, sie schmeckt nach Kalk und hinterlässt kleine Brösel im Mund. Der Laden, in dem ich diese Utensilien erstanden habe, liegt mitten in Kopenhagen, heißt »Pure« und ist Europas bestsortierte ökologische Parfümerie. Die Gesichts-, Körper- und Haarpflegeprodukte hier sind so pure, dass man sich manches auch gut als erfrischenden Brotaufstrich vorstellen kann.
Ich bin nach Dänemark gepilgert, um mich für dieses Buch inspirieren zu lassen. Kopenhagen ist nämlich ein – im positiven Sinn – eigentümlicher Ort. In der Fernsehserie »Borgen« kommt der dänische Premierminister morgens mit dem Fahrrad ins Büro, es gibt mehr Fahrradwege als in jeder anderen Hauptstadt Europas, die Ampeln sind so geschaltet, dass man als Radfahrer immer ein paar Sekunden Vorfahrt hat, an jeder Ecke sieht man eine cykel værksted, jedes dritte Gefährt ist eines dieser Cargobikes, mit denen man zwei oder drei Kinder transportieren kann. Kopenhagen vermittelt einen Eindruck davon, wie es in ganz Europa bald aussieht, wenn die grüne Wende wirklich geschafft ist.
Die gute Nachricht ist: So schlecht sieht es gar nicht aus.
Die Jægersborggade im Stadtteil Nørrebro zum Beispiel: Es gibt hier Gründerzeithäuser am Rande eines der schönsten Gärten (und Friedhöfe) Skandinaviens (Kierkegaards Grab ist hier), wo früher Straßenkreuzungen waren, findet man jetzt improvisierte Minigärten, wo früher städtische Grünanlagen waren, befinden sich jetzt Permakulturen. Die Leute bauen in sogenannten Urban-Gardening-Projekten ihr eigenes Gemüse mitten in der Stadt an. Vorbei an solchen halbwilden Stadtgärten biegt man also in die Jægersborggade ein. Sie ist klein, man hat sie in fünf Minuten durchschritten, aber man kann sich auch mühelos Stunden dafür Zeit nehmen. Die ganze Straße riecht nach Mamas Kuchen, jedes der kleinen Geschäfte hat lustige Namen, in einem der Läden steht im Schaufenster »STOP FUCKING BUYING!«, im Spielzeugladen gibt es nur Spielzeug aus zweiter und dritter Hand, vor dem Pop-up-Shop, der Kimonos verkauft, stehen Frauen, denen man ansieht, dass sie Yoga machen, die Männer sehen trotz ihrer uniformen Bärte und ihrer ironischen T-Shirts irgendwie souverän und gelassen aus. Überall hat man freies WLAN, der Eisladen heißt »Banana«, der Claim lautet: »Less worry! More life!«, klingt nach einer super Idee. Im besten Lokal der Straße, dem »Manfreds«, wird nur Gemüse serviert, das am Morgen von der hauseigenen, 50 Kilometer entfernten kleinen Farm geliefert wurde, es gibt auch Fleischgerichte, aber wenn man will, kann man, bevor man ein Tier isst, sich dessen Lebensgeschichte erzählen und den Stammbaum aushändigen lassen. Im Café-Kollektiv, eine Ecke weiter, lockt das köstlichste vegetarische Eggs Benedict der Welt (keine Ahnung, aus was der »Schinken« gemacht war, er schmeckte besser als Fleisch), für unsere Freunde des Superfoods fand ich dort: frischen Krauskohlsalat mit Kräutern, hausfermentiertem Sauerkraut, aktivierten Mandeln, laktofermentiertem Fenchel, angegrilltem Blumenkohl, Kurkuma, Granatapfel, Goji-Beeren und Koriander.
Der Stadtteil Nørrebro ist so økologisk, dass Freiburg im Breisgau daneben wie Tschernobyl aussieht. Im Hafen von Kopenhagen kann man schwimmen, selbst die autonome Hippiekommune Christiania ist blitzsauber, und die Energie ist es angeblich auch. Ein großer Teil der Bevölkerung hat sich zusammengetan und in erneuerbare, emissionsfreie Energien für den Großraum Kopenhagen investiert. Jeder, der mitgemacht hat, hat inzwischen knapp acht Prozent Rendite gemacht. Bis 2025 wird die Energieversorgung Kopenhagens komplett selbstversorgend sein. Für den Reiseführer »Lonely Planet« war die dänische Hauptstadt 2019 das Städteziel Nummer eins in Europa, unter anderem wegen Attraktionen wie »Copenhill«, der einzigen Müllverbrennungsanlage weltweit, die so sauber ist, dass sie den Kopenhagenern als Nahausflugsziel dient. Das Dach wurde nämlich so designt, dass es, mit einem Kunstteppich versehen, als Skipiste dient. Die Philosophie des Architekten, Bjarke Ingels, lautet: »Wir können die Welt formen. Mein Kind wird zum Beispiel in einer Welt aufwachsen, in der es völlig normal ist, auf der Spitze eines Müllkraftwerks frische Luft zu atmen und dort Ski zu fahren.« Er sagt auch Sätze wie: »Wir müssen Energie verbrauchen. Das unterscheidet uns von toter Materie. Energie zu verbrauchen ist also eine gute Sache, jedenfalls wenn man das Leben für eine gute Sache hält. Wir wollen Energie verbrauchen. Wir wollen sie nur nicht verschwenden.« Im Vorort Ørestad hat Ingels ein ziemlich innovatives, autarkes Wohnobjekt hingestellt, das »8 Haus«, dänisch »8 Tallet«, 62 000 Quadratmeter in der Form einer Acht, 476 Wohnungen, mit begrünten abfallenden und ansteigenden Dächern, immer wieder unterbrochen durch Grünanlagen, so konzipiert, dass man den Gebäudekomplex auch als Jogging-Track nutzen kann, all das energetisch optimiert und so an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen (zwölf Minuten ins Stadtzentrum), dass eigene Autos hier völlig überflüssig sind. Zu den innovativsten Projekten von Bjarke Ingels gehört auch die »Oceanix City«, die 2050 fertig sein soll und klimaneutralen Wohnraum für mehrere Zehntausend Menschen auf dem Wasser schaffen will – falls es tatsächlich so etwas wie überflutete Städte geben sollte, zeigt Ingels mit solchen Ideen dem Klimawandel die lange Nase. »Oceanix City« ist natürlich als selbstversorgendes Ökosystem ohne Abgase und Abfall konzipiert. Bjarke Ingels ist ein absoluter Superstar in Kopenhagen und einer der begehrtesten Ökoarchitekten weltweit. Kopenhagen ist also geradezu der ideale Ort, um darüber nachzudenken, wie man sein Leben grüner und dabei angenehmer und zeitgemäßer gestalten kann.
Eines möchte ich an dieser Stelle übrigens klarstellen: Ich verstehe von der wissenschaftlichen Seite der Materie so wenig wie Sie. Ich hätte schon Schwierigkeiten, auf Anhieb zu erklären, wie genau der Abfluss bei mir zu Hause funktioniert. Meine Ahnungslosigkeit paart sich übrigens auch mit einer gewissen Skepsis gegenüber wissenschaftlicher Gewissheiten, die ich für ziemlich gesund halte. Es gehört zum Wesen der Wissenschaft, dass sie immer nur zu vorläufigen Ergebnissen kommt, die später wieder überworfen werden. Auch Rassismus basierte früher einmal auf vermeintlich wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wiederum längst von Wissenschaftlern widerlegt wurden. Als 1962 Der stumme Frühling erschien, worin Rahel Carson auf die Gefahren durch Pestizide und Insektizide hinwies, wurde sie von den namenhaftesten Wissenschaftlern geradezu lächerlich gemacht. Es gibt nämlich auch in der Welt der Wissenschaft so etwas wie Moden und Gruppendruck. Neben sehr viel Einleuchtendem ist so viel wissenschaftlicher Unfug im Umlauf, dass niemand von uns Laien je in der Lage sein wird, alles im Einzelnen nachzuprüfen.
Die einen sagen, die Rolle des CO₂ bei der Erderwärmung werde überschätzt. Andere sagen, dass die Maßnahmen, mit denen wir jetzt versuchen, dem CO₂-Ausstoß Herr zu werden, uns Billiarden kosten, aber nur minimale Effekte zeitigen werden. Wiederum andere sagen, es sei eh alles zu spät. Die Zeit, unsere Art zu wirtschaften grundlegend zu ändern, sei vor 30 Jahren gewesen, inzwischen hätten wir so viel zusätzliches CO₂ in die Atmosphäre gepumpt, dass selbst die drastischsten Gegenmaßnahmen die Folgen allenfalls ein bisschen hinauszögern und abmildern könnten.
Dann gibt es auch glaubhafte Stimmen, die sagen, dass das mit der Reduzierung des CO₂-Ausstoßes sehr wohl sinnvoll ist, dass wir uns dadurch aber zum Teil auch lähmen, weil wir vor lauter Starren auf dieses vermaledeite Kohlendioxid versäumen, uns um Dinge zu kümmern, die mindestens so wichtig sind, den Zugang zu Frischwasser in der Dritten Welt zum Beispiel oder Schutzmaßnahmen (wie Umsiedelung oder der Bau von Staudämmen) in Weltregionen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, um sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wehren.
Und dann gibt es noch die Zukunftsgläubigen, die behaupten, dass drastische Gegenmaßnahmen zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes dringend geboten sind, dass wir aber die falschen Maßnahmen ergreifen, weil wir viel zu hektisch in emissionsfreundliche, aber alte Technologien investieren, statt viel mehr Geld in die Erforschung ganz anderer, völlig neuer Technologien zu stecken. Sie beklagen, dass wir vor lauter Untergangsprophezeiungen die gigantischen Chancen für Innovation verpassen, die in der ökologisch-ökonomischen Wende liegen. Die anderen Länder sind dabei, uns davonzueilen, in den Golfstaaten werden Züge geplant, die bis zu 1200 km/h schnell fahren sollen, von den zehn am meisten verkauften Automarken ist nur eine aus Deutschland, Firmen, von denen noch niemand von uns gehört hat, wie BYD aus China, verkaufen sechsmal mehr Elektroautos als VW. Wir könnten, argumentieren Ökooptimisten, mit unserem Know-how Weltmarktführer in alternativen Technologien werden und verlieren uns stattdessen in Visionen von »Degrowth«, Wachstumsrückbau, also Morgenthau-Plan-ähnlichen Deindustrialisierungsfantasien, statt uns für die Zukunft zu rüsten.
Welche der gerade genannten Einwände berechtigt sind und welche nicht, kann ich nicht beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist mein eigenes Leben, sind meine eigenen Konsumgewohnheiten. Wenn ich die Welt verändern will, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, erst einmal mit meinem Mikrokosmos anzufangen. Ich weiß, dass viele bei Zitaten des umstrittenen kanadischen Psychologen Jordan B. Peterson genervt reagieren, aber seinem Satz »Wenn du die Welt retten willst, räum erst mal dein Zimmer auf!« kann man eine gewisse Evidenz nicht absprechen. Außerdem sagt er damit auch nichts anderes als der sehr viel konsensfähigere Dalai Lama, der einmal gesagt haben soll: »Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuche mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist.« Dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, die Welt ein Stückchen in die richtige oder in die falsche Richtung zu stupsen, ist auch die Kernaussage von Alexander Solschenizyns berühmter Dankesrede nach Entgegennahme des Nobelpreises. Jeder von uns hat Wirkung, zumal auch jeder von uns – für mich nehme ich das wenigstens in Anspruch, und Sie sollten das auch – für irgendjemanden als Vorbild fungiert.
Bevor wir uns nun Fragen der grünen Lebensführung zuwenden, ist es aber notwendig, etwas Grundsätzliches zu klären: Wie sehe ich meine Position als Mensch und die der Menschheit vis-à-vis der Natur? Und überhaupt, was ist das eigentlich, Natur?
Wir Deutschen haben ja ein traditionell inniges Verhältnis zur Natur. Vor allem zu Bäumen. Bevor wir (halbwegs) christianisiert wurden, wurden Baumriesen in unseren Breiten als heilig verehrt. Als Mittelpunkt der Welt galt unseren Vorfahren die Weltesche oder Yggdrasil, auf der ständig ein Eichhörnchen namens Ratatosk rauf- und runterrannte, um Nachrichten zu überbringen. Dann natürlich der Christbaum. Ist es nicht verblüffend, wie wir alle zu Weihnachten andächtig vor einem Baum stehen? Dann all die Märchen und Mythen, in denen der Wald als Ort der Zivilisationsflucht, als Sehnsuchtsort gefeiert wird, aber auch als Ort, an dem das Wilde, das Unzähmbare haust.
Mein Vater war ein Jäger, also ein Waldmensch. Ich habe meine halbe Kindheit im Wald verbracht. Meist schoss mein Vater gar nichts. Ich führe das jetzt nicht ins Feld, um alle Tierliebhaber zu beruhigen. Mein Vater verstand etwas von der Jagd, er sagte immer, dass die Wildbestände künstlich hoch gehalten werden, damit Zahnärzte und Anwälte ihrem Jagdhobby nachgehen können, für echte Jäger ist ein guter Wald nur sehr spärlich mit Wild bevölkert, und da heißt »auf die Jagd gehen« in Wahrheit stundenlang still sitzen und gucken. Ich saß oft mit ihm endlose Stunden still auf dem Hochstand. Damals nervte mich das. Heute verstehe ich die Faszination Wald. Die Tage mit meinem Vater fingen immer sehr früh an. Im Morgengrauen am Hochstand sitzend einen Wald erwachen zu sehen – und vor allem ihm beim Erwachen zuzuhören – hat, zumindest wenn ich heute daran zurückdenke, tatsächlich etwas. Der Geruch von nassem Holz und frischem Harz, die Musik der Singvögel, das Rascheln und Knistern der Tiere im Unterholz. Dass Pflanzen, einschließlich der Bäume, lebende Organismen sind, war mir von klein auf klar, noch vor der Lektüre von Tolkien und Roald Dahl. Erinnern Sie sich noch an die Geschichte des Mannes, der verrückt wird, weil er eine Maschine erfindet, mit der man das Schreien der Grashalme hörbar machen kann, wenn sie gemäht werden? Und an die Stelle in Herr der Ringe, an der Baumbart seine gefällten Artgenossen beklagt? »Oh! Viele dieser Bäume waren meine Freunde. Geschöpfe, die ich von Nuss und Eichel kannte.«
Natürlich habe auch ich das Buch von Peter Wohlleben verschlungen, weil dort meine tiefe, in meiner Kindheit geprägte Ahnung endlich Bestätigung erfuhr, dass Bäume miteinander reden können. Als Wohlleben, den die Forstwirte in meiner weiteren Familie aus Borniertheit gern als »Ökospinner« abtun, beschrieb, wie Buchen über ihre Wurzeln Kontakt zu ihren Nachbarn halten und sich nicht nur vor Insektenattacken warnen, sondern sich bei Bedarf gegenseitig sogar Zuckerlösungen zur Erfrischung hin und her reichen, fand ich das völlig einleuchtend.
Erst durch die oben erwähnten bornierten Verwandten habe ich später erfahren, dass der deutsche Wald so wenig mit Natur zu tun hat wie Fünf-Minuten-Terrine mit selbst gekochter Suppe.
Deutschlands Wälder sind zu 80 Prozent Forste, also mehr Plantagen als Wälder. Es gibt in ganz Europa, mit sehr wenigen Ausnahmen in Skandinavien und Polen, gar keine natürlichen Wälder mehr. Wenn unsere Wälder »natürlich« wären, gäbe es keine Dürreschäden, keine extremen Orkanschäden, und wenn der böse Borkenkäfer käme, wäre auch bald der Specht zur Stelle, zu dessen Leibgerichten er gehört. Diese Wälder wären dann aber sogenannte Mischwälder, bestehend hauptsächlich aus Laubbäumen, die ließen sich allerdings nicht so effizient bewirtschaften. Wald, das bedeutet in Deutschland Forstwirtschaft, Monokultur, »Massenbaumhaltung«, wie Wohlleben es nennt.
Der Wald ist also ein gutes Beispiel dafür, wie wir mit manchen Wörtern romantische Ideen verbinden, aber oft nur verschwommene Vorstellungen von der Realität dahinter haben. Mit dem Begriff »Natur« ist es ganz ähnlich.
Die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur fängt schon mit der Komplikation an, dass in dem Moment, in dem man von Natur überhaupt spricht, man sich von ihr abseitsstellt und damit implizit anerkennt, dass man nicht Teil von ihr ist. Stellt man die Natur aber auf einen Sockel, entfernt man sich noch weiter von ihr und macht so aus Natur erst recht Kultur. Bestes Beispiel: der Naturschutz. Wenn wir die Natur schützen, sie also abzäunen, stellen wir damit etwas Künstliches her. Wir definieren einen bestimmten Zustand der Natur als ursprünglich und bewahrenswert und bewachen diesen dann. Ein Eingriff, also Kultur. Fast alle Landschaften, bis auf ein paar Ecken in der Wüste Gobi, sind inzwischen streng genommen Kulturlandschaften. Im Grunde sind somit die französischen Parks mit ihren brutal beschnittenen Hecken, ihren kerzengeraden Wegen und geometrischen Formenspielen ehrlichere Gärten als die sogenannten englischen, die Natürlichkeit simulieren, weil Erstere uns klar vor Augen führen, dass der Mensch dazu neigt, sich der Natur zu bemächtigen.
Wir können gar nicht anders. Die Natur ist zunächst einmal ein ziemlich brutaler Ort. Wenn Prinz Charles von »Mutter Natur« schwärmt und dabei rührselig die Augen rollt, ist das schön, aber auch sentimental. Die Natur ist keine Mutter. Auch Krebs ist Natur. Die giftigsten Stoffe überhaupt sind Naturstoffe. Natur ist, auf sich allein gestellt, ein einziges Töten und Verdrängen, eine moralfreie Zone. Selbst unser Freund, der Wald, ist unerbittlich, dort herrscht ein gnadenloser Kampf um Licht und Lebensraum, sich eng aneinanderschmiegende Bäume sind der Todesstoß für das Unterholz, das kein Licht mehr bekommt. Alles, was klein, schwach und putzig ist, wird von der Natur in der Regel niedergemäht. Wenn junge Rehe in einen Wald kommen, knabbern sie dort zuallererst die saftigen Stücke, also die jungen, nachwachsenden Bäume kurz und klein.
Natur ist hart, und gerade die, von denen wir die träumerische Vorstellung haben, dass sie »im Einklang« mit der Natur leben, wissen oft am besten um diese Härte. Ihr wollt wissen, wie die Natur ist, fragt einer meiner Lieblingsautoren, der große Joseph de Maistre, dann betrachtet sie, wie sie ist, nicht, wie wir sie gern hätten, und schaut euch den sogenannten natürlichen Menschen an: »Il tue pour se nourrir, il tue pour se vêtir, il tue …«, er tötet, um sich zu ernähren, er tötet, um sich anzuziehen. Aus dem Lamm reißt er den Darm, um so Klänge auf seine Harfe zu zaubern, vom Elefanten nimmt er das Horn, um daraus Spielzeug für seine Kleinen zu machen, sein Esszimmertisch ist übersät mit Leichen.
Die von uns lange gern verklärten Buschmänner der Kalahari gehen, wie man zum Beispiel inzwischen weiß, traditionell sehr robust vor, wenn sie mithilfe von Flächenbränden jagen oder ganze Regionen abbrennen, um Lebensraum für ihre weidenden Herden zu schaffen. Es ist auch eine falsche Vorstellung, dass es erst die Industrielle Revolution war, mit der die Zerstörung von Flora und Fauna anfing. Unsere angeblich so naturverbundenen Vorfahren waren ausgesprochene Umweltfrevler. Wo immer die Urmenschen ihren Fuß hinsetzten, begann sofort ein dramatisches Artensterben. Und auch schon die Sumerer und Babylonier kannten schadhafte Monokulturen.
Es ist schwer, ein Anfangsdatum für das Werk der menschlichen Zerstörungswut zu setzen. Das plausibelste Datum liegt leider relativ weit zurück: rund 12 000 Jahre, der Zeitpunkt, an dem wir beschlossen, unser Jäger-und-Sammler-Dasein hinter uns zu lassen, und sesshaft wurden. Diese sogenannte Landwirtschaftliche Revolution war die eine große, unumkehrbare, in ihren Folgen weitreichendste und unsere Existenz völlig neu definierende Zäsur der Menschheitsgeschichte. Von diesem Moment an lebten die Menschen sozusagen nicht mehr mit der Natur, sondern gegen sie, fingen also an, ihr etwas abzuringen, sie zu zähmen und zu beherrschen.
»Zurück zur Natur« hört sich gut an, und auch das Shampoo mit »nur natürlichen Zutaten« klingt gut, aber wollen wir wirklich »zurück zur Natur«? Und selbst wenn: Gibt es überhaupt einen Weg dorthin zurück?
Es gab und gibt Ökologisten, darunter sogar ernsthafte Wissenschaftler wie Eugene Odum, die Deindustrialisierung und »Degrowth«, also den Rückbau der nordischen Weltwirtschaft als die einzige Lösung bezeichneten, und bis heute ist Wachstumskritik ein respektiertes, wenn auch randständiges Thema auf Volkswirtschaftsseminaren, das ändert aber nichts daran, dass es schlicht unrealistisch ist, unsere Art, zu wirtschaften und zu leben, auf ein präindustrielles Niveau zurückzuschrauben. Es soll Kulturen gegeben haben, die den Weg zurückgefunden, die Handbremse gezogen und einen U-Turn hingelegt haben. Aber nur in Legenden, wie in der von der indianischen Hohokam-Kultur, die schon lange vor Kolumbus’ Ankunft systematische Landwirtschaft betrieben und Kanäle gebaut haben soll, bis sie eines Tages einsah, dass sie zum Sklaven ihrer Errungenschaften geworden war und beschloss, alle modernen Hilfsmittel wegzuschmeißen und wieder wie ihre Vorväter zu leben. Eine Legende, wie gesagt. In der Realität gehen solche »Zurück zu den Wurzeln«-Manöver meist unschön aus, wie bei dem Pariser Intellektuellen aus Kambodscha namens Saloth Sar, besser bekannt als Pol Pot oder »Bruder Nummer eins«, der, als er in seinem Land an der Macht war, alle, die in Städten und in Schreibstuben saßen, auf die Felder schickte, um Reis zu ernten, dann alle zu Zwangsarbeit verurteilte und am Ende ein Viertel der Bevölkerung auf den »Killing Fields« ermordet hatte.
Wenn es kein »Zurück zur Natur« gibt, dann vielleicht wenigstens so etwas wie Leben im Einklang mit der Natur? Heidegger meinte nein. Er setzte die wirkmächtige These in die Welt, Schuld an der Ausbeutung der Natur sei letztlich das europäische Christentum, das das »Macht euch die Erde untertan« einfach zu wörtlich genommen habe. Allerdings hatte Heidegger ein verkorkstes Verhältnis zur Kirche (die ihn förderte und der er seine Ausbildung verdankte) und wollte daher nicht einsehen, dass der Auftrag im Buch Genesis auch ganz anders ausgelegt werden kann. Anspruchsvoller, delikater. Geht es in den archetypischen Geschichten von der Bibel bis zu Walt Disney doch eher darum, die Natur zu nutzen, sie aber auch zu hegen (schönes, vergessenes Wort, mein Vater benutzte es oft). Um aus »König der Löwen« zu zitieren:
»Everything you see exists together
in a delicate balance.
As king, you need to understand that balance
and respect all the creatures,
from the crawling ant to the leaping antelope.«
Die Ehrfurcht vor allem Lebenden, die hier so poetisch anklingt, ist natürlich nur dem möglich, der das Leben an sich schätzt. Und da tut sich ein großer Teil der modernen Umweltbewegung sehr schwer. In den Augen der »Deep Ecology«-Schule, also der orthodoxen Öko-Fundis, dazu gehören einflussreiche Figuren wie Paul Ehrlich, David Suzuki und auch Rajendra K. Pachauri (ehemaliger Chef des Weltklimarats IPCC) bis hin zu Al Gore, ist der Mensch, wie in dem berühmten Planeten-Witz, ein Störenfried – um nicht zu sagen ein Schädling. Sie kennen den Witz: Treffen sich zwei Planeten. »Du siehst aber gar nicht gut aus. Was hast du?« – »Menschen.« – »Keine Sorge, das geht rasch vorbei!«
Alle großen politischen Ideologien sind anthropozentrisch. Das heißt, dass sie das Wohl des Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das grüne Denken ist die einzige politische Ideologie, die auf Prämissen beruht, die nicht anthropozentrisch sind. Das hat eine lange Tradition und reicht von Konrad Lorenz (der sagte in einem seiner letzten Interviews: »Gegen die Überbevölkerung hat die Menschheit nichts Vernünftiges unternommen. Man könnte daher eine gewisse Sympathie für Aids bekommen«) über Alexander King, einen der Gründer des Club of Rome, der einmal zum Thema Malariabekämpfung meinte: »Mein Problem ist, dass es die Überbevölkerung verstärkt!«, bis hin zu Englands Prinz Harry, der gelobt hat, aus Klimaschutzgründen maximal zwei Kinder haben zu wollen. Die »Deep Ecology«-Denkschule, auf die der moderne Ökologismus fußt, ist letztlich dem Menschen gegenüber feindselig.
Wer Prinz Harry Applaus spendet, liegt zwar weltanschaulich in der Tradition des »Deep Ecology«-Denkens, muss sich aber auch klar sein, dass ganz ähnlich einer der Amokschützen an der Columbine High School argumentierte, der wahllos Menschen tötete, um den Planeten von vermeintlichem Ungeziefer zu befreien. In seinem Tagebuch notierte einer der beiden Täter: »Die menschliche Rasse ist es nicht wert, dass man sie verteidigt, sie ist nur wert, getötet zu werden. Gebt die Erde den Tieren zurück. Die haben es verdient, wir nicht.«
Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das keine sehr kultivierte Weltsicht ist. Es kann nicht sein, dass wir nur die Wahl zwischen schlecht und weniger schlecht haben. Das geht schon aus philosophischen und aus Gründen der Logik nicht. Wenn es das Schlechte gibt, gibt es auch das Gute. Und wenn es das Gute gibt, kann man es auch tun. Menschen sind keine Schädlinge.
»Ich will, dass ihr Angst habt!«, sagt Greta. Ist das wirklich eine gute Idee?
Holt nicht Angst generell das Schlechteste aus den Menschen heraus? Besteht nicht vielleicht sogar ein Zusammenhang zwischen dem Selbsthass der zivilisierten Menschheit, der in Witzen wie dem der Planeten anklingt, und den Angstbotschaften der Generation Klima?
Ende der Leseprobe