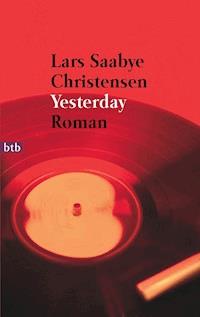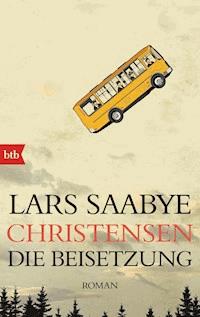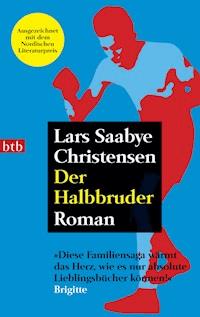
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Barnum wird in eine Welt hineingeboren, die von Frauen geprägt ist und von alten Familiengeheimnissen. Sein Leben wird immer wieder überschattet von seinem Halbbruder Fred. Bis dieser eines Tages spurlos verschwindet und damit das Leben aller unwiderruflich in neue Bahnen lenkt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1434
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Eine Familiengeschichte über drei Generationen:
Am Tag der deutschen Kapitulation wird die zwanzigjährige Vera auf dem Trockenboden ihres Hauses von einem Unbekannten vergewaltigt. Sie bringt einen Sohn zur Welt, Fred, der später als schwererziehbar und legasthenisch eingestuft werden wird. Die außergewöhnliche Familie wird von den Nachbarn und den offiziellen Stellen misstrauisch beobachtet, zumal Vera den Vater des Kindes nicht identifizieren kann. Die Situation entspannt sich nur wenig, als Vera den kleinwüchsigen Arnold Nilsen heiratet. Der ist ein Blender und Angeber, der nur sporadisch anwesend ist. Zur Arbeit muss er oft mehrere Wochen fort, auch wenn er seine Familie nie über die Art seines Berufes aufklärt. Sein Verhalten ändert sich auch nicht, als Barnum, der zweite Sohn und Erzähler der Geschichte, zur Welt kommt. Barnum bewundert seinen wortkargen, mürrischen Bruder Fred, auch wenn dieser nichts tut, um diese abgöttische Liebe zu rechtfertigen. Eines Tages dann verschwindet Fred und es wird Jahre dauern, bis Barnum wieder ein Lebenszeichen von ihm erhält …
Autor
Lars Saabye Christensen, 1953 in Oslo geboren, ist einer der bedeutendsten norwegischen Autoren der Gegenwart. Er ist vielfach preisgekrönt, seine Werke wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt. “Der Halbbruder” wurde in ganz Skandinavien geradezu hymnisch aufgenommen und mit allen wichtigen Literaturpreisen des Nordens ausgezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
(prolog)
»Vielen Dank!«
Ich stand auf Zehenspitzen, streckte den Arm so weit nach vorne, wie ich konnte, und bekam von Esther das Wechselgeld zurück, fünfundzwanzig Öre auf eine Krone. Sie beugte sich durch die enge Luke und legte ihre schrumplige Hand auf meine goldenen Locken, ließ sie dort eine Weile liegen, nicht, dass ich das sonderlich mochte, aber es war ja nicht das erste Mal, so langsam gewöhnte ich mich daran. Fred hatte mir schon lange den Rücken gekehrt, die Tüte mit dem Kandiszucker in die Tasche gestopft, und ich konnte an der Art, wie er ging, sehen, dass er aus irgendeinem Grund wütend war. Fred war wütend, und das war beunruhigend, ziemlich beunruhigend. Er schurrte mit seinen Schuhen über den Boden und schien sich seinen Weg zu bahnen, sein Kopf lag tief zwischen den hohen, spitzen Schultern, es war, als kämpfte er mit starkem Gegenwind und müsste alle Kräfte mobilisieren, aber es war nur ein ruhiger Nachmittag im Mai, ein Samstag war es außerdem, und der Himmel über Marienlyst war glänzend blau und rollte langsam wie ein riesiges Rad auf die Wälder hinter der Stadt zu. »Hat Fred wieder angefangen zu sprechen?«, flüsterte Esther. Ich nickte. »Was hat er gesagt?« »Nichts.« Esther lachte verlegen. »Lauf schnell hinter deinem Bruder her. Damit er nicht alles aufisst.«
Sie zog ihre Hand aus meinem Haar und schnupperte einen Augenblick lang daran, während ich mich beeilte, um Fred einzuholen, und genau daran erinnere ich mich, das ist der Muskel des Gedächtnisses, nicht die gelben Finger der alten Dame in meinen Locken, sondern wie ich schnell hinter Fred, meinem Halbbruder, herlaufe und es fast unmöglich ist, ihn einzuholen. Ich bin der kleine, kleine Bruder, und ich möchte nur wissen, warum er so wütend ist, ich fühle, wie es pocht in meiner Brust, und spüre einen warmen, scharfen Dunst im Mund, denn möglicherweise habe ich mir auf die Zunge gebissen, während ich auf die Straße gelaufen bin. Ich balle die Faust um das Wechselgeld, die warmen Münzen, und ich laufe hinter Fred her, hinter dieser schmalen dunklen Gestalt in all dem Licht um uns herum. Die Uhr hinten beim NRK, beim Norwegischen Rundfunk, zeigt acht nach drei, und Fred hat sich schon auf die Bank bei den Büschen gesetzt. Ich spurte so schnell ich kann über den Kirkevei, es herrscht so gut wie kein Verkehr, denn es ist Samstag, nur ein Leichenwagen fährt vorbei, und plötzlich hat er mitten auf der Kreuzung eine Panne, der Fahrer kommt heraus in seiner hellgrauen Uniform, und er schlägt fluchend ununterbrochen auf die Motorhaube, und in dem Wagen, in dem lang gestreckten Kofferraum hinter den Sitzen, da steht ein weißer Sarg, aber der ist bestimmt leer, es will doch wohl niemand an einem Samstagnachmittag beerdigt werden, die Totengräber haben jetzt sicher frei, und wenn doch jemand drinnen liegt, dann macht das gewiss auch nichts, denn die Toten müssen viel Zeit haben, so denke ich, ich denke so, damit ich etwas zu denken habe, und der graue Fahrer mit seinen schwarzen Handschuhen schafft es endlich, wieder den Wagen zu starten, und verschwindet Richtung Majorstuen. Ich atme ganz tief den schweren Geruch von Abgasen und Benzin ein und laufe übers Gras, an den kleinen Fußgängerüberwegen, Ampeln und Fußwegen vorbei, die es dazwischen gibt, wie eine Stadt für Zwerge, wo wir einmal im Jahr hin befördert werden, um von großen Polizeibeamten in Uniformen mit strammen, breiten Gürteln die Verkehrsregeln zu lernen. Genau dort, in dieser kleinen Stadt, geschah es, dass ich aufhörte zu wachsen. Fred sitzt auf der Bank und schaut nicht zu mir, sondern ganz woanders hin. Ich setze mich neben ihn, und hier gibt es nur uns beide, an diesem Samstagnachmittag im Mai.
Fred schiebt sich einen scharfen Kandisklumpen in den Mund und saugt lange daran, es gurgelt in seinem Gesicht, ich kann sehen, wie die braune Spucke langsam von seinen Lippen tropft. Seine Augen sind dunkel, fast schwarz, und sie schielen, seine Augen schielen. Ich habe das früher schon mal an ihm gesehen. Er schweigt. Die Tauben watscheln lautlos durch das matte Gras. Ich warte. Dann halte ich es nicht mehr aus. »Was ist los?«, frage ich. Fred schluckt, und ein Ruck fährt durch seinen Adamsapfel. »Man redet nicht beim Essen.« Fred schiebt sich mehr Kandis zwischen die Zähne und zermalmt langsam den Zucker. »Aber warum bist du so wütend?«, flüstere ich. Fred isst den ganzen Kandis auf, knüllt die braune Tüte zusammen und wirft sie auf den Fußweg. Eine Möwe stürzt herunter, verscheucht die Tauben, schlittert mit einem Schrei über den Asphalt und steigt an einem Laternenpfahl wieder auf. Fred schiebt seinen Pony nach hinten, aber der fällt wieder in die Stirn, und er lässt ihn dort hängen. Endlich sagt er etwas. »Was hast du zu der Alten gesagt?« »Zu Esther?« »Zu wem sonst? Redet ihr euch jetzt schon mit Vornamen an?« Ich bin hungrig, und mir ist schlecht. Ich würde mich am liebsten hier ins Gras legen und schlafen, zwischen den Tauben. »Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe.« »Das tust du doch. Wenn du ein bisschen drüber nachdenkst.« »Nein, Ehrenwort, Fred. Ich erinnere mich nicht mehr.« »Und warum erinnere ich mich dann noch? Obwohl du dich nicht mehr dran erinnerst?« »Ich weiß es nicht, Fred. Bist du deshalb so wütend?« Plötzlich legt er mir die Hand auf den Kopf. Ich sinke zusammen. Seine Hand ist geballt. »Bist du dumm?«, fragt er. »Nein. Ich weiß nicht, Fred. Sei doch etwas netter. Bitte.« Er lässt seine Faust auf meinen Locken liegen. »Bitte? Es ist allerhöchste Eisenbahn, Kleiner.« »Red nicht so. Bitte.« Er lässt die Finger über mein Gesicht gleiten, sie riechen süß, als würde er mich mit Leim einschmieren. »Soll ich dir genau sagen, was du gesagt hast?« »Ja. Mach das. Sag es mir.« Fred beugt sich zu mir hinunter. Ich schaffe es nicht, ihm in die Augen zu sehen. »Du hast gesagt ›vielen Dank‹!«
Ich war erleichtert. Eigentlich hatte ich befürchtet, ich hätte etwas anderes gesagt, was viel, viel schlimmer gewesen wäre, etwas, was ich nie hätte sagen dürfen, was mir einfach so herausgerutscht war, Worte, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gab. Dreckige Fotze. Ich hustete. »Vielen Dank? Habe ich das gesagt?« »Ja. Du hast verdammt noch mal vielen Dank gesagt!« Fred schrie es heraus, obwohl wir auf der gleichen Bank saßen, dicht nebeneinander. »Vielen Dank!«, schrie er. Ich verstand nicht ganz, was er damit meinte. Und jetzt bekam ich noch mehr Angst. Ich musste dringend aufs Klo. Ich hielt die Luft an. Ich wollte so gern die richtigen Dinge sagen, aber ich wusste nicht, was ich antworten sollte, weil ich nicht begriff, was er überhaupt meinte. Vielen Dank. Und ich konnte auch nicht anfangen zu weinen. Dann wäre Fred nur noch wütender geworden, oder er hätte mich vielleicht ausgelacht, und das war fast das Schlimmste überhaupt, wenn er über mich lachte. Ich beugte mich über meine Knie nach vorne. »Ja und?«, flüsterte ich. Fred stöhnte. »Ja und? Ich glaube, du bist doch dumm.« »Ich bin nicht dumm, Fred.« »Und woher willst du das wissen?« Ich musste nachdenken. »Mutter hat das gesagt. Dass ich nicht dumm bin.« Fred saß eine Weile schweigend da. Ich traute mich nicht, ihn anzusehen. »Und was hat Mutter über mich gesagt?« »Das Gleiche«, antwortete ich schnell. Ich spürte seinen Arm auf meiner Schulter. »Du schwindelst deinen Bruder doch wohl nicht an«, sagte Fred leise. »Auch wenn ich nur dein Halbbruder bin?« Ich schaute auf. Das Licht um uns herum blendete mich. Und es schien, als wäre die Sonne voller Lärm, einem lauten, schrillen Lärm aus allen Richtungen. »Bist du deshalb so wütend auf mich, Fred?« »Warum?« »Weil ich nur dein Halbbruder bin?« Fred zeigte auf meine Hand, in der ich immer noch das Wechselgeld hielt, ein Fünfundzwanzig-Öre-Stück, es war warm und klebrig wie eine platte Pastille, die jemand lange gelutscht und dann ausgespuckt hatte. »Wem gehört das?«, fragte Fred. »Das ist unsres, nicht?« Fred nickte mehrere Male, und mir wurde ganz heiß vor Freude. »Aber du kannst es gern haben«, sagte ich schnell. Ich wollte ihm die Münze geben. Fred saß regungslos da und starrte mich an. Ich wurde wieder ganz unruhig. »Warum sagst du eigentlich vielen Dank? Wenn du Geld zurück kriegst, das uns gehört?« Ich holte tief Luft. »Ich hab das nur so gesagt.« »Denk das nächste Mal vorher nach, okay?« »Ja«, flüsterte ich. »Denn ich will keinen Bruder haben, der sich lächerlich macht. Auch wenn du nur mein Halbbruder bist.« »Nein«, flüsterte ich. »Ich werde nächstes Mal besser nachdenken.« »Vielen Dank ist ein Scheißwort. Sag niemals vielen Dank. Kapiert?« Fred stand auf, spuckte in hohem Bogen einen dicken, braunen Schleimklumpen aus, der mit einem Klatscher direkt vor uns im Gras landete. Ich sah eine ganze Schar Ameisen, die auf ihn zu krabbelten. »Ich hab Durst«, sagte Fred. »Man wird so verdammt durstig von Kandis.«
Wir gingen wieder zu Esther hinüber, zu dem Kiosk im Torweg gegenüber der Majorstuen Kirche, der weißen Kirche, deren Pfarrer damals Fred nicht hatte taufen wollen, und später weigerte er sich auch, mich zu taufen, aber das nur wegen meines Namens. Ich stellte mich vor die Luke, auf Zehen, Fred lehnte sich an die Regenrinne, hob die Hand und nickte, als wären wir uns über eine große Sache einig geworden. Esther kam zum Vorschein, lächelte, als sie mich entdeckte, und musste noch einmal meine Locken befühlen. Fred streckte die Zunge so weit er nur konnte aus dem Mund und tat, als würde er kotzen. »Und was soll es jetzt sein, mein kleiner Herr?«, fragte Esther. Ich schüttelte ihre Finger von meinem Kopf. »Ein Saftpäckchen. Rot.« Sie sah mich etwas verwundert an. »Ja, ja. Ein rotes Saftpäckchen. Hätte ich mir doch denken können.« Sie fand das, was ich haben wollte. Fred stand da, im Schatten, aber er wurde gleichzeitig fast geblendet von dem scharfen Schein der weißgekalkten Kirchenmauer auf der anderen Seite. Fred starrte mich wortlos an. Er ließ mich nicht aus den Augen. Er sah alles. Er hörte alles. Ich legte schnell die Münze in Esthers Hand, und sie gab mir sofort einen Fünfer zurück. »Bitte schön«, sagte Esther. Ich sah ihr in die Augen. Ich stand auf Zehenspitzen und sah ihr in die Augen, schluckte ein paarmal, und über uns rollte immer noch der Himmel hinweg, langsam, wie ein großes, blaues Rad vor den Wolken. Ich zeigte auf den Fünfer. »Das ist unsrer«, sagte ich laut. »Nur dass du das weißt!« Esther fiel fast aus ihrer engen Luke. »Aber in Gottes Namen. Was ist denn mit dir los?« »Nichts, wofür man sich bedanken muss«, sagte ich. Und Fred packte mich beim Arm und zog mich den Kirkevei entlang. Ich gab ihm das Saftpäckchen. Ich hatte keine Lust auf ein Saftpäckchen. Er biss ein Loch in die Ecke und drückte den roten Saft in einem Streifen hinter uns aus. »Nicht schlecht«, sagte er. »Du machst dich.« Ich freute mich. Ich wollte ihm auch den Fünfer geben. »Behalte ihn«, sagte er. Ich drückte die Finger um die braune Münze. Ich konnte mit ihr Kibbelkabbel spielen, wenn jemand mit mir Kibbelkabbel spielen wollte.
»Vielen Dank«, sagte ich.
Fred seufzte tief, und ich fürchtete schon, dass er wieder wütend werden würde. Ich hätte mir am liebsten die Zunge abgebissen und sie verschluckt. Aber stattdessen legte er den Arm um mich, während er den letzten Tropfen aus dem Saftpäckchen in den Rinnstein spritzte. »Weißt du noch, was ich dich gestern gefragt habe?«, fragt er. Ich nicke schnell und wage kaum zu atmen. »Nein«, flüstere ich. »Nein? Das weißt du nicht mehr?« Ich weiß es noch. Aber ich will nicht mehr daran denken. Und ich schaffe es einfach nicht, es zu vergessen. Es wäre mir lieber, wenn Fred nicht wieder davon anfangen würde. »Nein, Fred. « »Soll ich dich das Gleiche noch einmal fragen?« »Ja«, flüstere ich. Und Fred lächelt. Er ist nicht wütend, nicht, wenn er so lächelt wie jetzt.
»Soll ich für dich deinen Vater umbringen, Barnum?«, fragt er.
DAS LETZTE MANUSKRIPT
(das festival)
Dreizehn Stunden in Berlin und schon ein Wrack. Es war das Telefon, es hat geklingelt. Ich habe es gehört. Es hat mich geweckt. Aber ich war woanders. Ich war nahe dran. Ich war losgelöst. Ich war nicht geerdet. Ich hatte keinen Summton, nur ein Herz, das schwer und unrhythmisch schlug. Das Telefon klingelte immer weiter. Ich öffnete die Augen, tauchte auf aus einer flachen Dunkelheit ohne Bilder. Jetzt konnte ich meine Hand sehen. Das war kein besonders schöner Anblick. Sie kam näher. Sie betastete mein Gesicht, prüfend, als wäre sie bei einem Fremden im Bett aufgewacht, an dem Arm eines anderen Mannes befestigt. Die rundlichen Finger verursachten mir plötzlich Übelkeit. Ich blieb liegen. Es hörte nicht auf zu klingeln. Ich konnte leise Stimmen hören, ab und zu ein Stöhnen, hatte jemand bereits für mich den Hörer abgenommen? Warum klingelte es dann aber immer noch? Warum war jemand in meinem Zimmer? War ich doch nicht allein ins Bett gegangen? Ich drehte mich um. Ich konnte sehen, dass die Geräusche vom Fernseher kamen. Zwei Männer trieben es mit einer Frau. Sie sah nicht glücklich aus, eher gleichgültig. Sie hatte eine Tätowierung auf einer Pobacke, die jämmerlich falsch platziert war. Die Oberschenkel waren voller blauer Flecken. Die Männer waren übergewichtig und bleich und hatten Schwierigkeiten mit der Erektion, ließen aber nicht locker, sie stöhnten hohl, während sie sie aus allen möglichen Winkeln nahmen. Es war unbeholfen und traurig anzusehen. Die Gleichgültigkeit der Frau wurde für einen Augenblick von einem Schmerz ersetzt, einem verzerrten Gesicht, als einer der Männer seinen schlaffen Penis über ihren Mund klatschte und schlug. Die Hand verschwand aus meinem Gesicht. Kurz darauf war das Bild weg. Wenn ich meine Zimmernummer eintippte, konnte ich noch zwölf weitere Stunden Pay-TV sehen. Ich wollte nicht mehr sehen. Ich wusste nicht mehr, welches Zimmer ich hatte. Ich lag quer auf dem Bett, noch halb in der Anzugjacke, wahrscheinlich in einem Versuch, einigermaßen anständig ins Bett zu kommen, ausgezogen und wie es sich gehört, aber weiter war ich wohl nicht gekommen, bevor das Licht im innersten Verschlag meiner linken Kopfhälfte ausgegangen sein musste. Aha, ein Schuh stand auf der Fensterbank. Hatte ich selbst dort gestanden und die Aussicht bewundert oder an etwas ganz anderes gedacht? Möglich. Oder auch nicht. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Mein Knie tat weh. Ich fand die Hand wieder. Es war meine Hand. Ich schob sie zum Nachttisch, und als sie da hing wie ein kranker, gespreizter Vogel über einer weißen Ratte, die mit einem roten, böse blitzenden Auge blinzelte, hörte das Telefon auf zu klingeln. Die Hand flog heim. Die Ruhe kam hinterrücks, zog den festen Reißverschluss in meinem Nacken herunter und leckte das Rückgrat mit einer Zunge aus Eisen. Ich rührte mich eine ganze Weile nicht. Ich musste wieder ins Gleichgewicht finden. Die grüne Luftblase musste allmählich in dem gekenterten Fleisch zur Ruhe kommen, in der Mulde der Seele. Ich erinnerte mich an nichts. Das große Radiergummi war über mir gewesen, wie schon so oft. Ich hatte nicht gerade wenige Radiergummis verbraucht. Ich erinnerte mich nur noch daran, wie ich hieß, denn wer kann so einen Namen schon vergessen: Barnum. Barnum! Was sind das eigentlich für Eltern, die ihre Söhne und Töchter zu lebenslänglichem Gefängnis hinter dem Gitter der Buchstaben verurteilen. Kannst du nicht einfach den Namen wechseln?, fragte einer, der nicht wusste, wovon er sprach. Als ob das etwas nützen würde. Wenn du versuchst, ihn loszuwerden, verfolgt dich der Name mit doppeltem Schamgefühl. Barnum! Ein halbes Leben lang habe ich mit diesem Namen gelebt. Es fehlte nicht mehr viel, und er hätte mir sogar gefallen. Das war das Schlimmste. Da sah ich, dass ich etwas in der anderen Hand hielt. Eine Schlüsselkarte, eine neutrale Plastikscheibe mit einer bestimmten Anzahl Löcher in einem bestimmten Muster, die man in den Geldautomaten der Tür stecken und dann das Konto des Zimmers leer räumen konnte, wenn es nicht vom vorherigen Gast überzogen war, der nur ein paar abgebissene Nägel unter dem Bett und ein Seufzen von schweren Träumen in der Matratze hinterlassen hatte. Ich konnte sonst wo sein. In einem Zimmer in Oslo, in einem Zimmer auf Røst, in einem Zimmer ohne Aussicht. Der Koffer stand auf dem Boden, der alte, schweigsame Koffer, ungeöffnet, leer war er sowieso, kein Applaus, nur ein Manuskript, ein paar schnelle Seiten. Ich war gekommen und gegangen. Das bin ich. Gekommen und gegangen und wieder zurückgekrochen. Aber ich konnte noch lesen. Über dem Stuhl am Fenster hing der weiße Bademantel des Hotels. Und auf dem konnte ich den Namen des Hotels erkennen. Kempinski. Kempinski! Da hörte ich die Stadt. Ich hörte Berlin. Ich hörte die Bagger aus dem Osten und die Kirchenglocken aus dem Westen. Langsam stand ich auf. Dieser Tag hatte angefangen, und er hatte ohne mich begonnen. Jetzt fiel mir noch etwas ein. Ich hatte eine Verabredung. Das rote Auge des Telefons blinzelte immer noch. Es war eine Nachricht für mich. Ich schiss drauf. Peder konnte warten. Denn wer sonst als Peder konnte es sein, der mich um diese Uhrzeit anrief und mir eine Nachricht hinterließ? Natürlich war es Peder! Er konnte warten. Peder war gut im Warten. Ich hatte es ihm beigebracht. Niemand mit nur einem Fünkchen Verstand macht am ersten Morgen in Berlin Termine vor dem Mittagessen, nur Peder, mein Freund, mein Partner, mein Agent, er hatte schon Termine vor dem Frühstück, denn Peder war stubenrein geworden. Die Uhr zeigte zwei vor halb eins. Die Zahlen leuchteten in grüner, viereckiger Schrift unter dem toten Fernsehbildschirm und änderten sich um halb eins genau zwischen zwei ungleichmäßigen Herzschlägen. Ich schälte mich aus den Laken, öffnete die Minibar und trank zwei Jägermeister. Sie blieben drin. Ich trank noch einen, ging ins Badezimmer und kotzte sicherheitshalber. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, was ich gegessen hatte. Der Knick an der Klopapierrolle war intakt. Ich war nicht mal auf dem Klo gewesen. Dann putzte ich die Zähne, warf mir den Bademantel über, schob die Füße in die weißen Hotelpantoffeln, und bevor ich rausging, sah ich, dass mich das rote Auge des Telefons noch immer anstarrte, aber Peder konnte warten, das war Peders Job. Peder konnte hohles Stroh dreschen, bis sein Zimmer Feuer fing.
Ich nahm den Fahrstuhl hinunter zum Schwimmbecken, lieh mir eine Badehose, trank ein Bier und noch einen Jägermeister und schaffte drei Bahnen, bis ich erschöpft war. Ich ließ mich auf der Wasseroberfläche treiben. Klassische Musik strömte aus Lautsprechern, die ich nicht sehen konnte. Bach natürlich, synthetische Versionen, unberührt von Menschenhand. Ein paar Damen lagen auf dem Rücken und glitten ruhig dahin. Sie glitten auf Amerikanisch, die Arme wie Flügel ausgebreitet, und sie trugen Sonnenbrillen, die sie die ganze Zeit hochschieben mussten, auf die Stirn, um besser sehen zu können, um den Blick anderer erwidern zu können, denn Robert Downey könnte ja entlanggeschlendert kommen, Al Pacino auf Plateausohlen oder mein alter Freund Sean Connery, dann würde ich ihm einen richtigen Drink spendieren und darüber reden, wie schön es letztes Mal war. Aber keiner aus der Etage des Himmels war in Sicht, und ich war auch keine große Augenweide. Die Damen ließen die Sonnenbrillen wieder auf ihren Platz kippen und hielten sich mit langsamen, blauen Armen im Fluss, sie waren Engel im Chlor mit kleinen aufgeblasenen Bäuchen. Das ließ mich plötzlich ganz ruhig werden, ganz erschöpft und ruhig und fast glücklich. Ich glitt auch dahin. Ich glitt auf Norwegisch, die Hände an den Seiten und die Finger wie Schaufeln, um das Gleichgewicht zu halten, das Gleiten, ich strich die Riemen. Jetzt war ich in der Waage. Dann war die Angst da, sie überraschte mich jedes Mal wieder von Neuem, selbst wenn ich wusste, dass sie kommen würde, so wie Schnee. Die Angst nippte an meiner Ruhe. Die Angst kippte meine Ruhe. War in der Nacht etwas passiert? Hatte ich jemandem Blumen gekauft, bei jemandem um Entschuldigung gebeten, um Verzeihung, für jemanden gratis gearbeitet, ihm den Rücken geleckt? Keine Ahnung. Alles konnte passiert sein. Ich befand mich in den Klauen des Verdachts. Ich drehte mich und machte Wellen unter den amerikanischen Damen, kletterte die geriffelten Stufen hinauf wie eine bucklige, zweigeschlechtliche Aphrodite, hörte das leise Lachen über dem Wasser, und in dem Moment kam Cliff Richard aus dem Umkleideraum, wenn er es denn war, in Bademantel und Hotelpantoffeln. Sein Haar lag wie eine Hochgebirgsebene auf seinem Kopf, sein Gesicht war frisch geliftet. Er ähnelte einer Mumie, die aus einer Pyramide aus den Sechzigern geflohen war. Mit anderen Worten: er hielt sich wacker, und die Damen machten da draußen ziemlich auf sich aufmerksam, sie schnaubten wie freundlich gesinnte Schweinswale, obwohl Cliff möglicherweise nicht an oberster Stelle auf ihrer Wunschliste stand. Aber für mich war er mehr als gut genug. Er ließ mich nämlich für einen Augenblick die Angst vergessen, er hatte mir eine Verschnaufpause verschafft, allein durch seine Anwesenheit, wie schon einmal in diesem Leben, das unsere Geschichte ist, meine und Freds Geschichte, und die ich nur damals nenne. Damals, als wir in unserem Zimmer saßen, im Kirkevei, das Ohr an den Plattenspieler geklebt und Livin’ lovin’ doll hörten, während Fred mit weit offenen Augen stumm auf dem Bett lag. Er hatte seit zweiundzwanzig Monaten nicht gesprochen, genauso lange, wie Elefanten trächtig sind, nicht ein einziges Wort hatte er gesagt, seit die Alte gestorben war, und alle hatten aufgegeben, ihn wieder zum Sprechen zu bringen, Mutter, Boletta, der Klassenlehrer, der Schulzahnarzt, Esther im Kiosk, Gott und die Welt, niemand kriegte ein Wort aus ihm heraus, und ich schon gar nicht. Aber als ich den Tonabnehmer hob und Livin’ lovin’ doll zum zwanzigsten Mal spielen wollte, erhob sich Fred vom Bett, riss den Tonabnehmer ab, ging hinunter in den Hof, warf dort den gesamten Plattenspieler in den Mülleimer und fing an zu reden. Dazu war ein Cliff nötig gewesen. Und dafür wollte ich mich bedanken. Aber Sir Cliff Richard ging nur in einem großen Bogen an mir vorbei und setzte sich auf ein Trimmdichrad zwischen die Spiegel in der Ecke und strampelte auf sein eigenes Bild zu, ohne etwas aufzunehmen, wie eine Mumie mit Tennisarm. Und meine Hand glitt über den Bartresen und packte das Erste, was sie erwischte, Gin Tonic, das reinste Zuckerwasser. Vier Uhren zeigten die Zeit in New York, Buenos Aires, Djakarta und Berlin an. Ich begnügte mich mit Berlin. Viertel vor zwei. Peder schwitzte jetzt. Peder machte Konversation, entschuldigte sich, holte Bier, Kaffee, Sandwiches, er rief im Hotel an, ließ mich suchen, hinterließ erneut eine Nachricht, irrte im Pressezentrum umher und nickte allen zu, die ihn wiedererkannten, und verbeugte sich vor allen, die er nicht kannte, und gab allen Visitenkarten, die ihn nicht wiedererkannten. Ich konnte ihn fast sagen hören, Barnum kommt gleich, er hat sicher nur einen kleinen Umweg gemacht, ihr wisst ja, wie er ist, nicht wahr, die guten Ideen kommen meistens aus zerstreuten Köpfen, ich bin nur die Fleisch gewordene Fantasie, die sie sichtbar werden lässt. Einen Toast auf Barnum! Ja, Peder schwitzte jetzt wahrscheinlich, und das geschah ihm ganz recht. Ich lachte, ich lachte laut am Rand des Schwimmbeckens im Kempinski Hotel, während Cliff Richard mit drei Spiegeln und unter den gierigen Blicken der amerikanischen Damen um die Wette radelte, und ebenso plötzlich, wie die Angst und das Lachen kamen, drang ein Schatten in mich ein. Was ging mit mir vor? Welcher verdrehten Ekstase war ich ausgesetzt, was für eine Art finsteres Glück ritt mich? War es das letzte Lachen, bevor das kommen würde, von dem ich noch nichts wusste, das ich aber dennoch am meisten fürchtete? Ich fröstelte. Einen Augenblick lang schwankte ich auf den grünen Marmorfliesen. Ich saugte das Lachen in mich hinein. Ich rief es zurück. Das war nicht die Ruhe vor dem Sturm. Das war die Ruhe, die die Katzen dazu bringt zu zittern, lange bevor der Regen fällt.
Ich duschte und überlegte eine Weile, ob ich mich ins Solarium legen sollte. Ein Hauch brauner Farbe und etwas Gesichtslifting vor dem Treffen würden sich gut machen. Aber ich war in der unschlüssigen und gleichgültigen Phase. Ich holte mir stattdessen ein Bier. Der Kellner lächelte kaum, als er mir die Flasche gab. Mir fiel plötzlich auf, wie jung er war. Er trug die Hoteluniform mit einer linkischen Würde, fast Trotz, wie ein Kind, das den dunklen Anzug des Vaters gestohlen hat. Ich nahm an, dass er aus dem alten Ostdeutschland kam, es war etwas an seinem Trotz, das mich zu der Annahme brachte. Er hatte den beschwerlichen Aufstieg in der Schwimmhalle des Kempinskis begonnen. »Mr. Barnum?«, fragte er leise. Er glaubte offenbar, das wäre mein Nachname. Er war nicht der einzige. Es war ihm vergeben. »Ja? Das bin ich.« »Ich habe eine Nachricht für Sie.« Er gab mir einen breiten Umschlag mit dem Hotel-Logo drauf. Peder fand mich also trotzdem. Auch wenn ich mich hinter den Klippen von Røst versteckte, er würde mich finden. Wenn ich in der Ausnüchterungszelle schlief, war es Peder, der mich weckte. Wachte ich im Cochs Hospiz am Bogstadveien auf, war es Peder, der an die Tür klopfte. Ich beugte mich über den Tresen. »Wie heißt du?«, fragte ich. »Kurt, Sir.« Ich nickte zu den Spiegeln in der Ecke. »Siehst du den Typen da, Kurt. Der die ganze Zeit Rad fährt.« »Ja, Sir. Ich sehe ihn.« »Aber erkennst du, wer es ist?« »Tut mir Leid, Sir. Nein.« Und ich verstand, langsam, aber sicher, dass ich alt geworden war. »Das macht nichts, Kurt. Bring ihm eine Cola. Light. Und schreib die Rechnung auf meine Zimmernummer.«
Ich faltete den Umschlag viermal zusammen und schob ihn in die Bademanteltasche. Wenn Peder wollte, dass ich auch ins Schwitzen kam, sollte er seinen Wunsch erfüllt bekommen. Ich nahm ein Bier mit in die Sauna und fand einen Platz auf der obersten Bank. Da saß schon jemand, den ich irgendwie kannte, aber nicht richtig einordnen konnte, deshalb grüßte ich vage, nur ein leichtes Nicken mit dem Kopf, meine Spezialität, meine persönliche Geste an die Welt. Aber der andere starrte mich geradewegs an, ohne jede Scheu. Ich hoffte nur, dass es keiner meiner Landsleute war, Dramaturgen vom Norsk Film, Journalisten von den Unterhaltungsseiten, Tratschspezialisten von den Zeitschriften oder andere Wichtigtuer. Schon bald bereute ich meinen Entschluss, diese heiße Hintertür, denn hier mussten alle nackt sein, und hier gab es Männer und Frauen. Und derjenige, der ein ganz normales Handtuch um den Leib geschlungen hatte, war ein Eindringling, der die anderen in Verlegenheit brachte. Ich war der Angezogene, der ihre Nacktheit plötzlich sichtbar und unerträglich machte, alle Krampfadern, Hautfalten, Leberflecken, die vielleicht bösartig waren. Ich musste das Handtuch entfernen. Es ging nicht anders. Raus konnte ich nicht, denn das hätte meine Feigheit entlarvt und mich als Voyeur abgestempelt, und das Festival sollte noch drei Tage dauern. Widerstrebend zog ich das Handtuch zur Seite und zeigte ihnen, dass ich unter meinen vielen Kostümen auch ganz natürlich sein konnte, dass ich mir meine Nacktheit wohl bewahrt hatte. So saß ich da, die Beine übereinander geschlagen, entblößt in einer deutschen Gemeinschaftssauna, und wunderte mich darüber, dass man in diesem gesetzestreuen und humorlosen Land fast verpflichtet war, zusammen zu sitzen, Männer und Frauen, wenn man ein bisschen schwitzen wollte. In dem naturverbundenen Norwegen, das sich noch kaum von den Gletschern befreit hatte, würde das eine Regierungskrise und Leserbriefe nach sich ziehen. Aber darin, dass es so angeordnet war, steckte auch eine gewisse Logik. Es gab nur eine einzige Sauna im Hotel, und die mussten Frauen und Männer benutzen, nackt und gleichzeitig. Wenn es freigestellt gewesen wäre, wäre es ungehörig. Das musste etwas mit dem Krieg zu tun haben. Alles hatte hier etwas mit dem Krieg zu tun, und ich dachte an die Konzentrationslager, an die letzte Dusche, wie Männer und Frauen voneinander getrennt wurden, ein für alle Mal, von den adretten Massenmördern, es gab sogar eigene Lager für Frauen, Ravensbrück, und einen Augenblick lang, fast erregt, glaubte ich, das wäre zu etwas zu benützen, dieser Sprung, der Gedankensprung, von der Vernichtung zu diesem zufälligen Zusammentreffen in der Sauna im Kempinski während des Filmfestivals in dem neuen Berlin. Aber wie so oft in letzter Zeit rutschte es weg. Der Gedanke riss ab, der Widerhaken war zu schwach, und während er wegglitt, versank ich umso tiefer in meinen Zweifeln. Was hatte ich eigentlich zu bieten? Für welche Geschichten war ich der richtige Mann? Wie viel kann man stehlen, bis man geschnappt wird? Wie viel muss man lügen, bevor einem geglaubt wird? War ich etwa nicht immer ein Zweifler gewesen, ein gewöhnlicher Zweifler? Doch, ich hatte an fast allem meine Zweifel gehabt, ganz zu schweigen von mir selbst. Ich war überhaupt im Zweifel, ob es etwas gab, das »Ich« genannt werden konnte, in finsteren Zeiten betrachtete ich mich selbst als eine begrenzte Menge Fleisch, die nach einem bestimmten Prinzip gestapelt war und unter dem Namen Barnum lief. An allem hatte ich gezweifelt, abgesehen von Fred, denn Fred war zweifellos, er war über jeden Zweifel erhaben. Ich erinnerte mich an das, was Vater immer sagte: Nicht das, was du siehst, ist wichtig, sondern das, was du zu sehen glaubst. Ich leerte die Flasche, und jetzt erkannte ich eine von denen, die da saßen. Genau wie ich befürchtet hatte, eine bekannte Kritikerin, eine, die jeder kennt, ich erwähne ihren Namen besser nicht, wir haben sie immer nur die Elchkuh genannt, denn sie erinnerte uns immer an einen Sonnenuntergang. Sie schrieb, als sie noch im Geschäft war, dass ich »ein Volkswagen unter den Rolls Royce« wäre, aber ich habe den Artikel nie gelesen, denn ich hatte damals keine guten Manieren. Peder plante eine Anklage wegen Verleumdung, zum Glück wurde da nie etwas daraus, aber wenn sie sich mit Metaphern duellieren wollte, war sie bei mir an den falschen Mann geraten. Jetzt blickte sie in meine Richtung und zeigte ein Lächeln, und auch wenn sie hier sehr viel weniger pompös als in ihren Artikeln wirkte, eher als wäre sie eine kleine weiche Frucht, die mit einem Hobel abgeschabt worden war, so vermied ich es tunlichst, ihr Lächeln zu erwidern. Sonst konnte es noch geschehen, dass ich etwas sagen würde, was ich nie hätte sagen sollen. Sie war mein böses Omen. Was prophezeite sie mir diesmal? Ich mochte gar nicht daran denken. Ich lächelte sie an. »Hol euch doch alle der Teufel!«, sagte ich. Ich beugte mich weit nach vorne und hustete kräftig. Kaum zu glauben. Meine Zunge verhedderte sich wieder. Die Zunge war ein Stolperdraht. Deine Zunge ist eine Rutsche, sagte Fred immer. Aber das wusste nur ich. Hol euch doch alle der Teufel. Die Elchkuh schaute verblüfft auf, ich hustete mit aller Kraft, es fehlte nicht viel, und ich hätte angefangen zu kotzen, und noch einmal kam mir Cliff Richard zu Hilfe. Er betrat nämlich genau jetzt die Sauna, eine Cola in der Hand, und erinnerte mich an das Cover von Livin’ lovin’ doll, blieb einige Sekunden an der Eieruhr stehen, in der der Sand fiel und stieg, als wäre die Zeit nicht etwas, das man hinter sich lässt, sondern beiseite. Dann setzte Cliff sich nach ganz oben zu mir. Es war eng. Es wurde bald zu heiß. Die Nadel stand auf neunzig. Die Elchkuh hatte genug. Sie schlängelte sich hinter ihrem Handtuch nach draußen, mit einem schnellen letzten Blick über die Schulter. Lachte sie? Lachte sie über mich? Hatte sie jetzt eine Geschichte, die sie heute Abend am Bartresen erzählen konnte? Jemand goss Wasser auf die Steine, es zischte. Und die Feuchtigkeit wurde sichtbar wie kochender Nebel. Ich drehte mich zu Cliff um. Er schwitzte nicht. Er war trocken. Sein Haar lag an Ort und Stelle. Er hatte eine schöne braune Hautfarbe. Jetzt konnte ich es ihm endlich sagen. »Danke«, sagte er plötzlich, »für die Cola.« »Im Gegenteil, ich bin es, der sich bedanken muss«, sagte ich. »Danke.« Cliff hob die Flasche, lächelte. »Wofür?« »Für deinen Song, der meinen Bruder zum Reden gebracht hat«, sagte ich. Da wurde er für einen Moment verlegen. »Dann war es nicht mein Song, sondern Gottes Kraft«, flüsterte Cliff.
Es wurde zu heiß. Ich nahm mein Handtuch und wankte hinaus, schwindlig und durstig, duschte noch einmal und sah aus den Augenwinkeln Kurt an der Bar. Er nickte diskret und zwinkerte. Er war jetzt mein Mann. Ich nahm den Fahrstuhl zum Zimmer nach oben. Das Telefon leuchtete immer noch rot. Ich nahm den Hörer ab und ließ ihn wieder fallen, warf den Bademantel aufs Bett, zog mir einen Anzug an und schob eine Flasche aus der Minibar in jede Tasche. Es gab viele Taschen in meinem Anzug. Ich war mit Schnaps bewaffnet. Dann trank ich den letzten Jägermeister, er blieb wie eine brennende Säule vom Magen bis zur Kehle stehen, ich aß einen Löffel Zahnpasta und legte die Einlegesohlen in die neuen, italienischen Schuhe. Ich war bereit für den Termin.
Und was konnte ich schon wissen von all dem, was dort geschah, wo ich nicht war, die Bewegungen, die außer meiner Reichweite vor sich gingen? Ich wusste es nicht. Ich lebte noch in Unwissenheit, im Zustand des Verdachts, und ich wollte es nicht wissen, während ich in dem langsamen Fahrstuhl mit den verspiegelten Wänden stand, sogar an der Decke war ein Spiegel. Ich wollte nur in diesem Augenblick sein, ein gegenwärtiger Mann, der eine Sekunde nach der anderen nahm, eingesperrt in den kleinsten aller Zeiträume, in dem es nur Platz für mich gab. Ich erspähte kurz mein Gesicht in den Spiegeln und dachte an ein Kind, das hinfällt, wieder aufsteht und erst anfängt zu schreien, wenn es die erschrockenen und besorgten Menschen um sich herum sieht, wie ein verspäteter Schmerz, das Echo eines Schocks. Ich schaffte es, einen Wodka zu trinken. Dann öffnete ein weißhaariger Portier die Tür und wollte mich mit einem Regenschirm hinausbegleiten. Ich gab ihm fünf Mark, damit er es sein ließ. Er schaute ganz betrübt auf die Münze, bevor sie plötzlich zwischen den glatten, grauen Fingern verschwand und es unmöglich war festzustellen, ob ich ihn beleidigt hatte, indem ich ihm zu viel gab oder viel zu wenig. Er sah aus wie ein Diener aus der Kolonialzeit. Er war es, der die Fäden im Hotel Kempinski in den Händen hielt. Er war es, der die Klopapierrollen knickte. Ich trat auf den roten Läufer hinaus, der an den Rändern schon abgenutzt war. Vier schwarze Limousinen mit getönten Scheiben standen am Straßenrand geparkt. Keine gehörte mir. Es gibt ein altes Sprichwort in der Branche: No limo, no deal. War mir doch scheißegal. Der Wodka brannte unter der Zunge. Ich zündete mir eine Zigarette an. Zwei Fernsehteams, CNN und NDR, warteten, dass etwas passieren würde. Ein dünner Regenfilm lag über Berlin. Der Geruch von Asche. Der wilde Staub von den Baustellen. Die Kräne drehten sich langsam im Kreis, soweit sie unter den tief hängenden Wolken zu sehen waren. Es sah aus, als spielte Gott mit einem Mechano-Bausatz. Noch eine Limousine, eine lange, weiße Lokomotive mit amerikanischen Wimpeln, hielt direkt vor dem Hotel, und heraus stieg eine Frau mit dem geradesten Rücken, den ich jemals gesehen habe. Neunzehn Regenschirme kamen ihr entgegen. Sie lachte, und dieses Lachen war in Whisky getaucht, mit Teer eingeschmiert und mit grobem Sandpapier geschmirgelt. Sie lachte und ging den roten Läufer entlang, während sie mit einer schlanken Hand winkte, die sich mit der Eleganz eines Taschendiebs zwischen die Tropfen außerhalb der Reichweite der schwarzen Regenschirme schmiegte. Und niemand konnte auf einem roten Läufer so gehen wie sie. Es war Lauren Bacall. Es war niemand anders als Lauren Bacall. Sie war in ihrem eigenen Körper zu Hause, in jedem einzelnen Gramm zur Stelle. Sie füllte ihn bis zu den Fingerspitzen, den Ohrläppchen, bis zu den Augenbrauen. Die Regenschirme verdrehten sich über ihr, als sie das Kinn vorreckte. Sie war gerade eben erst in Deutschland eingefallen. Und ich blieb stehen, von diesem elektrisierenden Anblick wie festgezurrt: Lauren Bacall, wie sie langsam und souverän an mir vorbeigeht, und ich stehe in ihrem Fahrtwind, und es ist eine rückwärts gespulte Warnung, ein spiegelverkehrtes Déjà Vu: Ich sehe es vor mir, Rosenborg Kino, Reihe 14, Platz 18, 19 und 20, The Big Sleep, Vivian sitzt in der Mitte, das ist logisch und klar, ich kann sogar den neuen Rollkragenpullover im Nacken kratzen spüren, ich kann Lauren Bacall hören, wie sie Humphrey Bogart mit dieser Stimme zuflüstert, die uns ein prickelndes Gefühl im Mund und ein unruhiges Rückenmark bereitet, A lot depends on who’s in the saddle, und Peder und ich legen gleichzeitig unseren Arm um Vivian, meine Hand stößt auf Peders Finger, keiner von uns sagt etwas, und Vivian lächelt, lächelt vor sich hin und lehnt sich zurück, gegen unsere Arme. Aber als ich mich zu ihr drehe, sehe ich, dass sie weint.
Und jetzt stehe ich im Regen in Berlin, neben dem roten Läufer, vor dem Hotel Kempinski. Etwas ist passiert. Jemand schrie die ganze Zeit, aber ich hörte keinen Laut. Die Lampen waren erloschen, die Kameras abgestellt, die Limousinen woanders hin gefahren. Der gleiche Portier wie vorhin fasste mich vorsichtig beim Arm. »Alles in Ordnung, Sir?« »Was?« Sein Gesicht kam näher. Alle beugten sich zu mir, nach unten. »Sir, ist alles in Ordnung mit Ihnen?« Ich nickte. Ich schaute mich um. Die Kräne standen still, Gott hatte keine Lust mehr, mit dem Mechano-Baukasten zu spielen, oder waren es vielleicht nur die Wolken, die in entgegengesetzter Richtung über den Himmel zogen und es so aussehen ließen? »Sicher, Sir?« Die Zigarette flog in den Rinnstein. Jemand hatte einen Fotoapparat verloren. Er lag da und spulte zurück. »Können Sie mir ein Taxi besorgen?« »Aber gern, Sir.« Er blies in eine Pfeife, die er schon in der Hand bereit hielt. Ich holte eine Münze heraus, die wollte ich ihm geben, er hatte es verdient. Aber er schüttelte nur den Kopf und schaute weg. »Behalten Sie’s nur, Sir.« Ich schob das Geld schnell wieder in die Tasche. »Vielen Dank«, sagte ich.
Das Taxi kam, der Portier öffnete die Tür für mich. Es roch nach Gewürzen und Rauchwerk in dem Auto. Ein Gebetsteppich lag zusammengerollt auf dem Beifahrersitz. »Zoo Palast«, sagte ich. Der Fahrer drehte sich kurz um und lächelte. Ein Goldzahn blinkte mitten in dem schwarzen Mund. »Soll ich am Tiergarten halten?« Ich musste auch lächeln. »Nein, am Festivalcenter. Dort sind die witzigeren Tiere.«
Es dauerte eine halbe Stunde. Zu Fuß hätte ich fünf Minuten gebraucht. Ich leerte einen Cognac und schlief ein. Im Schlaf sah ich ein Bild: Fred, wie er einen Sarg über den Schnee im Hinterhof zieht. Der Fahrer musste mich wecken. Wir waren da. Er lachte. Jetzt hörte ich es. Es war das barmherzige Lachen. Der Goldzahn blendete mich. Ich bezahlte viel mehr, als ich musste, und er glaubte wohl, dass es ein Missverständnis wäre, dass ich ein Tourist wäre, der nicht rechnen konnte, oder ein betrunkener Kinochef in viel zu teurem Anzug. Er wollte mir etwas zurückgeben, der ehrliche Moslem in Berlin, aber ich stand schon auf dem Bürgersteig, zwischen Ruinen und Kathedralen, zwischen Affen und Sternen. Jemand wollte mir sogleich eine Lederjacke verkaufen. Ich schob ihn beiseite. Es hörte auf zu regnen. Die Kräne zogen weiter ihre langsamen Kreise, und der Himmel über Berlin glänzte plötzlich und war fast durchsichtig. Eine kühle Sonne stach mir direkt in die Augen, während ein Schwarm Tauben hochflatterte und das Licht in Stücke zerhackte.
Ich ging ins Festivalcenter hinein. Zwei bewaffnete Wachen kontrollierten meine Akkreditierungskarte mit dem kleinen Foto, das am vorherigen Abend gemacht worden war, Barnum Nilsen, Screenwriter, starrten etwas zu lange auf mein Gesicht und ließen mich dann die Sicherheitszone passieren, das heilige Tor, das die, die dazugehörten, von denen trennte, die nicht dazugehörten. Jetzt gehörte ich dazu. Leute wuselten wie die Wahnsinnigen durcheinander, die Hände voll mit Bier, Broschüren, Kassetten, Handys, Plakaten und Visitenkarten. Die Frauen waren groß und mager, mit aufgestecktem Haar, Brillen an einer Schnur um den Hals und engen, grauen Röcken, als kämen alle direkt aus dem gleichen Laden. Die Männer waren meistens fett, klein geraten, in meinem Alter, und das Herzflimmern drehte sich in den blutunterlaufenen Augen, wir ähnelten uns alle zum Verwechseln, und mindestens einer von uns würde noch sterben, bevor dieser Tag zu Ende war. Auf einem Großbildschirm wurde der Trailer eines japanischen Gangsterfilms gezeigt. Ästhetische Gewalt war auf dem Siegeszug. Langsam zu töten wurde akzeptiert. Jemand gab mir ein Glas Sake. Ich trank. Ich bekam einen Nachschlag. Ich belegte meine Leber mit einem Bombenteppich. Bille August wurde vom australischen Fernsehen interviewt. Sein Hemd war so weiß wie immer. Niemand hat weißere Hemden als Bille August. Danach hätten sie ihn fragen sollen. Wie viele weiße Hemden haben Sie? Wie oft wechseln Sie Ihr Hemd? An einer anderen Stelle stand Spike Lee vor einer Kamera und gestikulierte. Und durch all das Gewimmel kam Peder herangestürmt, sein Schlipsknoten hing über dem Bauch, sein Mund bewegte sich unaufhörlich, es sah aus, als hyperventilierte er oder versuchte, einen neuen Rekord im Passivrauchen aufzustellen. Es war nicht unmöglich, dass Peder im Laufe dieses Abends sterben würde. Er blieb direkt vor mir stehen und schnappte nach Luft. »Aha«, sagte er. »Du bist ausgelaufen.« »Ich war nie ganz dicht.« »Wie besoffen bist du?« »Fünfeinhalb.« Peder beugte sich näher vor, seine Nasenflügel vibrierten. »Fünfeinhalb? Das sieht eher nach einem Strafporto aus, Barnum.« »Nichts da. Ich habe alles unter Kontrolle.« Ich lachte. Es gefiel mir, wenn Peder unsere alten Witze benutzte. Aber Peder lachte nicht. »Wo zum Teufel bist du gewesen?« »In der Sauna.« »In der Sauna? Weißt du, wie lange ich schon hier sitze und auf dich warte? Weißt du das?« Peder rüttelte an meinem Arm. Er war aus dem Gleichgewicht geraten. »Verdammte Scheiße, ich habe so viele nette Worte über dich gesagt, dass ich kurz vorm Kotzen bin!« Er zog mich rüber in den skandinavischen Bereich. »Nun mal langsam«, sagte ich. »Jetzt bin ich ja hier.« »Kannst du dir nicht ein Handy anschaffen, verflucht noch mal! Wie alle normalen Leute!« »Ich will keinen Kopfkrebs kriegen, Peder.« »Soll ich dir einen Europieper besorgen? Verdammte Scheiße, ich werde höchstpersönlich einen Europieper für dich kaufen!« »Glaubst du, der funktioniert auch in der Sauna?« »Der funktioniert auf dem Mond!« »Du findest mich doch auch so, Peder.« Er blieb abrupt stehen und sah mich lange an. »Weißt du was? Du wirst verdammt noch mal deinem verrückten Halbbruder immer ähnlicher!« Und als Peder das sagte, explodierte der Augenblick, mein Bunker, und die Zeit kam von allen Seiten auf mich zu. Ich packte ihn bei der Jacke und drückte ihn gegen die Wand. »Das sagst du nie wieder! Niemals!« Peder sah mich verblüfft an, er hatte Sake auf der Hose. »Verdammte Scheiße, Barnum. Das habe ich nicht so gemeint.« Ich glaube, einige wurden auf uns aufmerksam. Es war eine Wut in mir, die ich kaum wiedererkannte. Es tat fast gut. Damit war etwas anzufangen. »Ich scheiß drauf, was du meinst. Aber vergleich mich niemals wieder mit Fred! Kapiert?« Peder versuchte zu lächeln. »Ich habe es kapiert! Jetzt lass mich los, Barnum.« Ich wartete ein bisschen. Es ging nicht anders. Dann ließ ich Peder los. Er blieb ganz ruhig an der Wand stehen, verwundert und betreten. Die Wut verließ mich und hinterließ nichts außer einem Gefühl der Scham, der Angst und der Verlegenheit. »Ich möchte einfach nicht an ihn erinnert werden«, sagte ich leise. »Tut mir Leid«, flüsterte Peder. »Das war dumm von mir.« »Ist schon in Ordnung. Vergessen wir’s. Entschuldige.« Ich zog ein Taschentuch heraus und versuchte, den japanischen Alkohol von seiner Hose zu reiben. Peder bewegte sich nicht. »Wollen wir jetzt zu dem Termin gehen?«, fragte er. »Wer ist alles dabei?« Peder seufzte. »Zwei Dänen und ein Engländer.« »Wie lustig. Ist das ein Witz? Zwei Dänen und ein Engländer.« »Sie haben ihre Büros in London und Kopenhagen. Sie waren schon bei Miss Daisy und ihr Chauffeur dabei. Ich habe es dir gestern erzählt, Barnum.« Ich hatte auch noch auf seine Schuhe Sake gekleckert. Ich kniete mich hin und putzte sie, so gut ich konnte. Peder trat nach mir. »Reiß dich zusammen!«, fauchte er. Ich stand auf. »Was wollen die eigentlich?« »Was die wollen? Was denkst du? Dich kennen lernen natürlich. Sie lieben den ›Wikinger‹.« »Vielen Dank, Peder. Schleimen wir uns jetzt schon gegenseitig voll?« »Nein. Jetzt gehen wir, Barnum.«
Wir gingen. Es wurden immer weniger Leute. Es war typisch, dass der norwegische Stand ganz hinten lag, in einer Ecke, wir waren immer noch nicht über Die Gefahren des Fischerlebens hinausgekommen, den Grundstein der norwegischen Melancholie, und der schob uns an den Außenrand Europas und des Festivals. Es war eine richtige Expedition, nach Norwegen zu kommen. Peder sah mich böse an. »Verdammt, du hörst dich wie eine ganze Minibar an, wenn du gehst.« »Sie ist gleich leer, Peder.« Ich schraubte einen Whisky auf und trank ihn. Peder packte mich am Arm. »Wir brauchen das, Barnum. Reiß dich zusammen.« »Miss Daisy? War das nicht eigentlich ein ziemlicher Scheißfilm?« »Ein Scheißfilm? Weißt du, wie viele Nominierungen der gekriegt hat? Das ist was für die großen Jungs. Für größere als uns.« »Und warum warten die dann drei Stunden?« »Wie ich schon sagte, Barnum. Die sind verrückt nach dem Wikinger.«
Sie saßen an einem Tisch in einer Nische hinter der Bar. Sie waren Anfang dreißig, trugen maßgeschneiderte Anzüge, hatten Sonnenbrillen in der Brusttasche, Pferdeschwänze, einen Ring im Ohr, dicke Bäuche und einen schmalen Blick. Sie waren die Männer unserer Zeit. Sie waren mir bereits jetzt unsympathisch. Peder holte tief Luft und schob den Krawattenknoten hoch. »Und du bist jetzt nett, höflich und nüchtern, ja, Barnum?« »Und genial.« Ich klopfte Peder auf den Rücken. Er war ganz nass. Dann gingen wir zu ihnen. Peder klatschte in die Hände. »Hier haben wir unseren sehnlichst erwarteten Freund! Er hat sich irgendwo im Tiergarten verirrt. Hat den Unterschied nicht bemerkt.« Sie standen auf. Die Lächeln wurden angeknipst. Peder hatte sich auf Plattitüden verlegt, und es war noch nicht mal drei. Der eine Däne, Torben, beugte sich über den Aschenbecher, in dem zwei Zigarren lagen und starben. »Ist Barnum ein Pseudonym oder dein richtiger Name?«, fragte er. »Das ist mein richtiger Name. Aber ich benutze ihn als Pseudonym.« Unsicheres Gelächter war die Folge, und Peder versuchte, die Gläser zu heben, aber so schnell gab sich der Däne nicht geschlagen. »Ist das dein Vorname oder dein Nachname?« »Beides. Kommt drauf an, mit wem ich rede.« Torben lächelte. »War Barnum nicht ein amerikanischer Schwindler? There’s a sucker born every minute.« »Stimmt nicht«, sagte ich. »Das hat ein Bankier gesagt. David Hannum. Barnum hat gesagt: Let’s get the show on the road.« Peder gelang es endlich, einen Toast einzuschieben. Wir stießen an, und dann war der andere Däne, Preben, an der Reihe, sich über den Tisch zu beugen. »Den Wikinger finden wir einfach toll! Ein wunderbares Manuskript.« »Vielen Dank«, sagte ich und kippte meinen Schnaps. »Nur schade, dass nie ein Film draus wurde.« Peder ergriff das Wort. »Jetzt wollen wir uns nicht an Details aufhängen.« »Doch, ich finde, gerade das sollten wir.« Peder trat mich unter dem Tisch. »Jetzt wollen wir in die Zukunft schauen«, sagte er. »Neue Projekte. Neue Ideen.« Ich war kurz davor aufzustehen, ich ertrug das nicht. »Aber wenn ihr meint, das Manuskript sei wunderbar, warum macht ihr dann nicht den Film?« Peder schaute zu Boden, und Torben wand sich einen Augenblick lang auf dem Stuhl, als säße er auf einer riesigen Reißzwecke. »Wenn wir Mel Gibson für die Hauptrolle gekriegt hätten, wäre es vielleicht gegangen.« Der andere Däne, Preben, beugte sich zu mir. »Außerdem ist action out«, sagte er. »Action ist old fashioned.« »But what about vikings in outer space?«, fragte ich. Eines der Telefone klingelte. Alle griffen nach ihrem, wie ein wenig müde Revolverhelden. Tim, der Engländer, siegte. Es war die Rede von einigen hohen Summen, und ein paar ebenso hohe Namen wurden beiläufig erwähnt, Harvey Keitel, Jessica Lange. In der Zwischenzeit konnte man einander nur zulächeln und austrinken. Es gelang mir, aufzustehen und aufs Klo zu gehen. Ich leerte einen Gin, lehnte die Stirn an die Wand und versuchte herauszufinden, was ich offenbaren sollte. Ich wollte ihnen nicht das geben, was ich hatte. Ich war der unbeschriebene Drehbuchautor, auf den sie drei Stunden lang gewartet hatten. Das Spiegelbild aus dem Fahrstuhl stand plötzlich deutlich vor mir. Es war kein schöner Anblick. Das kaputte Augenlid rutschte schwer nach unten. Ich versuchte einen Augenblick zu finden, in dem ich mich verstecken konnte. Ich fand ihn nicht. Als ich zurückkam, hatte Peder meinen Schnaps gegen Kaffee ausgetauscht. Ich bestellte einen doppelten Schnaps. Tim hatte seinen Terminkalender gezückt, der war dicker als die Bibel im Hotel Kempinski. »Wie du dir denken kannst, Barnum, stehst du ganz oben auf unserer Liste der Drehbuchautoren, mit denen wir gern zusammenarbeiten wollen.« Peder strahlte von einem Ohr zum anderen. »Habt ihr irgendwelche konkreten Projekte?«, fragte ich. »Wir würden gern hören, was du so auf Lager hast.« »Ihr zuerst«, sagte ich. »Dann weiß ich irgendwie besser, wie der Hase läuft.« Tim verschob seinen Blick langsam von mir zu den Dänen. Peder schwitzte wieder schrecklich. »Barnum wirft gern anderen den Ball zu«, sagte er schnell. Das klang so sinnlos, dass ich das Lachen nicht mehr zurückhalten konnte. Ich prustete laut los. Barnum wirft gern anderen den Ball zu. Peder trat mir wieder gegen das Schienbein. Wir waren wie ein altes Ehepaar. Plötzlich stand der Schnaps vor mir. Torben übernahm. »Okay, Barnum. Wir spielen gern Ball. Wir wollen Die Wildente machen. Action ist wie gesagt out. Das Publikum ist an den intimen Dingen interessiert, nicht wahr? An der Familie zum Beispiel. Deshalb Die Wildente.« Peder saß da und starrte mich unverwandt an. Das war reichlich nervig. »Das ist doch was für dich, Barnum«, sagte er schließlich. »Oder? Du machst das Stück in nur ein paar Monaten filmgerecht, nicht wahr, Barnum?« Aber niemand hörte jetzt auf Peder. »Soll es eine norwegische Produktion werden?«, fragte ich. »Oder eine skandinavische?« »Größer«, sagte Torben lächelnd. »Amerikanisch. Keitel. Lange. Robbins. Nichts spricht dagegen, Max oder Gitta dazuzuholen. Aber der Dialog läuft auf Englisch. Sonst gibt es kein Geld.« »Und dann müssen wir es ein bisschen modernisieren«, sagte Preben schnell. »Wir verlegen die Wildente in unsere Zeit. Die Wildente in den Neunzigern.« »Wozu soll das gut sein?«, fragte ich. »Natürlich verlegen wir die Handlung in die Jetztzeit«, sagte Peder. »Wir haben kein Interesse an Kostümfilmen, nicht wahr?« Eine Weile blieb es still. Ich fand noch einen Schnaps. Tim flüsterte Preben etwas zu, worauf dieser sich zu mir umdrehte. »Wir dachten an etwas in der Art Rainman meets Herbstsonate«, sagte er. Ich musste mich zu ihm vorbeugen. »Wie bitte? Wer trifft was?« »Wir wollen nur Ibsens Genialität zeigen«, sagte Torben. »Nämlich seine Zeitlosigkeit.« »Zeitlosigkeit? Miss Daisy meets Der Tod eines Handlungsreisenden, so in der Art?« Es zuckte ein wenig in Torbens Blick. Die anderen lachten kurz. Peder hielt es nicht länger aus. Er versuchte, den richtigen Ton zu treffen. »Möchte jemand etwas zu essen haben?«, fragte er. Niemand antwortete. Peder begann zu rauchen. Er hatte vor acht Jahren aufgehört. Torben faltete die Hände und sah mich über die Knöchel hinweg an. »Und welchen Ball hast du einzuwerfen, Barnum?« »Pornofilme«, sagte ich. »Pornofilme?« »Ich war heute Morgen in meinem Hotelzimmer und habe Pay-TV geschaut. Und da fiel mir auf, wie talentlos und unbeholfen diese Pornofilme sind. Keine Dramaturgie. Hoffnungslose Charaktere. Ein schreckliches Casting. Ungewöhnlich schlechte Dialoge. Abstoßendes Bühnenbild.« Torben wurde ungeduldig. »Du meinst erotische Filme, nicht wahr?« »Nein. Ich meine Porno. Hardcore. Mit guter Story, interessanten Charakteren und messerscharfer Dramaturgie. Aristotelischer Aufbau bis zum Orgasmus. Porno für ein modernes Publikum. Für Frauen wie für Männer und uns alle. Das ist Nora meets Deep Throat. Das ist zeitlos.«
Der Engländer stand als Erster auf. Die Dänen folgten ihm. Sie gaben Peder die Hand. Visitenkarten wurden ausgetauscht. »Wir bleiben in Kontakt«, sagte Peder. »Barnum kann einen Entwurf im Laufe von ein paar Monaten fertig haben.« »Erinnere ihn dran, dass es Ibsen ist«, sagte Torben, »und kein Pay-TV.« Peder lachte laut. »Kein Problem! Ich habe Barnum unter Kontrolle.«
Die großen Jungs gingen. Wir blieben sitzen. Peder war wortkarg. Peder ist der Einzige, den ich so bezeichne. Wenn Peder beschloss, zu schweigen, dann war er wortkarg. Und jetzt war er so wortkarg wie noch nie. Ich habe gelernt, damit zu leben. Wenn es etwas gibt, was ich kann, dann mit einem wortkargen Menschen zusammen zu sein. Man muss nur selbst die Schnauze halten und sehen, was kommt. Peder verlor. »Ist doch richtig prima gelaufen«, sagte er und sah mich dabei an. »Du kommst drei Stunden zu spät, und als du endlich auftauchst, bist du unverschämt, betrunken und hast nichts anzubieten. Absolut leere Hände. Es ist unglaublich. Prost, Barnum.« Wir tranken eine Weile, und dann war ich dran, etwas zu sagen. »Glaubst du, Meryl Streep will die Ente spielen?«, fragte ich. Peder wandte den Blick ab. »Jetzt bewegst du dich hart an der Grenze, Barnum. Mein Gott. Aristotelischer Porno!« »Was meinst du mit an der Grenze?« »Das weißt du nur zu gut.« »Nein, das weiß ich nicht.« Peder drehte sich schnell wieder zu mir um. »Ich habe es schon einmal mit ansehen müssen, Barnum. Ich habe dich schon einmal fallen sehen. Und jetzt schaffe ich es nicht mehr, jetzt kann ich dir nicht länger folgen.« Ich stand auf. Plötzlich wurde ich unruhig. Es war das Gesicht aus dem Fahrstuhl, das zurückgekommen war, ein ganzer Bienenstock von Gesichtern, die mir übergezogen wurden, eins nach dem anderen. »Ach Scheiße, Peder. Ich kann die Art, wie sie reden, nicht vertragen. Rainman meets Herbstsonate. All dieser Scheiß, den sie da von sich geben. Ich hasse es einfach.« »Ja, ja. Ich kann es auch nicht ab. Aber kriege ich davon ein gutes Gefühl? So reden sie nun einmal. Alle reden so. Reifeprüfung meets Kevin allein zu Haus und Waterfront meets Pretty Woman. Wir werden auch eines Tages so reden, wir auch.« Peder stellte den Schnaps ab, stützte den Kopf in die Hände und wurde wieder wortkarg. »Ich habe Lauren Bacall gesehen«, sagte ich. Peder schaute langsam hoch. »Was sagst du da?« Ich setzte mich wieder. Ich musste sitzen, wenn ich es ihm erzählen wollte. »Ich habe Lauren Bacall gesehen«, sagte ich. »Ich war dicht neben ihr.« Peder zog den Stuhl näher und lächelte unsicher. »Unsere Lauren Bacall?« »Ja, Peder. Gibt es noch eine andere?« »Natürlich nicht. Tut mir Leid. Ich bin irgendwie nicht ganz bei der Sache. Ich habe gerade drei dicke Brieftaschen den Raum verlassen sehen.« Ich nahm seine Hand, sie war warm und zitterte. »Wie sah sie aus?«, flüsterte er. Ich ließ mir viel Zeit. »Wie eine Sphinx«, sagte ich. »Wie eine blaue Sphinx, die sich
Die norwegische Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Halvbroren« bei Cappelen, Oslo.
Die vorliegende Übersetzung wurde von NORLA, Oslo, gefördert. Der Verlag bedankt sich dafür.
1. Auflage
Genehmigte Taschenbuchausgabe Septemper 2005 btb Verlag Copyright © der Originalausgabe 2001 J. W. Cappelens Forlag a.s. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: Design Team München unter Verwendung einer Vorlage von Stian Hole Umschlagillustration: Hole Design Satz: IBV Satz- und Datentechnik GmbH, Berlin
SR · Herstellung: Augustin Wiesbeck
eISBN 978-3-641-14118-9V002
www.btb-verlag.de
www.randomhouse.de